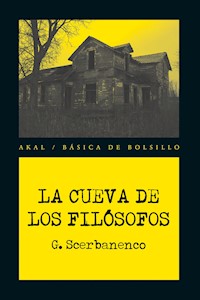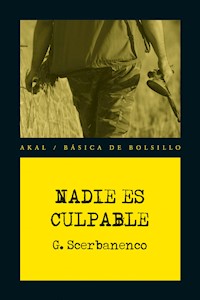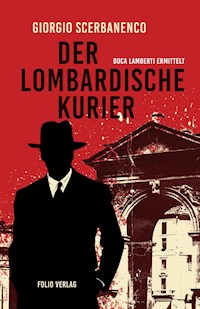
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Duca Lamberti ermittelt
- Sprache: Deutsch
Grausamer Mord an einer jungen Lehrerin. In seinem neuen Fall sieht sich Duca Lamberti mit einem besonders brutalen Überfall halbwüchsiger Schüler auf ihre Lehrerin konfrontiert. Die junge Frau stirbt an den Folgen ihrer Misshandlung. Als Lamberti der Verdacht kommt, dass hinter dem Mord das kaltblütige Kalkül eines Erwachsenen stecken könnte, greift er zu einem ungewöhnlichen Mittel - und bringt sich fast um Kopf und Kragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
GIORGIO SCERBANENCO
DERLOMBARDISCHEKURIER
DUCA LAMBERTI ERMITTELT
Aus dem Italienischen von Christiane Rhein
Mit einem Nachwort von Thomas Wörtche
Inhalt
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
ZWEITER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
DRITTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
VIERTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
FÜNFTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
ERSTER TEIL
Signorina Matilde Crescenzaghi, Tochter des verstorbenen Michele Crescenzaghi und seiner Frau Ada Pirelli, unterrichtete an der Abendschule Andrea e Maria Fustagni. Fast alle ihrer dreizehn-bis zwanzigjährigen Schüler hatten bereits einen Teil ihres kurzen Lebens in der Besserungsanstalt verbracht. Mal war der Vater Alkoholiker, mal die Mutter im horizontalen Gewerbe. Einige der Jungen litten an Tuberkulose, andere an vererbter Syphilis. Vermutlich wäre es besser gewesen, einen Exfeldwebel der Fremdenlegion ans Lehrerpult dieser Klasse zu stellen, als sie einer zarten jungen Dame aus dem norditalienischen Kleinbürgertum zuzumuten.
1
Sie ist vor fünf Minuten verstorben“, sagte die Krankenschwester.
Duca Lamberti schaute über ihre Schulter hinweg auf Mascarantis bulliges, leidenschaftliches Gesicht und antwortete nicht.
„Wollen Sie sie trotzdem sehen?“, fragte die Schwester. Sie wusste, dass die beiden Polizeibeamten eigentlich gekommen waren, um die Lehrerin zu verhören, aber eine Verstorbene zu verhören ist nicht einfach.
„Ja“, antwortete Duca.
Die Decke hatte man ihr bereits weggezogen, und so lag sie dort in einem rührend altmodischen, gelben Babydoll, das starre, schmerzverzerrte Gesicht von einem großen blauen Fleck unter dem rechten Auge entstellt. Auch die ebenmäßig gewölbte Stirn war hässlich verunstaltet: Mit bestialischer Grausamkeit war ihr ein großes Haarbüschel ausgerissen worden, sodass eine unnatürlich kahle Stelle zurückgeblieben war, die traurig und komisch zugleich wirkte. Ihr Leib war unförmig wie ein Fass durch das riesige Gipskorsett, das in aller Eile angefertigt worden war, um die Schmerzen im Brustkorb zu lindern. Wie viele Rippen gebrochen waren, stand nicht fest, vielleicht sogar alle, der Chirurg hatte jedenfalls keine Zeit gehabt, sie zu zählen.
In der Ecke wartete ein kleiner Mann mit dem sogenannten Sarg auf Rädern, eigentlich einem ganz normalen Krankenhausbett, das allerdings nicht mit Laken, sondern mit einer grauen Plastikplane bespannt war. Darauf würde sie nach unten gebracht werden, in die Kühlzelle, bis die Erlaubnis zur Autopsie vorlag.
Ein uniformierter Polizeibeamter erkannte Duca und hob schüchtern und respektvoll die Hand an die Mütze. Er war blutjung und sagte mit einer für Polizisten vielleicht ungewöhnlich bewegten Stimme: „Sie ist tot.“ Dann verknotete er seine schweißigen Hände auf dem Rücken und knetete sie nervös – vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, Polizeibeamter zu werden. „Sie hat noch ‚Herr Direktor!‘ gerufen, dann ist sie gestorben.“
Duca trat an das Bett, um den entsetzlich zugerichteten Körper dieser armen Kreatur von zweiundzwanzig Jahren genauer zu betrachten, den Körper von Matilde Crescenzaghi, Tochter des verstorbenen Michele Crescenzaghi und seiner Frau Ada Pirelli, wohnhaft in Mailand, Corso Italia 6, ledig, Lehrerin an der Abendschule Andrea e Maria Fustagni an der Porta Venezia, wo sie mehrere Fächer unterrichtet hatte, unter anderem gutes Benehmen. Ihr linker kleiner Finger war gebrochen und mit einem länglichen Plastikplättchen geschient. Überhaupt war der ganze Körper so zerschunden, dass die Ärzte ihr mehrere Notverbände angelegt hatten, zum Beispiel dort an der Leiste, wo sich eine dicke Schicht Mull unter dem Höschen des gelben Babydolls abzeichnete, das die Mutter ihr gleich ins Krankenhaus gebracht hatte, als sie von der Polizei angerufen worden war. Doch auch andere Körperteile wiesen dicke Verbände auf – man hätte meinen können, sie sei von einem Zug überrollt worden.
„Die Mutter steht unter Schock. Wir haben ihr deshalb noch nicht gesagt, dass ihre Tochter gestorben ist“, erklärte die Schwester, die ihnen gefolgt war. Verschieden vor wenigen Minuten, mit dem flehenden Ausruf „Herr Direktor!“ auf den Lippen. Vor dem Krieg soll es ja Leute gegeben haben, die im Sterben Worte wie „Mein Duce!“ ausgestoßen haben oder: „Zieht mir das Schwarzhemd an!“ Viele Menschen hauchten ihr Leben weniger dramatisch aus und seufzten einfach nur noch „Mama“. Diese Frau hingegen hatte sich mit den Worten „Herr Direktor!“ als Letztes flehend an ihren Schulleiter gewandt. Wie traurig.
„Wann kann ich ihre Mutter befragen?“, erkundigte sich Duca und löste seinen Blick – hoffentlich für immer – von diesem armen, misshandelten menschlichen Wesen.
„Ich frage mal den Oberarzt, aber ich denke, kaum vor morgen Abend“, antwortete die Schwester.
„Danke“, erwiderte Duca und ging mit Mascaranti hinaus. Sie verließen das Krankenhaus und blieben am Bordstein der Straße stehen, eingehüllt, ja fast geknebelt von einem eisigen Nebel. Außer einer Straßenlaterne und dem Blaulicht des Alfa Romeo der Polizei, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf sie wartete, war nichts zu sehen als ein eintöniges, dunkles Grau, das alle Geräusche verschluckte oder besser: erstickte.
„Warum hat dieser Idiot nur auf der anderen Straßenseite geparkt?“, brummte Mascaranti. „Jetzt müssen wir auch noch die Fahrbahn überqueren.“ Bei dem Nebel hätte er sich nicht einmal über ein Spitzentüchlein getraut.
„Zum Glück ist es eine Einbahnstraße“, beschwichtigte ihn Duca.
Mascaranti lachte bitter auf. „Nur dass wir von der Polizei die Einzigen sind, die sich an die Verkehrsregeln halten.“
Vorsichtig überquerten sie den breiten Fahrdamm. Aus dem undurchsichtigen Nichts tauchten hin und wieder die Scheinwerfer eines Autos auf, das mit zehn Stundenkilometern durch den Nebel kroch. Als sie bei dem blinkenden Blaulicht des Polizeiautos auf der anderen Straßenseite ankamen, stellte Mascaranti fest: „Entschuldigung, aber ich brauche jetzt einen Schnaps.“ Er war ein erfahrener Polizist und hatte schon einiges erlebt, aber nachdem er die Leiche dieser jungen Frau gesehen hatte, spürte er das dringende Bedürfnis, etwas Starkes zu trinken, um seine unbändige Wut hinunterzuspülen.
„Ich auch“, stimmte Duca zu.
Sie gingen den Gehsteig entlang bis zur Ecke, wo durch die schneidend kalten Nebelwolken die blaue Leuchtschrift Tavola calda zu sehen war.
„Ist Ihnen nicht kalt, Doktor Lamberti?“, fragte Mascaranti.
Doch. So ohne Mantel, ohne Hut, ohne Schal, die Haare mit dem Rasierapparat kurz geschoren und eingetaucht in den eisigen Nebel, war ihm schon kalt. Nur hätte er es wohl weniger gespürt, vielleicht auch gar nicht, wenn er diese junge Frau nicht gesehen hätte.
„Doch, mir ist ein wenig kalt“, antwortete er, während Mascaranti ihm die Tür zu dem Imbiss aufhielt. „Ich nehme einen Grappa, und du?“
„Ich zwei“, erwiderte Mascaranti.
„Zwei doppelte Grappa“, bestellte Duca. Er betrachtete den schmalen Hals des Mädchens hinter der Theke, das sich umgedreht hatte und nun müde und lustlos auf dem Wandbord nach der Grappaflasche suchte. Schließlich fand sie sie und goss den Schnaps in zwei große Gläser.
Langsam und ohne abzusetzen trank Duca seinen Schnaps und betrachtete den großen Mann mit dem imposanten Bauch, der vor der stummen Jukebox stand und schließlich zwei Knöpfe drückte. Fett, alt und glatzköpfig, wie er war, hatte er sich natürlich eine Platte von Caterina Caselli ausgesucht. Doch auf einmal nahm Duca seine Umgebung nicht mehr wahr, und auch Mascaranti, der vor ihm stand und sein Glas ebenfalls langsam in einem Zug leerte, sah die kleine, schäbige Bar nicht mehr, in der sie sich befanden. Deutlich, wie auf einer Leinwand, drängte sich ihnen das Bild der ermordeten Frau auf, dieser Körper in dem altmodischen gelben Babydoll und mit all den dicken, inzwischen vollkommen nutzlosen Verbänden.
Sie haben sie erbarmungslos abgeschlachtet, dachte Duca. Er konnte sich von dem Bild dieser elenden, auf dem Krankenhausbett ausgestreckten Gestalt einfach nicht lösen. Kopfschüttelnd nahm er seinen letzten Schluck Grappa. Wenn sie in einen Keller voller ausgehungerter Ratten gestürzt wäre, hätte sie nicht übler zugerichtet werden können. Bestien. Noch einmal schüttelte er den Kopf, und plötzlich nahm er Mascaranti und den fetten Mann an der Jukebox wieder wahr. „Gehen wir“, sagte er.
Draußen ruderten sie durch den dicken Nebel, von dem Blinken des Blaulichts geleitet.
„Wohin?“, erkundigte sich Mascaranti.
„In die Schule“, erwiderte Duca.
2
Die Abendschule Andrea e Maria Fustagni befand sich in einer dieser alten, zweistöckigen Villen im Stil eines mittelalterlichen Schlosses, wie sie einst in der äußersten Mailänder Peripherie gebaut wurden, damals, als hier noch offenes Land war, während sich nun überall riesige Mietshäuser mit zehn, fünfzehn oder zwanzig Stockwerken drängten. Die Villa lag etwas zurückgesetzt an einer Einbuchtung der Straße, die einen kleinen Vorplatz bildete. Dort stand, in den Nebel eingetaucht, ein kleiner Lkw, dessen Scheinwerfer das Messingschild der Abendschule anleuchteten. Neben dem Lastwagen vertraten sich vier uniformierte Polizeibeamte die Beine. Auf dem Bordstein des Gehsteigs saß ein Fotograf und döste vor sich hin, und auch drei oder vier Halbwüchsige lungerten dort herum. Ohne Publikum geht es wohl nicht, dachte Duca bitter, als er aus dem Alfa stieg, mag das Schauspiel auch noch so abstoßend sein.
Der Fotograf schreckte auf, erblickte das Polizeiauto und stürzte durch die Nebelschwaden auf Duca zu. „Herr Kommissar“, stieß er hervor, „gibt’s was Neues?“
Duca antwortete nicht. Mascaranti packte den Mann energisch am Arm: „Gehen Sie, hier gibt es nichts zu sehen.“
„Bitte, lassen Sie mich kurz hinein, nur für eine einzige Aufnahme“, bettelte der Fotograf. „Ich weiß, dass die Tafel beschmiert ist mit Schimpfwörtern und schmutzigen Zeichnungen, die ich natürlich nicht fotografieren kann. Außerdem veröffentlicht das sowieso niemand. Aber vielleicht kann ich ja das Lehrerpult aufnehmen, mit der Tafel im Hintergrund, sodass man nicht erkennt, was da steht. Nur ein einziges Bild, Brigadier, nur ein einziges Bild!“
Mascaranti zog ihn weg, und Duca betrat, von einem der Polizeibeamten geleitet, die Villa. Die Klasse A lag im Erdgeschoss. Links von der Treppe, die zu den Klassenräumen im ersten Stock führte, befanden sich die beiden Zimmerchen des alten Hausmeisters und seiner Frau, deren angespannte, bekümmerte Gesichter deutliche Spuren der Katastrophe trugen, die vor achtundvierzig Stunden über sie hereingebrochen war. Rechts von der Treppe lag der Raum der Klasse A – Allgemeinbildung –, vor dem ein weiterer Polizeibeamter Wache hielt.
„Gehen Sie ruhig in Ihre Zimmer zurück, im Moment brauche ich Sie nicht“, sagte Duca zu dem Hausmeisterehepaar, während der wachhabende Beamte die Tür öffnete. Dann traten Duca und Mascaranti in das Klassenzimmer, das von zwei langen Neonröhren erleuchtet war.
Der Raum sah genau so aus, wie der alte Hausmeister und seine Frau ihn vor zwei Tagen vorgefunden hatten. Nur ein paar Einzelheiten deuteten auf die Arbeit der Spurensicherung hin. Die drei hohen Fenster waren mit einem schwarzen Tuch verhängt, das man mit zwei schmalen, über Kreuz angebrachten Holzleisten fixiert hatte – eine Maßnahme gegen allzu neugierige Fotografen und Journalisten, denn das Klassenzimmer lag im Erdgeschoss und ging direkt auf die paar Quadratmeter vereisten Bodens hinaus, die allgemein als „Garten“ bezeichnet wurden, und man musste nicht besonders groß sein, um von draußen in den Raum sehen zu können. Die Fenster waren zwar vergittert, die Scheiben geschlossen und die Rollläden herabgelassen, aber ein besonders dreister Fotograf hatte eine Scheibe eingeschlagen und versucht, den Rollladen von außen hochzuschieben, um ein paar Bilder zu schießen. Der Mann war bemerkt und fortgeschickt worden, doch um ähnliche Vorfälle zu verhindern, hatte man die Fenster zusätzlich verhängt.
„Die Karte“, sagte Duca Lamberti, der direkt neben der Klassentür stehen geblieben war und unbeweglich auf die Tafel starrte. Mascaranti kramte in seiner Tasche, fand das einfache, weiße Blatt, das Duca „Karte“ genannt hatte, und reichte es ihm.
Duca löste seinen Blick von der Tafel und musterte die Kreise aus weißer Farbe, die auf die Arbeit der Spurensicherung hinwiesen und dem Raum ein ungewöhnliches Aussehen verliehen. Einige waren nicht größer als der Abdruck eines nassen Glases auf einem Tisch, andere hatten den Durchmesser einer großen Korbflasche. In jedem Kreis stand eine weiße Zahl. Es waren etwa zwanzig, um genau zu sein, zweiundzwanzig, wie aus dem getippten Blatt in Ducas Hand hervorging: Unter einer Zeichnung, aus der man die Position im Klassenzimmer ersehen konnte, waren die einzelnen Gegenstände aufgelistet, die man nach dem Gemetzel in der Klasse sichergestellt hatte, jeweils mit Hinweis auf den mit einer Nummer versehenen Fundort.
Die weißen Kreise befanden sich überall: auf dem Pult der Lehrerin, auf dem Boden, auf den vier langen Tischen der Schüler und sogar an der Wand. Dort waren sie allerdings schwarz.
„Eine Zigarette, bitte“, sagte Duca und streckte seine Hand aus, während er die Kreise weiter betrachtete. Gerade jetzt fixierte er den mit der Zahl 19 in der Mitte.
„Hier.“ Mascaranti reichte ihm eine Zigarette und gab ihm Feuer.
Duca Lamberti sah auf seinem Blatt unter der Nummer 19 nach. Dort stand: Schnapsflasche. Dann blickte er auf einen Kreis auf dem Fußboden, den mit der Nummer 4, und las: Nr. 4 – Kleines Goldkreuz. Das musste einer der Schüler verloren haben. Der Kreis Nummer 4 befand sich unmittelbar neben einer größeren Zeichnung, die ebenfalls mit weißer Farbe auf den Fußboden gemalt war, aber keinen Kreis darstellte, sondern den Umriss einer Person: die Silhouette von Matilde Crescenzaghi, der jungen Lehrerin.
Duca rauchte, ohne die Zigarette auch nur einen Moment aus dem Mund zu nehmen. Erst als die Glut fast seine Lippen berührte, warf er die Kippe auf die Erde. Nach und nach kontrollierte er alle Einzelheiten auf seiner Karte: Nr. 1 – Silhouette von Matilde Crescenzaghi; Nr. 19 – Schnapsflasche.
„Eine Zigarette“, bat er noch einmal.
Er setzte sich auf den harten, unbequemen Stuhl hinter dem Lehrerpult, rauchte und musterte die vier einfachen Tische mit jeweils vier Stühlen, an denen die Schüler dieser unglückseligen Klasse gelernt hatten. Wieder blickte er auf die Karte: Nr. 8 – Urin. Nicht nur einer, sondern gleich mehrere der elf Jungen hatten in eine Ecke gepinkelt und diesen bescheidenen, aber doch einem hehren pädagogischen Ziel gewidmeten Raum zu einem stinkenden Stall gemacht. Zweimal, dreimal hintereinander zog Duca an seiner Zigarette, ohne Mascaranti oder den uniformierten Polizeibeamten zu beachten, der an der Tür des Klassenzimmers stand. Dann blickte er wieder auf die Karte: Nr. 2 – Slip. Der Slip der Lehrerin Matilde Crescenzaghi hatte an einem der beiden Haken gehangen, an denen die große Europakarte befestigt war.
„Eine Zigarette.“ Dass die Zeit verging, merkte er nur an der Anzahl der Zigaretten, die er sich von Mascaranti geben ließ. Jetzt musste er die Tafel begutachten, die den Fotografen und Journalisten Anlass zu ihrer unverfrorenen Offensive gegeben hatte. Es war Pornografie auf niedrigstem Niveau. Duca erhob sich und ging nach vorn, die Zigarette zwischen den Lippen. Noch nie hatte er auf diese fast zwanghafte Art geraucht – normalerweise hielt er die Zigarette ganz gewöhnlich in der Hand. Doch das hier überstieg alles, was er bisher erlebt hatte, und um den Vulkan von Wut und Verzweiflung niederzuhalten, der in ihm auszubrechen drohte, rauchte er wie besinnungslos, auch wenn das überhaupt nichts nützte.
Er studierte die Tafel. Unten links in der Ecke stand etwas verwischt, aber doch noch gut lesbar, das Wort IRLAND. Vermutlich hatte die Lehrerin Matilde Crescenzaghi es da hingeschrieben, ein Überbleibsel des Geografieunterrichts. Offenbar hatten die Schüler an jenem Abend etwas über Irland gelernt. Die Lehrerin hatte ihnen wahrscheinlich erklärt, dass es ein unabhängiges Irland gibt, eben IRLAND, aber auch einen anderen Teil, nämlich Nordirland, der zu Großbritannien gehört.
Wie viel die Schüler an jenem Abend wohl wirklich von dem Geografieunterricht begriffen hatten? Am Abend darauf jedenfalls hatte jemand neben das Wort IRLAND einen großen Phallus gezeichnet, der umgeben war von allen nur denkbaren Bezeichnungen für das männliche Geschlecht, ein paar oder vielleicht sogar die Mehrheit im Mailänder Dialekt. Ein Schüler musste allerdings aus Rom stammen, denn die Namen des weiblichen Geschlechts standen in römischem Dialekt an der Tafel. Auch alle anderen erogenen Zonen waren aufgeführt, manche mit etwas unbeholfenen Zeichnungen versehen.
Schließlich gab es noch ein paar vollständige Sätze – keinen einzigen ohne Rechtschreibfehler –, die zu den verschiedensten, meist nicht gerade konventionellen sexuellen Praktiken aufforderten. Und zwischen all diesen in manisch brutaler Handschrift an die Tafel geschmierten Schweinereien stand naiv und freundlich das Wort IRLAND.
Nummer 11 – Büstenhalter der Lehrerin. Der hatte am Fensterknauf links von der Tafel gebaumelt. Ihr Rock, Nummer 6, hatte fast ordentlich an einem Garderobenhaken in der Klasse gehangen, zusammen mit dem Pullover und dem Mantel. Einer ihrer Nylonstrümpfe – Nummer 21 – war mit Reißzwecken zwischen zwei Tische gespannt gewesen, sodass es aussah, als habe dort jemand Schnurspringen gespielt. Der andere Strumpf fehlte auf der Liste, da er im Klassenzimmer A nicht gefunden worden war. Aus einer Fußnote mit Sternchen ging jedoch hervor, dass man ihn in der Hosentasche eines der elf Schüler entdeckt hatte, und zwar bei Carolino Marassi, vierzehn Jahre, Vollwaise. Obwohl Duca bei der Inspektion dieses abstoßenden Schlachtfeldes speiübel geworden war, musste er bei dem merkwürdigen Namen Carolino unwillkürlich lächeln. Dieser Carolino hatte sich den Strumpf seiner jungen Lehrerin also in die Tasche gesteckt. Ob es wohl der rechte gewesen war oder der linke? Nach Bertrand Russell ist bei einem Strumpf, im Gegensatz zu einem Schuh, nicht eindeutig festzustellen, ob es sich um den linken oder den rechten handelt, nur der Schwerpunkt kann ausgemacht werden … Vermutlich hatte der Junge den Strumpf selbst vom Bein seiner unglückseligen, geschändeten Lehrerin gestreift, nachdem er ihn vom Strumpfhalter – auf der Karte die Nummer 7, aufgefunden in der Schublade eines der vier Tische – abgerissen hatte. Dann hatte er sich den Strumpf in die Tasche gesteckt, vielleicht um sich später noch einmal daran aufzugeilen. Und dieser Junge trug den merkwürdigen Namen Carolino.
Sorgfältig, Quadratmillimeter um Quadratmillimeter, untersuchte Duca Lamberti das Klassenzimmer. Fast auf Zehenspitzen balancierte er zwischen den weißen Kreisen auf dem Fußboden umher und blieb schließlich an der Rückseite der Tafel stehen, die auch mit Schweinereien beschmiert war. Dort rauchte er seine Zigarette zu Ende.
„Doktor Lamberti?“, fragte Mascaranti.
In dem überhitzten Klassenraum klang seine Stimme spitz.
„Ja?“, antwortete Duca hinter der Tafel und warf den Zigarettenstummel auf die Erde.
„Ach, nichts“, bemerkte Mascaranti. Nummer 3 – linker Schuh der Lehrerin Matilde Crescenzaghi, an die Rückseite der Tafel geklebt. Womit? Die Karte verriet auch dies: mit einem Kaugummi. Einer der Schüler hatte seiner Lehrerin offenbar den Schuh ausgezogen und mit dem Kaugummi, den er gerade im Mund gehabt hatte, an die Tafel geklebt.
Gefolgt von den Blicken Mascarantis und des uniformierten Beamten, ging Duca Lamberti noch einmal durch die ganze Klasse A und öffnete nacheinander alle Schubladen der vier Tische. Sie waren leer. Die Männer von der Spurensicherung hatten alles mitgenommen. Dann hockte er sich vor einen kleinen weißen Kreis, den kleinsten von allen, und sah auf seine Karte. Nummer 18 – 50 Rappen. Dort, an dieser Stelle, hatte man eine Schweizer Münze gefunden, einen halben Franken. Fassungslos schüttelte Duca den Kopf und sagte schließlich zu Mascaranti: „Die Hausmeisterin.“ Noch einmal schüttelte er den Kopf. „Sie, nicht ihren Mann.“ Dann richtete er sich wieder auf, ging zum Lehrerpult und setzte sich auf den Stuhl, auf dem Abend für Abend, außer an Sonn- und Feiertagen, die junge Lehrerin gesessen hatte, die nun mausetot war. Kurz darauf kam Mascaranti mit der Alten zurück und führte sie zum Pult. Ihr kurzer, männlicher Pagenschnitt wirkte ein wenig befremdlich bei so einer alten, grauhaarigen Frau.
„Gib ihr einen Stuhl“, wies Duca Mascaranti an.
Sie setzte sich – klein, müde und verängstigt.
„Um welche Uhrzeit beginnt der Unterricht?“, begann Duca das Verhör.
„Morgens um halb sieben.“
„Wieso? Ist dies nicht eine Abendschule?“
„Doch“, erklärte die Hausmeisterin, „aber es gibt auch Schüler, die abends nicht kommen können, und die haben morgens eine Stunde Unterricht, von halb sieben bis halb acht. Um acht kommen dann die Jugendlichen aus der Handelsschule und lernen Stenografie und Buchhaltung. Nachmittags ist Sprachunterricht.“
„Ich dachte, dies sei eine Abendschule!“ Duca streckte Mascaranti seine Hand hin, um die nächste Zigarette in Empfang zu nehmen.
„Ja, schon, vom Namen her schon, aber der Unterricht ist über den ganzen Tag verteilt.“ Die Alte antwortete angespannt, aber präzise.
„Und abends?“, fragte Duca.
„Abends wird nur hier unterrichtet, in der Klasse A.“ Die Alte bemühte sich krampfhaft, nicht an die Tafel mit all den obszönen Zeichnungen zu blicken. Das war jedoch gar nicht so einfach, denn unglücklicherweise saß sie genau davor.
„Und was lernen die Schüler der Klasse A?“
„Na ja“, antwortete die Alte bitter und verächtlich, „was sollen die schon groß lernen? Das ist doch das übelste Gesindel der ganzen Gegend. Diese Sozialarbeiterinnen, diese freundlichen Damen mit ihren schwarzen Ledertaschen, wissen Sie, die haben nichts Besseres zu tun, als zu all den armen Familien zu gehen, die zwischen Piazzale Loreto und Lambrate wohnen, und ihnen zu erzählen, ihre Kinder müssten die Abendschule besuchen, statt in den Kneipen herumzuhängen und Tischfußball zu spielen. Und dann schicken sie sie her. Bloß, dass sie leider nichts lernen, sondern nur ihre Lehrerinnen zur Verzweiflung bringen.“ Sie biss die Zähne zusammen, holte tief Luft und stieß dann hervor: „Oder sie bringen sie um und spielen dann wieder Tischfußball in ihren Stammkneipen, wo es vor alten Lüstlingen nur so wimmelt. Deshalb gehen die Jungen da ja überhaupt hin.“
Sie nahm wirklich kein Blatt vor den Mund, die Alte mit dem Pagenschnitt.
„Um wie viel Uhr kommen die Schüler in die Klasse A?“, fragte Duca freundlich.
„Der Unterricht beginnt um halb acht.“ Sie holte noch einmal tief Luft. Immer wieder musste sie daran denken, wie sie die Lehrerin Matilde Crescenzaghi nach der schrecklichen Schandtat gefunden hatte. Vollkommen nackt hatte sie auf dem Fußboden gelegen, fast unter der Tafel, mit einem dünnen Blutrinnsal zwischen den weißen Schenkeln, von dem kalten Licht der Neonröhren unbarmherzig angestrahlt. Nie würde sie ihr Schluchzen vergessen, nie die bestialischen Wunden am ganzen Körper. „Aber eigentlich kommen sie immer eher“, fuhr die Alte gewissenhaft fort. „Allerdings nicht, um etwas zu wiederholen oder so, denn nicht einer von denen hat Interesse am Unterricht. Im Grunde warten sie nur darauf, dass es halb elf ist und sie wieder gehen können, um irgendwo Unheil anzurichten. Ja, genau, deshalb kommen sie früher: um gemeinsam ihre nächste Schandtat auszuhecken. Zweimal bin ich im Kommissariat gewesen und hab denen erklärt, dieses Gesindel gefiele mir nicht. Wissen Sie, was mir der zuständige Beamte gesagt hat? ‚Wenn es nach mir ginge, würde ich die Kerle einen nach dem anderen ins Klosett werfen und abziehen. Aber laut Gesetz haben sie nun einmal ein Recht auf Bildung, und deshalb müssen sie in die Schule gehen.‘ ‚Aber das hier sind Kriminelle‘, hielt ich dagegen. ‚Schauen Sie sich sie doch nur einmal an: Jemanden umzubringen ist für die genauso normal wie einen Witz zu reißen.‘ Darauf der Beamte: ‚Wenn sie wirklich jemanden umbringen, lochen wir sie ein. Aber solange das nicht passiert, gehen sie in die Schule und lernen. Das ist Gesetz.‘ Und was ist geschehen? Genau das: Sie haben jemanden umgebracht, und die Polizei hat sie eingelocht. Ihre Lehrerin aber, die Ärmste, ist jetzt mausetot, und warum? Weil diese elenden Kerle ein Recht auf Bildung haben!“
Bitter, aber wahr. In schlichten Worten, aber mit klarem Blick hatte die Alte mit dem Pagenschnitt einen der großen sozialen Missstände auf den Punkt gebracht.
„Aber wie ist es möglich, dass Sie von all dem nichts bemerkt haben?“, fragte Duca, ohne der sozialen Frage weiter nachzugehen. „Die Jungen waren doch stockbesoffen und müssen einen Heidenlärm veranstaltet haben.“
„Wissen Sie, abends, bevor das Fräulein Lehrerin kam, warfen ich oder mein Mann immer mal einen Blick in die Klasse, um zu sehen, was die Jungen so trieben. Stellen Sie sich vor, eines Abends waren sie viel früher als sonst gekommen und hatten ein Mädchen mit ins Klassenzimmer geschmuggelt! Erst als mein Mann die Polizei anrief, haben sie sie wieder laufen lassen. Das war auch der Grund, warum der Herr Direktor die Klasse A eigentlich auflösen wollte. Aber unsere übereifrigen Sozialarbeiterinnen haben mal wieder lauthals protestiert. Wenn diese Jugendlichen nicht in die Schule gehen, haben sie gesagt, dann stellen sie nur noch mehr Blödsinn an, und es sei sehr wichtig, Geduld mit ihnen zu haben. Und der Direktor, der nicht gerade ein Muster an Standhaftigkeit ist, hat mal wieder nachgegeben.“ In der Stimme der Alten lagen Wut und Trauer. „Oder vor zwei Jahren – da ist eine Lehrerin aus Bergamo gekommen, die war ganz klein und schmal und sah aus wie eine Nonne. Sie war auch ein bisschen so gekleidet, ganz in Dunkelblau und mit einem weißen Kragen. Nicht mal drei Tage hat sie es ausgehalten. Am dritten Abend kam sie weinend bei mir an und meinte: ‚Bestellen Sie dem Herrn Direktor, dass es nicht geht, dass ich es einfach nicht schaffe.‘ Es ist uns nicht gelungen – weder mir noch dem Herrn Direktor –, herauszubekommen, was sie mit ihr angestellt hatten, diese Wüstlinge, auch wenn man es sich vorstellen kann.“
„Sehr interessant“, warf Duca geduldig ein. Offenbar war kein Mensch auf die Idee gekommen, einer solchen Klasse einen männlichen Lehrer zu geben, womöglich einen Exfeldwebel der Fremdenlegion, der wusste, wie man mit Schülern dieses Kalibers umgehen musste. Den Verantwortlichen hatte es anscheinend komplett an Vorstellungsvermögen gemangelt, oder es fehlten einfach männliche Lehrer – Männer, die sich dieser schwierigen, undankbaren und schlecht bezahlten Arbeit widmeten, zu der sich so viele Frauen bereitfanden, und zwar nicht nur aus materiellen Gründen, sondern oft – wie etwa im Fall der Verstorbenen – aus ehrlicher Überzeugung. „Wirklich sehr interessant. Aber ich würde gerne wissen, wie es möglich ist, dass Sie überhaupt keine verdächtigen Geräusche gehört haben. Die Jungen waren doch völlig außer Rand und Band, haben Tische und Stühle umgeworfen und so weiter. Und Sie haben Ihre Wohnung gleich nebenan …“
„Nein, da hört man überhaupt nichts. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für einen Lärm all die Autos, Straßenbahnen und Lastwagen verursachen, die den ganzen Tag über die Straße dröhnen. Vor neun Uhr abends wird es hier nicht still“, unterbrach ihn die Alte entschieden. „Manchmal müssen mein Mann und ich in der Küche regelrecht schreien, damit wir uns überhaupt verstehen.“
Duca nickte. Es stimmte: Mit der Straßenbahn und all den Lastwagen, die knapp drei Meter vor dem Gebäude vorbeidonnerten, war es wohl unmöglich gewesen, etwas zu hören. „Und wie haben Sie die Sache dann entdeckt?“, fragte er die Hausmeisterin.
Auch diesmal antwortete sie, ohne zu zögern: „Kurz nach neun bin ich in den Garten gegangen, um den großen Topf mit der Grünpflanze hereinzuholen. Tagsüber steht er immer draußen an der frischen Luft, aber bei dieser Kälte holen wir ihn nachts ins Haus. Mein Mann und ich sind also rausgegangen, denn der Topf ist schwer, und haben ihn zusammen reingetragen und neben die Treppe gestellt. Und da haben wir plötzlich gemerkt, dass das Licht in der Klasse ausgeschaltet war: Das Fensterchen über der Tür war dunkel.“
„Das Licht war aus?“, fragte Duca. Merkwürdigerweise musste er plötzlich an das Gesicht seiner Nichte Sara denken, der kleinen Tochter seiner Schwester Lorenza, die allmählich größer wurde und, wenn sie ihn begrüßte, immer ein Liedchen sang: „Onkelchen, mein Onkelchen, was hast du mir wohl mitgebracht?“ Er musste ihr wirklich mal wieder was mitbringen.
„Ja, es war aus. Mein Mann meinte: ‚Lernen die, oder schnarchen die?‘, und ich darauf: ‚Das gefällt mir ganz und gar nicht, schauen wir doch mal nach.‘ Und so haben wir gesehen, was passiert war.“ Die Alte schluckte und starrte auf den Boden, um nicht an die Tafel blicken zu müssen.
„Vielen Dank.“ Duca entließ sie und sah Mascaranti an, der kramphaft versuchte, die Tafel und all die großen und kleinen weißen Kreise zu ignorieren. „Und jetzt gehen wir wieder nach Hause.“ Er meinte, ins Kommissariat.
3
Als sie im Kommissariat ankamen, schickte er Mascaranti erst mal etwas essen. Er selbst ging direkt in sein Büro – falls der einfache Raum diese Bezeichnung verdiente – und fand dort einen Zettel auf dem Schreibtisch – falls man seinen grob gehobelten Tisch denn so nennen wollte. Deine Schwester hat zweimal angerufen, ruf sofort zurück! Carrua.
Er wählte die Nummer. „Na, was ist?“, fragte er, als er Lorenzas Stimme vernahm.
„Sara hat fast vierzig Fieber. Sie ist heiß wie ein Bügeleisen“, antwortete seine Schwester atemlos.
„Versuch mal, ihr in den Hals zu schauen, ob du einen weißen Belag oder kleine Pünktchen erkennen kannst“, schlug Duca vor.
„Das habe ich schon, aber es ist nichts zu sehen. Bitte, komm sofort nach Hause, Duca. Das Fieber ist einfach zu hoch, ich habe schreckliche Angst!“
Er starrte auf den großen grauen Ordner vor ihm: die Kopien von den Verhören der elf Jungen aus der Abendschule Andrea e Maria Fustagni, Klasse A, die er jetzt durcharbeiten musste. „Lorenza, jetzt beruhige dich doch erst mal! Ich rufe Livia an und sage ihr, sie soll dir Fieberzäpfchen bringen. Ich komme, sobald ich hier fertig bin. Als Erstes solltest du Sara mal einen kalten Waschlappen auf die Stirn legen.“
„Ach, Duca, komm doch bitte!“ Sie weinte fast.
„Ich komme, sobald ich kann. Mach dir keine Sorgen – es ist bestimmt nur eine Grippe.“
Er legte auf und rief Livia an. Durch den Hörer vernahm er ihre klare, aufgeweckte Stimme. „Oh, ciao, Duca.“
„Hör mal, Sara hat hohes Fieber, aber ich kann hier absolut nicht weg.“
„Bist du im Kommissariat?“
„Ja. Könntest du vielleicht bei Lorenza vorbeischauen? Und auf dem Weg eine Packung Uniplus-Zäpfchen besorgen? Eins gibst du ihr sofort, und wenn das Fieber nach einer Stunde nicht gesunken ist, noch ein zweites. Ach ja, und nimm bitte noch eine Packung Luminaletten mit, und gib ihr eine, damit sie keinen Fieberkrampf kriegt. Und mach ihr den Nuckel immer mal wieder nass, damit sie etwas Flüssigkeit zu sich nimmt. Sobald ich hier fertig bin, komme ich nach Hause. Aber wenn irgendetwas ist, rufst du mich sofort an, ja?“
Noch einmal drang ihre klare, jetzt jedoch leicht beunruhigte Stimme an sein Ohr: „Gut, ich gehe sofort los.“
„Vielen Dank, du Liebe.“
„Es wird doch nichts Schlimmes sein, oder?“, fragte sie.
„Ich weiß nicht. Ich glaube, eigentlich nicht. Beeil dich jetzt, ja?“
„Ja, Lieber.“
Duca legte den Hörer auf die Gabel, erhob sich und ging zum Fenster, um es zu öffnen. Der Raum war so klein, dass das Fenster fast die Hälfte der Wand einnahm. Eisige Luft, drei Grad unter null, strömte herein. Draußen war außer Nebel nichts zu erkennen. Der kalte Luftstrom vertrieb den unangenehmen Geruch von altem Holz, staubigen Akten und abgestandenem Rauch, der in dem winzigen Zimmer hing. Er ließ das Fenster offen und setzte sich wieder an seinen Tisch, klappte den Aufschlag seines Jacketts hoch und öffnete den dicken Ordner vor sich.
Er begann zu lesen, ganz ordentlich, ein Blatt nach dem anderen. Der Ordner enthielt elf Akten, eine für jeden der Jungen, die an dem schrecklichen Verbrechen in der Abendschule beteiligt gewesen waren. Zuerst waren immer die Personalien aufgeführt, dann kamen drei oder vier Zeilen Stichworte über ihr Leben. Beigelegt waren ein ärztliches und ein psychiatrisches Gutachten und schließlich die Abschrift des auf Tonband aufgezeichneten Verhörs. Duca stellte fest, dass er pro Akte etwa zwanzig Minuten brauchte, um sie zu lesen und sich ein paar Stichpunkte zu notieren.
Nach dem dritten Hefter hörte Duca, wie die Tür aufging. Es war Mascaranti.
„Doktor Lamberti, es ist ja so kalt hier, dass einem die Zähne klappern. Merken Sie das nicht?“
„Doch, doch.“ Er klapperte tatsächlich mit den Zähnen. „Sie können gern zumachen.“
Mascaranti schloss das Fenster. „Kann ich Ihnen behilflich sein?“
„Ja. Geh in Carruas Büro – er ist heute zu Hause –, setz dich in einen Sessel und versuch, ein wenig zu schlafen. Ich hole dich, wenn ich dich brauche. Wir haben heute Nacht noch einiges vor.“
„Gut, Doktor Lamberti.“ Dann, als er bereits in der Tür stand, fragte er noch: „Soll ich Ihnen eine Zigarette dalassen?“
„Nein“, antwortete Duca. „Ich brauche drei Päckchen Nazionali, die einfachen, nicht Esportazione. Und zwei Schachteln Streichhölzer.“
„Drei Päckchen!“, staunte Mascaranti. Normalerweise rauchte Duca nicht besonders viel.
„Jaja, du hast ganz richtig verstanden.“ Trotz ihres kurzen Gesprächs ließ Duca sich nicht einen Augenblick vom Lesen abbringen. Sein Gesicht und seine Hände waren ganz blau vor Kälte, da er eine volle Stunde bei offenem Fenster still dagesessen hatte. Ganz bewusst hatte er das getan, schließlich wollte er objektiv sein – kühl und objektiv! „Außerdem wollte ich dich bitten, mir vor dem Schlafengehen noch zwei Flaschen milchweißen Anis zu besorgen.“
„Doktor Lamberti, wo soll ich denn um diese Zeit milchweißen Anis auftreiben?“ Dieser Schnaps war eine sizilianische Spezialität, die es nur in wenigen sehr gut sortierten Geschäften gab.
„Ach, das ist ganz einfach“, murmelte Duca seelenruhig, während er in dem grellen Licht der Schreibtischlampe weiterlas. „Den gibt es bei ‚Angelina‘, dem besten sizilianischen Restaurant in dieser nordischen Stadt. Zwei Flaschen.“
„In Ordnung“, erwiderte Mascaranti skeptisch, aber gehorsam.
Als Duca bei der fünften Akte war, klingelte das Telefon. „Für Sie“, schnarrte die Vermittlerin.
„Danke“, entgegnete Duca. Als er die Stimme seiner Schwester Lorenza vernahm, wollte er sofort wissen: „Na, wie sieht’s bei euch aus?“
„Schlecht. Das Fieber geht einfach nicht runter, obwohl wir Sara schon zwei Zäpfchen gegeben haben. Sie hat die ganze Zeit fast vierzig, nur mit einem kalten Waschlappen auf der Stirn sinkt es um ein halbes Grad. Ich habe furchtbare Angst, Duca! Bitte, komm sofort!“
Lorenza war offensichtlich einer Panik nahe. „Moment“, warf er ein. „Hat sie Krämpfe?“
„Nein.“
Duca biss sich auf die Lippen. Er war kein Kinderarzt, und außerdem übte er seinen Beruf nun schon seit fünf Jahren, die drei im Gefängnis mitgerechnet, nicht mehr aus. Aber er konnte der Kleinen ja zur Sicherheit ein Breitbandantibiotikum verschreiben. „Ich kann jetzt wirklich nicht kommen, Lorenza.“ Er musste husten vor Anspannung. Noch einmal sah er sich das große Foto an, das ganz hinten in seinem Ordner lag. Es zeigte die Lehrerin Matilde Crescenzaghi, wie man sie nach der grausamen Tat gefunden hatte. Fotos besitzen eine Klarheit, die der Wirklichkeit fehlt: Diese hat immer etwas Fliehendes, Vergängliches, Fotos hingegen sind erschreckend statisch und konkret. Und obwohl er ja Medizin studiert und in den Anatomiesälen so einiges gesehen hatte, hätte er dieses Bild am liebsten aus seinem Gedächtnis gelöscht. „Ich kann jetzt wirklich nicht. Bitte verzeih mir!“ Seine Stimme klang heiser. „Schick Livia in die Apotheke, ein Antibiotikum kaufen, am besten Ledermicina, und gib der Kleinen zwanzig Tropfen davon. Ich kümmere mich inzwischen um einen Arzt.“
„Wie heißt das Mittel?“
„Le-der-mi-ci-na“, buchstabierte Duca langsam.
„Ledermicina“, wiederholte Lorenza.
„Ich versuche, einen Kinderarzt aufzutreiben, denn von Kinderkrankheiten verstehe ich nichts. Aber mach dir keine Sorgen, es wird schon nichts Ernstes sein.“
„Duca“, unterbrach ihn seine Schwester, „Livia möchte dich noch kurz sprechen.“
„Duca!“ Jetzt hörte er Livias Stimme. „Du musst kommen, das Kind ist schwer krank!“ Ihre Stimme war nicht nur ängstlich, sondern auch schroff und befehlend. Bei Livia Ussaro gab es keine Zwischenstufen: Entweder sie gehorchte oder sie befahl.
„Livia, ich kann jetzt nicht“, entgegnete er trocken und distanziert, denn ihr befehlender Ton machte ihn immer schwach. Er musste mit seiner Arbeit vor morgen früh um zehn fertig sein, denn dann kam der Untersuchungsrichter, und alles wäre vorbei. „Ich verspreche dir, dass binnen einer Stunde ein Kollege kommt, der viel mehr Erfahrung hat als ich.“
„Nein, Duca“, widersprach sie unerbittlich. „Du weißt genau, dass es hier nicht nur darum geht, einen guten Arzt zu finden. Der Punkt ist: Deine Nichte hat vierzig Fieber, deine Schwester ist einem Nervenzusammenbruch nahe, und du bleibst im Büro wegen irgendeiner widerlichen Akte, statt herzukommen und uns wenigstens moralisch zu unterstützen.“ Sie klang, wie so häufig, ein wenig spitzfindig.
Doch natürlich hatte Livia recht. Es war wirklich eine widerliche Akte. Und es stimmte auch, dass er ihnen seine moralische Unterstützung verweigerte. Wer so viel von Kant hielt wie sie, musste das natürlich sofort merken. Trotzdem sagte er hart: „Livia, jetzt reicht’s! Spätestens in einer Stunde ist der Kinderarzt da.“ Dann legte er auf. Einen Moment lang versuchte er, sich zu entspannen, dann wählte er eine Nummer. Niemand ging ans Telefon, doch Duca ließ nicht locker, und nach mehreren Anläufen meldete sich eine ärgerliche Frauenstimme. „Entschuldigen Sie, dass ich Sie um diese Zeit störe, Signora. Hier ist Duca Lamberti. Ich hätte gern mit Ihrem Mann gesprochen.“
„Mein Mann schläft“, entgegnete die Stimme kurz angebunden. Es war die Frau des berühmten Kinderarztes.
„Tut mir leid, aber es ist wirklich sehr dringend.“
„Na gut, ich schau mal“, sagte sie unfreundlich.
Er musste lange warten, doch endlich vernahm er die gähnende Stimme seines Freundes Gian Luigi. „Ciao, Duca.“
„Entschuldige, Gigi, aber meine Nichte hat vierzig Fieber, und ich sitze hier im Kommissariat fest und kann nicht weg. Sie hat auf meine Anweisung hin zwanzig Tropfen Ledermicina und zwei Zäpfchen Uniplus bekommen, aber das Fieber geht einfach nicht runter. Tu mir doch bitte den Gefallen und sieh mal nach ihr.“
Er hörte ihn noch einmal gähnen. „Ausgerechnet heute Nacht, wo es mir ausnahmsweise einmal gelungen war, schon um zehn im Bett zu liegen.“
„Es tut mir wirklich leid, Gigi. Tu mir den Gefallen, bitte!“
Dann las er die fünfte Akte zu Ende und begann mit der sechsten. Als er fast fertig war, kam Mascaranti mit den zwei Flaschen, den Zigaretten und den Streichhölzern herein.
„Wo soll ich die Sachen hinstellen?“, erkundigte er sich.
„Hier neben mich auf die Erde“, erwiderte Duca. „Und jetzt geh eine Runde schlafen. Ich hole dich, wenn es so weit ist.“
„Ja, Doktor Lamberti.“
Er las die siebte Akte und dann die achte und die neunte. In jeder Akte lagen zwei Fotos des jeweiligen Schülers, eins von vorn und eins im Profil, wie bei gewöhnlichen Verbrechern. Es waren keine schönen Gesichter. Bevor er mit der zehnten Akte begann, öffnete er das Fenster, betrachtete die dicken Nebelschwaden, die sich durch die Via Fatebenefratelli wälzten, und atmete tief durch. Er ließ das Fenster offen, ging zum Tisch zurück und las die zehnte und die elfte Akte, wobei er sich weiter Notizen machte.
Nun war er mit dem ersten Teil seiner Arbeit fertig. Er klappte die Aufschläge seines Jacketts wieder hoch, denn die eisige Luft war schon bis in die letzte Ecke des Zimmerchens gedrungen, und überflog noch einmal seine Aufzeichnungen. Um in die Abendschule eingelassen zu werden, mussten die Jugendlichen klingeln. Die Hausmeisterin öffnete ihnen die Tür und wusste also immer, wer gekommen war und wer nicht. Sie hatte ausgesagt, dass an dem Abend des Verbrechens elf Jungen in der Schule gewesen waren. Duca hatte ihre Namen und einige Stichpunkte auf einem Blatt Papier zusammengefasst und sie dem Alter nach aufgelistet.
13 Jahre: CARLETTO ATTOSO. Vater Alkoholiker. Tuberkulosekrank.
14 Jahre: CAROLINO MARASSI. Waise. Mehrere Diebstähle.
14 Jahre: BENITO ROSSI. Eltern anständige Leute. Gewalttätig.
16 Jahre: SILVANO MARCELLI. Vater im Gefängnis. Mutter verstorben. Vererbte Syphilis.
16 Jahre: FIORELLO GRASSI. Eltern anständige Leute. Nicht vorbestraft. Guter Junge.
17 Jahre: ETTORE DOMENICI. Mutter Prostituierte. Übertragung des Sorgerechts auf die Tante. Zwei Jahre Besserungsanstalt.
17 Jahre: MICHELE CASTELLO. Eltern anständige Leute. Zwei Jahre Besserungsanstalt. Zwei Jahre Sanatorium.
18 Jahre: ETTORE ELLUSIC. Eltern anständige Leute. Spieler.
18 Jahre: PAOLINO BOVATO. Vater Alkoholiker. Mutter im Gefängnis wegen Zuhälterei.
18 Jahre: FEDERICO DELL’ANGELETTO. Eltern anständige Leute. Gewohnheitstrinker. Gewalttätig.
20 Jahre: VERO VERINI. Vater im Gefängnis. Drei Jahre Besserungsanstalt. Sexualtäter.