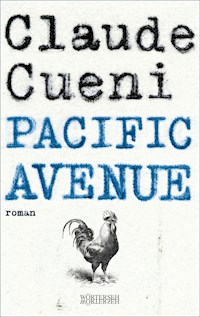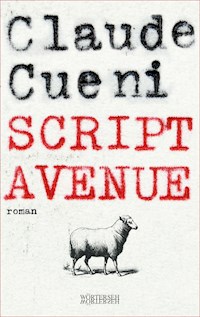18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lenos Polar
- Sprache: Deutsch
Lukas Rossberg lag seit einem Kopf- und Lungendurchschuss, den er als Unbeteiligter bei einem Casinoüberfall erlitten hatte, sieben Jahre im Wachkoma. Als er nach der Reha ins Leben zurückkehrt, ist nichts mehr so, wie es war: Seine Freundin hat ihn verlassen, die Angestellten seiner IT-Firma sind ins Silicon Valley ausgewandert. Und die Folgen seiner schweren Verletzungen bleiben spürbar, er hat Gedächtnisausfälle und Depressionen. Sein alter Freund Robert Keller gibt ihm aus Mitleid einen Job bei der Lotteriegesellschaft. Fortan berät Lukas frischgebackene Lottomillionäre - er wird der Mann, der Glück bringt, aber selbst kein Glück hatte. Doch das eigenartige Verhalten des Lotteriechefs weckt schon bald sein Misstrauen. Der Verdacht, dass sich in der verhängnisvollen Casinonacht manches anders zugetragen hat, erhärtet sich. Als Lukas schließlich den Server der Lotteriegesellschaft hackt, kommt er Roberts Komplott auf die Spur. In seinem neuen Roman blickt Claude Cueni in die Seele eines nicht nur körperlich verletzten Menschen, der seinen Frieden finden will, aber stattdessen hinter ein Geheimnis kommt, das seine Rachegelüste weckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
www.lenos.ch
Claude Cueni
Der Mann, der Glück brachte
Roman
E-Book-Ausgabe 2018
Copyright © 2018 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Hauptmann & Kompanie, Zürich, Dominic Wilhelm, unter Verwendung eines Fotos von © frankie’s/Shutterstock.com
eISBN 978 3 85787 963 0
Claude Cueni, geboren 1956 in Basel, schrieb Romane, Psychothriller, Theaterstücke, Hörspiele und über fünfzig Drehbücher für Film und Fernsehen. Sein historischer Roman Das Grosse Spiel über den Papiergelderfinder John Law war ein Bestseller und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Mit seinen Romanen über Charles-Henri Sanson (Der Henker von Paris), Gustave Eiffel (Giganten), die Entdeckung der Philippinen (Pacific Avenue), die Goldgeschäfte des Vatikans (Der Bankier Gottes) und den Gallischen Krieg (Das Gold der Kelten) hat er eine treue Leserschaft gefunden. Für seinen autobiographischen Bestseller Script Avenue wurde er 2014 von den Zuschauern des Schweizer Fernsehens mit dem Golden Glory für die emotionalste Geschichte des Jahres ausgezeichnet. Claude Cueni lebt bei Basel. www.cueni.ch.
für Dina Ariba Cueni
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Nachwort
Glück ist, wenn das Pech die anderen trifft.
Horaz
Wenn man nur glücklich sein wollte, wäre es bald getan, aber man will ja glücklicher als die anderen sein, und das ist fast immer schwierig, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie wirklich sind.
Montesquieu
Die hier geschilderten Ereignisse und Personen sind fiktiv. Oft ist diese Formulierung ironisch gemeint oder aus juristischen Gründen angebracht. Im vorliegenden Fall ist sie ernst gemeint und notwendig, da ich als Autor und Gamedesigner in den neunziger Jahren mit meinem Black-Pencil-Team Game-Software für in- und ausländische Lotteriegesellschaften und Software für Casinoautomaten entwickelt und produziert habe. Ich habe dabei ausschliesslich gute Erfahrungen gemacht.
Claude Cueni
1
»Jetzt haben Sie Ihr Leben zurück.«
»Welches Leben?« Ich schaute auf den Park hinunter, es war Sommer, die Menschen trugen bunte T-Shirts und dunkle Sonnenbrillen, einige waren zu zweit, andere hatten nur ein Handy, sie kamen und gingen, sie hatten alle einen Plan, ich hatte keinen.
»Werden Sie nicht abgeholt?«
Ich drehte mich um. Sabrina Padelli stand immer noch mit meiner Adidas-Tasche in der offenen Zimmertür. Sie war um die dreissig und hatte halblanges braunes Haar. Ich wollte ihr sagen, dass ich von niemandem erwartet wurde und meine Rückkehr vielleicht nicht allen gefallen werde, aber ich verkniff mir die Bemerkung. Mich ihr anzuvertrauen, hielt ich für eine schlechte Idee – Padelli hatte über die psychosozialen Folgen schwerer Schädel-Hirn-Traumata promoviert, ging zweimal die Woche schwimmen und verfasste Berichte über mich.
»Sie hatten damals nach Ihrer Einlieferung oft Besuch, eine junge Frau, können Sie sich erinnern?«
Ich ging langsam auf sie zu. »Das war früher«, sagte ich mit schleppender Stimme, »jetzt ist nicht mehr früher.«
Sie schien besorgt und zog die Stirn in Falten, wie sie es in letzter Zeit immer getan hatte, wenn sie spürte, dass ich mir keine Illusionen mehr machte. Aber es war nicht meine Aufgabe, sie aufzumuntern, sie hingegen wurde dafür bezahlt, mich und meine Adidas-Tasche nach Hause zu bringen.
»Sie wollen immer noch nicht darüber sprechen«, stellte sie bedrückt fest, als empfinde sie meine Weigerung als persönliches Versagen.
Wir traten auf den bunt gestrichenen Flur hinaus, ein bisschen Flower-Power im Todestrakt, sie taten hier alles, damit wir uns besser fühlten. Nach ein paar Schritten blieb ich stehen, hatte bereits Mühe mit dem Atmen. Ich warf einen letzten Blick in Zimmer 204, das in den letzten Jahren mein Zuhause gewesen war. Ich war da und war doch nicht da. Als wir den Flur entlanggingen, fragte die Psychologin, worauf ich mich am meisten freute.
»Worauf sollte ich mich denn freuen?«
Sie fuhr einen Fiat 500e, einen grünen Cityflitzer, sie sagte, Benziner und Diesel, das sei vorbei und das Austrittsformular habe sie in der Tasche.
»Wie schnell können Sie damit fahren?«, fragte ich. Sie schien erfreut, dass ich mich nach der Leistung des Elektromotors erkundigte, dass ich überhaupt Interesse an etwas hatte, kommunikativ, würde sie vielleicht in ihren Rapport schreiben. Aber ich interessierte mich nicht für Autos, von Motoren hatte ich keine Ahnung.
»Hundertfünf Stundenkilometer Maximum, aber mehr brauchen Sie im Stadtverkehr nicht. Und wenn ich woandershin will, nehme ich den Zug.«
Ebenso wenig interessierte ich mich für Züge, Fahrpläne und Destinationen. Meine Welt waren stets Quellcodes und Algorithmen gewesen, damals. Ich mochte auch nicht viel sprechen, meine Stimme klang so heiser, so gepresst, als hätte ich zu wenig Luft, um einen Laut von mir zu geben, als hätte ich diese Stimme seit einer Ewigkeit nicht mehr benutzt.
»Verzeihung, ich habe eben nicht zugehört.«
»Werden Sie wieder in Ihrem Beruf arbeiten?«, fragte Sabrina Padelli laut und deutlich, weil sie wusste, dass ich seit der Schussverletzung auf dem linken Ohr taub war.
»Sieben Jahre sind eine lange Zeit in der IT-Branche.«
Ich wandte mich von ihr ab und beobachtete die Passanten. Mir schien, sie hätten alle dringende Termine, als hätte in meiner Abwesenheit eine Beschleunigung stattgefunden. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil ich die letzten Jahre in Slow Motion verbracht hatte – in Zimmer 204.
Was tut man in diesem Raum? Man geht verloren. Man starrt auf die Uhr über der Tür, die man öffnen könnte und die doch verschlossen bleibt, man schaut nach einer Weile wieder auf das Ziffernblatt und stellt fest, dass sich der Zeiger nicht bewegt hat. Man überlegt, ob die Uhr defekt ist, ob sie von Batterien betrieben oder an das Stromnetz angeschlossen ist, man fragt sich, ob die einen schon vergessen haben, und dann bricht die Nacht an, obwohl es draussen noch hell ist, man versinkt in einer Finsternis, in der man sich nie zurechtfindet, und wenn man die Augen wieder öffnet, überlegt man, ob jetzt Herbst oder Mittwoch ist, schielt zum Fenster und sieht den Schnee auf den Dächern, und jemand flüstert: Können Sie mich hören?
Wir parkten vor einer Altbauliegenschaft, wie sie der damalige Stadtarchitekt Baumgartner in den dreissiger Jahren zu Dutzenden im Quartier erstellt hatte, vierstöckige Bauten mit Mansarden für den Mittelstand nach dem immer gleichen modularen Bauschema. Die Metzgerei im Erdgeschoss war offenbar ausgezogen, das Ladenlokal an einen Italiener vermietet worden. Er stand gelangweilt vor der offenen Tür und zeigte mit dem Kinn auf die grünen Obst- und Gemüseharassen, die er vor dem Schaufenster aufgestellt hatte. Sabrina Padelli löste an der Parkuhr für dreissig Minuten. Das war mir recht so, ich konnte es kaum erwarten, wieder allein zu sein. Allein, aber nicht in einem geschlossenen Raum. Vielleicht würde ich auf dem Balkon übernachten. Für einen Augenblick war ich mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt einen hatte. Ich schaute die Fassade hoch und sah die kleinen Balkone.
Wer eines der Spitalzimmer im zweiten Stock verlässt, ist sehr fragil, verunsichert, er verträgt nicht mehr viel, er hat das Urvertrauen in das Leben verloren. In der letzten Sitzung hatte mir die Psychologin geraten, ich solle mir die Zeit nehmen, die ich brauchte. Ich sah, dass das kleinere Ladengeschäft auf der anderen Seite des Hauseingangs leer stand. Zu vermieten. Sabrina Padelli fragte mich, ob mich der laute Strassenverkehr störe. Schon allein ihre mitfühlende Art und die Kummerfalten auf ihrer Stirn konnten einen in Schwermut stürzen.
»Das ist mir egal«, sagte ich. Es sollte ruhig laut werden, damit das Piepsen in meinem Kopf übertönt würde. Von mir aus hätten auch schwere Frachtmaschinen im Tiefflug über die Dächer donnern können.
Sie bestand darauf, meine Tasche zu tragen, weil ich motorisch noch einige Probleme hatte, aber das war angeblich normal am Anfang.
»Ich schaffe das schon«, sagte ich und räusperte mich. Ich wollte ihr die Tasche abnehmen, aber sie zog sie mit einem schelmischen Lächeln an sich und brachte mich dabei beinahe zu Fall. Der Italiener lachte, wahrscheinlich, um unsere Aufmerksamkeit auf seine Auslage zu lenken. Er nahm zwei schön geformte Orangen in die Hand und jonglierte ein bisschen, aber wir wollten keine Orangen. Der Hauseingang war mit Graffiti besprayt, doch es waren keine Motive, Bilder oder gar Kunstwerke wie in Wynwood, Downtown Miami, vielmehr gesudelte Initialen, wie ich sie früher auf jede Seite unserer Softwareverträge gekritzelt hatte. Ich blieb stehen und versuchte, durch den halboffenen Mund zu atmen. Der Druck auf der Brust hatte erneut zugenommen, aber ich konnte nicht den Rest meines Lebens wie eine Schaufensterpuppe auf einem Styroporfelsen sitzen.
»Stört Sie das?«, fragte Padelli erneut, bemüht, mich vor allem Unbill zu schützen. Ich überlegte, worauf sie anspielte. Sie meinte wohl die Grafitti.
»Mir egal«, antwortete ich und warf einen flüchtigen Blick auf die Klingelschilder. Die meisten waren mit von Hand geschriebenen Namen überklebt. Mein Briefkasten war leer, vielleicht kümmerte sich der Hauswart darum, aber ich hatte seinen Namen vergessen.
Wir stiegen die knarrende Rundtreppe hoch, ich hatte ziemliche Mühe damit, Treppensteigen hatten wir in der Reha wenig trainiert. Vielleicht würde ich mir eine neue Wohnung suchen, aber der Physiotherapeut hatte mir jeden Morgen um halb sieben gesagt: Use it or lose it.
Ich wohnte im zweiten Stock. Etwas umständlich kramte Sabrina Padelli einen Schlüsselbund hervor. Ich warf einen Blick auf die Tür zur Nachbarwohnung. Am Rahmen klebte ein Fetzen Papier: Sabih Gürsoy. Hier hatte zu meiner Zeit der Hauswart gewohnt. Johannes Hofer, jetzt fiel es mir wieder ein. Sein Sohn hatte eine Chinesin geheiratet und war nach Shenzhen gezogen, das hatte ihm arg zugesetzt. Vielleicht war der Türke nebenan sein Nachfolger und kümmerte sich um meine Post.
Sabrina Padelli öffnete die Wohnungstür. An der Wand hing ein altes schwarzes Telefon mit Wählscheibe, Jennifer hatte es behalten wollen, Vintage und so. Jennifer war meine Freundin gewesen, damals, als ich noch ein Leben führte wie andere auch. Die Küchentür stand weit offen, ich trat ein und ging gleich zum Balkon, öffnete die Tür und setzte mich in meinen alten braunen Ledersessel. Jetzt erst sah ich die Postberge hinter der Wohnungstür. Mit Mahnungen musste ich nicht rechnen, denn ich hatte alle laufenden Kosten mein Leben lang per Lastschriftverfahren bezahlt. Irgendjemand musste in meiner Abwesenheit nach dem Rechten geschaut haben. Aber wer ausser Jennifer hatte einen Schlüssel? Für einen Augenblick begann ich zu hoffen, doch gleich darauf spürte ich Zorn in mir aufsteigen. Was es war, das mich erzürnte, wusste ich nicht genau. Nein, es war nicht Jennifer, nicht nur.
»Nehmen Sie Milch?«
Ich beobachtete, wie Sabrina Padelli Kaffee machte. Sie sagte, man müsse das Gerät entkalken, und fing schon wieder mit diesen Grafitti an: Es gebe Leute, die sich dadurch verunsichert fühlten. Das sei ganz normal, nach all dem, was ich durchgemacht hätte, einige Menschen würden überempfindlich, ängstlich, verlören den Glauben an die Zukunft.
Nicht schon wieder, dachte ich, nimmt diese überfürsorgliche Dauerbetreuung denn gar kein Ende? Ich fuhr mir langsam über den kahlen Schädel und entgegnete leicht gereizt, aber doch beherrscht: »Ich sagte doch, ist mir egal.«
Es kostete mich einige Mühe, mich aus dem Sessel zu schälen und alleine im Wohnzimmer herumzulaufen, ich vermisste die Barren aus der Reha.
»Und? Wie fühlen Sie sich?«
Ich mochte nicht antworten und entfernte mich von ihr. Die Hälfte der Bücherregale war leer, an den Wänden sah man grosse helle Flächen, wo einst die zwölf eingerahmten persischen Kalenderblätter gehangen hatten, ein Weihnachtsgeschenk von Jennifers Arbeitgeber. Sie hatte damals die Buchhaltung in einer Anwaltskanzlei gemacht und sich etwas darauf eingebildet, denn sie hatte mit ihrem Fünfzig-Prozent-Job die Arbeit einer Ganztagsstelle erledigt. Ich hatte ihr gesagt, dass solch ein Kalender das mindeste sei, was man in ihrem Fall zu Weihnachten geschenkt erhalten sollte, und sie solle den Lohn ihres Vorgängers fordern. Doch Jennifer hatte gesagt, Doktor Schultheiss müsse selbst bemerken, was sie leiste.
»Nehmen Sie Zucker?«
»Nein«, sagte ich enerviert. »Wissen Sie, wer hier zum Rechten geschaut hat? Ich hatte erwartet, dass hier alles voller Spinnweben ist …«
»Nein, am besten, Sie fragen den Hauswart.« Sabrina Padelli stellte die beiden Tassen auf den Tisch und nahm einen kleinen Karton mit einem Truffes-Orangen-Cake aus ihrer Tasche. Sie schnitt mir eine Tranche ab und reichte mir einen Teller und eine Dessertgabel. »Dunkle Schokolade ist gut für die Moral.«
»Dann hätten Sie ein grösseres Stück kaufen sollen!« Ein dummer Scherz, denn sie hatte jetzt den Eindruck, dass meine Moral im Keller war. Und damit lag sie nicht mal falsch. Eben hatte ich an Suizid gedacht, nicht an einen Mord, den man selbst an sich ausführt, sondern an Schmerzlinderung mit Todesfolge.
»Werden Sie den Ort wieder aufsuchen, wo alles passiert ist?«
Ich setzte meine Tasse ab und überlegte. »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.«
»Das sollten Sie aber«, sagte sie und nickte eindringlich, »ich habe die Zeitungsberichte von damals aufbewahrt.« Sie nahm eine gelbe Mappe aus ihrer Tasche und legte sie auf den Tisch. »Sie müssen sie nicht anschauen. Aber den Tatort sollten Sie vielleicht nochmals aufsuchen. Das kann Ihnen helfen, alles zu verarbeiten.«
Ich genoss die zartbittere Schokolade. Sabrina Padelli sah mir zu und sagte, die Torte sei nur für mich, sie mache Diät und habe zudem eine Laktoseintoleranz. Ich nickte, ohne sie anzuschauen, und schnitt mir ein weiteres Stück ab. »Was geschehen ist, ist geschehen und hat mit meinem neuen Leben nichts mehr zu tun. Was soll ich dort?«
Sie wartete eine Weile, und als sie ahnte, dass ich nicht auf ihren Vorschlag eingehen würde, nahm sie eine Visitenkarte aus ihrer Aktentasche und legte sie auf die Pressemappe. Sie sei immer erreichbar und für mich da. Sie wiederholte es zu oft. In meinem alten Leben war ich ohne sie ausgekommen, und in meinem neuen Leben würde ich auch ohne sie auskommen. Als ich die Gabel in meiner Hand sah, liess ich sie angeekelt fallen. Ich hatte plötzlich Angst, ich könnte damit in Sabrina Padellis Finger stechen. Ich sah es nicht gern, dass sie mit der Hand immer wieder unruhig über die Pressemappe fuhr. Das musste aufhören. Es war nie meine Absicht, sie zu verletzen, ich hatte einfach die Befürchtung, ich könnte es tun.
Zum Glück stand sie auf, nahm eine transparente Plastiktasche von der Küchenkombination und legte sie vor mir auf den Tisch. »Das sind Ihre persönlichen Sachen, die Sie bei der Einlieferung bei sich trugen. Auch Ihr Handy ist dabei. Die Kriminalpolizei hatte es später zurückgebracht.« Sie legte die Haus- und Wohnungsschlüssel auf den Tisch, sie zögerte es absichtlich hinaus. »Aber Sie müssen mich anrufen, wenn Sie ein Problem haben, versprochen?«
Ich nickte und folgte ihr ins Treppenhaus. Als sie stehen blieb, überlegte ich, ob sie die Treppe hinunterfallen könnte. Nicht aus Versehen, nein, ich würde sie stossen, vorsätzlich. Ich weiss nicht, wieso ich das hätte tun sollen. Als sie die ersten Stufen nahm, war ich enorm erleichtert. Ich kehrte rasch in meine Wohnung zurück und schloss die Tür. Endlich hatte ich meine Ruhe, um über alles nachzudenken. Wenigstens hatte ich nicht mehr an die Essgabel gedacht. Nein, jetzt war mir die Gabel wieder eingefallen.
Ich nahm mein Handy aus der Plastiktasche, die das Logo der Kriminalpolizei trug, und fuhr mit dem Finger über das Display. Es war zerbrochen. Ich überlegte, ob ich mir ein neues kaufen sollte, aber ich verwarf den Gedanken wieder, weil ich spürte, dass mich ein Gang in die Stadt überfordern würde. Ich müsste einen Laden finden und mich dann zwischen unzähligen Modellen entscheiden. Sie würden mir dort Dinge erklären, die ich zu Hause schon wieder vergessen hätte. Dann sah ich erneut die Gabel. Ich nahm sie vorsichtig in die Hand, als solle sie nichts bemerken, und schmiss sie dann blitzschnell gegen den Kühlschrank.
Mit beiden Händen griff ich nach dem Truffes-Cake, krallte meine Finger in die Schokoladenmasse und stopfte mir faustgrosse Stücke in den Mund. Plötzlich hatte ich Lust auf Zucker.
2
Ich lief ziellos im Quartier umher, denn wo ich hergekommen war, hatte man mir gesagt, ich solle so viel laufen wie nur möglich. An jenem Ort waren die Menschen immer wach, aber sie hatten kein Bewusstsein mehr. Und wenn sie eines Tages das Bewusstsein wiedererlangten, mussten sie alles von Grund auf neu erlernen, monatelang, zweiter Stock, Zimmer 204. Von hier aus sah man die Welt aus einer anderen Perspektive, man fühlte sich nicht erhaben, man fühlte sich ausgeschlossen, wie als Teil eines Geräteparks. Die Pflegerinnen nannten die Infusionsständer Weihnachtsbäume, weil die Displays in der Nacht leuchteten und unsere Nächte sehr lang waren. Einige Maschinen piepsten leise, aber ich konnte sie hören, selbst wenn sie ausgeschaltet waren. Manchmal blendeten mich die Monitore, wenn die Software sie plötzlich mitten in der Nacht aus ihrem Schlafmodus weckte, weil die Infusionsbeutel leer waren. Dann begann wieder dieses hektische Piepsen, aufdringlich und fordernd, man möchte schlafen, nur noch schlafen, aber doch nicht sterben, und wenn die Zeiger in den roten Bereich zurückfallen, weiss man, dass es vielleicht vorbei ist, jetzt ist alles egal, und dann stirbt man doch nicht.
Zu Hause rollte ich meinen Bürostuhl vor die Bücherregale und setzte mich. Das Treppensteigen hatte mich erschöpft. Ich keuchte, als wäre ich eine Stunde durch den Wald gerannt. In der Küche hatte ich noch ein paar leere Einkaufstaschen gefunden. Ich starrte auf das mittlere Regal mit all den bunten Hochglanz-Reiseführern. Jennifer und ich hatten beinahe die ganze Vis-à-Vis-Reihe von Dorling Kindersley gekauft, diese hochwertigen Bücher, die natürlich ihren Preis hatten. Ich war erstaunt, dass Jennifer die Reiseführer zurückgelassen hatte, und legte Thailand und die Philippinen in die Papiertasche. Als ich Südkorea in den Händen hielt, bemerkte ich, dass es noch ungelesen war. Ich glaube, was man am Ende des Lebens am meisten bereut, sind all die Dinge, die man auf später verschoben hat. Ich würde nie mehr reisen. Vielleicht noch in Gedanken, immerhin. Als ich auch Peru und Chile weglegte, kam mir in den Sinn, dass es heute im Internet Tausende von Reiseführern geben musste, und erst noch auf dem aktuellsten Stand. Also war es vielleicht gar keine nette Geste von Jennifer gewesen, auf diese Bücher zu verzichten. Sie hatte unnötigen Ballast zurückgelassen. Ich war ein Teil davon.
In Zukunft wollte ich mir angewöhnen, vor dem Spaziergang jeweils eine Salzlösung und anschliessend zwei Stösse Kortison zu inhalieren. Das würde helfen, die verklebten Lungenbläschen zu belüften. Ich hatte es per Mail mit dem Pneumologen abgesprochen. Mir war bewusst, dass man die Dosis nicht unbeschränkt erhöhen konnte, sonst würde man irgendwann an den Nebenwirkungen sterben. Morgens im Spiegel sah ich, wie das Kortison meinen Körper veränderte, mein Bauch war steinhart und aufgeblasen, als würde ich demnächst einige von HR Gigers Birth Machine Babies gebären. Das Gesicht war stark gerötet und aufgequollen, die Augen wirkten plötzlich so klein. War dies das berühmte Mondgesicht der Kortisonpatienten? Ich beschloss, beim Zähneputzen nicht mehr in den Spiegel zu schauen, aber die Birth Machine Babies wurde ich dadurch nicht los. Ich schleppte sie mit mir, wenn ich aus dem Badezimmer flüchtete, aus der Wohnung, auf die Strasse hinaus. Ich versuchte, in der Menge unterzutauchen und wieder einer von ihnen zu werden. Doch ich stand allen im Wege. Links und rechts wurde ich überholt, angerempelt, einige warfen mir vorwurfsvolle Blicke zu, ich war ihnen zu langsam, die Strasse gehört den Gesunden, aber sie hatten ja keine Ahnung, was mir widerfahren war und was möglicherweise ihnen eines Tages aus heiterem Himmel widerfahren würde.
Erschöpft setzte ich mich in ein Strassencafé und schaute den Menschen zu. Ja, einen Kaffee, ja, mit Zucker, viel Zucker. Ich hätte gern mit dem einen oder anderen Gast ein paar Worte gewechselt, aber sie waren alle beschäftigt, mit sich selbst und ihrem Handy. Ungeduldig wartete ich auf meine Bestellung. Eine Gruppe junger Frauen kam die Strasse herunter, wahrscheinlich Schülerinnen, für einen Augenblick hatte ich geglaubt, Jennifer zu erkennen, aber auch sie musste ja älter geworden sein. Die Mädchen nahmen die drei leeren Stühle von meinem Tisch und setzten sich neben den Eingang. Dachten sie etwa, einer wie ich sei mit niemandem verabredet? Ich hatte keine Lust, weiter wie ein Aussätziger allein an diesem Tisch zu sitzen, stand auf und wollte die Strasse überqueren, da rempelte mich eine Frau mit ihrer monströsen Einkaufstasche an und brachte mich beinahe zu Fall. Ich gab einen Laut der Entrüstung von mir, sie schaute zurück, für einen Augenblick dachte ich, es sei Jennifer, schon wieder Jennifer, aber sie war es nicht, die Fremde schüttelte enerviert den Kopf, tat so, als sei ich der Schuldige, irgendein Demenzkranker, der aus dem Heim geflohen ist und jetzt allen im Wege stand. Das machte mich zornig, und in Gedanken schrie ich Jennifer an und sagte ihr, dass es nicht meine Schuld war, was damals im Grand Casino passiert sei, doch im selben Augenblick begriff ich, dass die Frau, die nun vor mir herlief, nichts damit zu tun hatte, da sie ja nicht Jennifer war. Ich folgte ihr trotzdem, ich weiss nicht, wieso.
Jemand riss mich am Arm zurück. Es war der Kellner, er sagte, mein Kaffee sei serviert, ich hätte nicht bezahlt, ich könne nicht einfach davonlaufen. Ich entschuldigte mich und nahm mein Portemonnaie hervor. Dabei fielen ein paar Münzen auf den Asphalt. Wir bückten uns gleichzeitig und stiessen die Köpfe zusammen. Ich verlor das Gleichgewicht und kippte über den Bordstein auf die schmutzige Fahrbahn. Der Kellner sah, dass ich allein nicht mehr auf die Beine kam, und half mir hoch. Dann bückte er sich erneut nach den Münzen, zählte sie und wollte mir die Hälfte zurückgeben. Ich lehnte ab, sagte, das sei schon in Ordnung. Er war nicht mehr erbost, wahrscheinlich hatte er jetzt Mitleid.
Die Fremde hatte ich aus den Augen verloren, ich hatte auch keine Lust, einer unbekannten Frau zu folgen. Ich begriff nicht, wieso ich überhaupt auf diesen Gedanken gekommen war.
Ich schlenderte die Strasse hinunter, blieb ab und zu vor einem Schaufenster stehen und schaute mir die Auslagen der kleinen Lebensmittelgeschäfte an, die überall entstanden waren, Streetfoodbaracken und Hotdogstände, ich sah ein Dutzend Männer, die in einem italienischen Coiffeursalon auf ihren Haarschnitt warteten. Das musste ein besonders talentierter oder günstiger Coiffeur sein, vielleicht war es auch ein Treffpunkt italienischer Landsleute. Ich brauchte keinen Haarschnitt mehr, in der Chirurgie hatten sie mich kahlgeschoren, bevor sie den Schädel aufgebohrt hatten, um das Blut abfliessen zu lassen, die Schwellung zu lindern und den Druck auf das Gehirn zu reduzieren. Auf der linken Seite würde deshalb kein Haar mehr wachsen, also war es naheliegend gewesen, auch die andere Seite kahlzuscheren. Trotzdem hätte ich viel darum gegeben, in diesem Coiffeursalon zu sitzen, einer von ihnen zu sein, vielleicht sogar ein Cousin. Selbst wenn ich zu einer Mafiafamilie gehört hätte, wäre mir das egal gewesen, Hauptsache Familie. Ich glaube, deshalb mögen die Leute Mafiafilme, es liegt nicht an den blutigen Gewaltszenen, sondern am bedingungslosen Zusammenhalt eines Clans: Familie.
Ich betrat einen Trödlerladen, sah mich um, obwohl ich nicht vorhatte, etwas zu kaufen, aber ich wollte erst wieder in meine Wohnung zurück, wenn die letzten Geschäfte geschlossen waren. Ich blieb vor einer Sammlung Wanderstöcke stehen. Die ehemaligen Besitzer hatten zahlreiche Blechplaketten daran befestigt, sogenannte Stocknägel, kleine, gebogene Blechsouvenirs, Elsass, Matterhorn, Luzern, einige hatten den Schwarzwald bevorzugt, andere waren viel weiter gewandert, einer nach Schottland, dem Hadrianswall entlang, ein anderer in die Normandie. Am Ende waren sie alle im gleichen Tal zur Ruhe gekommen, und egal ob sie reich, bedeutend gewesen waren, Glück oder Unglück erfahren hatten, sie waren alle zu einem Häufchen Kompost zerfallen, und was von ihnen übrig blieb, war hier versammelt, ihre Wanderstöcke mit den Stocknägeln. Sabrina Padelli hatte mich mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig sei, positive Gedanken zu haben, das sei hilfreich. Aber was hätte ich beim Anblick dieser Stocknägel denken sollen? Ich überlegte, wieso die Menschen keine Spazierstöcke mehr haben, und war stolz, als mir einfiel, dass die Leute heute zum Wandern Skistöcke benutzen. Diese Erkenntnis war immerhin ein Hinweis darauf, dass mein Intellekt wieder an Schärfe gewann. Das stimmte mich zuversichtlich, hatte ich doch sehr darunter gelitten, dass mich schon einfachste Gedankengänge überforderten, als ich das Wachkoma überwunden hatte.
»Nichts gefunden?«, fragte mich der Händler, als ich mich zum Ausgang bewegte.
»Nein«, sagte ich, »nichts gesucht und nichts gefunden.«
Bei der Tür war eine schmale Vitrine aufgestellt, auf den Tablaren allerlei Kitsch, drei kleine Elastolinhühner aus den vierziger Jahren. Der Händler schlurfte hinter der Theke hervor. »Ich mache Ihnen die Vitrine auf.« Er schien müde, hatte wohl bessere Zeiten erlebt, viel geraucht, viel gekokst, viel gelebt. Er öffnete die Glastür und fixierte mich.
»Was kostet das Huhn?«, fragte ich.
Er nahm das vorderste aus der Vitrine. »Fünfzehn«, sagte er nach einem Blick auf das Preisschild.
»Ich nehme alle drei für zehn pro Stück«, sagte ich.
Er zögerte. »Sammeln Sie?«
»Nein«, log ich, »ich schenke sie einem Kind aus der Nachbarschaft.«
Er nickte und verzog dabei das Gesicht, als würde ihn der Preisnachlass in den Bankrott treiben.
Ich gab ihm das Geld und verliess den Laden. Als Kind hatte ich mit Elastolinfiguren gespielt, einige Hühner aus Hartplastik waren übrig geblieben, ich dachte, vielleicht könnte ich meine Sammlung weiter ausbauen, das würde bedeuten, dass ich wieder an eine Zukunft glaubte, dass ich eine Zukunft hatte. Ich weiss allerdings nicht, ob man sich mit drei Elastolinhühnern eine Zukunft erschaffen kann.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte eine freundliche Stimme mit französischem Akzent. Vor mir stand eine Frau mit blondem Bubikopf, wie man ihn im Paris der zwanziger Jahre geliebt hatte. Sie war vielleicht fünfunddreissig, achtunddreissig und trug einen roten Arbeitskittel mit dem grüngelben Logo der Supermarktkette.
Ich stand gerade vor einem Regal mit Heftpflastern, die mit Kindermotiven verziert waren. »Ich suche ein Desinfektionsmittel, ich habe mir die Füsse wund gelaufen.«
Sie sagte, so was hätten sie nicht im Sortiment, aber drüben sei eine Apotheke. Und eigentlich, fügte sie freundlich hinzu, würden sie jetzt schliessen.
»Fünf Minuten?«
Sie nickte verständnisvoll und beobachtete, wie ich den Regalen entlangging. Wann war ich zuletzt in einem Supermarkt gewesen? Für die meisten Menschen ist das Einkaufen von Nahrungsmitteln eine lästige Notwendigkeit, für mich indes war dieser Moment ein Triumphzug, es war grossartig. Ich fühlte mich wie ein römischer Imperator, der nach jahrelangem Feldzug im Triumph nach Rom zurückkehrt. Aber ohne Legionen. Ich hatte nur drei Elastolinhühner in der Hosentasche.
Als ich die Strasse zu meinem Haus überquerte, war der Italiener gerade dabei, seine Plastikkisten einzuräumen. Ich fragte ihn, ob er bereits geschlossen habe oder ob ich noch etwas einkaufen könne. Mein Interesse freute ihn, er sagte, sein Name sei Antonio, und er fragte, ob ich hier eingezogen sei. Ich erwiderte, ich würde schon sehr lange hier wohnen, ich hätte noch die Metzgerei gekannt, aber sei eine Weile weg gewesen, und fragte, wer nun der Hauswart sei.
»Ah«, machte er bloss, »grosse Firma, alles kompliziert.« Johannes Hofer sei ein guter Mann gewesen, »wenn Winter kalt, Giovanni Heizung fortissimo, ich sagen, Giovanni, coglioni ghiacciati«, er griff sich dabei in den Schritt, »nessun problema«. Ich kaufte ein paar Pistazien und eine Flasche Pio Cesare Barbaresco. Er sagte, das sei der beste Wein Italiens und die Pistazien erhalte er direkt vom Produzenten, die gebe es nur bei Antonio.
Als ich meine Wohnungstür öffnen wollte, stellte ich fest, dass sie nicht verschlossen war. Hatte ich es vergessen? Der Neurologe hatte mich gewarnt, Zerstreutheit sei in den ersten Monaten normal, ich solle mich nicht verunsichern lassen. Trotzdem. Wut stieg in mir hoch. Ich betrat die Wohnung und erschrak: In der Küche stand ein junges Mädchen mit dunklen Mandelaugen, sie trug zerfranste Military-Shorts und ein ärmelloses Shirt mit der Aufschrift Some people just need a high five in the face. Sie war wohl chinesischer Abstammung, um die zwanzig und schaute mich überrascht an. Dann neigte sie grinsend den Kopf zur Seite, als wolle sie fragen, ob ich mich in der Tür geirrt hätte. Für einen Augenblick war ich erneut verunsichert. Ich trat in den Flur hinaus und warf einen Blick auf das Namensschild an der Tür der Nachbarwohnung. Sabih Gürsoy. Ich betrat wieder meine Wohnung, sah das schwarze Wandtelefon und die Postberge hinter der Tür. Das war meine Wohnung. Es machte mich zornig, dass ich schon wieder an meinem Verstand gezweifelt hatte.
»Was tun Sie hier?«, fragte ich entgeistert und ging drohend auf die junge Frau zu, aber ich schien sie nicht zu beeindrucken.
»Ich mache mir eine Nudelsuppe, und Sie?« Ihre Fröhlichkeit war die reinste Provokation. Sie riss kleine Tüten auf und schüttete gelb-orange Gewürze in den Suppenbecher. »Ich bin Yao, Yao Min«, sagte sie und goss heisses Wasser über die Nudeln, »und wer sind Sie?«
»Lukas Rossberg, ich wohne hier.«
Plötzlich stürmte sie auf mich zu und umarmte mich. »Dann sind Sie wieder aufgewacht, Herr Rossberg, das ist ja kaum zu fassen!«
Ich stiess sie sanft von mir. Das hatte sie nicht erwartet. Sie wich verunsichert zurück und hob langsam die Gabel vom Boden auf, ohne mich aus den Augen zu lassen.
»Ich werde Ihnen ein Taxi rufen«, sagte ich müde.
»Nicht nötig«, sagte sie enttäuscht und zeigte zur Decke, »ich wohne oben in Ihrer Mansarde.«
Auch das noch, dachte ich.
»Im Sommer ist es sehr heiss unter dem Dach, das müssen Sie verstehen, Herr Rossberg, und kochen kann ich da oben auch nicht.«
»Das ist nicht mein Problem«, sagte ich mehr zu mir selbst als zu ihr, während ich mich an den Küchentisch setzte, »und ich werde es auch nicht zu meinem Problem machen.«
»Nehmen Sie einen Grüntee? Wir haben uns eine Menge zu erzählen.«
»Das glaube ich nicht«, sagte ich und starrte auf mein altes iPhone, um die Essgabel zu vergessen.
Yao stand nun vor mir und rührte mit der schmutzigen Gabel in ihrer Nudelsuppe. »Sie sollten Grüntee trinken, am besten aus eisernen Tassen, Eisenmangel macht müde …«
Sie wollte sich zu mir setzen, aber ich hielt sie davon ab: »Yao, ich bin wirklich müde, sehr sogar, und ich habe wenig Lust, an einer Teezeremonie teilzunehmen. Tun Sie mir einen Gefallen, und gehen Sie einfach. Ich ertrage keinen Stress mehr.«
Yao stellte ihre Nudelsuppe auf den Tisch, stemmte beide Hände in die Hüften und versuchte die Stirn in Furchen zu legen. »Herr Rossberg, was glauben Sie eigentlich, wie Ihre Wohnung aussehen würde, wenn ich nicht jeden Samstag nach ihr geschaut hätte?« Sie zeigte auf den Poststapel hinter der Wohnungstür.
Ich zuckte die Schultern. »Sie hätten das alles wegschmeissen können.«
»Gut, dann werde ich es für Sie entsorgen, ich habe nur getan, was mir mein Grossvater aufgetragen hat.«
Ich fragte sie, ob Johannes Hofer ihr Grossvater sei.
»Ja«, sagte sie, »er ist leider letztes Jahr verstorben. Meine Mutter wollte, dass ich zur Familie nach Shenzhen zurückkehre, aber mein Vater hat Shenzhen nie gemocht, er war durch und durch Europäer.« Plötzlich hellte sich ihre Miene auf. »Oh, wir kriegen Besuch!« Sie neigte sich zur Seite und schaute an mir vorbei in den Flur, der zum Schlafzimmer führte.
Ich hörte ein klägliches Miauen, und schon sah ich eine schwarzweiss gefleckte Katze hereinstürmen. Sie blieb vor mir stehen, setzte zum Sprung an und landete auf meinen Knien. Überschwänglich stupste sie mich an und drückte ihren Kopf unter meine Hand. Ich begann sie zu streicheln und war augenblicklich versöhnt. »Sie heisst Venus«, sagte ich leise.
»Ich weiss, Jennifer hat es meinem Grossvater gesagt, als sie die Wohnung verliess. Sie sagte ihm, sie wolle ein neues Leben anfangen und Venus ins Tierheim bringen. Das konnte er nicht zulassen, denn mein Opa liebte Tiere. Er versprach, sich um die Katze zu kümmern.«