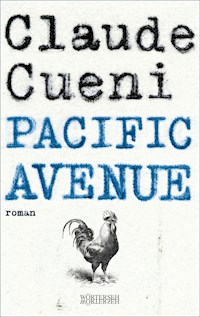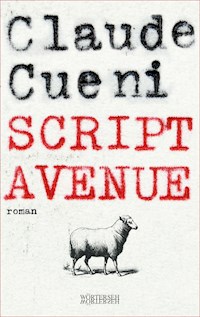
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Roman erzählt Claude Cueni, anders als in seinen viel beachteten historischen Romanen, nicht die Geschichten anderer, sondern seine eigene. Aus der Perspektive seines Krankenlagers erinnert er sich an seine mehr als abenteuerliche Lebensgeschichte, die ihren Anfang in einem von religiösem Wahn, sexuellen Zwängen und Gewalt geprägten Milieu im schweizerischen Jura nimmt. Aus dieser skurrilen Umgebung flüchtet er in seine eigene fantastische Welt, die Script Avenue. Mit viel Selbstironie und ohne den geringsten Funken Political Correctness schreibt Claude Cueni von seinem Überlebenswillen, seinem Schreibzwang, über die Liebe im Allgemeinen und zu seinem spastischen Kind im Besonderen, über schlaflose Nächte, herzzerreißende Abschiede und über das Glück anzukommen. Dabei zeichnet er in den ihm so eigenen, verblüffend schönen Sätzen ein opulentes Gemälde von den Sechzigerjahren bis in die Gegenwart. "Script Avenue" ist ein ebenso verstörendes wie absolut betörendes Buch, in dem Fremdenlegionäre, Krebskranke, Roulettespieler, Pädophile, Heldenfiguren, New-Economy-Blasen und Hongkonger Nächte das Korsett des Schriftlichen verlassen und zum Film werden. Ein Feuerwerk an Komik und Desaster und eine alle Sinne bezaubernde Betrachtung über die Kürze des Lebens, die Vergänglichkeit aller Dinge und die Versöhnung mit dem Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Claude Cueni
SCRIPTAVENUE
Roman
Spotlights auf die Script Avenue
Ich saß seit Monaten im fünften Stock der hämatologischen Abteilung der Universitätsklinik und wartete auf den Tod.
Das ist die perfekte Dramaturgie. Titanic! Sie ergattern noch zwei Tickets für das Oberdeck. Und saufen dann erbärmlich ab.
Nein, sie hat mich nicht enttäuscht, sie ist gestorben.
Wir wollten alle Amerikaner sein. Nur John F. Kennedy wollte ein Berliner sein.
Schicksalsschläge sind eine super Diät. Und wenn man keine neue Partnerin findet, gibts auch keinen Jo-Jo-Effekt.
Wir tun alle irgendetwas, um zu vergessen, dass mit unserer Geburt unser Schicksal bereits besiegelt ist: Wir müssen sterben.
Dieses Buch werde ich noch schreiben, denn wenn ich schreibe, denke ich nicht an den Tod.
In seinem neuen Roman erzählt Claude Cueni, anders als in seinen viel beachteten historischen Romanen, nicht die Geschichten anderer, sondern seine eigene.
Aus der Perspektive seines Krankenlagers erinnert er sich an seine mehr als abenteuerliche Lebensgeschichte, die ihren Anfang in einem von religiösem Wahn, sexuellen Zwängen und Gewalt geprägten Milieu im schweizerischen Jura nimmt. Aus dieser skurrilen Umgebung flüchtet er in seine eigene fantastische Welt, die Script Avenue.
Mit viel Selbstironie und ohne den geringsten Funken Political Correctness schreibt Claude Cueni von seinem Überlebenswillen, seinem Schreibzwang, über die Liebe im Allgemeinen und zu seinem spastischen Kind im Besonderen, über schlaflose Nächte, herzzerreißende Abschiede und über das Glück anzukommen. Dabei zeichnet er in den ihm so eigenen, verblüffend schönen Sätzen ein opulentes Gemälde von den Sechzigerjahren bis in die Gegenwart.
Claude Cueni, geb. 1956 in Basel, schrieb historische Romane, Thriller, Theaterstücke, Hörspiele und über 50 Drehbücher für Krimiserien wie »Tatort«, »Eurocops«, »Peter Strohm« und »Cobra 11«. Für Blackpencil designte er jahrelang Computergames, darunter den Welthit »Catch the Sperm«. Sein Roman »Das große Spiel« (Heyne), die wahre Geschichte des Papiergelderfinders John Law, belegte Platz eins der Schweizer Bestseller liste und wurde bisher in 13 Sprachen übersetzt. Claude Cueni erkrankte nach dem Tod seiner ersten Ehefrau an Leukämie und lebt heute, in zweiter Ehe, mit seiner Frau in Basel.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe
© 2014 Wörterseh Verlag, Gockhausen
Lektorat: René Staubli, ZollikonKorrektorat: Andrea Leuthold, Zürich, und Eliane Maria Degonda, ZürichUmschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, Dominic WilhelmLayout und Satz: Lucius Keller, ZürichHerstellerische Betreuung: Andrea Leuthold, Zürich
Print ISBN 978-3-03763-043-3E-Book ISBN 978-3-03763-549-0
www.woerterseh.ch
Für Clovisund alle Bewohner der Script Avenue
Selten machen wir uns klar, dass wir selbst es sind,die sterben werden. Während die Welt ungerührt weiterexistiert.Literatur öffnet uns manchmal für Momente die Augenfür diese Wahrheit, vor der wir sie sonst zumeist schließen.
Marcel Reich-Ranicki (1920–2013)
Inhalt
In My Secret Life
Woodstock
Ave Maria
Don’t You Want Me?
As Tears Go By
Carry That Weight
1
In My Secret Life
»Das sind Metastasen«, sagte der Arzt leise.
»All die winzig kleinen schwarzen Punkte?«, fragte Andrea entsetzt.
»Nein«, sagte der Onkologe und umkreiste mit einem Bleistift große weiße Flächen auf dem Thorax-Bild, »das ist der Krebs.«
»Dann ist ja alles … Wie viele Jahre noch?«, keuchte Andrea.
»Höchstens ein paar Wochen. Jetzt geht alles sehr schnell.«
»Aber ich habe einen Sohn«, flüsterte Andrea verzweifelt. Der Onkologe schwieg, er drängte uns nicht zu gehen. Andrea gab mir zu verstehen, dass sie aufstehen wolle. Ich nahm vorsichtig ihren Arm und führte sie hinaus zum Parkplatz. Sie sagte, ich solle schneller gehen, sie würde sich noch erkälten, dann sagte sie, ich solle nicht rennen, ob ich denn keine Rücksicht auf ihre Lunge nehmen könne. Wir begriffen beide, dass sie nun angefangen hatte zu sterben.
Als ich die Augen öffnete, sah ich eine verschwommene Gestalt in einem weißen Gewand. Das Licht blendete mich. Es war eine Frau. Sie trug einen breiten Mundschutz, das Haar hatte sie mit einer Plastikhaube abgedeckt. Sie hängte eine neue Flasche an den Infusionsständer und stöpselte den Schlauch um.
»Hat meine Frau angefangen zu sterben?«, murmelte ich. »Sie lagen im Koma, Monsieur Bretelle. Sie hatten Hirnblutungen. Wir mussten eine Bohrlochtrepanation vornehmen, um das Blut abzusaugen.«
Ich fasste mir an den Kopf, ich trug einen dicken Verband.
»Sie haben mir den Schädel aufgebohrt?«
»Frontal, beidseitig. Falls der Druck wieder ansteigt, müssen Sie mich rufen.«
»Hat meine Frau angefangen zu sterben?«, fragte ich erneut.
»Sie sind Witwer, Monsieur Bretelle. So steht es in Ihrer Krankenakte.«
»Dann ist sie tatsächlich gestorben«, murmelte ich.
»Ja. Das tut uns allen sehr leid, aber Sie müssen jetzt an sich denken. Ihr Sohn wartet draußen auf dem Flur, er wird gerade eingekleidet. Sie erinnern sich doch, dass Sie einen Sohn haben?«
»An meinen Sohn werde ich mich immer erinnern, er muss um die 26 Jahre alt sein. Oder lag ich sehr lange im Koma?«
»Nein, nur eine Weile. Einige können sich später an nichts mehr erinnern.«
»Ich versuchte mich eben an meine Frau zu erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie sie ausgesehen hat. Es ist nur ein Gefühl zurückgeblieben, ein sehr merkwürdiges Gefühl, voller Widersprüche. Ich hatte einst Angst, die Erinnerung zu verlieren, und jetzt habe ich sie doch verloren. Ist es möglich, dass man gleichzeitig Liebe und Hass empfindet?«
»Ich werde jetzt Ihren Sohn ins Zimmer bringen.«
»Beeilen Sie sich. Mir ist plötzlich so kalt.«
Andrea döste auf dem Bett und vergewisserte sich immer wieder, dass ich noch da war. Das Morphium zeigte keine Wirkung mehr. Andrea berührte meine Hände, sanft, fast zärtlich.
»Ich habe dich so geliebt«, flüsterte sie. »Du warst immer die große und einzige Liebe meines Lebens. Halt mich fest.«
Ich nahm sie in meine Arme, ich brachte kein Wort über die Lippen. Sie sah, dass ich stumm weinte. Dann sagte sie noch ein einziges Wort. Es war kaum zu fassen, dass sie es aussprach, aber das war ihr letztes Wort: »Danke.« Es klang so traurig, als hätte sie verloren, ausgerechnet sie, die nie verlieren konnte. Es kostete sie viel Überwindung, aber sie sagte: »Danke.« Es klang auch etwas versöhnlich. Sie hätte es mir nicht zu sagen brauchen, es wäre auch ohne in Ordnung gewesen. Aber als sie es ausgesprochen hatte, fühlte ich wieder die Seele meiner Jugendliebe, den Atem meines besten Kumpels, ich hatte sie so sehr geliebt.
»Andrea ist schon lange tot«, sagte der junge Mann an meinem Bett. Tim. Er hielt meine Hand fest. Er getraute sich nicht richtig, weil er die gesteckten Infusionsnadeln nicht berühren wollte.
»Die Operation ist gut verlaufen«, sagte Tim, »du lagst wieder im Koma.« Wir schwiegen eine ganze Weile, dann sagte er plötzlich: «Du hast mir zuletzt von der Script Avenue erzählt, erinnerst du dich? Von einem kleinen Jungen, der seine ersten Lebensjahre in einem düsteren Winkel der zivilisierten Welt verbringt.«
»Ich habe dir tatsächlich von diesem Jungen erzählt?«
»Ja, dass er die ersten Jahre in einer Schraubenkiste verbrachte. Er sah kaum Menschen, er hörte nur das Blöken der Schafe draußen auf der Weide.«
»Und er erlernt das Blöken der Schafe.«
»Ja, so hast du es mir erzählt. Er versuchte, dieser skurrilen Welt zu entfliehen, und erschuf sich ein eigenes Paradies: eine Fantasiewelt aus erfundenen Geschichten und Heldenfiguren, ein Boulevard voller realer und fiktiver Figuren. Du hast diesen Ort Script Avenue genannt.«
»Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber ich kann nicht mehr schreiben. Jedes Wort wiegt wie ein Stein, jeder Satz wie ein Berg. Ich habe mein ganzes Leben geschrieben, wer kann schon ewig schreiben?«
»Niemand kann ewig schreiben«, sagte Tim, »weil niemand ewig leben kann. Aber wenn man die Hoffnung aufgibt, stirbt man. Deshalb musst du das Buch der Script Avenue schreiben, vielleicht ist es dein letztes Buch.«
»Du hast mit den Ärzten gesprochen.«
»Du sagtest, es würde ein ehrliches Buch werden. Authentisch. Erinnerst du dich? Aber nicht alle werden es mögen, hast du gesagt.«
»Ja, ich erinnere mich. Wenn ich schreibe, denke ich nicht an den Tod. Wir tun alle irgendetwas, um zu vergessen, dass mit unserer Geburt unser Schicksal bereits besiegelt ist: Wir müssen sterben. Ich werde schreiben, dass man bei der Geburt unverständliches Zeug brabbelt und dass man auch im Sterben unverständliches Zeug brabbelt. Und eigentlich auch dazwischen. Ich werde über ängstliche Kinder schreiben, über onanierende Kids, über Diebe und Lügner, Sieger und Verlierer, Krebskranke und Sterbende, denn eines Tages werden wir all das gewesen sein.«
Tim zog mir die Bettdecke weg.
»Ich werde dir jetzt helfen aufzustehen. Wir werden zusammen zum Fenster rübergehen.«
»Mit all diesen Infusionsständern?«
»Ja, mit all diesen Infusionsständern. Und dann werde ich deinen Laptop anschalten und dir ein neues Dokument laden. Du hast dich nie vor einem weißen Blatt gefürchtet. Du hast immer gleich drauflosgeschrieben. Hemingway sagte: ›Schreib als ersten Satz einen wahren Satz‹, aber du solltest gleich einen Roman schreiben. 10 000 wahre Sätze.«
Ich setzte mich mühsam auf die Bettkante und versuchte, den Schwindel zu ertragen. Gleich würde ich erbrechen, all das Gift, das man mir seit Monaten in die Venen spritzte.
»Lass mir noch ein bisschen Zeit, ich bin schon lange nicht mehr aufgesessen.«
Tim half mir in den Rollstuhl. Ich hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Ich konnte nicht mehr akkommodieren.
»Ich sehe alles wie durch ein Kaleidoskop.«
»Wir werden ein Auge abdecken«, sagte Tim und zog ein Pflaster aus seiner Tasche, »wenn sie dir den Kopf aufbohren und Blut entnehmen, stimmt der Flüssigkeitspegel nicht mehr. Das wird schon wieder.«
Tim deckte mein linkes Auge ab und stellte den Laptop an. »Ich sollte im Jahr 1956 beginnen, aber mir fehlt die Erinnerung.«
»Ich habe dir alle Songs der Sechzigerjahre kopiert. Wenn du die Songs hörst, wirst du dich erinnern.«
Tim schob die Vorhänge beiseite. Unten im Park waren Menschen, die kamen, andere gingen nach Hause. Sie waren schon lange nicht mehr Teil meiner Welt. Ich saß seit Monaten hier oben im fünften Stock der hämatologischen Abteilung der Universitätsklinik und wartete auf den Tod.
»Alle Chemotherapien sind fehlgeschlagen«, sagte ich Tim, »wenn sie die Leukämie besiegen wollen, müssen sie mich töten.«
»Schreib einfach drauflos«, insistierte Tim, »dann wirst du überleben.«
»Ja«, lächelte ich, »das ist sehr clever von dir, ich werde mich in der Script Avenue verstecken. Kein Mensch hat die Script Avenue jemals gesehen. Nur du.«
Tim drückte die Play-Taste. Elvis!
Love Me Tender
»Ich hasse dieses Kind!«, schrie meine Mutter, als ein beinahe fünf Kilo schweres Ungeheuer ihren Unterleib zerriss. Ich hatte mich lange geweigert, geboren zu werden. Aus gutem Grund, würde ich heute sagen. Während Carl Perkins Blue Suede Shoes sang, wurde ich einem Krebsgeschwür entbunden. Meine Mutter hatte die letzte Ölung schon erhalten und blieb nach der Geburt gleich im Spital. Sie verschenkte mich an ihre Schwester Puce, die aussah wie die Frau von Popeye und in Vilaincourt wohnte. Das ist ein sehr kleines Dorf im französischsprachigen Schweizer Jura, das heute wahrscheinlich ausgestorben und von der Landkarte verschwunden ist.
In Vilaincourt lebten Bauern, die gekrümmt wie Rebstöcke mit grimmigen Gesichtern ihre Felder bewirtschafteten. Es gab auch einen Priester, der dafür sorgte, dass alles, was in Vilaincourt geschah, in Vilaincourt blieb. Und es geschah einiges, wenn die Kühe in den Ställen waren und die Nacht anbrach. Außerhalb von Vilaincourt war Feindesland. Kaum ein Fremder hat sich jemals nach Vilaincourt getraut, denn die Dorfbewohner hätten ihn mit ihren Blicken erstarren lassen wie die Basilisken, die in grauer Vorzeit die ersten Städte bewachten. Auf der Anhöhe hinter dem Tal stand ein schlossähnliches Gebäude. Hier thronte die Familie Tinville, die angeblich seit Jahrhunderten dieses Gebiet beherrschte. Die Bauern kamen auf den Berg, um die Ernte ihrer Tabakfelder zu verkaufen, denn hinter dem Schloss verbarg sich nichts anderes als eine Zigarettenfabrik. In Vilaincourt hat keiner jemals einen aus der Familie der Tinvilles gesehen.
In diesem düsteren Tal wehte noch der Rauch der letzten Hexenverbrennungen über die Höfe und Ställe. Die Kühe in Vilaincourt waren so schmutzig, als hätten die Bauern in einem geheimen Abkommen beschlossen, ihre Ställe nie auszumisten. Der Kot von Wochen war großflächig am Fell der Kühe eingetrocknet und ließ sie wie gepanzerte Tiere aussehen, wie schwarzweiß gefleckte Rhinozerosse.
Ein paar Wochen nach meiner Geburt wartete mein Onkel Maurice mit seinem schwarzen Motorrad mit Seitenwagen am Bahnhof von Porrentruy auf meine Ankunft. Das Gefährt hatte er zuvor auf dem Waffenplatz in Bulle gestohlen, aber daraus machten die tiefgläubigen Menschen von Vilaincourt keine große Geschichte. Das taten sie nur, wenn sie selber bestohlen wurden.
Onkel Maurice legte mich in den Seitenwagen. Er war so grob. Ich stieß mir den Kopf an und begann aus voller Kehle zu schreien. »Halt die Klappe, du kleiner Scheißer!«, schrie er mit rauchiger Stimme und holperte über die trockenen Feldwege nach Vilaincourt. Ich bin in der Staubwolke beinahe erstickt, aber Onkel Maurice saß ungerührt mit zusammengekniffenen Augen über sein Motorrad gebeugt und fluchte.
Onkel Maurice war kein Bauer, sondern ein Patron. So sah er sich jedenfalls. Nachdem alle seine Kühe an einer mysteriösen Infektion verendet waren, hatte er den Stall in eine kleine Fabrik umgebaut. Hier setzten wortkarge Arbeiter mit Tunnelblick Uhrwerke für eine Fabrik am Neuenburgersee zusammen. Es waren griesgrämige Leute, die sich stolz Bauern nannten, obwohl in ihren Ställen höchstens noch eine halbe Sau von der Decke hing und in der Scheune ein paar Äpfel lagen, die aussahen wie Robert Redford in seinem letzten Film.
Auch Tante Puce arbeitete in dieser »Fabrik«. Da Onkel Maurice ihr verbat, sich tagsüber um mich zu kümmern, legten sie mich in eine Holzkiste, die auf einer Werkbank neben dem Plumpsklo lag. So verbrachte ich meine ersten Lebensjahre in einer Schraubenkiste. Das klingt hart, aber die Kiste war mit einer grauen Militärdecke ausgepolstert und angenehm weich. Ich war auch nie allein. Ich meine jetzt nicht in der Kiste, sondern allgemein. Wenn einer aufs Klo musste, kam er unweigerlich an mir vorbei und strich mir mit ölverschmierten Fingern übers Gesicht. Hatte er sich erleichtert, passierte er erneut meine Kiste und strich mir einige Kolibakterien über die andere Wange. Diese Leute hatten noch nie etwas von Robert Koch oder Louis Pasteur gelesen. Auf jeden Fall war dies der Grundstein für eine solide Immunabwehr.
Mein einziger Lichtblick war ein verschmutztes Fenster, das teilweise die Sicht auf eine kleine Schafweide freigab, eigentlich ein idealer Ort, um günstig einen Film über das finsterste Mittelalter zu drehen. Aber wie sollte die Crew jemals Vilaincourt finden?
Die Schafe haben mich geprägt. Selbst ein halbes Jahrhundert später, als ich im Koma lag, erinnerte ich mich an sie. Wenn ich heute Schafe sehe, fühle ich einen Kloß im Hals und versuche, ein Mann zu sein. Mein Onkel Maurice hatte es auch mit den Schafen. Wenn alle Arbeiter den Stall, oder von mir aus die Fabrik, verlassen hatten, ging Onkel Maurice zu seinen Schafen. Die Tiere mochten ihn nicht, Schafe spüren, wenn sich ein Dreckskerl nähert. Onkel Maurice stellte sich hinter ein Schaf und hielt es an den Lenden fest. Wenn das Schaf ruhig war, ließ er zu meiner großen Verblüffung seine Hose fallen und ich sah seinen nackten, affenmäßig behaarten Hintern. Er vollführte dann rhythmische Bewegungen, ich dachte, dass er das Schaf molk, denn abends, wenn er in die Küche kam, brachte er stets Milch mit. So entsteht Intelligenz. Man beobachtet etwas, bringt es in Zusammenhang mit einer anderen Beobachtung und lernt. Heureka! Das ist der Grundstein der Evolution. Aber richtig verwirrend war, wenn mein Onkel Maurice abends meine zerbrechliche Tante Puce molk. Er packte sie am Nacken wie seine Schafe und drückte sie über den Küchentisch. Dann ließ er seine Hose runter und führte wieder seine rhythmischen Bewegungen aus. Er war zu dumm, um auch nur zu ahnen, dass ich es nicht vergessen würde. Irgendwie hielt er mich immer noch für einen seelenlosen Embryo. Aber ich vergaß nichts. Ich hatte von klein auf ein Gedächtnis wie ein Elefant. Beneiden Sie mich nicht darum, und lesen Sie weiter.
»Frau! Suppe!«, schrie Onkel Maurice, wenn er Tante Puce gemolken hatte, und zündete sich eine filterlose Gitane Bleue an, die mit dem gelben Maispapier. Im Nachhinein würde ich gern erfahren, wieso die nette Tante Puce diesen Typen geheiratet hat. Wahrscheinlich das mangelnde Angebot. Alle meine zwölf Tanten und Onkel wohnten in Vilaincourt. Außer mein Onkel Arthur. Er war die Nummer dreizehn. Er war nie da. Wo er war? Keine Ahnung. Man durfte seinen Namen nicht erwähnen, geschweige denn nach ihm fragen, aber ich hörte, er würde eines Tages zurückkommen, dann würde ich ihn kennen lernen. Wohl oder übel, fügten einige bekümmert hinzu.
Onkel Maurice ärgerte sich jede Nacht über meine Husten- und Erstickungsanfälle, und Tante Puce versuchte ihm zu erklären, dass es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen Gitanes Bleues und meinem hochroten Kopf gäbe. Doch Onkel Maurice war das egal. Er brüllte sie in Grund und Boden, zündete sich die nächste Kippe an. Wenigstens musste auch er husten. Jahre später machte ich mir Sorgen, dass ich wegen der schlechten Luft in meiner frühen Kindheit an Lungenkrebs sterben könnte. Heute weiß ich, dass ich an etwas anderem sterben werde. Ich machte mir später auch Sorgen, ich könnte an Krebs erkranken, weil ich einem Krebsgeschwür entsprungen war. Aber wie das so ist mit den Sorgen: Die meisten Szenarien treten nie ein. Ich glaube, das ist von Dale Carnegie. Sorge dich nicht, lebe! heißt sein Bestseller. Er ist damit Multimillionär geworden. Ich hatte das später auch im Sinn, aber von der Schraubenkiste zum Millionär war es natürlich ein weiter Weg. Deshalb hat dieses Buch so viele Seiten.
Es grenzt an ein Wunder, dass ich die Sprache der Menschen erlernte, denn in Vilaincourt sprach niemand mit mir. Irgendwann übernahm ich das Blöken der Schafe. Anfangs fanden die Leute in der Fabrik das lustig, doch mit der Zeit nervte dieses repetitive Blöken, und sie bedeckten mich mit alten Zeitungen. Mütterliche Zuwendung soll sich ja auf die Chemie des limbischen Systems auswirken. Babys, die Mutterliebe erfahren, sollen später weniger ängstlich sein. Das hat man in Mäuseexperimenten festgestellt. Ich war zwar keine Maus, aber nach zwei Jahren Schraubenkiste und Mutterentzug in permanenter Panik. Alle Ampeln auf Rot. Bereit zum letzten Gefecht. Fluchtwege prüfen. Mayday, Mayday.
Eine einsame Kassiererin, die mich während ihrer Mittagspause im Getränkelager verführt hatte, sagte mir später, dass die ersten Lebensjahre prägend seien für die spätere Stabilität der Psyche, für das Urvertrauen, für ein angstfreies Leben. Eine plausible Erklärung, aber nicht wirklich hilfreich. Ich beharrte darauf: Wasser ist sehr gefährlich, darin kann man ertrinken. Später erfuhr ich von der Wasserfolter der Amerikaner. Mein Mitgefühl für die Opfer kannte keine Grenzen. Natürlich wurde ich ausgelacht. Das simulierte Ertrinken, die weiße Folter, ist so alt wie die Menschheit und wie die meisten grausamen Foltermethoden von der katholischen Kirche erfunden worden. Die Spanier wendeten sie bereits im 16. Jahrhundert auf den Philippinen an. Auch im Algerienkrieg war diese Folter Standard. Ich erwähne diese beiden Länder nur deshalb, weil sie in diesem Buch noch eine gewaltige Rolle spielen werden. Das ist wichtig in der Dramaturgie. Wenn Sie später etwas ernten wollen, müssen Sie es vorher gesät haben. Wenn jemand am Ende eines Films auf der Flucht ist und nur der schwarze Citroën am Ende der Straße könnte ihn retten, dann müssen Sie am Anfang der Story beiläufig platziert haben, dass er nicht Auto fahren kann. Ich sagte beiläufig!
Wir waren beim Waterboarding. Ich erlebte das später am eigenen Leib. Aber unter Narkose. Lungenwaschung. Lachen Sie ruhig. Furchtlosigkeit ist eine Form der Fantasielosigkeit. Später hatte ich auch große Angst vor Riesenrädern, Monsterschaukeln und all diesen masochistischen Jahrmarktsattraktionen. Bei diesen Geschwindigkeiten kann sich leicht eine Kabine oder ein Sitz lösen, und man landet abseits des Messerummels in einer Dönerbude. Man muss sich nur mal die Schrauben anschauen, die Kabinen und Sitze zusammenhalten. Ich habe ja Erfahrung mit Schrauben. Auch Fräsmaschinen halte ich für Folterwerkzeuge. Die wurden in der Fabrik von Onkel Maurice zehn Stunden am Tag benutzt. Ich hörte das Geräusch zwei Jahre lang.
Ich erinnerte mich daran, als ich zum ersten Mal beim Zahnarzt war. Ich will nicht auf die Details eingehen, aber nach einer Stunde schrie er, er würde alle Patienten verlieren, wenn ich nicht sofort verschwände. Aber ich hatte aus gutem Grund um Hilfe geschrien und ihn in den Unterleib getreten. Zähne sind Trojaner! Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Magellan, der große Seefahrer, hat 1521 wegen Zahnwurzelentzündungen und Skorbut viele Matrosen verloren. Aber für einen promovierten Hypochonder besteht der menschliche Körper nicht nur aus Zähnen. Es gibt auch Darmverschlüsse, Schrumpfpenisse, Herzattacken, frühzeitige Ejakulation, Magenkrebs, nicht enden wollender Schluckauf (der Rekord liegt bei vierzehn Jahren), Blutvergiftungen und plötzlicher Herztod. In Tokio gestand mir Jahrzehnte später ein Sushi-Koch, dass sich sein Penis über Nacht in den Unterbauch zurückgezogen habe und seitdem spurlos verschwunden sei. All diese Ängste kann man nur mit einem prophylaktischen Selbstmord ausmerzen. Aber selbst vor dem Selbstmord hatte ich Angst. Ich denke, wenn einem alles misslingt im Leben, sollte wenigstens der Selbstmord gelingen. Aber so einfach ist es nicht. Das Leben kennt keine Gerechtigkeit, keine Logik. Man kann nachträglich eine Logik konstruieren; das wäre so, als würde man rückblickend einen Börsencrash erklären.
Hätte mir der Glaube an irgendetwas Göttliches geholfen? Wer zwei Jahre im Qualm der Gitanes Bleues in einer Schraubenkiste verbringt, hält Gott eh für einen Trottel. Wie kann man sich so bescheuerte Lebensbedingungen ausdenken? Als Drehbuchautor hätte Gott keine Chance in Hollywood, und als Brettspiel wäre das menschliche Dasein ein Flop. Kein Mensch würde so etwas spielen. Ich denke, wenn es einen Gott gibt, dann hasst er uns alle. Und wir hassen ihn auch.
Neurotische und ängstliche Menschen haben es schwer im Leben. Nur ein Leben als Schriftsteller gibt ihnen die Möglichkeit, den ganzen Müll zu verarbeiten und artgerecht zu entsorgen. Im Grunde genommen ist jedes Lebenswerk eine Therapie, und wenn es zur Literatur erklärt wird, kann man damit seine Stromrechnung bezahlen. So weit sind wir aber noch lange nicht. Ich verliere mich in Details, das ist ein Problem seit der Schädelperforation. Dann wird ein Subplot zum Hauptplot. Aber noch sind wir im Jahr 1956. Don’t Be Cruel. In den Kinos taucht Jules Vernes 20 000 Meilen unter dem Meer, und Gregory Peck spielt Moby Dick. Hat mir Tim gemailt. 1956 war übrigens der Startschuss für die Frauenemanzipation, kaum zu glauben, oder? Nicht Charlotte Corday war die erste Emanzipierte, nein, die wurde ja während der Französischen Revolution guillotiniert, weil sie irrtümlicherweise angenommen hatte, die Menschenrechte gelten auch für Frauen. Nein, die ersten Frauenrechtler waren Hoover und Volta. Hoover war eine elektrische Waschmaschine mit eingebautem Pulsator in der Seitenwand oder ein Staubsauger, und Volta war ein Dreischeibenblocher, der die Böden sogar reinigen, wachsen und polieren konnte.
Ohne Hoover und Volta hätten die Frauen nie die Zeit gehabt, sich weiterzubilden und ihre Männer in den folgenden Jahrzehnten so abzurichten, dass sie später zu verachtenswerten Pantoffelhelden wurden. Aber in Vilaincourt hielt man wenig von Hoover und Volta. Man wusste hier nichts von den Aufständen in Ungarn, den Phosphorbomben auf Budapest und den französisch-britischen Truppen am Suezkanal. In den Städten trugen Frauen Deux-Pièces, hummerrot, nepalgelb und azurblau. Aber in Vilaincourt hüllten sich die Leute immer noch in die Lumpen, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hatten. Im Radio sangen Tino Rossi, Charles Aznavour, Edith Piaf und Gilbert Bécaud. Doch die einzige Musik, die man in Vilaincourt kannte, waren die Psalme in der Sonntagsmesse und das Furzen der Kühe. Hier bin ich aufgewachsen.
Steine fressen
1958 sang Chuck Berry Johnny B. Goode, die Everly Brothers Bye Bye Love, aber ich gab immer noch blökende Geräusche von mir. Doch meine sprachliche Entwicklung schritt voran. Einige Laute erinnerten nun an grunzende Schweine, gebärende Kühe, brünstige Katzen oder seufzende Appenzeller Hunde. »Dieser Junge wird eine Menge Steine fressen in seinem Leben«, prophezeite eine Kartenlegerin meiner Mutter. Sie haben scharf kombiniert: Meine Mutter ist nach meiner Geburt doch nicht gestorben. Sie konnte das Krankenhaus nach zwei Jahren wieder verlassen und ärgerte sich sehr, dass sie dem Pfarrer dreimal das Honorar für die letzte Ölung bezahlen musste. Aber der Pfarrer meinte, es sei nicht seine Schuld, dass sie dreimal nicht gestorben sei. Sie hätte halt weniger beten sollen.
Mit Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und Gene Vincent setzte der Rock ’n’ Roll seinen Siegeszug fort und begeisterte die jungen Menschen in aller Welt. Die iranische Regierung bezeichnete diesen Musikstil als Bedrohung für die muslimische Seele. Namhafte Wissenschaftler warnten vor den Folgeschäden von exzessivem Hüftschwung. Wollte man als Pubertierender seine Eltern schockieren, musste man nicht kiffen, saufen oder Tankstellen überfallen; es genügte, wenn man grinsend Elvis Presleys erotischen Hüftschwung nachahmte. So viel Bewegungsfreiheit hatte ich in der Schraubenkiste natürlich nicht. Ich atmete Tag für Tag den Qualm der Gitanes Bleues ein und wartete auf den Tod, der irgendwann in siebzig Jahren endlich eintreten würde. Ich konnte es kaum erwarten, diesem erbärmlichen Dasein zu entkommen.
Meine Mutter wollte oder konnte mich nicht zurückholen: Sie war am Leben, aber todkrank. Im Kino lief Die den Tod nicht fürchten mit Charlton Heston und – ist mir entfallen. So was wäre mir vor dem Jahr 2009 nie passiert. Ich war eine organische Version von Wikipedia. Und schneller als ein Intel-Core-17-Prozessor.
Ich wurde zu meiner Großmutter Germaine transferiert, die in Vilaincourt auf dem Bauernhof ihres früh verstorbenen Ehemannes wohnte. Das war wie ein Aufstieg von der dritten Liga in die erste Liga. Hier wurde nicht geraucht, hier wurden weder Schafe noch Tanten gemolken. Hier lernte ich auch das Wiehern der Pferde und die Sprache meiner geliebten Großmutter. Französisch. Es gab nichts Schöneres, als sich an ihre Brust zu kuscheln und in ihrem Bett einzuschlafen. Ich dachte lange, dass meine Großmutter Germaine mit Charlie Chaplin verheiratet gewesen war, denn das Foto auf dem schwarzen Klavier erinnerte verblüffend an den kleinen Mann. Aber im Gegensatz zu Chaplin hatte mein Großvater, den ich nie gekannt habe, ein kurzes Leben. Er wurde von der einzigen Kuh, die er im Stall hatte, in den Unterleib getreten. Aua. So was schreibt man nicht gern. Sie haben ja keine Ahnung, wie stark sich ein Autor mit seinen Geschichten identifiziert. Es gibt Autoren, die beim Schreiben in Tränen ausbrechen oder onanieren. Je nach Abschnitt. Charlie Chaplin onanierte nicht, er verblutete während des Ersten Weltkrieges in seinem Stall.
Großmutter Germaine hatte nun zwölf Kinder zu ernähren. Nein, dreizehn. Onkel Arthur hätte ich beinahe wieder vergessen. Eigentlich erstaunlich, dieser zahlreiche Nachwuchs, denn mein Großvater hat ja nicht so lange gelebt. Aber mathematisch-biologisch geht das in Ordnung. Als ich unter die Fittiche von Großmutter Germaine kam, lebte sie zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Fleur und ihren 24 Katzen im ersten Stock. Neben der Küche war die schwere Tür zur Treppe, die in den gigantischen Dachboden führte. Dort oben sah es aus wie in einem riesigen Trödlerschuppen. Es war alles da, was man auf Flohmärkten und in Antiquitätenläden finden konnte: Tausende von Büchern, Schachteln mit uralten Briefen und Postkarten, Möbel aus vergangenen Zeiten, alte, schwere Schallplatten, stapelweise Kleider aus dem letzten Jahrhundert, auf denen Katzen dösten. Meine Großmutter stellte ihnen jeden Morgen Milchschalen vor die massive Holztür. Damit die Katzen den Dachboden bei Bedarf verlassen konnten, hatte jemand mit einer Axt ein Loch in die Tür geschlagen. Ja, im Schweizer Jura nimmt man selten eine Säge und versucht sich kaum an sauberen, quadratischen Schnitten – im Jura nimmt man eine Axt. Während des Essens sah ich von meinem Schemel aus jeden Mittag, wie eine Katze nach der andern durch die Öffnung schlich, trank und blitzschnell wieder in den Dachboden verschwand. Ab und zu kam ein Weibchen mit seinen Neugeborenen, um sie Großmutter Germaine zu zeigen.
Im Erdgeschoss lebte mein Onkel Louis (der mit der Axt) mit Tante Paulette und ihren acht Kindern. Tja, Sie vermuten richtig, dass es in Vilaincourt weder Versicherungen noch Kondome gab. Acht Kinder waren ungefähr gleichwertig mit einer Vollkasko-Hausrat-Haftpflicht-Lebensversicherung. Ich mochte Onkel Louis nie. Er sah aus wie diese Waldmonster, die zum Frühstück Kinder verspeisen. Ich musste unwillkürlich an ihn denken, als ich Jahrzehnte später im Britischen Museum in London das naturalistische Modell eines Neandertalers sah.
Oder haben Sie kürzlich The Walking Dead gesehen? Onkel Louis’ Schritt hatte etwas Bedrohliches. Er machte immer den Eindruck, als würde er gleich die Beherrschung verlieren und Amok laufen. In ihm tobte das keltische Blut unserer Vorfahren, er verwechselte das Hinterteil eines jeden Tieres mit einem Fußball. Jurassier und ihre Hunde, das ist kein schönes Kapitel. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, sonst kriegt das Buch noch einen Kleber: Ab 18 Jahren. Man muss ja Tiere nicht wie heute antiautoritär erziehen, aber man ersäuft auch nicht gleich einen Hund, wenn er das Französisch eines stockbesoffenen Jurassiers nicht versteht. Die Pädagogik wurde also nicht von einem Jurassier erfunden. Vielleicht aber die Axt.
Die Kinder meines Onkels Louis waren sehr nett. Mit seinen sechs Jungs spielte ich Fußball, vor allem mit Guy, dem ältesten, der ein Jahr jünger war als ich. Wie alle seine Brüder war Guy einem permanenten Druck ausgesetzt. Man erkannte meine Cousins von weitem an der optimalen Durchblutung der roten Backen: Onkel Louis ohrfeigte seine Kinder, wie andere Guten Tag sagten.
Da er die fixe Idee hatte, von einem General Napoleons abzustammen, erwartete Onkel Louis, dass seine Kinder mindestens ein Viertel des Guinness-Buch der Rekorde füllen. Er sprach von sich oft in der dritten Person und prahlte jeden Tag lautstark mit irgendwelchen überragenden Leistungen, die jemand aus seiner Sippe vollbracht hatte. »Wir, die XXX…« Hier hatte ich einen Nachnamen, aber Tim hat mir die Streichung empfohlen. Übrigens, jetzt fällt es mir ein: Es war Gary Cooper, der zusammen mit Charlton Heston den Tod nicht fürchtete. Im gleichen Jahr wurde auch die Brücke am Kwai gebaut. Ich habe später alle Filme gesehen, die jemals gedreht wurden, einfach alles, vom anspruchsvollen japanischen Experimentalfilm bis hin zum Spaghetti-Western. Die japanischen Experimentalfilme waren natürlich Sexfilme für europäische Intellektuelle. Kennen Sie Kaneto Shindo? Sehen Sie, ich habs nicht vergessen. Der drehte 1964 Onibaba. Sexfilme habe ich mir nie angeschaut. Die hatten keine Story. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich nicht ins Kino getraute. Kommt der Sache wahrscheinlich etwas näher. Manchmal stehe ich am Morgen auf und nehme mir vor, den ganzen Tag über ehrlich zu sein. Heute ist so ein Tag. Erwarten Sie also keine Political Correctness, weiterlesen auf eigene Gefahr. Und schreiben Sie keine bösen Mails.
Aber wir waren bei Großmutter Germaine. Obwohl sie nie Rock ’n’ Roll getanzt hatte, war ihre linke Hüfte schief und kaputt, als hätte ihr Onkel Louis einen Axthieb verpasst. Sie beklagte sich nie. Sie spielte mit mir Karten, mogelte ohne Talent und lehrte mich, dass Mogeln auch für tiefgläubige Katholiken rechtens sei. In Vilaincourt war Mogeln Bestandteil der dörflichen Kultur. Man mogelte beim Kartenspiel, im Gespräch, in der Erinnerung, bei der Steuererklärung und wenn man wertlose Antiquitäten im Heuwagen über die Grenze fuhr. Kurz: Das ganze Leben in Mogelei war Vilaincourt. Ich meine: Das ganze Leben in Vilaincourt war Mogelei. Das ist eine der zahlreichen Nebenwirkungen meiner Zehnuhrfünfzehn-Pillen. Habs auf dem Beipackzettel gelesen.
Meine Großmutter kochte wunderbare Frikadellen mit knusprig-krustigen Bratkartoffeln in einer gewaltigen gusseisernen Pfanne, machte geniale Aprikosenkonfitüre, und ich leerte im Gegenzug zweimal täglich ihren punkigen Nachttopf, der farblich an Lady Gagas Blue Dress erinnerte. Wenn Großmutter vergaß, ihre Pillenkollektion einzuwerfen, erkannte ich es an der Farbe ihres Urins. Nur marineblau war der echte.
Großmutter Germaine war die Einzige in Vilaincourt, die einen Fernseher hatte. Wenn der Papst auf der Mattscheibe ihres klobigen Schwarz-Weiß-Philips’ erschien, kniete sie nieder. Damals vertrat Johannes XXIII. den lieben Gott. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Pius XII. liebte er nicht die Nazis, sondern Schweinebraten an einer kräftigen Bordeaux-Sauce. Er war durchaus beliebt, weil ihm seine Körperfülle etwas Gutmütiges, ja Väterliches verlieh. Sobald der Papst den Segen sprach, kamen auch Guy und seine Geschwister in den oberen Stock. Wir knieten alle zusammen auf dem abgewetzten Teppich nieder, der nach abgestandener Katzenpisse stank, und machten uns lustig über den dicken Papst in Frauenkleidern. Wir warteten sehnsüchtig auf den Segen, weil anschließend Rin Tin Tin ausgestrahlt wurde. Das war die allererste amerikanische TV-Serie, die zu uns kam. The Adventures of Rin Tin Tin. Vor dem Hintergrund der Indianerkriege des 19. Jahrhunderts erleben der kleine Waisenjunge Rusty und sein Schäferhund Rin Tin Tin, die in Fort Apache in Arizona bei der 101. Kavallerie leben, ein Abenteuer nach dem andern. Lieutenant »Rip« Masters ist Rustys Held, der trottelige Sergeant Biff O’Hara sein Freund. Die Figur O’Hara finden Sie in Tausenden von TV-Serien und Spielfilmen: Sie ist immer dick, etwas dümmlich, aber treu bis in den Tod. Ich war auch so, aber holzmager. Ohne den Erfolg der 164 Rin-Tin-Tin-Episoden wäre Warner Brothers damals bankrottgegangen.
Mein Cousin Guy und seine Geschwister warteten also sehnsüchtig, dass der Gourmet-Papst erste Ermüdungserscheinungen zeigte und die Trompeten der 101. Kavallerie erklangen. Damals liebte man die Amerikaner noch. Sie hatten uns von Hitler befreit, und jetzt hingen wir zitternd am Rockzipfel Amerikas und blinzelten ängstlich nach Osten. Wir wollten alle Amerikaner sein. Nur John F. Kennedy wollte ein Berliner sein. Die Syphilis kennt viele Frühformen.
Großmutter Germaine erlaubte uns also Rin Tin Tin. Dass die hübschen blauen Armeehosen mit den gelben Streifen nur in Schwarz-Weiß zu sehen waren, fiel uns gar nicht auf. Sehen Sie? Ohne Vergleichsmöglichkeiten können Sie weder glücklich noch unglücklich werden. Deshalb sind historische Romane nicht nutzlos! Sie ermöglichen uns, die Epochen miteinander zu vergleichen, die Gegenwart einzuordnen und zu verstehen. Und sie zu schätzen! Historische Romane machen glücklich.
Nach Rin Tin Tin folgte die Mittagsbörse, die mit einem Jingle eröffnet wurde. Die Melodie riss Großmutter aus dem Halbschlaf. Wie von der Tarantel gestochen, humpelte sie trotz schwerer Hüftarthrose zum Fernseher und stellte ihn ab. Hat Sie das jetzt irritiert? Fernbedienung gab es noch nicht, das Wort »zappen« war noch nicht erfunden – dafür gab es schlicht zu wenige Programme. Noch keine Vielfalt der Einfalt. Meine Großmutter behauptete stets, die Menschen würden in dieser Börsensendung ihr Geld verlieren und sich umbringen. Ich muss gestehen, ich hätte das ganz gern gesehen, wie die Leute Harakiri machen oder sich in der Badewanne ersäufen. Selbstmord war ja in den Fünfzigerjahren noch nicht sehr populär. Er wurde praktiziert, aber nicht so wie heute. Und schon gar nicht live. Heute wird der Suizid auf Facebook angekündigt, die Ausführung kann man sich auf Youtube anschauen, Todesanzeige auf Twitter: Löffel abgegeben. Aber damals wartete man noch allein am Gleis 1 auf den Schnellzug aus Porrentruy. Wenigstens waren die Züge noch pünktlich. Ich dachte später regelmäßig an Selbstmord. Siehe frühkindliche Prägung. Auch jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, denke ich immer wieder an Suizid. Aber dann nehme ich mir vor, noch ein paar Seiten zu schreiben. Ich bin der Sklave der Script Avenue. Das ist keine Koketterie. Das ist mein Schicksal.
Ich sah heute früh um drei die DVDs, die mir Tim letzte Woche mitgebracht hat. Sorgfältig desinfiziert. Asterix & Obelix mit dem französischen Topmodel Laetitia Casta. Ich dachte, besser Laetitias Busen gucken als mit dem Tod feilschen. Laetitia Casta erinnerte mich an Tante Fleur. Sie war nicht nur schön, sie war die schönste von allen meinen Tanten. Sie war die Marilyn Monroe von Vilaincourt. An Weihnachten machte sie für die Kinder eine Bûche de Noël. Als die Knochenschmerzen unerträglich wurden, klingelte ich und verlangte nach mehr Morphium. Doch als die Pflegefachfrau ins Zimmer kam und nach meinem Wunsch fragte, sagte ich: »Die Bûche de Noël von Laetitia Casta.« Die Schwester legte mir eine Infusion für einen weiteren Cocktail. Das ist ein Mix aus Schmerzmitteln, der verhindert, dass man die 23-Uhr-Infusion herauskotzt. Ich liebe diese Cocktails!
Der hagere Blonde im hellblauen Hemd
Ich landete sanft wie eine Daunenfeder auf dem Boden der Script Avenue. Tante Fleur kniete zu mir nieder und reichte mir eine dicke Scheibe ihrer Bûche de Noël. Egal wo Sie diese Patisserie essen, Sie schmeckt immer hervorragend. Auch in der Script Avenue. Tante Fleur war für uns die große Welt, wie heute New York, Hongkong oder Schanghai. Sie hatte Vilaincourt in ihrem Leben zwar nur einmal verlassen, um die Ostermesse in Rom zu besuchen, aber sie hörte französische Schlager und sang dabei fröhlich mit. Ich höre jetzt noch Poupée de cire, poupée de son von France Gall. Damit gewann diese übrigens 1965 den Eurovision Song Contest. Stopp. Sorry, das ist gar nicht möglich. Vielleicht war es doch ein Song von Sœur Sourire, dieser singenden Nonne, die angeblich nie Sex hatte. Ne me quitte pas von Jacques Brel kam auch viel später. Vielleicht Edith Piaf? Oh, jetzt fällt es mir ein: Es muss Edith Piaf gewesen sein. Ja, meine Tante Fleur sang Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien … Ich erinnere mich noch an jede Textzeile. Ich könnte gleich lossingen. Aber die Luft meiner Lunge reicht nicht mehr für einen Song. Und inhaltlich betrachtet, gibt es da schon das eine oder andere, das ich bereue. Ich denke, Frank Sinatra macht sich was vor, wenn er My Way singt und meint, es gebe nichts Bedeutendes, das er bereue. Die Jugend kennt keine Reue, denn sie hat noch Zeit zum Umsteigen. Die Reue kommt, wenn es definitiv zu spät ist. Ich denke, das ist die wahre Hölle und nicht die Geisterbahn der katholischen Kirche.
Zurück nach Vilaincourt. Als man mir sagte, dass ein hagerer Blonder käme, um mich abzuholen, hätte ich fliehen sollen. Aber ich wusste nicht, dass es ein Mann war, der von mir verlangte, dass ich ihn Vater nenne. Tim meint, es sei jetzt Zeit, etwas über meinen Vater zu schreiben.
Muss das sein? Darf denn Schreiben nicht auch Spaß machen? Was wollen Sie wissen? Ich weiß eigentlich nichts über meinen Vater. Für mich war er stets der hagere Blonde im hellblauen Hemd mit dem abwesenden Blick. Wenn er sprach, meinte er es nicht so. Sein Lächeln hatte etwas Heuchlerisches, vielleicht sogar Teuflisches. Ich hatte stets Angst vor seinen Händen. Seine Geschwister habe ich nur einmal gesehen. Als deren Vater starb. Der hagere Blonde stellte mich den Geschwistern als seinen Sohn vor. Daraus schloss ich, dass er wahrscheinlich mein Vater und der Tote mein Großvater war. Ich starrte in den Sarg und sah ein kleines Wurzelmännchen, das etwas verloren in diesem großen Sarg lag und an eine nicht vollendete Waldskulptur erinnerte.
Ein Mann, der behauptete, mein Onkel Moritz zu sein, erzählte mir leise die Geschichte ihrer Sippe. Sie stammten aus dem hohen Norden. Sie seien marodierende Waldarbeiter gewesen, die das schwedische Heer begleitet hatten und schließlich irgendwo zwischen Elsass und Süddeutschland desertiert waren. Im 17. Jahrhundert, erzählte er, hätten in der Gegend von Baden-Baden an einem einzigen Tag 1440 schwedische Waldarbeiter um Brot gebettelt. Eine riesige Hungersnot habe die Menschen dahingerafft, viele Dörfer seien verödet, Wolfsrudel drangen in die abgefackelten Bauernhöfe ein, die Deserteure mordeten und vergewaltigten, was überlebt hatte. Die Not war so groß, dass die Überlebenden Pferde, Hunde, Katzen, Mäuse und Ratten verspeisten. Aus Eichenrinde buken sie Brot, fraßen wie Vieh das Gras von den Feldern und aßen sogar Leichen und stinkendes Aas. Mein Agent hat das alles gestrichen. Das ist kein historischer Roman, hat er an den Rand geschrieben. Ausrufezeichen. Und Tim hat am anderen Rand kommentiert: Hör nicht auf deinen Agenten! Für die Kreativität sind demokratische Meinungsfindungen aktive Sterbehilfe. Aber zurück zu den Zuständen im 17. Jahrhundert. Die Schilderung veranschaulicht, wie gut wir es heute haben, trotz allen Unkenrufen, wonach alles schlechter wird und der Weltuntergang kurz bevorsteht. Nein, nein, alles wird besser. Nur bei mir wird alles schlechter. Collateral Damage.
Der hagere Blonde im hellblauen Hemd stammte also von marodierenden schwedischen Waldarbeitern ab. Seine Vorfahren blieben in einem kleinen Dorf hängen und schwängerten einander, bis sie auf Schweizer Boden eine neue Sippe ausgebrütet hatten. Genauer gesagt im kleinen bernischen Dorf Ederswiler, das heute kaum noch hundert Einwohner hat und an das französischsprachige Schweizer Dorf Movelier angrenzt. Beide Dörfer gehörten zwar zum gleichen Kanton Bern, damals, aber beide pflegten ihre eigene Sprache und ihre eigenen Vorurteile und Feindschaften. Hier hätte man durchaus eine nette Romeo-und-Julia-Geschichte ansiedeln können, aber mein Agent, ja der redet jetzt auch noch drein, also mein Agent sagt, für einen Schweizer Roman sei der Markt viel zu klein. Sind Sie der Meinung, Romeo und Julia wäre dann ein Schweizer Roman? Das ist doch eine herzzerreißende Liebesgeschichte zwischen zwei verfeindeten Sippen. Könnte auch in Afrika spielen zwischen den Stämmen der Samburu und Turkana oder in der Türkei oder in der arabischen Welt. Aber es ist wohl einfacher, einen Weihnachtsbaum durch ein Nadelöhr zu fädeln, als einem Agenten zu widersprechen. Er hat übrigens auch schon angedeutet, dass Script Avenue ein Schweizer Roman sei. Ich werde das jetzt nicht kommentieren, denn vielleicht liest er auch noch diese letzte Fassung. Es ist kein Schweizer Roman. Es geht um Themen, die seit über 10 000 Jahren die Menschen beschäftigen. Liebe, Leidenschaft, Freundschaft, Verlust … Du verlierst den Plot, schreibt mein Agent hier an den Rand. Hört denn diese Nörgelei nicht mehr auf? Stop it, schreibt mein Agent jetzt mit roter Farbe, oder such dir einen neuen Agenten. Dafür reicht meine Zeit nicht mehr. Notfalls muss ich es mit Selfpublishing versuchen.
Tim besteht darauf, dass ich kurz erläuterte, wie meine Mutter auf den hageren Blonden im hellblauen Hemd hereinfiel. Am Anfang war eine Zigarette. Eine Zigarette, die fehlte. Mein nikotinsüchtiger Vater musste wohl oder übel die Sprachgrenze überschreiten und zum kleinen Laden im Nachbardorf laufen. Dort arbeitete meine Mutter aushilfsweise im Verkauf. Das war für ein Mädchen aus Vilaincourt bereits das große Ausland. Damals gabs tatsächlich noch Verkäuferinnen, heute sind es ja Kassiererinnen, und bald gibts nur noch das Selbstscanning. Aber damals war der Kunde noch König. Mein Vater bat in gebrochenem Französisch um Zigaretten, meine Mutter sah seine schönen blauen Augen und das flächendeckende blonde Moos an seinen Wangen und suchte vergebens nach deutschen Worten. Die beiden lächelten sich verlegen an. Draußen spielten Kinder auf der Straße. Mein Vater kaufte spontan 25 Cailler-Branches und verteilte sie draußen an die Kinder. Meine Mutter beobachte ihn hinter dem Schaufenster und fand Gefallen an diesem netten Blonden, der zwar eine schreckliche französische Aussprache hatte, aber ein Herz für Kinder. Er kam in den Laden zurück, um Ovationen entgegenzunehmen. Eigentlich wäre die Sprachbarriere die Chance gewesen, diese Beziehung mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Aber meine Mutter schenkte ihm diskret eine weitere Zigarettenpackung. Sie stahl für diesen hageren Blonden, den sie gar nicht kannte.
Ich weiß nicht, ob das der Grund war, weshalb ihr mein Vater wenig später einen Heiratsantrag machte. Aber auf jeden Fall waren Mary-Long-Zigaretten der Auslöser. Die in der gelben Packung, die roten kamen erst Ende der Siebzigerjahre. Entgegen anderslautenden Gerüchten wusste also meine Frau von Anfang an, dass er ein süchtiger Raucher war. Nicht meine Frau, meine Mutter natürlich. Das sind keine freudschen Versprecher, das war jetzt die Viertelnachneun-Pille. Sind wir jetzt fertig?, schreibt mein Agent an den Rand. Beende endlich dieses Jahr! Dieses »forward shadowing« macht die Leute irre. Ist das so?
Okay, bin gleich so weit. Im deutschen Fernsehen wurde der allererste Werbespot ausgestrahlt, Persil. Dann wurden die Sauberkeitsneurotiker Clementine und Meister Proper zu Werbe-Ikonen. Nach dem Krieg entwickelten die Leute in den zerbombten Städten einen Putzfimmel. Da Vilaincourt während des Zweiten Weltkrieges von Bomben verschont geblieben war, pissten hier die Katzen immer noch auf den Teppich, und die Bauernhöfe verlotterten auch ohne Bombeneinschlag. Der Trend zur Hygiene verfehlte also Vilaincourt.
Auch in der Politik waren Säuberungen im Trend. Nikita Chruschtschow kam endlich zum Schluss, dass Stalin infolge einer Leseschwäche Marx falsch interpretiert und deshalb sechs Millionen Landsleute getötet hatte. Mit dem Parteitag der KPdSU – das ist nicht die Bezeichnung für das neue iPad, sondern die damalige Abkürzung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion – wurde die Entstalinisierung eingeleitet. Ein Ereignis hätte ich beinahe vergessen. Die erste Ausgabe der Bild am Sonntag ging in Druck. Sie war ein Riesenerfolg. Dank der großen Buchstaben. Im Alter nimmt die Sehkraft ab. Unter anderem. Endlich konnten die Menschen dank Bild am Sonntag erfahren, wie ein Rasenmäher einen Baron in seinem Schlosspark kastriert hatte oder wie man in naher Zukunft aus einem verfaulten Zahn John Lennon klonen konnte.
Ein Geheimnis blieb: wieso Jugendliche immer zahlreicher das Streben ihrer kriegsmüden Eltern nach Wohlstand ablehnten. Sie begeisterten sich für Musik, Tanz und Kino und verehrten James Dean und Bill Haley, Rock Around the Clock und so. Tja, und Elvis schwang seine Hüften und fauchte Hound Dog. Und ich schwöre, er hatte, im Gegensatz zu meiner Großmutter Germaine, immer noch keine Hüftarthrose.
Kurze Unterbrechung
Ich musste einige Wochen mit dem Schreiben aufhören, aber ich denke, ich kann jetzt weitermachen. Ich mag Ihnen die Gründe an dieser Stelle auch nicht lang und breit erklären. Ich muss mich auf den Hauptplot konzentrieren! Außerdem würde meine Erklärung wenig glaubhaft klingen.
In einem Film könnte man die Story der Script Avenue unmöglich so erzählen. Ich kenne mich aus mit Filmen. Ich habe später damit mein Geld verdient. Und ich erwähnte ja schon. Meine Geschichte ist wahr, aber nicht glaubwürdig.
Only the Lonely
1960 nahmen mich meine Eltern wieder zurück. Ich war gerade mal vier Jahre alt, im Radio sang Wanda Jackson Let’s Have a Party, und Elvis Presley fragte Are You Lonesome Tonight? In den Kinos gab es Frühstück bei Tiffany und die Meuterei auf der Bounty. Das Auto wurde zum Statussymbol. Albert Camus starb im Auto. Der Ford Taunus 17M, ein Straßenkreuzer nach amerikanischem Designvorbild, »die Badewanne« genannt, eroberte die Welt. Mein Vater hatte nicht mal ein Fahrrad. Wir wohnten in einer merkwürdig kleinen und düsteren Wohnung, die an das Hinterzimmer einer Sakristei erinnerte. Überall hingen Kreuze, Jesus- und Marienbilder. Auf einem Bild durchbohrte ein geflügelter Ritter mit seiner Lanze ein feuerrotes, gehörntes Viech, halb Mensch, halb Bock. Der Ort machte mir von Anfang an Angst, weil er stets finster und bedrohlich war. Meine Mutter lag Tag und Nacht regungslos im Bett und kündigte ihren baldigen Tod an. Ich trug damals Mädchenkleider, die mein Vater auf dem Weihnachtsmarkt der Zeugen Jehovas erstanden hatte. Ich kauerte als vierjähriger Transvestit im Flur und lauerte auf irgendeine Bewegung unter der Bettdecke meiner Mutter. Ab und zu schielte ich ängstlich zu den Heiligen, die mich von den Wänden herab beobachteten, bedrohten. Ich wusste nie so genau, ob meine Mutter schon tot war oder bald sterben würde. Sie nannte mich »Sammy«. Daraus schloss ich messerscharf, dass »Sammy« mein Name war. Samuel war ein lächerlicher Name. Er erinnerte an säuerlich riechende Methusalems mit langen Bärten und erhobenem Warnfinger.
»Ich wollte dich eigentlich Petrus nennen«, murmelte meine Mutter einmal im Fieber, »wie der Apostel Petrus. Petrus bedeutet der Stein. Und Gott sprach zu Petrus: ›Auf diesem Stein werde ich meine Kirche bauen.‹ Aber dein Vater war dagegen. Wir haben uns schließlich auf Samuel geeinigt. Der heilige Samuel wurde von seiner Mutter dem lieben Gott geweiht, der Priester Eli erzog ihn, und Gott ernannte ihn zum Propheten.«
Solche Dinge erzählte sie, wenn sie halb wach war. Bis ihr die Luft ausging. Dann machte sie komische Faxen, und ich holte ihr rasch einen Apfel aus der Küche. Wenn ich zurückkam, war sie wieder eingeschlafen. Ich setzte mich ans Bettende und aß den Apfel. Ich hatte kein Wort verstanden. Sie hätte mir auch die Zutaten von Ovomaltine vorlesen können. Es wäre ohne Zweifel auch beruhigend gewesen, aber genauso unverständlich. Vielleicht war das Fieber gestiegen. Vielleicht war sie lautlos gestorben. Ich wusste es nie. Ich wusste nicht, wie tot man war, wenn man tot war.
Ich fühlte mich so verloren und einsam auf dieser Bettkante mit meinem halben Apfel und all den Heiligen, die mich beobachteten. Manchmal weinte ich, aber sehr leise, weil ich meine Mutter nicht aufwecken wollte. Falls sie noch nicht tot war. Manchmal trank ich die Weihwasserschale neben der Tür leer, denn meine Mutter sagte, dieses Wasser würde heilen. Ich starrte den massiven Kleiderkasten an und dachte, dass ich diesen Kasten und das Bett und alles andere hier zurücklassen würde, falls sie starb. Ich würde nach draußen gehen und eine Landstraße entlanglaufen, bis ich tot umfiel. Ich legte mich neben meine Mutter und knabberte an meinem Apfel. Seit sie diese Medikamente nahm, war sie sehr lichtempfindlich, schwitzte stark, und ihr Körper roch wie eine verrostete Dachrinne. Ich döste so vor mich hin, vermied es, die teilnahmslosen Heiligen an den Wänden anzuschauen und dachte an die Landstraße. Ein Lächeln huschte über meine Lippen. Ich sah meine Mutter auf der Landstraße. Sie kam mir entgegen. Sie lachte, breitete ihre Arme aus und küsste mich. Ich liebte meine Mutter über alles. Gemeinsam liefen wir Hand in Hand die Landstraße hinunter. Jetzt wuchsen links und rechts Pappeln. »Gib mir deine Hand«, lachte meine Mutter, »lass uns die Avenue hinuntergehen.« Dann weckte mich etwas auf.
»Sammy«, stöhnte meine Mutter, »bist du noch da?«
»Ja«, sagte ich und kuschelte mich an sie heran. Ich legte meinen Arm um ihre Taille, aber es reichte nicht ganz.
»Ich brauche Weihwasser«, keuchte sie, »nur ein paar Tropfen auf die Stirn.« Da die Schale neben der Tür leer war, nahm ich heimlich Hahnenwasser.
»Ja, das ist gut so«, stöhnte sie, »tu immer, was man dir sagt, sonst wird dich Gott fürchterlich bestrafen. Gott sieht alles.« Dann schlief sie wieder ein, und ich wünschte mir, in diese Avenue zurückzukehren. Die Heiligen an den Wänden warnten mich, es zu versuchen. Ich begriff, dass es verboten war, in diese Avenue zurückzukehren. Nach einer Stunde verlangte meine Mutter nach ihrem Rosenkranz. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass sie eine Perlenkette meinte. Doch sie hängte sie nicht um den Hals, sondern zählte die Perlen. Nach zehn kleinen Perlen kam eine größere. Und das fünf Mal. Vielleicht übte sie sich in Mathematik. Auf jeden Fall musste es sehr langweilig sein, immer die gleichen Perlen zu zählen. Hatte was Zwanghaftes. Irgendwann musste ja klar sein, dass es immer zehn Perlen waren. Sie schlief beim Erbsenzählen immer ein. Dann nahm ich einen von Vaters illustrierten Sprachkursen aus dem Nachttisch und blätterte ihn durch. Meine Mutter wollte, dass er Englisch lernte und einen besseren Beruf wählte. Er war Grenzwächter. Er liebte wie alle seine schwedischen Vorfahren die Natur, die frische Luft. Trotzdem kaufte er den Sprachkurs in einem Antiquariat, doch dann verließ ihn die Energie. Sie kam zeitlebens nie mehr zurück. Er war leider kein Vorbild.
Ich benutzte jedoch die Sprachkurse täglich. Ich suchte Illustrationen und besang sie. Ich dachte mir immer neue Geschichten und Melodien aus. Wäre die Oper nicht schon erfunden worden, ich wäre ihr Entdecker. Meine Mutter fand das manchmal nicht so lustig und murmelte, ich würde sie ins Grab singen, ich meine: bringen, wenn ich nicht aufhörte.
Die Sterbedrohung wurde zur wichtigsten Erziehungsmaßnahme. Siehe auch Pädagogik in Vilaincourt. Mit der Zeit nützte sich die Drohung ab, und meine Mutter inszenierte mit viel Herzblut Herzinfarkte, Erstickungsanfälle und Selbstmorde. Später drohte sie mit dem gefallenen Engel Luzifer, mit dem Fluch Gottes und den göttlichen Schlägertrupps und erzählte mir täglich furchterregende Geschichten von Menschen, die von Gott grausam bestraft worden, und von abtrünnigen Christen, die nachts von verstorbenen Heiligen heimgesucht und vor Schreck gestorben waren. Und dann gab es noch die Abenteuer der Märtyrer, die ihren abgeschlagenen Kopf am Schopf packten und das Schafott verließen.
Die Angst wurde mein Zuhause. Jeder Schritt, jedes Wort, jeder Gedanke musste sorgfältig überlegt sein. Ich stand unter der permanenten Beobachtung Gottes und seiner Racheengel. Manchmal geriet ich in Panik und blökte wie ein Schaf. In meiner Verzweiflung verriet ich ihr, dass ich geträumt hätte, sie sei wieder gesund, aber ich erzählte nichts von meiner geheimen Avenue. Meine Mutter stieg eines Tages tatsächlich wieder aus dem Bett und befragte mich nun jeden Morgen nach meinen Träumen, als sei ich das Orakel von Delphi. Nun kümmerte sie sich rührend um mich. Ich liebte sie wie Großmutter Germaine. Sie war nun alles, was ich hatte. Je mehr ich sie liebte, desto größer wurde die Angst, sie eines Tages wieder zu verlieren und wieder allein zu sein. Ich hätte am liebsten den Rest meines Lebens unter ihrem Rock verbracht. Oder auf dieser Landstraße, die meine geheime Avenue geworden war.
Den hageren Blonden im hellblauen Hemd sah ich kaum. Es gab diesen Mann in der Grenzwächteruniform, der ständig nach Zigaretten und Bier roch und hartnäckig behauptete, mein Vater zu sein. Meistens stritt er mit meiner Mutter. Es ging, wie in achtzig Prozent aller Ehen, um Geld. Genauer gesagt: Meine Mutter wollte etwas aus ihm machen, aber da hatte sie sich den Falschen ausgesucht. Er wollte kein Englisch lernen und schon gar nicht am Abend den Ausbildungskurs der städtischen Steuerverwaltung besuchen.
»Beamter beim Staat, das ist der ideale Beruf für dich. Die leben vom Nichtstun und erhalten später eine hohe Pension.«
Mein Vater machte jeweils ein mitleiderregendes Gesicht. Er liebe die Freiheit. Er wollte aber mehr als frei sein: Er wollte frei sein von jeglichen Verpflichtungen. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Ein Egoist aus purer Faulheit. Eigentlich war er der 68er-Bewegung weit voraus. Wissen Sie, wann ich an meinen Vater denke? Wenn der Metzger mich fragt, ob ich noch ein Stück Gallert will, diese zitternde, transparente Masse, die aus dem eingekochten Saft von Knorpel hergestellt wird.
Wenn sie das gewusst hätte, sagte meine Mutter manchmal. Er sagte das auch. Nun wussten es beide. Meine Mutter beklagte sich darüber bei ihren jurassischen Freundinnen. Einige wohnten in Basel. Keine einzige sprach Deutsch. Auch wenn es meine grün-roten Freunde nicht wahrhaben wollen: Jurassier kann man nicht integrieren. Sie wollen nicht. Sie hassen unsere Sprache und unsere Sitten. Sie wollen mit uns nichts zu tun haben. Punkt. Und wenn Sie keinen Jurassier integrieren können, wie wollen Sie erst Menschen aus Kulturkreisen integrieren, in denen noch Blutrache, Steinigungen, Massenvergewaltigungen und die Scharia praktiziert werden? Und in schwarzen Tüten rumlaufen hat mein Agent gestrichen.
Wenn meine Mutter sich mit ihren Freundinnen unterhielt, erfuhr ich mehr über ihr Leben. Einmal erzählte sie, dass sie die Scheidung einreichen wollte, als mein Vater ihr erklärte, wie man Kinder zeugt. Sie sei schockiert gewesen und habe sofort ihre Mutter angerufen. Wieso sie ihr das vor der Hochzeit nicht gesagt habe. Ich erwähne das nur, damit Sie sich das Bildungsniveau meiner Verwandtschaft in Vilaincourt besser vorstellen können. Die Freundinnen meiner Mutter hatten alle erfolgreichere Männer, die am Ende des Monats mehr nach Hause brachten als der ihre. Das nagte an ihr. Aber sie hatte es auch lustig mit ihren Freundinnen. Es gab da einen Running Gag: Zum Spaß erzählte sie ihren Freundinnen, dass sie ihnen mal zeigen wolle, wie sehr ich sie liebe, und sagte dann mit tieftrauriger Stimme, dass sie wohl nächste Woche sterben würde. Ich schrie sofort verzweifelt auf und stürzte mich heulend in ihre Arme. Ich verlor schier den Verstand. Meine Mutter lachte herzhaft und sagte: »Seht ihr, wie sehr der kleine Sammy mich liebt?« Ich kriegte dann keine Luft mehr und konnte nachts kaum schlafen. Ich war so nervös, dass alle Muskeln in meinem Gesicht zuckten und ich leise blökte wie ein Schaf.
Taubenkot
Und dann musste meine Mutter schon wieder ins Spital. Es war meine Schuld. Ich hatte das Weihwasser getrunken und ihr stattdessen Hahnenwasser gegeben. Es tat mir so unendlich leid. Ich war am Boden zerstört und nässte jede Nacht mein Bett. Ich flüchtete auf die imaginäre Landstraße, um meine Mutter zu treffen. Doch sie kam nicht mehr. Und die Pappeln waren verdorrt. Wenn ich morgens von einer Ohrfeige geweckt wurde, wusste ich, es war mir wieder passiert. Ja, meinem Vater war die Natur vertrauter als die menschliche Seele. Einmal packte er mich und schleppte mich auf den kleinen Balkon. Er hängte mich über die Brüstung und hielt mich an den Fußgelenken fest. Das Blut stieg mir in den Kopf, und ich sah die mit weißlichem Taubenkot verschmutzen Garagendächer. Ich weiß nicht, ob man noch mehr Angst empfinden kann. Er ließ mich einfach baumeln. Heute sagt man, man wolle die Seele ein bisschen baumeln lassen. Aber ich denke, mein Vater hasste mich, und ich war ihm hilflos ausgeliefert.
Eine der Freundinnen meiner Mutter wohnte im Quartier und nahm mich immer bei sich auf, wenn meine Mutter im Spital war. Das waren üble Momente, denn ich dachte immer, ich würde sie nie mehr lebend wiedersehen. Es war wie ein Fluch. Sobald ich etwas liebte, begann ich es zu verlieren. So versetzte mich bald jeder glückliche Augenblick in Panik. Die Angst wurde mein ständiger Begleiter. In meiner Landstraße begann das Leben wieder zu sprießen, aber es waren gigantische, furchterregende Bäume, die da wild in den Himmel wuchsen und mit ihren dichten Kronen die Sonne fernhielten. Ich irrte nun durch stockfinstere Wälder auf der Suche nach meiner geliebten Mutter. Ich hätte brüllen können vor Angst. Ich fand mich in der Finsternis der Wälder nicht zurecht. Manchmal streifte ein Ast mein Gesicht, manchmal stolperte ich über eine Wurzel, manchmal hörte ich Stimmen.
Rief meine Mutter um Hilfe? Wieso hatte ich bloß diese Weihwasserschale ausgetrunken? Ich verkroch mich in einer Höhle. Von hier aus konnte ich die Schneise sehen, die ein Sturm gerissen hatte. Es sah aus wie ein verwilderter Trampelpfad. Es war ein Weg durch die Finsternis. Manchmal sah ich Gestalten den Pfad hinunterkommen. Sie sahen aus wie später Gandalf in Der Herr der Ringe. Manchmal sah ich auch meinen Onkel Louis, der nach frischem Menschenfleisch Ausschau hielt und die Axt schwang.
Dieser Ort war nun mein Zuhause. Später standen hier Zelte, Baracken, Häuser, und es gab sogar eine Straßenbeleuchtung. Und viele Jahre später gab ich dieser Straße einen Namen: Script Avenue. Hier ersuchte ich um lebenslängliches Asyl.
Die Oper
Eine Freundin meiner Mutter hieß Agathe. Sie hatte eine Tochter ungefähr in meinem Alter, Odile. Anfangs verstanden wir uns recht gut. Ich lehrte sie, den englischen Sprachführer meines Vaters zu besingen. Mein Auftritt war auf Seite 54. Da war ein Mann mit Schirm und Melone abgebildet, der ein Londoner Taxi bestellt. Den besang ich am liebsten und erfand täglich neue Geschichten für ihn. Sozusagen eine serielle Oper. Die kleine Odile blätterte zur Seite 78, wo ein Zeitungsladen abgebildet war. Sie besang die Schließung des Zeitungsladens, damit der Kerl, der immer ein Taxi bestellt, keine Zeitung mehr kaufen konnte.
Ja, manchmal war sie etwas boshaft. Dann setzte sie sich rittlings auf meinen Rücken, während ich ihr auf allen vieren entwischen wollte. Sie hatte immer eine blaue Dose Nivea in Griffnähe und cremte mich damit ein. Sie nahm diesen Job sehr ernst. Sie cremte alles ein, die Augen, die Nasenlöcher, die Mundhöhle, bis ich halb erstickt unter ihr zusammenbrach. Manchmal schlug sie mir auch eine Lampe oder einen Teller über den Kopf. Ich habe mal gehört, dass Kinder nicht immer enthusiastisch auf Nachwuchs und gleichaltrige Gäste reagieren. Ich denke, das trifft es in etwa.
Ich machte dann das, was in den späten Sechzigerjahren sehr populär wurde: einen Hungerstreik. Damals war es noch keine öffentlich zur Schau gestellte Diät von übergewichtigen Intellektuellen zum Schutz von bedrohten Himalaja-Würmern. Aber Agathe, die ich nun Tante Agathe nennen musste, ließ nicht mit sich reden. Damals setzte man den Kindern noch Grenzen. Tante Agathe nahm mich in den Schwitzkasten, öffnete mir mit einer Holzkelle den Mund und schob mir den Spinat rein. Es gibt Leute, die behaupten, man könne über alles reden. Mit Tante Agathe konnte man nicht reden. Ich versuchte es deshalb mit erbrechen. Doch sie zwang mich jedes Mal – zur Freude von Odile –, den erbrochenen Spinat wieder aufzulöffeln. Fünfzig Gramm fanden jeweils den Weg in die Luftröhre. Ich konnte kaum noch singen. Ich beschloss deshalb, das Opernhaus zu schließen, und verbrachte meine Tage fortan blökend am Fenster. Mit großen Augen starrte ich auf die Straße hinunter und sehnte mich nach meiner Mutter. Nie wieder würde ich die Weihwasserschale leer trinken. Das Schicksal hatte mich zutiefst getroffen. Ein Gefühl von lauerndem Unglück übermannte mich, und allmählich begriff ich, dass Leid und Schmerz der wesentliche Bestandteil der menschlichen Existenz sind.