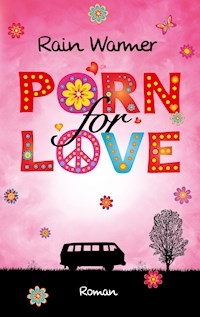Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nikolai Jablonsky will ein Zeichen gegen den dekadenten Kapitalismus setzen. Als die DDR ihre Grenzen öffnet, sieht der sozialistische Hardliner seine Chance gekommen. Mit der Mutter aller Bomben im Gepäck macht er sich auf den Weg nach Sylt. Die Insel der Reichen und Schönen scheint dem Untergang geweiht, bis Jablonsky den falschen Leuten ihren Wohnwagen klaut, plötzlich auf einer Tasche voller Geld sitzt und sein Herz an eine schrullige Bäckereifachverkäuferin verliert. - Der Mann, der Sylt in die Luft sprengte ist eine irrwitzige Odyssee, bei der hinter jeder Ecke der Wahnsinn lauert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Kapitel 1
Schon als er vierzig wurde, wusste Jablonsky, dass er die Insel Sylt in die Luft sprengen würde.
Damals fragte ein Kollege nach eventuellen Plänen für das Rentnerdasein und ihm schossen sofort zwei Möglichkeiten durch den Kopf: Entweder Modelleisenbahn, mit allem drum und dran, was durchaus seinen Reiz hatte, oder Sylt in die Luft sprengen!
Die Idee mit der Eisenbahn verblasste rasch gegenüber dem explosiven Einstieg in die Rentenzeit. Er sah es genau vor sich, ein Feuerwerk, das man noch bis zu den Shetland-Inseln sehen würde. Seine ganz persönliche Art, der Welt zu zeigen, wie hingebungsvolle Vaterlandsliebe aussehen sollte. Sein letzter Dienst an der DDR, dem Klassenfeind eins überbraten.
Zur Umsetzung des Plans gab es bisher nur ein Hindernis: Wie sollte er mit den zahlreichen Einzelteilen, die für den Bau der Bombe notwendig waren, aus der DDR hinausgelangen, ohne einen Verdacht zu erwecken?
Seit zwei Jahren befand sich Jablonsky bereits in der Rentenzeit, aber der Umstand, dass er Bürger der DDR war, schien seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen.
“Schien” war das richtige Wort, denn es tat sich etwas im Arbeiter- und Bauernstaat. Unzufriedenheit und Unruhe hatten sich in der Bevölkerung breit gemacht. Kaum ein Tag, an dem die Bürger nicht auf die Straße gingen, um gegen das sozialistische Regime zu protestieren.
Auch wenn Jablonsky die Meinung der Demonstranten nicht vertrat, so kam ihm deren Unzufriedenheit sehr entgegen. Die DDR begann sich aufzulösen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, und die Mauer würde zusammenfallen wie das Kartenhaus einer längst ergrauten Idee. Dann bräuchte er sich nur noch einen LKW mit möglichst viel Nutzlast auszuleihen, die Einzelteile der Bombe darin zu verstauen, und sich auf den Weg nach Sylt zu machen. Obwohl die Überlegung bezüglich der Nutzlast natürlich Unsinn war. Auf den Straßen der DDR fuhr hauptsächlich ein LKW-Typ: Der IFA W 50, und der hatte eine Nutzlast von zehn Tonnen. Aber das würde reichen, um Bombe und persönliches Hab- und Gut zu verstauen.
Es war der Abend des 9. November 1989. Jablonsky stand am Küchenfenster und schaute gedankenverloren auf die Reihenhäuser der gegenüberliegenden Straße. Genau genommen auf den IFA W 50, der vor dem Haus seines Nachbarn Walter Plöschke stand. Plöschke arbeitete als Fahrer für das gleiche Institut, an dem Jablonsky als Kernphysiker und Pyrotechnikexperte angestellt gewesen war. Plöschke fuhr Materialien hin und her und machte diverse Sonderfahrten, die es offiziell gar nicht gab. Nach Feierabend nahm er sein Arbeitswerkzeug meistens mit nach Hause und parkte es vor der Tür.
Seitdem Plöschke, wie die meisten anderen Nachbarn das Haus verlassen hatte, fixierten Jablonskys stahlgraue Augen, die einen leicht bläulichen Schimmer hatten, den LKW des Nachbarn. Schuld an der massenhaften Wohnungs- und Häuserflucht war eine Nachricht des SED-Funktionärs Günter Schabowski, die dieser erst vor wenigen Minuten über das Fernsehen verkündet hatte: Ständige Ausreise über alle Grenzübergänge der DDR zur BRD. Ab sofort!
Jablonskys Überlegung, dass sich die Deutsche Demokratische Republik in absehbarer Zeit auflösen würde, hatte sich damit erledigt. Das Ende des Arbeiter- und Bauernstaats traf jetzt, in diesem Moment ein, und gleichzeitig öffnete es Tür und Tor zur westlichen Welt. Zur verhassten kapitalistischen Welt, denn Jablonsky war überzeugter Sozialist. Und damit meinte er jenen Sozialismus, wie er einst definiert worden war: Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität.
Nur die Integrierung in politische Systeme war seiner Meinung nach kläglich gescheitert. Die DDR war dafür ein gutes Beispiel. Dennoch war er der Idee des Sozialismus treu ergeben, und mit der gleichen Inbrunst, wie er diese Ideologie verinnerlicht hatte, verachtete er den Kapitalismus, der nur wenigen den größten Anteil des Kuchens in ihre raffgierigen Hände spielte. Aber es gab noch eine Steigerung. Jablonsky bezeichnete sie als den ‚Dekadenten Kapitalismus’. Die Insel Sylt war hierfür ein gutes Beispiel. Reiche Säcke kauften die Insel zunehmend auf, mit dem Ergebnis, dass das Leben dort für die einheimische Bevölkerung zu teuer wurde und sie von der Insel verdrängt wurden. Dabei verbrachten die Reichen gerade mal drei bis vier Wochen im Jahr dort. Die restliche Zeit standen ihre Protzhütten leer, und Sylt wurde zunehmend zur Geisterinsel. Wichtige Fachkräfte, wie z.B. Ärzte verließen die Insel, da sich deren Aufenthalt nicht mehr rechnete. Hier war für Jablonsky das Ende der Akzeptanz erreicht, und es reifte in ihm der Plan, ein Exempel zu statuieren. Ein Exempel gegen den ,Dekadenten Kapitalismus’. Und was bot sich da besser an, als Sylt in die Luft zu sprengen?
Nun ja, es würde auch einige Unschuldige treffen, aber die würden für eine gute Sache sterben, fand Jablonsky. Außerdem: Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Und wenn Sylt erst einmal von der Landkarte gestrichen wäre, dann wüsste die Welt, dass es ihm ernst war mit seinem Anliegen für Gleichheit und Gerechtigkeit.
Jablonsky starrte nach wie vor auf den Lastwagen. Jetzt nur nicht die Geduld verlieren, dachte er. Du hast zwei Jahre auf diesen Moment gewartet, du brauchst dich jetzt nicht Hals über Kopf ins Abenteuer stürzen. Jablonsky ballte die Fäuste, sein Körper stand unter Spannung. Er konnte sich mit diesen Gedanken nicht überlisten. Alles in ihm schrie nach Aktion. Er gehörte nicht zu der Art von Rentnern, die im Garten saßen und Kreuzworträtsel lösten. Mit seinen 65 war er noch voller Tatendrang. Ein großer hagerer Mann, in dessen Blutbahnen das Leben eines 30-Jährigen pulsierte.
»Scheiß doch was auf die Vernunft!«, sagte er zu sich selbst. Dann eilte er in den Flur und griff sich das Telefon. Während er die Nummer seines Neffen wählte, blitzte es aufrührerisch in seinen Augen. Jenes Blitzen, das seinen stahlgrauen Augen das bläuliche Funkeln verlieh. Ein Zeichen für aufkommende Aktivität.
Nachdem er die Nummer gewählt hatte, wischte er sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sein graues Haar hatte stets einen leichten Glanz und fiel in Strähnen bis zum Halsansatz. Diese beiden Tatsachen ließen den Betrachter vermuten, dass Jablonsky fettige Haare hatte, und genauso war es auch. Zum einen zählte das Haarewaschen nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, zum anderen bekamen die Haare dadurch einen natürlichen Halt, ohne dass er mit irgendwelchen Mittelchen nachhelfen musste. Tatsächlich gab ihm das, zusammen mit seinem hageren, kantigen Gesicht ein verwegenes Aussehen.
Endlich wurde am anderen Ende der Leitung abgenommen. Ein krächzendes »Ja« ertönte aus der Muschel und variierte in der Tonhöhe. Sein Neffe Ewald befand sich gerade im Stimmbruch.
»Da bist du ja endlich«, sagte Jablonsky. »Wieso hat das denn so lange gedauert?«
»Ich bin ganz alleine«, krächzte Ewald. »Meine Eltern sind auf dem Weg zum Grenzübergang Bornholmer Straße.«
»Und wieso du nicht?«
»Weißt du doch, Onkel. Ich steh genauso hinter der sozialistischen Idee wie du.«
Jablonsky nickte. Natürlich wusste er das, dennoch hätte er gedacht, dass sich sein Neffe dieses Spektakel nicht entgehen lassen würde. Aber umso besser. »Sehr gut«, sagte Jablonsky, »dann schwing deinen Hintern aufs Moped und komm hier her. Ich brauche deine Hilfe.«
»Muss das sein, Onkel? Im Fernsehen läuft gerade Blaulicht.«
»Es muss sein. Es geht um die Sache.«
»Welche Sache denn?«
»Die Sache!«
»Welche die Sache denn?«
»Herrgott, bist du mal wieder schwer von Begriff! Ich meine das Hobby, dass ich mir in meiner Rentenzeit zulegen wollte.«
»Ah, du meinst die Modelleisenbahn.«
»Nein, das andere Hobby.«
Einen Augenblick war Stille in der Leitung. Jablonsky glaubte aber zu hören, wie in Ewalds Kopf ein Rädchen ins andere fasste. Dann folgte die Erleuchtung. »Du meinst die Sprengun….«
»Bist du wahnsinnig?«, fiel ihm Jablonsky ins Wort. »Ja, aber genau das meine ich, und ich will damit jetzt beginnen.«
»Du brauchst nichts mehr zu sagen, Onkel. Ich bin gleich bei dir. – Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« Dann legte Ewald auf.
Jablonsky legte den Hörer ebenfalls auf die Gabel und nickte zufrieden. Dann eilte er in den Keller, schnappte sich ein paar Werkzeuge und kehrte in den Flur zurück. Rasch zog er sich seinen grauen Trenchcoat über und schlüpfte in ein Paar robuste Schuhe. Dann verließ er das Haus. Die Reihenhaussiedlung lag vor ihm wie eine schwarz-weiß-Fotografie, der das Alter bereits einen Sepia-Stich verliehen hatte. Ein schwarzer, sternenklarer Himmel hob sich von den grauen Dächern ab. Jablonsky öffnete die beiden Pforten, die zur Auffahrt des Vorgartens führten. Dann setzte er sich in seinen Trabbi, fuhr ihn vom Grundstück und parkte ihn am Rand der Straße. Er stieg aus, ließ den Blick einmal die Straße hinauf und hinunter wandern und stellte zufrieden fest, dass in den meisten Häusern kein Licht brannte. Ein Zeichen dafür, dass die Bewohner ausgeflogen waren, denn niemand in der DDR ließ das Licht an, wenn er nicht zu Hause war. Das hatte auch einen weiteren Vorteil: Die Straße lag weitestgehend in Dunkelheit. Über die Straßenlaternen brauchte er sich keine Sorgen zu machen, brannte doch eh nur jede vierte. Aber ausgerechnet die beim Nachbarn Plöschke brannte und erhellte den Lastwagen.
Jablonsky ging ruhig über die Straße. Das Ziel war der IFA W 50. Nach seinem Verständnis gehörte der Laster, wie auch alles andere im Land, dem Volk. Deswegen hatte er auch nicht die Spur eines schlechten Gewissens, dass er das Gefährt an sich nehmen würde. Dennoch wusste er, dass viele Bürger ein anderes Verständnis von Besitztum hatten. Die einzige Schwäche, die er seinen Genossen und Genossinnen zugestand. Das Jagen und Sammeln, und somit das Besitzen war zu tief im menschlichen Bewusstsein verankert, als dass man es innerhalb von 50 Jahren komplett eliminieren konnte. Also ging er mit Bedacht vor und war so umsichtig wie ein Dieb in der Nacht.
In der Mitte der Straße angekommen, warf er noch einmal einen Blick durch die Reihenhaussiedlung. Alles ruhig, nur die Sterne schienen ihn zu beobachten.
Als Jablonsky auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig angekommen war, genügte ein Tritt gegen die Straßenlaterne, und der LKW wurde von Dunkelheit umhüllt. Jablonsky überprüfte die Türen. Sie waren verschlossen. Jetzt hoffte er nur, dass Plöschke den Fahrzeugschlüssel nicht mitgenommen hatte. Er umrundete das Fahrerhaus und stellte zum wiederholten Male fest, dass von dem Laster etwas Monströses ausging. Der IFA W 50 war längst nicht so groß wie die schweren Laster aus dem Westen, dafür wirkte seine Vorderseite wie ein bulliges Gesicht, das einen böse anstarrte.
Jablonsky ging weiter und war mit wenigen Schritten bei der Haustür angekommen, dann überlegte er es sich anders. Plöschke wohnte in einem End-Reihenhaus. Der nächste Häuserblock fing erst in fünf Metern an. Dazwischen standen hohe Büsche und ein schmaler, rasenbedeckter Weg. Jablonsky verschwand in den Büschen und stand kurz darauf vor dem Wohnzimmerfenster auf der Rückseite. Hier konnte ihn niemand sehen, selbst wenn der eine oder andere Nachbar zu Hause geblieben und noch nicht vor dem Fernseher eingeschlafen war. Plöschkes Grundstück war mit hohen Bäumen und Büschen umgeben. Ein Blick auf die verglaste Terrassentür und Jablonsky wusste, dass er hier mit seinem Dietrich-Set nicht weiterkam. Er griff in seinen Trenchcoat und holte ein Brecheisen hervor.
Einen Augenblick später durchquerte er Plöschkes Wohnzimmer und ging in den Flur. Wie in jedem ordentlichen Haushalt, hingen alle Schlüssel kurz vor der Haustür. Erleichtert stellte er fest, dass Plöschke den Schlüssel zum LKW zu Hause gelassen hatte. Jablonsky schnappte ihn sich und machte sich nicht die Umstände, das Haus wieder über die demolierte Terrassentür zu verlassen. Er war gelassen genug, um die Haustür zu benutzen. Natürlich nur äußerlich gelassen. Innerlich puschte ihn ein Adrenalinstoß nach dem anderen in eine euphorische Stimmung. Endlich konnte er seinen Plan umsetzen. Vor seinem geistigen Auge sah er bereits Sylt im Meer versinken. Dazu gesellte sich noch die Aufregung, ob seine Bombe überhaupt funktionieren würde, schließlich konnte er sie nirgends testen. Laut seinen Berechnungen hatte sie eine Sprengkraft von zehn Hiroshima-Bomben. Wie und wo sollte er so etwas testen?
Das Geräusch eines Mopeds drang die Straße herauf. Als Jablonsky auf dem Fahrersitz des IFA W 50 Platz nahm, sah er im Rückspiegel, wie sein Neffe auf dem Moped heranrauschte und vor seiner Haustür zu stehen kam. Jablonsky ließ den Lastwagen an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr ihn zu seinem Haus. Er wollte ihn dicht vor der Tür parken, um einen möglichst geringen Abstand zur Ladefläche zu haben. Langsam fuhr er den Laster die Auffahrt hinauf. Am Ende angekommen, lenkte er ihn nach links und fuhr über den Rasen weiter, direkt auf den Eingang, direkt auf Ewald zu. Dieser bekam so große Augen, dass Jablonsky es sogar im Rückspiegel erkennen konnte. Im letzten Moment sprang Ewald zur Seite. Jablonsky stellte den Motor ab und stieg aus.
»Mensch, Ewald«, sagte Jablonsky. »Wie schwer ist es eigentlich, einen 10-Tonner zu sehen, der sich langsam auf einen zubewegt?«
»Keine Ahnung, Onkel. Ich musste mich voll und ganz auf den LKW konzentrieren.«
Jablonsky schüttelte den Kopf.
»Du hast den Rasen und das Blumenbeet zerstört. Wenn du zurück kommst, wirst du eine Menge zu tun haben«, krächzte Ewald. Seine Stimme durchwanderte die unterschiedlichsten Frequenzen.
»Ich habe nur eine Einfach-Fahrt gebucht«, sagte Jablonsky.
»Häh? Wie meinst du das?«
»Ich komme nicht wieder zurück.«
»Wow!«
»Und außerdem musste ich den Laster so dicht vor die Tür stellen, weil wir den gesamten Inhalt meines Kellers auf die Ladefläche verfrachten. Einige Teile sind sehr schwer. Je kürzer der Weg, desto besser.« Jablonsky öffnete die Haustür und fixierte sie mit dem Regenschirmständer. Sein Neffe nahm ein Paar Arbeitshandschuhe vom Gepäckträger des Mofas und zog sie sich an. Dann folgte er seinem Onkel ins Haus.
»Hat Plöschke dir seinen LKW geliehen?«, fragte Ewald.
»Ja.«
Ehrfürchtig und mit offenem Mund bewunderte Ewald die riesige Ansammlung von Stahl-, Chrom-, Metall- und Kupferteilen, die den gesamten Keller füllten. »Wow«, kam es ihm wieder über die Lippen. Aber diesmal lag echte Bewunderung in dem ‚Wow‘. »Sieht gar nicht wie eine Bombe aus«, sagte er.
»Soll es auch nicht«, sagte Jablonsky. »Aber selbst wenn ich das Teil zusammen gebaut habe, wird es nicht wie eine Bombe aussehen. Eher wie eine große Tonne, umgeben von einem verzweigten Stahlgerüst. Es ist halt ein Prototyp. Nichts, was man von einem Flugzeug abwerfen könnte.«
»Und wo willst du das Teil unbemerkt auf Sylt aufbauen?«
»Das lass mal meine Sorge sein. Fang jetzt an, die Sachen zu verladen. Ich geh derweil nach oben und suche alles zusammen, was ich zum Leben brauche. Danach helfe ich dir.«
Jablonsky befand sich im oberen Stockwerk. Während er aus dem Erdgeschoss Ewalds Schnaufen vernahm, ging er ins Schlafzimmer, um die zwei wichtigsten Dinge einzupacken. Die zwei wichtigsten nach der Bombe, natürlich. Zum einen waren es 50.000 Ostdeutsche Mark. Vielleicht könnte er sie schon bald im Westen in Deutsche Mark umtauschen. Die derzeitige Entwicklung sprach dafür. Zum anderen waren es die geheimen Bunkerpläne von Sylt. Geheim deswegen, weil vermutlich niemand davon wusste. Und diejenigen, die davon gewusst hatten, waren wahrscheinlich schon tot. Genau wie sein Vater, der diese Pläne in den letzten Tagen des dritten Reiches an sich gebracht hatte. Sein Vater gehörte zum Stab des Führer-Bunkers in Berlin. Der Führer selbst hatte ihm befohlen, alle geheimen Pläne aus Berlin rauszubringen, ehe sie dem Feind in die Hände fielen. Sein Vater hatte dieses Wunder vollbracht. In einem Kugel- und Bombenhagel war er auf einer Zündapp KS 750 quer durch das zertrümmerte Berlin gerast. Der Führer hatte ihm nur mitgeteilt, dass er die Pläne irgendwo verstecken sollte, wo sie dem Feind nicht in die Hände fallen würden. Jablonskys Vater selbst hatte keine Idee gehabt. Er musste sich konzentrieren und den permanenten Granat-Einschlägen ausweichen, da war kein Platz für andere Gedanken gewesen.
Nachdem er Berlin hinter sich gelassen hatte und die Umgebung immer ländlicher geworden war, hatte er sich schließlich auf einem verlassenen Bauernhof niedergelassen und das Ende des Zweiten Weltkrieges abgewartet. Später hatte er das Gestüt wieder verlassen und war nach Hause gefahren. Dort hatte er die Pläne versteckt und sie schließlich dem jungen Nikolai zum zwölften Geburtstag geschenkt. Der Junge hatte nicht schlecht darüber gestaunt. Nazi-Pläne von geheimen, unterirdischen Bunkeranlagen auf der Insel Sylt und noch viele andere Pläne. Was könnte sich ein Junge in diesem Alter mehr wünschen?
Nikolai tat wie ihm sein Vater geheißen, versteckte die Pläne und erzählte niemandem davon. Erst Mitte 40, als die Frage auftauchte, was er denn in der Rentenzeit tun wolle, kamen ihm die Pläne wieder in den Sinn und inspirierten ihn dazu, dem ‚Dekadenten Kapitalismus‘ den Kampf anzusagen.
Jablonsky stand vor dem Schlafzimmerschrank. Er wischte die Erinnerung an die Vergangenheit beiseite und öffnete den Schrank. Dann hob er den Boden an und zog eine Plastiktüte sowie einen Umschlag hervor. Den Umschlag mit den geheimen Plänen schmiss er in den Reisekoffer. Das Geld wollte er immer bei sich tragen. Da es nur aus 200- und 500-Mark-Scheinen bestand, passte es in die beiden Innentaschen des Trenchcoats, die er mit einem Reißverschluss verschließen konnte. Danach suchte er alle Dinge zusammen, die er zum Leben auf der Insel benötigte.
Am Grenzübergang Bornholmer Straße war die Hölle los. Mehrere 1000 Menschen drängten sich vor der Schranke und forderten lautstark die Öffnung. Im Gesicht des diensthabenden Oberstleutnants zeichnete sich zunehmende Unsicherheit ab. Von überall hörte er Rufe, dass die ständige Ausreise schon längst amtlich sei.
Was sollte er tun? Ihm und seinen Mitarbeitern wurde eine derartige Nachricht nicht mitgeteilt. Sie wussten von nichts. Der Oberstleutnant hatte bereits mehrfach versucht, seinen Vorgesetzten anzurufen, aber Fehlanzeige. Am anderen Ende der Leitung nahm niemand ab. Der zunehmende Druck der Massen beunruhigte den Mann. Er befürchtete, dass die Lage eskalieren könnte. Die Ausreisewilligen könnten an die Waffen seiner Mitarbeiter kommen. Er musste unbedingt etwas tun.
Als erstes sammelte er die Waffen seiner Soldaten ein und verstaute sie im Tresor des Dienstgebäudes. Als er wieder auf die Straße trat, schaute er auf seine Uhr. Es war 23:15 Uhr. Als er den Kopf wieder hob, bot sich ihm ein merkwürdiges Bild: Ein Lastwagen bahnte sich einen Weg durch die Menschenmenge. Immer wieder ertönte die Hupe. Die Leute sprangen zur Seite und ließen das mächtige Stahlross passieren. Der Oberstleutnant fing an, diesen Tag zu verfluchen. Der Lastwagen machte die Situation noch brenzliger als sie schon war. Als das blecherne Ungetüm neben ihm zu stehen kam, überlegte der diensthabende Offizier, ob es wirklich eine kluge Idee gewesen war, die Waffen wegzusperren. In diesem Moment ging auf der Fahrerseite des IFA W 50 die Tür auf. Ein grauhaariger Mann in einem ebenso farbigen Trenchcoat stieg aus und kam auf ihn zu. Dem Oberstleutnant fiel der leichte Glanz in den Haaren auf. Entweder waren sie fettig oder der Mann hatte Pomade drin.
»Gestatten. Nikolai Jablonsky«, sagte der alte Mann. »Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben: Die Grenzen sind offen.«
Der diensthabende Offizier schüttelte den Kopf. »Solange ich keine offizielle Anweisung bekommen habe, weiß ich von nichts.«
Jablonsky kniff die Augen zusammen, schaute sich um und überlegte, ob er die Grenze mit dem Lastwagen gewaltsam durchbrechen sollte.
»Augenblick mal«, sagte der Oberstleutnant. »Ich kenne Sie. Sie sind doch dieser Kernphysiker. Ich hab Sie mal im Fernsehen gesehen.«
Jablonsky zog die Brauen hoch. »Ich war nur ein einziges Mal im Fernsehen und daran erinnern Sie sich?«
»Nun ja. Ich schaue gerne Wissenschafts-Sendungen.«
»Respekt, junger Mann.« Jablonskys stahlgraue Augen fixierten die Augen des Soldaten. »Und wie denken Sie darüber, dass die DDR im Begriff ist, sich aufzulösen und damit die sozialistische Idee den Bach runtergeht?«
»Unerträglich.«
Jablonsky nickte. »Gut, gut«, sagte er, drehte sich herum und ließ den Blick über die Menschenmenge gleiten. Seinen Adleraugen entging nichts. Auch nicht die wild wedelnden Arme, die zu seinem Nachbarn Walter Plöschke gehörten. Der stand keine 30 Meter hinter dem Laster. Jablonsky konnte nicht hören was er die ganze Zeit rief. Aber seinem erbosten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hatte es etwas mit dem 10-Tonner zu tun.
Rasch wandte sich Jablonsky wieder dem Oberstleutnant zu. »Hören Sie. Den Untergang der DDR können wir beide nicht mehr aufhalten. Aber wir können dem ‚Dekadenten Kapitalismus‘ eine gehörige Ohrfeige verpassen. Dort im Laster befindet sich eine gewaltige Bombe, die ich entwickelt habe. Sie ist zehnmal so stark wie die Hiroshima-Bombe und absolut umweltfreundlich.«
Der Oberstleutnant starrte ihn aus großen Augen an. Jablonsky ließ sich davon nicht beirren und fuhr fort. »Damit meine ich, dass sie frei von radioaktivem Niederschlag ist. Keine giftigen Abfallstoffe, die unsere liebe Erde auf lange Sicht verseuchen.«
»Das ist…«, begann der Oberstleutnant.
»Umweltfreundlich«, wiederholte Jablonsky. »Eine konventionelle Massenvernichtungswaffe. Etwas wonach die ganze Welt forscht, ohne Ergebnis. Aber ich habe das hinbekommen. Während meiner Zeit am ‚Zentralinstitut für Kernforschung‘ habe ich dieses kleine Kabinettstück bewerkstelligt. Allerdings…« Er machte eine Pause. »Allerdings habe ich vergessen, es meinen Vorgesetzten mitzuteilen.« Er lachte.
Der Oberstleutnant starrte ihn immer noch aus großen Augen und mit offenem Mund an. Dann blinzelte er einmal, wandte sich abrupt um und rief den beiden Soldaten an der Schranke zu: »Sofort öffnen!«
Die beiden Männer schauten sich zunächst irritiert an, dann zuckten sie mit den Schultern, was so viel bedeutete wie ‚Was soll’s. Chef ist Chef‘.
Der diensthabende Offizier wandte sich wieder an Jablonsky und salutierte zum Abschied. »Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Mission, Genosse Jablonsky.«
»Danke«, sagte dieser, wandte sich um und beeilte sich zum Laster zu kommen. Walter Plöschke hatte sich inzwischen ein gutes Stück nach vorne gearbeitet. Jablonsky erreichte den IFA W 50 und stieg ins Führerhaus.
»Hey, das ist mein Laster!«, hörte er Plöschke rufen. »Jablonsky! Wo willst du damit hin? JAAAABLOOOONSKYY!«, schrie er.
Dieser ließ den Motor an. Die Schranke ging nach oben und Jablonsky drückte aufs Gaspedal. Die Menschen hinter dem Laster drängten sofort mit euphorischen Rufen nach. »Die Mauer ist weg!«, erklang es von allen Seiten. »Die Mauer ist weg!«
Und so kam es, dass der überzeugte Sozialist, Nikolai Jablonsky, den Grenzübergang Bornholmer Straße für sich und alle anderen öffnete.
Jablonsky lenkte den LKW durch das westliche Berlin. Er fühlte sich großartig, geradezu euphorisch. Die erste Hürde war genommen. Natürlich wäre es einfacher gewesen, um West-Berlin einen Bogen und direkt auf einer Transitstrecke zur innerdeutschen Grenze zu fahren. Dann hätte er nur eine Grenzkontrolle überwinden müssen. So aber waren es drei Grenzübergänge, denn West-Berlin war nichts anderes als eine Insel. Eine kapitalistische Insel mitten im Reich des Arbeiter- und Bauernstaates. In Jablonskys Augen eine Schande. Immerhin eine Schande, die er sich schon immer einmal ansehen wollte. Deswegen hatte er den Übergang an der Bornholmer Straße ausgewählt. Deswegen, und weil der praktischerweise am nächsten lag.
Jablonsky konnte den Laster nur langsam vorwärtsbewegen. Zahlreiche entgegenkommende Westberliner verhinderten ein schnelles Fahren. Mit euphorischen Rufen und Sektflaschen in den Händen liefen sie zum Grenzübergang, um ihre Brüder und Schwestern Willkommen zu heißen. Die vor Freude strahlenden Gesichter ließen Jablonsky sauer aufstoßen. Ihr wisst doch gar nicht, was auf euch zukommt, dachte er. Wie soll ein verkommenes, dekadentes System, mit einer Bevölkerung harmonieren, deren Denken und Streben, durch die sozialistische Erziehung, wesentlich höher entwickelt ist?
Nachdem er den Menschenstrom hinter sich gelassen hatte, wurde es nicht viel ruhiger. In den meisten Gebäuden brannte Licht. Auf den Straßen waren zahlreiche Autos unterwegs, auch die Gehsteige hatten keine Pause. Junge Menschen kamen aus Bars und Restaurants. Die Stadt schien selbst in der Nacht nicht zur Ruhe zu kommen. Jablonsky schüttelte den Kopf. In seinen Augen war diese Umtriebigkeit eine Nebenwirkung des Kapitalismus. Der nach Profit strebende Mensch kam einfach nie zur Ruhe und starb wahrscheinlich einen früheren Tod als der Sozialist, der keine üblen Nebenwirkungen zu befürchten hatte, weil er das unnütze ‚Medikament’ Kapitalismus nicht einnahm. Jablonsky war froh, diesen Weg genommen zu haben. Das unermüdliche Treiben in Westberlin zeigte ihm, dass er auf dem richtigen Weg war. Der Kapitalismus musste abgeschafft, musste weggesprengt werden.
Auf der rechten Seite glitt ein kleiner Park vorbei. Hohe Bäume umsäumten eine grüne, hügelige Fläche. Laternen schmückten die grüne Oase mit ihren Lichtkegeln. Auf dem Gehsteig kam dem Laster ein Mann mit einem Hund entgegen. Jablonsky hielt kurzentschlossen an, stieg aus und fragte nach dem Weg zum Grenzübergang Stolpe/Heiligensee, der zur Transitstrecke durch die DDR führte. Der Fußgänger musterte ihn für einen Moment skeptisch, so als müsse er den alten Mann mit dem seltsamen Laster erst einmal in irgendeiner Schublade unterbringen. Dann schien er die passende Schublade gefunden zu haben und beschrieb, mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, den Weg nach Stolpe/Heiligensee. Jablonsky bedankte sich, stieg wieder ein und setzte seine Fahrt fort.
Nach einer Weile glaubte er sich verfahren zu haben. Er wollte schon den nächsten Passanten ansprechen, da tauchte ein Hinweisschild zur Bundesautobahn 11 auf. Jene Schnellstraße, die für den Transitverkehr nach Norden freigegeben worden war. Er folgte dem Schild und auf einmal machte sich ein ungutes Gefühl in ihm breit. Er war so ziemlich der Erste, der über die Grenze gefahren war, und es war unwahrscheinlich, dass die DDR-Bürger sofort die Koffer packten, in ihre Trabbis stiegen und die Verwandtschaft in der BRD besuchen wollten. Sicherlich fand an der Grenze, die Berlin teilte gerade eine große Willkommens-Party statt, aber höchstwahrscheinlich nicht an den Übergängen zu den Transitstrecken. Und vielleicht hatte die Nachricht über die ständige Ausreise die dort stationierten Soldaten noch gar nicht erreicht. Nachdenklich ging Jablonsky vom Gas. Es waren einfach zu viele Wahrscheinlichkeitsfaktoren im Spiel. Er wollte nicht, dass seine Mission ein abruptes Ende fand, nur weil er sich nicht gedulden konnte. Einen Tag abwarten, das musste doch zu schaffen sein. Im Grunde genommen hätte er gar nicht aufbrechen, sondern von vornherein einen Tag abwarten sollen. Die Geduld, die er jetzt von sich abverlangte, hätte er vor zwei Stunden an den Tag legen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Die Sache war nun einmal gelaufen, dennoch konnte er sich wenigstens jetzt in Geduld üben, sich irgendein Hotel suchen und dort abwarten. Bis morgen Abend würde die Nachricht von Genosse Schabowski die Runde gemacht haben, und dann würde die große Reisewelle in den bescheuerten Westen beginnen. Eine Blechlawine gen Westen, in der er mit dem Laster wunderbar untertauchen konnte. Jablonsky fuhr nur noch mit 30 km/h durch das nächtliche Berlin. Er ließ seinen Blick an den Häuserfassaden entlanggleiten. Auf der linken Seite erschien schließlich in Neonbuchstaben der Schriftzug ‚Hotel Berlin Berlin’. Die großen Buchstaben auf dem überdachten Eingang leuchteten in rotem und gelbem Neonlicht. Jablonsky schüttelte über eine derartige Stromverschwendung den Kopf, hielt aber trotzdem an der gegenüberliegenden Straßenseite. Er stieg aus, ließ zwei Autos vorbeifahren und überquerte die Straße.
Gläserne Schiebetüren öffneten sich, als er das Hotel betrat. Eine runde Halle, in einer schlichten, unterkühlten Eleganz, breitete sich vor ihm aus. Die Farbe Weiß überwog. Ihm gegenüber befand sich die Rezeption. Darüber führte eine Galerie, von der man zu den Zimmern zu kommen schien. Eine hochgewachsene Frau in einem blauen Sakko lächelte ihm entgegen. Ansonsten war die Halle verwaist. Jablonsky fiel plötzlich ein, dass er nur Ostdeutsche Mark bei sich hatte. Unwillkürlich blieb er stehen, fasste sich an die Brust und fühlte die Geldscheine unter dem Trenchcoat. Würde das Hotel das DDR-Geld akzeptieren? Zögernd ging er weiter. Die Frau war etwas größer als er. Vielleicht trug sie auch Absätze.
»Einen schönen guten Abend«, sagte er. »Sagen Sie, kann ich bei Ihnen mit Ostdeutschem Geld bezahlen?«
»Nein, das geht leider nicht«, entgegnete die dunkelhaarige Frau mit einem Lächeln, als hätte sie ihm verkündet, dass er sechs Richtige im Lotto hatte.
»Mhhmmm«, erwiderte Jablonsky und warf einen nachdenklichen Blick in den Ausschnitt ihrer Bluse. Sie hatte makellose, weiße Haut. »Das ist äußerst bedauerlich. Ich würde gleich morgen früh zur nächsten Bank gehen und das Geld umtauschen.«
»Ich fürchte, dass unser Etablissement sich darauf nicht einlassen kann. Der Umtausch dürfte nämlich schwierig werden. Warum sollte hier irgendjemand Ost-Geld haben wollen?«, sagte die Lotto-Fee. Ihr Lächeln schien angeboren zu sein. Er fragte sich, ob es nicht anstrengend ist, den ganzen Tag so zu lächeln.
»Die Grenze ist offen. Früher oder später muss alles Geld aus der DDR umgetauscht werden«, sagte er.
»Von einer offenen Grenze weiß ich nichts. Aber wie dem auch sei, bei uns müssen Sie die Rechnung in DM begleichen.«
Er verfluchte sich selbst darüber, dass er das Ostdeutsche Geld überhaupt erwähnt hatte. Wahrscheinlich hätte er die Rechnung erst zum Zeitpunkt der Abreise begleichen müssen. Bis dahin hätte er das Geld vielleicht doch umtauschen können, oder ihm wäre etwas anderes eingefallen. Aber vielleicht war das Kind noch nicht endgültig in den Brunnen gefallen. Er blinzelte zweimal. »Da fällt mir ein: Ich habe ja noch westdeutsches Geld. Ich wollte nur noch nicht alles aufbrauchen. Aber wenn es nun einmal nicht anders geht...«
Sie konfrontierte ihn wieder mit dem fast schon aggressiven Lächeln. In den Augen konnte er ein Funkeln erkennen. »Nun«, sagte sie. Es war ein sehr langes ‚Nun’. »Ich fürchte, die Katze ist bereits aus dem Sack, nicht wahr?«
Er blinzelte erneut, starrte sie einen Augenblick an. Dann wandte er sich um und verließ mit einem ‚Scheiß Wessis’ auf den Lippen das Hotel.
Mürrisch überquerte er die Straße, öffnete die Fahrertür des IFA W 50 und ließ sich in den Sitz fallen. »Scheiß Wessis!«, wiederholte er und schaltete das Radio ein.
»...auch die Grenzübergänge an der West-Berliner Außengrenze sowie an der innerdeutschen Grenze wurden soeben geöffnet...«
Schabowskis frohe Botschaft hat sich also doch schon herumgesprochen, dachte Jablonsky. Vielleicht sollte er es wagen und seine Fahrt fortsetzen. Die Aussicht darauf, die Nacht in der kalten Fahrerkabine zu verbringen, behagte ihm ganz und gar nicht. Wenn die Grenzen offen waren, dann waren sie offen. Sein Unbehagen war unbegründet, dennoch ließ es sich nicht verleugnen. Er ließ den Motor an und fuhr los.
Als er auf die Autobahn 11 fuhr, hatte er seine Bedenken in einem inneren Dialog soweit herunter geredet, dass sie nur noch ein Schimmern am Horizont waren. Ähnlich, wie das Schimmern, das er weit vor sich sah. Es war der überdachte Grenzübergang Stolpe/Heiligensee, der von zahlreichen Scheinwerfern beleuchtet wurde. Bis dorthin wurde die Autobahn von einem hohen Erdwall umschlossen, der an einen Deich erinnerte. Obendrauf befanden sich, auf beiden Seiten, hellerleuchtete Wachtürme. Jablonsky waren diese Bauten von der Berliner Mauer hinsichtlich bekannt. Für ihn war das immer ein beruhigender Anblick, schließlich dienten die Türme dazu, das hässliche Gesicht des Kapitalismus draußen vor der Tür zu lassen. Nur heute wollte sich dieses Gefühl nicht einstellen. Heute beunruhigte ihn der Anblick. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn genau beobachteten, dass sie wussten, warum er hier war. Schließlich gab es kaum mehr als seinen Laster zu beobachten. Nur wenige Autos teilten mit ihm die Autobahn. Die meisten DDR-Bürger hatten die Nachricht über die Grenzöffnung schlichtweg verschlafen.
Kurz vor dem Kontrollpunkt wurde die Straße breiter. Aus den zwei Spuren wurden vier, um bei hohen Betriebsaufkommenmehrere Fahrzeuge gleichzeitig abzufertigen, was in der heutigen Nacht natürlich nicht nötig war. Nur eine der schmalen Gassen war geöffnet, und als Jablonsky den Mann sah, der dort stand, hellte sich sein Gemüt auf. Der Mann mit dem Schnauzer winkte die zwei Trabbis, die soeben dort angekommen waren, fröhlich hindurch. Mit einem Schlag fiel die Anspannung von Jablonsky ab. Erleichtert steuerte er den Durchgang an. »Ein Volk, ein Land!«, hörte er den Grenzsoldat fröhlich rufen. Dabei riss er sich die grüne Mütze vom Kopf und winkte Jablonsky mit ausholender Bewegung durch die Schneise hindurch. »Ein Volk, ein Land!«, rief der Soldat unentwegt.
»... ein Führer«, ergänzte Jablonsky spöttisch. Hoffentlich ist dieser Mann kein Vorzeichen dafür, dass jetzt alles in die entgegengesetzte Richtung geht, dachte Jablonsky. Vom Sozialismus zurück zum Nationalsozialismus. Einfach grotesk. Er beachtete den Mann nicht weiter und sah nach vorne. Weiter hinten, dort, wo keine Scheinwerfer mehr den Schutzwall erleuchteten, begann die verheißungsvolle Dunkelheit. Jablonsky drückte aufs Gas.
Er hatte es geschafft, oder besser gesagt fast geschafft. Es galt immer noch die innerdeutsche Grenze bei Gudow zu überwinden. Aber jetzt machte er sich darüber keine Sorgen mehr. Die Grenzer wussten Bescheid. Er konnte seine Gedanken wieder auf die vor ihm liegende Aufgabe lenken. Die Umsetzung seines Plans rückte in greifbare Nähe. Endlich bekam sein Rentner-Dasein einen Sinn. Vor seinem geistigen Auge sah er bereits den mächtigsten Atompilz, den die Welt je gesehen hat. Nur, das es eben kein Atompilz war. Eine Explosionswolke ohne Radioaktivität. Eine saubere Sache, falls sie funktionierte. Auf dem Papier schien alles perfekt zu sein. Dennoch nagte ein letzter Zweifel an ihm. Theorie war nun einmal Theorie und Praxis war Praxis. Er verscheuchte den Gedanken. Es würde schon klappen.
Schattengleich tauchten links und rechts der Autobahn Bäume und Wiesen auf. Hier und da erkannte er schemenhaft einen Bauernhof. Er befand sich jetzt auf der nördlichen Transitstrecke. Sie war eine jener Straßen, auf denen Westberliner in die BRD fahren konnten und umgekehrt.
Am Grenzübergang zur Bundesrepublik Deutschland lief alles glatt. Anders als bei der Westberliner Außengrenze warteten hier mehr Autos auf die Ausfahrt, aber die Zöllner winkten alle durch. Jablonsky wusste natürlich nicht, dass er indirekt damit zu tun hatte. Die Nachricht über die Öffnung an der Bornholmer Straße hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Der Oberstleutnant hatte sofort andere Grenzübergänge informiert, da er von diesen wusste, dass sie auch keinen Kontakt zur militärischen oder politischen Führung hatten.
Jablonsky drückte aufs Gas. Er hatte es geschafft. Jetzt konnte das Abenteuer beginnen. Fehlte nur noch die passende Musik. Er schaltete das Radio ein und suchte nach einem West-Sender. Er wollte etwas Schmissiges hören, nicht die verschnarchten Schlager aus dem Osten. Eine Musik, die ihn beflügelte. Nach einer Weile bekam er einen Sender in guter Qualität herein. Ein Moderator kündigte einen englischsprachigen Sänger an, von dem Jablonsky noch nie gehört hatte. Als das Lied begann, drehte er das Radio sofort lauter. Die Musik war großartig. So etwas hatte er noch nie gehört. Was für ein großer Künstler, dachte er.
Gutgelaunt lenkte er den LKW durch die Nacht, während aus den Lautsprechern ,I’VE BEEN LOOKING FOR FREEDOM!’ dröhnte.
Kapitel 2
Auf dem Rastplatz ,Gudow Nord’ an der A24 roch es heftig nach Marihuana. Die beiden hauptberuflichen Drogenkuriere Hendrik und Klaas saßen auf der Mini-Terrasse vor ihrem Hotelzimmer und gaben sich ihrer allabendlichen Entspannungstherapie hin. Eine großzügig gerollte Tüte mit dem besten Gras, das man aus Holland importieren konnte. Dabei ließen sie großzügiger Weise jene Hotelbewohner daran teilhaben, die ihre Fenster offen hatten, oder ihren Abend auch auf der Terrasse verbrachten. Während sie den Qualm genüsslich in den Nachthimmel pusteten, schauten sie auf die vorbeirasenden Autos auf der Autobahn. Nachts war nicht so viel los wie am Tage, dennoch reichte es aus, um ein permanentes Rauschen erklingen zu lassen. Ein Klang, der den beiden Drogenfreunden sehr gut gefiel, hatte er doch eine beruhigende Wirkung und ergänzte sich somit perfekt zum Marihuana. Da sie eh den ganzen Tag ‚on the road’ waren, suchten sie sich grundsätzlich eine Raststätte an der Autobahn, um den abendlichen Drogenrausch mit der Wirkung des Autobahnrauschens zu kombinieren. Es war die perfekte Dröhnung.
Nun könnte man sich fragen, warum die beiden denn überhaupt ein Hotel als Nachtquartier aufsuchten, wo sie doch einen Wohnwagen an ihrem Volvo hängen hatten. Die Antwort darauf war ganz simpel. Im Wohnwagen war kein Platz mehr, denn er war mit jener Ware vollgestopft, die sie in der ganzen Bundesrepublik verkauften. Bestes Gras aus den Niederlanden. Dabei belieferten sie nicht den Endkunden auf der Straße, sondern die Dealer. Sie waren das verbindende Glied zwischen Dealer und dem Big-Boss Joop van Veen, der die Ware in einem großen Gewächshaus anbauen ließ. Das Gewächshaus war eines von vielen und befand sich in hinterster Reihe. In den Glashäusern davor befanden sich sämtliche Pflanzen, die das Herz von Hobbygärtnern höher schlagen ließ. Und davor wiederrum erstreckte sich ein großes Gebiet mit Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen. Der Big-Boss hatte die Hanf-Plantage wunderbar in eine Baumschule integriert. Das hatte nicht nur den Vorteil des ungestörten Hanf-Anbaus, nein, hier konnte Joop van Veen das Drogengeld auch gleich waschen. Perfekt!
Der Big-Boss hatte allen seinen Kurieren eingeschärft, dass sie das Zeug nicht selbst konsumieren sollen. Bei einer zufälligen Polizeikontrolle würden die Bullen den Braten sofort riechen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen achtete Joop van Veen auch darauf, dass seine Kuriere keine Junkies waren. Nur Hendrik und Klaas hatten es geschafft, ihm etwas vorzumachen. Vielleicht lag es daran, dass sie von allen die höchste Bildungsstufe hatten, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls haben sie erfolgreich verheimlicht, dass sie selbst ihre besten Kunden waren. Am Anfang war es nur der allabendliche Joint gewesen, später kam dann der Joint als Nachtisch zum Mittagessen dazu. Dann waren beide der Meinung gewesen, dass der Kaffee am Nachmittag am besten mit einer selbstgedrehten Tüte zu genießen sei. Irgendwann hatten sie den Punkt erreicht, an dem es nur drei Stunden pro Tag gab, an denen sie nicht komplett zugedröhnt durch die Nation fuhren. Aber was sollte es. Solange sie ihr Tagessoll erreichten, war alles andere egal. Das Wort ‚egal’ bekam übrigens eine immer größere Bedeutung in ihrem Leben.
Hendrik und Klaas bliesen weitere Rauchwolken in Richtung der Autobahn und sanken noch tiefer in die Klappstühle. Beide waren knapp 30, blond und trugen stets einen Dreitagebart. Bei Hendrik wurde es zunehmend ein Vollbart. Seine schulterlangen Haare kamen unter einer Baseballkappe hervor, die er eigentlich nur zum Schlafen abnahm.
»Haste schon gehört?«, kam es von Klaas.
Hendrik ließ sich mit der Antwort Zeit. Schließlich sagte er: »Nee, was denn?«
»Die Grenze ist offen.«
»Was denn für ne’ Grenze?«
Jetzt ließ sich Klaas mit der Antwort Zeit. Nachdem er einen weiteren Schwall Marihuana in die Nacht geblasen hatte, sagte er: »Na, die Grenze.«
»Ach so, du meinst.... die Grenze.«
»Ja, genau, du. Voll krass, oder?«
Tatsächlich hatte die Nachricht über die Grenzöffnung in Westdeutschland schon längst die Runde gemacht, ehe es überhaupt passiert war. Irgendein Fernsehsender hatte dies ohne ordentliche Recherche einfach mal in den Äther geblasen. Die anderen Sender hatten sich angeschlossen. In Wahrheit passierte Jablonsky erst in diesem Moment den Grenzübergang Bornholmer Straße.
»Nö«, sagte Hendrik. »Is’ egal.«
Klaas atmete langsam aus. »Hast Recht. Is’ egal.« Dann besann er sich eines anderen, rutschte ein Stück höher und erhob die Stimme. »Nee, Augenblick mal.
Is’ gar nicht egal, du Klootzak!«
Hendrik wurde hellhörig und rutschte jetzt auch ein Stück höher. »Klootzak? Wenn hier einer der Klootzak ist, dann bist du das!« Er war jetzt plötzlich auch laut geworden. Ein Nachteil des ständigen Marihuana-Konsums waren die immer häufiger auftretenden, emotionalen Achterbahnfahrten. Von einem Augenblick zum anderen wechselte Sanftheit zu Aggressivität und umgekehrt.
»Nein, du bist der Klootzak!«, brüllte jetzt Klaas. Selbst im fahlen Licht der Terrassen-Laterne konnte Hendrik erkennen, dass Klaas einen puterroten Kopf bekommen hatte. »Und weißt du auch warum?«, fuhr Klaas fort. »Weil wir uns im Osten dann auch den Arsch platt fahren dürfen! Und weißt du was das bedeutet?«
»Nein, weiß ich nicht!«, schrie Hendrik.
»Das bedeutet mehr Arbeit!«
Hendrik starrte Klaas aus großen Augen an. »Godverdomme!«
»Ja genau!«
»Unsere schönen Ärsche sind doch jetzt schon total platt!«, schrie Hendrik. In seiner Stimme lag Verzweiflung, was Klaas sofort die Tränen in die Augen trieb. Er konnte seinen besten Freund nicht leiden sehen. Spontan stand er auf, sein Freund tat es ihm gleich. Beide fielen sich in die Arme.
»Dein Arsch ist immer noch wunderschön!«, schrie Klaas.
»Deiner auch!«, schrie Hendrik zurück.
»Ich liebe dich, Mann!«, schrie Klaas.
»Ich dich auch! Komm, lass uns schlafen gehen und nicht mehr über den Feind nachdenken!«
»Du meinst den Big-Boss?«, schrie Klaas.
»Nein, die Arbeit!«
»Okay!«
Arm in Arm gingen sie durch die offene Terrassentür in ihr Hotelzimmer. Sie waren nicht schwul, dennoch waren sie in tiefer Freundschaft miteinander verbunden und wirkten auf so manchen wie ein altes Ehepaar.
Jablonsky lenkte den IFA W 50 durch die Nacht. Im westlichen Deutschland wirkte der Laster wie ein Relikt. Mitternacht war bereits durch. Jablonsky fühlte keine Müdigkeit, dennoch entschied er sich für eine Pause. Es war mehr eine Vernunftentscheidung. Er hatte ein paar anstrengende Stunden hinter sich, und es lag noch eine weite Strecke vor ihm. Sein Verstand sagte ihm, dass ein wenig Schlaf zum Gelingen der Mission unabdingbar sei.
Nach einer Weile tauchte das erste Hinweisschild auf eine nahende Raststätte auf. Jablonsky entschied sich, diese zu nehmen. Vielleicht hatte er Glück und er konnte sich, trotz der vorangeschrittenen Stunde, ein Hotelzimmer nehmen. In der DDR wäre das um diese Zeit unmöglich gewesen. Er konnte sich gut vorstellen, dass das in der BRD anders war, aber sicher war er sich nicht.
Die Abfahrt zur Raststätte tauchte auf. Jablonsky setzte den Blinker und verließ die Autobahn.
Nachdem er eine Tankstelle passiert hatte, folgte ein Parkplatz auf dem hauptsächlich LKWs standen. Dahinter folgten dann ein paar wenige Autos. Der IFA W 50 tuckerte langsam an ihnen vorbei. Im Hintergrund konnte Jablonsky das Hotel erkennen. Ein zweistöckiger Bau. Aus den verglasten Eingangstüren schimmerte ihm Licht entgegen. Vielleicht war das Hotel tatsächlich noch geöffnet. Links neben dem Hauptgebäude war ein flacher Anbau zu erkennen. Vermutlich die Hotelzimmer, dachte Jablonsky. Er wollte gerade zurücksetzen, um sich auf einen der ausgewiesenen LKW-Parkplätze zu stellen, da sah er den Wohnwagen. Es war nicht irgendeiner, nein, es war der Wohnwagen. Ein Hobby 520. Jablonsky war ein leidenschaftlicher Camper. Auch auf Sylt hatte er vor zu campen. Er besaß einen kleinen Qek, das Standardmodell der DDR. Schon immer hatte er von einem großen Hobby 520 geträumt, den er unlängst in einem Katalog gesehen hatte. Ein Besucher aus dem Westen hatte ihn in einem Restaurant auf einem Campingplatz liegen gelassen. Jablonsky hatte nicht gezögert und den Katalog an sich genommen. Seitdem hütete er ihn wie einen Schatz, und in manch trüben Stunden zauberte der Anblick der schönen West-Wohnwagen, ein Lächeln auf sein Gesicht. Und hier stand nun sein absoluter Favorit. Der Hobby 520.
Eigentlich hatte er vorgehabt, sich unterwegs einen gebrauchten Campingwagen zu kaufen. Auf der Fahrt in den Norden wäre er sicherlich an einem Wald- und Wiesenhändler mit Wohnwagen vorbei gekommen. Die Deutschen waren doch Weltmeister im Campen. Oder waren das die Holländer?
Egal, entscheidend war die Frage, die Jablonsky jetzt durch den Kopf schoss: Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass er bei einem Händler vorbeikam, der genau dieses Modell auf seinem Platz stehen hatte? – Sehr gering, beantwortete er sich die Frage selbst, und beschloss gleichzeitig, die Gelegenheit beim Schopf zu packen, und den vor sich stehenden Wohnwagen mitzunehmen. Genau wie beim Laster, kamen auch hier keine Beschwerden von seinem Gewissen. Sein eigentliches Vorhaben, auszuruhen, verschob er auf später. Während der Überfahrt nach Sylt, würde er genug Gelegenheit dazu haben. Er fuhr den Lastwagen ein kurzes Stück vor und stellte den Motor ab. Dann stieg er aus, schloss so leise wie