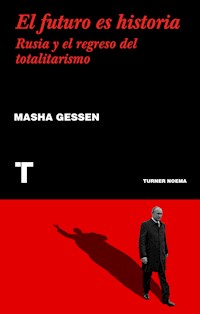10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wladimir Putin hat mit Hilfe einer kleinen, aber mächtigen Gruppe des russischen Geheimdienstes KGB, alten kommunistischen Potentaten und neureichen Oligarchen eines der größten Länder der Erde in eine Diktatur zurückverwandelt. Masha Gessen entlarvt den unscheinbaren Mann ohne Gesicht als das, was er wirklich ist: ein skrupelloser Machthaber, umgeben von Korruption und Terror.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Henning Dedekind und Norbert Juraschitz
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95654-3
© 2012 by Masha Gessen Titel der englischen Originalausgabe: »The Man Without A Face: The Unlikely Rise Of Vladimir Putin«, Granta Books, London 2012 Deutschsprachige Ausgabe: © 2012 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.de Umschlagfoto: Antoine Gyori/Sygma/Corbis
Prolog
Ich erwachte, weil mich jemand rüttelte. Kates Gesicht wirkte entsetzt. »Im Radio bringen sie etwas über Galina«, sagte sie halb flüsternd. »Und über eine Schusswaffe. Ich glaube … ich verstehe das nicht.«
Ich stand auf und taumelte in die winzige Küche, wo Kate das Frühstück zubereitet und dabei Echo Moskwy gehört hatte, den besten Talkradio- und Nachrichtensender des Landes.
Es war an einem für Moskauer Verhältnisse ungewöhnlich hellen und klaren Samstagmorgen im November. Ich machte mir keine großen Sorgen: Aus einem unerfindlichen Grund berührte mich Kates Angst nicht. Was immer sie gehört oder mit ihrem dürftigen Russisch missverstanden hatte, konnte der Beginn einer weiteren spannenden Geschichte sein. Als Chefkorrespondentin des führenden russischen Nachrichtenmagazins Itogi glaubte ich, einen rechtmäßigen Anspruch auf alle großen Geschichten zu haben. Und es gab jede Menge solcher Geschichten. In einem Land, das sich gerade wieder neu erfand, waren jede Stadt, jede Familie und jede Institution gewissermaßen unerforschtes Gebiet. Seit Beginn der Neunzigerjahre waren praktisch alle Stories, die ich schrieb, Geschichten, die vor mir noch niemand erzählt hatte. Ich verbrachte die Hälfte meiner Zeit außerhalb Moskaus, reiste in Konfliktgebiete, besuchte Goldminen, Waisenhäuser und Universitäten, verlassene Dörfer und aufblühende Ölstädte. Über all das schrieb ich Reportagen. Die Zeitschrift, die demselben Magnaten und Finanzier gehörte wie Echo Moskwy, belohnte mich dafür, indem sie meine extravagante Reiseaktivität niemals infrage stellte und meine Geschichten regelmäßig auf der Titelseite brachte.
Mit anderen Worten: Ich gehörte zu den jungen Leuten, die in den Neunzigern alles erreicht hatten. Viele jüngere und ältere Menschen hatten in den Jahren des Umbruchs viel verloren. Der älteren Generation hatten die Hyperinflation ihre Ersparnisse und die Zerschlagung sämtlicher Sowjet-Einrichtungen ihre Identität genommen. Die jüngere Generation wuchs auf im Schatten der Angst und häufig auch des Versagens ihrer Eltern. Ich hingegen war 24 Jahre alt, als die Sowjetunion zusammenbrach. Meine Altersgenossen und ich hatten die Neunziger für unseren beruflichen Erfolg genutzt und dabei die Strukturen und Institutionen einer neuen Gesellschaft erfunden. Zumindest dachten wir das. Selbst als Gewaltverbrechen in Russland zur Epidemie zu werden drohten, fühlten wir uns noch sicher. Wir beobachteten das organisierte Verbrechen und schrieben gelegentlich auch darüber, ohne jemals auf den Gedanken zu kommen, dass die Kriminalität Einfluss auf unsere eigene Existenz bekommen könnte. Darüber hinaus war ich überzeugt, dass alles nur besser werden könnte. Vor Kurzem hatte ich eine heruntergekommene, ehemals kommunale Wohnung direkt im Herzen Moskaus gekauft, die ich nun renovierte. Bald wollte ich aus dem Apartment ausziehen, das ich mit Kate bewohnte, einer britischen Journalistin, die für die Publikation einer Ölfirma arbeitete. Ich malte mir aus, in der neuen Wohnung eine Familie zu gründen. Genau an jenem Samstag hatte ich eine Verabredung mit dem Bauunternehmer, um die Ausstattung des Badezimmers auszusuchen.
Kate deutete auf den Ghettoblaster, als verströme er giftige Gase, und sah mich fragend an. Galina Starowoitowa, deren Namen der Nachrichtensprecher ständig wiederholte, war Mitglied des Unterhauses im Parlament, eine von Russlands bekanntesten Politikerinnen und eine Freundin. Ich will sie hier kurz vorstellen:
Als die russische Großmacht Ende der Achtziger vor dem Zusammenbruch stand, wurde aus der Ethnografin Starowoitowa eine pro-demokratische Aktivistin und eine äußerst prominente Fürsprecherin der Menschen von Berg-Karabach, einer armenischen Enklave in Aserbeidschan, in der nun einer der ersten ethnischen Konflikte ausgebrochen war, die mit der Auflösung des Ostblocks einhergingen. Wie viele Akademiker, die politisch aktiv wurden, stand sie anscheinend von Anfang an im Licht der Öffentlichkeit. Zwar hatte sie seit ihrer Kindheit in Leningrad gelebt, doch nominierten die Armenier sie als Repräsentantin für den ersten quasi-demokratisch gewählten Obersten Sowjet. Im Jahre 1989 wurde sie mit überwältigender Mehrheit ins Amt gewählt. Im Obersten Sowjet wurde sie Leiterin der Interregionalen Gruppe, einer pro-demokratischen Minderheitenfraktion, zu deren Führung auch Andrej Sacharow und Boris Jelzin gehörten. Als Jelzin 1990 zum russischen Präsidenten gewählt wurde – damals ein Amt von vorrangig repräsentativer und gesellschaftlicher Bedeutung –, wurde Galina seine engste Beraterin, die er offiziell in ethnischen Fragen und inoffiziell in allen möglichen anderen Belangen konsultierte, darunter auch bei Regierungsbildungen. Im Jahre 1992 überlegte Jelzin sogar, Galina mit dem Amt des Verteidigungsministers zu betrauen. Die Ernennung eines Zivilisten, einer Frau, deren Weltanschauung an Pazifismus grenzte, wäre eine große Geste im klassischen Jelzin-Stil der frühen Neunziger gewesen, eine Botschaft, dass in Russland und vielleicht auch in der Welt nichts so bleiben würde, wie es einmal war.
Dass nichts so bleiben sollte, wie es war, bildete den Kern von Galinas Agenda, die selbst nach den Maßstäben pro-demokratischer Aktivisten zu Beginn der Neunziger radikal war. Sie gehörte zu einer kleinen Gruppe von Rechtsanwälten und Politikern, und diese Aktivisten versuchten vergeblich, die Kommunistische Partei der UdSSR anzuklagen. So verfasste sie einen Gesetzesentwurf zur lustrasija, zur Lustration1 – einem Konzept, das nach dem altgriechischen Wort für »Reinigung« benannt war. In den ehemaligen Ostblockstaaten bezeichnete der Begriff damals den Prozess, durch welchen ehemalige Funktionäre der Partei und der Geheimdienste aus öffentlichen Ämtern verbannt wurden. Im Jahre 1992 erfuhr Galina, dass der KGB erneut eine interne Parteiorganisation aufgebaut hatte2 – ein unmittelbarer Verstoß gegen das Dekret Jelzins zum Verbot der KPdSU, das dieser nach dem gescheiterten Putsch im August 1991 erlassen hatte.3 Als sie bei einer öffentlichen Versammlung im Juli 1992 Jelzin mit dieser Tatsache konfrontierte, kanzelte er sie rüde ab und signalisierte dadurch sowohl das Ende ihrer Karriere in seiner Regierung als auch seine eigene zunehmend versöhnliche Haltung gegenüber den Geheimdiensten und den vielen Altkommunisten, die an der Macht oder ihr zumindest nahe geblieben waren.
Von den Regierungsgeschäften ausgeschlossen, machte sich Galina für das Lustrationsgesetz stark. Als sie damit keinen Erfolg hatte, kehrte sie der Politik ganz den Rücken und siedelte in die Vereinigten Staaten über, wo sie zunächst am Friedensinstitut in Washington tätig war und später an der Brown University lehrte.
Als ich Galina zum ersten Mal traf, konnte ich sie gar nicht sehen: Sie war in einem Meer von Hunderttausenden Menschen verborgen, die am 28. März 1991 zum Majakowski-Platz in Moskau geströmt waren, um an einer Kundgebung für Jelzin teilzunehmen, der kurz davor vom sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow öffentlich kritisiert worden war. Zudem hatte Gorbatschow im selben Monat ein Dekret erlassen, das alle Proteste in der Stadt untersagte.4 An jenem Morgen rollten Panzer in die Stadt und positionierten sich so, dass die Menschen zu der verbotenen pro-demokratischen Kundgebung kaum noch durchkamen. Im Gegenzug teilten die Organisatoren ihre Kundgebung in zwei Veranstaltungen auf, um den Menschen zu ermöglichen, wenigstens einen der beiden Orte zu erreichen. Es war mein erster Besuch in Moskau, nachdem ich zehn Jahre als Emigrantin in den USA gelebt hatte. Zufällig hielt ich mich in der Wohnung meiner Großmutter in der Nähe des Majakowski-Platzes auf. Ich stellte fest, dass die Hauptstraße, die Twerskaja, blockiert war, also nahm ich einen Schleichweg durch einige Hinterhöfe. Als ich schließlich einen Torbogen durchschritt, fand ich mich mitten im Getümmel wieder. Ich konnte nichts sehen außer den Hinterköpfen der Menschen und unzähligen, fast identischen grauen und schwarzen Wollmänteln. Ich konnte jedoch hören, wie eine Frauenstimme über die Menge hinweg schmetterte und von der Unverletzlichkeit des von der Verfassung garantierten Versammlungsrechts sprach. Ich wandte mich an einen Mann, der neben mir stand. In der einen Hand trug er eine gelbe Plastiktüte, an der anderen führte er ein kleines Kind. »Wer spricht da?«, wollte ich wissen. »Starowoitowa«, entgegnete er. In diesem Moment führte die Frau die Menge in einen fünfsilbigen Sprechgesang hinein, der in der ganzen Stadt widerzuhallen schien: »Ros-si-ja! Jel-zin!« Kaum ein halbes Jahr später brach die Sowjetunion auseinander, und Jelzin wurde zum Staatsoberhaupt eines neuen, demokratischen Russland gewählt. Dass dies unvermeidlich war, wurde vielen Menschen, darunter auch mir, an jenem Tag im März bewusst, als die Bürger Moskaus gegen die kommunistische Regierung und ihre Panzer aufbegehrten und darauf beharrten, auf einem öffentlichen Platz ihre Meinung frei äußern zu dürfen.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich Galina zum ersten Mal persönlich begegnete, doch wir freundeten uns in dem Jahr miteinander an, als sie an der Brown University unterrichtete – sie war regelmäßig zu Gast im Haus meines Vaters im Großraum Boston. Ich pendelte zwischen den Vereinigten Staaten und Moskau hin und her, und Galina wurde für mich eine Art Mentorin auf dem Gebiet der russischen Politik, wenngleich sie gelegentlich betonte, dass sie sich vollkommen aus der Politik zurückgezogen habe. Diese distanzierte Haltung muss sie im Dezember 1994 abgelegt haben, als Jelzin in der abtrünnigen Republik Tschetschenien eine Militäroffensive startete. Seine damaligen Berater hatten ihm offenbar versichert, dass der Aufstand von der Zentralregierung schnell und schmerzlos niedergeschlagen werden könne. Galina betrachtete den neuen Krieg als die Katastrophe, die er zweifellos war, und als bislang größte Bedrohung der russischen Demokratie. Im Frühjahr war sie im Ural Vorsitzende eines Kongresses mit dem Ziel der Wiedererweckung ihrer Partei Demokratisches Russland, die einst eine der stärksten politischen Kräfte des Landes gewesen war.
Ich berichtete damals für eine führende russische Zeitung über den Kongress, doch auf meiner Reise nach Tscheljabinsk – ein dreistündiger Flug und anschließend eine dreistündige Busfahrt – wurde ich überfallen und ausgeraubt. Als ich kurz vor Mitternacht entnervt und ohne Bargeld endlich in Tscheljabinsk eintraf, lief ich in der Hotellobby Galina über den Weg. Sie hatte gerade einen langen Tag angespannter Gespräche hinter sich. Bevor ich noch etwas sagen konnte, bugsierte sie mich in ihr Zimmer, drückte mir ein Glas Wodka in die Hand und setzte sich an ein gläsernes Kaffeetischchen, um mir ein paar Salamibrote zu machen. Außerdem lieh sie mir das Geld für mein Rückreiseticket nach Moskau.
Galina hegte eindeutig mütterliche Gefühle für mich, war ich doch genauso alt wie ihr Sohn. Dieser war mit seinem Vater nach England gezogen, als seine Mutter eine wichtige politische Rolle zu spielen begann. Die Szene mit den Salamibroten bedeutete jedoch mehr als Gastfreundschaft und Mütterlichkeit: In einem Land, dessen politische Vorbilder vom Kommissar in Lederjacke bis hin zum altersschwachen Apparatschik reichten, wollte Galina einen vollkommen neuen Typus kreieren, eine Politikerin, die auch ein menschliches Antlitz hatte. Bei einer Versammlung russischer Feministinnen schockierte sie das Publikum, als sie ihren Rock hob und ihre Beine entblößte, um zu beweisen, dass sie keine O-Beine hatte, denn ein Politiker hatte sie abfällig als o-beinig bezeichnet. Einem der ersten russischen Hochglanzmagazine gegenüber sprach sie über die Nöte, die jemand, der so stark übergewichtig war wie sie, beim Kauf von Kleidung hatte. Aber von solchen Anekdoten abgesehen verfolgte sie beharrlich und mit aller Kraft ihr legislatives Programm. Ende 1997 versuchte sie abermals, ihren Gesetzesentwurf zur Lustration durchzudrücken – und scheiterte. Im Jahre 1998 stürzte sie sich in eine Untersuchung zur Wahlkampffinanzierung einiger ihrer mächtigsten politischen Feinde, darunter des kommunistischen Sprechers der Duma (die Kommunistische Partei war wieder legal und beim Volk sehr beliebt).5
Ich hatte sie gefragt, warum sie sich dazu entschlossen habe, in die Politik zurückzukehren, obwohl sie doch ganz genau wisse, dass sie nie wieder den Einfluss erlangen werde, den sie einmal gehabt habe. Sie hatte mehrfach versucht, mir zu antworten, und war dabei jedes Mal über ihre eigene Motivation gestolpert. Schließlich rief sie mich aus einem Krankenhaus an, in dem sie sich einer Operation unterziehen wollte: Kurz vor der Anästhesie hatte sie ihre Lebenshaltung gründlich überdacht und schließlich ein Gleichnis gefunden, das ihr gefiel. »Es gibt eine alte griechische Legende über Harpyien«, sagte sie zu mir. »Das sind Schattenwesen, die nur dann lebendig werden können, wenn sie menschliches Blut trinken. Das Leben eines Gelehrten ist ein Schattendasein. Wenn man an der Gestaltung der Zukunft teilhat – und sei es an einem noch so kleinen Teil der Zukunft, denn darum geht es in der Politik –, dann kann so ein Schattenwesen zum richtigen Leben erwachen. Dafür muss man allerdings Blut trinken, und zwar auch das eigene.«
Jetzt folgte ich Kates starrem Blick zum Ghettoblaster, der ein bisschen knisterte, als strapazierten ihn die Worte, die aus seinen Lautsprechern drangen. Der Nachrichtensprecher sagte, Galina sei vor einigen Stunden im Treppenhaus ihres Mietshauses in Sankt Petersburg erschossen worden. Am Abend erst war sie mit dem Flugzeug aus Moskau eingetroffen. Sie und ihr Assistent Ruslan Linkow hatten einen kurzen Zwischenstopp im Haus von Galinas Eltern eingelegt, bevor sie zu ihrer Wohnung am Gribojedow-Ufer weitergefahren waren, einer der schönsten Straßen der Stadt. Als sie das Gebäude betraten, war das Treppenhaus unbeleuchtet. Die Schützen, die ihnen dort auflauerten, hatten die Glühbirnen herausgedreht. Trotzdem stiegen sie die Treppen hinauf und sprachen dabei über ein Klageverfahren, das eine nationalistische Partei kürzlich gegen Galina geführt hatte. Dann gab es ein klatschendes Geräusch, und ein Licht blitzte auf. Galina hörte auf zu sprechen. Linkow schrie, »Was macht ihr da?«, und rannte in Richtung des Geräuschs und des Lichts. Er wurde von den ersten beiden Kugeln getroffen.
Ruslan verlor das Bewusstsein, erlangte es aber wohl lange genug wieder, um von seinem Mobiltelefon aus einen Journalisten anzurufen. Dieser Journalist verständigte die Polizei. Jetzt, so erzählte mir die Stimme aus dem Ghettoblaster, war Galina tot, und Ruslan, den ich ebenfalls kannte und schätzte, lag in kritischem Zustand im Krankenhaus.
Wäre dieses Buch ein Roman, hätte die Figur, die ich bin, bei der Nachricht vom Tode der Freundin wahrscheinlich alles stehen und liegen gelassen und unverzüglich etwas unternommen – irgendetwas, das den Ereignissen angemessen gewesen wäre. Sie hätte sofort erkannt, dass ihre Welt nie wieder dieselbe sein würde. In Wirklichkeit jedoch erkennen wir nur selten unmittelbar, wenn ein Ereignis unser Leben unwiderruflich verändert, oder wie wir uns verhalten sollen, wenn sich eine Tragödie ereignet. Also ging ich die Ausstattung meines neuen Badezimmers aussuchen. Erst als der Leiter des Bautrupps, der mich begleitete, sagte, »Haben Sie das von Starowoitowa gehört?«, blieb ich auf einmal wie angewurzelt stehen. Ich erinnere mich, dass ich auf meine Stiefel und den Schnee hinabstarrte, der unter den Füßen Tausender künftiger Immobilienbesitzer grau und hart geworden war. »Wir hatten den Auftrag, eine Garage für sie zu bauen«, sagte er. In diesem Augenblick, als ich überlegte, dass meine Freundin diese Garage niemals brauchen würde, wurde mir erst bewusst, wie hilflos, verängstigt und wütend ich eigentlich war. Ich sprang in mein Auto, fuhr zum Bahnhof und reiste nach Sankt Petersburg. Ich wollte eine Geschichte darüber schreiben, was Galina Starowoitowa zugestoßen war.
In den folgenden Jahren verbrachte ich viele Wochen in Sankt Petersburg. Ich war an einer Story dran, die noch niemand erzählt hatte – aber es war eine viel größere Story als alle, die ich bisher geschrieben hatte, größer noch als die über den kaltblütigen Mord an einer der bekanntesten politischen Gestalten des Landes. In Sankt Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands, fand ich einen Staat im Staate vor. Es war ein Ort, an dem der KGB – die Organisation, gegen welche Starowoitowa ihren wichtigsten und aussichtslosesten Kampf geführt hatte – übermächtig war.
Lokalpolitiker und Journalisten glaubten, dass ihre Telefone und Büros abgehört wurden, und sie hatten zweifellos recht. Es war ein Ort, an dem die Ermordung führender Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft an der Tagesordnung war. Außerdem war es ein Ort, an dem man durch geplatzte Geschäfte leicht hinter Schloss und Riegel geraten konnte. Mit anderen Worten: Die Situation war ungefähr so, wie sich die Lage wenige Jahre später in ganz Russland entwickelte, als jene Leute an die Macht im Staate gelangten, die in den Neunzigern Sankt Petersburg beherrscht hatten.
Ich fand nie heraus, wer den Auftrag zur Ermordung Starowoitowas gegeben hatte (die beiden Männer, die man deswegen Jahre später vor Gericht stellte, waren nur Handlanger). Ich fand auch nie heraus, weshalb sie liquidiert worden war. Doch ich fand heraus, dass in den Neunzigern, als junge Leute wie ich ein neues Leben in einem neuen Land aufbauten, eine Parallelwelt neben der unsrigen existiert hatte. Sankt Petersburg hatte viele Schlüsselmerkmale des Sowjetstaates konserviert und perfektioniert: Es war ein Regierungssystem, das seine Feinde eliminierte – ein paranoides, geschlossenes System, das darauf ausgerichtet war, alles zu kontrollieren und alles zu vernichten, was es nicht kontrollieren konnte. Es war unmöglich zu ergründen, was letztlich der Anlass für die Ermordung Starowoitowas gewesen war, aber sie war als Feindin des Systems ohnehin eine gebrandmarkte Frau, eine Todgeweihte gewesen. Ich war schon in vielen Krisengebieten gewesen und hatte buchstäblich unter Granatbeschuss gearbeitet, doch dies war die erschreckendste Geschichte, die ich jemals schreiben musste. Nie zuvor war ich gezwungen gewesen, eine Wirklichkeit zu beschreiben, die so gefühllos und grausam, so kalt und gnadenlos, so korrupt und ruchlos war.
Nur wenige Jahre später lebte ganz Russland in dieser Wirklichkeit. Wie es dazu kam, ist die Geschichte, die ich in diesem Buch erzählen will.
Der Zufallspräsident
Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Land, aber niemanden, der es regiert. Dies war das Dilemma, mit dem sich Boris Jelzin und sein engster Kreis 1999 konfrontiert glaubten.
Jelzin war seit langer Zeit schwer krank. Er hatte mehrere Herzinfarkte erlitten und sich kurz nach seiner Wiederwahl im Jahre 1996 einer Operation am offenen Herzen unterziehen müssen. Die meisten glaubten, dass er zu viel trank – in Russland ein weitverbreitetes und nicht zu verbergendes Laster, wenngleich Teile seines nächsten Umfelds darauf beharrten, Jelzins gelegentliche Verhaltensauffälligkeiten und geistige Aussetzer seien keine Folge überhöhten Alkoholkonsums, sondern vielmehr Zeichen seiner körperlichen Gebrechen. Was auch immer der Grund war – jedenfalls hatte Jelzin zum Entsetzen seiner Anhänger und zur Enttäuschung seiner Wähler bei einigen Staatsbesuchen verwirrt gewirkt oder war einfach verschwunden.
Als sich Jelzins Beliebtheit 1999 dem einstelligen Prozentbereich näherte, war er längst nicht mehr der Politiker, der er einst gewesen war. Er bediente sich immer noch vieler Mittel, die ihn groß gemacht hatten, etwa wenn er überraschende politische Ernennungen vornahm oder Phasen strenger Kontrolle mit einem Laissez-faire-Regierungsstil abwechselte und somit seine übermächtige Persönlichkeit strategisch in den Vordergrund stellte – doch ähnelte er mittlerweile einem erblindeten Boxer, der im Ring wahllos um sich schlägt und seine eigentlichen Ziele verfehlt.
In der zweiten Hälfte seiner zweiten Amtszeit krempelte Jelzin seine Regierung mehrfach überstürzt um. Er feuerte einen Ministerpräsidenten, der seit sechs Jahren im Amt war, und ersetzte ihn durch einen 36-jährigen Unbekannten, nur um sechs Monate später den alten Ministerpräsidenten wieder einzusetzen – und ihn drei Wochen später erneut seines Postens zu entheben. Jelzin ernannte einen Nachfolger nach dem anderen, nur um sich mit allen in einer sehr öffentlichen Weise zu überwerfen, was nicht nur die Objekte seines Missfallens demütigte, sondern auch alle anderen peinlich berührte, die Zeugen dieser Szenen wurden.
Je unberechenbarer Jelzin wurde, desto mehr Feinde machte er sich – und desto mehr schlossen sich seine Feinde zusammen. Ein Jahr vor dem Ende seiner letzten Amtszeit stand er an der Spitze einer sehr wackeligen Pyramide. Durch seine vielen Umstrukturierungen hatte er mehrere Generationen fähiger Politiker verschlissen. Viele Führungspositionen in Ministerien und staatlichen Behörden waren nun mit jungen Kleingeistern besetzt, die in das Vakuum an der Spitze gesaugt worden waren. Jelzins Vertraute waren mittlerweile so wenige und so weltabgeschieden, dass sie in der Presse als »die Familie« bezeichnet wurden. Zu diesem engsten Zirkel gehörten Jelzins Tochter Tatjana; sein Stabschef Alexander Woloschin; sein ehemaliger Stabschef Walentin Jumaschew, den Tatjana später heiratete; ein weiterer ehemaliger Stabschef; der Ökonom und Architekt der russischen Privatisierung, Anatoli Tschubais, und der Unternehmer Boris Beresowski. Von den »Oligarchen« – jenen Geschäftsleuten, die unter Jelzin superreich geworden waren und ihm dies durch die Orchestrierung seiner Wiederwahlkampagne gedankt hatten – war Beresowski der einzige, der dem Präsidenten unerschütterlich die Treue hielt.
Jelzin war weder dazu berechtigt noch in der gesundheitlichen Verfassung, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Zudem hatte er allen Grund, einen feindseligen Nachfolger zu fürchten. Jelzin war am Ende seiner Amtszeit höchst unpopulär, gerade weil er der erste Politiker gewesen war, dem die Russen jemals vertraut hatten. Die Enttäuschung, die sein Volk nun verspürte, war ebenso groß, wie die Unterstützung, die er einst genossen und die motivierend auf ihn gewirkt hatte.
Das Land war ausgelaugt, traumatisiert und enttäuscht. Ende der Achtziger hatten die Menschen Hoffnung und Einheit erlebt. Dieses neue Selbstverständnis war im August 1991 auf dem Höhepunkt, als die Junta, die gegen Gorbatschows Regierung geputscht hatte, gescheitert war. Das Land hatte all seine Hoffnungen auf Boris Jelzin gesetzt, den ersten frei gewählten russischen Staatschef der Geschichte. Doch das russische Volk stürzte in eine Hyperinflation, die innerhalb weniger Monate die gesamten Ersparnisse der Menschen verschlang. Bürokraten und skrupellose Unternehmer plünderten sich gegenseitig und den Staat ungeniert aus, und schließlich entstand eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheit nie gekannten Ausmaßes. Am schlimmsten aber war, dass viele und womöglich alle Russen den Glauben an eine gesicherte Zukunft verloren – und damit das Gefühl der Einigkeit, das sie durch die Achtziger- und frühen Neunzigerjahre getragen hatte.
Die Jelzin-Regierung hatte den fatalen Fehler begangen, sich den Sorgen und Nöten des Landes zu verschließen. Im Lauf eines Jahrzehnts zog sich der einstige Populist Jelzin, der je nach den Erfordernissen der Stunde mit dem Bus gefahren und auf Panzer geklettert war, mehr und mehr in eine abgeschirmte und schwer bewachte Welt schwarzer Limousinen und nicht öffentlicher Konferenzen zurück. Sein erster Ministerpräsident, der brillante junge Wirtschaftswissenschaftler Jegor Gaidar, der zum Sinnbild für die post-sowjetischen Wirtschaftsreformen wurde, verkündete öffentlich, dass er die Bürger für zu dumm halte, um sie an einer Diskussion über Reformen zu beteiligen. Das russische Volk, das sich in der Stunde der Not von seiner Führung im Stich gelassen fühlte, suchte Trost in der Nostalgie – nicht so sehr in der kommunistischen Ideologie, die ihre inspirierende Wirkung schon Jahrzehnte zuvor verloren hatte, sondern in der Sehnsucht nach einer Rückkehr Russlands in die Rolle einer Supermacht. Im Jahr 1999 war eine gefährliche Aggression im Schwange, die ein Grund dafür war, dass sich Jelzin und die »Familie« zu Recht fürchteten.
Schmerz und Aggression machen die Menschen oft blind. Die Menschen in Russland waren daher überwiegend nicht in der Lage, die tatsächlichen Errungenschaften der Dekade Jelzin zu erkennen. Trotz vieler, vieler Fehlentscheidungen in dieser Zeit war es Russland gelungen, große Teile der Wirtschaft zu privatisieren; die größten privatisierten Unternehmen hatte man auf Vordermann gebracht und wettbewerbsfähig gemacht. Trotz gestiegener Ungleichheit hatten sich insgesamt die Lebensumstände der Mehrheit der Russen verbessert: Die Anzahl der Haushalte mit Fernsehern, Waschmaschinen und Kühlschränken wuchs; die Zahl privater Pkw verdoppelte sich; die Anzahl derer, die sich einen Auslandsurlaub leisten konnten, verdreifachte sich sogar zwischen 1993 und 2000.1 Im August 1998 hatte Russland seine Schulden nicht mehr bedienen können, was zu einem kurzen, aber signifikanten Anstieg der Inflation geführt hatte; danach war die Wirtschaft jedoch stetig gewachsen.
Auch die Medienlandschaft florierte. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Russen aus eigener Kraft aufgeholt: Es gab nicht nur ein anspruchsvolles, gutes Fernsehprogramm, sondern auch eine unüberschaubare Anzahl von Printmedien und etliche aufblühende elektronische Publikationen.
Viele, wenn auch sicher nicht alle Infrastrukturprobleme des Landes waren in Angriff genommen worden: Die Intercity-Züge fuhren wieder pünktlich, die Post funktionierte, die Zahl der Haushalte mit Telefonanschluss steig. Ein russisches Unternehmen, ein 1992 gegründeter Mobilfunkdienstanbieter, war sehr erfolgreich in New York an die Börse gegangen.
Trotz alledem erwies sich die Regierung als unfähig, das Volk davon zu überzeugen, dass nun alles besser war als vor wenigen Jahren und auf jeden Fall besser als vor einem Jahrzehnt. Das Gefühl der Unsicherheit, das die Menschen verspürten, seit die Sowjetunion zusammengebrochen war, blieb so übermächtig, dass jeder Rückschlag die Erwartung des drohenden Untergangs zu bestätigen schien, während Erfolge in Angst vor künftigen Verlusten umgemünzt wurden. Jelzin konnte nur auf seine populistischen Methoden zurückgreifen; Erwartungen infrage stellen oder neu definieren konnte er nicht. Er konnte dem Land nicht dabei helfen, neue Ideale und eine neue Rhetorik zu finden. Doch immerhin versuchte er, den Menschen zu geben, was sie wollten.
Doch was sie wollten, war auf keinen Fall Jelzin. Zig Millionen machten ihn persönlich für jedes Unglück verantwortlich, das ihnen in den vergangenen zehn Jahren widerfahren war, für ihre enttäuschten Hoffnungen und ihre zerstörten Träume, ja, so schien es, sogar für ihre verlorene Jugend. Sie hassten ihn leidenschaftlich. Wer immer das Land nach Jelzin regieren sollte, hätte sich durch die Verfolgung seines Vorgängers leicht beliebt machen können. Was der gesundheitlich angeschlagene Präsident daher am meisten fürchtete, war, dass eine Partei namens Otetschestwo – Wsja Rossija (Vaterland – ganz Russland; der Name ist ein Hybrid aus zwei Begriffen und klingt auf Russisch ebenso holprig wie auf Deutsch), welcher ein ehemaliger Ministerpräsident und mehrere Bürgermeister und Gouverneure vorstanden, an die Macht gelangen und sich an Jelzin und der Familie rächen könnte. Womöglich hätte er dann den Rest seiner Tage im Gefängnis zubringen müssen.
An dieser Stelle kommt Wladimir Putin ins Spiel.
Laut Beresowski sah sich die »Familie« nach einem geeigneten Nachfolger um. Beresowskis Version der Geschichte krankt jedoch an gewaltigen Ungereimtheiten. Eine kleine Gruppe von Leuten, isoliert und in die Enge getrieben, suchte nach jemandem, der die größte zusammenhängende Landmasse der Erde regieren könnte, mit einer enormen Anzahl nuklearer Sprengköpfe und einer tragischen Geschichte. Einzig die Liste der Qualifikationen, die sie als Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringen mussten, war vermutlich noch kürzer war als die Liste der denkbaren Kandidaten. Alle, die über echtes politisches Kapital verfügten und entsprechend ambitioniert waren – kurz gesagt: alle, die für das Amt genug Format besaßen –, hatten Jelzin bereits den Rücken gekehrt. Die Kandidaten waren allesamt Durchschnittsfiguren in grauen Anzügen.
Beresowski behauptet, Putin sei sein Protegé gewesen. Er berichtete mir in seiner Villa in der Nähe von London (ich hielt mein Versprechen, deren genaue Lage zu vergessen, sobald ich wieder in der Stadt war), er habe Putin 1990 kennengelernt, als er seine geschäftlichen Aktivitäten auf Leningrad auszudehnen gedachte. Beresowski war ein Akademiker, der sein Geld als Autohändler machte. Sein Unternehmen verkaufte Fahrzeuge der Marke Lada – wie die Russen ein schäbiges Auto auf Basis eines längst veralteten Fiats nannten. Daneben importierte er gebrauchte europäische Wagen und baute Werkstätten, in denen die von ihm verkauften Autos repariert werden konnten.2 Putin, damals noch Stellvertreter des Stadtratsvorsitzenden Anatoli Sobtschak, hatte Beresowski dabei geholfen, eine Werkstatt in Leningrad zu eröffnen, und ein Bestechungsgeld abgelehnt – was bewirkte, dass sich Beresowski an ihn erinnerte. »Er war der erste Bürokrat, der keine Schmiergelder annahm«, versicherte mir Beresowski. »Im Ernst. Das machte großen Eindruck auf mich.«3
Beresowski machte es sich zur Gewohntheit, in Putins Büro »vorbeizuschauen«, wenn er in Sankt Petersburg war. Bedenkt man Beresowskis hektisches Wesen, dann schaute der Oligarch wahrscheinlich wirklich nur kurz herein, quasselte aufgeregt und stürmte wieder heraus – möglicherweise sogar, ohne viel von den Reaktionen seines Gastgebers mitzubekommen. Als ich mit Beresowski sprach, konnte er sich kaum an eine Äußerung Putins erinnern. »Ich betrachtete ihn jedoch als eine Art Verbündeten«, sagte er. Es beeindruckte ihn auch, dass Putin, der zum stellvertretenden Bürgermeister von Sankt Petersburg aufstieg, als Sobtschak Bürgermeister wurde, nach dessen gescheiterter Wiederwahl ein Amt unter dem neuen Bürgermeister ausschlug.
Als Putin 1996 nach Moskau zog, um eine Verwaltungsaufgabe im Kreml zu übernehmen, sahen sich die beiden häufiger, meist in dem exklusiven Club, den Beresowski im Stadtzentrum unterhielt.
Beresowski hatte seine Verbindungen genutzt, um an den zwei Enden eines Häuserblocks Verkehrsschilder mit der Aufschrift »Durchfahrt verboten« aufstellen zu lassen. Damit kennzeichnete er einen bestimmten Abschnitt einer Anwohnerstraße de facto als eigenes Territorium. (Die Bewohner mehrerer Apartmenthäuser auf der anderen Straßenseite konnten nun nicht mehr vor ihre Häuser fahren, ohne ein Bußgeld zu riskieren.)
Anfang 1999 war Beresowski jedoch in Bedrängnis geraten – wie der Rest der »Familie« auch, oder sogar noch mehr: Er war der Einzige der Clique, der an seiner gesellschaftlichen Stellung in Moskau hing. Verstrickt in einen ebenso verzweifelten wie vergeblichen Machtkampf mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Jewgeni Primakow, der die Anti-Jelzin-Kampagne führte, war Beresowski in gewisser Weise zum Paria geworden. »Es war am Geburtstag meiner Frau Lena«, erzählte er mir. »Wir beschlossen, nur wenige Leute einzuladen, weil wir nicht wollten, dass jemand seine Beziehungen zu Primakow strapazieren musste. Also kamen nur unsere Freunde. Dann teilte mir mein Sicherheitsdienst mit: ›Boris Abramowitsch, Wladimir Putin wird in etwa zehn Minuten eintreffen.‹ Und ich sagte: ›Was ist los?‹ Und er sagte: ›Er will Lena zum Geburtstag gratulieren.‹ Tatsächlich erschien er zehn Minuten später mit einem Blumenstrauß. Ich sagte: ›Wolodja, warum machen Sie das? [Wolodja, Wowa, Wolod’ka und Wowka sind alles Kurzformen von Wladimir, die hier in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Gebräuchlichkeit aufgeführt sind.] Sie haben doch schon genug Probleme. Wollen Sie denn eine große Schau daraus machen?‹ Er entgegnete: ›Ja, ich will eine große Schau daraus machen.‹
Und damit zementierte er unsere Beziehung. Es begann damit, dass er kein Schmiergeld annahm. Dann weigerte er sich, Sobtschak im Stich zu lassen. Und schließlich dieser Besuch, der mich davon überzeugte, dass er ein guter, ehrlicher Mensch war – ein Mann vom KGB, ja, aber trotzdem ein Mensch.« Diese Eindrücke gingen Beresowski nicht mehr aus dem Kopf.
Freilich war er aus demselben Holz geschnitzt wie die anderen russischen Unternehmer der ersten Stunde. Wie sie alle war auch er sehr intelligent, gut ausgebildet und äußerst risikofreudig. Wie die meisten war auch er Jude, was ihn seit seinen Kindertagen zum Außenseiter gemacht hatte. Wie alle anderen besaß auch er gewaltigen Ehrgeiz und eine unerschöpfliche Energie. Er war ein Doktor der Mathematik, der mit einem Autoimport- und Serviceunternehmen ins Geschäftsleben eingestiegen war. Mit geschickten Kreditgeschäften hatte er in der Hyperinflation den größten russischen Autobauer um Millionen von Dollar geprellt.4 Anfang und Mitte der Neunziger versuchte er sich im Bankgeschäft, behielt einen Fuß in der Autobranche, erwarb einen Teil einer Ölgesellschaft und, was am wichtigsten war, wurde der größte Anteilseigner des staatlichen Fernsehsenders Kanal Eins, des meistgesehenen Fernsehsenders des Landes – was ihm den direkten Zugang zu 98 Prozent der russischen Haushalte verschaffte.5
Wie andere Oligarchen investierte auch Beresowski 1996 in Jelzins Wiederwahlkampagne. Im Gegensatz zu anderen nutzte er dies jedoch dazu, um sich politisch in den Vordergrund zu spielen. Er fuhr kreuz und quer durchs Land, handelte politische Deals aus, führte Friedensverhandlungen in Tschetschenien und fühlte sich sichtlich wohl im Rampenlicht. Er kultivierte das Image eines Königsmachers, wobei er seinen eigenen Einfluss zweifellos überschätzte. Andererseits glaubte er bestimmt auch nur die Hälfte von dem, was er sagte oder andeutete. Ein paar aufeinanderfolgende Generationen von Auslandskorrespondenten in Russland waren jedenfalls der Ansicht, dass der Strippenzieher Beresowski der eigentliche Herrscher des Landes sei.
Niemand ist leichter zu manipulieren als ein Mann, der seinen eigenen Einfluss überschätzt. Als die »Familie« nach dem künftigen Herrscher Russlands Ausschau hielt, kam es zu den ersten von mehreren Treffen zwischen Beresowski und Putin. Letzterer war inzwischen Chef der russischen Geheimpolizei. Jelzin hatte wiederholt sämtliche Spitzenpositionen ausgewechselt, und der FSB – der Föderale Sicherheitsdienst, wie die Nachfolgeorganisation des KGB nun genannt wurde – bildete dabei keine Ausnahme. Wenn man Beresowski Glauben schenken darf, hatte er Putin bei Jelzins Stabschef Walentin Jumaschew persönlich empfohlen. »Ich sagte: ›Wir haben doch Putin, der im Geheimdienst tätig war, oder nicht?‹ Und Walja sagte: ›Ja, stimmt.‹ Darauf sagte ich: ›Hör mal, ich glaube, das wäre eine Option. Denk darüber nach. Er ist schließlich ein Freund.‹ Walja sagte: ›Er hat einen ziemlich niedrigen Dienstgrad.‹ Ich entgegnete: ›Na ja, da ist eine Revolution im Gange, alles ist völlig durcheinander, also …‹«
Als Beschreibung der Entscheidungsfindung für die Ernennung des höchsten Geheimdienstagenten einer Nuklearmacht klingt dieses Gespräch so vollkommen absurd, dass ich gewillt bin, es für wahr zu halten. Putin hatte tatsächlich einen niedrigen Dienstgrad: Er hatte den aktiven Dienst im Rang eines Oberstleutnant verlassen und war als Reservist automatisch zum Oberst befördert worden. Später behauptete er, man habe ihm die Sterne eines Generals angeboten, als er den FSB übernahm, er habe diese Ehre jedoch ausgeschlagen. »Man braucht keinen General, um Oberste zu kommandieren«, erklärte seine Frau diese Entscheidung. »Man braucht jemanden, der dazu fähig ist.«6
Ob er nun dazu fähig war oder nicht, Putin fühlte sich in seiner Position beim FSB jedenfalls erkennbar unsicher. Rasch begann er, die Top-Positionen in der föderalen Struktur mit Leuten zu besetzen, die er aus dem Leningrader KGB kannte. Zwischenzeitlich fühlte er sich nicht einmal in seinem eigenen Büro sicher: Wann immer er sich mit Beresowski traf, verlegten die beiden ihre Gespräche in einen stillgelegten Fahrstuhlschacht hinter dem Büro. Dies war nach Putins Ansicht der einzige abhörsichere Ort in dem Gebäude. In dieser tristen Lokalität traf sich Beresowski fast täglich mit Putin, um über seinen Kampf gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Primakow zu sprechen – und schließlich auch über die künftige Präsidentschaft Putins in Russland. Anfangs sei der potenzielle Kandidat noch skeptisch gewesen, erinnerte sich Beresowski, doch er habe bereitwillig zugehört. Einmal schloss Putin versehentlich die Tür, die den Schacht vom Flur seines Büros trennte, sodass die beiden im Fahrstuhlschacht eingesperrt waren. Putin musste gegen die Wand klopfen, bis jemand kam, der sie wieder herausließ.
Beresowski fühlte sich ganz als Vertreter Russlands und umwarb Putin schließlich regelrecht. Im Juli 1999 flog Beresowski nach Biarritz im Südwesten Frankreichs, wo Putin gerade seine Ferien verbrachte. »Ich rief ihn vorher an«, erinnerte sich Beresowski. »Ich sagte ihm, dass ich kommen wolle, um etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen. Dann flog ich hin. Er machte Urlaub mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern, die damals beide noch sehr jung waren. Sie wohnten in einer sehr bescheidenen Unterkunft, ähnlich einer kleinen Eigentumswohnung. Es war eine Mischung zwischen einem Mietshaus und einem Apartmenthotel. Eine kleine Küche, ein Schlafzimmer oder mehrere Schlafzimmer. Wirklich nichts Besonderes.« Russische Millionäre, zu denen man Putin zweifellos zählen konnte, verbrachten ihre Ferien mittlerweile meist in riesigen Villen an der Côte d’Azur. Deshalb war Beresowski von Putins bescheidenem Urlaubsdomizil so beeindruckt.
»Wir redeten einen ganzen Tag lang miteinander. Am Ende sagte er: ›In Ordnung, versuchen wir es. Aber Sie verstehen, dass Boris Nikolajewitsch [Jelzin] derjenige sein muss, der mich dazu auffordert.‹«
Das Ganze erinnerte an einen alten Schtetl-Witz. Ein Heiratsvermittler sucht einen alternden Schneider auf, um mit ihm zu besprechen, ob es gelingen könnte, dessen mittlere Tochter mit dem Erben des Rothschild-Imperiums zu verheiraten. Der Schneider hat gleich mehrere Einwände: Erstens hat er nicht die Absicht, seine mittlere Tochter zu verheiraten, solange die ältere Tochter noch nicht unter der Haube ist, zweitens will er nicht, dass seine Tochter weit von zu Hause wegzieht, und drittens ist er nicht ganz sicher, ob die Rothschilds so fromm sind, wie er sich den Ehemann seiner Tochter wünscht. Der Heiratsvermittler begegnet jedem Einwand mit seinem Gegenargument: Es handelt sich schließlich um den Erben des Rothschild-Vermögens. Schließlich willigt der alte Schneider ein. »Ausgezeichnet«, sagt der Heiratsvermittler. »Dann muss ich jetzt nur noch mit den Rothschilds sprechen.«
Beresowski redete Putin gut zu. »Ich sagte, ›Wolodja, wovon reden Sie? Er selbst hat mich hierher geschickt, um ganz sicher zu gehen, dass es zu keinem Missverständnis kommt; damit er es nicht zu Ihnen sagt und Sie ihm antworten, dass Sie das nicht wollen, wie Sie mir schon so oft geantwortet haben.‹ Also willigte er ein. Ich kehrte nach Moskau zurück und berichtete Jumaschew von unserem Gespräch. Kurz darauf – ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage später – kehrte Putin nach Moskau zurück und traf sich mit Boris Nikolajewitsch. Jelzins Reaktion war kompliziert. Ich erinnere mich aber noch genau, dass er einmal zu mir sagte: ›Er scheint ganz in Ordnung zu sein, aber er ist ein bisschen klein.‹«
Jelzins Tochter Tatjana Jumaschewa erzählt die Ge-schichte ein wenig anders. Sie erinnert sich, dass Jelzins damaliger Stabschef Woloschin und der ehemalige Stabschef Tschubais eine Meinungsverschiedenheit hatten: Beide waren sich einig, dass Putin als Nachfolger eine gute Wahl sei, aber Tschubais glaubte nicht, dass das Parlament ihn als Ministerpräsident bestätigen würde. Als beide Jelzin ihre Sicht vortrugen, flog Beresowski nach Biarritz, um Putin zur Kandidatur für das Amt aufzufordern, weil er wollte, dass ihn Putin und der Rest des Landes für den Königsmacher hielten.
Wie alle anderen Teilnehmer an der Suche nach einem neuen Präsidenten erinnert sich Tatjana Jumaschewa aber auch an die Panik, mit der sie die politische Situation und die Zukunft des Landes beurteilten. »Tschubais glaubte, die Duma [das Unterhaus im Parlament] würde Putin nicht im Amt bestätigen. Es werde drei Abstimmungen geben, dann komme es zur Auflösung des Parlaments. [Die russische Verfassung erlaubte es Jelzin, drei Abstimmungen über die Kandidatur zum Ministerpräsidenten zu erzwingen und danach das Parlament aufzulösen.]
Die Kommunisten, wiedervereint mit [dem ehemaligen Premier] Primakow und [dem Moskauer Bürgermeister Juri] Luschkow, würden bei den nächsten Wahlen die stärkste Partei werden und womöglich die absolute Mehrheit erringen. Danach würde das Land in eine gefährliche Schieflage geraten, es könnte zu einer Katastrophe und vielleicht sogar zu einem Bürgerkrieg kommen. Das bestmögliche Szenario wäre noch ein den modernen Bedingungen ein wenig angepasstes, neo-kommunistisches Regime7; die Wirtschaft würde jedoch erneut verstaatlicht, die Grenzen wären wieder dicht, und viele Medienunternehmen müssten schließen.«
»Die Situation grenzte an eine Katastrophe«, beschrieb Beresowski die Lage. »Wir hatten Zeit verloren und damit unseren Positionsvorteil. Primakow und Luschkow machten landesweit mobil. Rund fünfzig Gouverneure [von 89] hatten sich bereits ihrer Bewegung angeschlossen. Außerdem war Primakow ein Ungeheuer, das alles rückgängig machen wollte, was in jenen Jahren erreicht worden war.«
Wenn die »Familie« die Lage als derart verzweifelt beurteilte, warum sah sie dann in Putin ihren Retter? Tschubais hielt ihn für den idealen Kandidaten. Auch Beresowski hielt ihn offenbar für eine erstklassige Wahl. Wer, glaubten sie, war Putin, und warum dachten sie, dass er in der Lage sein könnte, das Land zu regieren?
Die wahrscheinlich bizarrste Tatsache an Putins Aufstieg zur Macht ist, dass die Leute, die ihn auf den Thron hievten, kaum mehr über ihn wussten als Sie, lieber Leser. Beresowski sagte mir, er habe Putin nie als Freund betrachtet und ihn als Person nicht interessant gefunden – ein drastisches Urteil für einen Mann, der so überschäumend ist, dass er intellektuell ambitionierte Menschen nicht nur begeistert, sondern sie unwiderstehlich in seinen Orbit zieht und dort durch die Schwerkraft seiner Persönlichkeit festhält. Die Tatsache, dass Beresowski Putin nicht interessant fand und deshalb auch nicht versuchte, ihn als persönlichen Freund zu gewinnen, legt nahe, dass er in dem anderen Mann niemals auch nur einen Funken von Neugier entdeckte. Als er ihn jedoch als Nachfolger für Jelzin in Betracht zog, schien er offenbar anzunehmen, dass gerade die Eigenschaften, die sie auf Abstand zueinander gehalten hatten, Putin zu einem idealen Kandidaten machten: Putin, der anscheinend weder eine Persönlichkeit noch persönliche Interessen besaß, wäre ebenso formbar wie diszipliniert. Beresowski hätte sich nicht gründlicher irren können.
Tschubais hatte Putin während seiner Zeit als Wirtschaftsberater von Bürgermeister Sobtschak in Sankt Petersburg kennengelernt, nachdem Putin zum Stellvertreter ernannt worden war. Er erinnerte sich an Putin, wie er in seinem ersten Jahr in dieser Stellung gewesen war: Es war ein extrem arbeitsreiches Jahr gewesen, und Putin hatte sich außerordentlich energisch und wissbegierig gezeigt. Ständig hatte er Fragen gestellt. Tschubais hatte Sankt Petersburg im November 1991 verlassen, um der Regierung in Moskau beizutreten. Sein erster Eindruck war unverändert geblieben.
Und was wusste Boris Jelzin selbst über seinen künftigen Nachfolger? Er wusste, dass er einer der wenigen Männer war, die ihm gegenüber loyal geblieben waren. Er wusste, dass er einer anderen Generation angehörte: Anders als Jelzin, sein Feind Primakow und dessen Armee von Gouverneuren war Putin nicht über die Ränge der Kommunistischen Partei aufgestiegen und hatte deshalb beim Zusammenbruch der Sowjetunion nicht öffentlich die Seiten wechseln müssen. Er sah auch anders aus: All die anderen Männer waren ausnahmslos füllig und hatten Falten im Gesicht; Putin indes – schlank, klein, und inzwischen ein Freund gut geschnittener europäischer Anzüge – sah eher aus wie das neue Russland, das Jelzin seinem Volk zehn Jahre zuvor versprochen hatte. Jelzin wusste auch, oder dachte zumindest, dass Putin eine Strafverfolgung oder gar die öffentliche Hetzjagd auf ihn nicht gestatten würde, nachdem er aus dem Amt geschieden war. Und wenn Jelzin auch nur ein Bruchteil seines einstmals herausragenden politischen Gespürs geblieben war, dann wusste er, dass die Russen diesen Mann lieben würden, den sie mit Putin erben und der ihn beerben würde.
Jeder konnte in diesen grauen, gewöhnlichen Mann hineinprojizieren, was immer er wollte.
Am 9. August 1999 ernannte Boris Jelzin Wladimir Putin zum Ministerpräsidenten Russlands. Eine Woche später wurde er mit überwältigender Mehrheit von der Duma im Amt bestätigt. Er erwies sich als genauso einnehmend oder zumindest unangreifbar, wie Jelzin es vorhergesehen hatte.
Der Wahlkrieg
»Wissen Sie, manche Leute sagen, der FSB stecke hinter den Bombenanschlägen«, sagte mein Chefredakteur – einer der intelligentesten Menschen, die ich kennengelernt habe – zu mir, als ich 1999 an einem Septembernachmittag in die Redaktion kam. »Glauben Sie das?«
Seit drei Wochen wurden Moskau und andere russische Städte von Bombenanschlägen terrorisiert. Der erste traf am 31. August ein belebtes Einkaufszentrum im Herzen Moskaus. Ein Mensch starb, und mehr als 30 weitere wurden verletzt. Es war jedoch nicht sofort klar, dass dieser Anschlag mehr war als böser Streich oder vielleicht nur ein Waffengang in einem Streit zwischen Konkurrenten.
Fünf Tage darauf stürzte bei einer zweiten Explosion ein Teil eines Apartmentblocks in der Stadt Buinaksk ein, die im Süden unweit der tschetschenischen Grenze liegt. Diesmal wurden 64 Menschen getötet und 146 verletzt. Die Bewohner des Gebäudes waren jedoch allesamt russische Offiziere mit ihren Angehörigen – daher bewirkte der Anschlag nicht, dass sich Zivilisten, insbesondere Zivilisten in Moskau, angreifbar oder gefährdet fühlten, obwohl unter den Toten 23 Kinder waren.
Weitere vier Tage später, am 8. September um zwei Sekunden vor Mitternacht, erschütterte eine gewaltige Explosion eine Schlafstadt am Rande Moskaus. Ein dicht besiedelter Wohnblock wurde entzweigerissen und zwei seiner Treppenhäuser – mit insgesamt 72 Wohnungen – vollkommen dem Erdboden gleichgemacht. Exakt 100 Menschen starben1; fast 700 wurden verletzt.
Fünf Tage später stürzte bei einer weiteren Explosion in einer Moskauer Vorstadt abermals ein Gebäude ein. Der achtstöckige Backsteinbau klappte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die Journalisten in der Menge, die an je-nem Morgen zur Unglücksstelle eilten, sprachen darüber, dass Betonbauten offenbar nach außen explodierten, während Backsteingebäude eher in sich zusammenstürzten. Die Bombe explodierte um fünf Uhr morgens. Die meisten Bewohner waren um diese Zeit zu Hause; fast alle kamen ums Leben: 124 Menschen starben, sieben wurden verletzt.
Drei Tage darauf, am 16. September, explodierte in einer Straße in der südrussischen Stadt Wolgodonsk ein Lastwagen. Dabei starben 19 Menschen, und über 1000 wurden verletzt.
Panik breitete sich im ganzen Land aus. Einwohner von Moskau und anderen russischen Städten bildeten in ihren Vierteln Bürgerpatrouillen; viele Menschen gingen hauptsächlich deshalb auf die Straße, weil sie sich dort sicherer fühlten als in ihren Wohnungen. Freiwillige hielten jeden an, der ihnen verdächtig erschien, was oft bedeutete: jeden, der nicht zur Patrouille gehörte. Wenigstens eine Gruppe Moskauer Freiwilliger hielt alle an, die einen Hund an der Leine führten – um den Hund zu überprüfen. Die Polizei wurde überflutet mit Anrufen von Menschen, die meinten, sie hätten etwas Verdächtiges beobachtet oder verdächtige Objekte entdeckt.
Am 22. September ging die Polizei von Rjasan, einer etwa 100 Kilometer von Moskau entfernten Stadt, einem solchen Anruf nach und fand unter der Treppe einer Mietskaserne versteckt drei Säcke mit Sprengstoff. In einer Stadt, in der Furcht und Trauer herrschten, zweifelte niemand daran, dass die Tschetschenen dahintersteckten – und dieser Glaube war keine Ausnahme.
Ich war die Tage zuvor in Moskau herumgefahren und hatte tschetschenische Familien besucht: Flüchtlinge, gut ausgebildete Fachkräfte, die vor langer Zeit hergezogen waren, Zeitarbeiter, die in Schlafsälen übernachteten. Alle hatten sie Angst. Die Moskauer Polizei trieb junge tschetschenische Männer zusammen und nahm sie im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Attentaten fest. Viele der Männer, die ich interviewte, gingen nicht mehr nach draußen und weigerten sich sogar häufig, die Tür ihrer Wohnung oder ihres Schlafsaals zu öffnen. Das Kind einer Familie war von der Schule nach Hause gekommen und hatte erzählt, der Lehrer habe die Worte »Explosion« und »Tschetschenen« nebeneinander an die Tafel geschrieben.
Ich wusste, dass die Polizei Hunderte unschuldiger Männer verhaftete, konnte mir aber durchaus vorstellen, dass für die Bombenanschläge Tschetschenen verantwortlich waren. Ich hatte von Anfang bis Ende über den Tschetschenienkrieg von 1994 bis 1996 berichtet. Als ich das erste Mal hörte, wie eine Bombe nur wenige Meter von meinem Standort entfernt explodierte, befand ich mich gerade im Treppenhaus eines Wohngebäudes für Blinde in einem Vorort von Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens. Es war im Januar 1995, dem ersten Kriegsmonat, und ich hatte diesen Stadtteil bewusst aufgesucht, weil die russische Armee behauptete, sie bombardiere keine Zivilisten. Auf wen passte der Begriff »Zivilist« besser als auf die Bewohner dieser Einrichtung: blinde, hilflose Menschen, die nicht in der Lage waren, die Stadt zu verlassen. Als ich aus dem Gebäude trat, sah ich überall Leichen und Leichenteile herumliegen.
Die vielen Kinder, die ich an diesem und an den folgenden Tagen in Grosny sah, hatten dasselbe gesehen. Sie waren die Kinder, die bald um die offenen Feuer auf den Gehsteigen Grosnys standen und zusahen, wie ihre Mütter etwas zum Essen zubereiteten. Es waren dieselben Kinder, die danach jahrelang in winzigen Wohnungen auf engstem Raum zusammengepfercht leben mussten – bis zu zwölf Personen in einem Zimmer, weil so viele Gebäude dem Erdboden gleichgemacht worden waren – Kinder, denen es verboten war, nach draußen zu gehen, aus Angst, sie könnten auf eine Landmine treten oder einem russischen Soldaten in die Arme laufen, der ein Mädchen vergewaltigen und einen Jungen festnehmen könnte. Und doch gingen sie nach draußen, wurden vergewaltigt, verhaftet, gefoltert, viele kamen nie zurück oder sahen mit an, wie dasselbe ihren Schwestern, Brüdern und Freunden angetan wurde. Diese Kinder waren inzwischen junge Erwachsene, und ich konnte mir gut vorstellen, dass einige von ihnen auf fürchterliche Rache sannen.
Die meisten Russen haben nicht gesehen, was ich gesehen habe, aber sie sahen immer wieder schreckliche Fernsehbilder von den Schauplätzen der Bombenanschläge. Der Krieg in Tschetschenien war nie wirklich beendet worden: Das drei Jahre zuvor unter anderem von Beresowski ausgehandelte Abkommen war nicht mehr als ein Waffenstillstand. Die Russen waren also immer noch eine Nation im Krieg, und wie alle Nationen, die sich im Krieg befinden, glaubten sie an einen barbarischen Feind, der zu unvorstellbaren Gräueltaten fähig wäre.
Am 23. September schrieb eine Gruppe von 24 Gouverneuren – mehr als ein Viertel aller Gouverneure der Föderation – einen Brief an Präsident Jelzin. Darin baten sie ihn, die Macht an Putin abzutreten, der das Amt des Ministerpräsidenten erst seit einem guten Monat bekleidete. Am selben Tag erließ Jelzin ein geheimes Dekret, das die Armee ermächtigte, die Kampfhandlungen in Tschetschenien wieder aufzunehmen. Das Dekret war nicht nur geheim, sondern auch rechtswidrig, da das russische Gesetz den Einsatz regulärer Truppen innerhalb der eigenen Grenzen untersagt.2 An jenem Tag bombardierten russische Kampfflugzeuge wieder Grosny, beginnend mit dem Flughafen, der Ölraffinerie und Wohngebieten. Am darauffolgenden Tag erließ Putin einen eigenen Befehl, der russische Truppen zu Kampfhandlungen in Tschetschenien ermächtigte. Diesmal war es kein Geheimbefehl, obwohl das russische Gesetz dem Ministerpräsidenten gar keine Befehlsgewalt über das Militär verleiht.
Am selben Tag absolvierte Putin einen seiner ersten Fernsehauftritte. »Wir werden sie zur Strecke bringen«, sagte er über die Terroristen. »Wo immer wir sie finden, werden wir sie vernichten. Selbst wenn wir sie auf der Toilette erwischen. Dann radieren wir sie eben im Klohäuschen aus.«3
Putin gebrauchte eine Rhetorik, die sich von der Jelzins deutlich unterschied. Er versprach nicht, die Terroristen einer gerechten Strafe zuzuführen. Er äußerte auch kein Mitgefühl für die Hunderte von Opfern der Explosionen. Es war die Sprache eines Führers, der mit der Faust regieren wollte. Solche vulgären Aussagen, oft gespickt mit Anspielungen unterhalb der Gürtellinie, wurden bald zu Putins sprachlichem Markenzeichen. Seine Popularitätskurve schoss prompt in die Höhe.
Der promovierte Beresowski und seine kleine, aus hochgebildeten Männern bestehende Propagandaarmee schienen keinen Widerspruch zwischen ihrem erklärten Ziel – der Sicherung von Russlands demokratischer Zukunft – und jenem Mann zu sehen, in den sie all ihre Hoffnungen für diese Zukunft setzten. Unermüdlich arbeiteten sie an ihrem Wahlkampf und nutzten dabei die Medienmacht von Beresowskis Kanal Eins, um den ehemaligen Ministerpräsidenten Primakow und seine verbündeten Gouverneure in den Schmutz zu ziehen. In einer bemerkenswerten Sendung wurde eine Hüftoperation, der sich Primakow kurz davor unterzogen hatte, anatomisch bis ins Detail genau erklärt. Eine andere fokussierte sich auf die angebliche Ähnlichkeit des Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow mit Mussolini.4 Putins Verbündete – die sich selbst mehr als Macher denn als bloße Gefolgsleute sahen – mussten jedoch mehr tun, als nur seine Gegner zu diskreditieren. Sie mussten ihrem eigenen Kandidaten ein tragfähiges Image verpassen.
Streng genommen führte Putin keinen Wahlkampf. Die Präsidentschaftswahlen standen erst in knapp einem Jahr an, und in Russland gab es keine Kultur langfristiger Wahlkämpfe. Doch die Leute, die ihn als Präsident sehen wollten, betrieben sehr eifrig einen Wahlkampf. Eine einflussreiche politische Beraterfirma namens Stiftung für Erfolgreiche Politik, die in einem der schönsten historischen Gebäude der Stadt am Ufer der Moskwa gegenüber dem Kreml residierte, wurde damit beauftragt, für Putin das Image eines jungen, energischen Politikers zu schaffen, der die dringend erforderlichen Reformen durchsetzen würde. »Alle hatten Jelzin gründlich satt, es war also nicht besonders schwer«, sagte mir eine Frau, die maßgeblich an der Kampagne mitgearbeitet hatte.5
Ihr Name war Marina Litwinowitsch, und wie viele ihrer Kollegen bei der Stiftung für Erfolgreiche Politik war sie sehr jung, sehr gebildet (sie hatte gerade ihr Studium an einer der besten Universitäten abgeschlossen) und politisch sehr unerfahren, ja, geradezu naiv. Bereits als Studentin hatte sie begonnen, in Teilzeit bei der Stiftung zu arbeiten, und nur drei Jahre später war sie eine Schlüsselfigur in Putins Wahlkampfteam. Sie selbst huldigte begeistert demokratischen Idealen, doch fand sie nichts Falsches daran, wie der neue Präsident aufgebaut und der Öffentlichkeit verkauft wurde: Sie vertraute schlicht denjenigen, die sich das Spektakel ausgedacht hatten. »Es erschienen ein paar Artikel, in denen es hieß, er sei vom KGB«, erzählte sie mir Jahre später. »Sein gesamter Stab war jedoch mit Liberalen besetzt, also dachten wir, das wären die Leute, die später auch zu seinem engsten Kreis gehören würden.«
Ohnehin musste man nicht jung und naiv sein, um das zu glauben. Im Spätsommer des Jahres 1999 hatte ich eine denkwürdige Verabredung zum Abendessen mit Alexander Goldfarb, einem alten Bekannten, der in den Siebzigerjahren Dissident gewesen war. Er hatte für Andrej Sacharow die Rolle des Dolmetschers übernommen, war in die USA emigriert, hatte dort die Achtzigerjahre in New York verbracht und war in den Neunzigern zu einem ernst zu nehmenden Gesellschaftsaktivisten geworden. Für den Milliardär und Menschenfreund George Soros war er als Russlandberater tätig gewesen, dann hatte er eine Kampagne zur Aufklärung über die in Russland grassierende medikamentenresistente Tuberkulose und deren Bekämpfung gestartet, bei der er die Weltöffentlichkeit fast im Alleingang aufrüttelte. Nun saßen Alex und ich beim Abendessen und sprachen über Putin. »Er ist das Fleisch und Blut des KGB«, sagte ich zu ihm. Damals testete ich eine Theorie noch eher, als dass ich sie bereits ernsthaft vertreten hätte. »Von Tschubais höre ich aber, er sei klug, pragmatisch und weltoffen«, entgegnete Alex. Sogar ein ehemaliger Dissident war geneigt zu glauben, dass Putin tatsächlich der moderne junge Politiker sei, den die Stiftung für Erfolgreiche Politik erfunden hatte.
Je stärker die Kampfhandlungen der Streitkräfte in Tschetschenien eskalierten, desto mehr schien das ganze Land hörig zu werden. Beresowski hatte derweil die Idee zu einer neuen politischen Partei, einer, die von jeglicher Ideologie frei sein sollte. »Niemand hätte zugehört, wenn wir argumentiert hätten«, erzählte er mir Jahre später, offensichtlich immer noch überzeugt, dass er einen brillanten Einfall gehabt hätte. »Daher beschloss ich, Ideologie durch Gesichter zu ersetzen.« Beresowskis Leute suchten also nach geeigneten Gesichtern und fanden schließlich ein paar Prominente und einen Kabinettsminister. Das Gesicht, das am allerwichtigsten war, gehörte jedoch dem Mann, der noch Wochen zuvor gesichtslos gewesen war: Mit dem Anstieg von Putins Popularität wuchs auch die der neuen Partei. Bei den Parlamentswahlen am 19. Dezember 1999 entschieden sich beinahe ein Viertel der Wähler für den erst zwei Monate alten Block namens Einiges Russland oder Medwed (der Bär), welcher dadurch zur größten Fraktion im Unterhaus wurde.
Um Putins Führungsrolle endgültig zu zementieren, schlug jemand aus der »Familie« – niemand scheint sich mehr zu erinnern, wer es eigentlich war – einen brillanten Schachzug vor: Jelzin sollte vorzeitig das Amt niederlegen. Als Ministerpräsident würde Putin damit per Gesetz zum amtierenden Präsidenten, also zum sofortigen Amtsinhaber, bevor der Wettstreit noch richtig begonnen hatte. Seine Gegner wären darauf nicht gefasst. Jelzin tat es tatsächlich, und zwar am 31. Dezember 1999. Es war typisch für ihn: Damit stahl er der Jahrtausendwende, dem Millennium-Bug und praktisch sämtlichen anderen Pressemeldungen aus aller Welt die Schau. Er tat es zudem am Abend vor der traditionellen zweiwöchigen Neujahrs- und Weihnachtspause, sodass Putins Gegnern nun noch weniger Zeit blieb, sich auf die Wahl vorzubereiten.
Der Neujahrsabend, ein säkularer Feiertag, war in Russland seit Langem der wichtigste Tag des Jahres für die Familie. An diesem Abend trafen sich im ganzen Land Freunde und Verwandte. Kurz vor Jahresende versammelte man sich vor dem Fernseher, um zuzusehen, wie die Uhr an einem der Kreml-Türme Mitternacht schlug – dann stieß man mit Sekt an und setzte sich danach zu einer traditionellen Mahlzeit zu Tisch. In den Minuten vor Mitternacht wandte sich das Staatsoberhaupt in einer Rede an die Nation; dies war eine Tradition aus Sowjetzeiten, die Boris Jelzin am 31. Dezember 1992 aufgegriffen hatte (am 31. Dezember 1991, als die Sowjetunion offiziell aufgelöst wurde, richtete ein Komiker das Wort an die Nation).
Jelzin erschien zwölf Stunden früher auf den Bildschirmen. »Meine Freunde«, sagte er. »Meine Lieben. Heute ist das letzte Mal, dass ich am Neujahrsabend zu Ihnen spreche. Doch das ist nicht alles. Heute ist das letzte Mal, dass ich als russischer Präsident zu Ihnen spreche. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe lange nachgedacht, und es ist mir nicht leicht gefallen. Heute, am letzten Tag des Jahrhunderts, lege ich mein Amt nieder … ich gehe … Russland sollte mit neuen Politikern, neuen Gesichtern, neuen, klugen, starken, energischen Leuten in das neue Jahrhundert gehen … Warum sollte ich noch sechs Monate länger an meinem Platz ausharren, wenn das Land bereits einen starken Mann hat, der es verdient, Präsident zu werden, und auf den alle Russen ihre Hoffnungen für die Zukunft setzen?«
Dann entschuldigte sich Jelzin. »Es tut mir leid«, sagte er, »dass viele unserer Träume nicht wahr geworden sind. Dass sich Dinge, die wir für einfach hielten, als ungeheuer schwierig erwiesen haben. Es tut mir leid, dass ich den Hoffnungen der Menschen nicht gerecht werden konnte, die glaubten, dass wir in einem Zug, mit einem einzigen beherzten Schritt unsere graue, starre und totalitäre Vergangenheit abschütteln und in eine strahlende, wohlhabende, zivilisierte Zukunft schreiten könnten. Ich selbst glaubte das … Ich habe das noch nie gesagt, aber ich möchte, dass Sie das wissen. Ich spürte den Schmerz jedes Einzelnen von Ihnen in meinem Herzen. Ich verbrachte schlaflose Nächte, zermarterte mir das Gehirn, wie ich das Leben nur ein klein wenig besser machen könnte … Ich gehe. Ich habe getan, was ich konnte. Eine neue Generation kommt. Sie kann mehr tun und es besser machen.«6
Jelzin sprach zehn Minuten lang. Er war aufgedunsen, schwerfällig, beinahe unbeweglich. Zudem wirkte er niedergeschlagen, hilflos, wie ein Mann, der sich vor den Augen von über hundert Millionen Menschen selbst beerdigte. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich während der gesamten Ansprache kaum, aber seine Stimme zitterte vor Ergriffenheit, als er sein Amt niederlegte.
Um Mitternacht erschien dann Wladimir Putin auf den Bildschirmen. Anfangs wirkte er sichtlich nervös und stotterte zu Beginn seiner Rede sogar. Als er fortfuhr, gewann er jedoch zusehends an Selbstvertrauen. Er sprach dreieinhalb Minuten lang. Bemerkenswerterweise nutzte er nicht die Gelegenheit, seine erste Wahlkampfrede zu halten. Er machte keine Versprechungen und sagte nichts, was man als aufmunternd hätte interpretieren können. Er sagte, in Russland werde sich nichts ändern, und versicherte den Zuschauern, dass ihre Rechte geschützt würden. Am Schluss schlug er vor, die Russen sollten ihr Glas auf »Russlands neues Jahrhundert« erheben – obgleich er selbst kein Glas hatte, um ihnen zuzuprosten.7
Putin war nun amtierender Präsident, und der Wahlkampf hatte offiziell begonnen. Putin, so erinnerte sich Beresowski, war diszipliniert und sogar fügsam. Er tat, was man ihm sagte – und man sagte ihm, er solle nicht viel tun. Er war bereits so populär, dass es im Grunde ein Wahlkampf ohne Wahlkampf war, der zu einer Wahl ohne Wahl führte. Alles, was Putin tun musste, war, niemals allzu anders zu erscheinen, als seine Wähler ihn sehen wollten.
Am 26. Januar 2000, exakt zwei Monate vor den Wahlen, fragte der Moderator eines Russland-Gremiums beim jährlichen Weltwirtschaftsforum in Davos: »Wer ist Herr Putin?« Tschubais – jener Mann, der sieben Monate zuvor geäußert hatte, Putin sei ein idealer Nachfolger – war gerade am Mikrofon, als die Frage gestellt wurde. Er wurde unruhig und sah einen ehemaligen russischen Ministerpräsidenten, der zu seiner Rechten saß, fragend an. Auch dieser wollte eindeutig nicht antworten. Die vier Mitglieder des Gremiums sahen sich betreten an. Nach einer halben Minute brach der ganze Saal in Gelächter aus. Die größte Landmasse der Erde, ein Land mit Öl, Gas und Nuklearwaffen, hatte einen neuen Staatschef, und seine wirtschaftlichen und politischen Eliten hatten keine Ahnung, wer er war. Wirklich sehr komisch.
Eine Woche später beauftragte Beresowski drei Journalisten einer seiner Zeitungen damit, Putins Lebensgeschichte zu schreiben. Darunter war eine junge Blondine, die ein paar Jahre zum sogenannten Kreml-Pool gehört hatte, neben extrovertierteren Kollegen jedoch ziemlich farblos geblieben war. Der zweite war ein junger Reporter, der sich mit seinen humorvollen Berichten bereits einen Namen gemacht, aber noch nie etwas über Politik geschrieben hatte. Das dritte Mitglied des Teams war ein Star, eine erfahrene Reporterin, die Anfang der Achtziger aus Krisengebieten weltweit berichtet hatte. Gegen Ende des Jahrzehnts hatte sie für die Moskauer Nachrichten, die Flaggschiff-Publikation der Perestroika, über Politik, insbesondere über den KGB geschrieben. Natalija Geworkjan war eine Reporterin für Reporter, die unumstrittene Leiterin des Teams und die Journalistin, die Beresowski am besten kannte.
»Beresowski rief mich immer wieder an und fragte: ›Ist er nicht unglaublich?‹«, erzählte sie mir Jahre später. »Ich antwortete: ›Borja, Ihr Problem ist, dass Sie nie zuvor einen KGB-Oberst kennengelernt haben. Er ist nicht unglaublich. Er ist vollkommen normal.‹
Ich wollte natürlich unbedingt herausfinden, wer dieser Kerl war, der nun das Land regieren sollte«, sagte sie.8 »Ich bekam das Gefühl, dass er gern redete, und er redete auch gern über sich selbst. Freilich habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die interessanter waren als er. Ich habe fünf Jahre lang über den KGB geschrieben: Er war nicht besser und nicht schlechter als alle anderen dort; er war nur klüger und ein wenig verschlagener als viele.«
Abgesehen von der Herkulesaufgabe, innerhalb weniger Tage ein Buch zu schreiben, wollte Natalija Geworkjan ihre Zeit mit dem Präsidenten dazu nutzen, einem Freund zu helfen. Andrej Babizki, ein Reporter des von den USA finanzierten Senders Radio Free Europe/Radio Liberty, war im Januar in Tschetschenien verschwunden. Offenbar war er von russischen Truppen wegen eines Verstoßes gegen deren strikte »Einbettungspolitik« festgenommen worden: Während des ersten Tschetschenienkrieges hatten die Medien das Vorgehen Moskaus durchweg sehr kritisch begleitet, deshalb war es Journalisten diesmal verboten, die Kampfgebiete ohne uniformierte Begleitung zu betreten. Diese Politik behinderte nicht nur den Zugang zu kämpfenden Einheiten beider Seiten, sondern setzte die Journalisten auch zusätzlichen Gefahren aus: In einem Kriegsgebiet ist es fast immer sicherer, wenn man keine Uniform trägt und auch nicht von Uniformierten umgeben ist. Die Reporter wurden im Umgehen dieser Politik sehr erfinderisch – und kaum einer war geschickter darin als Babizki, der jahrelang schwerpunktmäßig über den Nordkaukasus berichtet hatte.
Ende der Leseprobe