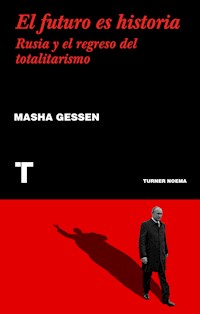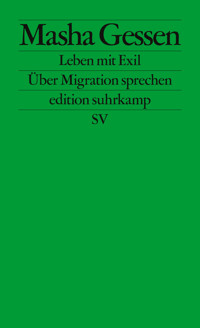14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fesselnd wie ein Gesellschaftsroman schreibt Bestsellerautorin Masha Gessen, warum ein Land, das in einem ungeheuren Kraftakt seine lähmenden Machtstrukturen abschütteln konnte, zu einem autoritär geführten Staat mit neoimperialen Zügen geworden ist.
Eine Gesellschaft, die zu Emanzipation, Freiheit und Selbsterkenntnis aufgebrochen war, leidet heute unter Bevormundung und Repression. Wie konnte es dazu kommen? Im Zentrum stehen vier Menschen der Generation 1984. Sie kamen in die Schule, als die Sowjetunion zerfiel, und wurden unter Präsident Putin erwachsen. Junge Leute aus unterschiedlichen sozialen und familiären Verhältnissen: zum Beispiel Zhanna, deren Vater Boris Nemzow, ein prominenter Reformer, mitten in Moskau erschossen wurde. Oder Ljoscha, der als schwuler Dozent seine Stelle an der Uni Perm verliert. Die große Erzählung von Aufbrüchen und gescheiterten Hoffnungen der Jungen wird flankiert von den Bildungsgeschichten des liberalen Soziologen Lew Gudkow, der Psychoanalytikerin Marina Arutjunjan und des rechtsnationalistischen Philosophen Alexander Dugin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 921
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
3Masha Gessen
Die Zukunft ist Geschichte
Wie Russland die Freiheit gewann und verlor
Aus dem amerikanischen Englisch von Anselm Bühling
Suhrkamp
5Svetlana Boym zum Gedächtnis
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Personen
Prolog
I
Born in the USSR
1 Jahrgang 1984
Mascha
Shanna
2 Lebensfragen
Dugin
Arutjunjan
Gudkow
3 Privilegien
Serjosha
Ljoscha
4 Homo Sovieticus
II
Revolution
5 Schwanensee
6 Schüsse auf das Parlament
7 Wer wird Millionär
III
Auflösung
8 Versperrte Trauer
9 Alte Lieder
10 Ende und Anfang
IV
Auferstehung
11 Leben nach dem Tod
12 Die orange Gefahr
13 Familienwerte
V
Protest
14 Die Zukunft ist Geschichte
15 Buduschtschego njet
16 Weiße Bänder
17 Mascha — 6. Mai 2012
VI
Zerschlagung
18 Serjosha — 18. Juli 2013
19 Ljoscha — 11. Juni 2013
20 Eine geteilte Nation
21 Shanna — 27. Februar 2015
22 Krieg ohne Ende
Epilog
Dank
Register
Fußnoten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
345
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
9Personen
Dieses Buch hat sieben Hauptpersonen, die im Verlauf der Erzählung immer wieder auftreten. Ich verwende für sie eine leicht abgewandelte russische Namenskonvention. Wer schon einmal einen russischen Roman gelesen hat, weiß: Russen haben viele Namen. Der offizielle Name besteht aus dem vollständigen Vornamen und dem Vatersnamen. Er wird heute jedoch in der Regel nur noch bei formellen Anlässen und zur Anrede älterer Personen gebraucht. Für die meisten Vornamen gibt es zahlreiche abgewandelte Diminutivformen. Die meisten Russen haben einen Diminutivnamen, der ihnen in der Kindheit gegeben wurde und den sie ihr Leben lang beibehalten. Oft lässt sich der vollständige Name eindeutig aus dem Diminutiv erschließen. Ein Sascha heißt zum Beispiel immer Alexander, und eine Mascha heißt meist Maria. Kinder werden fast nur im Diminutiv angesprochen.
Für alle Personen, die noch Kinder sind, wenn sie erstmals in der Geschichte auftreten, gebrauche ich durchgängig die Diminutivform, wie Mascha oder Ljoscha. Personen, die beim ersten Auftreten erwachsen sind, werden mit vollständigem Vornamen genannt, etwa Boris oder Tatjana. Ältere Menschen werden durchgehend mit Vor- und Vatersname bezeichnet. Nachstehend folgt eine Liste der Hauptfiguren. Zahlreiche weitere Personen, die im Buch vorkommen, sind hier nicht aufgeführt, weil sie nur in einzelnen Episoden auftreten.
Shanna (geb. 1984)
Boris Nemzow, Vater
Raissa, Mutter
Dmitri, Ehemann
Dina Jakowlewna, Großmutter
10Mascha (geb. 1984)
Tatjana, Mutter
Galina Wassiljewna, Großmutter
Boris Michailowitsch, Großvater
Sergei, Ehemann
Sascha, Sohn
Serjosha (geb. 1982)
Anatoli, Vater
Alexander Nikolajewitsch Jakowlew, Großvater
Ljoscha (geb. 1985)
Galina, Mutter
Juri, leiblicher Vater
Sergei, Stiefvater
Serafima Adamowna, Großmutter
Marina Arutjunjan, Psychoanalytikerin
Maja, Mutter
Anna Michailowna Pankratowa, Großmutter
Lew Gudkow, Soziologe
Alexander Dugin, Philosoph und politischer Aktivist
11Prolog
Ich habe viele Geschichten über Russland erzählt bekommen und einige selbst erzählt. Als ich elf oder zwölf war, in den späten 1970er Jahren, erklärte mir meine Mutter, die UdSSR sei ein totalitärer Staat. Sie verglich das sowjetische Regime mit dem nationalsozialistischen – für eine Sowjetbürgerin ein unerhörter Gedanke. Meine Eltern erzählten mir, das Sowjetregime werde ewig währen und deshalb müssten wir das Land verlassen.
In den späten 1980er Jahren – ich war inzwischen angehende Journalistin – geriet das Regime ins Schwanken und sank schließlich zu einem Haufen Schutt zusammen. So lautete jedenfalls die Geschichte, die damals erzählt wurde. Gemeinsam mit zahllosen anderen Reportern berichtete ich begeistert vom Aufbruch meines Landes zu Freiheit und Demokratie.
Zwanzig Jahre lang habe ich dann den Tod einer russischen Demokratie dokumentiert, die nie wirklich lebensfähig geworden war. Verschiedene Leute erzählten dazu unterschiedliche Geschichten: Viele beharrten darauf, Russland habe nur einen Schritt zurückgesetzt, nach zwei Schritten vorwärts in Richtung Demokratie. Die einen machten Wladimir Putin und den KGB für das Scheitern verantwortlich, andere die angebliche Vorliebe der Russen für die eiserne Hand und wieder andere den rücksichtslosen, anmaßenden Westen. Es kam ein Zeitpunkt, an dem ich mir sicher war, dass ich die Geschichte vom Verfall und Untergang des Putin-Regimes schreiben würde. Bald darauf verließ ich Russland zum zweiten Mal – diesmal als Erwachsene mittleren Alters mit Kindern. Wie zuvor meine Mutter mir, so erklärte jetzt ich meinen Kindern, warum wir nicht in unserem Land bleiben konnten.
Die Umstände sprachen für sich. Die russischen Bürger hatten 12seit fast zwei Jahrzehnten immer mehr Rechte und Freiheiten eingebüßt. Im Jahr 2012 begann die Regierung Putin flächendeckend gegen politische Gegner vorzugehen. Sie führte Krieg gegen den inneren Feind und gegen Nachbarländer. Bereits 2008 war Russland in Georgien eingefallen. 2014 folgten die Annexion der Krim und die Unterstützung der sogenannten Separatisten in der Ostukraine. Die russische Führung entfesselte einen Informationskrieg gegen Idee und Wirklichkeit der westlichen Demokratie. Es dauerte eine Weile, bis westliche Beobachter sich klargemacht hatten, was da geschah. Inzwischen ist es zur Gewohnheit geworden, Russland in der Weltpolitik als aggressiven Akteur wahrzunehmen. Im Weltbild der USA gilt das Land wieder als Reich des Bösen und als existenzielle Bedrohung.
Die Repressionen, die Kriege, selbst der Rückfall Russlands in die alte Rolle auf globaler Bühne – all das hat sich vor meinen Augen abgespielt. Von diesen Geschehnissen wollte ich berichten, aber zugleich auch von dem, was nicht geschehen ist: von der Freiheit, die nicht ergriffen wurde, und der Demokratie, die nicht erwünscht war. Wie lässt sich eine solche Geschichte erzählen? Wo lassen sich Gründe dafür festmachen, dass etwas nicht da ist? Wo beginnen und mit wem?
Es gibt grob gesagt zwei Arten von Büchern über Russland, die sich an ein breites Publikum richten: Die einen handeln von den Mächtigen – den Zaren, Stalin, Putin und ihrem Umkreis. Sie wollen erklären, wie das Land regiert wurde und bis heute regiert wird. Die anderen berichten von »normalen Menschen«, um zu zeigen, wie es ist, in diesem Land zu leben. Doch selbst die besten journalistischen Bücher über Russland – vielleicht sogar gerade sie – vermitteln stets nur einen Teilaspekt, wie die sechs Blinden in der indischen Fabel, die einen Elefanten beschreiben sollen, aber jeweils nur vom Kopf oder nur von den Beinen berichten. Auch wenn in anderen Büchern Schwanz, Rüssel und Rumpf beschrieben werden, gibt es kaum welche, die zu erklären versuchen, wie das Tier insgesamt aussieht oder um was für ein Tier es sich eigentlich handelt. In die13sem Buch habe ich mir zum Ziel gesetzt, das ganze Tier zu beschreiben und zu erklären.
Ich beschloss, mit dem Niedergang des Sowjetregimes zu beginnen: Die Annahme, dass es »zusammengebrochen« sei, musste hinterfragt werden. Des Weiteren beschloss ich, mich auf die Menschen zu konzentrieren, für die das Ende der Sowjetunion zu den frühesten prägenden Erinnerungen gehört: die Generation der Anfang bis Mitte der 1980er Jahre geborenen Russen. Sie sind in den 1990er Jahren aufgewachsen, dem vielleicht umstrittensten Jahrzehnt der russischen Geschichte. Einigen ist es als Zeit der Befreiung im Gedächtnis geblieben, andere verbinden damit Chaos und Leid. Diese Generation hat ihr gesamtes Erwachsenenleben in einem Russland unter der Führung Wladimir Putins verbracht. Bei der Auswahl meiner Protagonisten habe ich auch nach Leuten gesucht, deren Leben sich durch die Repressionswelle im Jahr 2012 drastisch verändert hat. Dank Ljoscha, Mascha, Serjosha und Shanna – vier jungen Leuten aus unterschiedlichen Städten, Familien, ja aus unterschiedlichen sowjetischen Lebenswelten – konnte ich erzählen, wie es war, seine Kindheit in einem Land zu verbringen, das sich öffnete, und in einer Gesellschaft volljährig zu werden, die sich verschließt.
Bei der Recherche hielt ich Ausschau nach Gesprächspartnern, die »normal« waren – insofern ihre Erfahrungen beispielhaft für Millionen andere stehen – und zugleich außergewöhnlich: intelligent, leidenschaftlich, zur Selbstbeobachtung fähig und in der Lage, ihre Geschichten lebendig zu erzählen. Doch wer das eigene Dasein in der Welt als sinnvoll erfahren will, braucht Freiheit. Das Sowjetregime hat den Menschen nicht nur die Möglichkeit genommen, frei zu leben, sondern auch die Fähigkeit, wirklich zu verstehen, was ihnen vorenthalten wurde und wie das geschah. Es wollte die persönliche und historische Erinnerung ebenso auslöschen wie die wissenschaftliche Erforschung der Gesellschaft. Der geballte Krieg gegen die Sozialwissenschaften hatte zur Folge, dass westliche Wissenschaftler jahrzehntelang besser in der Lage waren, Russland 14zu interpretieren, als die Russen selbst. Sie konnten das Defizit jedoch nicht ausgleichen, da sie als Außenstehende nur beschränkt Zugang zu Informationen hatten. Das alles schadete nicht nur der Wissenschaft, es war vor allem ein Angriff auf die humane Verfasstheit der russischen Gesellschaft. Denn diese wurde dadurch der Werkzeuge und sogar der Sprache beraubt, die sie benötigte, um sich selbst zu verstehen. Die einzigen Geschichten, die Sowjetrussland sich über sich selbst erzählte, stammten von sowjetischen Ideologen. Was kann ein modernes Land über sich wissen, wenn ihm weder Soziologen noch Psychologen, noch Philosophen zur Verfügung stehen? Und was können seine Bürger über sich wissen? Ich begriff, dass die einfache Handlung meiner Mutter – das Sowjetregime in eine Kategorie einzuordnen und mit einem anderen Regime zu vergleichen – ein außerordentliches Maß an Freiheit erfordert hatte. Diese Freiheit verdankte sich zumindest teilweise der bereits gefallenen Entscheidung zur Emigration.
Um die größere Tragödie zu schildern, den Verlust des Erkenntnisinstrumentariums, suchte ich nach Gesprächspartnern, die in der sowjetischen und postsowjetischen Zeit versucht hatten, sich dieses Instrumentarium anzueignen. So wurde die Besetzung um einen Soziologen, eine Psychoanalytikerin und einen Philosophen erweitert. Wenn jemand das nötige Handwerkszeug hat, um einen Elefanten zu definieren, dann sie. Sie sind keine »normalen Menschen« – die Geschichte ihres Kampfes um die Wiederbelebung ihrer Disziplin ist nicht repräsentativ. Und ebenso wenig sind sie »Mächtige«. Sie sind diejenigen, die versuchen zu verstehen. In der Putin-Ära sind die Sozialwissenschaften mit neuen Methoden unterworfen und herabgewürdigt worden, und meine Protagonisten sahen sich vor völlig neue, unmögliche Entscheidungen gestellt.
Beim Zusammenfügen all dieser Geschichten habe ich mir vorgestellt, ich arbeite an einem umfangreichen faktografischen russischen Roman, der sowohl die individuellen Tragödien darstellen soll als auch die Ereignisse und Ideen, die sie geprägt haben. Ich wollte zeigen, wie es war, in den vergangenen dreißig Jahren in 15Russland zu leben – und zugleich erzählen, wie Russland selbst in dieser Zeit gewesen ist und wie es wurde, was es heute ist. Ich hoffe, dass das vorliegende Buch diesem Anspruch gerecht wird. Und auch der Elefant hat seinen kurzen Auftritt (siehe S. 467).
17IBorn in the USSR
191 Jahrgang 1984
Mascha
Am siebzigsten Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution nahm die Großmutter, eine Raketenforscherin, Mascha mit in die Kirche St. Johannes der Krieger im Zentrum Moskaus, um sie dort taufen zu lassen. Mascha war dreieinhalb – etwa drei Jahre älter als alle anderen Kinder, die an diesem Tag dort waren. Ihre Großmutter Galina Wassiljewna war fünfundfünfzig und damit etwa so alt wie die meisten anderen Erwachsenen. Sowjetische Frauen gingen mit fünfundfünfzig in Rente, und fast alle hatten in diesem Alter bereits Enkelkinder. Aber sie waren nicht alt genug, um sich an eine Zeit zu erinnern, in der die Religion in Russland offen und stolz praktiziert wurde. Galina Wassiljewna hatte bis vor kurzem nicht groß über Religion nachgedacht. Ihre eigene Mutter war zur Kirche gegangen und hatte sie taufen lassen. Sie selbst hatte Physik studiert. Als sie ihren Abschluss machte, gab es an den sowjetischen Hochschulen noch keinen Pflichtkurs über die »Grundlagen des wissenschaftlichen Atheismus« – er wurde erst einige Jahre später flächendeckend eingeführt. Trotzdem hatte man ihr beigebracht, dass Religion das Opium des Volkes sei.
Als Erwachsene hatte sie ihr Leben zum großen Teil damit verbracht, an Objekten zu arbeiten, die in direktem Gegensatz zur Religion standen: Sie waren materiell, kein bisschen mystisch, und sie flogen in den Weltraum. Zuletzt war sie bei der wissenschaftlichen Produktionsvereinigung Molnija (»Blitz«) tätig gewesen, wo die sowjetische Raumfähre Buran (»Schneesturm«) entwickelt wurde. Sie hatte die mechanische Vorrichtung entworfen, mit der die Besatzung nach der Landung die Tür öffnen konnte. Die Arbeit an der 20Raumfähre war fast abgeschlossen. Ein Jahr später würde sie ihren ersten Flug antreten. Es war ein unbemannter Testflug, der erfolgreich verlief. Aber der Buran sollte danach nie wieder fliegen. Die Finanzierung für das Projekt versiegte. Der Mechanismus, mit dem sich die Tür der Raumfähre nach der Landung von innen öffnen ließ, wurde nie benötigt.1
Galina Wassiljewna hatte schon immer ein feines Gespür für subtile Änderungen der Stimmungen und Erwartungen in ihrer Umgebung gehabt. In einem Land wie der Sowjetunion, wo Leben oder Tod davon abhängen konnten, ob man wusste, woher der Wind weht, war diese Fähigkeit äußerst nützlich. Obwohl in ihrem Berufsleben alles bestens zu stehen schien – es war ein Jahr vor dem Flug des Buran –, merkte sie, dass sich ein Riss im Fundament der einzigen Welt zeigte, die sie kannte, der Welt, die auf dem Primat des Materiellen beruhte. Um die entstandene Kluft zu füllen, bedurfte es anderer Ideen – oder, besser noch, eines anderen Fundaments. Es war, als hätte sie geahnt, dass das handfeste und unmystische Objekt, an dem sie ihr Leben lang gearbeitet hatte, außer Gebrauch kommen und eine metaphysische Leere hinterlassen würde.
Man hatte ihr – wie dem ganzen Land und der ganzen Welt – erzählt, die Bolschewiki hätten die organisierte Religion besiegt. Doch Galina Wassiljewna wusste, dass das nicht ganz stimmte, immerhin hatte sie mehr als fünfzig Jahre ihres Lebens in der Sowjetunion verbracht. In ihrer Kindheit, in den Dreißigern, hatten die meisten Erwachsenen noch offen gesagt, dass sie an Gott glaubten.2 Die neue Generation sollte völlig frei von Religion und anderen abergläubischen Vorstellungen aufwachsen – und auch das Leid, um dessentwillen Religion notwendig war, sollte es nicht mehr geben. Als Galina Wassiljewna neun Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg. Die Deutschen rückten so schnell vor und die sowjetische Führung wirkte so hilflos, dass außer Gott nichts mehr blieb, woran man glauben konnte.3 Sehr bald schon schien die Sowjetregierung die russisch-orthodoxe Kirche zu akzeptieren. Von nun 21an kämpften Kommunisten und Kleriker gemeinsam gegen die Nazis.4 Nach dem Krieg wurde die Kirche wieder zu einer Institution für die ältere Generation. Was blieb, war das Wissen darum, dass sie in Zeiten katastrophaler Ungewissheit eine Zuflucht sein konnte.
Die Großmutter erzählte Mascha, weshalb sie zur Kirche gingen: Es lag an Vater Alexander Men – einem russisch-orthodoxen Priester, der Menschen wie Galina Wassiljewna anzog. Seine Eltern waren Naturwissenschaftler gewesen, und er verstand sich darauf, mit Leuten zu sprechen, die ohne kirchlichen Bezug aufgewachsen waren. Die russisch-orthodoxe Kirche, die seit dem Krieg in Diensten des Kremls stand, hatte ihn ordiniert. Doch er lernte und lehrte auf seine eigene Weise, und das hatte ihn fast ins Gefängnis gebracht.5 Jetzt, wo sich eine vorsichtige Öffnung andeutete, war Men im Begriff, ungeheure Popularität zu erlangen. Er fand erst Tausende, dann Hunderttausende von Anhängern, auch wenn es noch einige Jahre dauern sollte, bis seine Schriften in der Sowjetunion veröffentlicht werden konnten. Mascha verstand nicht viel von dem, was ihre Großmutter ihr von Vater Alexander oder dem Licht in den Lehren Jesu Christi erzählte. Aber sie hatte nichts gegen den Kirchenbesuch. Der 7. November war ihr Lieblingsfeiertag. Denn an diesem Tag – dem Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution1 – buk ihre Großmutter Kuchen, die ihr schmeckten, während sie den Rest des Jahres über weder besonders gern noch besonders gut kochte.
»Scheiße, was soll das denn?«, fragte Maschas Mutter, als sie ihre Tochter abholte und das kleine Kreuz entdeckte, das sie um den 22Hals trug. Doch damit war das Gespräch auch schon beendet. Tatjana hatte für Worte nicht viel übrig, sie war eine Frau der Tat. Als sie festgestellt hatte, dass sie schwanger war, hatte sie das Parteikomitee ihrer Graduiertenschule verständigt – in der Hoffnung, die Behörden würden den Vater des ungeborenen Kindes, der noch mindestens eine weitere Freundin hatte, zwingen, sie zu heiraten. Es war durchaus üblich, dass solche Anliegen beim Parteikomitee vorgebracht wurden und die Genossen entsprechend intervenierten. In Tatjanas Fall ging die Sache allerdings schief. Maschas Vater verlor seinen Platz in der Graduiertenschule und damit auch sein Aufenthaltsrecht in Moskau. Er musste nach Hause zurückkehren – in den sowjetischen Fernen Osten, Tausende Kilometer entfernt von seinen Freundinnen.
Das war nicht die einzige unangenehme Überraschung für die junge Mutter. Tatjana war wieder auf ihre Eltern angewiesen. In ihrer Generation war es die Regel, die Kinder kostenlos von den eigenen Eltern betreuen zu lassen.6 Die einzigen Alternativen waren staatliche Bezirkskindergärten – eine Mischung aus Babygefängnis und Verwahranstalt – oder unbezahlbare private Kinderbetreuungsdienste mit zweifelhaftem Rechtsstatus. Tatjana hatte sich eine ungewöhnliche Unabhängigkeit von ihren Eltern erobert. Anders als die meisten ihrer Altersgenossen lebte sie getrennt von ihnen, in einer Kommunalka, einer Gemeinschaftswohnung, die sie nur mit einer einzigen Familie teilte. Durch das Baby war sie jedoch wieder an die Wohnung ihrer Eltern gebunden, die nur wenige Blocks entfernt lag. Galina Wassiljewna und Boris Michailowitsch hatten eine Zweizimmerwohnung mit Küche – Platz genug, um sich um die kleine Mascha zu kümmern. Beide arbeiteten als ranghohe Wissenschaftler in der Raumfahrtindustrie und hatten mehr Zeit zur Verfügung als ihre Tochter, die sich im Graduiertenstudium befand. Tatjana kam zu dem Schluss, dass sie Geld verdienen und Beziehungen spielen lassen musste, wenn sie sich endgültig von ihrem Elternhaus loseisen wollte. Keine ihrer Tätigkeiten war im strengen Sinn legal – das sowjetische Recht begrenzte jegliche Eigeninitiati23ve und verbot fast alle Arten von Unternehmertum. Doch in den meisten Fällen wurden diese Tätigkeiten von den Behörden stillschweigend geduldet.
Im Alter von drei Jahren wurde Mascha in eine prestigeträchtige Vorschule aufgenommen. Hier einen Platz zu bekommen war eigentlich so gut wie unmöglich – es handelte sich um eine Vorschule für die Kinder von Mitgliedern des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. (Als Mascha geboren wurde, lag das Durchschnittsalter der ZK-Mitglieder bei knapp 75 Jahren.7 Daher wurden in der Schule ihre Enkel und Urenkel unterrichtet – gemeinsam mit den Kindern einiger außergewöhnlich zielstrebiger Sowjetbürger wie Tatjana.) Eine Autorin aus einer früheren Schülergeneration beschrieb die Vorschule so:
»Im Kindergarten roch alles nach Wohlstand und frisch gebackenen piroschki. Die Leninecke war besonders prachtvoll. Dort stand ein Strauß weißer Gladiolen, über dem Familienbilder der Uljanows wie Ikonen auf einer purpurroten Pinnwand arrangiert waren. In Daunenschlafsäcke eingemummelt, schlummerten die Sprösslinge der Nomenklatura wie kleine Ferkel auf einer Veranda, die zum verwunschenen Wald hinausging. Ich war während der ›Toten Stunde‹ gekommen, der Zeit des sowjetischen Nachmittagsschläfchens.
›Wacht auf, zukünftige Kommunisten‹, rief die Erzieherin und klatschte in die Hände. Sie lächelte verschlagen. ›Zeit für das Fischfett.‹ … [Eine] große, massige Erzieherin namens Soja Petrowna [kam] mit einem riesigen Löffel voller schwarzem Kaviar auf mich zu.«8
Als Mascha aufgenommen wurde, hatte die Leninecke an Glanz eingebüßt, und die Lehrer legten mit ihren Parolen etwas mehr Zurückhaltung an den Tag. Sie brüllten ihren Schützlingen nur noch selten das Wort »Kommunisten« entgegen. Aber es gab immer noch die täglichen Kaviarrationen, die nun in noch stärkerem Kontrast 24zur Außenwelt standen, wo Lebensmittelknappheit den Alltag bestimmte. Und wie in allen sowjetischen Vorschulen gab es immer noch den unvermeidlichen Grießklumpen, den man senkrecht auf den Teller stellen konnte. Die Schule bot an Werktagen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung an – ein einzigartiger sowjetischer Luxus. Die Wochenenden verbrachte Mascha in der Regel bei ihren Großeltern, wie so viele sowjetische Kinder. Tatjana war sieben Tage in der Woche damit beschäftigt, dieses Leben zu finanzieren.
Als Mascha vier Jahre alt war, brachte ihre Mutter ihr bei, wie man gefälschte Dollars von echten unterscheidet. Mit echter oder gefälschter Fremdwährung erwischt zu werden war gefährlich – nach sowjetischem Recht standen darauf bis zu fünfzehn Jahre Gefängnis.9 Doch Tatjana schien keine Furcht zu kennen – jedenfalls sicherte sie damit den Lebensunterhalt. Zudem betrieb sie eine Nachhilfevermittlung. Erst hatte sie selbst Nachhilfe gegeben, doch bald sah sie ein, dass sie expandieren musste, um wirklich Geld zu verdienen. Sie begann, ihre Kunden – meist Oberschüler, die für die nervenaufreibenden Hochschul-Zulassungsprüfungen büffelten – an Kommilitonen zu vermitteln, die sie vorbereiten konnten. Für ihre eigene Nachhilfetätigkeit hatte sie sich ein äußerst rentables und seltenes Spezialgebiet erschlossen: Sie studierte mit ihren jungen Klienten Antworten auf die sogenannten Särge ein.
So hießen Fangfragen, die speziell für jüdische Bewerber gedacht waren. Die meisten sowjetischen Hochschuleinrichtungen fielen unter zwei Kategorien: Es gab solche, die Juden gar nicht zum Studium zuließen, und solche, die die Aufnahme jüdischer Bewerber streng limitierten. Natürlich waren diese Bestimmungen nirgendwo öffentlich zugänglich. Die Ablehnung wurde auf besonders sadistische Weise gehandhabt. Jüdische Bewerber nahmen in der Regel mit allen anderen an den Aufnahmeprüfungen teil. Genau wie alle anderen zogen sie die Karten mit Prüfungsfragen aus einem Bestand. Doch wenn sie die zwei oder drei Fragen auf der Karte richtig beantworteten, stellte man ihnen, während sie mit den Prüfern allein im Raum waren, beiläufig eine weitere Frage, wie um noch ein25mal nachzuhaken. Diese Frage war dann der »Sarg«. In der Mathematik handelte es sich meist um ein Problem, das nicht einfach nur schwer zu lösen, sondern unlösbar war. Der Bewerber geriet ins Straucheln und scheiterte. Jetzt konnten die Prüfer den Sarg zunageln: Der jüdische Bewerber hatte nicht bestanden. Es sei denn, er hatte sich von Tatjana vorbereiten lassen. Sie übte mit ihren Klienten nicht nur die Antworten auf konkrete »Särge« ein, die sie sich irgendwie hatte beschaffen können, sondern zeigte ihnen auch, wie es möglich war, solche Fangfragen generell zu erkennen und ihre Unlösbarkeit zu beweisen. Diese Blondine mit Pferdegebiss und Pilotenbrille konnte sowjetischen Juden beibringen, wie sich die antisemitische Maschinerie austricksen ließ. So verdiente sie das Geld für Maschas Kaviar und den ekligen Grießbrei in der ZK-Vorschule.
Shanna
Wer auch nur annähernd gleiche Chancen haben wollte, durfte nicht jüdisch sein. Die »Nationalität« – bei uns würde man von »ethnischer Zugehörigkeit« sprechen – war in allen wichtigen Ausweisdokumenten vermerkt, von der Geburtsurkunde über den Inlandspass bis zur Heiratsurkunde und der Personalakte am Arbeitsplatz oder in der Schule. Eine einmal zugeteilte »Nationalität« konnte praktisch nicht mehr geändert werden und wurde von Generation zu Generation vererbt. Dank einem glücklichen Umstand – vermutlich dem Weitblick und der Initiative seiner Eltern – besaß Shannas Vater Boris Dokumente, die ihn als ethnischen Russen auswiesen. Mit seinen dunkelbraunen Augen, dem dunklen, dicht gelockten Haar und den erkennbar jüdischen Vornamen seiner Eltern – Dina und Jefim – konnte er niemandem etwas vormachen. Wenn jemand nachfragte, gab er an, er sei »halb jüdisch«. Das war zwar nicht sehr plausibel, aber es genügte meist, um das Thema zu beenden. Dank dieser Gewandtheit, seinen »ethnisch korrekten« Dokumenten und 26exzellenten Schulnoten erlangte er die Zulassung zur Universität. Dabei war ein großes Hindernis zu überwinden: Anders als die überwältigende Mehrheit der sowjetischen Oberschüler war Boris nicht Mitglied im kommunistischen Jugendverband, dem Komsomol, gewesen. Deshalb wurde er in seinen Abgangszeugnissen als »politisch unzuverlässig« eingestuft. Seine Mutter, Dina Jakowlewna, setzte alles in Bewegung, damit die Schule die Formulierung änderte. Ein scheinbar aussichtsloses Unterfangen, aber etwas anderes kam nicht in Frage. Alle Familienmitglieder waren entweder Naturwissenschaftler oder Ärzte, alle waren hochintelligent und Kapazitäten auf ihrem Gebiet. Die Formulierung wurde geändert. Boris wurde zum Studium an der Fakultät für Strahlenphysik der Gorkier Staatsuniversität zugelassen. Er schloss mit Auszeichnung ab und legte mit vierundzwanzig Jahren seine Dissertation vor. Seine Familie und seine Freunde rechneten fest damit, dass er für seine Arbeit im Bereich der Quantenphysik eines Tages den Nobelpreis erhalten würde.
Shanna kam 1984 zur Welt – in dem Jahr, als Boris seine Dissertation fertigstellte. Ihre Mutter Raissa war Französischlehrerin. Nach sowjetischen Begriffen gehörte die Familie zur Bohème – russisch bogema: Sie lebte nach Vorstellungen, die als westlich galten, und pflegte einen Bekanntenkreis, der sich ständig erweiterte. Anders als Boris' ältere Schwester, die mit ihrem Kind bei Dina Jakowlewna lebte, wie es üblich war, mieteten die Nemzows ein eigenes Haus – ein altes Holzhaus im verfallenen Stadtzentrum, das weder Badewanne noch Dusche hatte, sondern nur eine Toilette. Sie machten Wasser auf dem Herd warm und wuschen sich am Waschbecken, oder sie duschten bei Freunden – so verwestlicht, dass sie täglich eine Dusche gebraucht hätten, waren sie nicht. Aber immerhin westlich genug, um Tennis zu spielen, eine Sportart, die als so exklusiv galt, dass die Lokalzeitung der Familie eine Fotostrecke widmete, als Shanna im Kleinkindalter war. Auf den Fotos sind drei dunkelhaarige Menschen zu sehen, die über das ganze Gesicht lächeln und dabei strahlend weiße Zähne zeigen. Sie fielen auf in ihrer grauen Stadt.
27Die Stadt hieß Gorki – auf Deutsch »bitter«. Sie war nach dem russischen Schriftsteller Maxim Gorki benannt, der eigentlich Alexei Peschkow hieß und sich ein rührseliges Pseudonym zugelegt hatte, wie es in revolutionären Kreisen Mode war. Als Shanna ihre Umgebung bewusst wahrzunehmen begann, ahnte sie nichts von einem Schriftsteller namens Gorki. Sie hielt den Namen einfach für eine Beschreibung ihrer Heimatstadt. Auch die sowjetische Regierung schien das so zu sehen. Vier Jahre vor Shannas Geburt hatte sie Gorki zum Verbannungsort des Physikers Andrei Dmitrijewitsch Sacharow bestimmt. Sacharow hatte 1975 den Friedensnobelpreis erhalten und war der bekannteste Dissident des Landes. An der Art, wie ihr Vater seinen Namen aussprach, merkte sie, dass ihm etwas Magisches anhaftete. Vergeblich bat sie ihn darum, sie mitzunehmen, wenn er zu »Sacharows Haus« ging. Sie dachte, er würde den berühmten Mann tatsächlich besuchen; in Wirklichkeit hielt er gelegentliche Mahnwachen vor dem Haus ab. Shanna taufte ihr Kätzchen auf den Namen Andrei Dmitrijewitsch Sacharow.
Im Frühjahr 1987 – Shanna war noch nicht ganz drei Jahre alt – beschrieb Sacharows Frau Jelena Bonner die Stadt Gorki so:
»Es ist Ende April, aber das Wetter erinnert eher an den Spätherbst oder Winteranfang. […] Ich sehe, wie die Passanten die Füße aus den Pfützen ziehen und pfundschwere Dreckklumpen an ihren Schuhen haften bleiben. Der Wind beugt die Baumwipfel. Vom trüben Himmel fällt Schneeregen herab und bildet schmutzig weiße Flecken auf der Oberfläche, die man nicht als ›Erde‹ bezeichnen möchte.«10
Shannas Heimatstadt war die schlimmste Stadt der Welt, da war sie sich ziemlich sicher. Und der Name »Bitter« beschrieb das Leben der Menschen, die dort wohnen mussten – besonders das ihrer Mutter. Raissa verbrachte die meiste Zeit mit der Jagd nach Lebensmitteln. Manchmal nahm sie den Nachtzug nach Moskau, stand dort den ganzen Tag Schlange und kam mit dem nächsten Nachtzug zu28rück. Sie brachte vor allem Fleischprodukte mit, die in Gorki schon seit Jahren nicht mehr gesichtet worden waren. Auch in Moskau herrschte kein Überfluss, auch dort waren manche Lebensmittel knapp. Aber verglichen mit Gorki, wo es im Laden manchmal nichts gab als undefinierbaren dunklen Saft in Drei-Liter-Gläsern mit Zinndeckeln, kam ihr die Hauptstadt wie das Gelobte Land vor. Einmal brachte Raissa eine durchsichtige Plastiktüte voll lieblos eingewickelter, graubrauner, zylinderförmiger Bonbons von dort mit. Sie bestanden aus Soja mit Zucker und gehackten Erdnüssen und waren mit Kakaopulver bestreut. Shanna fand, dass sie noch nie in ihrem Leben etwas Köstlicheres probiert hatte. Ein andermal kam eine Freundin von Raissa mit einem Turnbeutel voller Bananen zurück. Sie waren grün und hart. Raissa, die im Gegensatz zu ihrer Tochter schon einmal Bananen gesehen hatte, wusste, dass sie in einem dunklen Schrank aufbewahrt werden mussten, um dort zu reifen. Boris beteiligte sich nicht an der täglichen Lebensmittelbeschaffung. Aber manchmal hatte er seinen großen Auftritt, wenn er an schwer aufzutreibende Produkte »herangekommen« war – so der gängige Ausdruck. Shanna dachte, dass ihr Vater an Dinge »herankommen« konnte, weil er so groß war. Für sie war er der Superheld.
Shanna hatte keine feste Schlafenszeit. Und weil das Haus immer voller Gäste war und man am Tisch saß und redete, blieb sie bis Mitternacht oder noch länger auf. Ihr Vater, der nicht an bestimmte Arbeitszeiten gebunden war, brachte sie auf dem Weg zum Labor in der Vorschule des Wohnbezirks vorbei. Meist begann dort gerade die ›Tote Stunde‹ – die nachmittägliche Schlafenszeit. So konnte sie den fehlenden Schlaf nachholen.
Als Shanna etwa drei Jahre alt war, begannen die Gespräche am Tisch im alten Holzhaus sich zu verändern. Man sprach jetzt nicht mehr über den anomalen Dopplereffekt oder andere theoretische Fragen, die Boris gerade beschäftigten, sondern darüber, dass in Gorki ein nuklear betriebenes Heizwerk gebaut werden sollte. Die Arbeiten waren schon im Gang.11 Erst ein Jahr zuvor war es zu 29der Reaktorkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl gekommen. Die Regierung hatte versucht, Informationen über das Unglück unter Verschluss zu halten, aber sie hatte deren Ausbreitung nur hinauszögern können. Inzwischen war durchgesickert, wie groß das Ausmaß des Schadens und der Gefahr war. Dina Jakowlewna, von Beruf Kinderärztin, lag ihrem Sohn in den Ohren: »Wie kannst du als Physiker untätig zusehen, wenn so etwas mitten in der Stadt gebaut wird?«
Dass Sowjetbürger untätig zusehen, während die Regierung ihr Leben vorsätzlich gefährdet, war die Regel gewesen, solange Raissa, Boris und selbst Dina Jakowlewna denken konnten. Aber inzwischen hatte sich etwas geändert. 1985 hatte der neue Generalsekretär der Kommunistischen Partei, zugleich Staatsoberhaupt der Sowjetunion, einen »neuen Kurs« verkündet. Auch frühere Generalsekretäre hatten diese Worte im Mund geführt, sogar das Wort Perestroika, das so viel wie »Umbau« bedeutet. Doch diesmal tat sich wirklich etwas. Dina Jakowlewna nahm an einer Protestkundgebung gegen das geplante Atomkraftwerk teil. Noch ein Jahr zuvor hätte eine nicht von der Partei abgesegnete Kundgebung unweigerlich die Verhaftung und Verurteilung der Teilnehmer nach sich gezogen. Sacharow durfte Gorki nach sieben Jahren verlassen und nach Moskau zurückkehren. Der Physiker, der als »Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe« galt, war schon seit langem ein vehementer Verfechter der nuklearen Sicherheit. Boris besuchte ihn in seiner Moskauer Wohnung und führte ein Interview, in dem Sacharow sich gegen das atomare Heizkraftwerk aussprach. Das Interview erschien in einer Lokalzeitung von Gorki. Der berühmte Dissident schloss mit den Worten: »Ich hoffe, es gelingt Ihnen, den Gang der Ereignisse zu ändern. Ich bin voll und ganz auf Ihrer Seite.«12
Die Pläne für das Heizkraftwerk wurden schließlich begraben. Und Boris hatte etwas entdeckt, das ihn mindestens so sehr faszinierte wie die Physik. Am Küchentisch war das Wort jetzt immer öfter zu hören – politika. Dann kam ein weiteres hinzu: vybory – Wahlen.
—
30Die Sowjetunion, das Geburtsland von Mascha und Shanna, war der langlebigste totalitäre Staat der Welt. Das Geburtsjahr der beiden, 1984, wurde im Westen zum Symbol des Totalitarismus. Orwells gleichnamiges Buch konnte in einer Gesellschaft, die der darin beschriebenen so sehr glich, nicht erscheinen. Deshalb hatte die breite sowjetische Leserschaft erst 1989 die Möglichkeit, es kennenzulernen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zensurbestimmungen so weit gelockert worden, dass die führende Literaturzeitschrift des Landes eine Übersetzung drucken konnte.13 Bereits 1969 hatte der Journalist Andrei Amalrik einen Langessay mit dem Titel Kann die Sowjetunion das Jahr 1984 erleben? verfasst, den er als vervielfältigtes Typoskript an Freunde weiterverteilte. Er vertrat darin die These, dass das Regime auf die Implosion zusteuere.14 Amalrik, der bereits zuvor aus politischen Gründen inhaftiert gewesen war, wurde erneut festgenommen, zusammen mit einem Mann, der beschuldigt wurde, das Buch verbreitet zu haben. Beide erhielten Gefängnisstrafen. In seiner Schlusserklärung vor Gericht sagte Amalrik: »Mir ist klar, dass Verfahren wie dieses viele Leute abschrecken sollen – und viele werden sich abschrecken lassen. Trotzdem glaube ich, dass ein Prozess der Befreiung des Denkens begonnen hat, der nicht mehr umkehrbar ist.«15 Er verbrachte mehr als drei Jahre hinter Gittern, drei weitere Jahre in der Verbannung und musste schließlich die Sowjetunion verlassen. 1980 starb er bei einem Autounfall in Spanien auf dem Weg zu einer Menschenrechtskonferenz.16 Das Sowjetregime lebte fort und überdauerte auch das Jahr 1984.
Doch schon im folgenden Jahr traten die ersten Risse auf. Wurden sie von dem neuen Generalsekretär Michail Gorbatschow verursacht, als er Veränderungen forderte und Glasnost und Perestroika verkündete? Oder verschaffte er damit nur der Entwicklung Gehör, die Amalrik fünfzehn Jahre zuvor zu beschreiben versucht hatte? Die marxistische Ideologie, so Amalrik, habe das Land niemals fest im Griff gehabt, und die russisch-orthodoxe Kirche habe ihre Autorität eingebüßt. Ohne ein zentrales, einheitsstiftendes Glaubenssystem jedoch werde die Sowjetunion sich letztlich selbst zerstö31ren – auseinandergerissen von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit unvereinbaren Zielen.
Amalrik gehörte zu den verschwindend wenigen Sowjetbürgern, die das System als im Kern instabil betrachteten. Die meisten nahmen an, es werde ewig währen – eine in Stein, oder sowjetischen Stahlbeton, gemeißelte Ordnung. In dem Jahr, als Amalrik vor Gericht stand, schrieb ein anderer Dissident, der Schriftsteller und Liedermacher Alexander Galitsch, ein Lied, das davon handelt, wie eine kleine Gruppe von Freunden Aufnahmen von ihm anhört. Einer der Zuhörer meint, der Sänger gehe mit seinen antisowjetischen Witzen ein zu großes Risiko ein. Die Gastgeberin erwidert: »Der Autor hat nichts zu befürchten. Er ist seit hundert Jahren tot.«17 (Galitsch musste 1974 emigrieren und kam drei Jahre später in seiner Pariser Wohnung durch einen Stromschlag ums Leben.18)
Theoretiker, die sich mit der Sowjetunion beschäftigten – ob im In- oder Ausland –, waren mit zwei Handicaps konfrontiert: Sie mussten ihre Schlussfolgerungen auf fragmentarisches Wissen stützen und sie in einer Sprache formulieren, die der Aufgabe nicht angemessen war. Das Land verbarg alle wesentlichen und unwesentlichen Informationen hinter einer Mauer aus Geheimnissen und Lügen. Und damit nicht genug: Es führte jahrzehntelang Krieg gegen das Wissen als solches. Die symbolträchtigste – wenn auch bei weitem nicht die grausamste – Schlacht in diesem Krieg wurde im Jahre 1922 geschlagen. Damals ordnete Lenin die Abschiebung von (je nach Schätzung) zweihundert oder mehr Intellektuellen ins Ausland an – darunter Ärzte, Ökonomen und Philosophen. Diese Aktion wurde unter dem Namen »Philosophenschiff« bekannt (tatsächlich handelte es sich um mehrere Schiffe). Die Abschiebungen wurden als eine humane Alternative zur Todesstrafe dargestellt. Spätere Intellektuellengenerationen hatten weniger Glück: Wer gegenüber dem Regime als illoyal galt, wurde verhaftet, oft hingerichtet und fast immer daran gehindert, in seiner Fachdisziplin tätig zu sein.19 Mit zunehmender Etablierung des Regimes wurden die Einschränkungen für die Sozialwissenschaften weiter verschärft und 32zeigten – allein schon aufgrund ihrer Dauer – immer tiefere Wirkung. Während die exakten Wissenschaften und Technologien infolge des Wettrüstens erneuert und vorangetrieben wurden, gab es nichts – oder fast nichts –, was das Sowjetregime dazu bewegen konnte, die Entwicklung der Philosophie, der Geschichte und der Sozialwissenschaften zu fördern. Diese Disziplinen verkümmerten derart, dass – so formulierte es ein führender russischer Wirtschaftswissenschaftler im Jahr 2015 – die wichtigsten sowjetischen Ökonomen in den 1970er Jahren nicht mehr in der Lage waren, die Arbeit zu verstehen, die ihre Vorgänger ein halbes Jahrhundert zuvor geleistet hatten.20
In den 1980er Jahren fehlte es den Sozialwissenschaftlern in der Sowjetunion nicht nur an Informationen, sondern auch an der nötigen Kompetenz, dem theoretischen Wissen und der Begrifflichkeit, um ihre eigene Gesellschaft zu verstehen. Sehr wenige haben es dennoch versucht, allen Widrigkeiten und Hindernissen zum Trotz. Sie mussten sich im Dunkeln vorantasten.
332 Lebensfragen
Dugin
Am letzten Abend des Jahres 1984 gab Jewgenija Debrjanskaja eine Party. Sie war dreißig, alleinerziehend und stammte aus Swerdlowsk, der größten Stadt im Ural. Jewgenija hielt sich für provinziell und ungebildet – sie hatte keine Hochschule besucht. Dafür besaß sie Geld, Beziehungen und gutes Aussehen, und das bestärkte sie in ihrer Entschlossenheit, sich in Moskau einen Namen zu machen. Das Geld verdiente sie mit Kartenspielen: Sie war Zockerin, also ein Outlaw. Die Beziehungen verdankte sie ihrer außergewöhnlichen Abkunft als nichteheliche Tochter des langjährigen Moskauer Parteichefs.1 Ihre ausgefallene Erscheinung prägte sich sofort ein: Die äußerst schlanke Gestalt, die markante Nase, das dunkle Haar, das auf einer Seite kurz geschnitten war und ihr auf der anderen ins fein ziselierte Gesicht fiel, sowie die rauchige Baritonstimme. Das Zusammenspiel all dieser ungewöhnlichen Eigenschaften hatte Jewgenija zu einem Quartier verholfen, das so extravagant war wie sie selbst: einer riesigen Nomenklatura-Wohnung auf der Gorki-Straße, der zentralen Moskauer Prachtstraße.
Bei ihrer Neujahrsparty tauchten immer neue Gäste auf. Sie blieben, bis frühmorgens die erste Metro fuhr, oder sie tranken und rauchten und diskutierten weiter, den ganzen Tag über und auch noch am Tag danach. Dies war die Moskauer bogema – die hart feiernde Bohème, zu der Schwarzmarkthändler, Schriftsteller, Künstler und andere Außenseiter und intellektuelle Trendsetter zählten. Die Aura der Verwegenheit wurde noch dadurch verstärkt, dass einige Orwells 1984 oder Amalriks Kann die Sowjetunion das Jahr 341984 erleben? gelesen oder davon gehört hatten. Eine sehr junge, aufstrebende Schauspielerin erschien mit einer Schar männlicher Verehrer. Einer von ihnen – er schien kaum dem Teenager-Alter entwachsen – setzte sich sofort von der Gruppe ab. Statt wie die anderen in die Küche zu gehen, nahm er im Flur Platz auf einem leeren Stuhl und bat Jewgenija um ein Glas Wasser.
Sie brachte es ihm. Er nahm einen Schluck und fragte: »Weißt du, wann Veilchen auf den Lippen blühen?« Sie hatte keine Ahnung, was er meinte. Und genau das gefiel ihr an ihm: dass er so wunderschöne und zugleich völlig unverständliche Dinge sagen konnte. Er blieb am nächsten Tag, am Tag danach und dann drei ganze Jahre lang, bis sie aufhörte, ihn zu lieben.2
Sein Name war Alexander Dugin. Er kam aus einer sowjetischen Familie der ödesten Sorte, wie beide fanden: Sein Vater hatte ein Ingenieurstudium absolviert und ging beim KGB einer geheimen, aber unspektakulären Tätigkeit nach. Die Mutter arbeitete im Gesundheitsministerium. Die Großmutter war Dekanin an der Parteihochschule der KPdSU, nur wenige Minuten entfernt von der Wohnung, in der Jewgenija und Dugin jetzt zusammenlebten. Der Hass auf das Sowjetregime verband die beiden mindestens so sehr wie ihre Liebe zueinander. Dugin wagte sich gedanklich weiter vor als Jewgenija. Als Gorbatschow 1985 die Perestroika verkündete, sagte er, dies sei das Ende der Sowjetunion. Im gleichen Jahr wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Sie nannten ihn Artur, zu Ehren von Rimbaud.
Dugin brachte Jewgenija Französisch und Englisch bei. Bücher mussten im Original gelesen werden, darauf bestand er. Als die beiden sich kennenlernten, war er zweiundzwanzig, von einer technischen Hochschule geflogen, konnte jedoch bereits Französisch, Englisch und Deutsch lesen. Das ermöglichte ihm, sich innerhalb von wenigen Wochen eine neue europäische Sprache zu erschließen. Er lernte, indem er Bücher las. Jewgenija lernte mit ihm. Beide loteten abwechselnd die Sätze aus. Solange sie ihn liebte, wurde sie es nie müde, Worte zu hören, die sie nicht verstand. Das erste Buch, 35das sie gemeinsam auf Englisch lasen, war Das Bildnis des Dorian Gray.
Jewgenija beschaffte weiterhin das Geld. Aber beide fanden, dass Dugin derjenige war, der wirklich arbeitete. Er stand früh auf, aß, was er in der Küche fand, und setzte sich an den Schreibtisch, um dann achtzehn Stunden lang zu lesen. Sein Wissensdurst war unstillbar und er hatte viel nachzuholen. Vor allem interessierte er sich für Philosophie. Monatelang beschäftigte er sich mit Nietzsche und erklärte Jewgenija den Begriff des Dionysischen. Ihr gefiel der Gedanke, dass man das Chaos bejahen soll. Das schien genau das richtige Mittel zu sein, um die erstickende, reglementierte Langeweile zu bekämpfen, die sie umgab. Irgendwann sagte Dugin, er habe einen Philosophen entdeckt, den niemand kenne und der Nietzsches Ideen noch viel weiter getrieben habe: Martin Heidegger.
Werke von Heidegger waren damals auf Russisch nicht zu bekommen; die erste, nur zwanzig Seiten lange Übersetzung sollte erst 1986 erscheinen.3 Und weil Dugin nicht zu einer Hochschule oder einer anderen sowjetischen Institution gehörte, hatte er keinen Zugang zu wissenschaftlichen Bibliotheken, so dass er sich Heideggers Bücher auch nicht im Original verschaffen konnte. Schließlich ergatterte er eine Mikrofilm-Kopie von Sein und Zeit. Da er nicht die Möglichkeit hatte, ein passendes Lesegerät zu nutzen, projizierte er das Buch mithilfe eines handkurbelbetriebenen Diafilmprojektors auf seine Schreibtischplatte. Als Dugin mit Sein und Zeit fertig war, brauchte er eine Brille. Doch er hatte einen Text gelesen, der von nun an nicht nur sein Denken, sondern auch sein weiteres Leben bestimmen sollte.
36Arutjunjan
Wenn russische Intellektuelle über die frühen achtziger Jahre sprechen, fällt sehr wahrscheinlich der Ausdruck beswosduschnoje prostranstwo – »Raum ohne Luft«. Die Atmosphäre dieser Zeit war so stickig wie in einer isba, dem altrussischen Blockhaus, wenn die Fenster für den Winter abgedichtet sind: Das hält die Kälte draußen, aber auch die frische Luft. Die Fenster werden bis weit in den Frühling hinein auch nicht einen Spalt weit geöffnet. Die Ausdünstungen von Menschen, Essen und Kleidung vermischen sich nach und nach zu einem undefinierbaren, überwältigenden, alles betäubenden Geruch. Etwas Ähnliches war im Verlauf von zwei Generationen Sowjetherrschaft mit dem russischen Geistesleben geschehen. Zur Zeit der Oktoberrevolution hatte die russische intellektuelle Elite im geistigen Austausch mit ganz Europa gestanden. Nach einem halben Jahrhundert der Säuberungen, Verhaftungen und unablässigen Repressionen war die russische Gedankenwelt nach außen abgeschottet und nur noch von Gespenstern der einst so lebendigen Ideen bevölkert. Sogar die kommunistische Ideologie war bloß ein Schatten ihres früheren Selbst – eine Ansammlung von Begriffen, die rituell wiederholt wurden und jeden Sinn verloren hatten. Lenin hatte schon vor langer Zeit den größten Teil des Marxschen Gedankenguts entsorgt und einige ausgewählte Ideen als sakrosankte Gesetze verankert.
»Mit der Zeit zeigten Marx' Nachfolger die Tendenz, seine Lehren als endgültige und allumfassende Weltanschauung darzustellen; sie betrachteten sich als verantwortlich für den Fortbestand von Marx' Gesamtwerk, das sie als wirklich vollständig ansahen«, so die Bilanz von Milovan Djilas, einem marxistischen Dissidenten aus Jugoslawien. »Die Wissenschaft gab nach und nach der Propaganda Raum und das Resultat war, dass die Propaganda mehr und mehr die Neigung zeigte, sich als Wissenschaft auszugeben.«4
371973 schrieb sich die siebzehnjährige Marina Arutjunjan an der Fakultät für Psychologie der Moskauer Staatsuniversität ein. Die Fakultät war gerade erst eingerichtet worden, und Gegenstand und Zweck des Studiums waren nicht ganz klar. Aber es zog junge Leute wie Arutjunjan an, die gleichermaßen geistig wie romantisch veranlagt waren und die Geheimnisse der menschlichen Seele erforschen wollten. »Psyche« hieß »Seele«, so viel wusste Arutjunjan.
Die ersten beiden Jahre an der Fakultät für Psychologie waren die Hölle. Sie musste endlose Stunden mit dem Studium der marxistisch-leninistischen Philosophie verbringen. Das war offenkundig Propaganda unter wissenschaftlichem Deckmantel. Die junge Psychologiestudentin knackte den Code: Sie erstellte ein einfaches Koordinatensystem, mit dem sich alle philosophischen Richtungen einordnen und beurteilen ließen. Es bestand aus zwei kreuzförmig angeordneten Achsen, die das Feld in vier Quadranten einteilten. Eine Achse reichte vom Materialismus (gut) bis zum Idealismus (schlecht), die andere von der Dialektik (gut) bis zur Metaphysik (schlecht). Die Philosophen im unteren linken Quadranten, wo die Metaphysik auf den Idealismus traf – wie zum Beispiel Kant –, waren alle schlecht.
Jemand wie Hegel, der Dialektik und Idealismus verband, war schon besser, aber nicht optimal. Die Vollendung der Philosophie thronte in der oberen rechten Ecke des Diagramms, auf dem Gipfel des dialektischen Materialismus. Arutjunjan gab die Matrix an einige Kommilitonen weiter, und damit hatten sie die marxistisch-leninistische Philosophie in der Tasche.
Schwieriger war es im Kurs zur Geschichte der Kommunistischen Partei. »Schauen Sie sich mal Ihr Becken an«, sagte der Professor spöttisch zu Arutjunjan. Sie sah sich verwirrt um. Hatte sie etwa aus Versehen ein Laborbecken verschmutzt? Im Hörsaal für die Geschichte der KPdSU? Dann begriff sie, dass der Dozent ihre Hüften gemeint hatte – er fand sie zu schmal, um wertvollen Parteinachwuchs zu gebären.
Neben pseudowissenschaftlichen Propagandakursen absolvier38ten die Studenten auch naturwissenschaftliche Praxisübungen. Sie sezierten Frösche. Als anschließend Ratten an die Reihe kommen sollten, rebellierte Arutjunjan, und ihre Gruppe wurde glücklich von der Pflicht befreit, Säugetiere töten zu müssen. Es gab ein Fach namens Anthropologie, in dem es eigentlich um Evolutionsbiologie ging – Anthropologie im westlichen Sinn war in der Sowjetunion nicht zugelassen. Dieser Kurs beinhaltete eine Einführung in die Genetik, die nach jahrzehntelangem Verbot gerade erst rehabilitiert worden war. Das war interessant.
Die Physiologie der höheren Hirnfunktionen wurde anhand menschlicher Gehirne gelehrt, die in Formaldehyd konserviert waren. Sie wurden zu Seminarbeginn in den Lehrsaal gebracht und auf den Tischen verteilt. Arutjunjan konnte sich nicht überwinden, das Gehirn mit dem bloßen Finger zu berühren – Handschuhe gab es nicht; sie waren im ganzen Land Mangelware. Deshalb benutzte sie einen Stift und zog sich damit den Zorn des Professors zu. »Sie machen das Hirn kaputt!«, blaffte er sie an.
Die Psychologiestudenten mussten zudem eine ausführliche und gründliche Ausbildung in statistischer Analyse und Datenanalyse absolvieren. Nur das Eigentliche, die Psyche selbst, kam nicht vor. In den ersten Semestern lernte Arutjunjan vor allem, wie diese Abwesenheit begründet wurde:
Der Marxismus war in der Sowjetunion auf die Vorstellung reduziert worden, dass die Menschen – die Sowjetbürger – vollständig durch die Gesellschaft und die materiellen Lebensbedingungen geformt seien. Wenn die Arbeit der Persönlichkeitsformung korrekt verrichtet wurde, entsprachen die Ziele der geformten Persönlichkeit ganz und gar den Zielen der Gesellschaft, die sie hervorgebracht hatte. Und das war notwendig der Fall, denn die sowjetische Gesellschaft beanspruchte mittlerweile, den »real existierenden Sozialismus« aufgebaut und damit das marxistische Projekt im Wesentlichen erfüllt zu haben. Abweichungen kamen vor. Sie fielen in eine von zwei möglichen Kategorien: Kriminalität oder Geisteskrankheit. Die sowjetische Gesellschaft hatte die nötigen Einrich39tungen, um mit beiden fertig zu werden. Andere Misshelligkeiten waren nicht vorstellbar. Innere Konflikte kamen nicht in Frage. Kurz: Es gab eigentlich keinen Grund, sich mit der Erforschung der Psyche zu befassen.
Auf der Website der Fakultät für Psychologie der Moskauer Staatsuniversität sind die Brüche, die die Geschichte des Fachs in Russland kennzeichnen, bis heute erkennbar. 1885 wurde an der Universität eine psychologische Gesellschaft gegründet, die – wie stolz vermerkt wird – »zum Zentrum des philosophischen Lebens in Russland werden sollte«.5 1914 entstand daraus ein vollwertiges Institut mit Lehr- und Forschungstätigkeit. Dann wird die Erzählung auf der Website plötzlich verhalten: »In den Jahren des verschärften ideologischen Kampfes für den Aufbau einer marxistischen Psychologie kam es zu einem Wechsel an der Spitze des Instituts.« Tatsächlich wurde im Jahr 1925 das gesamte Institut geschlossen. Sechs Jahre später schloss die Universität alle Fakultäten für Geistes- und Sozialwissenschaften. Nach weiteren zehn Jahren kehrten die Geisteswissenschaften zurück, doch die Psychologie war nun der Fakultät für Philosophie unterstellt. Erst 1968 erkannte die Sowjetunion die Psychologie wieder als eigenständiges Fachgebiet an und ließ akademische Abschlüsse zu. Nach einem halben Jahrhundert Stillstand nahm die führende Universität des Landes die Erforschung und das Studium der menschlichen Psyche wieder in ihren Kanon auf – zumindest auf dem Papier.6 Die Studenten konnten nicht wissen, dass russische Denker weniger als ein Jahrhundert zuvor Nietzsche gelesen und sich mit ihm auseinandergesetzt hatten und dass die von Nietzsche vergeblich umworbene Lou Andreas-Salomé, die seine Ideen in Russland verbreitet hatte, aus Sankt Petersburg stammte. Eine frühe Schülerin Sigmund Freuds, war sie eng mit ihm verbunden und praktizierte bis wenige Jahre vor ihrem Tod 1937 als Psychoanalytikerin in Deutschland. Ihre Beziehungen zu Russland waren jedoch schon fast zwanzig Jahre zuvor durch die Revolution abgeschnitten worden.7
Der bolschewistische Staat wollte den Neuen Menschen schaf40fen. In diesem Projekt hallte Nietzsches Idee des Übermenschen nach. Aber es ging nun nicht mehr um eine philosophische Übung, sondern um eine praktische Aufgabe. Eine Zeit lang schien es, als ob die Lehren von Freud helfen könnten, die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überwinden. Vor der Revolution waren viele seiner Schriften übersetzt worden, und seine Schüler hatten eine Reihe russischer Psychoanalytiker ausgebildet.8 Kurz bevor die Bolschewiki an die Macht kamen, schien die Psychoanalyse in Russland schneller Fuß zu fassen als in Westeuropa.9 Nach 1917 begann das neue Regime, Freuds Theorien – ebenso wie den Marxismus – in ein Dogma zu verwandeln, auf dessen Grundlage riesige Institutionen errichtet werden sollten. Die vereinfachte Form des Freudismus – so der analog zum Begriff »Marxismus« geprägte Ausdruck – »galt als wissenschaftlich sanktionierte Verheißung einer realen und nicht bloß literarischen Umformung des Menschen kraft der Veränderung seines Bewusstseins«, so Alexander Etkind in seiner Geschichte der Psychoanalyse in Russland.10
In einem neu gegründeten Staatsverlag erschien 1922 eine zweibändige Ausgabe von Freuds Einführung in die Psychoanalyse. Innerhalb eines Monats wurden 2000 Exemplare verkauft. Für ein Buch mit einer solchen Thematik in dieser Epoche war das sehr viel.11 Im selben Jahr wurde unter dem Dach des Staates die Russische Psychoanalytische Vereinigung gegründet.12 Zwischen 1922 und 1928 publizierten staatliche Verlage eine ganze Bibliothek mit Übersetzungen der Grundlagenwerke von Freud, Jung und weiteren frühen Psychoanalytikern.13 In Moskau wurde ein psychoanalytisches Kinderheim-Laboratorium eröffnet, in dem die neu entstandene bolschewistische Elite ihren Nachwuchs unterbrachte. Es war ein Pilotprojekt, ein Prototyp künftiger Fabriken, in denen der Neue Mensch produziert werden sollte.
Das Vorhaben scheiterte. Die Psychoanalyse erwies sich nicht nur als ausgesprochen ungeeignet für eine Reproduktion im industriellen Maßstab – sie rief schon in einer einzigen Vorschule für die Elite Unbehagen und Unzufriedenheit hervor. Nachdem vage Be41fürchtungen hinsichtlich sexueller Frühreife aufkamen, wurde die experimentelle psychoanalytische Vorschule 1925 wieder geschlossen.14 In den nächsten fünf oder sechs Jahren stellte die Russische Psychoanalytische Vereinigung ihre Aktivitäten ein, Freuds Schriften verschwanden aus der Öffentlichkeit, und die Freudianer fielen in Ungnade oder erlitten ein noch schlimmeres Schicksal. Sabina Spielrein, Freuds wichtigste russische Schülerin – Patientin, Studentin, Kollegin und Geliebte von C. G. Jung, Lehrerin von Jean Piaget und Mitentdeckerin der Gegenübertragung –, war 1923 aus der Schweiz nach Sowjetrussland zurückgekehrt. Sie geriet offenbar bald in Vergessenheit und wurde 1942 in Rostow am Don von nazistischen Besatzungstruppen als Jüdin erschossen.15
Der Untergang der russischen Psychoanalyse bedeutete zugleich das Ende praktisch jeder Art von Psychologie – teils, weil die Psychoanalyse die Psychologie so stark dominiert hatte, und teils, weil der neue Staat nun jede Erklärung menschlichen Verhaltens ablehnte, die nicht sowohl materiell begründet als auch einfach war. Iwan Pawlows eingängige Theorie des Kausalverhältnisses von Reiz und Reaktion entsprach diesen Anforderungen perfekt: Man musste nur die gesamte Bevölkerung konditionieren, um sie formbar und berechenbar zu machen. Etkind erwähnt einen Psychoanalytiker in Odessa, der auf der Rückseite eines Freud-Porträts, das in seinem Büro hing, ein Porträt von Pawlow anbrachte. Pawlow war tagsüber zu sehen, wenn Staatsvertreter vorbeischauen konnten, und Freud begrüßte nachts die heimlichen Psychoanalyse-Patienten.16
Nur wenige der frühen sowjetischen Psychoanalytiker blieben in Russland – und am Leben. Ein solcher Langzeitüberlebender war Alexei Nikolajewitsch Leontjew. Er war in den dreißiger Jahren knapp einer offiziellen Verdammung oder einem schlimmeren Schicksal entgangen17 und blickte auf eine lange akademische Laufbahn zurück. Im Alter wandte er sich der Psycholinguistik zu. Dass er seine Forschungsarbeit auch in den dunkelsten Jahrzehnten der Sowjetunion fortsetzen konnte, verdankte er jedoch seiner »Tätigkeitstheorie«. Sie betrachtete den Menschen ausschließlich unter 42dem Gesichtspunkt des Verhaltens und begriff jede individuelle menschliche Handlung als Teil eines umfassenderen, gemeinschaftlichen Prozesses der Tätigkeit.18 In den ersten Jahren von Arutjunjans Studium an der Moskauer Staatsuniversität repräsentierte Leontjews Kurs den Stand der psychologischen Theorie. Seine Vorlesungen waren quälend langweilig und ärgerlich. Arutjunjan fand es frustrierend, dass Leontjews Ansatz nur die bewusste Dimension der menschlichen Existenz anerkannte und keinen Raum für Metaphysik ließ. Sein Unterricht bestand darin, dass er seinen Studenten sperrige Ausdrücke einhämmerte, die schwer begreifliche Theorien zusammenfassten. Eines dieser Mantren lautete »Die Motivation aufs Ziel verlagern«. Ein Student, dessen Ziel es ist, die Prüfung zu bestehen, hat seine Motivation dann aufs Ziel verlagert, wenn er Interesse am Fachgebiet entwickelt. Arutjunjan wartete vergeblich darauf.
Nach dem zweiten Studienjahr wurde sie ernsthaft krank und musste das Studium für zwei Jahre unterbrechen. Als sie zurückkam, war sie älter und vielleicht auch klüger geworden. Nachdem sie die Prüfungen für das dritte Studienjahr erfolgreich abgelegt hatte, durfte sie das Studium im vierten Jahr wiederaufnehmen. An diesem Punkt wählten die Studenten ihr Fachgebiet und führten erstmals Forschungsprojekte durch. Arutjunjan landete in der Sozialpsychologie. Damit begann für sie ein neues Leben. Einige Veranstaltungen wurden von Doktoranden geleitet, unter anderem ein Seminar über sexuelle Anziehung. Der junge Dozent sprach über die Kastrationsgefahr, die dem männlichen Empfinden nach von sehr attraktiven Frauen ausgeht. Die Studenten waren hingerissen. Hier ging es nicht um »Tätigkeitstheorie«. Hier ging es um Sex und die Psyche und all das, was sie sich bei ihrer Bewerbung an der Fakultät für Psychologie erträumt hatten.
Nach und nach merkten Arutjunjan und ihre Kommilitonen, dass der Raum, der sie umgab, nicht ganz ohne Luft war. In russischen Gebäuden, die an ein sehr kaltes Klima angepasst sind, gibt es die Fortotschka, ein kleines Fensterchen, das in die eigentliche 43Fensterscheibe eingelassen ist. Wenn die Fenster für den langen Winter versiegelt sind, bleibt die Fortotschka in Gebrauch und wird regelmäßig geöffnet, damit Luft herein- und hinausströmen kann. Wie sich zeigte, gab es auch an der sowjetischen UniversitätFortotschkas. Wer etwas lernen wollte, musste sie aufspüren, so nah wie möglich an sie herankommen und die frische Luft in vollen Zügen einatmen, als ob die Lunge auf Vorrat gefüllt werden könnte.
Eine Fortotschka war etwa der Denker Merab Mamardaschwili, der an der philosophischen Fakultät lehrte. Er sprach von Marx und Freud als intellektuellen Revolutionären. Für Arutjunjan und ihre Freunde war das fast schon Ketzerei – Freud war für sie ein Gott und Marx eher ein Teufel. Trotzdem war es berauschend, jemandem zuzuhören, der laut dachte – wirklich und wahrhaftig dachte. Eine weitere Fortotschka war Alexander Lurija, der klinische Psychologie unterrichtete. Lurija war in den zwanziger Jahren Sekretär der Russischen Psychoanalytischen Vereinigung gewesen.19 Er hatte die Repressionsjahre überlebt, indem er zur Neurologie gewechselt war. Mit seinen Geschichten über den menschlichen Geist hatte er es geschafft, über den Abstand einer Generation, eines Ozeans und des Eisernen Vorhangs hinweg Oliver Sacks zu inspirieren, der ihn als seinen Lehrer in der Kunst des »neurologischen Romans« ansah.20 Die wichtigste Fortotschka befand sich jedoch in der Universitätsbibliothek. Dort stand der spezchran