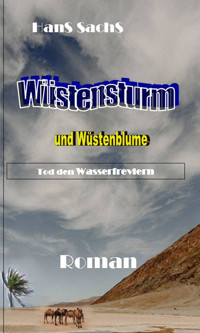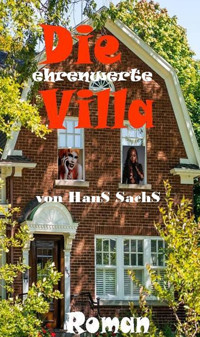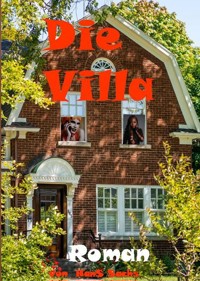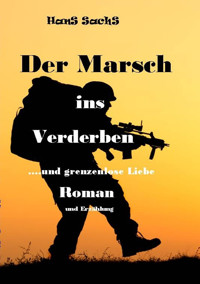
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Selbstverlag Werner Schröder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rudolf Haubold ist ein Kind des Erzgebirges. Als junger Mann schloss er sich den Nationalsozialisten an. Aus wirtschaftlicher Not wurde er ein glühender Anhänger des Adolf Hitler– so wie viele Deutsche zwischen 1933 und 1945. Und damit startete er seinen verhängnisvollen Irrweg nach Polen. Er wurde SS-Offizier, Partisanenjäger und einer der Kommandanten des KZ Auschwitz. Seine Kinder-und Jugendzeit verbrachte er in dem kleinen Ort Rübenau. Direkt an der Grenze zur Tschechoslowakei. Als Jugendliche kannten er und sein gleichaltriger Freund Anton Grynszpan Schleichwege nach Kalek. In der ärmlichen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war man oft auf Schmuggeltour, um Lebensmittel einzukaufen. Driiben war manches reichlicher und preisgünstiger zu bekommen. Das Wissen der Dorfschule seines Geburtsortes Rübenau war Rudolf nicht ausreichend. Er wollte mehr. Haubold ist im Laufe der Jahre zum Handlanger einer Vernichtungsideologie aufgestiegen, die schwere Schuld durch Verfolgungen deutscher und europäischer Juden auf sich nahm. Er wurde Teil der Vernichtungsmaschine des NS-Regime. In der eigenen Familie war er ein liebenswürdiger, sangesfreudiger Mensch. In der Zeit des Nationalsozialismus zeigte er ein zweites Gesicht. Er übernahm die Ideologie des Adolf Hitler. Rudolf war wie tausende andere verblendet. Er wurde Teil des Marsches ins Verderben. Das Verbrecherische des Systems erkannte er viel zu spät. Wird er seine Schuld begleichen können? 458 spannende Seiten um Krieg und Liebe, um Armut und Überlebenswillen. Die Erzählung ist teilweise authentisch, die Begebenheiten um die Familie Grynszpan fiktiv.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
HanS SachS
Der Marsch ins Verderben
....und grenzenlose Liebe
Roman
und Erzählung
Über den Autor HanS SachS:
Hans SachS ist mein Pseudonym. Der Name steht für Reisen in Deutschland und der weiten Welt.
Erst im fortgeschrittenen Alter entdeckte ich die Lust, in Romanform über die Episoden zu schreiben. Da fließen Erlebnis und Fiktion zu spannungsreichen Erzählungen zusammen.
Ich charakterisiere in meinen Romanen Land und Leute und verstricke sie in Situationen, die unter die Haut gehen. So fügen sich Erinnerungen und Fantasie zu spannenden Geschichten, worin auch Kriminalistik und Erotik ihren Platz finden.
Bisher erschienen sieben Romane: Der Marsch ins Verderben; Die Hölle lassen sie hinter sich; Die ehrbare Villa; Wüstensturm und Wüstenblume; Black is beautiful; Das Dorf der Puppen- und Das Russenkomplott.
In Bearbeitung ist noch die Organmafia.
Holz- und Specksteinskulpturen haben mich beschäftigt und die Fotografie. Kurzgeschichten und Gedichte schreibe ich seit Jahren, gelegentlich auch mundartliche. Der Roman Das Dorf der Puppen wurde durch die DEUTSCHE WELLE bekannt. Lässt sich alles nachverfolgen auf der Webseite www.romane-undreisen.de
Impressum/Datenschutz
www.Romane-undreisen.de
© Hans Sachs – alle Rechte vorbehalten.
3. überarbeitete Auflage 2022
© 2018
Covergestaltung: Werner Schröder
Quellenverzeichnisse: LEMO lebendiges Museum Deutsches historisches Museum Berlin
Wikipedia VW Typ 82
Hans Sachs
C/o Papyrus Autoren-Klub,
R.O.M. Logicware GmbH
Pettenkoferstr. 16-18
10247 Berlin.
E-Mail: [email protected]
Bildrechte: Eigene Bilder, Wikipedia Museum Berlin (Lemo)
Link zur Datenschutzerklärung:
Selbstverlag:
Werner Schröder
Prolog
Rudolf Haubold ist ein Kind des Erzgebirges. Seine Kinder-und Jugendzeit verbrachte er in dem kärglichen Ort Rübenau. Direkt an der Grenze zur Tschechoslowakei. Als Jugendliche kannten er wie auch sein gleichaltriger Freund Anton Grynszpan Schleichwege nach Kalek. In der ärmlichen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war man oft auf Schmuggeltour, um Lebensmittel einzukaufen. Driiben war manches reichlicher und preisgünstiger zu bekommen.
Das Wissen der Dorfschule seines Geburtsortes Rübenau war Rudolf nicht ausreichend. Er wollte mehr.
Als junger Mann schloss er sich den Nationalsozialisten an, und aus wirtschaftlicher Not wurde er zum glühenden Anhänger des Adolf Hitler– so wie viele Deutsche in den Zeiten um 1930. Somit startete er seinen verhängnisvollen Irrweg nach Polen. Er wurde SS-Offizier, Partisanenjäger und einer der Kommandanten des KZ Auschwitz. Haubold ist im Laufe der Jahre zum Handlanger einer Vernichtungsideologie aufgestiegen, die schwere Schuld durch Verfolgungen deutscher wie europäischer Juden auf sich nahm. Er wurde Teil der Vernichtungsmaschine des NS-Regime.
In der eigenen Familie ist er ein liebenswürdiger, singbegeisterter Mensch. In der Zeit des Nationalsozialismus zeigt er ein zweites Gesicht. Er übernahm die Ideologie der Nationalsozialisten. Rudolf ist wie Tausende andere verblendet. Der Marsch ins Verderben lässt ihn Höhen und Tiefen des Systems erleben.
Das Verbrecherische des Regimes erkannte er viel zu spät. Wird er seine Schuld je begleichen können?
Kindheit im Erzgebirge
Diese deutsche Mittelgebirgslandschaft ist um die Jahrhundertwende eine bitterarme Grenzregion. Sie bildete seit Generationen die natürliche Grenze zwischen dem deutschsprachigen und dem slawischen Sprachgebiet. Der Fichtelberg mit 1.215 wie der Keilberg (Klinovic) mit 1.244 m ü.N. N. prägen die Landschaft. Das Klima ist herb, die Sommer merklich kühler wie im übrigen Deutschland. Der Ort Kühnhaide im Schwarzwassertal des Erzgebirges gilt als der kälteste bewohnte Flecken in der östlichen BRD.
Erst im Mittelalter wurde das Mittelgebirge dichter besiedelt. Die Landschaft war durch Straßen kaum erschlossen. Der Holzreichtum aber ermöglichte die Glasherstellung. Bis zur Entdeckung ergiebiger Erzvorkommen galt es als das Land der Glasmacher. Dann verdrängten Silbererzfunde das Glasgewerbe und brachten zeitweise ein besseres Auskommen für die Bewohner. Aber manche Bergleute erkrankten durch ihre schwere Tätigkeit. Da musste die Armut durch Heimarbeit abgemildert werden. Klöppeln und Holzschnitzkunst halfen zum Überleben der meist kinderreichen Familien. Dennoch war Schmalhans der Küchenmeister. Oft kam nur Kartoffelsuppe auf den Tisch. Nur zu den Bergmannsfesten kam Freude auf.
Als die Lagerstätten sich durch jahrzehntelange Ausbeute erschöpft hatten, folgte eine erneute Verarmung. Zuwanderungen in Jahren des Booms wechselten zu Abwanderungen. In den 30ern des 20. Jahrhunderts, während der Weltwirtschaftskrise, gingen viele Verarmte den Versprechungen der National-Sozialisten auf den Leim. Massenhaft zog es sie in die nahen Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig in der Hoffnung, sich dort ihr Brot auf leichtere Art verdienen zu können.
Haubold wurde 1906 in eine arme Weberfamilie hineingeboren. Mit acht Geschwistern war seine Kindheit entbehrungsreich. Als junger Mann sah er keine Zukunft für sich in der Gebirgsregion. Auch er vertraute den Versprechungen einer zunächst sozial handelnden Partei. Es war die NSDAP des Adolf Hitler. Die hat sich im Verlauf ihrer Herrschaft zu einer verbrecherischen Organisation entwickelt.
Rudolf Haubold wuchs in sehr beengten Wohnverhältnissen auf. Es wurde gewitzelt, dass, weil es nicht genügend Schlafstellen für alle Kinder gab, der Nachwuchs nur stundenweise zur Nachtruhe kommt. Man würde die Blagen nach dem Einschlafen aufrecht an die Wand stellen, damit deren Geschwister ebenso das wärmende Bett genießen dürfen......
Eine Kate mit ungeheiztem Schlafzimmer, einer Wohnküche, in der sich das Leben abspielte. Das war die Behausung. Das Plumpsklo auf dem Hof in Nachbarschaft zum Ziegenstall. Ein ungeregelter Schulbesuch, wenn die Arbeit Vorrang hatte-das war der Tagesablauf der meisten Kinder des Gebirges.
Aus falsch verstandener Altersabsicherung wurde eine beachtliche Kinderschar in die Welt gesetzt. Einer der Gründe war auch die übergroße Kindersterblichkeit. Unhygienische Lebensumstände waren dafür verantwortlich. Einige Bürger hatten jedoch erkannt, dass viele Kinder der Anlass zur Armut sind. Dazu gehörte die Familie Grynszpan. Ein ungewöhnlicher Name in Rübenau. Er gab aber keinen Grund zum Nachdenken. Das änderte sich erst mit den Nazis.
Gegenüber dem Mittelalter hat sich zwar manches verbessert. Damals war das Gesinde zu Fronarbeit verpflichtet. Dazu erhielten sie freie Kost mit Logis im Stall, auf dem Heuboden, in der Futterküche. Die Verköstigung bestand vorwiegend aus Hafergrütze, Graupen, Erbsen, Sauer- oder Grünkohl. Dazu Rüben mit Brot. Sonntags gab es Hirse- und Weizenbrei. Nur zu Festtagen wie Weihnachten Fleisch, eine Kanne Bier, eine Semmel.
Wenn das um 1900 auch nicht mehr so war; es herrschte doch erhebliche Armut. Die Renten- und Invalidenversicherung wurde 1890 eingeführt, zahlte allerdings erst ab dem 70. Lebensjahr. Das erreichten nur einige der Versicherten, denn die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei nur 65 Jahren. Aus der Zeit stammt auch die Redensart, dass es zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel war, was sich in der Tasche fand.
Rudolf hatte, wie die meisten Kinder, zum Überleben seiner Familie beizutragen. Textilverarbeitung wurde überwiegend in Heimarbeit ausgeübt. In der Wohnküche, weil das der einzig beheizbare Raum in den ärmlichen Behausungen war. Weberfamilien waren arm, trotz Arbeit vom frühen Morgen bis in die Nacht. Die Spitzenklöppelei ist eine elegantere Form des Gewerbes und brachte etwas mehr in die Haushaltskasse. Trotzdem reichte es hinten wie vorne nicht. Es war der Nährboden für die Nazis.
Die allgemeine Schulbildung erlaubte nichts außer dem Erlernen der Grundkenntnisse vom Lesen und Schreiben. Oft fielen die Schulstunden aus, weil Erntearbeiten für die Ernährung der Familie Vorrang hatte. Im Winter machte der meterhohe Schnee den Schulbesuch unmöglich oder die Schulstube war nicht beheizbar. Ein Lehrer musste sich dazuverdienen, obwohl er ein etwas angesehener Zeitgenosse war. Nicht selten ließ er sich auch durchfüttern. Man hoffte dann auf bessere Zensuren für den Nachwuchs.
Fast ausschließlich sind Leute vom niedrigen Stand mit ihren Kindern Selbstversorger. Ein paar Ziegen meckern, Schafe blöken im Stall. Gelegentlich gehörte eine Kuh zum Bestand. Im Hausgarten werden Kartoffeln, Bohnen und weitere Nahrungsmittel angepflanzt. Das unwirtliche Klima im Erzgebirge sowie die kurzen Sommer lassen jedoch eine ertragreiche Ernte nicht zu.
Die Kindheit der Haubolds war also alles andere als lustig. Meist kämpft die Familie ums nackte Überleben. Die Kinder wurden früh eingebunden zum Schafe scheren, Wolle spinnen, Stoffe waschen. Dann mussten die Ballen in Tragekiepen zu den Färbereien und Aufkäufern in Olbernhau getragen werden. Das waren lange, beschwerliche Wege durch Feld, Tann sowie entlang der Natschung, dem Gebirgsfluss. Denn gepflasterte Straßen gab es keine.
Wenn sich im Winter vor den Butzenscheiben der Schnee türmte, Eisblumenbilder die Fenster zierten, war das Leben besonders mühselig. Dann verbreitete der mitten im Raum stehende Bollerofen wohlige Wärme. Jetzt wurden Heimarbeiten erledigt, wozu man im Sommer keine Zeit fand. Dazu werden erzgebirgische Lieder gesungen, deren Texte von der geliebten Heimat handeln. Das macht die Dunkelheit erträglicher. Trotz aller Armut: Man liebte das Leben.
Rudolf ist einer von den gescheiteren Söhnen im Dorf. Sowie ihm die Kargheit bewusst wurde, mochte er sich für sein weiteres Erdenleben nicht damit abzufinden. Der Junge erlebte den Ersten Weltkrieg; in den Hungerwintern 16/17 war er eben 12 Jahre alt. Sein Vater war Soldat und zog mit 'Hurra' gegen die Franzosen in`s Gefecht. Rudolf, der Älteste der Kinderriege, sorgte mit für das kümmerliche Durchkommen der Familie.
Auf ihm ruhte bereits viel Verantwortung. Denn gemeinsam mit den Geschwistern hatte er zu sorgen, das Überleben zu sichern. Alles war ärmlich. Kriegs- wie Nachkriegsjahre des Ersten Weltkrieges prägten den Jüngling.
Die Revolution in Deutschland erlebte Rudolf als blutjunger Mann. Oft war er von Hunger geplagt. Daher bestrebt, sich ein über seine Dorfschulbildung hinausgehendes Wissen anzueignen. Das war der Grund, weshalb er mit nationalsozialistischem Gedankengut in Kontakt kam. Ihm war nicht bewusst, dass er sich damit pervertierte Ideen aneignet. Die Erkenntnis kam erst sehr viel später.
Nicht oft erwarb ein intelligenterer Familienvater einen Lebensstandard, der ihm Achtung sowie ein sorgloseres Leben verschaffte. Doch das war es, was Rudolf vorschwebte. Dafür möchte er eine Schule in Marienberg besuchen. Aber dazu benötigt er eine Empfehlung. Würde der Pastor gut für ihn sprechen? Er war doch ein fleißiger, sonntäglicher Kirchgänger!
Rübenau
Rübenau liegt in unmittelbarer Nähe zur tschechischen Grenze. Der Ort wurde in der Zeit um 1580 gegründet. Flößer und Köhler waren die ersten Bewohner. Bereits 1571, noch bevor das Örtchen entstand, wurde mit dem Bau von Flößteichen begonnen.
Der Gebirgskamm war im Mittelalter mit undurchdringlichem Urwald bedeckt, dem Miriquidi. Wölfe und Bären verbreiteten Angst und Schrecken. Ziegen sowie die wenigen wertvollen Rinder wurden gerissen. Selbst Babys sind zerfleischt worden, wenn sie in ihren Wiegen vor den Katen Sonnenstrahlen genossen.
Ringsum von Rübenau wurde Bergbau betrieben, der aber nicht allzu ertragreich war. Profitablere Erzlager fand man in der weiteren Umgebung, in Freiberg, Marienberg und Annaberg. Flößerteiche ermöglichten die Nutzung des Waldreichtums. Deshalb entstanden viele Eisenschmieden. Rübenau wird noch heute das »Dorf der Schmiede« genannt.
Im 17.und 18.- Jahrhundert trugen Silber- wie Kohleschürfungen im Erzgebirge zu einem den damaligen Verhältnissen guten Einkommen bei. Daher gab es im Gebirge erhebliche Zuwanderungen. Die Leute kamen aus verschiedensten Glaubens-wie Himmelsrichtungen. Neue Orte entstanden, meist in der Nähe von Erz- und Kohlezechen. Die Gegend blühte auf.
Die Zugewanderten waren überwiegend Protestanten; aus dem Böhmischen vertrieben. Der Katholizismus unter Ferdinand II. um 1620 gewann an Bedeutung. Durch Vertreibungen wurden in Böhmen ganze Dörfer entvölkert. Lutheranhänger flüchteten nach Sachsen. Die Flagge des Nachbarlandes versprach ein erträglicheres Leben. Einige Jahre war es auch so. Dann erschöpften sich die Stollen. Armut kam zurück.
Seine Kinderzeit im Gebirge formte Rudolf Haubold zu einem hilfsbereiten, sympathischen Jugendlichen. Er war ein gern gesehener Zeitgenosse. Die Erziehung in einer Großfamilie wie die Konfrontation mit dem Leid in den Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren lassen ihn allerdings zu einem Skeptiker werden. Auch in den Jahren nach der SS-Zeit, vom Kriegsende 1945 bis zum Tod in den Achtzigern kümmerte er sich mit Empathie um andere.
Seit der Machtergreifung durch die Hitlerpartei 1933 bis zum Ende des Hitlerregimes zeigte Haubold dagegen ein dämonisches Gesicht. Er mutierte zum Herrn über Leben und Tod.
In Rübenau kennt man sich. Durch Eingemeindungen um 1900 zählte der Ort etwa 2.100 Einwohner. In der Ortsmitte die evangelische Kirche. Sechseckig, mit einem zwiebelförmigen Turm. Das Gebäude ähnelt eher einer Windmühle wie einem Gotteshaus.
In Rudolfs Jugendjahren gab es in Rübenau nur eine dem Landleben angepasste Schulbildung. Die war für Rudolf keine Grundlage zu einem erfolgreichen Lebensweg. Seine Integrations- und Anpassungsfähigkeiten verschafften ihm jedoch Kontakte zu Mitbürgern von Ruf. Die verhalfen ihm zum Schulwechsel nach Marienberg. Auch zum späteren Aufstieg in der Nazipartei. Er entspricht auch dem Idealbild eines Germanen. Hochgewachsen, blauäugig, drahtig. Solche Männer sind das Ideal Hitlers. Die passen in seine Großmannsüchte. Haubold ist, ohne sich dessen bewusst zu sein, ein Kandidat für Höheres.
In Notzeiten rücken Menschen gewöhnlich enger zusammen. Man hilft sich gegenseitig. Steigt der Wohlstand, wird wieder mehr an das eigene Wohl gedacht. Egoismus macht sich breit.
Die Großfamilie Haubold hatte zur Nachbarsfamilie Grynszpan eine lebhafte Freundschaft entwickelt. Deren Vorfahren waren im 16. Jahrhundert aus dem Böhmischen vertrieben worden. Bruno und Judith Grynszpan haben vier Kinder. Nach damaliger Auffassung wenige. Sie erkannten jedoch beizeiten, dass nicht Kinderreichtum ihr Leben im Alter absichert, sondern eine gute Ausbildung des Nachwuchses. Die würden ihren Eltern einen sorgenfreieren Lebensabend bereiten. Erhofften Vater wie Mutter sich jedenfalls. Denn auf die durch Otto v. Bismark eingeführte Rentenversicherung hatte man vor dem 70. Lebensjahr keine Ansprüche. Leider erlebten das Alter nur wenige. Es war nur ein politisches Versprechen. Mehr nicht. Die Hitlerpartei agierte da geschickter. Mit Speck fängt man Mäuse.
Der Erste Weltkrieg war durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajewo ausgelöst worden. Schwere Zeiten kamen dann auf die Erzgebirgler zu. Durch die Grenznähe ergaben sich oft Reibereien mit den Nachbarn auf böhmischer Seite. Selbst Kinder trugen Kämpfe untereinander aus, denn die kannten Schleichwege zwischen den Ortschaften Rübenau diesseits wie Kalek und Necétin jenseits der Grenze. Sie führten Krieg im Niemandsland, in den Wäldern des Gebirges, ohne recht zu wissen, weshalb eigentlich. Doch sobald die Rübenauer sich eine Höhle gegraben hatten, kamen die Kaleker und zerstörten sie wieder. Die Jungs befeuerten einander mit selbst gebauten Zwillen. Kiesel oder Eicheln wurden als Munition verwendet. Gelegentlich aber, wenn die Wut über die Zerstörungen zu krass war, beschoss man sich mit Drahtkrampen. Das führte zu erheblichen Verletzungen. Doch dann waren die Auseinandersetzungen auch schlagartig beendet. Man war fair zueinander.
Anton, der älteste Sohn der Grynszpans, hatte kurz vor Beginn des Weltkrieges, sowie er neun Jahre alt war, auch Freunde 'driiben', wie es auf sächsisch hieß. Diese Freundschaft war aus der Not geboren. Im Nachbarland gab es Waren des täglichen Bedarfs erheblich preisgünstiger zu kaufen. Deshalb wurde Anton im jugendlichen Alter zum Schmuggler. Er schleppte in einem für ihn viel zu großen Rucksack aus kräftigem Leinen Metzgerwaren nach Rübenau hinüber. Gelegentlich war sogar eine Flasche Strohrum darunter. Auch Zigaretten. Die ließen sich gewinnbringend weiter verkaufen.
»Andon« sagte seine Mutter im bestem erzgebirgisch, wenn wieder eine Schmuggeltour anstand, »Schie wieda giehts heit ins Beems. Bist scho huppetil? (aufgeregt) Do giebts no a Ohmbrud, u dee giehts los. Un ziag dei Lodn a, is fei an Hundswatre. Glig aaf, un bis bälde.«
»Bis bälde, Mutt.«
Es sind verschlungene Pfade, auf denen er schleicht, stets unter Ängsten, entdeckt zu werden. Hört er es knacken, versteckt sich Anton im Unterholz. In Bächen holt er sich nasse Füße. Doch er ist gewitzt, ließ sich nie ertappen. Im Dunkeln machte er allerdings oft mit Bäumen Bekanntschaft, denn eine Taschenlampe durfte er natürlich nicht benutzen. Manchmal kehrte er nach anstrengender Tour mit Blessuren nach Hause zurück.
Bei Einbruch der Nacht musste er los, vorzugsweise bei Dreckwetter. Da war es unwahrscheinlicher, entdeckt zu werden. Denn selbst Zöllner sind Menschen, die nicht unbedingt bei 'Hundswatre' das trockene Revier verlassen. Manchmal kämpfte er sich auch bei Vollmond durch das Gestrüpp des Unterholzes, stets ängstlich lauschend, ob nicht doch ein Grenzwächter unterwegs ist. Gelegentlich ahmte er den Laut der Rehe oder eines Uhus nach, um auf eine Reaktion zu warten. Aber man hat ihn nie gepackt.
Wenn er mit einem Rucksack voller Lebensmittel heil zurück war, gab es für einige Tage reichhaltigere Rationen. Und da Grynszpans eine selbstlose Nachbarschaft zu den Haub`s pflegten, bekam die Nachbarsfamilie stets etwas von den begehrten Schmuggelwaren ab.
Rudolf und Anton Grynszpan sind Freunde im fast gleichen Alter. Sie verbrachten ihre Freizeit oft gemeinsam. Nur auf Schmuggeltour konnte Anton keinen Mitwisser gebrauchen.
Not schweißt zusammen. Daher haben die Nachbarsfamilien Haubold und Grynszpan auch zu anderen Leuten des Grenzdorfes ein freundschaftliches Verhältnis. An lauen Sommerabenden sitzt man einträchtig vor der Haustüre, in Winternächten am knisternden Holzofenfeuer in der Wohnstube. Es werden alte Geschichten erzählt sowie volltönende erzgebirgische Weisen gesungen. Das Lied vom »Vugelbeerbam« ist immer dabei. Rudolf singt mit ausdrucksvoller Stimme. Sein durchdringender Tenor erfüllt die Stube; wie geschaffen als Befehlsstimme. Doch dann war sie nicht mehr melodiös.
Vier Jahre Krieg und gnadenlose Hungerjahre hinterließen tiefe Wunden. In Rübenau auf deutscher wie Kalek auf tschechischer Grenzseite. Sowie aber die Wirren der frühen 20er überstanden waren, besserten sich die Verhältnisse in Rübenau langsam. Die Verbundenheit zwischen den Familien Haubold und Grynszpan löste sich. Unterschiedliche Interessen bestimmten ab da ihr Leben.
Die Nachkriegszeit
Der 1. Weltkrieg endete 1918 mit der Niederlage Deutschlands. Die heimkehrenden, schwer traumatisierten, oft amputierten Soldaten fanden oft selbst in der Heimat und bei ihren Familien keinen Halt. Sie orientierten sich zu rechten oder linken Parteien, ohne zu wissen, was von denen zu erwarten ist. Deutsche Kleinstaaten unter Kaiser Wilhelm II. mitsamt seiner Verbündeten hatten an zwei Fronten gekämpft. Im Westen gegen die so apostrophierten 'Erzfeinde' Frankreich mit England, im Osten das zaristische Russische Reich.
Die Monarchie wurde durch bürgerkriegsähnliche Zustände abgeschafft, Kaiser-Wilhelm II. verschwand ins Exil nach Holland, bürgerliche Parteien entstanden. Die Wirren der Zwanziger, dazu Hungerjahre, untergruben manche Gesundheit. Froh war, wer Kartoffeln im Keller und einen Hering auf dem Tisch hatte. Nicht nur abgelegene Regionen wie das Erzgebirge, der Pfälzer - wie der bayrische Wald sowie Oberbayern litten Not. Im durch viele Kleinstaaten zersplitterten Deutschen Reich war der Hunger zu Hause.
Links- wie rechtsradikale Parteien werden einflussreich. Die kommunistische DKP mit russischer Doktrin, rechtspopulistisch die Volksfront und spätere NSDAP. Blutige Straßenkämpfe tobten in Berlin wie anderen Städten Deutschlands. Litfaßsäulen und Hungerleider prägten das Straßenbild. Meuchelmorde waren an der Tagesordnung und ständiges Gesprächsthema. Das Land war in Aufruhr, das Volk sehnte sich nach einer starken Hand.
Der Aufstand auf dem Panzerschiff Aurora in St. Petersburg gegen das Zarenregime mündete in Russland im Chaos. Die Zarenfamilie wurde ermordet. Weiß bekämpfte Rot. Tausende verbluteten im Bürgerkrieg.
Rudolf `s Vater kam zurück, beinamputiert, dazu seelisch ein Krüppel. Fürchterliche Monate lang hatte er vor Verdun gelegen, im Schlamm der Schützengräben, bei Angriff wie Verteidigung. Er ist so traumatisiert, dass er darüber nicht sprechen konnte, wie noch mit Bajonetten gegeneinander gekämpft wurde. Wie im Mittelalter hatte man sich gegenseitig abgestochen. Auge in Auge stand man sich gegenüber. Millionen brachte es den Tod, Milliarden Reichsmark waren in Kriegswerkzeug und Tod investiert statt ins Wohlergehen der Bevölkerung.
Kurz nach seiner Rückkehr starb die Frau an den Folgen körperlicher Auszehrungen durch die vielen Geburten wie auch ständiger Unterernährung. Der Veteran Haubold wurde von zwei Töchtern bis zum Tod voller Hingabe umsorgt. Die Familie war am Ende. Rübenau sowie andere Orte im Erzgebirge durch Hunger und Kriegstod dezimiert.
Bruno Grynszpan war aufgrund einer Bergmannskrankheit von der Bürgerwehr freigestellt. Er hat deshalb an den Schlachten 14/18 nicht teilgenommen. Stattdessen engagierte er sich in Rübenau und den umliegenden Orten humanitär. Seinen Nachbarn Haubold betreute er mit Hingabe.
Der nachbarschaftliche Zusammenhalt in der Kriegszeit war sehr ausgeprägt. Doch in der Zeit danach hatten die Leute weder Geld noch den Sinn, die früher so begehrten erzgebirgischen Holzwaren zu kaufen; die Familien kämpften ums nackte Überleben. Es war wichtiger, an lebensnotwendige Grundnahrungsmittel zu gelangen. Von Rächermandeln war nichts abzubeißen. Die Heimarbeit mit vormals so geschätzten Holzfiguren brachte kaum noch Gewinn.
Der Weberfamilie Haubold erging es daher etwas besser. Jetzt waren neben Lebensmitteln vor allem Textilerzeugnisse gefragt. Rauborstig gestrickte Unterwäsche aus Schafwolle, die zwar unangenehm auf der Haut kratzt, aber behaglich wärmt, riss man ihnen aus der Hand. In den eisigen Wintern des Erzgebirges war das die richtige Handelsware. Joppen, Hosen, zwiefach verknüpfte Handschuhe sowie Strümpfe erwiesen sich als Renner.
Reichtümer ließen sich mit diesen Erzeugnissen zwar nicht erwerben, aber es reichte so hin. Der Tauschhandel florierte. Heiß begehrt waren auch Zigaretten, für die mancher sein letztes Hemd gab.
Die zahlreichen Geschwister Rudolf`s hatten das Erwachsenenalter erreicht. Sie verließen das Haus. Mitesser am Tisch wurden weniger. Was brachte es also, viele Kinder zu haben? Die Eltern waren froh, dass die Stuben sich endlich leerten.
Die Ansichten der beiden in den Vor- wie Kriegsjahren so sehr verbundenen Familien Haubold und Grynszpan drifteten auseinander.Rudolf ebenso wie zwei seiner Schwestern fühlten sich zur S.A. hingezogen. Es war ihre Überzeugung, dass es in Deutschland ohne Zucht und Ordnung wie bisher nicht weitergehen kann.
Anton, Emma, Arthur, besonders aber Joseph Grynszpan verspürten ein religiöses Gemeinschaftsgefühl. Sie engagierten sich für ihre hilfsbedürftigen Mitmenschen. Es wurde ihnen nicht gedankt. Im Gegenteil. Unter den Nationalsozialisten hatten sie ein schweres Los zu tragen. Die Familie wurde verfolgt und inhaftiert. Man verdächtigte sie, Juden zu sein.
Aber Emma mochte ihre Fähigkeiten nicht brachliegen lassen. Sie versuchte sich mit der brotlosen Kunst der Aquarell-Malerei. Insgeheim hoffte sie, dass der Handel mit den erzgebirgischen Holzwaren wieder in Gang käme. Daran hatte das Madel ihr Herz verloren.
Zwischen den Kriegen
Rudolf war im bisherigen Leben aus Rübenau kaum hinausgekommen. Nur gelegentlich machte er sich mal nach Kühnhaide oder Rothental auf die Socken. Das sind jeweils Fußmärsche von 5 bzw. 8 Kilometer. Und der Rückweg ist auch nicht kürzer. Bis Kalek, direkt hinter der tschechischen Grenze, sind es dagegen bloß knappe drei km, doch der reguläre Grenzübergang ist stets mit erheblichen Schwierigkeiten und Kontrollen verbunden. Die Zöllner vermuten nicht ohne Grund, dass gefragte Waren irregulär den Schlagbaum passieren; denn so entgehen dem Staat ja Zolleinnahmen. Deshalb hatte sich ja Anton Grynszpan im Jugendalter zum Grenzschmuggler ausgewachsen. Er schleppte lebensnotwendige Lebensmittel sowie den begehrten Strohrum durch die tiefen Wälder in sein heimatliches Dorf.
Das also ist die überschaubare Welt des Rudolf Haubold. Die einflussreicheren Orte Marienberg und Olbernhau, die nächsten Bahnstationen, liegen außerhalb seiner Reichweite, obwohl sie lediglich 12 bzw. 16 km entfernt sind. Die unbefestigten Wege dorthin sind beschwerlich; der Tagelöhner quält sich bergauf und bergab. Wenn es zwar keine Felsenberge wie in den bayrischen Alpen sind–der Mensch ist geschafft, wenn er die Entfernungen, meist mit einer schweren Traglast auf dem Rücken, bewältigt hat.
In der zwei-klassigen Volksschule Rübenau erhielten die Kinder nur ein Grundwissen vermittelt. Es reichte eben mal aus, die in der Gemeinde ansässigen Handwerke zu erlernen. Das genügteRudolf aber nicht. Er sehnte sich mit dreizehn Jahren in die für ihn unbekannte Welt Marienbergs. Weil Klassenbester, hatte er eine Empfehlung zur Mittelschule der Kreisstadt erhalten.
Die gleichaltrigen Rudolf Haubold und Anton Grynszpan schlagen unterschiedliche Lebenswege ein. Rudolf auf der Realschule in Marienberg, Anton mit Volksschulbildung in einem Hammerwerk bei Rübenau. Jeder hat eigene Vorstellungen von einem Leben nach den Hungerjahren. Viele Parteien versprechen das Blaue vom Himmel. Wissen aber nicht, wie das zu realisieren sei. Hunger ist überall greifbar.
Der Jüngling Rudolf verlässt die Familie und den Heimatort, wo er seine Kindheit verbrachte. Unterkunft in Marienberg findet er bei einer Tante, der Schwester der verstorbenen Mutter. Der Hinterwäldler kommt in eine ihm völlig andersartige Umgebung, in der er sich zunächst überhaupt nicht zurechtfindet. Von einer Dorfschule auf die Mittelschule einer Stadt zu wechseln, erfordert Mut; aber er hat ein Ziel vor Augen. Rudolf ist ehrgeizig, will mehr aus seinem Leben machen. Neben Mathematik schwärmt er für deutsche Geschichte. Anders wie in der Zwergschule Rübenau könnte ihm dort das Wissen vermittelt werden. Das war die Intention.
Doch sie birgt Gefahr: In Marienberg unterrichten Lehrkräfte, welche den soeben überwundenen Weltkrieg ideologisch behandeln. Das aber war Rudolf nicht bewusst. Er verschlang das an Wissen, was ihm geboten wird. Doch es besitzt einen eigenartigen Beigeschmack.
Realschuloberlehrer Böhm ist so ein gestriger, und ausgerechnet der wurde zum Klassenlehrer des neuen Schülers. Der Zufall führte dahin, dass der geschichtsdurstige Rudolf auf den Pädagogen trifft, der dieses Wissensgebiet zu seinem persönlichen Lehrauftrag gemacht hatte. Die Weichen wurden unbewusst zu einer schicksalsträchtigen Symbiose gestellt, aus der es kein Entrinnen geben wird. Doch Lehrer wie Schüler ahnen es nicht.
Dieser hinterwäldlerische Neuling gelangt also in eine 4-stufige Realschulklasse. Nach sechs Jahren Volksschule hat er sich mächtig anzustrengen, um das Klassenziel der 10. Klasse zu erreichen, zumal der Unterricht in Rübenau wegen Mithilfe bei der Heimarbeit und in den grimmigen Wintern oft unterbrochen war. Rudolf hat es schwer, das Niveau der neuen Schule zu finden.
Wie es halt ist, wenn man sich in fremder Umgebung nicht auskennt, tritt man oft in Fettnäpfchen. Manchmal werden die auch extra aufgestellt, um NEUE aufs Glatteis zu führen. Das ist zwar fies, aber alle Beteiligten, außer dem Opfer selbst, ergötzen sich daran.
Anders, wie er es bisher kannte, findet der Unterricht auf der Realschule getrennt nach Mädchen und Jungen statt, worüber Rudolf nicht im Bilde war. Er wird als Neuling einer 6. Klasse zugeteilt, doch man schickte ihn bewusst in eine Mädchenklasse. Da sitzt er, der einzige Bub. Er hat sich Spott wie Neckereien der Mädel gefallen zu lassen. Bis die Klassenlehrerin ihn auf diesen Schabernack hinwies und er unter schadenfrohem Gelächter die Weiberklasse fluchtartig verließ.
Ein wüstes Gejohle empfing ihn ebenfalls in der ihm zugeteilten Klasse, denn hier wusste man auch von dem Streich. Hätte Rudolf nicht ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein entwickelt, wäre er umgehend wieder zurück nach Rübenau geflüchtet. Er aber sinnt auf Rache. Bei passender Gelegenheit würde ihm sicher eine geeignete Retourkutsche einfallen.
Oberlehrer Böhm ist Garant für Zucht und Ordnung in der Klasse. Der gediente Soldat brachte es bis zum Hauptmann. Er marschiert mit festen Schritten während des Unterrichts im Klassenraum auf und ab; mit einem Rohrstock klopfte er auf das Pult oder Tische der Schüler. Nicht selten auch auf die Hand- und Sitzflächen seiner Untergebenen. Er ist typisch Respektsperson; duldet keine Flachsereien oder Widerreden.
Schummeleien schon mal gar nicht. Erwischt er jemanden mit Spickzettel, fand der sich für Stunden vor der Klassentür wieder; der Schüler hatte dazu Spott und Gemeinheiten anderer Pennäler zu ertragen.
Im Unterricht hilft solch militärisches Regiment, außerhalb der Penne aber geht man dem Herrn Böhm gerne aus dem Weg. Da besitzt er kaum Freundschaften. Doch im Fach deutsche Geschichte ist der Pauker ein ausgewiesener Experte. Doch da Rudolf für dieses Lehrfach besonderes Interesse zeigt, wird er bald der Lieblingsschüler des Klassenlehrers. Beide sahen sich bestätigt und anerkannt: Der Lehrer, weil er einen wissensdurstigen für sein Lieblingsfach gefunden hatte; der Pennäler wegen der Möglichkeiten, bei einem Fachlehrer sein Wissen auf eine gehobenere Grundlage stellen zu können.
Für die meisten Schüler ist Geschichte ein rotes Tuch. Wer begeistert sich schon für Alarich und die Horden der Mongolen. Niemand freudig, nur unter schulischen Zwang. Die Kreuzzüge der Ordensritter gegen Sarazenen wie die Jahrhunderte lange Besetzung der iberischen Halbinsel durch mohammedanische Araber findet wenig Interesse bei Schülern. Das Pauken von Jahreszahlen wäre für manchen Pennäler Grund, den Unterricht zu schwänzen. Rudolf aber kann von diesen historischen Zeiten nicht genug erfahren.
Doch ebenso die überwundene Vergangenheit, die aktuelle Weltlage sowie die sich daraus entwickelnde Zukunft ist Gegenstand mancher Schulstunde. Somit von brennendem Interesse für Rudolf. Böhm sieht sich in seiner Unterrichtsgestaltung bestätigt, und der Neue hat einen Mentor, der ihm bisher Unbekanntes nahebringt. Böhm ereifert sich darüber, wie schändlich die Siegermächte von 14/18 mit Deutschland umgegangen wären. Die Partei des bis dahin unbedeutenden Hitler hatte es ihm angetan.
Die Mittelschule Marienbergs ist in die Jahre gekommen. Schülergenerationen haben die hölzernen Treppenstufen ausgetreten, die Toilettenwände mit sinnhaften Sprüchen und Zeichnungen verziert. Aus Geldmangel in der Nachkriegszeit hat die Stadtverwaltung notwendige Renovierungen nicht durchführen können. Daran störte sich Rudolf weniger; er war es aus Rübenau noch primitiver gewohnt. Da gab es Plumpsklos mit Herzen in der Tür, nicht getrennt für Mädchen wie Jungen. Der Lehrer – und es gab nur Einen– hatte ein eigenes Örtchen, das zudem abschließbar war.
WennRudolf die Toilettenräume der Marienberger Schule aufsuchen muss, erinnert er sich an den Empfang und persönliche Rachegelüste. Eine derartige Schmach hat sich tief bei ihm eingeprägt. Hier zeigte sich zum ersten Mal seine sadistische Ader. Er kommt auf eine perfide Idee. Frösche.
Wofür leben solche Tiere? Doch nicht nur, um Fliegen zu fangen oder selbst als Futter zu enden: Streiche könnte man damit aushecken. Nur erwischen lassen sollte man sich nicht.
Der vom Dorf »Zugreiste« kennt sich in der Natur aus. Er versteht sich darauf, wo diese Amphibien einzufangen sind. Sammelt einige davon und bringt sie in einem Karton mit zur Schule. Aber nicht für den Naturkundeunterricht.
Das Geschrei und Gekreische der Mitschüler auf den Toiletten ist markdurchdringend. Wer die Frösche in den Aborten ausgesetzt hat, wurde nie herausgefunden.
Für Rudolf ist unerlässlich, sich im Rechnen – Mathe war noch kein gängiger Ausdruck – zu verbessern. Doch seine wahre Liebe ist Deutsch und Geschichte. Lehrfächer, die für viele abschreckend sind. In den Grundschulen lernte man nur das Wesentlichste. Die Namen Karl d. Große, Friedr. d. Große oder der nach Holland geflüchtete Kaiser Wilhelm II. sind ihm bekannt. Auch dass Deutschland eine Kolonialmacht neben England und Frankreich war und sich zur Industrienation entwickelte, lernte er. Hintergründe dazu sowie tieferes Wissen besitzt er aber nicht. Das besonders reizt den Jungen aus Rübenau.
Nach einigen Monaten hatte der Dörfler sich eingelebt. Respekt gegenüber seinen Mitschülern verschaffte er sich durch Lerneifer und Hilfsbereitschaft. Prügeleien, wie sie in Rübenau vorkamen, erlebt er an dieser Bildungsstätte keine. Hier gewinnt man mit Kenntnissen Vorteile, nicht durch Rabaukentum.
Lehrer Böhm findet Gefallen an dem neuen Schüler. Er gestattet ihm Zugang zu der vorzüglich ausgestatteten Bibliothek der Bildungseinrichtung, was eher unüblich ist. Rudolf nutzt das Privileg. Hier gewahrt er einen umfangreichen Fundus an Geschichtsbüchern; genau das, was den wissensdurstigen Neuen fasziniert. Er wird Dauergast im Lesesaal. Höhere Mathematik mit Algorithmenrechnung liegt ihm nicht so sehr. Davon lernt er just so viel, dass er dem Unterricht folgen kann und nicht mit einer EINS oder ZWEI im Zeugnis nach Hause geht.
Hey, das sind doch Superzensuren. Nein, waren es nicht. In den Zwanzigern ist die beste Zensur die SECHS, die geringwertigste die EINS. Rudolf genügen die Grundrechenarten. Das Fach Geschichte mit seinen zahlreichen Verzweigungen ist für ihn das wahre Leben. Da glänzt er mit den Bestnoten.
Der Klassenunterricht in Geschichtsschreibung fordert ihn kaum. Sein Wissen holt er sich gierig aus dem Lesesaal. Stunden verbringt er dort. Von der Literatur des Mittelalters kommt er an die Zeit um 1900. Die Jahre vor dem 1. Weltkrieg faszinieren ihn. Das ist dann fast selbst erlebte Geschichte. Die Chronik ist auch politisch wie finanzpolitisch zu sehen.
Aus dem Altertum ist überliefert, dass Fehden stets Eroberungskriege waren. Dem Sieger brachten sie Macht wie auch Reichtum. Aber nach gewissen Zeiträumen – so liest Rudolf es aus dem Schrifttum heraus – zerfielen solche Imperien wieder. Dekadenz oder Erstarkung bisher unterdrückter Gegner gaben den Grund. Zerfall – manchmal erst nach Jahrhunderten – erlebten die Phönizier, Karthager, Ägypter, Griechen ebenso wie Römer. Dschingis Khan mit dem Mongolenreich ging gleichfalls unter. Davor schützten ihn auch nicht seine Reiterheere.
Das Eigenartige ist, wie Rudolf erkannte, dass die Zeitspannen der Hochblüte solcher Staatsgebilde stets kürzer wurden. Von Azteken über Pharaonen bis zu Griechen und Römern war es so. Die neuzeitlichen Staaten bringen es nur noch auf Jahrzehnte. Geht die Abwärtsspirale so weiter?
Der neue Schüler entwickelt sich zum jugendlichen Pseudowissenschaftler. Intensiv beschäftigt er sich mit geschichtlichen Abläufen und versucht, daraus naturgegebene Regeln zu erkennen. Nach 2 Jahren Unterricht ist Rudolf in der Neuzeit angekommen. Er setzt sich mit dem Deutsch-französischen Krieg 1870/71 und der Zeit darnach auseinander. Erkennt, dass der Auslöser für die Auseinandersetzungen ein Ansinnen von Napoleon III. war. Der drängte König Wilhelm von Preußen, zu verhindern, Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen zum Monarchen von Spanien krönen zu lassen. Es barg das Potenzial eines neuen Krieges. Rudolf erkennt, wie dreist Diplomatie sein kann. Der Jüngling verabscheut jegliche Gewalt.
Der Rübenauer kann jetzt nachvollziehen, wie es dem Vater im 1. Weltkrieg ergangen war. Nur mit Gotteslohn versehen erreichte er seinen Heimatort wieder. Er war ein Krüppel und so traumatisiert, dass er über die Kriegserlebnisse selten nur gesprochen hat. Rudolf aber war wissensdurstig und findet in Marienberg endlich Gelegenheit, Hintergründe wie Zusammenhänge zu erkennen.
Ihm wird bewusst, dass aus nichtigen Anlässen Konflikte angezettelt werden. So hat der unwissende Untertan mit Hurra für seinen Landesherrn das eigene Leben geopfert. Das führte zum 1. Weltkrieg. Nach dessen Ende dann zu Reparationszahlungen an England und Frankreich. Es war der Auslöser für den Aufstieg des Adolf Hitler.
Rudolf geht in der Historik auf. Er verschlingt Bücher und bastelt sich sein Bild der Zeit zusammen.
Deutschland als Kolonialmacht fasziniert den Schüler, der im Kindesalter erlitt, wie das Kaiserreich unter Wilhelm II. auf den 1. Weltkrieg zusteuerte. Die Hungerjahre erlebte er dann selber mit.
Nach Kriegsende 14/18 wurde das Deutsche Reich ausgerufen, das zunächst aus 26 Kleinstaaten bestand. Aus der Kleinstaaterei ist ein gewichtiger Nationalstaat entstanden. Staaten wie England, Russland oder das wieder erstarkte Frankreich wurden zu Neidern.
Aus Missgunst und Angst ist das politische Attentat von Sarajewo zu erklären, das zum Ausbruch des 1. Weltkrieges führte. Die Hintergründe dazu verinnerlichte sich Rudolf während der Schulzeit in Marienberg. 1922 im Alter von 18 Jahren beendete er mit brauchbaren Prüfungszeugnissen diese Zeit.
Der Heranwachsende ist aber noch nicht volljährig. Den Status erreichte man damals erst mit einundzwanzig Lenzen. Weil die Eltern jedoch nicht mehr lebten, musste sein Vormund, die Tante, bei der er die Schuljahre über wohnte, zustimmen zu dem, was er nach der Schulzeit lernen wolle.
Weil ihm die aristokratischen Voraussetzungen sowie die finanziellen Mittel fehlten, bleibt nur die Ausbildung in einem Handwerk oder im kaufmännischen Bereich. Rudolf entscheidet sich für eine Berufslaufbahn mit weißem Kragen. Eine Lehrstelle fand sich durch Vermittlung des Oberlehrers Böhm im Büro des Bergbaumuseums Freiberg. Der Jüngling nimmt Abschied von Marienberg sowie seiner betagten Tante. Dass er den Lehrer unter völlig anderen Umständen einmal wiedersehen würde, ließ sich nicht erahnen. Das Weltgeschehen stellt aber die Weichen.
»Glig aaf!, liaber Jung, in Fribarg bist wiedr a Uhiesschr (Fremder). Loß dr annern fei lorxn, schee wars miet dr. Bist an gudds Berschl.«
»Dank di, Tante, war schee bei dr, hinnewider kimm i vorbie, denn kehr i mohl ei!« Der sächsische Dialekt ließ sich nicht verbergen, er musste sich aber für die Zukunft mehr auf das Hochdeutsche konzentrieren.
Von Marienberg fährt er mit der fauchenden Eisenbahn ein Stück weiter in unbekanntes Land. Freiberg ist ein neuer Ort im Alltag des jungen Rudolf. Die schulische Bildung hilft ihm, Herausforderungen anzunehmen. Wenn auch die politischen Zeiten und das wirtschaftliche Leben unsicherer wurden; der Jüngling muss sich auf die Forderungen des Lebens einstellen. Rübenau und Marienberg lässt er hinter sich. Dass er ein Rad im Getriebe einer weltpolitischen Katastrophe sein könnte, war noch nicht abzusehen.
Im Haus der Witwe eines Freundes von Böhm erhält er eine Unterkunft. Der Verstorbene, ebenfalls Lehrer, war wenige Tage vor Ende des Krieges in Frankreich gefallen. Rudolf ist 1924 zu einem 18-jährigen, kernigen, in jeder Hinsicht blauäugigen blonden Jüngling herangewachsen. Ein Arier, wie er genau ins absurde Weltbild der N.S.D.A.P. passt.
Durch die Tätigkeit im Bergbaumuseum kann er sich Kenntnisse im kaufmännischen Bereich erwerben. Doch geschichtliche Interessen lassen sich da nicht weiter nachgehen. Hier ist sein Aufgabengebiet mit der Darstellung der Fördergruben des Erzgebirges ausgefüllt. Das erfüllt sein Leben aber nur unvollkommen. Doch der Mensch muss ja was zum Beißen haben.
Rudolfs Kontakte nach Rübenau sind abgebrochen. Der Geburtsort liegt zwar quasi vor der Haustür; den jungen Mann berühren jedoch die Verhältnisse der Nachkriegsrepublik mehr wie das dörfliche Rübenau. Berichte über Verbrechen füllen die Spalten der Zeitungen. Vor allem die wiedergegründete NSDAP mit der SA stehen dabei im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzungen der Organisationen rauben ihm den Schlaf.
Die NSDAP war in den Jahren vor 1933 eine normale, dem deutschen Volkstum sich verpflichtende Partei. Das brachte ihr viele Anhänger, denn sie versprach und suggerierte dem Mann auf der Straße, ihn aus der wirtschaftlichen Misere herauszuführen, in der das Land sich befand. Das verarmte germanische Volk nagte am Hungertuch. Doch die Methoden zur Wiederauferstehung waren undemokratisch.
Vorerst wurde das radikale, die „arische Rasse“ hervorhebende Gedankengut der NSDAP betont unter Verschluss gehalten. Es war den nicht der Führungsriege zugehörigen Parteimitgliedern unbekannt, und dem kleinen Mann (und der Frau) schon gar nicht. Auch Rudolf wird davon ebenso keine Kenntnis besessen haben.
Als 20-Jähriger fühlte er sich zum Militär hingezogen, landete er aber in den Fängen der sozialistischen Arbeiterpartei. Er sieht Möglichkeiten zum persönlichen Aufstieg, und daran will Rudolf teilhaben. Er trat in die Partei ein im Glauben, im Leben voranzukommen. Das war auch so. Doch anders, wie er es sich erträumte. Er entwickelt sich zu einem Janus, einem Menschen mit diametralen Gesichtern.
In kinderreichen Familien war es üblich, dass Erstgeborene zuerst das Elternhaus verlassen. Es sei denn, es ist ein Sohn, der eine Landwirtschaft oder Betrieb übernehmen soll. Bei den Haubolds ist Rudolf der Älteste, doch die Heimarbeit mit Textilien bot ihm keine Zukunftsperspektive. Seine Geschwister verließen das Zuhause, nachdem sie den kriegsverletzten Vater bis zum Tod versorgt hatten. Drei weitere Nachkommen waren frühzeitig verstorben. Es verblieben nur zwei Schwestern Rudolfs im Haus der Kinderzeit.
Es ist eine Frage der Zeit, bis sie ebenfalls die Türen von außen schließen werden; es sei denn, sie fänden hier den Mann ihres Lebens. Schwierig wird es sein, weil bessere Arbeitsmöglichkeiten nur in den größeren Städten Dresden, Chemnitz oder Leipzig zu finden sind.
Der Zechenbetrieb im Rübenauer Ortsteil Einsiedel war bereits vor dem Krieg zum Erliegen gekommen. Bruno Grynszpan, der ehemalige Steiger, hatte jedoch noch beste Verbindungen zu einem Hammerwerkbetrieb. Dort wurden Gerätschaften für den Ackerbau, Schrotgewehre für die Jägerschaft, außerdem Nägel und Schellen gefertigt. 14/18 zudem Munitionshülsen. Der Betrieb war aber in die Jahre gekommen; Maschinen nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Es musste investiert werden, damit er überleben kann. Doch die Zeiten waren erbärmlich. Geld fehlte an allen Ecken.
Anton wird nach seiner Schulzeit in Rübenau jetzt in das Erwerbsleben eintreten. Der Vater half, eine Lehrstelle in diesem Hammerwerk zu bekommen. Anton wäre ja gerne ebenfalls Bergmann, doch das Gewerk in Rübenau ist mit Schließung der Silberzeche ausgestorben. Es blieb in dem Bergdorf nur der Beruf eines Schmiedes für Anton.
Ihm schwant, dass er ein schweres Berufsleben vor sich haben wird. Aber besser Feinschmied wie ohne Broterwerb, denn zum Holzschnitzer fehlt ihm das Talent. Der 14-Jährige beginnt daher 1920 seine Lehre zum Nagel- und Waffenschmied. Auch auf ihn traf zu, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind.
Schabernack ist im Handwerk weit verbreitet. Gleich am ersten Arbeitstag trug man dem neuen Lehrjungen auf, sich einen Hammer mit Gummistiel zu besorgen, mit dem man um die Ecke schlagen könne. Und für seinen Lehrmeister habe er Bier in Holzflaschen zu organisieren, weil das besonders potenzfördernd sein soll. Doch was wusste ein Bursche zu der Zeit schon, worum es sich bei Potenz handelt. Anton rätselt.
Weil sich aber beide Sachen nicht auftreiben ließen, verurteilte man ihn zu einem Jux. Barfuß in einem Wasserbottich stehend, wurde er an einem Pfahl gefesselt. Es ist Aberglaube unter Schmieden, dass, wer nach dieser Tortur nicht erkrankt, zum Lehrling für den Beruf geeignet sei. So denkt und handelt man seit uralten Zeiten.
Der neue Stift ist zwar grün hinter den Ohren, doch beileibe nicht töricht. Er ist aufmerksam und gewitzt, was er stets auch als Schmuggler bewiesen hatte. Sogar am 'Schandpfahl' nutzte er die Situation für sich. Anton analysierte das Verhalten seiner zukünftigen Kollegen.
Schadenfreudige gibt es jedoch immer, die sich an ihre eigene Lehrzeit erinnern. Man hantierte mit glühenden Nagelrohlingen vor Antons Nase, um ihm Angst einzujagen. Doch ebenso gab es Mitfühlende, die ihm während der Zeit am Pranger mit Aufmunterungen die Schmach erleichterten.
»’So wird man hart wie Kruppstahl’, denn ’Lehrjahre sind keine Herrenjahre’« rief man ihm zu. Er musste die Probe überstehen, um akzeptiert zu werden. Anton schaffte es.
Nach zwei Stunden wurde er befreit. Da hatte er seine Feuertaufe hinter sich und wird in die Betriebsgemeinschaft aufgenommen, wenn er denn nicht erkrankt. Auf diese Art wurden angehende Lehrlinge auch in anderen Berufen auf die Schippe genommen. Er ist zunächst der 'Stift', Unterster in der Betriebshierarchie, hat zu tun wie zu lassen, was Kollegen von ihm fordern. Aber – es stählt ihn, gibt Kraft und Mut für die folgenden Jahre.
So war es damals. Lehrbuben – Azubi nannte man die Lehrlinge erst sehr viel später. In den 80-ern, nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich fern am Horizont bereits abzeichnete.
Anton ist Laufbursche für alles- er hat Bier heranzuschleppen, die Werkstätten auszufegen, Zugpferde zu versorgen, Kohlen zu schippen sowie gelegentliche Watschen einzufangen. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Lehrlingslohn erhält er nicht; durfte nur froh sein, nicht selbst Ausbildungsgroschen zahlen zu müssen. Dass Handwerksmeister Vergütung forderten, war noch nicht lange her.
Es ist eine überschaubare Firma, in der Anton lernt. Eine Zwischenform von Handwerk und Industriebetrieb. Da haben die Mitarbeiter gewisse Vorteile. Dieses Hammerwerk wurde noch patriarchalisch geführt.
Patriarchen waren Eigentümer, aber auch Herrscher in ihrem Betrieb. Sie sahen sich persönlich verantwortlich für ihre Beschäftigten. Da hatte der Betriebsherr zwar oft sehr geringe Löhne gezahlt, von denen Arbeiter und deren meist umfangreiche Familien sich kaum ernähren konnten. Aber es gab Unterstützung bei Krankheit oder Tod. Zu Geburten erhielten die Mitarbeiter ebenso finanzielle Hilfe, doch immer auf freiwilliger Basis. Gewerkschaften und Tariflöhne waren noch unbekannt. Einflüsse der neuen Zeit mussten erst noch erkämpft werden. Da kamen die Parteien ins Spiel. Extreme Ansichten von Links wie Rechts prallten aufeinander.
Die Nagelschmiede hatte nach dem 1. Weltkrieg Hochkonjunktur, die Waffenschmiede nicht. Noch nicht. Nägel wie Schrauben werden für viele Zwecke eingesetzt. Klebetechnik war noch unbekannt.
Schwer zu verstehen, die Vielzahl unterschiedlicher Nägelarten. Gewöhnliche Drahtstifte wurden längst maschinell hergestellt. Nur besondere Ausführungen, Ziernägel, ließen sich in keine Form pressen. Die werden wie dunnemals mit handwerklichem Geschick geschmiedet. Dafür gibt es einen guten Markt. Der Absatz florierte.
Anton hat keinerlei Probleme, mit schweren Hämmern und überdimensionalen Zangen umzugehen. Er ist ein kräftiger junger Mann. Doch auch das feingliedrige Arbeiten liegt ihm. Dazu ist er ehrgeizig.
Bald wurden seine Fähigkeiten erkannt. Er war nicht mehr nur der Bierholer und Werkstattausfeger. Kunstvolle Stifte versteht er herzustellen, ebenso Ornamente, Wandteller und graziöse Kettenanhänger. Aus Schmiedeeisen, nicht aus Gold oder Silber. Anton war kaum ein Jahr in der Ausbildung, da ließ der Lehrmeister ihm auch die Freiheit, in andere Richtungen zu experimentieren. Heimlich durfte er sich daran üben, präzise Bohrungen auszuführen. Denn der Betrieb plante, die derzeit verbotene Schrotflintenproduktion wieder aufleben zu lassen. Dazu benötigt man qualifizierte Mitarbeiter. Anton besitzt das Feingefühl, Gewehrläufe zu fertigen. Automaten gibt es noch nicht.
Die beiden letztgeborenen Arthur und Joseph absolvierten ihre Schulzeit ebenso in der zwei-klassigen Volksschule Rübenau. Sie alle drückten die gleichen Bänke. Der Bruder mit dem missgestalteten Bein hat Probleme, weitere Wege zurückzulegen. Und bei der Lehrstellensuche gab es für ihn keine große Berufsauswahl. Er wird sich nur für einen der sitzenden Berufe Schneider, Uhr- oder Schuhmacher entscheiden können. Doch bis dahin ist noch Zeit.
Arthur wurde gehänselt, denn Kinder sind oft grausam. Er musste sich ständig Humpelfüßler nennen lassen, wie Brillenträger >Brillenschlange<. Es half nichts, den kräftigeren Bruder um Hilfe zu bitten. Danach wurde es nur weit übler. Deshalb sich zu prügeln, verabscheut er. Er ist ein sensibler Junge, der niemandem etwas zuleide tut.
Die Grynszpan-Familie hält zusammen, wenn es mit den Nachbarn Haubold auch weniger Gemeinsamkeiten gibt. Wenn die größte Not überwunden ist, wird man ungern daran erinnert. Darunter leidet die Verbundenheit der Dorfgemeinschaften. In Rübenau war es die Hauboldsippe, die sich zurückzog. Ein Jammer, dass die früher so eng befreundeten Rudolf und Anton schulisch, gedanklich und beruflich ungleiche Wege eingeschlagen haben. Die Umstände zeigten unterschiedliche Richtungen vor.
Nichts wird mehr so sein, wie es mal war. Wer Ohren hat zu hören, kann bereits das ferne Donnergrollen vernehmen.
Familie Grynszpan
Bruno Grynszpan lebt wie seine Vorfahren seit Alters her in Rübenau. Die Familie ist ortsverbunden.
Bruno war ein traditionsbewusster Bergmann und hatte es zum Steiger gebracht, bis er durch eine typische Bergmannskrankheit 1901 berufsunfähig wurde. In den Schacht einfahren und im Staub arbeiten war ihm nicht mehr möglich. Schmalhans, dieser garstige Küchenmeister, hat im Hause Einzug gehalten. Doch um das Überleben der Familie zu sichern, wurde nach zusätzlichen Erwerbsmöglichkeiten gesucht. Man versuchte es mit der Holzschnitzkunst, die im Erzgebirge weit verbreitet ist.
Judith war sich bewusst, dass sie etwas unternehmen musste, um ihre Familie durch diese schwierigen Jahre zu bringen.
Sie ist eine Frau voller Ideen. Neben ihren Hausfrauenpflichten findet sie noch die Zeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Es ist das Zusammenleimen von Einzelteilen und das Bemalen der Figuren. Das bringt etwas Geld ins Haus. Judith besitzt goldene Händchen.
Erzgebirgische Holz- und Weihnachtsspielsachen werden ebenso in Heimarbeit hergestellt wie Weberware. Bruno unterstützt seine Frau darin, indem er die Rohware von der Manufaktur in Olbernhau mit einer Tragekiepe abholt und die fertig bearbeiteten Sachen ebenso wieder zurückschafft. Es ist ein beschwerlicher, weiter Weg an der Natzschung entlang, einem reißenden Gebirgsbach. Hin-und zurück an einem Tag schafft er nicht. 22 Kilometer, schwer bepackt sind auch für einen kräftigen Mann keine Kleinigkeit. Er übernachtet dann stets bei einem ehemaligen Kumpel. Es gibt immer was zum Ratschen aus alten Zeiten.
Gemessen am Hauerlohn, den Bruno vor der Bergmannskrankheit ins Heim brachte, hat die Familie jetzt viel weniger zum Beißen. Es ist ein schweres Tagewerk. Manch einen schon trieb es vor Verzweiflung in den Tod.
In der ersten Zeit ihrer neuartigen Tätigkeit war Judith nicht perfekt. Deshalb wurde ihr manches Werkstück nicht vollwertig bezahlt oder sogar zurückgewiesen. Oftmals spielte da auch Schikane mit, wenn der Kalfaktor nur Mängel gesucht hat, um einen geringeren Lohn zu zahlen.
Jetzt zahlt es sich aus, dass die Grynszpans 'nur' vier Kinder zu versorgen haben. Im Abstand von etwa zwei Jahren wurden die geboren. Pünktlich alle 24 Monate lag ein frisches Pusselchen in der Wiege.
Das Älteste der Vier ist Anton. Im März 1905 kam er in Rübenau an, 1907 folgte ihm Emma. Ihre tiefgründigen, verschmitzt strahlenden Augen bezauberten schon als Baby aus der Kinderwiege. Winzige Händchen, die nach allem greifen, was in ihre Nähe kommt, entzücken die Eltern. Jedes unbekannte Gesicht brachte die Kleine zum Lachen.
Emma versucht schon als Fünfjährige, der Mutter bei den Heimwerkerarbeiten zur Hand zu gehen. Akkurat kann sie frühzeitig mit Pinsel und Farbe hantieren. Nussknacker, Engel und Rächermandln, von Judith ausgesägt, geschliffen und zusammengeleimt, bemalt sie perfekt. Mit feinsten Strichen zaubert sie Konturen auf das Holz. Ihr ungewöhnliches Geschick bewirkt, dass kaum noch Erzeugnisse vom Kalfaktor zurückgewiesen oder geringer entlohnt werden. Sie ist ein Goldmädchen.
»Hast widr gudde gemachat, bist a fei gueds Mad«. Das Lob von Mutter und Vater stärkt ihr Selbstbewusstsein und lässt ihre Augen leuchten. Bald wird sie zur Schule kommen, leider nur in die Dorfschule Rübenaus.
Emma entwickelt ungeahnte Fähigkeiten bei der Bemalung von Holzfiguren. Mutter schliff und leimt die Figuren zusammen wie eh und je, Vater Bruno erledigt nach wie vor den Zuträger mit Kiepe. Er hat lange Wege zu gehen.
1909 erschien dann Arthur in dieser Welt. Sein von Geburt an verkrüppeltes linkes Bein wird ihm erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Er ist das Sorgenkind seiner Eltern. Und nur deshalb ist er später von den Nazis als 'nicht lebenswert' eingeordnet worden. Die sahen nur kerngesunde, blonde Menschen als wertvolle Volksgenossen an. Wie wenn geistige Fähigkeiten keinen Wert besitzen.
Der Jüngste ist Joseph. Denkbar, dass man für diesen Sohn den biblischen Namen wählte, weil die Grynszpans eine gläubige Familie ist. Es ist ein Kinderquartett, das dem Elternpaar neben Sorgen, die es immer mal gibt, eine Menge Freude bereitet.
Nach wie vor sind es lausige Zeiten für erzgebirgische Nussknacker, Rächermandl und Weihnachtsengel. Nur Schwibbogen hatten zu Weihnachten Konjunktur, wenn die mit innovativen Ideen angeboten und durch Kerzen beleuchtet werden. In der dunklen Jahreszeit wird so eine heimelnde Stimmung in der Stube bereitet. Und damit möchte man auf dem neuerdings wieder abgehaltenen Weihnachtsmarkt die Besucher erfreuen. Christnächte sind seit Jahrzehnten ein Familienfest, und das besonders im Erzgebirge. Da hielt man auch in mageren Jahren dran fest.
Schwibbung war von alters her die Sehnsucht der Bergleute nach Licht, das sie so rar zu Gesicht bekamen. Morgens vor Sonnenaufgang fuhr der Bergmann in die Grube ein und abends bei Dunkelheit kam er erst heim. Kaum, dass die Kumpel ein paar freie Tage im Jahr erhielten. Ihre Kinder sahen sie nur sonntags aufwachsen.
Grynszpans hatten sich bald einen eigenen Vertrieb aufgebaut. Den Zwischenhandel über den Kalfaktor verdienten sie sich jetzt selber. Zur Adventszeit versilbert Bruno mit seinen Söhnen Josef und Arthur auf den Weihnachtsmärkten der reizvollen Städte Freital und Pirna ihre Kunstwerke. Einmal sogar auch in Dresden. Verkaufsbuden lassen sich da kostengünstig mieten.
Bruno ist ein uriger Verkäufer. Da kommt ihm seine Vergangenheit als Bergmann zugute. Er steht in erzgebirgischer Bergmannstracht am Stand–das mögen die Marktbesucher. Und er macht Musik auf dem Akkordeon oder seiner Mundorgel. Es regt zum Kauf an, besonders, sofern das Wetter mitspielt und die Berge tief verschneit sind. Konkurrenzdenken unter den Händlern gibt es aber auch, und innovative Ideen schaut man sich gelegentlich bei anderen Marktbeschickern ab.
»Joseph, gieh do eemol lunsn, wos de Adelbacher hot«
»eija, de hot orchveel gudde neie Zeich, abr de Küppner vu Olbrhaa......dos Gelump brucht keenr meh. ...«
So ist ihre Ausdrucksweise, die nicht überall verstanden wird.
Die Verkaufstouren sind zwar mit erheblichen Kosten und körperlichen Anstrengungen verbunden, doch wenn die Ware verkauft worden ist, hat sich der Aufwand gelohnt. Dann wird Heiligabend in den erzgebirgischen Stuben sehnsüchtig erwartet. Das Holzfeuer knistert, Tannenduft zieht durch die Behausung und man freut sich auf das traditionelle 'Neinerlei', die Suppe vor der Bescherung. Die Speise wird aus neun verschiedenen Gemüsearten gekocht und darf auf keinem Tisch fehlen.
Stets war es eine beschwerliche Tour, die kunstvollen Drechselarbeiten in Tragekiepen zum Zöblitzer Bahnhof zu schaffen; denn der Weg musste zu Fuß zurückgelegt werden. Es war zwar mal angedacht worden, von Olbernhau eine Zweigbahn nach Rübenau zu bauen. Doch wegen der geografischen Gegebenheiten wurde der Plan verworfen.
Daher ist Schuhwerk von hoher Qualität erforderlich für die steinigen Pfade. Und dafür sorgt der Schuhmacher Sachs, der ein Meister seines Fachs für robuste Gebirgsstiefel ist. Dessen urige Werkstatt in Rübenau ist weitbekannt.
Maschinen hat er keine im Arbeitsraum. Der ist Teil der Wohnküche, wo er vom frühen Morgen bis in späte Abendstunden bei dem Licht einer ’Schusterkugel’ arbeitet. Das ist eine mit Wasser gefüllte Glaskugel, welche den spärlichen Schein einer Kerze oder Spirituslampe verstärkt und durch Lichtbrechung so bündelt, dass der Schuhmacher die Schuhe auch bei Dunkelheit bearbeiteten kann. Alles ist präzise Handarbeit, was Hans Sachs fertigt.
Gemeinsam mit einem Lehrjungen besucht er auch entlegene Bauernhöfe und repariert dort die schweren Arbeitsstiefel. Es ist ein hartes Stück Brot, das er sich da verdient.
Einfache Ausführungen des Schuhwerks werden mit Holzstiften genagelt, Wertvolle mit Pechfaden genäht. Man nennt es doppeln. Dafür ist mancher Stich erforderlich. Das ist eine hochwertige Arbeitsweise, und derart hergestellte Schuhe trägt man über viele Jahre. Immer wieder kommen die zur Reparatur, wenn Sohlen oder Absätze verschlissen sind. Sogar mit erneuerten Vorschuhen werden die Treter versehen, um sie weiterhin gebrauchsfähig zu halten. Wegwerfartikel sind das keine. Das änderte sich dann, als es Schuhfabriken gab. Seitdem wurden Schuhwaren zu Massenartikeln. In den 30ern war das aber noch nicht der Fall.
So was von wertvoll waren früher ein Paar handgefertigte Schuhe, dass sie nicht selten sogar vererbt worden sind. Und die anstrengende, schweißtreibende Arbeit bringt dem Dorf-Schuhmacher Sachs trotzdem nur ein bescheidenes, aber für die Zeit um 1920/30 sicheres Einkommen. Er ist ein angesehener Mann im Ort, denn genau wie sein berühmtes Vorbild aus Nürnberg verfasst Hans Gedichte über sein geliebtes Erzgebirge. Er hat sich und sein Handwerk mit ein paar Zeilen gewürdigt:
Den Mann, der Schuhe machen kann,
den hat man Grund zu lieben.
Denn hat man keine Schlappen an,
dann käm man schnell zum Liegen.
Man hätte Husten, Schnupfen, Weh,
und manchmal schmerzt der große Zeh.
Drum achtet drauf und seid gescheit,
Kauft gute Schuhe, liebe Leit!
Politische Welt
Die Epoche der Weimarer Republik nahm ihren Anfang im November 1918, nachdem der mörderische Krieg endlich beendet war. Der Kaiser musste abdanken und ging ins Exil, Parteien von rechts und links drängten zur Macht. Deutschnationale, Gemäßigte und Kommunistische. Es waren bange, angsterfüllte Zeiten. Morde an Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und vielen anderen grassierten. Dazu kam die galoppierende Inflation, später sogar Hyperinflation, bei der es bis 1923 einen Werteverfall der Reichsmark von 32.400 % pro Monat gab. Mit solchen Zahlen vermochte der Normalbürger nicht mehr zu rechnen. Es kam wie im frühen Mittelalter wieder zur Tauschhandelswährung. Ende des Jahres 1923 hatte die Währung nur noch einen Wert von 1.000.000.000.000. zu 1, bis durch eine Währungsreform verhältnismäßig normale Verhältnisse eintraten.
Die Grynszpans kamen von den Weihnachtsmärkten gelegentlich mit Kartoffeln, Brot und gackernden Hühnern zurück nach Rübenau. Zur Ergänzung des Anbaus im eigenen Hausgarten sicherte das ein knappes Überleben. Und in der größten Krise hatten sie ausgesprochenes Glück. Eine aristokratische Familie bot Wertgegenstände zum Tausch an, nur weil diese Hochnäsigen sich erzgebirgische Handwerkskunst leisten wollten. Doch wie lässt sich das Meißener Porzellan unbeschadet nach Rübenau bringen? Darüber hat Bruno sich mit seinen Söhnen den Kopf zermartert. Aber es gelang. Das Geschirr wurde nicht zerdeppert. Zum Beißen war es nicht geeignet. Doch zum Schachern.
Es sind für die meisten Zeitgenossen schwer zu ertragende Lebensumstände in den ersten Jahren der Republik. Leider gibt es immer auch Kriegsgewinnler. Bekannte Fabriken, ebenso gewiefte Händler, die es verstanden, an gefragte Waren zu gelangen, haben Konjunktur. Unter dem Ladentisch verborgen finden sich Sachen, an die nicht jeder herankommt.
Nur Anton in der Waffen- und Nagelschmiede sah ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Im Hammerwerk, wo er seine Lehre zum erstklassigen Handwerker abgeschlossen hat. Nägel jeglicher Art und zunehmend Jägerwaffen, wurden zu gefragten Produkten. Wilderer haben Hochkonjunktur.
Anton trägt zum Überleben der Familie bei. Da er weiterhin unter dem Dach der Eltern wohnt, unterstützt er die Seinen. Er steht ja in Lohn und Brot. Die Grynszpans haben eine große soziale Empathie. Wenn sich etwas erübrigen ließ, gedachten sie noch ärmeren Dorfbewohnern und gaben, was entbehrlich war. Kirchlich engagiert man sich ebenfalls, denn vor allem Judith ist der Überzeugung, dass ihre erträgliche Situation mit festem Gottvertrauen in Zusammenhang steht.
Doch es stehen schwere Zeiten ins Haus. Nur-es weiß bisher niemand. Hitler war noch nicht an der Macht.
Es ist die schwerste Phase der Weimarer Republik. Täglich steigt die Inflation, Brot zu kaufen war fast unerschwinglich. Der niedrigste Wert einer Geldnote wurde mit der Ausgabe eines Geldscheines von 100 Billionen Mark 1923 erreicht.
Jeder, der etwas besitzt, handelt in Naturalien. Aber nicht alle verfügen über Wertsachen, die einzutauschen sind. Und daher verarmen viele Menschen und ganze Landstriche. Hungernde überleben nur mit Essen aus den Armenküchen, und mancher Verzweifelte in den Großstädten sieht nur einen Ausweg: einen Strick um den Hals.
Anton fürchtet in dieser Zeit auch, arbeitslos zu werden und dann keinen Unterhalt für die Hausgemeinschaft mehr leisten zu können. Doch mit Prädikat-Abschluss seines Prüfungsstückes, das er gefertigt hatte, ist er eine Fachkraft, auf die man nicht verzichten mag. Er wird zum Geselle und in der Schmiede-und Büchsenmacherzunft übernommen. Familie Grynszpan belastet eine Sorge weniger.
Antons Gesellenstück war ein künstlerisch gestalteter, handgeschmiedeter Schmucknagel. Und ein Gewehr, dessen Patronenlager- und Lauf bis auf eintausendstel m/m genau geschliffen und poliert ist. Das waren seine Prüfungsaufgaben. Er bekam auf beide Arbeiten die Höchstnote 'besser wie gut.' Das ist eine überdurchschnittliche Auszeichnung. Darauf darf er stolz sein.
Die Inflationszeit endet nur schleppend. Der Umtausch von Papiermark in neue Reichsmark fand am 15. November 1923 statt, doch das funkelnagelneue Geld wurde erst anerkanntes Zahlungsmittel, als ihm wieder reale Werte gegenüberstanden. Die Wirtschaftsleistung in der Republik beginnt sich zwar zu erholen, aber der Mittelstand war nachhaltig verarmt. Alles sind Folgen des 1. Weltkrieges.
Ab Mitte 1924 zeigt sich ein leichter Wirtschaftsaufschwung, doch gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Die Hansestädte Bremen und Hamburg profitieren zuerst. Steigender Im- und Export bringt Wachstum, später folgt die Industrieregion des Ruhrgebietes. Durch revolutionäre Aufstände von links- und rechtsgerichteten Parteien ist der Distrikt lange gelähmt. Die Zeiten stehen auf Sturm. Arbeiterräte üben die Regierungsgewalt aus. Ein Dorn im Auge der Nazipartei.
Auch in Thüringen und Sachsen, die wie andere Regionalstaaten dem Staatenbund angehören, bessert sich die Wirtschaftslage. Die Menschen kommen wieder in Arbeit und Brot. Es werden auch zunehmend Sachen gekauft, die nicht unbedingt zum Überleben notwendig sind. Davon profitieren die Familien Grynszpan in Rübenau und weitere Dorfbewohner. Man hofft, dass sich erzgebirgische Holzschnitzkunst wie früher gewinnbringend verkaufen lässt. Emma ist fleißig mit ihrer Kunst beschäftigt.
Rudolf ist im Büro des Bergbaumuseums Freiberg tätig. Sein Aufgabengebiet ist die Verwaltung von Exponaten. Ebenso die Planung von Ausstellungen im Museum. Die Abläufe ausarbeiten machen ihm Spaß. Da besitzt er besonderes Geschick. Sein mit Freuden begonnenes Selbststudium der mittelalterlichen- und modernen deutschen Geschichte zahlt sich aber nicht aus. Er bezieht zwar eine sichere, doch nur geringe Entlohnung. Damit lassen sich keine großen Sprünge hinlegen. Anders wie Anton Grynszpan kann Rudolf von der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung nicht profitieren.
Neben diesen Alltäglichkeiten reizt ihn das politische Geschehen, das er täglich vor Augen hat. Die Parolen der Parteien, die sich seit Ausrufung der Weimarer Republik gegründet haben, sind beunruhigend. Rudolf analysiert, welche der Organisationen dem zerrissenen deutschen Volk die beste Perspektive versprechen. Und er sucht nach verborgenen Inhalten. Die Linken und die Rechten gehen im Parlament mit Fäusten aufeinander los. Und noch immer werden Andersdenkende aus dem Weg geräumt. Wer steckt dahinter? Ist nicht leicht, den richtigen Faden zu finden.
1923 beendet Haubold die kaufmännische Lehre, dank der Realschulzeit um ein Jahr verkürzt. Er ist Theoretiker. Noch hat er sich die Hände nicht besudelt mit radikalen Machenschaften. Als Sekretär im Bergbaumuseum verdient er erste Gehälter. Durch das Studium der Geschichte besitzt er Kenntnisse, um zu erkennen, dass stets der „kleine Mann“ der Verlierer gegen die Obrigkeit ist.
Wenn es bis 1918 in Deutschland und vielen anderen Ländern der Adel war, welcher das Volk aussaugte, sind es neuerdings politische Vereinigungen. Wie die linksgerichtete KPD. Diese Partei will das Proletariat einführen, ohne jedoch über weitgehende wirtschaftliche Kenntnisse zu verfügen. Es dürfe keine Klassenunterschiede mehr geben, ist deren Philosophie. Und die Ideen sollen auch mit Gewalt durchgesetzt werden. Ein Aufruf lautet: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Der Wortlaut ist jedoch für gering Gebildete schwer zu verstehen. Aber er schürt Unruhen und Hass.
Handzettel sind unterzeichnet von Karl Marx, Karl Schapper, H. Bauer, Friedr. Engels, J. Moll und W. Wolff. Leute, die wenig später im Fokus der rechtsradikalen Partei des Adolf Hitler stehen. Der Abgrund ist nur noch nicht erkennbar. Doch das Volk schlitterte darauf zu.
Die Liebe des Rudolf
Als Angestellter verdiente Rudolf jetzt ein regelmäßig eintreffendes Gehalt. Der monatliche Scheck ist ausgestellt auf Reichsmark. Eine Währung, für die man sich wieder Reelles kaufen kann. Vorbei die Zeit, als Beziehungen überlebenswichtig waren. Die Zukunft lässt sich in rosigeren Farben darstellen.
Rudolf hatte zwar im Laufe der Schul-und Lehrzeit ab und an kurze Liebschaften, aber über mehr kam das nicht hinaus. Ihm fehlte schlicht das Geld, einer Freundin mit einer Kleinigkeit eine Freude bereiten zu können. Nun sieht es etwas anders aus.
Seit seiner Festanstellung im Bergwerksmuseum kann er sich leisten, entlegenere Gebiete mit dem Zug zu bereisen. Ein weiterer Schritt in eine ihm bisher vorenthaltene Welt.
Von Freiberg bis Chemnitz benötigt der Dampfzug eineinhalb Stunden. Einhundertachtzig Minuten hin–und zurück. Das ist an einem Tag zu schaffen, und da bleibt genügend Muße, sich die Großstadt anzusehen. Es ist das erste Mal, dass er eine Stadt dieser Größe besuchen wird. Er fiebert dem Ereignis entgegen.
Der junge Mann erlebt sich nicht mehr wie ein Hinterwäldler. Mit jeder Stufe auf der Lebensleiter wird der Rübenauer weltoffener, sein Horizont erweitert. Es ist ein Kennenlernen der Welt auf Raten.
Chemnitz mit 360.000 Einwohnern ist eine Großstadt. Sie bildet mit Dresden und Leipzig ein Städtedreieck. Viele Industriebetriebe sind dort angesiedelt, doch durch die Hyperinflation in den frühen Zwanzigern sind die massenhaft in den Ruin getrieben worden. Die Folgen sind weithin spürbar.