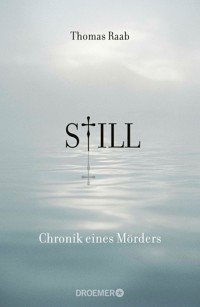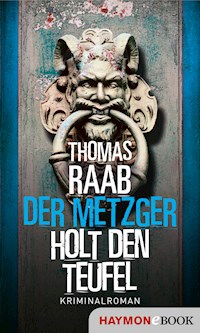
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Metzger
- Sprache: Deutsch
Konzertbesuch mit tödlichem Ausgang: Musik in den Ohren von Willibald Adrian Metzger? Wenn aus Reichen Leichen werden – der Metzger ermittelt in besten Kreisen Der Himmel hängt für den Metzger voller Geigen – leider bald im wahrsten Sinn des Wortes: Nach einem gemeinsamen Konzertbesuch mit Kommissar Pospischill werden mehrere Orchestermitgliede ermordet – ein Requiem des Grauens. Treibt da ein Strawinsky hassender Serienkiller sein Unwesen? Als wäre das nicht schon genug Aufregung für den Ruhe und Ordnung liebenden Willibald Adrian Metzger, muss er sich auch noch mit Pospischills Beziehungsproblemen und einer schönen Unbekannten in seiner Werkstatt auseinandersetzen. Letztere bringt zudem das Duett zwischen dem Metzger und seiner großen Liebe Danjela Djurkovic ganz schön aus dem Takt. Ein lukrativer Restaurierungsauftrag führt den Metzger dann zwar in die bessere Gesellschaft – aber seines Lebens ist man auch dort keineswegs sicher. Kann Maestro Metzger den Violinschlüssel zur Lösung des Falls finden und diese Misstöne in Ordnung bringen, ehe der mörderische Schlussakkord verklungen ist? Der Metzger – ein Original Der Metzger, das ist einer, der alte Dinge liebt. Als Restaurator kennt er die Schönheit eines Gegenstands, wenn dessen abgenutzte Oberfläche eine Geschichte erzählt. Er ist einer, der gerne allein ist, manchmal allerdings war er auch einsam, bevor Danjela in sein Leben trat und es heller und schöner machte. Er ist einer, der in der Schule gemobbt wurde, weil er zu klug und zu weich war für die wilden Bubenspiele am Pausenhof. Einer, der gerne Rotwein trinkt, mitunter viel zu viel. Doch auch, wenn mit dem Wein manchmal die Melancholie kommt, weiß er um die schönen Seiten des Lebens. Und um die lustigen. Vor allem aber ist der Metzger einer, dem das Verbrechen immer wieder vor die Füße fällt, manchmal stolpert er sogar mitten hinein. Und dann muss er, sehr zu seinem Leidwesen, aber zur Freude einer großen Leserschaft, die gemütliche Werkstatt verlassen und Nachforschungen anstellen … Der Raab – ein Kultautor Der Raab, das ist einer, der einen unverwechselbaren Stil hat. Schräger Humor, authentische Charaktere, Wortwitz, feine Gesellschaftskritik; vor allem eine extrem gute Beobachtungsgabe und zugleich die Fähigkeit, die Beobachtungen treffend-komisch aufs Papier zu bannen, das ist die Mischung, die ihn so erfolgreich gemacht hat. Beim Lesen ist es zuweilen schwer zu entscheiden, ob man gespannt der Auflösung entgegenfiebern oder sich lieber doch möglichst viel Zeit lassen möchte, um das Lesevergnügen voll auszukosten. Und vielseitig ist er, der Raab – er schreibt nicht nur verschiedene Kriminalromane, sondern auch Drehbücher. Mit "Der Metzger holt den Teufel" beschert er seinem kultivierten Helden Willibald Adrian Metzger unerwarteten Besuch – und beweist einmal mehr, dass es an Wortwitz, Überraschungsmomenten und Kompositionstechnik so schnell niemand mit ihm aufnehmen kann!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Thomas Raab
Der Metzger holt den Teufel
Vor den Augen der anderen ein Verschwundener werden und sich zugleich unübersehbar in deren Blickfeld befinden, ist kein Kunststück.
1
Maximal ein Kilo Zucker auf drei Kilo Steinobst, so lautet der Geheimtipp, um die Marmelade ähnlich perfekt hinzubekommen wie ihre Oma. Und wer bei der Frucht aufs Geld schaut, kann sich auch gleich den Weg zur Herdplatte sparen. „Ohne die echten Wachauer schmeckt sie einfach nicht, die Marillenmarmelade!“ – diesen großmütterlichen Leitsatz kennt jeder in der Familie. Ebenso die genaue Zeitangabe zum Thema Einkochvorgang: „Bis die Milchsäure den Muskel lähmt, so lange muss er dauern, der Stockeinsatz.“ Und diesbezüglich hat ihre Oma eine Ausdauer, da kann sich eine Teilnehmerin der Olympischen Spiele zusatzernähren, auf dass die Brusthaare nur so sprießen, die Goldene im einarmigen Rühren ist vergeben.
Sandra Kainz wird dieses generationenübergreifende Erbe niemals antreten können, sosehr sie die Oma auch liebt. In einem aber ist sie ihr trotz der fehlenden Rexgläser ebenbürtig: im strikten Befolgen einer Rezeptur. In diesem Fall im Befolgen der Rezeptur zur Bewältigung ihres Lebens, darin ist sie Meister. Folglich sitzt sie wie immer um diese Zeit beim Sekretär, schreibt ihrem Nachbarn ein paar Zeilen und gibt sich anschließend der Pflege ihrer weiteren Sozialanschlüsse hin:
Qrz15h
Und, einen guten Tag gehabt?
Bungee11
Guter Tag? Ein klasse Tag war das! Draußen heizt die Sonne herunter wie Ende Juni. Keine überteuerten Sommerurlaube mehr, der Süden ist bei uns, mitten im Herbst. Morgen schnapp ich mir meinen Jack Russel, schmeiß ihn ins Fahrradkörbchen und hau ab ins Grüne.
schwarz_auf_weiss
Da ist wohl das Bungeeseil ein paar Zentimeter zu lang gewesen. Ein Hund im Fahrradkörbchen ist Fleisch am Grill, am Kühlergrill nämlich, und dass der Süden jetzt bei uns ist, nennt man Erderwärmung.
Bungee11
Den schönen Tag hab ich, und wenn ihr mich fragt: Um glücklich zu werden, muss man das Beste machen aus den Dingen, die nicht zu ändern sind.
Mein_Therapeut_ist_tot
Fragt dich aber keiner, Klugscheißer. Derartige Fertigprodukt-Weisheiten stehen auf jeder bedruckten Häuselpapierrolle, damit kannst du deinen Allerwertesten beglücken!
Bungee11
Fertigprodukt-Weisheiten! Dazu zwei Worte: „Der Schlüssel zum Glück“ UND „Bestseller“.
fettarmes_Joghurt
Das waren jetzt fünf Worte UND wie bereits gesagt: bedruckte Häuselpapierrolle (DAS übrigens sind zwei Worte!).
Qrzl5h
Na, da ist ja wieder einmal eine Bombenstimmung.
Kammerton
Wenn die Stimmung schlecht ist, muss man eingreifen, oder, Qrz15h? Also: Morgen stirbt der Nächste.
Wotan7
Na wunderbar, hoffentlich erwischst du den Richtigen. Kleiner Suchtipp: Fahrradkörbchen.
Gleiches-Recht-für-Alle
Wieso DEN Richtigen? Kann ja auch DIE Richtige sein.
2
„Entsetzlich klingt das alles.“
„Die stimmen!“
„Um Gottes willen, Metzger! Wenn das stimmen soll, bist du reif für die erste Therapiesitzung. Die spielen falsch, hundertprozentig.“
„Pospischill, die spielen noch gar nicht. Die stimmen ihre Instrumente!“
Stille.
Nicht nur Kommissar Eduard Pospischill hüllt sich in Schweigen, auch die Musiker warten nun auf ihren Einsatz. In manchen Fällen kann das schon ein Weilchen dauern. Da wird dann so ein plötzlicher Einstieg mitten hinein ins musikalische Geschehen, beispielsweise für eine Triangel, einen Gong oder Paukenschlag, eine ganz schön heikle Angelegenheit. Der muss perfekt sitzen.
Das sollte ein Anzug auch. Wie eine Zwangsjacke umschließt den Metzger sein einziger Zweiteiler, der Hochzeitsanzug seines Vaters, und kneift in jeder Körperfalte. Stocksteif sitzt der Restaurator neben seinem Freund in der vordersten Reihe einer Balkonloge und beobachtet den zum Bersten gefüllten Konzertsaal. Herausgeputzt und hölzern, als ginge es um die Erhebung in den Adelsstand, thronen die Besucher auf ihren Sitzplätzen. Willibald Adrian Metzger kommt sich trotzdem vor, als säße er im Warteraum zur Kontrolluntersuchung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassa, so ein hysterisches Geräusper und Gehuste geht durch den Saal. Heftig wird die letzte Möglichkeit vor der sich anschließenden kulturbedingten Ruhepause genutzt, um diversen Zwängen noch ein wenig Auslauf zu gönnen.
Hypochonder darfst du hier keiner sein!, denkt er sich, während auch ihm langsam ein verstärkter Speichelfluss den Mund wässrig macht. Nicht, weil sich ein Gusto auf etwas Paniertes und frisch Herausgebackenes einstellt, sondern weil da gerade eine kleine Übelkeit im Anmarsch ist. So ein enger Anzug oder das vorm Weggehen noch schnell verdrückte Grammelschmalzbrot könnte einem Magen zwar tatsächlich zusetzen, der Metzger kämpft jedoch an einer anderen Front: Reichlich aufgetragene Duftwässerchen, kombiniert mit dem nun eifrig zum Auftritt des Dirigenten applaudierenden Publikum, das kann schon was. Genauso wie das Orchester. Hierzulande soll es kein besseres geben.
Der Dirigent holt aus, einsam beginnt ein Fagott, und erst nach und nach schmeicheln sich auch die übrigen Instrumente dem Zuhörer ins Ohr. Wobei natürlich unter schmeicheln jeder etwas anderes versteht.
Volltönend setzt abermals die Stimme Eduard Pospischills ein: „Stimmen die schon wieder, oder willst du mir erklären, dass das jetzt nach Noten geht? Da setz ich mich aber heut noch zum Wirten und mal Kugerln auf ein paar Bierdeckeln.“
In der hinteren Reihe knirscht ein Holzsessel, es folgen ein dezentes Klopfen auf die Schulter des Restaurators und ein zischendes: „Meine Herren, Sie wissen aber schon, warum wir Zuhörer heißen?“
Dass dieser Kulturgenuss peinlich ausfallen könnte, hat Willibald Adrian Metzger schon beim Erhalt seiner Einladung befürchtet. „Metzger, stell dir vor“, wurde ihm da von Eduard Pospischill am anderen Ende der Leitung erklärt. „Da hab ich mein Lebtag noch nie etwas gewonnen, dann wird gestern am Polizeifest bei der Tombola meine Nummer gezogen, ich freu mich wie ein Hutschpferd, bekomm zwei Konzertkarten, und der einzige Kommentar meiner Göttergattin ist: ‚Schad ums Geld für die Lose!‘ Was mach ich jetzt? So etwas lässt man doch nicht einfach verfallen, oder? Sag, willst du mich nicht begleiten? Mir fällt sonst keiner ein. Außerdem, bei so etwas war ich noch nie!“
Das hat er ihm sofort geglaubt, der Metzger, auch dass dem Pospischill da kein anderer mehr eingefallen ist, denn erstens sind die Freunde des Kommissars so spärlich gesät wie die Frauenrechte in Dubai, und zweitens ist Igor Strawinskys „Le Sacre du printemps“ alles andere als leichte Kost.
Die Instrumentalisten leisten Schwerstarbeit. Ein Donnern dröhnt durch den Konzertsaal, ein Stürmen und Beben, dann kommen die Pauken. Kraftvoll, eins, zwei, als ginge es darum, eine Galeere vorwärtszutreiben, hinein in die Phalanx der gegnerischen Flotte. Die kleinste Unsicherheit wäre fatal. Fasziniert beobachtet Willibald Adrian Metzger die Präzisionsarbeit eines der beiden betreffenden Orchestermitglieder. Deutlich unterscheidet es sich von seinen Kollegen: Es trägt keinen Anzug.
Ein körperbetont geschnittenes schwarzes Kostüm schmiegt sich um die zierliche Figur der Schwarzhaarigen. Unweigerlich sieht sich der Metzger in den Reihen der Instrumentalisten nach weiteren Damen um und erkennt relativ rasch: Da gibt es leichtere Übungen. Erst inmitten der Celli stört eine Perlenhalskette samt dazugehörigem zierlichen Nacken das ansonsten so harmonische Bild zugeknöpfter weißer Hemden unter silbergrauen Krawatten und schwarzen Anzügen. Das war’s dann aber schon. Zwei Frauen sind es also, die sich auf diesen fremden Planeten verirrt haben, als wären sie ungeladene Gäste einer Sitzung der FIFA, UEFA oder FIS – was den Metzger nicht weiter wundert. Nur weil es an diversen Musikuniversitäten seit Jahrzehnten von Studentinnen nur so wimmelt, heißt das ja noch lange nicht, dass sich das beste Orchester des Landes gleich von seiner mittelalterlichen Tradition verabschieden muss. So blickdicht die Vorhänge beim Bewerbungsvorspielen für frei gewordene Streicherposten auch sein mögen, die alteingesessene, durchwegs männliche Jury registriert schon rechtzeitig, wenn ihrer Herrenrunde da ein Weibchen mit dem Bogen in der Hand einen Strich durch die Quote machen will. Völlig synchron schießen also eine Horde maskuliner Bögen energisch auf und ab, kurz wird es ruhig, alles legt sich, wenn er könnte, auch Eduard Pospischill, am liebsten zu Hause in seine großzügige Sitzecke vor den Fernseher. Selbst der Metzger denkt mit Wehmut an seine geräumige Bundfaltenhose, sein Chesterfieldsofa und seine Plattensammlung. Gute Musik zu einem guten Glas Rotwein in einem gut belüfteten Raum zieht er jedem Maskenball inmitten transpirierender Menschen vor. Von Sich-Erheben und Nach-Hause-Gehen kann aber jetzt nicht die Rede sein. Nach Teil eins, genannt „Die Anbetung der Erde“, folgt die für klassische Konzerte übliche beifallslose Pause zwischen den einzelnen Abschnitten des Werks. Wobei die Zuhörer ohnehin gar nicht hätten klatschen können. In diesem sehnsuchtsvoll erwarteten Zeitfenster hat man zwecks abermaliger Bronchialentleerung schließlich alle Hände voll zu tun. Der Dirigent wartet geduldig, denkt beruhigt an seine private Krankenversicherung und gibt den Einsatz zu Teil zwei, lautend auf: „Das Opfer“.
Welch düstere Vorahnung den Herrn Strawinsky da auch immer gequält haben mag, das Wissen um die grausame Ereigniskette, für die seine musikalisch ausformulierte rituelle Tötung einer Jungfrau zum Zwecke der Versöhnung mit dem Frühlingsgott nun fast ein Jahrhundert später den Startschuss liefert, wird es nicht gewesen sein.
Ganz abgesehen davon: Von Frühling kann im Konzertsaal keine Rede sein, hier herrscht Hochsommer mitten im Herbst. Der Dirigent schwitzt dank der Turnübungen im Frack, die Musiker schwitzen dank des durch die Luft sausenden Taktstocks, die Zuhörer schwitzen dank der fehlenden Klimatisierung. Männer fassen sich an die Krägen, Frauen packen ihre Fächer aus, wedeln mit dem Programmheft oder ihren winzigen Handtäschchen, und schließlich durchmischt sich die reichlich parfümierte Luft mit dem aus der Abendgarderobe hervorströmenden Eigengeruch: Synchron wie am Exerzierplatz heben die Menschen ihre Arme und lüften ihre Achselhöhlen. Der Applaus ist heftig, von der Luft ganz zu schweigen, ein jubelndes Publikum feiert frenetisch sein eigenes Durchhaltevermögen. So schlecht war dem Metzger schon lange nicht mehr.
Bis zur Pause müht sich Willibald Adrian Metzger noch durch die Notenfolge der zeitgenössischen Partitur, in der Pause dann nicht ohne Folgen durch die Menschenansammlung seiner Zeitgenossen. Genau das hat er befürchtet, hier auch noch einem bekannten Gesicht über den Weg zu laufen.
„Herr Metzger, Herr Metzger, so eine Überraschung!“ Der Tabernakelschrank zwängt sich freudig winkend durch die Menge.
Dem Metzger fällt ja lange vor dem Namen seiner ehemaligen Auftraggeber das dazugehörige, von ihm auf Vordermann gebrachte Möbelstück ein. Hier muss er jedoch nicht weiter überlegen: „Frau Joachim, heute also ohne Herrn Weinstadler?“ Der Spieltisch. Für den Tabernakelschrank und den Spieltisch nämlich wirkte sich der restauratorische Eingriff auch auf deren Besitzer aus. Seit sich Ingeborg Joachim und Otto Weinstadler vor der Metzger-Werkstatt über den Weg gelaufen sind, durchlaufen die beiden auch ihren zweiten Frühling. Als Vermittlungsprovision wurde dem Willibald der Tabernakelschrank inklusive ewiger Dankbarkeit zugedacht.
„Mein Otto macht sich nichts aus klassischen Konzerten. Ich bin mit Herrn Mühlbach und seinem Neffen Albert hier. Darf ich vorstellen!“
Ein aparter älterer Herr in Begleitung eines jungen, eleganten Mannes mit ungewöhnlich naturrotem Haar tritt aus dem Hintergrund hervor.
Stolz streicht Ingeborg Joachim heraus, dass Herr Wernher Mühlbach eigentlich ein Wernher von Mühlbach, in Wahrheit sogar ein Wernher Freiherr von Mühlbach ist. Was dem Herrn Mühlbach furchtbar peinlich zu sein scheint, denn prompt erklärt er, durch diesen Freiherrn mittlerweile so wenig frei zu sein, dass er sich freiwillig den Freiherrn spare. Ein „Freiherr“ wolle im 21. Jahrhundert nämlich wirklich kaum noch jemand hören, geschweige denn würdigen. Mit der damit verknüpften Anrede „Hochwohlgeboren“ würde man sich heutzutage, vom Zeitgeist für mögliche vergangene Standesüberheblichkeiten gnadenlos abgestraft, am ehesten eine einfangen.
Zwischen dem so unverblümt ehrlichen Mühlbach und dem Metzger fliegen auf Anhieb die Funken der Sympathie. Bei der Berufsangabe seines Gegenübers ist das Strahlen in den Augen des Herrn Hochwohlgeboren dann nicht einmal mehr vom Luster über seinem geadelten Haupt zu überbieten: „Ich brauch Ihre Kontaktdaten, Herr Metzger, wir müssen uns unbedingt wiedersehen. Ein verlässlicher Restaurator mit gutem Renommee kommt mir wie gerufen!“
Also werden Kontaktdaten ausgetauscht, Höflichkeitsfloskeln gewechselt und schließlich mit den Worten „Auf Wiedersehen!“ die Hände geschüttelt.
Das mit dem Wiedersehen wird gar nicht so lange dauern, und wie gerufen käme dem Metzger jetzt dringend ein Schub sauerstoffreicher Atmosphäre. Wozu hat man Freunde: „Metzger, Mensch, da bist du ja, hab schon befürchtet, wir verlieren uns! Sag, bist du heiß auf diese zweite Hälfte, oder kann ich dich mit einem Krügerl beim Wirten bestechen?“
Wie gut das tut, dank der Ehrlichkeit eines Kulturbanausen den eigenen, schwer erarbeiteten intellektuellen Schein wahren zu können: „Na, wenn es sein muss, dann gehen wir halt!“
Und wie dann das Läuten die Menschen zurück zu ihren Plätzen zieht, zieht er bereits die große gläserne Schwingtür zu sich heran und einen rettenden Schwall Frischluft durch seine Nase, der Willibald.
Es ist einfach Zeit, sich zu verabschieden – auch für das jungfräuliche Frühlingsopfer.
3
Der Beifall zur Pause war frenetisch. Seiner nicht.
Die Menschen hören nicht hin. Vielleicht hören sie zu, aber selbst dann bekommen sie die wirklich wichtigen Feinheiten nicht mit. Sie sind taub für die Nuance, die das Gute vom Minderwertigen unterscheidet; sie registrieren schlechte Stimmung erst, wenn sie ihnen ins Gesicht springt und alles verdirbt; sie erkennen Leid erst, wenn es durchs eigene Wohnzimmer spaziert.
Nur, dann ist es zu spät.
Wie betäubt tritt er ins Freie. Ein laues Lüftchen weht ihm um die Ohren, die Musik des Himmels. Dann macht er sich auf den Weg. Blätter gleiten sanft zu Boden, bedecken den Asphalt mit einer weichen Schicht satter Farben und verhüllen das Darunter. Es ist immer der Herbst, der ihm sein Ich zurückgibt. Der Sommer verabschiedet sich, kann angewidert seine eigene Hitze, seine aufgesetzte Fröhlichkeit nicht mehr ertragen, rettet sich in feuchte Kälte und Hochnebel, schickt das lästige Geschrei der Kleinen, das schale Getöse der Großen zurück in überheizte Wohnzimmer und gewährt sich selbst endlich Stille.
Zeit der Ernte, Zeit der Reife. Auch für ihn.
Denn dieser eine Herbst wird die Ernte dessen einbringen, was er Jahr für Jahr mit viel Mühe hat reifen lassen. Geduld ist der alles entscheidende Vorteil, um tatsächlich früher anzukommen. Rechtzeitig die Weichen stellen und warten, bis der Zug kommt. Alles vorbereiten, still am Rand der Gleise sitzen, nicht hektisch aufspringen, wenn er sich nähert, träge und unpünktlich, und ihn schließlich vorbeifahren lassen bis ans Ende – direkt in den Abgrund. Heute ist sein zweites Mal.
Er studiert die Menschen, beobachtet die Abläufe, lässt sich selbst beobachten, bis er verwachsen ist mit der Umgebung, bis ihn keiner mehr wahrnimmt. Vor den Augen der anderen ein Verschwundener zu werden, obwohl man sich unübersehbar in ihrem Blickfeld befindet, ist kein Kunststück. Dafür genügt es, einfach nur da zu sein. Jede sich aufopfernde Mutter weiß das, jeder treuherzig spendable Ehemann, jedes Schattenwesen in der hintersten Reihe.
Aus dieser hintersten Reihe konnte er inmitten der Zuschauer mehr sehen, als er wollte, denn auch derjenige, mit dem er es in nächster Zeit auf höchst spannende Weise zu tun bekommen wird, war anwesend, nicht dienstlich, sondern als Privatperson. Umso besser. Umso eindringlicher wird sich der Ermittler dieser Sache annehmen. Ein letztes Mal zupft er sein Kleid zurecht, richtet seine Pölsterchen, streicht sich übers Haar.
Auch brave Jungs brauchen Auslauf.
4
Es ist dann kein Wirtshausbesuch mehr geworden. Einen weiteren mit Menschen gefüllten, schlecht gelüfteten Raum hätte der Metzger nicht mehr ertragen, was folglich ebenso die Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel oder einem Taxi ausschloss. Auch eine einsame lederne Rückbank hinter einem schon seit Stunden am Rande eines bunten Duftbaum-Mischwaldes hausenden Fahrer ist kein Garant für frische Luft. Dem Metzger blieb also nur mehr die Kraft seiner Beine.
Bis zur ersten Kreuzung hat sich der Kettenraucher Eduard Pospischill noch bemüßigt gefühlt, gierig an seiner Zigarette saugend die Abendluft zu aromatisieren und sein Rad neben dem dahinschleichenden Restaurator herzuschieben, dann wurde es der Hilfsbereitschaft des Kommissars zu blöd, immerhin hatte die eingeschlagene Richtung mit seinem eigentlichen Heimweg aber rein gar nichts zu tun, und es trennten sich ihre Wege. Zumindest im Hinblick auf seine Lunge war der Metzger heilfroh.
An und für sich ist so ein nächtlicher Stadtspaziergang im anbrechenden Altweibersommer eine beinah meditative Angelegenheit, der Ausklang des Jahres liegt in der Luft, aus den gefüllten Gastgärten klingt ein Hauch von Melancholie, und dank der doch schon herbstlichen Abendtemperaturen braucht wegen ein paar gemächlicher Schritte keiner mehr zu schwitzen. Willibald Adrian Metzger stehen trotzdem die Perlen auf der Stirn. Immer noch ist ihm übel. Jetzt, wo seine Begleitung das Weite gesucht hat, kann das endlich auch seine Hose. Leider nimmt das der Knopf, den er da so verbissen aus dem Loch zu zwängen versucht, allzu wörtlich und verschwindet nach einem kurzen Schnalzer einige Meter entfernt im Kanalgitter. Wer lange still und heimlich unter Spannung steht, explodiert eben eines Tages völlig unvermutet, das wird der Willibald demnächst noch viel deutlicher zu spüren bekommen.
Mitgerissen von dieser Revolution, vollführt auch der Reißverschluss seinen Befreiungsakt. Keine Chance mehr, das zuzukriegen, wird dem Metzger nun klar, was ohne Gürtel auch für die Hose gilt. So angenehm dies für das eingeschnürte Gedärm auch sein mag, einen ungünstigeren Platz gäbe es wohl kaum. Wie gesagt, es ist ein lauer Abend, da geht man gern zu Fuß, es sind also nicht wenige Blicke, die den ahnungslosen Willibald da zu später Stunde auf dieser rege frequentierten Straße treffen. An einer Hausmauer lehnt ein Mann mit hochgeschlagenem Kragen und telefoniert, ein Stückchen entfernt umgarnen zwei Burschen eine junge Dame, auf einer der halbkreisförmig um ein Denkmal angeordneten Sitzgelegenheiten blättert ein Mann mit Hut und Vollbart im Licht der Straßenlaternen in einer Zeitung, und am Sockel dieses Denkmals springt ein zierlicher Bursche in blauer Jeans, weißem T-Shirt und auffällig roter Wollmütze, was die Farbkombination betreffend ein wenig an die flatternde Flagge Hollands, Luxemburgs oder Paraguays erinnert, mit seinem Rollbrett auf und ab. Irgendwie ist es ein entzückender Anblick, der sich dem Metzger da bietet, denn im Vergleich zu den Proportionen des kleinen Bengels wirkt alles andere einfach viel zu groß: die am Körper schlackernde Kleidung, die Haube, unter der kinnlanges blondes Haar zum Vorschein kommt, die über die Schuhe hängenden Hosenbeine, die Schuhe selbst, denen dieses gigantische hölzerne Sportgerät völlig widerspruchslos zu gehorchen scheint, das pompöse Denkmal, die Häuser dahinter, einfach alles, auch die aufmerksamen Augen im Gesicht des strahlenden Kindes. In Anbetracht dieses goldigen Engels, der ihn nun anblickt, ist er natürlich gleich ein wenig gerührt, der Willibald. Das war ihm in seinem Leben bisher nicht vergönnt: im Glauben, einen Schritt voraus, und im Wissen, immer einen Schritt hinterher zu sein, dem Heranwachsen eines Menschenjungen beiwohnen zu dürfen. Nur am Spielplatz gegenüber seiner Werkstatt ist er oft ungesehener Gast, wenn er hinter dem Fenster seines Gewölbekellers stehend mit dem schmerzhaften Wissen hinüberschaut, wahrscheinlich für den Rest seiner Tage den Kindern nur beim Schaukeln zusehen anstatt ihnen den nötigen Schubser geben zu dürfen. So unfassbar schnell geht alles vorbei.
Unfassbar schnell ist auch der Junge, und das in mehrfacher Hinsicht. Gekonnt bewegt er seinen fahrbaren Untersatz nun mit leichten, fließenden Bewegungen auf den Metzger zu, der mit der einen Hand seinen Hosenbund und in der anderen zusammengerollt sein Jackett hält. Natürlich könnte es als hilfsbereites Anliegen ausgelegt werden, wenn einem so ein reizender Knabe unter die Arme greift. In diesem Fall aber kann von Hilfe nur hinsichtlich der Entfaltungsmöglichkeit des Willibald beziehungsweise des Sakkos die Rede sein, denn nach einem kurzen Ruck hat er wenigstens eine seiner beiden Hände frei. Wer denkt auch in einer ohnedies garstigen Situation noch zusätzlich daran, auf der Hut sein zu müssen. Obwohl, ein Hut ist das schon, sogar ein alter, dass die Not des einen den Reichtum des anderen bedeutet.
Völlig paralysiert blickt Willibald Adrian Metzger dem Geratter hinterher. Hurtig sucht eine Gummisohle Halt auf dem Asphalt und bewegt das Skateboard, samt Sakko und einem Stückchen Erinnerung, in Richtung Nimmerwiedersehen. Das gilt nun ebenso für alle Anwesenden, die geschlossen auf das Verbrechen reagieren: So schnell kann der Metzger gar nicht um Hilfe rufen, ist er schon allein auf weiter Flur, hält sich handlungsunfähig mehr an der Hose fest, als er sie festhält, und überlegt, was denn da so alles in seinem flüchtigen Sakko war. Lang dauert sie nicht, seine Grübelei, dann nimmt er zusätzlich zur Beinbekleidung auch gleich die Beine in die Hand: „Ein besticktes weißes Stofftaschentuch, die Brieftasche und der Wohnungsschlüssel – der kann in meine Wohnung!“, geht es ihm panisch durch den Kopf. Da spürt man jedes Gramm Übergewicht, und weil beim Metzger diesbezüglich ein ansehnliches Sümmchen zusammenkommt, wechseln sich Laufen, schnelles Gehen und kurze Stopps ab. So geht es heimwärts, vorbei an den mit Münzeinwurf aktivierbaren Stadträdern, vorbei an seinem ehemaligen Gymnasium und somit auch vorbei an der Wohnung seiner Herzdame.
Im Erdgeschoss dieser pädagogischen Anstalt bewohnt Danjela Djurkovic ein kleines Apartment. Respektvoll ist die Beziehung zwischen der Schulwartin und dem Restaurator, was bedeutet: Die Djurkovic weiß, wie sehr ihr Willibald in gehaltvollen Happen seinen ureigenen, eingefleischten Einzelgängertrott braucht, und bevor sie ihn zu sehr belagert, lässt sie ihm diesen kleinen Imbiss. Während der Woche also drängt sie sich nicht auf, mit der Konsequenz, dass sich die Beziehung der beiden vermehrt auf die Wochenenden und somit in die vier Wände des Restaurators verlagert hat. Und sie ist alles andere als zufrieden mit ihrer Gesamtsituation, die Danjela, auch der beiden Wohnungen wegen. Wozu um Himmels willen müssen zwei ausgewachsene Menschenkinder innerhalb desselben Grätzels zwei eigene Haushalte führen, wenn sie doch längst ohne jeden Zweifel wissen, dass sie die beiden einzigen ineinanderpassenden Steine eines zweiteiligen Puzzles sind. Einfach absurd ist das. Nur, eine derartige Widersinnigkeit muss ein Mannsbild schon ganz allein erkennen. Auffällig gesetzte Wegweiser in Richtung eines gemeinsamen Haushalts können nämlich ganz schnell um einhundertachtzig Grad umschwenken. Maximal vereinzelt gesetzte, ganz dezente Lockrufe sind da gestattet.
Was solche sanften Töne betrifft, herrscht an diesem Wochenende jedoch Funkstille. Denn natürlich sind die Renovierungsarbeiten im Stiegenhaus nicht wie vorgesehen zu Schulbeginn fertig geworden. Und natürlich ist es Danjela Djurkovic, die nun Wochenende für Wochenende als Schulwartin dieses humanistischen Gymnasiums mit allem, nur nicht mit Humanismus zu rechnen hat. Was da von den Arbeitern an Dreck fabriziert und liegen gelassen wird, gleicht einer verspäteten Abrechnung mit der eigenen Schulzeit.
So liegt sie also nach getanem Tagewerk erschöpft mit ihrem Hündchen Edgar auf ihrer viel zu weichen Matratze, als gegenüber ihres Fensters jenes Lebewesen vorbeiläuft, das in dieser Wohnung ohne Voranmeldung jederzeit willkommen wäre, selbst mitten in der Nacht.
Beim Metzger hat sich mittlerweile die Stimme der Vernunft gemeldet. „Was gibt es bei mir in der Wohnung für so einen Fratzen schon zu holen! Außerdem könnt ich selbst mit einer Münze und einem der Radeln den Kerl auf seinem Brettel nicht mehr einholen!“ Da hat er natürlich recht, der Willibald, auch ohne zu wissen, dass das kecke Bürscherl gleich noch gewaltig an Geschwindigkeit zulegen wird.
5
Mit seinen immerwährend etwas traurigen und müden Augen steht der Hausmeister Petar Wollnar, Besitzer einer der beiden Reserveschlüssel zu Willibalds Domizil, nun im Vorzimmer seines einzigen Freundes und lauscht aufmerksam den besorgten Worten: „Es ist schrecklich, Petar. Alles weg! Geldbörse samt Jahresnetzkarte, Haus- und Wohnungsschlüssel, es ist die blanke Katastrophe! Was um Himmels willen soll ich tun!“
„Durchatmen!“ Ein gutherziger Blick versucht jene beruhigende Wirkung zu erzielen, die der Hausmeister aufgrund seiner Wortkargheit verbal nie zu vermitteln imstande wäre. Dann erklärt er stichwortartig die weitere Vorgehensweise: „Schloss wechseln, dann Anzeige erstatten!“
Schlüsseldienst wird keiner benötigt, weil eines Abends einer der bis dahin üblichen Begegnungen im Stiegenhaus eine spontane Weinverkostung oben in der Restauratorenwohnung folgte, dann ein zwecks unfallfreier Bewältigung innig umschlungener Abstieg hinunter ins ebenerdige Hausmeisterdomizil und, dort angelangt, schließlich ein ausgiebiges Restelessen. Restelessen im wahrsten Sinn des Wortes, denn die beiden Herren waren dazumal genau das, was man als Übriggebliebene bezeichnet. Naheliegend, dass schon kurz nach dieser ersten gemeinsamen, vornübergebeugt am Küchentisch verschlafenen Nacht nicht nur Sorgen, sondern auch Wohnungsschlüssel ausgetauscht wurden.
Somit erspart sich der Metzger also den Aufsperrdienst, einen Schlosswechsel erspart er sich aber nicht. Und weil zugezogene Volksgruppen innerhalb ihres neuen Heimatlandes nicht nur besser vernetzt sind als dessen Ureinwohner, sondern sich in Notfällen auch tatsächlich aufeinander verlassen können, weiß Petar Wollnar, wer anzurufen ist: Pawel Zieliński. Das Telefonat ist sehr kurz, da Pawel Zieliński am Wochenende in seiner Heimat statt passiver Roaminggebühren doch lieber aktiv und gebührend seine eigenen vier Wände ausbaut.
„Schlosswechsel Montag früh“, schließt Petar Wollnar das Gespräch. Als würde ein Schlosswechsel jemanden, der uneingeladen in eine Wohnung will, tatsächlich von einer Visite abhalten können.
„Gut, dann kann auch die Anzeige warten!“, erwidert der Metzger in Vorfreude auf sein Schlafgemach.
Von Nachtruhe kann allerdings nicht die Rede sein. Unruhig wälzt er sich im Bett herum, schleicht aufgewühlt zur Toilette, sieht sie da bereits liegen, und am Retourweg greift er zu. Richtiggehend auffordernd, mit sorgfältig abgestreifter Hülle wartet sie auf seinem Chesterfieldsofa im Wohnzimmer, die aktuelle Lektüre seiner Herzdame. Er liest wirklich gern, der Willibald, bevorzugt Biografien und Fachliteratur, ein derartiger Schund käme ihm für gewöhnlich aber niemals in seine Mansardenwohnung, außer ein Kasten steht schief.
„Ist Ratgeber auch gute Unterlage für Leben! Dreht sich um Perspektive, wirst du noch machen Augen!“, hat ihm seine Danjela allerdings erklärt. Seit sie dieses Werk studiert, macht er die Augen auch wirklich, denn wenn die Djurkovic neben ihm am Sofa sitzt, ist er seit Neuestem immer mit dabei: der Ratgeber mit dem Titel „Der Schlüssel zum Glück“. Und genau dieser Schlüssel liegt nun in seinen Händen.
So dick, wie der ist, muss das wohl ein ganzer Schlüsselbund sein, geht es ihm durch den Kopf. Wenn man dann allerdings die Flut derartiger Regelwerke der Anzahl grantig durch die Gegend marschierender Erdenbürger gegenüberstellt, fragt man sich schon: Wo sind sie alle, die glücklichen Menschen?
Müde hockt er sich im Pyjama in sein Chesterfieldsofa, öffnet einen Zweigelt Mitterjoch, schlägt den Ratgeber auf und liest. Und dann wird es spät.
„Guten Morgen, Metzger!“
„Pospischill?“
So aus dem Schlaf gerissen, hatte die hastige Überwindung der Distanz zwischen Chesterfieldsofa im Wohn- und Festnetzanschluss im Vorzimmer beinah ein ausgefülltes Aufnahmeformular in der Unfallambulanz zur Folge.
„Pospischill, ich fass es nicht! Es ist Sonntag, sechs Uhr! Hast du kein Privatleben?“
„Na wunderbar, das fragt mich die Trixi auch immer!“
„Es sind allein die Fragen, die uns die Antworten liefern.“
Es sind die gierig zum Rotwein konsumierten einhundertdreiundzwanzig Seiten, die ihm gestern Abend oder eigentlich heute Nacht zum Verhängnis wurden.
„Sag, Metzger, schläfst du gerade wieder ein, kämpfst du mit Restalkohol, oder geht’s dir nicht gut?“
„Stimmt alles, wobei Letzteres ausschließlich an dir liegt! Außerdem wundert es mich überhaupt nicht, wenn deine Ehefrau, was dein Privatleben angeht, mit mir einer Meinung ist! Du hast keines, oder?“
Trixi Matuschek-Pospischill wäre nach ihrer Eheschließung und der in späterer Folge damit verbundenen Arbeitsniederlegung als Kellnerin gewiss gern verliebt mit ihrem angetrauten Eduard in der eigenen Jacht um die Welt gesegelt oder Wochenende für Wochenende in ihr Landhaus an den See gefahren. In Ermangelung des Schiffleins und des Zweitwohnsitzes musste sie sich allerdings damit zufriedengeben, einmal die Woche gemeinsam mit ihrem Gatten die Tanzschule zu besuchen. Das mit der Tanzschule funktionierte recht gut, das mit dem Sichzufriedengeben weniger, was keineswegs nur am fehlenden Reichtum lag. Und weil sich dieser unerquickliche Zustand so hartnäckig hält wie ein sich selbst mehrfach zum italienischen Ministerpräsidenten ernennender Mafioso, legt der Kommissar in letzter Zeit einen ganz besonderen Diensteifer an den Tag – und der hat ja bekanntlich vierundzwanzig Stunden. Vierundzwanzig Stunden, von denen Willibald Adrian Metzger am Wochenende für gewöhnlich mehr als fünf im Bett verbringt.
„Was quälst du mich, so zeitig in der Früh? Ich bekomm hier im Vorzimmer schon langsam kalte Füße!“
„Kalt ist gut: Metzger, stell dir vor, es gibt eine Leiche!“
„Verzeih, wenn mich diese Mitteilung aus dem Mund eines Kriminalbeamten nicht unbedingt überrascht.“
„Jetzt sei nicht so ein Grantler. Es ist natürlich eine Leiche, die du kennst.“
Zu lange dauert dem Restaurator die eingelegte Gesprächspause: „Muss ich jetzt raten? Ich kann mir wirklich eine bessere Unterhaltung vorstellen! Also: Was heißt, ich kenn ihn?“
„Wer sagt ihn? Sie. Die Schlagzeugerin haben wir gefunden! Du weißt schon: bumbumm!“, tönt es vergnügt durch die Leitung.
„Pospischill, ich nehme an, du meinst Pauke, und zum Lachen ist mir jetzt wirklich nicht. Was bitte ist an einer toten Musikerin so unterhaltsam?“
„Tot ist gut! Galina Schukowa ist nicht einfach so verstorben, sie wurde ermordet. Kehle durchgeschnitten, nicht weit entfernt vom Veranstaltungsort in einer stillen Sackgasse. Gefunden haben wir sie in einer Mülltonne! Hat fürchterlich ausgesehen. Es gibt Leichen, denen sich der Todeskampf so ins Gesicht brennt, als wollten sie ihre Nachwelt zur Vorsicht mahnen. Das vergisst du nicht, von so was träumst du. Glaub mir, da hilft nur noch ein wenig Humor, sonst erträgt man das nicht!“
„Und um mich an deinen Heiterkeiten teilhaben zu lassen, rufst du an, sonntags, um sechs Uhr morgens, nach einer höchst unerfreulichen Nacht?“
Es folgt eine Kurzzusammenfassung der Ereignisse, nach deren Schilderung Pospischill noch die Frage stellt: „Hast du schon Anzeige erstattet? Im Hinblick auf etwaige Versicherungszahlungen ist das wichtig.“
„Die mach ich heute – so wie jetzt den Kaffee, denn Schlafen kann ich ja wohl vergessen.“
„Kaffee? Fein. Mach zwei.“
6
Um den Pospischill ins eigene Wohnzimmer zu bekommen, muss man keine Einladung aussprechen, der kommt ganz von allein. Da spielt es dann auch keine Rolle, wenn eine betroffene Person, so wie im Augenblick der Metzger, Lichtjahre davon entfernt ist, überhaupt an das mögliche Aussprechen einer solchen Einladung zu denken.
Während der Restaurator also noch etwas orientierungslos im Vorzimmer herumsteht, klopft es bereits an der Tür.
„Ja, Metzger, man lernt nie aus: Ich hab gar nicht gewusst, dass der Stoff, aus dem normalerweise Geschirrtücher oder Schnäuzfetzen fabriziert werden, auch für Pyjamas herhalten muss!“
„Pospischill, du Quälgeist. Sag, hast du vorhin aus dem Stiegenhaus angerufen, ich hab ja noch beinah den Hörer in der Hand!“ Nach einem tiefen Atemzug fährt er fort: „Na, wenigstens weißt du, wo die Küche ist! Und mach den Kaffee nicht zu stark.“
Genervt schlappt der Restaurator ins Badezimmer, und wie er nicht unbedingt aufgeweckter aus diesem zurückkehrt, liegen zwei Kornspitz und zwei herrlich duftende Butterkipferl am bemüht gedeckten Küchentisch. Dann erfährt Eduard Pospischill, was sich sein Gastgeber in Anbetracht des frischen Backwerks so denkt:
„Du hast also vorhin am Telefon bereits gewusst, wo du heute Morgen kurz nach sechs Uhr frühstücken wirst?“
Er hat noch viel mehr gewusst, der Pospischill, und dass er auf diese Frage absolut nicht eingeht, verspricht nichts Gutes. „Du Pechvogel, wirst du also ausgeraubt! Nun denn, leg los, ich schreib mit!“
Willibald Adrian Metzger erzählt, während der Kommissar auf seinem Block notiert und schließlich erklärt: „Der Rotzbub wollte garantiert nichts anderes als dein Bargeld, hier liegt also sicher kein organisiertes Verbrechen vor, und keiner will in deine Wohnung, außerdem bin ja jetzt ich da!“ Und mit Dasein meint Eduard Pospischill mehr, als dem Metzger lieb ist.
„Außerdem: Solche Kleinganoven gibt es heutzutage wie Sand am Meer, die finden wir ganz selten. Also: Um zwei Uhr ist die Leiche von einem Obdachlosen in einer Mülltonne gefunden worden, mit durchgeschnittener Kehle und Trommelschlägeln in ihren Händen. So ein hübsches Mäderl war das!“
„Wieso Mäderl?“
„Weil sie trotz ihrer achtundzwanzig Jahre ausgesehen hat wie eine Sechzehnjährige!“
„Schrecklich!“
Es folgen ein paar schweigsame Sekunden. Beinah synchron tauchen die beiden Herren ihre Butterkipferl in den Kaffee, dann meint der Metzger: „Und? Wie geht es jetzt weiter?“
„Zuerst wird der Tatort durchgeackert, dann der Gerichtsmediziner beliefert und nach möglichen Zeugen gesucht. Wenn du willst, nehm ich dich einmal mit auf einen Tatort, das ist interessant.“
„Machst du jetzt Witze oder ein Reisebüro auf? Außerdem hast du mich falsch verstanden: Bei aller Freundschaft, aber wie lang hast du noch vor, bei mir herumzuhocken, oder anders gefragt: Warum bist du überhaupt hier, am Sonntag um diese Uhrzeit, mit frischer Backware? Du willst doch etwas von mir! Darfst du nicht nach Hause?“
Langsam senkt Eduard Pospischill den Kopf. Und obwohl der Kommissar selten um spitzzüngige Antworten verlegen ist, steht ihm jetzt nicht gerade der Schalk ins Gesicht geschrieben. Das hat der Metzger natürlich nicht erwartet, dass er mit seinem lapidaren Sätzchen so einwandfrei ins Schwarze trifft.
„Es is grad etwas schwierig!“, erhält er als auffällig zurückhaltende Antwort.
„Was heißt ‚es‘?“
„Na, sie, die Trixi. Wir mustern zurzeit ein wenig aus!“
„Pospischill, du sprichst in Rätseln. Warum ist Ausmustern schwierig?“
Deutlich energisch folgt die Erklärung: „Zwischen uns fliegen gerade die Fetzen, verstehst du’s jetzt?“
Jetzt ist es also heraus. Und auch die weitere Erklärung lässt nicht lange auf sich warten: „Das ist immer dasselbe, wenn sie auch nur in die Nähe ihrer Tage kommt, ist sie ein wandelnder Sprengsatz. Wir haben nun mal keine Kinder, ich bin Alleinverdiener, meine Frau hat doch Zeit, oder? Verlangt ja keiner von ihr, dass sie den Haushalt führt, aber wenn ich sie schon durchfüttern muss, kann ich doch erwarten, dass sie nicht nur auf meinem Konto, sondern auch die Wohnung aufräumt. Ein Saustall ist das bei uns, da kommst du nicht bei der Tür hinein, vom leeren Kühlschrank will ich gar nicht erst reden. Gestern hab ich es gewagt, in unserer momentan ohnedies heiklen Situation einen dezenten Einspruch zu erheben. Und was ist passiert? Aus der eigenen Wohnung bin ich geflogen. Und wer hat dann auf mich gewartet? Eine Leich. So schaut’s aus, mein Leben. Traurig, oder? Apropos Trommel: Sag, könnt ich schnell bei dir meine Hose in die Waschmaschine schmeißen und vielleicht kurz duschen?“
Und wie dann ein für die so traurige Lebenssituation doch vergnügtes Pfeifen aus dem Badezimmer durch die Wohnung dröhnt, schleicht sich beim Metzger der Verdacht ein, es könnte noch schlimmer kommen. Und recht hat er. Das betrifft allerdings nicht den ausgemergelten Körper des Kettenrauchers Eduard Pospischill, der sich wenig später, nur umschlungen von einem Handtuch, triefend durchs Wohnzimmer bewegt, sondern die Antwort auf die Frage: „Und wo wohnst du jetzt?“
„Wohnen tu ich untertags ja eigentlich eh schon im Kommissariat. Ich bräuchte nur noch ein Bett zum Schlafen. Maximal für ein paar Nächte. Was denkst du, Willibald, glaubst du, dein Chesterfieldsofa hält mich ein Weilchen aus?“
„Das Sofa schon!“
Eduard Pospischill kramt eine Zahnbürste aus seiner Umhängetasche hervor, verschwindet wieder ins Bad, und auch beim Metzger verschwindet der letzte Funken an Zurückhaltung: „Ja, gibt’s das! Die Zahnbürste hast du also auch schon dabei! Ich bin kein Asylheim für vor die Tür gesetzte Ehemänner – die an ihrer Ausweisung übrigens zumeist gar nicht so unschuldig sind. Ich will mich ja nur ungern einmischen, aber bekanntlich hast du der Trixi versprochen, dir das mit einem Kind zu überlegen, und ihr angeraten, mit dem Kellnern aufzuhören. Das ist, soviel mir aus diversen Schilderungen bekannt ist, mittlerweile einige Jährchen her, oder?“
„Verdammt, Metzger, ich bin über vierzig. Das Kind wird zu mir Opa sagen, lange bevor ich auch nur theoretisch wirklich Großvater werden könnte!“
Richtig in Rage kommt er jetzt, der Willibald: „Dann stell nicht solche Versprechungen in den Raum. Nur zur Information: Die Trixi hat auch bald den Vierer vorne stehen. Da ist es selbst für den größten Idioten nachzuvollziehen, dass eine Frau in der Nähe ihrer Tage zum, wie du sagst, wandelnden Sprengsatz wird.“
„Bravo, Metzger, bravo. Ein toller Freund bist du!“
„So ein toller Freund will ich gar nicht sein, wie du ihn gerne hättest! Des Weiteren weigere ich mich, als Unterkunftsgeber für dich Partei zu ergreifen, also ruf deine Frau an.“
„Wie bitte? Es ist kurz vor sieben, bin ich verrückt, da weck ich doch meine Frau nicht auf!“
Der Metzger traut seinen Ohren nicht: „Schad, dass wir nicht verheiratet sind, dann läge ich jetzt wahrscheinlich noch gemütlich im Bett. Wenn du auch nur eine Minimalchance auf dieses Sofa hier haben willst, ruf gefälligst an, begrüß sie höflich, und gib mir den Hörer!“
So leise hat der Metzger den Pospischill noch nie reden gehört, dann wird ihm das Telefon überreicht: „Hallo, Trixi, glaub mir, ich weiß, es ist früh, aber dein Mann will mein Sofa besetzen, was mir wirklich äußerst unrecht ist!“
Nervös geht der Kommissar im Zimmer auf und ab, während Willibald Adrian Metzger seine ganze Aufmerksamkeit dem ergiebigen Monolog auf der anderen Seite schenkt. Schließlich kommt auch er wieder zu Wort: „Also gut, ausnahmsweise! Wenn du momentan den Abstand brauchst, lass ich eben einem kleinen Spinner in seiner selbst verursachten Obdachlosigkeit ein Winkerl zukommen – aber bitte für einen überschaubaren Zeitraum. Seid so gut und bringt eure Angelegenheit ins Reine, was auch heißt: Wenn dein Göttergatte frische Wäsche braucht oder irgendetwas anderes, lass ihn rein, denn sein Hygieneservice und seine Jausenstation bin ich nicht!“
Zum Pospischill gewandt, setzt er fort: „Und du zieh deine Hosen an, gewaschen wird bei mir erst, wenn ich eine Maschine voll hab. Schlüssel bekommst du keinen, Straßenschuhe kommen nicht weiter als bis ins Vorzimmer, wenn du hier bist, wird nicht herumgeschnüffelt, es wird kein einziges Kleidungsstück irgendwo anders liegen gelassen als im Kleiderschrank oder Schmutzwäschekorb, nicht einmal ein Solosocken, die Schlafzimmertür bleibt zu, da drinnen hast du nichts verloren, am Häusel wird immer gesessen, und auch diese Tür steht nie offen, kapiert, geraucht wird am Gang, keine Barthaare im Waschbecken, keine Überschwemmung nach der Dusche, wenn du nicht drauf schläfst, ist das Sofa picobello leer geräumt, die Bettwäsche kommt in die Kommode, du benutzt niemals das Festnetz, schon gar nicht dienstlich, wenn mich die Danjela besucht, bist du weg, wenn sie hier übernachtet, bist du weg, wenn ich außer Haus geh, bist du weg. Du bist eigentlich gar nicht da!“
„Muss ich salutieren, wenn du an mir vorbeigehst?“
„Die Grundstellung reicht.“
„Danke für den Internatsplatz!“
„Für Schwererziehbare!“, vervollständigt der Metzger, verschwindet am WC und weiß dabei natürlich nicht, wie froh er am Ende noch sein wird, mit Eduard Pospischill sozusagen unter einem Dach gewohnt zu haben.
„Natürlich kannst du heute ohne Schlosswechsel außer Haus, oder glaubst du, der Junge liegt mit Feldstecher gegenüber unter dem Dachbalken und wartet, bis er endlich in die Wohnung kann, um deinen alten Teppich zu klauen? Gibt ja eh nichts zu holen hier, keinen Fernseher, keine Stereoanlage, nicht einmal ein Radiowecker, traurig ist das.“
So dauert es nicht lange, bis die beiden Männer an diesem frühen Morgen aus jeweils dienstlichen Gründen die Wohnung verlassen. Früher, in der Lebensepoche ohne seine Danjela, verbrachte er die Sonntage ohnedies regelmäßig im heimeligen Gewölbekeller seiner Restauratorenwerkstatt. Wenn aber eines Tages ein Traum wahr wird und sich durch ein derartiges Prachtweib der Stau unerfüllter Sehnsüchte auflöst, staut es sich zwangsweise an anderen Stellen, das ist ein ehernes Gesetz. So weiß sich der Metzger nun also zu beschäftigen, obwohl das helle Geklingel der Glocke über seiner Eingangstür derzeit bedenklich selten ertönt. Kleinteile werden geordnet, Arbeitsgeräte gepflegt, die Arbeitsmaterialien auf ihren Bestand geprüft und eine Einkaufsliste erstellt. Richtig entspannen kann es hier, sein Hirn. Dann klingelt das Telefon.
„Ja, Metzger hier!“ Stille. Wobei es in diesem Fall zwei Sorten von Stille gibt:
– Die Stille, bei der die Verbindung hörbar in einem geräuschlosen, dumpfen, von einem gelegentlichen Knacken unterbrochenen Irgendwo gelandet ist. Der Metzger nennt das immer: „Anruf bei Gott“ und beginnt allen ihm nahestehenden Verstorbenen, vorrangig seiner Mutter, herzliche Grüße auszurichten.
– Und die Stille, bei der die Verbindung hörbar wie gewünscht hergestellt wurde, sich der Anrufer aber so anstellt, als wäre ihm in letzter Sekunde vor der bevorstehenden Liebeserklärung an die heiß verehrte Deutschlehrerin, der längst fälligen Morddrohung an den Vermögensberater oder der notwendigen Entschuldigung bei einem gekränkten Herzen ein kleines Angsttröpferl ins Höschen gegangen.
Und weil der Metzger unheimlicherweise weitaus öfter seiner Mutter auf diesem Weg liebe Grüße ausrichten kann, als so einem fremden Schnaufen zu lauschen, ist er nun entsprechend unsicher: „Ja, hallo? Ich kann Sie hören. Was kann ich für Sie tun?“
Gleichmäßig wird weitergeatmet.
„Hören Sie mich denn nicht? Hallo! – Wissen Sie was, ich bin noch ein Weilchen hier, wenn Sie es sich überlegen und doch eine Auskunft brauchen, rufen Sie einfach noch einmal an! Ja?“
Und da hat er jetzt mehr gesagt, als ihm lieb ist, denn die gewünschte Auskunft hat er nun bekommen, der Anrufer.
Das setzt sich auch beim nächsten Telefongespräch fort, mit dem Unterschied, dass seine Danjela im Anschluss an das ihr Erzählte bedeutend wortreicher aus dem Hörer heraustönt: „Bist du geritten von Teufel? Pospischill auf Chesterfieldsofa, meine geliebte Chesterfieldsofa! Und wie lange darf meine Willibald jetzt spielen Kindermädchen von Polizistenjunge?“
„Maximal ein paar Tage, und wenn du bei mir bist, schmeiß ich ihn raus. Du wirst von ihm also nichts merken!“
„Ist keine Problem mit illegale Einwanderer. Bin ich ja eh in Schule, werd ich sowieso nix verbringen können Sonntag neben meine Willibald auf meine Chesterfieldsofa!“ Reden und Denken ist eben nicht dasselbe, denn logisch, dass sich in den Gehirnwindungen der Danjela zusätzlich zu einem: „Bist du einfach bei mir, dann werd ich auch nix merken von Pospischill!“ ein Funken Hoffnung hinsichtlich gewisser Umzugsambitionen einstellt, und dieser Gedanke kommt ihr nicht zum ersten Mal.
Nur kann das ganz gewaltig nach hinten losgehen, wenn man vor lauter Anstand nicht ausspricht, was längst ansteht.
7
Tausendfach war es nur ein Film in seinem Kopf, eine Bewegung vor dem Spiegel, geprägt von den Fragen: Wie fühlt es sich tatsächlich an, wird es wie geplant zügig und lautlos gehen, reichen die Kräfte, die Nerven, ist es überhaupt zu ertragen? Und es ist zu ertragen, beinah ein ehrwürdiger Akt, es geht zügig, und es ist einfach. Erschreckend einfach.
So viel Mühe hatte er auf sich genommen, um so weit zu kommen, und so unglaublich schnell war alles vorbei. Nein, es gibt nichts zu bereuen, die Banalität des Mordens nimmt ihm den letzten Funken Zweifel. Zu glauben, man müsse dazu das Gewissen ausblenden, ist der zweite große Irrtum der Menschheit nach dem ersten: der Annahme, es existiere so etwas wie ein Gewissen an sich.
Was für ein grenzenloser Schwachsinn, ja, was für ein Hochmut, davon auszugehen, es sei gerade dem Ungetüm Mensch eine innere Stimme angeboren, gewissermaßen ein Einflüstern Gottes, das über das persönliche Urteilsvermögen hinausgeht.
Das Empfinden von Richtig und Falsch ist nichts weiter als eine Anpassung an jene gesellschaftlichen Denk- und Gefühlsmuster, die innerhalb eines geschlossenen Systems Gültigkeit haben, eine Verinnerlichung vereinbarter Spielregeln, und der Mensch die simple Spielfigur am Schachbrett des Geschehens. Man muss sich nur bedienen. Die Partie ist eröffnet.
Wenn er am Ziel ist, werden sich ganze Generationen damit abmühen, ihren Familiennamen aus dem Gedächtnis dieser Welt zu streichen. Nur das ist die gebührende Strafe, der Tod allein ist es nicht.
Alles war, wie schon beim ersten Mal, nach Plan verlaufen. Bis auf eine Kleinigkeit.
Außerhalb des Lichteinfalls der Straßenbeleuchtung war er an die Hausmauer gelehnt stehen geblieben. Das Orchester spielte nicht mehr, lärmend strömten die Menschen an ihm vorbei und zerstörten die Stille.
Schließlich trat auch sie ins Freie. Wie ein Spaziergänger war er ihr gefolgt, ohne bemerkt zu werden. Nur wer sich bemüht unauffällig gibt, fällt auf. Die Menschen haben kein Auge für das Gewöhnliche. Wie zufällig war er neben sie getreten, hatte sie höflich angesprochen.
„Wir kennen uns doch!“, hatte sie vermutet.
Ja, das sagen viele, und genau das ist seine Stärke: zu gewöhnlich zu sein, um aufzufallen, und, endlich bemerkt, so viel Vertrautheit auszustrahlen, als sei er immer schon da gewesen. „Nein, wir kennen uns nicht, aber es fühlt sich so an, da haben Sie recht!“, war seine Antwort. So leicht ist der Mensch zu gewinnen mit ein bisschen Freundlichkeit. Gemütlich sind sie dahingeschlendert.
Schön sah sie aus, nur Schönheit allein ist zu wenig. Vor Leistung und Talent hat er Respekt. Sie jedoch war einfach zu schlecht, zu ungenau, völlig fehl am Platz in diesen Reihen. Fehler sind menschlich, Verfehlungen nicht. Sie beruhen auf einer Ereigniskette kleiner Verstöße, die jedes Mal die Möglichkeit zur Umkehr böten. Wer auf Dauer nicht einlenken will, muss in sein Schicksal laufen. So wie sie und so wie diese nicht nach Plan verlaufene Kleinigkeit: der Zaungast.
Außerplanmäßige Begegnungen, Zufälle, Pannen können ihn nicht beunruhigen, nicht aus der Bahn werfen. Damit ist zu rechnen, damit wird er umgehen, je nach Lust und Laune, denn egal, was passiert, er wird allem stets einen Schritt voraus sein. Keiner wird ihn jemals finden. Niemals.
Akribisch ordnet er seine Garderobe, streift sein Alltagsgewand über und macht sich auf den Weg, denn jetzt ruft sie, die Pflicht.
8
Mittlerweile kommt es Eduard Pospischill so vor, als verfüge Gerhard Kogler, der letzte Nacht am Tatort einmal mehr die Streichhölzer zwischen den Fingern gehalten hat, über magische Kräfte. Er als Vorgesetzter seiner Truppe zieht regelmäßig den Kürzeren und somit das Los des schwarzen Boten. So auch in diesem Fall: Zusammen mit Irene Moritz steht der Kommissar an diesem Morgen mit einer Schreckensmeldung vor dem Leben anderer.
Nichts ist furchtbarer, als Eltern ein allerletztes Mal von ihren Kindern erzählen zu müssen. Zögerlich öffnet sich die Tür der Familie Schukow, die von nun an dazu verdammt ist, für den Rest ihrer Tage nur noch eine Frau und ein Herr Schukow sein zu müssen. Es folgt ein Zusammenbruch mehr, an dem Eduard Pospischill teilhaben muss, eine Schilderung des Unfassbaren mehr, die er über die Lippen zu bringen hat, eine gefühlte Ewigkeit des Schweigens mehr, die er aufgrund der fehlenden Worte des Trostes nicht beenden kann. Jeden, der in einem derartigen Fall Selbstjustiz übt, kann er verstehen.
Eduard Pospischill klammert sich am Türrahmen fest. Schmerzhaft vermisst er seine Trixi, denn genau jetzt wäre es so leicht zu erklären, warum er sich nichts sehnlicher wünscht als eigene Kinder – und doch keine will. Es ist nichts als die blanke Angst, weil all das Böse, das Grauen und Verderben, dem er tagtäglich ins Gesicht zu blicken hat, eines Tages völlig ungefragt vor seiner Tür stehen könnte.
Was den Metzger an diesem Abend ungefragt vor der Tür erwartet, ist zwar bei Weitem harmloser, ein höchst ungutes Gefühl löst es bei ihm aber dennoch aus. Da hat er noch die letzten paar Stufen hinauf zu seiner Mansardenwohnung vor sich, lacht es ihm bereits entgegen, das unerwartete Begrüßungskomitee. Gut, dass er sich aus Konditionsmangel bereits am Stiegengeländer festhält, denn was da fein säuberlich zusammengelegt am Fußabstreifer wartet, lässt ihm vor Überraschung die Knie weich werden: das Sakko des väterlichen Hochzeitsanzugs.
Darauf gebettet die beängstigende Dreifaltigkeit aus Stofftaschentuch, Geldbörse und Schlüsselbund. Nichts angreifen, geht es dem Metzger sofort durch den Kopf, dann schließen sich gezwungenermaßen ein paar fragwürdige Gedanken an: Warum bringt ein Räuber seine Beute zurück, wo liegt da der Sinn? Wer sagt, dass, nur weil das Sakko vor der Tür liegt, der Überbringer nicht auch in der Wohnung war?
Mit hellwachen Sinnen öffnet der Metzger die Eingangstür, vorsichtig schleicht er durch seine Räume und fühlt sich wie dazumal als kleiner Junge, wenn ihm die obligate frei erfundene Einschlafgeschichte nicht von seiner Mutter, sondern ausnahmsweise von seinem Vater erzählt wurde. Kaum war die Stimme des Erzeugers verklungen und die Tür des Kinderzimmers geschlossen, konnte von Schlafen nicht mehr die Rede sein. Ohne genehmigten Asylantrag waren sie plötzlich alle da, die Dämonen im Kleiderschrank. Dass Buben zwecks friedlichen Hineingleitens in eine gute Nacht nicht wie Mädchen von liebevollen Feen und schrulligen Kobolden, sondern von blutrünstigen Monstern und barbarischen Helden erzählt bekommen wollen, ist genau auf demselben Mist gewachsen, auf dem sich die dazu passenden Verbrechen der Spielzeugindustrie einzufinden hätten.
Ähnlich wie einst im Kinderbettchen steht ihm auch jetzt der Schweiß auf der Stirn, dem Willibald, und schuld daran ist in gewisser Weise wieder der Mist, wenn auch nicht seiner. Da war wer am Klo, er könnte wetten. Es liegt zwar jeder Gegenstand an seiner Stelle, es wurde nicht herumgekramt, nichts durchwühlt und wahrscheinlich nichts gestohlen, trotzdem drängt sich dem heimkehrenden Restaurator eine quälende Frage auf: Ich mach doch genauso wie die Schlafzimmertür immer auch die Klotür zu, warum stehen jetzt beide offen? Jeder hat so seine Macken. Beim Willibald hat sich da mittlerweile eine kleine Zwangsneurose eingeschlichen, sowohl nachts als auch untertags. Wohn-, Schlaf- und Ausscheidungsbereiche gehören getrennt, aus Prinzip. Egal, wer da nach einer Bettbesichtigung die Tür vergessen hat, er selbst war es nicht, da ist er hundertprozentig sicher. Und Eduard Pospischill hat keinen Wohnungsschlüssel! Genau den muss er informieren.
Es dauert nicht lange, und der vom gerade unabkömmlichen Kommissar geschickte Beamte betritt das Stiegenhaus.
Herbert Homolka, das völlige Gegenteil dessen, was man sich unter einem Polizisten so vorstellt. Zart in seinem Erscheinungsbild, groß, schlaksig und wie zur Entschuldigung für seine Größe gebückt mit schwitzigen Händen – also Recht und Ordnung in Gestalt von Theologie und Informatik.
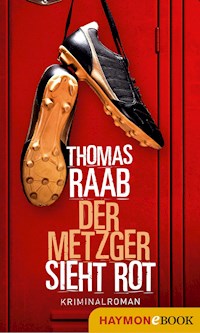


![Walter muss weg [Frau Huber ermittelt, Band 1] - Thomas Raab - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6449af66891644fec5c3bf512e0e7e71/w200_u90.jpg)

![Peter kommt später [Frau Huber ermittelt, Band 3] - Thomas Raab - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/37fbc55a2c46e56db5bce63bb86b09ca/w200_u90.jpg)