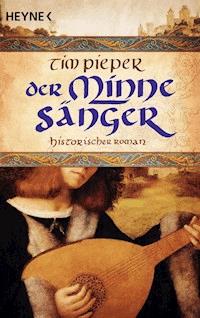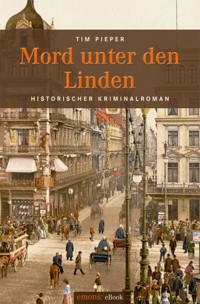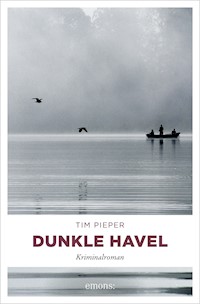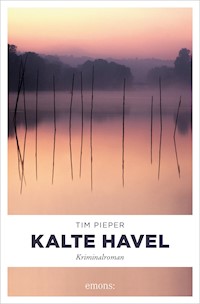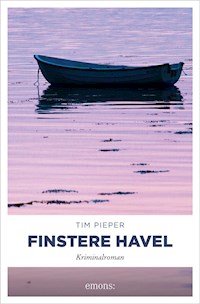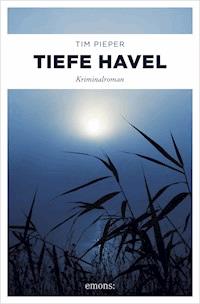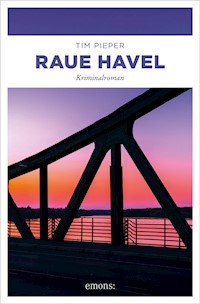Inhaltsverzeichnis
DAS BUCH
ZUM AUTOR
Widmung
Inschrift
Erster Teil: – von der Adlerburg ins Kloster
Im Jahre des Herrn 1160
1.
2.
3.
4.
5.
Im Jahre des Herrn 1164
1.
2.
3.
4.
5.
Im Jahre des Herrn 1166
1.
2.
Im Jahre des Herrn 1173
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Im Jahre des Herrn 1174
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Im Jahre des Herrn 1175
1.
2.
3.
4.
Zweiter Teil: – am herzoglichen hof
Im Jahre des Herrn 1176
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Im Jahre des Herrn 1182
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Im Jahre des Herrn 1183
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Im Jahre des Herrn 1184
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Im Jahre des Herrn 1185
1.
2.
Im Jahre des Herrn 1186
1.
Dritter Teil: – Kreuzzug und minne
Im Jahre des Herrn 1187
1.
2.
Im Jahre des Herrn 1889
1.
2.
3.
4.
Im Jahre des Herrn 1190
1.
2.
3.
4.
Im Jahre des Herrn 1191
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Im Jahre des Herrn 1202
1.
Im Jahre des Herrn 1203
1.
Quellenangaben
Glossar
Copyright
DAS BUCH
Hartmann von Aue: 1160 wird er in einer stürmischen Nacht unter Schmerzen geboren. Noch weiß niemand, wie sehr der spätere Dichter und Sänger die Damen an den Fürstenhöfen und die Ritter auf den Schlachtfeldern mit seiner Kunst in den Bann schlagen wird. Er singt von der großen Liebe, die sich für ihn noch nicht erfüllt hat. Mit seinen Liedern kann er zwar Judiths Herz gewinnen, sie aber nicht aus dem Kerker befreien. Doch genau das ist seine Aufgabe.
Eine stürmisch-romantische Mittelaltersaga von einer neuen Stimme im Genre des historischen Romans für alle Leser von Wolf Serno und Peter Prange.
ZUM AUTOR
Tim Pieper, geboren 1970 in Stade, studierte nach einer Weltreise Neuere und Ältere deutsche Literatur und Recht. Sein Hauptinteressengebiet ist die deutsche Geschichte. Der Minnesänger ist sein Debütroman. Tim Pieper lebt in Berlin, wo er an seinem zweiten historischen Roman arbeitet.
Für meine Eltern
Hartmann von Aue hat tatsächlich gelebt!Alles, was wir über ihn wissen,stammt aus literarischen Zeugnissen.Dieser Roman erzählt sein Leben.
T.P.
Erster Teil:
von der Adlerburg ins Kloster
Im Jahre des Herrn 1160
1.
Nach einem Festgelage lag Dankwart von Aue auf einer Strohmatte im Steinsaal. Ein Traum gaukelte ihm vor, dass sein Knecht durch das Portal trat. Was führt ihn her?, dachte er. Sucht er nach mir? Hat er eine Botschaft? Da streckte der Knecht die Hand nach ihm aus. Mehrere Male krümmte sich sein Zeigefinger und wurde wieder lang. Ich soll ihm folgen! Die Erkenntnis leuchtete so klar, dass Dankwart die Augen aufschlug.
In der Dunkelheit zeichneten sich Gewölbestützen ab. War da nicht...? Im Mund rollte er seine Zunge, die von einem pelzigen Geschmack belegt war – dann erinnerte er sich. Ächzend schlug er das Schafsfell zurück und stemmte sich hoch. Er setzte seine Fußsohlen auf den kalten Stein und hielt Ausschau. Überall um sich herum erkannte er Männer und Frauen, deren Brustkörbe sich regelmäßig hoben und senkten. Er hörte ihr Schnarchen, Seufzen und Schmatzen. Nur von seinem Knecht fehlte jede Spur.
Dankwart raufte sich das helle Haar. Nur langsam begriff er, dass sein Knecht ihm nicht leibhaftig erschienen war. Vor vielen Jahren hatte ihn seine Mutter gelehrt, dass Träume Botschaften waren. Sie hatte ihm auch erklärt, wie man die Bilder deutete, aber das Wissen des alten Volkes hatte den Knaben zu sehr geängstigt. Dankwart ließ seinen Kopf los. Auch ohne Kenntnis der Geheimlehre begriff er die Botschaft: Er hatte seinem Knecht folgen sollen. Offen blieb nur, wohin, und vor allem, warum.
Sogleich musste er an seine Ehefrau denken. Sie war auf der Adlerburg geblieben, weil ihr Leib so gewölbt war, dass sie jederzeit niederkommen konnte. Ihre letzte Geburt war schwer gewesen und hatte Agnes beinahe getötet. Vielleicht hätte ich nicht fortreiten dürfen, dachte er. Vielleicht hätte ich in ihrer Nähe bleiben sollen. Vielleicht, vielleicht! Um solche Überlegungen anzustellen, war es zu spät. Dankwart schluckte hart und schickte ein Stoßgebet zum Himmel: Mein Gott, ich bitte dich, stehe ihr bei, wenn sie in Not ist!
Da bauschte ein Windstoß die Brokatvorhänge auf. War das ein Zeichen? Dankwart glaubte nicht an das abergläubische Geschwätz der Kräuterfrauen und trotzdem war er verunsichert. Sollte er nach Aue reiten, um nach dem Rechten zu sehen?
Schon schlüpfte er in die Beinlinge und das rindslederne Schuhwerk. Dann warf er die Tunika über, griff nach dem Kettenhemd und dem Schwert. Vorsichtig stieg er über die Schlafenden, schob den Vorhang zur Seite und trat hinaus auf die Freitreppe. Der Junimorgen war frisch. Während er sich den Gürtel um die Hüfte schnallte, sah er zur bleichen Scheibe des Mondes auf. Nur Narren ritten bei Nacht! Vor allem von Erdlöchern drohte Gefahr, denn wenn der Hengst aus vollem Galopp hineintrat, konnte er sich die Läufe brechen. Er würde mit Vorsicht reiten müssen – mit großer Vorsicht!
Dankwart wickelte die Bänder seiner Rindslederschuhe um die Knöchel und verknotete sie. In seinem Rücken vernahm er lautes Gähnen, dann ein gedämpftes Murmeln. Der Vorhang versperrte ihm die Sicht in den Steinsaal, aber es konnte nicht mehr lange dauern, bis sich einer der Gäste zum Brunnen begab. Ist erst einer wach, dachte er, so folgen bald die anderen. Geschwind richtete er sich auf und eilte die Stufen hinab. Zertrampelte Blumenstreu, Knochen und Tonscherben bedeckten den Grund des Schlosshofes. Ein Schwein trottete umher und wühlte sich durch die Speisereste. Dankwart war froh, dass niemand draußen schlief oder noch an der Tafel zechte. Was hätte er seinem Dienstherrn und Gastgeber auch sagen sollen? Was hätte er den anderen Kriegern erwidern sollen, wenn sie nach dem Grund seines Aufbruchs fragten? Er hörte sie schon reden: »Weiber gebären alle naselang Kinder. Willst du dich aufführen wie ein Hasenfuß? Oder bist du gar ein Hasenfuß? Hahaha! Bleibe gefälligst hier und sauf mit uns.«
Nachdem er den Hengst aus dem Stall geführt hatte, wuchtete er sich in den Sattel und riss den Kopf des Tieres an den Zügeln herum. »Lasst die Zugbrücke herunter!« Dankwart erschrak über das laute Echo seiner Stimme und blickte sich nach dem Palas um. Dort rührte sich nichts. Auch im Wachlokal blieb alles ruhig. Die Soldaten werden ihren Rausch ausschlafen, dachte er. Und plötzlich war es ihm gleichgültig, ob er die Gefährten weckte oder nicht. Mit ihrem Geschwätz können sie mich nicht aufhalten. Sollen sie doch denken, was sie wollen. Er stellte sich in den Steigbügeln auf und rief aus voller Kehle: »Was ist da los? Kommt auf die Beine, ihr Kerle!«
Nun erklang das Ächzen eines Holzschemels. Füße schlurften über Stein und das schlaffe Gesicht eines Wachsoldaten tauchte im Portal auf. Als er den Reiter sah, weiteten sich seine Augen. Schnell blickte er zurück ins Wachlokal, flüsterte Unverständliches und trat wieselflink vor Dankwart hin.
»Verzeiht mir, Herr! Bitte sagt niemandem, dass...«
»Erspar mir deine Ausreden und lass endlich die Zugbrücke herunter!«
Bald ertönte das Kettengerassel. Zwischen Mauerwerk und Brückenholz wurde ein Spalt Himmel sichtbar. Der dunkle Tunnel des Torgangs lichtete sich mit jedem Ächzen der Winde. Mit einem Rums knallte das Tor auf der anderen Seite des Wehrgrabens nieder.
Der laute Aufprall erschreckte den Hengst. Das Tier wieherte und stellte sich auf die Hinterbeine. Dankwart neigte den Oberkörper gegen die Mähne, lockerte die Zügel und trat dem Hengst in die Flanken. Die Vorderläufe fielen auf den Grund
»Heja«, rief er, um das Tier anzutreiben. Als Herr und Pferd den Schlossberg hinunterpreschten, peitschte Dankwart die Luft ins Gesicht. »Heja, heja!«
Er überquerte die Brücke – die Hufe polterten über die Holzplanken -, nahm die leichte Steigung im Galopp und erreichte den Waldweg. Beschirmt von einem Blätterdach war er duster wie ein Felsstollen. Dankwart brachte sich und den Hengst in Gefahr. Er wusste es, aber etwas anderes war stärker. Der Weg würde ihn nach Aue, zu Agnes, führen. Vater im Himmel, betete er, zwölf Sommer hast du mir mit ihr geschenkt. Sie ist nicht mehr jung, aber Agnes ist mein Weib. Lass sie wohlauf sein! Ich bitte nur um das, Herr! Lass sie wohlauf sein!
Abrupt verstummte sein stilles Gebet. Der Körper des Tieres arbeitete unter ihm in einem ruhigen Gleichmaß. Die Hufe griffen weit in die Dunkelheit aus. Dumpf klang ihr Trommeln auf dem Erdboden. Irgendwo heulten Wölfe. Zu dieser Jahreszeit drohte von ihnen keine Gefahr, denn der Wald hielt genügend Kleintiere bereit.
Dankwart fühlte, wie die Ungeduld an ihm zehrte. Er musste schneller nach Aue kommen. Schneller zu Agnes! Mit Grimm zog er sein Schwert. Mit einem Schlag der flachen Seite in die Flanken trieb er den Hengst an. »Schneller! Lauf schneller!« Plötzlich sackte die Brust des Tieres nach unten und nach vorn weg. Mit einem Ruck wurde Dankwart aus dem Sattel geschleudert. Er spürte noch den Wind in seinem Gesicht, dann schlug er auf.
2.
Ein beständiger Harndrang hatte Agnes in der Nacht wach gehalten. Sie hatte auf der Strohmatratze gelegen und den Winden gelauscht, die über das Schieferdach gefegt hatten. Auch hatte sie sich in die Welt ihrer Ahnen begeben, um Dankwart zu rufen, denn alle Zeichen deuteten daraufhin, dass die Niederkunft nicht mehr fern war. Ihren Ehemann in der Nähe zu wissen, würde ihr ein sicheres Gefühl geben.
Mit einem Seufzen erhob sich Agnes vom Bett, um ihr Tagewerk zu verrichten. Durch die Tür des Bruchsteinhauses trat sie ins Freie. Spitze Steine drückten sich in ihre Fußsohlen, als sie sich zum Stall bewegte. Im Tor beugte sie sich hinab und ergriff eine Tonschale, die sie mit Gerstenkörnern aus dem staubigen Sack füllte. Da regte sich das Leben in ihr. Mit Vehemenz trat es in ihre Bauchdecke. Agnes spürte, wie sich Tränen in ihren Augen sammelten. Nein, rief sie sich sofort zur Ordnung. Ich darf mich der Angst nicht ergeben!
Agnes schleppte sich auf den Hof und stieß Lockrufe aus. Es dauerte nicht lange, bis sich eine Schar Hühner einfand und nach dem ausgestreuten Korn pickte. Der Schmerz kam plötzlich. Vor Schreck ließ sie die Tonschale fallen und griff mit beiden Händen nach dem Kugelbauch; sie blickte an sich hinab und ihre Augen weiteten sich. Noch immer versuchte sie tapfer zu sein und Fassung zu bewahren, aber ein spitzer Schrei sprang über ihre Lippen.
Ihr Sohn Heinrich rannte über den Hof. »Herrin, was ist passiert?«
Agnes biss sich auf die Unterlippe. Die Frauen im Dorf erzählten zwar, dass nur die Erstlingsgeburt schwer war, aber sie hatte anderes erfahren. Bei der letzten Niederkunft hatte sie sich halb besinnungslos auf dem Bett gewunden und mit Fäusten auf ihren Bauch getrommelt. Das Kind hatte einfach nicht hindurchgepasst. Sosehr sie sich auch abgemüht hatte, sosehr die Hebamme auch nachgeholfen hatte – der Gebärmund hatte sich nicht genug geweitet. Sie selbst hatte sich schon aufgegeben, als es nach drei Tagen und Nächten doch noch aus ihr herausgekommen war. Es war schon tot gewesen und hatte einen riesigen Wasserkopf gehabt.
Von Ostern bis Pfingsten hatte Agnes nicht einmal die Kraft aufgebracht, die milden Speisen zu verdauen, die ihre Freundin, Mechthild vom Hasgelhof, mit viel Sorgfalt zubereitet hatte. Alles hatte sie wieder ausgespien. An dem Unglück hatte nur die Fleischeslust schuld sein können! Auch ohne die Absicht, ein Kind zu zeugen, hatten sie und Dankwart sich vereinigt. Zur Strafe war in ihrem Leib ein Wesen herangereift, das dazu verdammt gewesen war, ohne Seele in diese Welt zu treten.
Agnes’ Wange zuckte. Sie gab sich solche Mühe, keusch zu bleiben! Das schwor sie bei Jesus, Maria und Josef! Aber manchmal genügte ein Blick in Dankwarts eisblaue Augen, damit sich in ihrem Schoß der Satan regte.
Heinrich stand noch immer vor ihr. Zärtlich strich sie über sein braunes Haar, über die blanke Stirn, die hohen Wangenknochen, über sein Gesicht, das dem ihren so ähnlich sah. »Ich habe geschrien, weil es jeden Moment losgehen kann, aber du kannst mir helfen. Wasch die Körnerschüssel aus, dann füll sie mit Wasser und bring sie mir. Hinterher weckst du den Knecht!«
Plötzlich musste sie an die vergangene Nacht denken. Irgendwann hatte sie am Fenster gestanden und beobachtet, wie Leutfried, der Knecht, mit einer Fackel in der Hand durch das Tor geschritten war. Wo hatte er so spät hingewollt? Oder hatte sie ihn gar nicht gesehen? War alles nur ein Trugbild gewesen?
Agnes schüttelte die Erinnerung ab. »Jedenfalls sagst du Leutfried, dass er den Ackergaul nehmen soll, um Mechthild vom Hasgelhof zu holen. Hast du verstanden?«
»Ja, Herrin!«
»Dann läufst du in den Wald, um der Hebamme Bescheid zu geben. Sie soll sofort kommen...«
Der Knabe legte den Kopf schief. Er zögerte.
»Im Wald leben keine Kobolde«, sagte Agnes. »Glaub nicht alles, was der Pfaffe im Heimgarten erzählt.« Ihre Worte erreichten den Knaben nicht. Noch immer blinzelte er nervös. »Soll ich lieber Leutfried zu der Hebamme schicken?«
»Nein«, rief Heinrich schnell und griff nach der Schale. »Ich hab keine Angst.«
Um Erschütterungen zu vermeiden, ging Agnes langsam zurück zum Bruchsteinhaus. Im Türrahmen streckte sie sich nach einem Beutel und durchtrennte die Schnur. Zugleich vernahm sie aus dem Nebenraum leises Kinderflüstern. Die Zwillinge müssen Angst bekommen haben, als sie meinen Schrei hörten, dachte sie und machte Heinrich den Durchgang frei, der die Schale mit Wasser auf den Tisch stellte.
»Wenn du mit der Hebamme zurückkommst«, sagte Agnes und sah ihn eindringlich an, »greifst du dir einen Sack aus dem Stall und führst deine Schwestern hinab ins Tal. Am Waldrand rupft ihr Blätter von den Büschen, damit das Vieh was zu fressen hat. Bleibt dort so lange, bis Leutfried oder Mechthild kommen, um euch zu holen.«
Der Junge nickte eifrig und rannte zur Hütte des Knechts.
Agnes zog ein getrocknetes, moosähnliches Knäuel aus dem Beutel. Schon vor Wochen hatte sie Dankwart gebeten, es bei einem Händler in Freiburg zu erstehen. Sie betrachtete die Rose von Jericho und setzte sie auf die glitzernde Oberfläche. Kleine Wellen dehnten sich konzentrisch von dem Treibgut aus. Auf Wasser schwimmend entfaltete das Gewächs Kräfte, die den Muttermund der Gebärenden öffnen sollten.
Noch einmal trat Agnes in den Türrahmen. Leutfried, der Knecht, eilte gerade aus seiner Hütte und rief ihr schüchtern einen Gruß zu. Dann rannte er quer über den Hof zum Stall. Heinrich bemühte sich nach Leibeskräften, den Torriegel anzuheben. Die beiden tun, was sie können, dachte Agnes. Doch wie viel sicherer würde sie sich fühlen, wenn Dankwart ihr zur Seite stände. »Mein Gott«, betete sie. »Bring ihn zu mir! Lass ihn wissen, dass ich niederkomme! Sprich zu ihm, nur dieses eine Mal!« Eine heftige Wehe lenkte ihr Denken zurück auf das Unvermeidbare.
3.
Dankwart setzte sich benommen auf und schaute besorgt zu dem Hengst hoch. Beim Tritt in ein Erdloch hatte er sich die Vorderläufe gebrochen und litt offenbar unter großen Schmerzen. Dem Dienstmann war sofort klar, dass der Rappe diese Verletzung nicht überleben würde. In einer solchen Situation gab es nur eine Maßnahme, und sie musste schnell ergriffen werden, um unnötige Qualen zu vermeiden.
Dankwart zog das Schwert aus der Scheide und stieß es dem Tier bis zum Heft in die Brust. Gelb quollen die Augäpfel hervor. In aller Erbärmlichkeit der Kreatur Gottes schnappte der Hengst nach Luft und versuchte vergeblich, auf die Beine zu kommen. Der Anblick rührte Dankwart so stark, dass er den zuckenden Kopf umfing und beruhigend zu dem Rappen sprach wie zu einem Wesen mit einer Seele. Schon wollte er den Knauf ergreifen, um das Schwert in der Wunde zu drehen – da lief ein Ruck durch den mächtigen Leib und die Augen brachen.
Nicht zum ersten Mal begriff Dankwart, dass es Unheil brachte, wenn er heidnischen Zeichen folgte. In dieser Nacht, in einem Zustand zwischen Traum und Wachsein, hatte er die Warnungen seines Verstandes ignoriert. Seine Eingebung hatte dem Hengst das Leben gekostet. Auf ihn war stets mehr Verlass gewesen als auf die Menschen. Er konnte nur hoffen, dass der Rappe nicht umsonst gestorben war.
Er beugte sich zu dem Tier hinab und flüsterte ihm Worte des Abschieds ins Ohr, dann schulterte er den Holzsattel und griff nach dem Zaumzeug. Normalerweise hätte er eine Grube ausgehoben, damit die Bären, Wölfe und Füchse die Gebeine nicht in alle Himmelsrichtungen verstreuten, aber die Sorge in ihm war stärker.
Als Jungmann war er ein geschickter Waldläufer gewesen und hatte dem Herzog von Zähringen in vielen Schlachten als Meldegänger gedient. Manche Männer setzten im Alter Fett an und wurden behäbig, aber er hatte sich seine sehnige Konstitution bewahrt. Er atmete tief durch und lief los. Gleichmäßig steigerte er die Geschwindigkeit, bis seine Füße einen geschmeidigen Rhythmus gefunden hatten.
Als er den Wald hinter sich ließ, war sein Rücken klatschnass und der Schweiß tropfte ihm von der Nase. Vor ihm lag das Hexental mit dem plätschernden Bach, den weitläufigen Wiesen, Obstbäumen und Rodungshöfen. Auf einer Anhöhe erhob sich eine Kapelle, die der Bischof von Freiburg Johannes dem Täufer geweiht hatte. Dankwart hatte keine Augen für seine Heimat. Er konzentrierte sich ganz auf das vor ihm liegende Gelände mit seinen Unebenheiten und Steinen. Wenn er sich den Knöchel verstauchte, würde er vielleicht zu spät kommen, und er musste endlich wissen, was mit Agnes los war.
Während er durch das kniehohe Flussgras hetzte, schlugen die Disteln gegen seine Schienbeine. Kurz schaute er zu seinem Heim hinauf. Auf einer vorspringenden Bergnase, auf halber Höhe des Schönebergs hatten er und sein Vater einst ein Plateau gerodet und ein befestigtes Bruchsteinhaus errichtet. Aus Treue zu ihrem Dienstherrn und aus Stolz auf die Arbeit ihrer Hände nannten sie es Adlerburg.
Ein Palisadenwall wehrte Angreifer ab. Ein gewundener Pfad, versteckt hinter Birken, Rotbuchen und Ebereschen, führte zum Tor hinauf. Das alles verlor seinen Wert, wenn seiner Ehefrau etwas zustieß. Sie allein erfüllte das Anwesen mit Leben. Dankwart ignorierte das Stechen in seinen Seiten, die brennenden Schenkel und die blutenden Füße. Schritt um Schritt kämpfte er sich die Steigung hinauf und betete inbrünstig: Mein Gott, lass sie wohlauf sein. Ich bitte nur um das, Herr! Lass sie wohlauf sein!
4.
Agnes’ Umhang und die Matratze waren getränkt von Fruchtwasser und Blut. Sie stützte sich auf die Ellenbogen und beobachtete die Hebamme. Mit hohler Hand schöpfte die Alte Kräuterwasser aus dem Holzzuber, um es über Gesicht und Körper des Neugeborenen zu gießen. Dabei murmelte sie Segenswünsche des alten Volkes.
Agnes sank zurück und starrte an die rußige Decke. Die Panik, die sie bei der ersten Wehe ergriffen hatte, erwies sich als unbegründet, denn das kleine Wesen hatte sich nach Kräften gemüht, um auf die Welt zu kommen, so als hätte es seiner Mutter nicht allzu viele Schmerzen bereiten wollen. Der erste klagende Schrei hatte geklungen wie der eines vergessenen Zickleins.
Agnes lächelte und erinnerte sich daran, wie sie vor Wochen einen durchreisenden Mönch bewirtet hatte. Der Geistliche hatte ihr erklärt, dass wenn der Samen des Mannes in der rechten Gebärmutterhälfte zu sprießen beginne, ein Junge, wenn er sich in der linken Hälfte einniste, ein Mädchen geboren werde. Agnes tastete ihren Leib ab. Nur wenn der Samen kräftig und die beiderseitige Liebe groß sei, hatte der Mönch gesagt, würde das Kind zu einem tugendreichen Menschen reifen. Dankwarts Samen ist stark, dachte Agnes und schloss für einen Moment die Augen.
»Herrin!«, rief der Sohn besorgt.
Auf dem Laubkissen drehte Agnes den Kopf zur Seite. Mechthild vom Hasgelhof hatte die Kinder vom Waldrand abgeholt. Agnes streckte die Arme nach ihnen aus, aber nur Heinrich lief auf sie zu, ergriff ihre ausgestreckte Hand und kniete auf dem Lehmfußboden nieder. Die Zwillinge drückten ihre Gesichter in den gewölbten Bauch der Freundin. Auch in ihrem Leib reifte ein Kind heran, das noch vor dem Fall des ersten Schnees die Taufe erhalten sollte.
Agnes strich Heinrich eine Locke aus der Stirn. »Hab keine Angst. Ich bin nur erschöpft.«
Währenddessen hob die Hebamme den Säugling aus dem Holzzuber. Sie streckte und beugte die kleinen Gliedmaßen, um ihre Gelenkigkeit zu prüfen, stippte den Finger in einen Holznapf mit Honig und führte ihn an den Mund, um die Geschmacksnerven des Kindes anzuregen. Nachdem sie den Säugling in ein Tuch gewickelt hatte, sagte sie: »Herrin, Euer Kind ist gesund. Sein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Schützt es drei Tage vor zu grellem Licht, damit sich seine Augen an diese Welt gewöhnen können.« Die Hebamme legte ihr das Bündel in den Arm.
Agnes wiegte den Säugling und beobachtete, wie er aus eigenem Antrieb ihre Brust suchte und schmatzend zu trinken begann. Sie war so erleichtert, dass ihr Tränen in die Augen schossen. »Sieh nur!«, rief sie. »Sieh doch nur! Mein Kind will leben!«
»Die Geburt erfolgte bei Sonnenaufgang«, sagte die Hebamme. »Da ist der Lebenswille groß. Der Mensch strebt nach Entfaltung.«
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Agnes blickte zum Eingang und freute sich sehr, als sie ihren Ehemann sah. Mochten die Leute aus dem Dorf über ihn denken, was sie wollten. Niemals hatte er ihr oder den Kindern Gewalt angetan. Niemals hatten sie Hunger leiden müssen. In seiner Gegenwart fühlte Agnes sich sicher. Er war nicht nur vor Gott, sondern auch tief in ihrem Herzen ihr Gemahl.
5.
Dankwart sah zuerst die blutigen Tücher, dann das rote Wasser in den Schüsseln. »Bist du wohlauf?«, platzte er heraus.
»Das bin ich, mein Geliebter«, erwiderte Agnes. »Gott hat uns mit einem Sohn gesegnet. Bitte schließ die Tür. Wir müssen seine Augen schützen.«
Dankwart eilte zum Bett und kniete nieder. Zunächst war er noch misstrauisch – vielleicht hielt seine Ehefrau eine Hiobsbotschaft zurück, vielleicht wollte sie ihn nur schonen -, aber welchen Sinn würde das ergeben? Nein, Agnes hatte selbst gesagt, dass sie die Geburt unbeschadet überstanden hatte. Sie wusste am besten, wie sich ihr Körper anfühlte.
Als er endlich begriff, dass alles gut war, streckte er seine Hand aus und strich ihr zärtlich über die Stirn. Er war so erleichtert, dass er auch den Tod des Hengstes akzeptierte. Wenn man es recht bedenkt, dachte er, hat so alles seine Richtigkeit. Gott hat meine Gebete erhört und dafür den Rappen genommen.
»Warum schwitzt du so?«, fragte Agnes.
»Das ist nicht mehr wichtig!«
»Unser Sohn ist kräftig! Wenn du einverstanden bist, möchte ich ihn nach meinem Vater nennen! Hartmann soll er heißen.«
»Herr«, sagte in diesem Moment die Hebamme. »Braucht Ihr mich noch?«
Dankwart drehte den Kopf nach hinten. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er nicht mit seiner Ehefrau alleine war. Sein Blick fiel auf die zwei Frauen, und es war ihm sehr unangenehm, dass ihn die beiden Hörigen in diesem aufgelösten Zustand erlebt hatten. Er musste ihnen zeigen, dass er immer noch Herr der Lage war. Gemessenen Schrittes ging er zur Eisentruhe und entnahm ihr zwei Silbermünzen. Dann drückte er eine in die faltige Hand der Hebamme und sagte: »Du kannst jetzt gehen!«
Ungläubig starrte die Hebamme auf das Geldstück und biss hinein, um sich von der Echtheit zu überzeugen. Sie verbeugte sich tief und sagte: »Gott segne Euch, Herr. Der Allmächtige schenke Euch und den Euren Gesundheit!« Eilig raffte sie den Kräuterbeutel und den Holznapf an sich und verließ den Raum.
Die zweite Münze wollte Dankwart Mechthild geben, aber sie wich ihm aus, trat Agnes zur Seite und strich ihr zärtlich über die Schulter.
»Wenn du mich brauchst«, sagte Mechthild, »schicke deinen Sohn mit einer Nachricht.« Dann verließ sie das Haus.
Dankwart stand mitten im Raum. Er konnte es kaum glauben, aber Mechthild hatte ihn einfach stehen gelassen! Sie hatte ihn nicht einmal eines Blickes gewürdigt! Eine heftige Wut erfasste ihn. »Was bildet sich dieses Weib ein? Sie ist eine Bäuerin und keine Königin!«
»Bitte verüble es ihr nicht«, sagte Agnes sanft. »Es muss sie kränken, wenn du ihr Geld anbietest. Sie ist zwar arm, aber meine Freundin.«
»Das war nicht das erste Mal. Das weißt du genau! Richte Mechthild aus, dass sich meine Geduld erschöpft hat. Verweigert sie mir noch ein einziges Mal im Beisein von anderen den Respekt, so wird sie es bereuen. Ich bin der Lehnsträger des Herzogs. Ich hab ihrem Ehemann den Hasgelhof überlassen, weil du mich darum gebeten hast. Wenn Mechthild es darauf anlegt, kann ich ihr den Acker auch wieder wegnehmen. Dann soll sie zusehen, wie sie mit ihrer Hochfahrendheit zurechtkommt. Richte ihr das Wort für Wort aus!«
»Natürlich«, sagte Agnes erschöpft.
Im Jahre des Herrn 1164
1.
Zwei Jahre des Friedens verstrichen, bis sich die unheilvollen Zeichen wieder verdichteten: Im Westen des Landes steckten Söldner mehrere Rodungshöfe in Brand, überall wurden Truppen zusammengezogen und zahlreiche Herolde galoppierten von Burg zu Burg, um Botschaften zu übermitteln. Alles deutete auf einen Krieg hin – trotzdem ließen sich die Hörigen aus Aue nicht von der jährlichen Erntedankfeier abhalten.
Dankwart schob sich durch das Festgetümmel. Lieber wäre er auf der Adlerburg geblieben, um mit Leutfried, seinem Knecht, den Pflug zu reparieren, aber er wusste um seine Pflichten. Auf den Festen der Hörigen musste er sich zeigen. Den Bauern durfte nicht der Eindruck entstehen, dass sie hirtenlos waren. Zugleich achtete er darauf, Distanz zu wahren. Er trank nicht mit ihnen, denn das lockerte die Zunge. Auch an ihren Spielen nahm er nicht teil, denn er wollte ihnen keine Gelegenheit geben, ihn zu übertreffen.
Er stellte sich zu mehreren Bauern und begrüßte einen von ihnen mit einem Nicken. Einem anderen legte er die Hand auf die Schulter und fragte: »Wie geht’s deinem Jungen?«
»Die Hebamme hat ihm einen Trank bereitet«, erwiderte der Mann. »Erst schwitzte er stark, dann schlief er eine Woche. Jetzt kann er wieder arbeiten.«
»Gott meint es gut mit dir«, sagte Dankwart und wandte sich dem dritten Bauern zu. »Und du? Wie viel Scheffel hat dir die Ernte eingebracht?«
»Nicht genug zum Leben und nicht genug zum Sterben, gnadenvoller Herr. Wenn wir Euch den Zehnt zahlen, werden wir verhungern!«
Auf diese Antwort hatte Dankwart nur gewartet. »Du solltest deinen Helfern das Maul verbieten, wenn du mich das nächste Mal betrügen willst. Bis morgen begleichst du deine Schuld, ansonsten wirst du es bereuen.«
»Herr, Ihr versteht nicht, was...«
»Überleg dir gut, was du jetzt sagst«, unterbrach Dankwart ihn. Eine offensichtliche Lüge vor Zeugen würde er nicht ungestraft lassen können, dann würde er mit aller Härte durchgreifen müssen. Als der Mann die Schultern hängen ließ, sagte Dankwart nur »Morgen!« und ging weiter.
Als er die Kapelle erreichte, war er erleichtert. Hier sah man ihn, zugleich würde er unbehelligt bleiben. Er drückte die Pforte zum Friedhof auf und schloss sie hinter sich. Lautes Gelächter drang vom Portal des Gotteshauses zu ihm her. Das konnte nur der Pfaffe Lampert sein, der sich wahrscheinlich mit einer Gespielin vergnügte.
Über einen Trampelpfad begab sich Dankwart zur Längsseite der Kapelle und setzte sich auf die Steinbank. Er verschränkte die Arme über der Brust und schaute dem Treiben jenseits des Lattenzaunes zu. Überall standen Tische mit Speisen und Getränken. Von der Linde flatterten bunte Bänder. Musik erklang und die Hörigen versammelten sich zu einem Reigen. Dabei legten sie die Arme um die Schultern des Nebenstehenden. Der Harfner sang die erste Strophe eines Sommerliedes: »Die Jungfrau flocht sich Blumen ins Haar / und als ich sie beim Tanze sah / da war der Winter längst vergessen...« Der Fiedler fiel in die Melodie ein. Die Menschen drehten sich zunächst gemächlich, dann immer ausgelassener um die Linde, wobei sie die Beine in die Luft warfen und in den Gesang einstimmten: »Die Jungfrau flocht sich Blumen ins Haar...«
Die Holzkreuze auf dem Kapellfriedhof warfen schon lange Schatten, als Dankwart spürte, wie jemand an seiner Schulter rüttelte.
»Herr«, sagte Leutfried, der Knecht. »Wacht auf! Der Herold des Herzogs ist eingetroffen. Er hat eine Botschaft für Euch.«
Dankwart erhob sich und streckte die Arme gähnend von sich. Er war etwas überrascht, als ihm auffiel, dass die Hörigen schon völlig betrunken waren. Sie lagen unter den Bänken, lehnten mit dem Rücken an der Linde, planschten johlend im Bach, einer schlief sogar auf einem frischen Grab. Offenbar hatte er den Großteil des Festes verschlafen. »Dann wollen wir ihn nicht warten lassen!«, sagte er.
Am Fuß des Hangs blickten Halbwüchsige, die nacheinander versuchten, ein Rundeisen um einen Holzpflock zu werfen, verstohlen auf den Herold. Mit durchgedrücktem Rücken saß dieser auf einem Schimmel und hielt an einer Stange das Banner des Herzogs, einen roten Adler auf goldenem Grund. Schaum tropfte vom Maul des Pferdes.
»Friede sei mit dir!«, grüßte Dankwart.
»Seid Ihr Dankwart von Aue?«, fragte der Herold.
»So ist es!«
»Berthold IV, Herzog von Zähringen und Rektor von Burgund, übersendet Euch seinen Gruß. Er ruft seine Getreuen zu den Waffen, um gegen die FestungTübingen zu ziehen. In einer Woche, am Tag des Herrn, sammeln sich seine Krieger am Ufer der Dreisam.« Der Schimmel tanzte unruhig auf der Stelle. Der Herold zähmte ihn und fuhr fort: »Auch Ihr werdet Euch einfinden. Habt Ihr das verstanden?«
»Ich werde da sein!«
»Der Herzog zählt auf Euch!«
»Dann weiß er um meine Treue!«
Der Herold blickte ihn ein letztes Mal prüfend an, dann riss er das Pferd an den Zügeln herum und stieß ihm die Sporen in die Flanken. »Heja!«, rief er. In dieser Nacht würde er noch bei vielen Lehnsträgern und Edelfreien vorsprechen; an einem der größeren Höfe würde man ihm ein frisches Tier zur Verfügung stellen.
Schweigend blickten Dankwart und Leutfried dem Banner nach, das im Galopp durch die Dämmerung flatterte.
Es gab nichts zu sagen. Beide kannten den Krieg.
2.
Am Vorabend der Zusammenkunft fand sich die Familie am Tisch ein. Agnes schöpfte aus einem Kochkessel Brei und füllte zuerst Dankwart, dann den Kindern und Leutfried und schließlich sich selbst den Napf. Nachdem sie sich gesetzt hatte, falteten alle die Hände. Dankwart sprach das Tischgebet und die Familie begann zu essen. Er wusste, dass niemand ein Gespräch anfangen würde, solange er schwieg. Bedächtig legte er den Löffel neben den Napf, trank aus einem hölzernen Becher einen Schluck Molke und betrachtete die vertrauten Gesichter.
Im Falle seines Todes würde der Hausherrenstuhl seinem ältesten Sohn zufallen. Heinrich fehlt es an Härte, dachte er, aber er ist von einem guten Kern beseelt; er wird für Agnes sorgen. Neben den Hufen eigenen Landes in Aue besaß Dankwart noch mehrere Wiesen und einen Weinberg bei Uffhausen. Heinrichs Erbe wäre damit reich genug, um den Schwestern eine Brautgabe zu ermöglichen, die es ihnen gestattete, in den Munt eines wohlhabenden Mannes zu gehen.
Dankwarts Blick fiel auf Hartmann, der neben Judith, dem kleinen Mädchen von Mechthild vom Hasgelhof, saß. Die beiden Kinder spielten jeden Tag zusammen und waren kaum voneinander zu trennen. Gerade kletterten sie von der Bank, um sich in eine Ecke zurückzuziehen, wo sie offenbar etwas Wichtiges zu bereden hatten.
Weil Hartmann der zweitgeborene Sohn war, konnte er keine Ansprüche auf das Amt des Dorfschulzen oder die Ländereien anmelden. EinesTages würde er die Adlerburg verlassen müssen, um eine eigene Familie zu gründen. Vom rechtlichen Standpunkt wäre er dann nicht besser gestellt als die Hörigen im Dorf. Soll er wirklich dem Bruder den Zehnt zahlen?, fragte sich Dankwart. Nein! Neid und Missgunst darf die Brüder nicht entzweien. Ich muss mir etwas überlegen, um dem Jungen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Agnes und die Mädchen räumten die Näpfe ab und stellten zwei Krüge mit Wein auf den Tisch, von denen sich die Erwachsenen nach Belieben bedienten. Durch die offene Tür fiel kaum noch Licht in den Raum. Auch das Holz in der Feuerstelle verglomm langsam. Sie bleiben sitzen, weil sie fürchten, dass sie mich zum letzten Mal sehen, dachte Dankwart und fühlte eine große Zuneigung.
Hartmann trat an den Tisch. »Darf Judith hier schlafen?«
»Wenn sie zu Hause nicht erwartet wird«, erwiderte Agnes.
Die Kinder jubelten.
»Herr«, ergriff Leutfried das Wort, »mir ist heute etwas zu Ohren gekommen, dass Ihr unbedingt erfahren müsst. August der Altere erzählt den Leuten im Heimgarten, dass die Lehnsherrenschaft und das Amt des Dorfschulzen – im Falle Eures Todes – nicht Eurem Sohn zustehen, sondern ihm, weil er mehr Hufen Land besitzt und weil er im Gegensatz zu Euch von freier Abkunft ist.«
»Das ist Unsinn!«
»Sobald Ihr tot seid, will er dem Herzog den Treueid schwören.«
»Er kann so viele Treueide schwören, wie er will. Das Lehen und das Amt sind erblich. Beides wird Heinrich zufallen, wenn ich getötet werde. Der Zähringer wird sich an die Gesetze halten.«
»Du darfst August den Älteren nicht unterschätzen«, sagte Agnes. »Du musst hierbleiben und ihn zum Schweigen bringen! Mechthild hat mir erzählt, dass sich der Lehnsherr von Herbolzheim mit zwanzig Silbermünzen und einem Schwein vom Waffengang freigekauft hat. So viel könnten wir auch aufbringen. Die Wände des Vorratsstalles faulen und müssen ausgebessert werden. Wenn er zusammenstürzt, verlieren wir das Getreide und hungern im Winter. Außerdem musst du die Abgaben überwachen. Du kennst sie; sie werden Heinrich betrügen!«
»Heinrich muss lernen, sich durchzusetzen. Und was das Freikaufen angeht – du weißt genau, warum ich den Waffengang nicht vermeiden kann.«
»Das weiß ich nicht! Ich verstehe einfach nicht, warum du dich abschlachten lassen willst.«
Argwöhnisch betrachtete Dankwart seine Ehefrau. Schon hundert Mal hatte er ihr erklärt, warum er den Zähringern zu besonderer Treue verpflichtet war. Im Grunde verhielt sich der Sachverhalt ganz einfach. Sein Großvater hatte noch dem Landadel angehört und hatte sich eine Hörige aus dem Dorf zur Ehefrau genommen. Nach Maßgabe der ärgeren Hand waren ihre Kinder in den niederen Stand der Mutter geboren worden. So war mit der Geburt von Dankwarts Vater die edle Blutlinie abgerissen. Gleichzeitig hatte Dankwarts Vater das Blutrecht verloren, um sich über die Bauern zu stellen. Natürlich hatte ihm die unsichere Rechtslage Sorgen bereitet: Würde der Herzog ihm das Lehen überlassen oder an einen Edelmann übertragen? Was würde mit den Ländereien geschehen? Bald hatte er die Ungewissheit nicht mehr ausgehalten und war vor den Zähringer hingetreten. Der Herzog hatte sich als kluger Politiker erwiesen und gespürt, wie er am meisten Gewinn aus der Angelegenheit ziehen konnte. »Wenn du mir mit genauso großer Treue dienst wie dein Vater«, hatte er gesagt, »will ich über den Mangel deiner Geburt hinwegsehen. Du sollst das Lehen behalten.« So war Dankwarts Vater zum ersten unfreien Herrn über Aue geworden. Zugleich hatte sein Geschlecht das Erbrecht zurückgewonnen.
In jenen Tagen hatten auch andere Fürsten Unfreie zu ihren Lehnsherren ernannt, denn es hatte sich gezeigt, dass von den Dienstmännern mehr Ergebenheit zu erwarten war als von den kleinen Landedelleuten, die immer wieder Anlässe für Fehden geliefert hatten: Entweder sie hatten die Befehlsgewalt selber beansprucht, oder sie hatten sich einfach geweigert, in die Schlacht zu ziehen.
»Nicht jeder Mann taugt zum Krieger«, sagte Dankwart. »Manch einer ist ein Gelehrter, ein anderer hat zwei linke Hände oder die Kraft eines Kindes, aber mein Vater war ein Mann des Schwertes und ich bin es auch. Unser Wert misst sich nicht am Stammbaum, sondern an unseren Taten. An jedem Tag müssen wir beweisen, dass wir das Vertrauen der Fürsten wert sind. Wenn Berthold mich ruft, folge ich ihm aufs Schlachtfeld. Und es ist mir gleichgültig, wer der Feind ist.«
»Im Großen kennst du dich aus«, sagte Agnes, »aber das Naheliegende übersiehst du. Ich prophezeie dir, dass August der Ältere die Bauern aufstacheln wird. Er sät ja schon das Gift. Du musst dich freikaufen, wenn du deine Familie nicht im Stich lassen willst!«
Dankwart blickte auf seine rechte Hand, die schon so vielen Männern den Tod gegeben hatte. »Warum fügst du dich nicht ein einziges Mal in meinen Entschluss? Warum lamentieren wir immer wieder aufs Neue über Dinge, die schon seit Jahren feststehen?«
Agnes brach in Tränen aus. »Dankwart, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe geträumt, dass du nicht zurückkehrst. Diese Fehde ist ungerecht. Was hat Berthold mit dem Tübinger zu schaffen? Was geht er ihn an? Wenn du mit dem Herzog ziehst, versündigst du dich und Gott muss dich bestrafen.«
Warum muss sie Zweifel streuen, obwohl sie ganz genau weiß, dass mir keine Wahl bleibt?, dachte Dankwart. Merkt sie denn nicht, dass ihre Reden mich schwächen? Mit voller Wucht ließ er seine Faust auf den Tisch krachen, so dass die Gefäße aufsprangen.
Agnes unternahm ziellose Schritte durch den Raum, blieb stehen und verschränkte die Arme vor der Brust. In dieser Haltung verharrte sie auch, als Dankwart zur Feuerstelle ging, einen Kienspan entzündete und ihn mit vorgehaltener Hand nach draußen trug. Auf dem Hof kühlte der Ostwind sein Gesicht ab. Am Himmel funkelten Sterne. Wenigstens wird es morgen keinen Regen geben, dachte er. Leutfried war seinem Herrn gefolgt. Gemeinsam gingen sie zum Vorratsstall. Mit dem flammenden Kienspan untersuchte Dankwart die von Agnes bezeichneten modrigen Stellen. Unmittelbar über der Erdoberfläche, wo Nässe und Frost besonders leicht angriffen, hatte Fäulnis das Holz befallen. »Das hat Zeit«, sagte er und richtete sich auf.
»Die Herrin ist eine gute Frau«, sagte Leutfried. »Sie ist nur in Sorge!«
Dankwart fröstelte. Die Nacht roch schon nach Herbst. »Wer hat dir erzählt, dass August der Ältere solche Parolen verbreitet?«
»Es war einer der Bauern im Heimgarten. Andere fassten sich ein Herz und stimmten ihm zu. Wie es den Anschein hat, passt August die Bauern einzeln ab, um sie gegen Euch aufzustacheln.«
»Vielleicht solltest du hierbleiben, um Heinrich beizustehen, wenn es Händel gibt.«
»Ihr habt selbst gesagt, dass Augusts Worte Narretei sind. Außerdem kann ich Euch nicht alleine ziehen lassen. Mit Euch habe ich in Burgund gelegen. Mit Eurem Vater hab ich gegen die Mailänder gekämpft. Herr, selbst wenn der freie Bauer etwas im Schilde führt – was sollte ich gegen ihn ausrichten? Wichtig ist, dass Ihr wieder heimkommt. Und wenn Ihr mich lasst, will ich meinen Beitrag dazu leisten.«
Dankwart wusste, dass Leutfried Recht hatte. Er wusste auch, dass der Knecht ihm mit Zähigkeit zur Seite stehen würde. Reif und kampferprobt wie er war, würde er Tapferkeit nicht mit Tollkühnheit verwechseln.
»Morgen erwartet uns ein anstrengender Tag!«, sagte Dankwart. »Geh jetzt schlafen!«
3.
Am Abend des 5. Septembers schlugen unweit der Festung Tübingen zweitausend Bewaffnete ihr Lager auf. Bis an den Rand der Wälder brannten die Lagerfeuer, um die sich nach Stand und Herkunft Krieger versammelt hatten. Die Wölfe witterten das gebratene Fleisch und strichen durch das Unterholz. Ihr Geheul klang schauderhaft.
Die zähringischen Ministerialen hockten in einer Senke, die Schutz vor den Ostwinden bot. Die Männer waren müde vom Marsch und berauscht vom Wein. Trotzdem spürte man deutlich, dass der geringste Anlass ausreichen würde, damit sie mit gezückten Dolchen aufeinander losgingen.
Dankwart saß etwas abseits und starrte in die lodernden Flammen. Sie sind so unstet wie die Herzen der Menschen, dachte er. Warum begriff Agnes nicht, dass er anders sein wollte als die zahllosen Wendehälse? Warum erfüllte es sie nicht mit Stolz, dass er sein Handeln einer Idee unterordnete und sich zu dieser Idee auch in der Gefahr bekannte? Seine Überlegungen ließen ihm keine Ruhe, und es dauerte noch lange, bis er sich in die grobe Wolldecke rollte und in einen traumlosen Schlaf sank.
Die Festung Tübingen lag auf einem Bergsporn mit weiter Sicht. Ihre Eroberung musste gut vorbereitet werden. Am nächsten Morgen postierten sich zu beiden Seiten des Neckars Wachmannschaften, um die Burg von ihren Versorgungswegen abzuschneiden. In den Wäldern wurden Stämme gefällt, die mit Eisen beschlagen als Rammböcke dienten. Kundschafter spähten eine geeignete Stelle für den ersten Sturmangriff aus.
Dankwart und Leutfried halfen dabei, ein Steinkatapult zusammenzusetzen. Werner von Schlatt, der zu den erfahrenen Kriegern unter den Ministerialen zählte und ein Kamerad Dankwarts war, gesellte sich zu ihnen. Eine rote Narbe verlief von seiner rechten Schläfe bis zum linken Ohr. Eines seiner Augen war durch den Schwertstreich erblindet und leuchtete in einem Weiß, das an die Milch junger Ziegen erinnerte.
Als die Sonne den Zenit erreichte, legten sie Kettenhemden und Schwerter an und fanden sich zum Waffensegen ein. Leutfried blieb in den hinteren Reihen bei den Knappen und Knechten zurück. Im Schatten einer Rotbuche am Ufer des Neckars bauten die Messdiener einen Tragaltar auf und arrangierten die Reliquienbehältnisse. Von den Zinnen der Burg tönten Schmährufe herüber. Das Weidegras war längst abgetreten und die Füße wirbelten Staub auf.
Der Bischof von Augsburg, ein Verbündeter des Welfen, ging in einem prachtvollen Gewand zum Altar. Dankwart und Werner von Schlatt knieten nieder. Beide hatten den Helm unter die Achsel geklemmt. Auf das Zeichen des Bischofs erhoben sich alle wieder und die Predigt begann: »Brüder im Glauben, wir haben uns hier eingefunden, um nach dem Willen Gottes zu handeln, denn Hugo von Pfalzburg hat großes Unheil über das Schwabenland gebracht. Zieht eure Schwerter, damit ich sie segnen kann, damit ihr kämpft im Namen des Allmächtigen. Paritur pax bello – Der Friede wird durch Krieg gewonnen...«
Jetzt kam der lateinische Teil, den Dankwart nicht verstand. Er sah sich um. Die Tatsache, dass er den Herzog nicht entdecken konnte, beunruhigte ihn.
»Hast du bemerkt, wie wild die Gäule sind?«, fragte Werner von Schlatt. »Sie müssen die Gefahr wittern. Ansonsten hätten sie die Umzäunung nicht zum Einsturz gebracht.«
»Der Sonntag soll doch nicht mit Kämpfen entweiht werden!«
»Was weiß ich? Hör doch nur die Schmährufe der Tübinger! Die Sonne macht sie streitsüchtig. Nicht einmal bei der Messe können sie ihre Lästermäuler halten. Und auf unserer Seite haben die Söldner die ganze Nacht gezecht. Noch in aller Frühe riefen sie Beleidigungen hoch. Wenn du mich fragst, kann es jeden Augenblick losgehen.«
Dankwart spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Insgeheim hatte er gehofft, noch ein oder zwei Tage Zeit zu haben, um über sich und Agnes in Ruhe nachzudenken. Seine Ehefrau bedeutete ihm viel zu viel, als dass er von dieser Welt abtreten könnte, ohne mit ihr Frieden geschlossen zu haben.
Plötzlich wurden in den hinteren Reihen Rufe laut. Dankwart stellte sich auf die Zehenspitzen, um Ausschau zu halten. Ein Reiter preschte im Galopp vorüber. Er trug das Feldzeichen Welfs an einer Stange.
»Komm mit!«, sagte Werner. »Ich glaube, es geht los.«
Dankwart zwängte sich durch die Versammelten. Immer wieder hob er den Kopf, um seinen Knecht in der Menge zu finden. »Leutfried, wo steckst du?« Er konnte nicht sehen, aus welcher Richtung sein Knecht zu ihm stieß, aber er vernahm seine Stimme: »Ich bin an Eurer Seite, Herr!«
Dankwart wusste kaum, wie ihm geschah, als er inmitten einer Schar von fünfzig Männern loslief. Der Helm rutschte auf seinem Kopf hin und her und verdeckte ihm die Sicht; die Nasenspange stach ihm in die Haut. Immer wieder ertönte der heisere Schlachtruf: »Auf sie! Auf sie!« Weit vor sich, auf einem Plateau nahe dem Südtor, erblickte er das Banner des Herzogs.
»Da ist Berthold!«, rief er. »Wir müssen zu ihm!«
»Wir werden ihn erreichen«, schrie Werner. »Mach dich bereit. Auf sie! Auf sie!... AUF SIE!«
Dankwart sah zu Werner hinüber und war froh, dass er im Kampf neben ihm stehen würde. Mit schmalen Lippen zog er das Schwert aus der Scheide. »Dann soll es so sein!... Auf sie!... AUF SIE!«
Halb kriechend, halb aufgerichtet, durch Sträucher und über Geröll kletterten die Krieger die steile Böschung zum Kampfplatz empor. Dankwart stemmte sich über den Felsvorsprung und richtete sich auf. Aufeinandergeschlagener Stahl und raues Gebrüll tönten ihm entgegen. Als sich ein Mann mit Streitaxt auf ihn stürzte, wich er reaktionsschnell aus und stach sofort zu. Dankwart drehte die Klinge in der Wunde, und der Tübinger fiel auf den felsigen Grund, der schon vom Blut glänzte.
Männer brachten sich kriechend in Sicherheit und schrien vor Schmerzen; niedersausender Stahl ließ sie für immer verstummen. Dankwart parierte einen Angriff, trat einem Tübinger in den Unterleib und stach ihm in die Seite. Plötzlich erblickte er den Herzog, der in dem Gewühl am Boden kniete. »Berthold ist verwundet!«, schrie Dankwart. »Los, kommt mit! Wir müssen zu ihm.« Scharfer Schweiß rann ihm in die Augen. Er wich einem Morgenstern aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte einem Zähringer in die Beine. Während er sich aufrappelte, hielten Leutfried und Werner ihm den Rücken frei. Schließlich erreichten sie den Herzog. Berthold hielt eine Hand auf die Schulter gepresst. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hindurch.
Dankwart ging neben seinem Herrn in die Knie und schüttelte ihn. »Hört Ihr mich?«
Der Herzog hob den Kopf. Müde Augen blickten ihn aus einem grauen Gesicht an. Er hatte viel Blut verloren. Auch aus seiner Nase tropfte es in den schwarzen Bart. »Dankwart?«
»Ich bringe Euch fort!«, sagte Dankwart und half seinem Herrn auf die Füße. »Leutfried, komm zu mir und stütz ihn! Der Herzog darf nicht in Gefangenschaft geraten.«
Während Leutfried dem Herzog unter die Achseln griff, schlugen Dankwart und Werner eine Bresche frei. Andere Zähringer eilten ihnen zur Hilfe. Aus den Reihen der Tübinger gellten Rufe: »Der Herzog flieht!... Haltet sie!... Versperrt ihnen den Weg!« Das Kampfgeschehen konzentrierte sich immer mehr um den Herzog, trotzdem erreichten die Zähringer den Felsvorsprung.
»Los, los!«, schrie Dankwart und stieß Berthold und seinen Knecht über die Kante. Für einen Augenblick verharrte er und beobachtete, wie beide den Hang hinabrollten. Unten sprang Leutfried auf die Füße und durchtrennte die Riemen der schweren Rüstungsteile mit einem Dolch, warf Helm und Bewaffnung fort, schlang sich die Arme des Herzogs um den Nacken und schleppte ihn flussabwärts.
Dankwart drehte sich um und sprang einen Soldaten an, der Werner eine Lanze in die Seite rammen wollte. Immer mehrTübinger stürmten aus dem Tor. An den Zinnen der Burgmauer postierten sich Bogenschützen, um die kämpfenden Zähringer und Welfen von den zu Hilfe eilenden Truppen abzuschneiden.
Die Übermacht wurde immer größer; der Kampf dauerte viel zu lange. Dankwart spürte, wie seine Kraft nachließ. Er konnte längst nicht mehr so gezielte Hiebe setzen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er seinen Arm nicht einmal mehr anheben konnte. Allmächtiger, dachte er und lenkte einen Speer ab. Sofort ging er zum Gegenangriff über. Bitte steh meinem Weib und den Kindern bei, wenn ich nicht mehr sein sollte. Bitte lass sie nicht ohne Schutz sein...
»Pass auf!«, brüllte Werner.
Dankwart spürte einen dumpfen Schlag in die Rippen, der ihm die Luft raubte. Das Schwert fiel ihm aus der Hand. Er hatte das Gefühl zu ersticken, er riss den Mund auf und rang nach Atem. Sein letzter Gedanke galt Agnes: Verzeih mir, dass ich dir kein besserer Ehemann war! Der nächste Schlag traf ihn am Kopf; sein Helm wurde fortgeschleudert. Mit dem Gesicht voran fiel er auf den Fels. Ein grauer Stollen verengte sich zu einem schwarzen bodenlosen Loch.
Bis zum späten Nachmittag wütete der Kampf. Dann mussten die Zähringer und Welfen die Waffen strecken. Zwei Männer packten Dankwart an den Füßen und schleiften ihn über den felsigen Grund. Sein Kopf schlug so heftig auf den Boden auf, dass er die Augen öffnete. Die Abendröte tauchte den Himmel in ein wunderschönes Licht. Erst jetzt wurde ihm seine Gefangennahme bewusst, und er griff nach dem Schwert, um den Kampf fortzusetzen, aber die Scheide war leer. »Werner!«, schrie er. »Werner, wo...« Dankwart sah nur den Schatten des Fußes, der direkt auf seinem Gesicht landete und ihm erneut das Bewusstsein raubte.
Als Dankwart erwachte, hatte er keine Ahnung, wo er sich befand. Er wusste nur, dass etwas nicht stimmte. Vorsichtig tastete er nach seiner Nase.
»Nicht!«, sagte jemand und griff ihm in denArm. Es war Werner von Schlatt, der neben ihm mit dem Rücken an einer schwarzen Bruchsteinmauer lehnte. »Ich hab sie gerichtet. Gut, dass du weggetreten warst, sonst hättest du es nicht ausgehalten.«
Dankwart erinnerte sich wieder an den Kampf und an seine Gefangennahme. Offenbar hatte man sie in den Kerker gesperrt und bis auf die wollenen Unterhemden entkleidet. Das Stroh stach ihm in die nackten Beine. »Was haben sie mit unseren Sachen angestellt?«
»Die Tübinger haben sie eingestrichen!«
Als Dankwart sich aufsetzte, spürte er ein solches Stechen im Kopf, dass ihm der kalte Schweiß ausbrach. Er biss die Zähne zusammen und der Schmerz ebbte etwas ab. Durch die Gitterstäbe fiel silbernes Mondlicht. Allmählich nahmen die anderen Gefangenen Konturen an. Ein Markgraf lief auf und ab und führte Selbstgespräche: »Das halt ich nicht aus. Ich muss hier raus. Warum bin ich nicht gefallen? Ich hätte es verdient. LieberTod als Gefangenschaft. Lieber im himmlischen Jerusalem als in diesem Kerker. Honesta mors turpi vita potior – Ein ehrenvoll er Tod ist einem schändlichen Leben vorzuziehen...«
Für einen Augenblick vergaß Dankwart die Umstände: Ein weltlicher Herr beherrschte die Sprache der Pfaffen. Das war sehr ungewöhnlich!
»So geht das schon seit Stunden«, sagte Werner. »Am besten stopft ihm einer das Maul, sonst macht er uns noch alle verrückt.«
»Was ist eigentlich geschehen?«, fragte Dankwart und spürte, wie ihm übel wurde.
»Ich weiß nur, dass unsere Männer geflüchtet sind. Der Tübinger hat viele Gefangene gemacht. Solange er auf ein Lösegeld hoffen kann, wird man uns am Leben lassen, aber wenn sich die Verhandlungen in die Länge ziehen, dann gnade uns Gott. Die Wärter haben mehrere Kameraden verloren und heizen sich schon gegenseitig auf.«
Die Foltermethoden waren allgemein bekannt. In erster Linie verfolgten sie das Ziel, den Stolz der Gefangenen zu brechen. Stundenlange Vergewaltigungen waren nichts Ungewöhnliches. Fand sich unter den Wärtern niemand, der es gerne mit Männern trieb, rammte man den Ausgelieferten einen Knüppel in den Anus oder man zwang sie, Kot zu schlucken. Verweigerte sich jemand den grausamen Spielen, hängte man ihn an den Hoden auf, bis sie abrissen. Dankwart entsann sich der Worte seines Weibes: Wenn du mit dem Herzog ziehst, versündigst du dich und Gott muss dich bestrafen. Jäh drehte sich das Innere seines Magens um. Saure Flüssigkeit füllte seinen Mund. »Ist der Herzog davongekommen?«
»Es wäre besser für uns«, erwiderte Werner.
Auf allen vieren kroch Dankwart vor und erbrach sich in die Bodenstreu. Kaum jemand nahm Notiz davon. Der Gestank war sowieso unerträglich.
Werner scharrte etwas Stroh über das Erbrochene, griff Dankwart unter die Achseln und schleppte ihn zurück. »Ruh dich aus! Wir werden unsere Kräfte noch brauchen!«
Dankwart bettete den Hinterkopf auf das Stroh und starrte in das dunkle Gewölbe. In den vergangenen Wochen hatte er so viel Herzenskraft aufgewendet, um den Widerreden seines Weibes standzuhalten, um seinen Ahnen keine Schande zu bereiten und um dem feigen Geschwätz der anderen Krieger entgegenzuwirken. Und wofür? Um anderen Kriegern das Schwert in die Eingeweide zu stechen, um sich in ihrem Blut zu suhlen und am Ende in einer Folterkammer zu verrecken! Hatte seine Ehefrau am Ende doch Recht gehabt? Hatte er ihr gemeinsames Leben, das so reich an reinen und erbaulichen Momenten gewesen war, leichtfertig aufs Spiel gesetzt?
Dankwart konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, was richtig und was falsch war, aber eines wusste er mit Sicherheit: Alle Schmerzen würde er aushalten, alle vorstellbaren und unvorstellbaren Grausamkeiten über sich ergehen lassen, nur um nach Aue zurückzukehren.
4.
Agnes drückte die Äste eines Stachelbeerstrauches zur Seite und trat auf eine Waldlichtung. Es war November und schon kalt. Zwei äsende Rehe sahen kurz auf und suchten mit großen Sprüngen das Weite. Kahle Äpfel-, Birnenund Pflaumenbäume standen neben einer Holzhütte. Das Dach war mit Grassoden eingedeckt worden. Agnes ging über die freie Fläche und schlug mit der flachen Hand gegen die Tür. Als sie keine Antwort erhielt, betrat sie den Wohnraum.
»Herrin!«, rief die Hebamme erschrocken. »Ihr seid es!« Die alte Frau stand mit einer Kelle über einem Kessel mit blubberndem Brei, der einen beißenden Geruch verströmte. »Haben die Zwillinge Ohrensausen? Oder ist etwas mit Eurem Ehemann? Ist er endlich heimgekehrt?«
Bei der Erwähnung Dankwarts musste Agnes schlucken. Seit der Tübinger Fehde fehlte jedes Lebenszeichen von ihm. Sie wusste nicht, ob er gefallen war, ob er mit einer schwärenden Wunde irgendwo siechte oder ob er im Tübinger Kerker langsam zugrunde ging. Die Berichte von Leutfried und anderen Zähringern widersprachen einander so stark, dass sie immer neue Fragen aufwarfen, anstatt sein Schicksal zu klären. »Ich bin gekommen, um dir einen Handel vorzuschlagen. Du bringst mir alles bei, was du über Heilkräuter weißt, und ich entlohne dich dafür.«
»Herrin, ich weiß nicht, ob das eine gute...«
»Ich will dir die Bauern nicht abspenstig machen. Sie sollen dich weiterhin um Rat fragen und dich für deine Medizin bezahlen. Ich brauche nur etwas, um meinen Geist...« Agnes unterbrach sich. Niemand durfte erfahren, dass die quälende Ungewissheit ihr langsam den Verstand raubte.
»Ihr wisst ja«, sagte die Hebamme, »dass ich sehr beschäftigt bin.«
»Natürlich«, erwiderte Agnes. Weil ihr die Ruhe zu Verhandlungen fehlte, lenkte sie schnell in die Forderungen der alten Frau ein. Das Herdfeuer spendete nur unruhiges Licht, deshalb setzten sie sich auf eine Strohmatte ins Gras. Am Himmel zogen stahlgraue, dräuende Wolken vorüber. Böen rüttelten an den Bäumen. Irgendwo hackte ein Specht in einen Stamm. Die Hebamme griff in den Weidenkorb und zog einen Zweig mit hellgrünen, länglichen und nach innen gebogenen Blättern heraus.
»Diese Pflanze hab ich erst gestern geschnitten. Ihr wisst sicher, wie sie genannt wird.«
»Das ist eine Mistel.«
Die Hebamme lächelte wohlwollend und zeigte ihren zahnlosen Oberkiefer. »Man nennt sie auch Affalter, Drudenfuß, Geißkraut oder Hexenbesen. Die Mistel ist eine wundersame Pflanze, die erst in den Wintermonaten sichtbar wird, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren. Ihr findet sie vorwiegend auf Tannen, Pappeln und Robinien, manchmal auch auf Ebereschen, Kiefern und Weiden. Ihr müsst darauf achten, dass sie nicht auf die Muttererde fällt, sonst büßt sie ihre Heilkraft ein.«
»Welche Wirkung hat sie?«
»Ihr könnt sie getrost gegen jedes Gebrechen einsetzen. Ich hab sie schon bei Weißfluss, Verstopfungen, Fieber und Gelenkentzündungen verabreicht. Eigentlich benutze ich sie immer, wenn ich das passende Kraut nicht zur Hand habe.«
»Auf dem Markt erzählen die Händler, dass sie giftig wäre.«
»Deshalb dürft Ihr das Gebräu immer nur als Kaltauszug ansetzen. In frischem Brunnenwasser lösen sich die gefährlichen Stoffe nicht auf...«
Die Hebamme erwies sich als kundige Lehrerin. Agnes prägte sich das Aussehen und die Eigenheiten der Pflanzen ein: Das Gartenbingelkraut durfte nur getrocknet verwendet werden und half gegen Husten. Die Blutwurz, eine mittelgroße, verästelte Pflanze mit gelben Blüten, linderte Entzündungen im Mund- und Rachenraum und stillte Blutungen. Die Wurzeln der weißen Lichtnelke fanden sich vorwiegend an Ackerrändern. Den ausgepressten Saft rieb man auf Hautausschläge und Flechten.
Agnes dankte dem Allmächtigen, dass ihr Denken endlich fruchtbare Wege beschritt, und ließ sich immer neue Fragen einfallen. Ihr Wissensdurst kannte keine Grenzen. Erst als die Sonne versank, nahm sie der Hebamme das Versprechen ab, morgen auf die Adlerburg zu kommen, um den Unterricht fortzusetzen. Agnes verabschiedete sich und begab sich auf den Heimweg. Zügig schritt sie über Steine, Moos und Wurzeln. Natürlich wusste sie, dass man nach Einbruch der Dunkelheit den Wald möglichst meiden sollte, aber die Lektionen hatten sie so beansprucht, dass sie die Gefahren vergessen hatte. Neben einer gespaltenen Eiche wuchsen zahlreiche Pilze, die im Zwielicht silbergrau schimmerten. Ein schwarzes Bodenloch führte in das Innere eines Dachsbaus.
Da ertönte ein Knurren.
Agnes tastete die Umgebung mit den Augen ab. Die hellen Stämme eines Birkenhains hoben sich aus der Dämmerung, gleich daneben zeichnete sich die runde Silhouette eines Busches ab und links davon, drei Ellen über dem Grund, blitzten rote Augen. Agnes zwang sich dazu, ruhig und gleichmäßig weiterzugehen. Wenn sie Furcht zeigte und Hals über Kopf flüchtete, verhielt sie sich wie ein Beutetier. Sie richtete den Blick geradeaus, bekreuzigte sich und sprach mit fester Stimme: »Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. DeinWille geschehe wie im Himmel so auf Erden...« Im Umhängebeutel tastete ihre Hand nach dem Dolch.
Früher konnten weder die Gefahren der Natur noch die Anfeindungen der Hörigen sie aus der Fassung bringen. Vor nichts und niemandem hatte sie Angst, denn sie wusste nur zu gut, dass es nur eines Wortes von ihr bedurfte, damit Dankwart sich drohend neben ihr aufbaute. Sein Mut färbte in all den Jahren auf sie ab und verlieh ihr auch in brenzligen Situationen Kaltblütigkeit.
Alles hatte sich verändert.
Als das Knurren lauter wurde und es im Unterholz knackte, verlor Agnes die Nerven. Keuchend sprang sie über morsche Äste, watete durch einen Bach und gelangte schließlich zu der steilen Anhöhe. Hastig zerrte sie an Gestrüpp, Gräsern und vorstehenden Wurzeln und zog sich hoch. Schroffe Felsen ragten über ihr empor. Gelockerte Lehmbrocken und Steine rollten in die Tiefe. Als sie endlich den Pfad erreichte, richtete sie sich auf und blickte den Hang hinunter. Das Tier war ihr nicht gefolgt, aber lauerte möglicherweise noch irgendwo. Erst im Schutz des Palisadenwalls durfte sie sich sicher fühlen.
Agnes war so sehr damit beschäftigt, auf Geräusche und plötzliche Bewegungen zu achten, dass sie erst wenige Pferdelängen vor dem geschlossenenTor erkannte, dass etwas auf der Erde lag. Verdutzt blieb sie stehen. Das war weder ein Wolf noch ein Bär. Angestrengt suchte sie nach einer Erklärung und langsam glomm Hoffnung in ihr auf. Vielleicht..., dachte sie. Zuerst näherte sie sich zaghaft, Schritt für Schritt, dann stürmte sie los und fiel auf die Knie. Sie packte die Gestalt an den Schultern und drehte sie auf den Rücken.
Es handelte sich um einen Mann, der bis auf ein zerrissenes Leibchen völlig nackt war. An seinen knochigen Beinen klebte geronnenes Blut. Das Gesicht war voller roter, violetter und blauer Flecken. Es dauerte eine Weile, bis Agnes ihren Ehemann erkannte. Entsetzt schlug sie die Hände vor den Mund. »Oh Gott! Was haben sie dir angetan? Was haben sie dir nur angetan?« Sie umarmte Dankwart und hob seinen Kopf auf ihren Schoß. Zärtlich schmiegte sie ihre Stirn an seine kalte Wange und wiegte ihn hin und her. »Ich hab dich so vermisst, so unfassbar vermisst! Endlich bist du wieder da!«Warum reagierte er nicht?Warum hing er so schlaff in ihren Armen und gab kein Lebenszeichen von sich? Mit zitternden Fingern tastete Agnes nach seinem Hals. Der Puls war fühlbar, schwach zwar, aber das Herz schlug noch. »Heinrich!«, schrie sie. »Leutfried! Kommt schnell her! Ihr müsst mir helfen!«
5.
Drei Wochen später ritten Dankwart und Agnes auf den Burghof des Herzogs von Zähringen. Zahllose Pechfackeln erhellten die graue Wehrmauer, das Gesindehaus und die Kapelle. Ein Pferdeknecht eilte herbei und griff nach dem Zaumzeug. Agnes rutschte vom Pferderücken und reichte Dankwart den Arm hoch.
»Lass es gut sein«, sagte der. »Ich muss es alleine schaffen!«
Mühsam hob er ein Bein über den Rücken des Hengstes und setzte den Fuß ab. Als das Schlachtross scheute, verlor Dankwart das Gleichgewicht – der andere Fuß klemmte noch im Steigbügel. Die Adern an Schläfen und Stirn traten deutlich hervor.
Agnes wollte ihn stützen, aber Dankwart ließ es nicht zu. »Nein, hab ich gesagt!«
»Der Herzog hat sich nach Euch erkundigt«, sagte der Pferdeknecht. »Er will Euch im Steinsaal empfangen. Den Palassaal sollt Ihr nicht betreten! Mit seinem Anblick will er Euch überraschen.«
»Warum schenkt uns der Herzog so viel Beachtung?«, fragte Agnes.
»Das erfahren wir noch früh genug«, erwiderte Dankwart und ordnete seine Tunika. Er winkelte seinen Unterarm an, damit Agnes ihre Hand darauf legen konnte. Zwei Freitreppen führten an der Vorderseite in den Palas, dicker roter Stoff verhängte die Portale. Dankwart humpelte los. Bei jedem Schritt straffte sich sein Hals. Im Tübinger Kerker hatte er fast die Hälfte seines Körpergewichts eingebüßt. Seine Kniegelenke waren dicker als die Schenkel, die Tunika flatterte lose um die knochigen Schultern. Wenn Agnes nach Einzelheiten der Gefangenschaft fragte, blieben seine Lippen verschlossen. Nicht etwa, weil er ihr etwas verschweigen wollte, sondern weil er sich bemühte, das Vergangene aus seinem Gedächtnis zu tilgen. Nichts sollte ihn daran erinnern, was im Kerker geschehen war.
Zitternd schob er den Vorhang zur Seite und trat in den Steinsaal, den viele mehrarmige Kerzenständer in einen warmen Schein tauchten. Die Anwesenden hielten in ihren Gesprächen inne und musterten sie. Der Herzog von Zähringen stürzte aus der Menge hervor, blieb vor seinem Dienstmann stehen und betrachtete ihn erschrocken. »Hauptsache, du lebst«, sagte er dann. »Alles andere kommt in Ordnung. Komm mit, die anderen sind schon da.« Der Herzog schob seinen Dienstmann in den Kreis der Krieger. »Seht, wer gekommen ist!«
Nach der allgemeinen Begrüßung berichtete Berthold, wie die Lösegeldzahlung schließlich zur Befreiung der Gefangenen geführt hatte. Dankwart erblickte in einer Ecke Werner von Schlatt. Ohne auf die höfischen Regeln zu achten, humpelte er zu ihm hinüber. Die Gefangenschaft hatte auch den Gefährten gezeichnet. Unter seinen Augen lagen dunkle Ringe, die Gesichtshaut glänzte wächsern.
Nun, da Dankwart ihm gegenüberstand, wurde ihm bewusst, wie verbunden er sich dem Freund fühlte. Tag für Tag hatten sie den Grausamkeiten getrotzt und zueinander gehalten. Tag für Tag hatten sie sich gegenseitig Hoffnung gegeben. Sie mussten keine großen Worte machen. Zwischen ihnen herrschte ein stilles Einverständnis: Was ihnen die Zukunft auch bringen mochte – sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten.