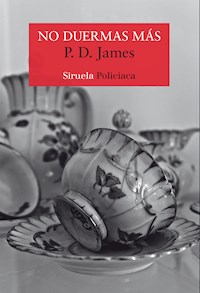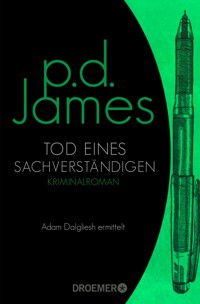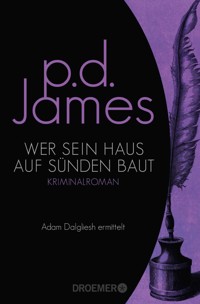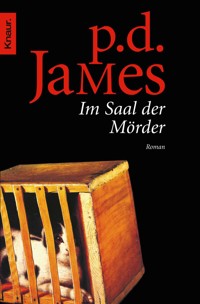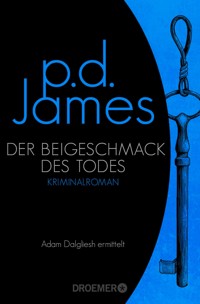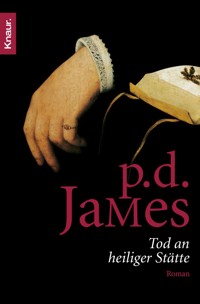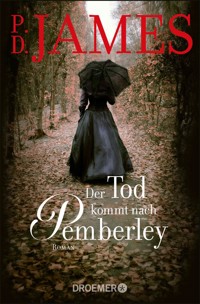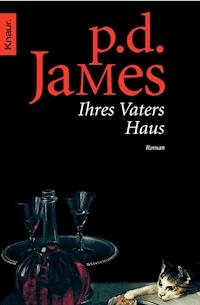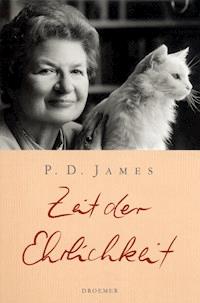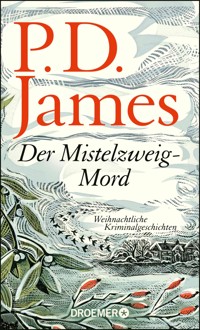
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Für alle Liebhaber klassischer Kriminal-Romane gibt es noch einmal Neues von P. D. James zu entdecken: vier Krimi-Kurzgeschichten, die im Laufe der Jahre für Weihnachts-Ausgaben verschiedener Zeitschriften und Magazine entstanden sind, drei davon hier erstmals auf Deutsch. Mit einem Geleitwort von Val McDermid. •»Der Mistelzweig-Mord«, die titelgebende Story, handelt von einer Weihnachtsfeier im Landhaus, die unter keinem guten Stern steht •In »A Very Commonplace Murder« geht es um eine illegale Affäre, die mit Mord endet •Und »The Boxdale Inheritance« und »The Twelve Clues of Christmas« sind neue Fälle für P. D. Jamesʼ Kult-Ermittler Commander Adam Dalgliesh, der längst in die Krimi-Literaturgeschichte eingegangen ist Diese vier Weihnachts-Krimis zeigen das ganze Können der englischen Bestseller-Autorin P. D. James, von ihrem eleganten Stil über ihre Akribie bis zum unbestechlichen Blick hinter alle Fassaden. Commander Adam Dalgliesh ermittelt in 14 Kriminalromanen: 1.Ein Spiel zuviel 2.Eine Seele von Mörder 3.Ein unverhofftes Geständnis 4.Tod im weißen Häubchen 5.Der schwarze Turm 6.Tod eines Sachverständigen 7.Der Beigeschmack des Todes 8.Vorsatz und Begierde 9.Wer sein Haus auf Sünden baut 10.Was gut und böse ist 11.Tod an heiliger Stätte 12.Im Saal der Mörder 13.Wo Licht und Schatten ist 14.Ein makelloser Tod
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
P. D. James
Der Mistelzweig-Mord
Weihnachtliche Kriminalgeschichten
Aus dem Englischen von Christa E. Seibicke und Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Weihnachtsfeier im Landhaus, die unter keinem guten Stern steht. Eine illegale Affäre, die mit Mord endet. Ein früher und ein später Fall für Commander Adam Dalgliesh … P. D. James wurde immer wieder gebeten, weihnachtliche Kriminalstorys für Zeitschriften und Magazine zu schreiben. In diesen vier sehr unterschiedlichen Kurzkrimis – drei davon erscheinen hier erstmals auf Deutsch – zeigt sich all das, was P. D. James zur »Queen of Crime« machte: ihr eleganter Stil, ihre Akribie und vor allem ihr unbestechlicher Blick hinter alle Fassaden der englischen Gesellschaft.
Inhaltsübersicht
Zum Geleit
Vorwort
Der Mistelzweig-Mord
Ein ganz banaler Mord
Das Boxdale-Erbe
Die zwölf Weihnachtsindizien
Nachweis
Zum Geleit
P. D. James hat, wie viele Kriminalschriftsteller, durch Liebe zu ihrer Berufung gefunden. Bevor sie selbst zum Stift griff, hat sie begierig Detektivromane gelesen, und während ihrer gesamten Laufbahn als Autorin konnte sie sich für das sogenannte Goldene Zeitalter der Kriminalliteratur, also die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, begeistern. Allerdings war sie mehr als ein Fan. Sie las mit scharfem Verstand und entwickelte sich zur Expertin. Vor Jahren habe ich ihre Vorlesung über die vier Queens of Crime gehört – Dorothy L. Sayers, Agatha Christie, Margery Allingham und Ngaio Marsh –, und sie hat eine beeindruckende Monografie zum Thema verfasst: Talking About Detective Fiction. Diese Liebe zum Werk ihrer Vorgängerinnen ist in den vorliegenden Kurzgeschichten deutlich zu spüren: Sie bedient sich bei den Plot-Techniken des Goldenen Zeitalters, es gibt Bezugnahmen auf Agatha Christie und gelegentlich ein wissendes Nicken, was die Regeln des traditionellen Cosy-Krimis angeht.
Dass sie die Konventionen des Althergebrachten einhält, verleitet manchen Leser dazu, P. D. James für eine gemütliche – cosy – Autorin zu halten. In Wahrheit war sie alles andere als das, und wenn sie auf diese Konventionen zurückgreift, dann oft nur, um sie auf raffinierte Weise zu unterminieren. Und eins unterscheidet P. D. James ganz klar von der Mainstream-Tradition des Goldenen Krimi-Zeitalters mit seinen Herrensitzen und spießigen Dörfern, in denen die raue Wirklichkeit sich nicht blicken lässt: Sie weiß, dass Mord hässlich ist und brutal, dass er aus denkbar finsteren Motiven heraus geschieht, und sie schreckt nicht davor zurück, es direkt mit dieser Finsternis aufzunehmen. Ihre Analyse dessen, was sie oft »Bosheit« oder »Gemeinheit« nannte, ist beunruhigend scharf. Sosehr die Settings dieser Storys auch an die Vorläufer erinnern – an den Morden, die hier geschehen, ist nichts Gemütliches.
Genau diese Settings sind ein weiteres Markenzeichen des Werks von P. D. James. All ihre Geschichten sind, was Zeit und Ort angeht, klar umrissen. Durch akribische Beschreibung schafft sie eine Szenerie, in der wir dem Verlauf der Ereignisse mühelos folgen können. Ja, sie lässt diese Szenerien für sich arbeiten: Sie erzeugen Atmosphäre und liefern oft Andeutungen dessen, was kommt. Zum Beispiel, wenn wir Stutleigh Manor zum ersten Mal erblicken: »Zuerst war da nur eine nüchterne Silhouette, die aus der Dunkelheit gegen den grauen, spärlich besternten Himmel aufragte. Doch dann trat der Mond hinter einer Wolke hervor, und in sein weißes Licht getaucht, erschien das Herrenhaus ebenmäßig, schön und geheimnisvoll.« Sofort wissen wir, dass ein rätselhaftes Unheil droht.
Sie kannte sich mit Gemeinheit aus, aber genauso sicher wusste P. D. James, welche enorme Bedeutung ein guter Ruf hat. Sie hat über Menschen geschrieben, die bereit sind, für ihre Reputation, ihren Status, zu töten, dies jedoch nie auf ordinäre Weise tun würden. Ihre elegante Prosa behandelt den Leser stets fair, und zugleich wiegt sie uns in falscher Sicherheit, genau wie ihre Mörder es versuchen. Hinter harmlosen Fassaden bauen sich Bosheit und Ungewissheit auf und lenken uns in dunkle, schreckliche, beängstigende Gefilde. Und das Ganze immer schön beschrieben. Zu einer Zeit, da wir dachten, wir würden nie wieder etwas Neues von P. D. James lesen, sind diese Storys ein wunderbares Geschenk.
Val McDermid
Vorwort
In ihrem Vorwort zu einer 1934 erschienenen Anthologie mit Krimi-Kurzgeschichten schrieb Dorothy L. Sayers: »Es scheint, als habe der angelsächsische Menschenschlag an keinem anderen Thema ein so aufrichtiges wie unschuldiges Vergnügen wie an Mord und Totschlag.« Damit meinte sie natürlich nicht die erschreckenden, schmutzigen, manchmal auch erbärmlichen Morde im richtigen Leben; vielmehr bezog sie sich auf die rätselhaften, elegant konstruierten und äußerst populären Erfindungen von Kriminalschriftstellern. Vielleicht ist »Vergnügen« nicht ganz das richtige Wort; passender wären »Unterhaltung«, »Entspannung« oder auch »Erregung«. Im Übrigen zeigt die allgemeine Beliebtheit von Kriminalromanen, dass nicht nur die Angelsachsen sich für schändliche Morde begeistern können. Millionen Leser weltweit fühlen sich in Sherlock Holmes’ vollgestopftem Arbeitszimmer in der Baker Street 221b, Miss Marples hübschem Cottage in St. Mary Mead und Lord Peter Wimseys eleganter Wohnung am Piccadilly wie zu Hause.
In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sind innerhalb der Kriminalliteratur besonders viele Kurzgeschichten entstanden. Die beiden Schriftsteller, die als Gründungsväter der Detektivgeschichte gelten können, Edgar Allan Poe und Sir Arthur Conan Doyle, waren Meister dieser Form, und Ersterer lässt die wesentlichen Merkmale nicht nur der Krimi-Kurzgeschichte, sondern auch des Kriminalromans bereits erahnen: den am wenigsten Verdächtigen, der dann doch der Mörder ist; das kriminalistische Rätsel im geschlossenen Raum; den Detektiv, der den Fall im Lehnstuhl sitzend löst; die Verwendung von Briefen als narratives Mittel. Eric Ambler schrieb: »Es mag der Geist von Edgar Allan Poe gewesen sein, der die Detektivgeschichte geboren hat, aber die Stadt London war es, die sie genährt, gekleidet und großgezogen hat.« Dabei dachte er natürlich an den genialen Conan Doyle, Schöpfer des berühmtesten Detektivs der Literaturgeschichte. Sein Vermächtnis an das Genre sind Respekt vor der Vernunft, eine nicht-abstrakte Betonung des Verstandes, Vertrauen eher in logisches Schlussfolgern als in physische Stärke, Abscheu gegenüber jeglicher Sentimentalität und die Gabe, eine geheimnisvolle, ganz und gar unheimliche Atmosphäre zu schaffen, die dennoch fest in der physischen Wirklichkeit verwurzelt ist. Vor allem aber hat er mehr als irgendein Autor sonst zur Tradition des großen Detektivs beigetragen, jenes allwissenden Amateurs, dessen exzentrische, zuweilen schrille Persönlichkeit in schönem Kontrast zur Rationalität seines Vorgehens steht und der dem Leser die tröstliche Gewissheit liefert, dass wir trotz aller scheinbaren Ohnmacht in einer Welt leben, die verstehbar ist.
Die Sherlock-Holmes-Geschichten sind zweifellos die bekanntesten aus jener Zeit, aber es gibt neben ihnen noch andere, die es wert sind, erneut gelesen zu werden. Julian Symons, angesehener Kritiker und Krimi-Experte, hat ausgeführt, dass die meisten bedeutenden Akteure des Kurzgeschichtenfachs im Schreiben über Ermittler eine Erholung von dem sahen, woran sie sonst arbeiteten, und es als ein Format zu schätzen wussten, das noch in den Kinderschuhen steckte und ihnen damit unendliche Möglichkeiten eröffnete, originell und variantenreich zu sein. G. K. Chesterton beispielsweise war ein Autor, dessen Hauptinteresse anderen Dingen galt, dessen Father-Brown-Storys aber bis heute sehr gern gelesen werden. Und es ist erstaunlich, wie viele hervorragende Schriftsteller sich an Krimikurzgeschichten versucht haben. Im zweiten, 1931 erschienenen Band mit Great Stories of Detection, Mystery and Horror finden sich unter den Mitwirkenden – neben denen, die man ohnehin dort erwartet – Autoren wie H. G. Wells, Wilkie Collins, Walter de la Mare, Charles Dickens und Arthur Quiller-Couch.
Kaum jemand unter den zeitgenössischen Krimiautoren steht nicht unter dem Einfluss dieser »Urväter«, allerdings werden heute eher Kriminalromane geschrieben als Kurzgeschichten. Das mag damit zu tun haben, dass der Markt für Kurzgeschichten allgemein geschrumpft ist. Der Hauptgrund aber ist vermutlich der, dass die Detektivgeschichte sich der gängigen erzählenden Literatur deutlich angenähert hat und die Autoren Raum brauchen, um alle Facetten ihrer Figuren psychologisch auszuleuchten, das komplexe Geflecht von Beziehungen zwischen ihnen darzustellen und zu beschreiben, welche Auswirkungen der Mord und die polizeilichen Ermittlungen auf diese Figuren haben.
Der Rahmen der Short Story ist naturgemäß begrenzt, und das bedeutet, dass sie am besten funktioniert, wenn sie sich auf ein Ereignis oder eine Idee konzentriert. Dabei sind die Originalität und die Kraft dieser Idee für den Erfolg der Geschichte maßgeblich. Obgleich im Aufbau weitaus weniger komplex als ein Roman, eher linear angelegt und direkt auf die Auflösung zusteuernd, vermag die Kurzgeschichte sehr wohl innerhalb ihrer engeren Grenzen eine glaubwürdige Welt erstehen zu lassen, die der Leser betreten kann und in der er findet, was wir von einem guten Krimi erwarten: ein plausibles Rätsel, Spannung und Aufregung, Figuren, mit denen wir uns identifizieren können, auch wenn wir nicht alle unbedingt mögen, und einen Schluss, der uns nicht enttäuscht. Es ist eine Kunst und zugleich sehr befriedigend, alle Elemente, die eine gute Kriminalgeschichte ausmachen – Plot, Setting, Figurenzeichnung und überraschendes Moment –, in ein paar Tausend Wörter zu packen.
Ich habe zwar vor allem Romane geschrieben, das Verfassen von Short Storys aber immer als Herausforderung im besten Sinne betrachtet. Es gilt, mit begrenzten Mitteln viel zu schaffen. Für lange, detailreiche Beschreibungen von Örtlichkeiten ist kein Platz, dennoch muss die Szenerie für den Leser plastisch werden. Die Zeichnung der Figuren ist in der Kurzgeschichte so wichtig wie im Roman, aber hier müssen die Grundzüge einer Persönlichkeit mit wenigen Worten umrissen werden. Der Plot muss tragen, darf jedoch nicht zu komplex sein, und die Auflösung, auf die jeder einzelne Satz der Erzählung zusteuern sollte, muss den Leser überraschen, ohne dass er sich hintergangen fühlt. Alles zusammen sollte den besonderen Reiz der Short Story ergeben: die vollkommene Überraschung. Eine gute Kurzgeschichte zu schreiben ist also schwer, sie zu lesen kann aber in diesen hektischen Zeiten ein äußerst befriedigendes Erlebnis sein.
P. D. James
Der Mistelzweig-Mord
Zu den kleineren Irritationen im Leben eines erfolgreichen Kriminalschriftstellers gehört die immer wiederkehrende Frage: »Und waren Sie im wirklichen Leben auch schon mal in einen Mordfall verwickelt?« Wobei Blick und Ton des Fragestellers mitunter zu verstehen geben, es könnte wohl nicht schaden, würde das Morddezernat der Metropolitan Police einmal in meinem Garten graben. Ich habe stets verneint, teils aus Diskretion, teils weil die wahre Geschichte zu viel Zeit in Anspruch nähme und meine Rolle darin selbst aus der Distanz von sechzig Jahren nur schwer zu rechtfertigen ist. Heute aber, als Achtzigjährige und einzige Überlebende jenes denkwürdigen Weihnachtsfestes von 1940, darf ich sie wohl getrost erzählen, und sei es nur mir selbst zu Gefallen. »Der Mistelzweig-Mord«, so soll sie heißen. Misteln kommen darin nur am Rande vor, aber ich hatte schon immer eine Schwäche für Alliterationen im Titel. Die Personennamen sind geändert. Zwar ist niemand mehr am Leben, der sich bloßgestellt fühlen oder dessen Ruf Schaden nehmen könnte, doch warum sollte man auf das Ansehen der Toten weniger Rücksicht nehmen?
Ich war achtzehn, als es geschah, eine junge Kriegerwitwe; mein Mann war zwei Wochen nach unserer Hochzeit gefallen, einer der ersten Piloten der Royal Air Force, die im Einzeleinsatz abgeschossen wurden. Danach meldete ich mich als Luftwaffenhelferin, zum einen, weil ich mir einredete, dass Alastair sich darüber gefreut hätte, vor allem aber aus dem Bedürfnis heraus, in einem neuen Wirkungskreis mit neuen Pflichten meine Trauer zu lindern. Was jedoch nicht gelang. So ein schmerzlicher Verlust ist wie eine schlimme Krankheit. Entweder man stirbt daran, oder man überlebt, und heilen kann sie nur die Zeit, nicht aber ein Tapetenwechsel. Den Ausbildungskurs absolvierte ich wild entschlossen, bis zum Ende durchzuhalten, doch als sechs Wochen vor Weihnachten die Einladung meiner Großmutter kam, sagte ich erleichtert zu. Damit war ein Problem gelöst. Ich hatte keine Geschwister, und mein Vater, ein Arzt, war trotz seines fortgeschrittenen Alters freiwillig als Rekrut zur Sanitätstruppe gegangen; meine Mutter hatte sich nach Amerika abgesetzt. Zwar hatten etliche Schulfreunde, darunter auch einige im Militärdienst, mich zu sich nach Hause eingeladen, aber ich fühlte mich nicht einmal den gedämpften Festlichkeiten einer Kriegsweihnacht gewachsen und fürchtete, ihnen und ihren Familien die Feiertage zu verderben.
Außerdem war ich neugierig auf das Haus, in dem meine Mutter aufgewachsen war. Mit der eigenen Mutter hatte sie sich nie verstanden, und nach ihrer Heirat kam es endgültig zum Bruch. Ich war meiner Großmutter nur einmal als Kind begegnet und hatte sie als eine furchterregende, scharfzüngige Frau in Erinnerung, die junge Leute nicht besonders mochte. Aber jetzt war ich nicht mehr jung, außer an Jahren, und was ihr Brief in dezenten Andeutungen verhieß – ein warmes Haus mit prasselnden Kaminfeuern, nahrhafte Kost und guten Wein, Ruhe und Frieden –, war genau das, wonach ich mich sehnte. Weitere Gäste waren nicht vorgesehen, aber mein Vetter Paul hoffte, an Weihnachten Urlaub zu bekommen. Ich hatte nur noch diesen einen Vetter und war sehr gespannt auf ihn. Paul war der jüngere Sohn des Bruders meiner Mutter und etwa sechs Jahre älter als ich. Nicht nur wegen der Familienfehde, sondern auch, weil seine Mutter Französin war und er einen Großteil seiner Kindheit in ihrer Heimat verbrachte, hatten wir einander nie kennengelernt. Sein älterer Bruder war gestorben, als ich noch zur Schule ging. Ich erinnerte mich dunkel an irgendein unrühmliches Geheimnis, das hinter vorgehaltener Hand kolportiert, aber nie gelüftet wurde. Wie Großmutter mir in ihrem Brief versicherte, würden außer uns dreien nur der Butler Seddon und seine Frau zugegen sein. Sie hatte sich die Mühe gemacht, einen Überlandbus herauszusuchen, der an Heiligabend um fünf Uhr nachmittags von der Victoria Station abfuhr und mich bis zur nächstgelegenen Ortschaft bringen würde, wo Paul mich abholen sollte.
Der entsetzliche Mord und der Stunde um Stunde in äußerster Spannung durchlebte traumatische Tag danach haben meine Erinnerung an Reise und Ankunft verwischt. Von Heiligabend sind mir eine Reihe unzusammenhängender, leicht surrealer Bilder wie aus einem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film im Gedächtnis geblieben. Der verdunkelte Bus, der mit abgeblendeten Scheinwerfern unter einem schwankenden Mond durch die unbeleuchtete, öde Landschaft kriecht; die hochgewachsene Gestalt meines Vetters, der mir an der Endstation aus dem Dunkel entgegentritt; ich, in eine Wolldecke gehüllt, auf dem Beifahrersitz seines Sportwagens während der Fahrt durch nachtschwarze Dörfer, die schemenhaft aus dem Schneegestöber auftauchen. Eins aber sehe ich klar und wundersam vor mir: meine erste Begegnung mit Stutleigh Manor. Zuerst war da nur eine nüchterne Silhouette, die aus der Dunkelheit gegen den grauen, spärlich besternten Himmel aufragte. Doch dann trat der Mond hinter einer Wolke hervor, und in sein weißes Licht getaucht, erschien das Herrenhaus ebenmäßig, schön und geheimnisvoll.
Fünf Minuten später folgte ich dem kleinen Lichtkegel von Pauls Taschenlampe ins Portal mit seinem rustikalen Sammelsurium von Spazierstöcken, derben Schuhen, Gummistiefeln und Regenschirmen und gelangte durch den Verdunkelungsvorhang in die angenehm warme, hell erleuchtete quadratische Halle. Ich erinnere mich an das mächtig lodernde Holzfeuer im Kamin, an die Familienporträts, das komfortable, aber schon etwas heruntergekommene Ambiente sowie an die Stechpalmen- und Mistelzweigsträußchen über Bildern und Türen, die den einzigen Weihnachtsschmuck darstellten. Meine Großmutter kam gemessenen Schrittes die breite Holztreppe herab, um mich zu begrüßen. Sie war zierlicher, als ich sie in Erinnerung hatte, feingliedrig und so klein, dass sie nicht einmal an mich mit meinen knapp ein Meter sechzig heranreichte. Doch ihr Händedruck war erstaunlich fest, und ein Blick in ihre scharfen, klugen Augen verriet mir ebenso wie der gebieterische Zug um ihren Mund, den ich so gut von meiner Mutter kannte, dass sie immer noch zum Fürchten war.
Ich war froh, hier zu sein, froh, zum ersten Mal mit meinem einzigen Vetter zusammenzutreffen, aber in einem Punkt hatte meine Großmutter mich getäuscht. Es gab nämlich noch einen zweiten Gast, einen entfernten Verwandten, der mit dem Wagen aus London gekommen und vor mir eingetroffen war. Rowland Maybrick wurde mir vorgestellt, als wir uns vor dem Abendessen in einem Salon links von der großen Halle zum Aperitif versammelten. Ich mochte ihn auf Anhieb nicht und war meiner Großmutter dankbar dafür, dass sie nicht vorgeschlagen hatte, er solle mich in seinem Auto mitnehmen. Die grobe Taktlosigkeit, die er gleich bei der Begrüßung beging – »Du hast mir ja gar nicht gesagt, Paul, dass ich bei euch auf so eine hübsche junge Witwe treffen würde« –, bestätigte mein Vorurteil gegen diesen Typus Mann, oder was meine jugendliche Intoleranz dafür hielt. Maybrick trug die Uniform eines Fliegerleutnants, aber ohne Pilotenschwingen – Wingless Wonders lautete unser Spitzname für diese Truppe. Er war dunkelhaarig, gutaussehend, mit vollen Lippen unter einem dünnen Schnurrbart, mit amüsiert forschendem Blick und siegessicherem Auftreten. Männer seines Schlages waren mir nicht fremd, in Stutleigh Manor hätte ich so jemanden allerdings nicht erwartet. Wie ich erfuhr, handelte er im Zivilleben mit Antiquitäten. Paul spürte vielleicht meine Enttäuschung darüber, nicht der einzige Gast zu sein, und erklärte, die Familie sehe sich genötigt, eine wertvolle Münzsammlung zu veräußern. Rowland habe man als Experten hinzugezogen, der die Stücke schätzen und einen Käufer dafür finden solle. Doch Maybrick war keineswegs nur an Münzen interessiert. Sein Blick schweifte über Möbel, Bilder, Porzellan und Bronzestatuen, die er mit langen Fingern befühlte und streichelte, als beziffere er im Geiste schon ihren Preis. Und bei entsprechender Gelegenheit hätte er sich vermutlich nicht gescheut, auch mich zu betatschen und meinen Gebrauchtwert zu taxieren.
Großmutters Butler und die Köchin, unentbehrliche Nebendarsteller eines jeden Landhaus-Mordes, waren tüchtig und respektvoll, ließen jedoch keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Meine Großmutter hätte, sofern sie sich überhaupt Gedanken darüber machte, vermutlich jeden der beiden als treu ergebenes Faktotum bezeichnet. Doch ich hatte meine Zweifel. 1940 waren die Zeiten nicht mehr so wie früher. Mrs Seddon wirkte überarbeitet und gelangweilt zugleich, eine ungute Mischung, während ihr Mann kaum den düsteren Groll desjenigen verhehlte, der weiß, wie viel mehr er als Rüstungsarbeiter auf dem benachbarten R. A. F.-Stützpunkt verdienen könnte.
Mein Zimmer gefiel mir: das Himmelbett mit den verblichenen Vorhängen, der bequeme niedrige Sessel am Kamin, der elegante kleine Schreibsekretär, die mit Fliegendreck besprenkelten Drucke und Aquarelle. Vor dem Zubettgehen knipste ich die Nachttischlampe aus und schob den Verdunkelungsvorhang zurück. Hohe Sterne und Mondschein, ein gefährlicher Himmel. Aber es war Heiligabend. Gewiss würden die Bomber heute Nacht nicht aufsteigen. Und ich stellte mir vor, wie überall in Europa Frauen die Vorhänge aufzogen und hoffend und bangend zum drohenden Mond emporblickten.
Als ich früh am nächsten Morgen erwachte, lauschte ich vergeblich auf das Geläut der Kirchenglocken – Glocken, die 1940 nicht das Weihnachtsfest, sondern die Invasion angekündigt hätten. Tags darauf ging die Polizei diesen ersten Feiertag Minute für Minute so gründlich mit mir durch, dass ich mich auch zweiundsechzig Jahre später noch an jede Einzelheit erinnern kann. Nach dem Frühstück kam die Bescherung. Für die reizende Brosche aus Gold und Emaille, die ich von meiner Großmutter erhielt, hatte sie offenbar ihre Schmuckkassette geplündert, und Pauls Geschenk, ein viktorianischer Ring mit einem von Staubperlen eingefassten Granatstein, stammte vermutlich aus derselben Quelle. Ich brauchte mit meinen Präsenten nicht zurückzustehen. Im Dienste der Familienversöhnung trennte ich mich von zwei ganz besonderen Kleinoden, einer Erstedition der Shropshire-LadGedichte für Paul und einer frühen Ausgabe von Grossmiths’ Diary of a Nobody