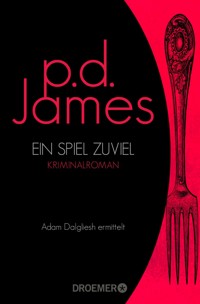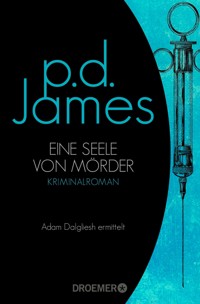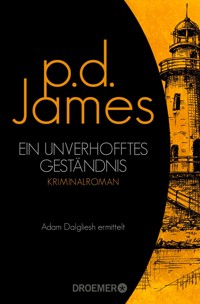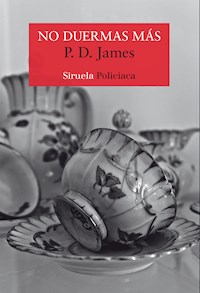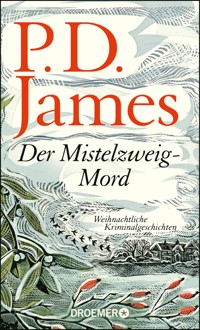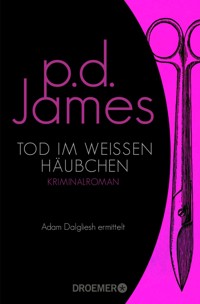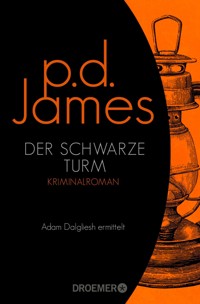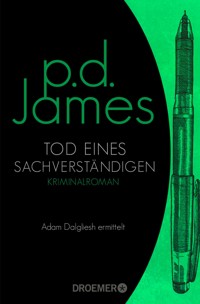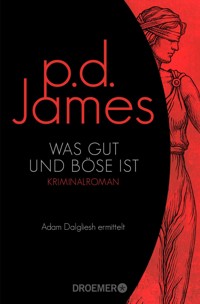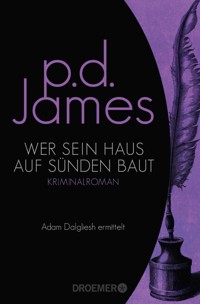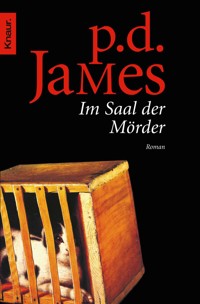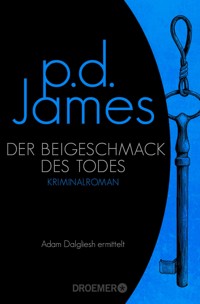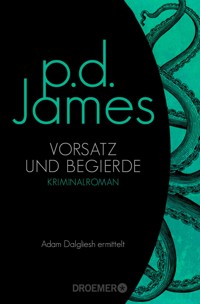
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dalgliesh-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Lustmörder und eine rätselhafte Tote - ein Fall für Commander Dalgliesh, der die idyllische Küste Norfolks erschüttert. An Norfolks beschaulicher Küste macht ein Lustmörder, genannt »Der Pfeifer«, Jagd auf junge Frauen. Als die attraktive Hilary Robarts erwürgt aufgefunden wird, nimmt man zunächst an, dass auch sie ein Opfer des Serienkillers wurde. Doch Commander Adam Dalgliesh stellt bei seinen Ermittlungen fest, dass der Pfeifer sich zum Zeitpunkt des Mordes an Hilary bereits selbst gerichtet hatte. Seine Nachforschungen führen ihn an den Arbeitsplatz der jungen Frau, die eine leitende Position in einem Atomkraftwerk innehatte. Bald wird klar, dass Hilary Robarts Geheimnisse hatte und ihr Tod mit Intrigen und Machtspielen im Kraftwerk zusammenhängt. Commander Dalgliesh muss tief in die Abgründe menschlicher Leidenschaften und Begierden eintauchen, um den wahren Mörder zu entlarven. Vorsatz und Begierde ist ein spannender Kriminalroman von Bestsellerautorin P.D. James, der Meisterin des klassischen britischen Krimis. Ein komplexer Fall für Commander Adam Dalgliesh, der in eine Welt von Hass, Machtgier und verborgenen Motiven führt - ein Muss für Fans intelligenter Ermittlungskrimis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
P. D. James
Vorsatz und Begierde
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Georg Auerbach und Gisela Stege
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Norfolks beschauliche Küste wird in den 1980er Jahren von einem Lustmörder heimgesucht, den alle nur »Der Pfeifer« nennen. Als ein Unbekannter die bildhübsche Hilary Robarts zu Tode stranguliert, geht man davon aus, dass auch sie ein Opfer des Frauenjägers wurde. Doch dann muss Commander Adam Dalgliesh feststellen, dass der Pfeifer sich zum Zeitpunkt des Mordes an Hilary bereits selbst gerichtet hatte. Wer also hat die junge Frau auf dem Gewissen?
Seine Ermittlungen führen Adam Dalgliesh bald an den Arbeitsplatz der Ermordeten, die als leitende Angestellte in einem Atomkraftwerk beschäftigt war …
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung der Autorin
Erstes Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Zweites Buch
11. Kapitel
12. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Drittes Buch
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Viertes Buch
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Fünftes Buch
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Sechstes Buch
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Epilog
Vorbemerkung der Autorin
Diese Geschichte spielt auf einer fiktiven Landzunge an der nordöstlichen Küste von Norfolk. Liebhaber dieses abgelegenen und faszinierenden Teils von East Anglia werden sie zwischen Cromer und Great Yarmouth vermuten, aber sie sollten nicht erwarten, ihre Topographie wiederzuerkennen, noch werden sie das AKW von Larksoken, das Dorf Lydsett oder die Larksoken-Mühle dort finden. Andere Örtlichkeiten sind authentisch, aber dies ist nur ein raffiniertes Mittel der Autorin, um den fiktiven Figuren und Geschehnissen zusätzliche Wirklichkeitsnähe zu verleihen. In diesem Roman sind nur die Vergangenheit und die Zukunft real; die Gegenwart und damit die Menschen und der Schauplatz existieren nur in der Vorstellung der Autorin und ihrer Leser.
Erstes Buch
Freitag, 16. September,bis Dienstag, 20. September
1
Das vierte Opfer des Whistlers war das bisher jüngste – Valerie Mitchell, fünfzehn Jahre, acht Monate und vier Tage jung. Sie musste sterben, weil sie den Bus um 21 Uhr 40 von Easthaven nach Cobb’s Marsh verpasst hatte.
Wie sonst hatte Valerie bis zur letzten Minute gezögert, die Disco zu verlassen. Auf der Tanzfläche wogte noch immer eine dicht gedrängte Masse von Körpern unter den flackernden Lichtern, als sie sich Waynes grapschenden Händen entwand, Shirl über das Musikgetöse hinweg zurief, was sie nächste Woche unternehmen könnten, und sich dann hinausstahl. Was sie von Wayne zuletzt noch sah, war sein ernstes, auf- und abhüpfendes Gesicht, auf das die kreisenden Lichter gespenstisch rote, gelbe und blaue Streifen malten. Ohne sich noch die Zeit zu nehmen, die Schuhe zu wechseln, zerrte sie in der Garderobe ihren Mantel vom Haken und rannte die Straße hinauf und an den dunklen Läden vorbei zur Bushaltestelle; die unförmige Umhängetasche schlug ihr gegen die Rippen. Als sie jedoch zur Haltestelle einbog, bemerkte sie entsetzt, dass die Lampen an den hohen Lichtmasten nur mehr eine fahlgraue, leere Fläche beschienen. An der Straßenecke sah sie gerade noch, wie der Bus bereits den Hügel hinauffuhr. Sie hatte noch eine Chance – wenn die Ampel umschaltete –, und so begann sie, zusätzlich behindert durch ihre dünnsohligen Stöckelschuhe, eine verzweifelte Verfolgungsjagd. Doch die Ampel war grün. Sie rang nach Luft, krümmte sich unter einem jähen Muskelkrampf, musste aber hilflos zusehen, wie der Bus über die Hügelkuppe schaukelte und ähnlich einem hellerleuchteten Schiff entschwand. »O nein!«, rief sie ihm nach. »Lieber Gott, nein!« Und sie spürte, wie ihr brennende Tränen in die Augen stiegen, Tränen der Wut und der Verzweiflung.
Das war das Ende. In ihrer Familie bestimmte allein der Vater die Verhaltensregeln; dagegen gab es keinen Einspruch, und man bekam auch keine zweite Chance zur Bewährung. Nach langen Diskussionen und wiederholten Bitten hatte man ihr den allwöchentlichen Besuch der von der Pfarrjugend geleiteten Disco am Freitagabend erlaubt, sofern sie verabredungsgemäß mit dem Bus um 21 Uhr 40 heimkehrte. Dieser setzte sie in Cobb’s Marsh beim Crown and Anchor ab, nur fünfzig Meter vom elterlichen Cottage entfernt. Von Viertel nach 10 an wartete ihr Vater darauf, dass der Bus am Vorderzimmer vorüberfuhr, wo er und ihre Mutter, die Vorhänge zurückgezogen, zerstreut vorm Fernseher saßen. Wie auch immer das Programm oder das Wetter sein mochten, er zog sogleich sein Jackett an und ging die fünfzig Meter weit, um sie abzuholen, da er sie nicht unbeaufsichtigt lassen wollte. Seit der Whistler von Norfolk sein Unwesen trieb, hatte ihr Vater eine zusätzliche Rechtfertigung für seine milde Tyrannei, die er, wie Valerie ahnte, im Umgang mit seinem einzigen Kind sowohl richtig fand als auch genoss. Die beiden hatten schon sehr früh eine Art Übereinkunft getroffen: »Wenn du rücksichtsvoll mit mir umgehst, Mädchen, tue ich es auch.« Valerie liebte ihren Vater, ängstigte sich aber auch vor ihm und fürchtete seinen Jähzorn. Nun würde es wieder zu einem dieser lautstarken Kräche kommen, bei denen sie, wie sie genau wusste, von ihrer Mutter keine Hilfe erwarten durfte. Das war das Ende der Freitagabende mit Wayne und Shirl und der Clique. Sie wurde sowieso schon von ihnen verspottet und bemitleidet, weil sie sich wie ein Kind behandeln ließ. Fortan würde die Demütigung vollkommen sein.
Ihr erster verzweifelter Gedanke war, ein Taxi zu nehmen, um dem Bus hinterherzufahren. Aber sie wusste nicht, wo der Taxistand war. Außerdem würde ihr Geld nicht reichen, dessen war sie sich sicher. Sie konnte zurück in die Disco gehen und fragen, ob nicht Wayne, Shirl oder ein anderer aus der Clique ihr Geld leihen könnte. Aber Wayne war immer so knickerig und Shirl so boshaft. Und bis sie es erbettelt hätte, wäre es längst zu spät.
Doch dann kam die Rettung. Die Ampel hatte auf Rot geschaltet, und ein Wagen am Ende einer Reihe von vier weiteren hielt sachte an. Valerie stand gegenüber dem offenen linken Wagenfenster und erblickte zwei ältliche Frauen. Sie hielt sich an der heruntergelassenen Scheibe fest und fragte atemlos: »Könnten Sie mich mitnehmen? Richtung Cobb’s Marsh? Ich habe den Bus verpasst. Bitte!«
Aber selbst dieser flehentliche Appell konnte die Fahrerin nicht rühren. Sie schaute geradeaus, runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf und ließ die Kupplung los. Ihre Begleiterin dagegen zögerte, musterte Valerie, griff nach hinten und öffnete die hintere Wagentür.
»Steig schon ein! Aber rasch. Wir fahren bis nach Holt. Wir können dich an der Kreuzung absetzen.«
Valerie zwängte sich hinein, und der Wagen fuhr mit einem Ruck los. Zumindest ging es in die gewünschte Richtung. Sie brauchte nur ein paar Sekunden, um sich einen Plan auszudenken. Von der Kreuzung in Holt waren es nur wenige hundert Meter zu der Stelle, wo die Busroute einscherte. Das Stückchen konnte sie laufen und den Bus bei der Haltestelle vor dem Crown and Anchor noch erwischen. Dazu langte die Zeit. Der Bus benötigte mindestens zwanzig Minuten, bis er sich durch all die kleinen Ortschaften geschlängelt hatte.
Erstmals sprach die Fahrerin sie an. »Du solltest nicht per Anhalter fahren«, tadelte sie sie. »Weiß denn deine Mutter überhaupt, dass du aus warst und was du so treibst? Heutzutage scheinen die Eltern keine Macht mehr über ihre Kinder zu haben.«
Blöde alte Zicke, dachte Valerie. Was geht dich das an, was ich so treibe? Nicht mal von den Lehrern in der Schule hätte sie sich diese Frechheit gefallen lassen. Aber sie verkniff sich eine patzige Antwort, was bei ihr sonst recht häufig vorkam, wenn sie von Erwachsenen kritisiert wurde. Sie musste sich nun mal mit den beiden alten Schachteln abfinden. Da war es besser, sie nicht zu verprellen. »Ich sollte den Bus um 21 Uhr 40 nehmen«, erklärte sie. »Mein Daddy bringt mich um, wenn er erfährt, dass ich per Anhalter gefahren bin. Ich würd’s auch nie tun, wenn Sie ein Mann wären.«
»Hoffentlich. Dein Vater hat völlig recht, wenn er Strenge walten lässt. Unsere Zeiten sind gefährlich für so junge Dinger wie dich. Vom Whistler mal ganz abgesehen. Wo wohnst du denn genau?«
»In Cobb’s Marsh. Aber in Holt habe ich eine Tante und einen Onkel. Wenn Sie mich an der Kreuzung absetzen, fährt mein Onkel mich heim. Sie wohnen ganz in der Nähe. Wenn Sie mich da rauslassen, passiert mir nichts. Wirklich.« Die Lüge ging ihr glatt über die Lippen und wurde auch bedenkenlos hingenommen. Danach schwiegen sie. Valerie saß da und musterte die Köpfe der beiden, ihr kurz geschnittenes graues Haar, die altersfleckigen Hände der Fahrerin am Steuerrad. Augenscheinlich Schwestern, dachte sie. Die gleichen Schädel, die gleichen Kinnladen, die gleichen geschwungenen Brauen über argwöhnischen, zornigen Augen. Die haben miteinander gestritten, dachte sie. Sie spürte die Spannung, die zwischen den beiden herrschte. Valerie war erleichtert, als die Fahrerin wortlos an der Kreuzung anhielt und sie sich mit einem gemurmelten Dankeschön hinauswinden konnte. Sie sah zu, wie die beiden weiterfuhren. Das sollten die letzten Menschen sein, von einem abgesehen, die sie noch lebend antrafen.
Sie bückte sich, um die derben Schuhe anzuziehen, die sie auf Geheiß ihrer Eltern tragen sollte, wenn sie zur Schule ging, und war froh, dass die Umhängetasche endlich leichter wurde. Danach marschierte sie von der kleinen Ortschaft zu der Straßeneinmündung, wo sie auf den Bus warten wollte. Die Straße dorthin war schmal und unbeleuchtet. Bäume säumten sie auf der rechten Seite, dunkle, zugeschnittene Baumgerippe, die in den sternenübersäten Himmel ragten. Auf der linken Seite, wo Valerie ging, war ein schmaler Streifen von Sträuchern und Büschen, die hin und wieder so dicht und breit wuchsen, dass sie den Weg überwölbten. Sie war zutiefst erleichtert, weil alles so gut verlaufen war. Sie würde den Bus noch erreichen. Doch während sie nun in der gespenstischen Stille weitertrottete und ihre behutsamen Schritte hörte, die unnatürlich laut klangen, überfiel sie ein beklemmendes Gefühl, und sie verspürte den ersten Anflug von Unbehagen. Als sie sich diese bedrückende Regung erst einmal eingestanden hatte, ergriff die Furcht Besitz von ihr und steigerte sich zu unentrinnbarer Angst.
Ein Auto näherte sich – einerseits ein Symbol von Sicherheit und Normalität, andererseits eine Bedrohung mehr. Jedermann wusste, dass der Whistler einen Wagen hatte. Wie hätte er sonst an so weit voneinander entfernten Orten in der Grafschaft all die Morde begehen können? Wie hätte er verschwinden können, nachdem er seine grässlichen Taten verübt hatte? Sie trat unter einen überhängenden Busch. Ihre Angst wuchs. Das Motorengeräusch kam näher. Kurz leuchteten die Katzenaugen auf, dann rauschte der Wagen an ihr vorbei. Und sie war wieder allein in der Dunkelheit und Stille. Aber stimmte das wirklich? Der Gedanke an den Whistler ließ sie nicht mehr los. Gerüchte, Halbwahrheiten vermengten sich zu einer beklemmenden Wirklichkeit. Er erwürgte nur Frauen. Drei waren es bis jetzt gewesen. Und dann schnitt er ihnen das Haar ab und stopfte es ihnen in den Mund, aus dem es hervorquoll wie Stroh aus einer Guy-Fawkes-Puppe am 5. November. Die Jungs in der Schule machten sich lustig über den Whistler, pfiffen im Fahrradschuppen, wie er es angeblich bei den Leichen seiner Opfer tat. »Dich schnappt der Whistler auch noch!«, hatten sie ihr einmal nachgerufen. Überall konnte er auftauchen. Er trieb sich nur nachts herum. Auch hier konnte er irgendwo lauern. Am liebsten hätte sie sich ganz klein gemacht, sich in das weiche, duftende Erdreich geschmiegt, die Ohren zugehalten und so bis zum Morgengrauen ausgeharrt. Aber schließlich überwand sie den Anflug von Panik. Sie musste zur Kreuzung gelangen und den Bus erreichen. Sie zwang sich, aus dem Schatten des Gebüschs herauszutreten und setzte – fast lautlos – ihren Weg fort.
Am liebsten wäre sie gerannt, aber auch diesen Impuls unterdrückte sie. Das Wesen – ob Mensch, ob Tier –, das da im Buschwerk lauern mochte, witterte doch ihre Angst, wartete nur darauf, dass sie in Panik geriet. Gleich würde sie das Knacken brechender Zweige hören, trampelnde Schritte, einen keuchenden Atem, der heiß ihren Nacken streifen würde. Nein, sie musste weitergehen, schnell, geräuschlos, musste die Tasche fest an sich drücken, möglichst leise atmen, nur geradeaus blicken. Während sie dahinschritt, betete sie: »Lieber Gott, lass mich bitte unversehrt heimkommen, und ich werde nie mehr lügen. Von nun an werde ich rechtzeitig aufbrechen. Hilf mir, damit ich unversehrt zur Kreuzung gelange. Lass den Bus bald kommen. Lieber Gott, hilf mir doch bitte!«
Und wie durch eine Weisung vom Himmel wurde ihr Gebet erhört: Unverhofft tauchte etwa dreißig Schritt vor ihr eine Frau auf. Sie überlegte nicht lange, wie das möglich sein konnte – so wunderbar war es, dass da diese schlanke, sich langsam nähernde Frauengestalt aufgetaucht war. Es genügte, dass es sie gab. Als sie auf sie zueilte, sah sie langes blondes Haar unter einer Baskenmütze und einen fest gegürteten Trenchcoat. Und neben der Frau trottete gehorsam – und das beruhigte sie am meisten – ein kleiner, krummbeiniger, schwarzweißer Hund. Jetzt konnten sie miteinander zur Kreuzung gehen. Vielleicht wollte die Frau auch den Bus erreichen. »Ich komme, ich komme!«, hätte sie am liebsten geschrien. Sie begann zu laufen, rannte – wie ein Kind in die ausgebreiteten Arme der Mutter – diesem Sinnbild der Sicherheit und Geborgenheit entgegen.
Die Frau bückte sich und leinte den Hund ab. Als befolge er einen Befehl, verschwand er im Gebüsch. Die Frau schaute sich kurz um und blieb dann, den Rücken Valerie halb zugekehrt, abwartend stehen. Die Hundeleine baumelte an ihrer Hand. Valerie stürzte förmlich auf die wartende Gestalt zu. Da drehte sich die Frau langsam um. Einen Atemzug lang war Valerie vor Schreck wie erstarrt. Sie sah ein fahles, angespanntes Gesicht, das niemals das einer Frau gewesen war, ein einfältiges, aufmunterndes, nahezu entschuldigendes Lächeln, funkelnde, erbarmungslose Augen. Sie öffnete den Mund, um zu schreien, aber es war vergeblich. Sie brachte vor Angst keinen Ton heraus. Mit einer blitzartigen Bewegung schnellte die Hundeleine wie eine Schlinge um ihren Hals. Dann verspürte Valerie einen Ruck und wurde von der Straße ins dunkle Gebüsch gezogen. Es kam ihr so vor, als stürze sie ab, durch die Zeit, durch den Raum, durch unendliches Grauen. Und dann war das Gesicht ganz dicht über ihr, und sie nahm den Geruch von Alkohol, von Schweiß, von Angst wahr, die so groß sein musste wie die ihre. Sie riss die Arme hoch, begann kraftlos auf den Angreifer einzuschlagen. Ihr Kopf drohte zu bersten. Der Schmerz in ihrer Brust schwoll zu einer riesigen roten Blüte an und entlud sich in einem lautlosen Schrei: »Mutter! Mutter!« Danach verspürte sie keine Angst, keinen Schmerz mehr, nur noch eine barmherzige, alles auslöschende Dunkelheit.
2
Vier Tage später diktierte Commander Adam Dalgliesh von New Scotland Yard seiner Sekretärin eine letzte Anweisung, erledigte die eingetroffene Post, sperrte die Schreibtischschublade ab, sicherte den Geheimaktenschrank mit dem Kombinationsschloss und bereitete sich auf seinen zweiwöchigen Urlaub an der Küste von Norfolk vor. Der Urlaub war überfällig, und er war schon ganz darauf eingestellt. Aber die Urlaubstage dienten nicht allein zur Erholung. Es gab gewisse private Angelegenheiten, um die er sich in Norfolk kümmern musste. Seine Tante, die letzte übrig gebliebene Verwandte, war vor zwei Monaten verstorben und hatte ihm ihr Vermögen und eine umgebaute Windmühle bei Larksoken an der Nordostküste von Norfolk hinterlassen. Das Vermögen war unerwartet groß, brachte ihn aber in einen bislang ungelösten Zwiespalt. Dabei war die Mühle noch die geringste Bürde, wenngleich auch sie ein paar kleinere Probleme aufwarf. Er hatte das Gefühl, er müsste erst ein, zwei Wochen darin wohnen, bevor er endgültig entscheiden konnte, ob er sie nun als gelegentliches Feriendomizil behalten, sie verkaufen oder sie zum Nominalwert dem Norfolk Windmill Trust überlassen sollte, der, wie er wusste, es als seine Aufgabe ansah, alte Windmühlen wieder instand zu setzen. Ferner waren da noch allerlei Familiendokumente und die Bücher seiner Tante, vor allem ihre reichhaltige Sammlung ornithologischer Werke, die er durchsehen und sortieren musste, bevor er sich über deren Verbleib schlüssig werden konnte. Das waren die angenehmen Aufgaben. Schon in seiner Jugend hatte er sich aus Ferien, in denen er sich nichts Bestimmtes vornahm, nicht viel gemacht. Er hatte keine Ahnung, von welchen in der Kindheit entstandenen Schuldgefühlen oder eingebildeten Verpflichtungen dieser merkwürdige Masochismus herrührte, der ihm nun, in seinen mittleren Jahren, abermals und noch vehementer als früher zu schaffen machte. Dennoch war er froh, dass in Norfolk eine Beschäftigung auf ihn wartete, zumal er genau wusste, dass die Fahrt auch so etwas wie eine Flucht war. Nachdem es vier Jahre still um ihn gewesen war, war nun sein neuester Gedichtband – A case to Answer and Other Poems – veröffentlicht worden. Auch wenn er von der Kritik beifällig aufgenommen worden war, was ihm überraschenderweise behagte, hatte er zudem beträchtliches öffentliches Interesse erregt, das ihm – keineswegs überraschend – weniger gefiel. Nach den spektakulären Mordfällen, die er bearbeitet hatte, hatte sich das Pressebüro der Metropolitan Police bemüht, ihn vor allzu großer Publicity abzuschirmen. Nun musste er sich erst an die gänzlich anders gearteten Vorstellungen seines Verlegers gewöhnen. Deswegen war er, offen gestanden, froh darüber, einen Vorwand zu haben, ihnen zu entwischen, wenngleich nur für zwei Wochen.
Von Kate Miskin, die mittlerweile zum Inspector avanciert und wegen eines Kriminalfalls unterwegs war, hatte er sich schon verabschiedet. Chief Inspector Massingham war zum Schulungskurs an die Polizeiakademie von Bramshill beordert worden, ein Karriereschritt weiter auf seinem Weg zum Chief Constable. Kate nahm vorläufig seine Position als Dalglieshs Stellvertreter bei der Sonderkommission ein. Er ging in ihr Büro, um einen Zettel mit seiner Urlaubsanschrift zu hinterlegen. Es war wie stets auffallend ordentlich und zweckdienlich, aber dennoch feminin eingerichtet. Ein einziges Bild hing an der Wand, eines der abstrakten Ölgemälde, die Kate selbst malte. Über verlaufenden Brauntönen leuchtete ein Streifen Giftgrün. Dalgliesh gefiel das Gemälde von Mal zu Mal besser. Auf dem aufgeräumten Schreibtisch prangte eine kleine Vase mit Freesien. Ihr anfänglich flüchtiger Duft wehte plötzlich zu ihm herüber und verstärkte den merkwürdigen Eindruck, der sich ihm stets aufdrängte, wenn er hier war: nämlich dass das Büro, wenn es leer war, mehr von Kate preisgab, als wenn sie dasaß und arbeitete. Er legte den Zettel genau in die Mitte der fleckenlosen Schreibunterlage und musste lächeln, als er mit unangebrachter Sachtheit die Tür hinter sich schloss. Jetzt brauchte er sich nur noch vom Einsatzleiter zu verabschieden; er machte sich auf den Weg zum Lift.
Die Fahrstuhltür schloss sich bereits, als er rasche Schritte und einen fröhlichen Zuruf hörte. Manny Cummings schlängelte sich noch so flink herein, dass ihn die zuschnappenden Stahlleisten knapp verfehlten. Wie immer strahlte er eine geradezu aufdringliche Betriebsamkeit aus, die nicht einmal die vier Fahrstuhlwände zu bändigen vermochten. Er schwenkte einen großen braunen Umschlag. »Gut, dass ich Sie noch antreffe, Adam. Sie hauen doch nach Norfolk ab, nicht? Wenn die Kripo von Norfolk den Whistler fasst, könnten Sie ihn sich doch mir zuliebe ansehen, geht das? Überprüfen Sie, ob er nicht unser Kunde in Battersea ist!«
»Der Würger von Battersea? Aber das ist doch wohl sehr unwahrscheinlich, wenn man die Zeitangaben und näheren Umstände vergleicht. Oder ziehen Sie diese Möglichkeit wirklich in Betracht?«
»Nicht ernsthaft. Aber Gottvater ist nun mal nicht zufrieden, solange wir nicht alle Theorien überprüft haben und jeder denkbaren Spur nachgegangen sind. Ich habe unsere bisherigen Erkenntnisse für Sie zusammengestellt und auch ein Phantombild beigefügt. Sie wissen ja, dass er ein paarmal gesichtet worden ist. Und ich habe Rikkards informiert, dass Sie sich in seinem Revier aufhalten werden. Sie erinnern sich doch noch an Terry Rikkards?«
»Aber ja.«
»Er ist mittlerweile Chief Inspector und hat sich in Norfolk ganz schön herausgemacht. Besser jedenfalls, als wenn er hier bei uns geblieben wäre. Außerdem habe ich erfahren, dass er geheiratet hat, was dieses Raubein vielleicht etwas umgänglicher stimmt.«
»Ich werde mich zwar in seinem Revier aufhalten, aber – dem Himmel sei Dank! – nicht zu seiner Verfügung stehen. Und warum sollte ich Sie auch um einen Tag auf dem Land bringen, wenn die dort den Whistler dingfest machen?«
»Ich mag das Land nicht, und schon gar nicht flaches Land. Denken Sie nur daran, wie viel Geld Sie dem Steuerzahler dadurch ersparen! Aber natürlich fahre ich nach Norfolk hinauf – oder besser hinunter? –, wenn der Bursche es wert ist, dass ich ihn mir vorknöpfe. Sehr freundlich von Ihnen, Adam. Schönen Urlaub auch.«
Nur Cummings brachte eine solche Dreistigkeit auf. Aber die Bitte war nicht ungebührlich. Zudem richtete sie sich an einen bloß um etliche Monate älteren Kollegen, der stets Zusammenarbeit predigte und auf die sachdienliche Ausschöpfung sämtlicher Ressourcen großen Wert legte. Außerdem war es unwahrscheinlich, dass ihm sein Kurzurlaub durch eine noch so flüchtige Begegnung mit dem Whistler, dem berüchtigten Serienmörder in Norfolk, vergällt werden könnte, mochte er ihn tot oder lebendig zu Gesicht bekommen. Der Mann trieb mittlerweile schon seit fünfzehn Monaten sein Unwesen, und sein letztes Opfer – hieß sie nicht Valerie Mitchell? – war sein bislang viertes. Solche Fälle waren zumeist schwierig, zeitaufwendig, mühevoll, da ihre Aufklärung häufig mehr von Glücksumständen als von ausgebuffter Fahndungsarbeit abhing. Als er die Rampe hinab zur Tiefgarage ging, schaute er auf seine Uhr. In einer Dreiviertelstunde war er unterwegs. Vorher musste er jedoch noch etwas mit seinem Verleger besprechen.
3
Der Fahrstuhl des Verlags Messrs. Herne & Illingworth am Bedford Square war beinahe so alt wie das Gebäude selbst: ein Sinnbild hartnäckigen Festhaltens an einer längst überholten Eleganz und einer etwas schrulligen Unwirtschaftlichkeit, hinter der sich jedoch eine durchaus gewiefte Geschäftspolitik verbarg. Während ihn der Lift mit einem beunruhigenden Rucken nach oben beförderte, dachte Dalgliesh, dass Erfolg, selbst wenn er zugegebenermaßen wohltuender war als eine Schlappe, auch seine Schattenseiten hatte. Dazu zählte Bill Costello, der PR-Direktor, der ihn in seinem bedrückend engen Büro auf der vierten Etage erwartete.
Sein Durchbruch als Schriftsteller war mit einem Wandel im Verlag zusammengefallen. Zwar gab es Herne & Illingworth noch – beide Namen standen stilvoll gedruckt oder mit Prägelettern unter dem altehrwürdigen, eleganten Verlagssignet –, aber die Firma gehörte inzwischen einem multinationalen Konzern an, der neben Konserven, Zucker und Textilien nun auch Bücher vertrieb. Der alte Sebastian Herne hatte eines der wenigen noch vorhandenen Londoner Verlagshäuser mit individuellem Flair für achteinhalb Millionen Pfund veräußert und gleich darauf eine ungemein hübsche PR-Assistentin geehelicht, die nur den Abschluss der Transaktion abgewartet hatte, bevor sie, allen unguten Vorahnungen zum Trotz, den unlängst erlangten Status einer Geliebten gegen den einer Ehefrau eintauschte, womit sie Geschäftssinn bewies und ihre Zukunft absicherte. Herne hatte binnen dreier Monate das Zeitliche gesegnet, was reichlich anzügliche Kommentare, doch nur wenig Bedauern auslöste. Zeit seines Lebens war Sebastian Herne ein bedachtsamer, den Konventionen verhafteter Mensch gewesen, der jegliche Extravaganz, Fantasie und gelegentliche Risikofreudigkeit seiner verlegerischen Tätigkeit vorbehalten hatte. Dreißig Jahre lang hatte er als treuer, wenn auch einfallsloser Ehemann dahingelebt. Wenn ein Mann von fast siebzig Jahren sich mehr oder minder anstandslos den Konventionen beugt, verlangt ihm das vermutlich sein Naturell ab, dachte Dalgliesh. Herne war weniger an sexueller Erschöpfung gestorben, sofern sich derlei, wie die Puritaner meinen, überhaupt medizinisch nachweisen lässt, als an einer letztlich fatalen Ansteckung durch die derzeit modische Sexualmoral.
Die neuen Verlagschefs förderten ihre Lyrikautoren nach Kräften. Vermutlich sahen sie in den Gedichtbänden ein Gegengewicht zur Vulgarität und Schlüpfrigkeit ihrer Bestsellerautoren, deren Werke sie mit Kalkül und Raffinement auf den Markt brachten, als könnte man rein kommerziell ausgerichteten Banalitäten durch elegant gestylte Buchumschläge oder die Qualität des Drucks einen literarischen Wert verleihen. Bill Costello, im vorigen Jahr zum PR-Chef ernannt, sah nicht ein, warum der Verlag Faber & Faber eine Monopolstellung innehaben sollte, was die einfallsreiche Vermarktung von Gedichtbänden anbelangte, und rührte deswegen mit großem Erfolg die Werbetrommel für die verlagseigenen Poeten, auch wenn gemunkelt wurde, er selbst habe noch kein einziges modernes Gedicht gelesen. Für Verse interessierte er sich insofern, als er Präsident des McGonagall-Clubs war, dessen Mitglieder am ersten Dienstag jeden Monats in einem Pub in der City zusammenkamen, wo sie sich den weithin gerühmten Steak and kidney-Pudding der Wirtin einverleibten, reichlich zechten und einander die eher lächerlichen Reime des armseligsten Poeten von ganz England vortrugen. Ein Dichterkollege hatte Dalgliesh die Sache einmal so verdeutlicht: »Der Arme muss so viel unverständliche moderne Lyrik lesen, dass es niemand verwundern kann, wenn er hin und wieder eine Dosis verständlichen Unsinn zu sich nimmt. Es ist wie bei einem treuen Ehemann, der gelegentlich therapeutische Erleichterung im nächstgelegenen Puff sucht.« Dalgliesh fand die Erklärung zwar einfallsreich, aber nicht eben überzeugend. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Costello die Gedichtbände las, für die er so eifrig warb. Er begrüßte seinen neuesten Anwärter auf Medienruhm mit einer Mischung aus beharrlichem Optimismus und leichter Besorgnis, als ahnte er, wie schwierig die Sache werden würde.
Sein kleines, versonnenes, kindlich wirkendes Gesicht passte nicht so recht zu seiner korpulenten Statur. Offensichtlich war sein Hauptproblem die Frage, ob er den Gürtel über oder unter seinem Wanst tragen sollte. Saß er darüber, so wurde gemunkelt, war das ein Anzeichen von Zuversicht; war er hinabgerutscht, deutete das auf Bekümmertheit hin. Heute trug er ihn knapp oberhalb des Skrotums, was auf einen Pessimismus schließen ließ, der im nachfolgenden Gespräch auch noch seine Bestätigung finden sollte.
»Nein, Bill«, wehrte Dalgliesh entschieden ab. »Ich denke nicht daran, etwa mit dem Fallschirm ins Wembley-Stadion einzuschweben, in einer Hand mein Buch, in der anderen ein Mikrofon. Und ich werde auch nicht mit dem Zugansager vom Bahnhof Waterloo wetteifern und den Fahrgästen lauthals meine Verse vortragen. Die Leute interessieren sich doch nur für den nächsten Zug.«
»Das hat’s alles schon gegeben. Ein alter Hut. Und das mit dem Wembley-Stadion ist doch blanker Unsinn. Wie kommen Sie nur auf so was? Nein, das hier ist wirklich ein guter Vorschlag. Ich habe schon mit Colin McKay gesprochen. Er ist begeistert. Wir mieten einen roten Doppeldeckerbus und machen eine PR-Tour durchs ganze Land. Zumindest so weit, wie man es in zehn Tagen schaffen kann. Ich sage Clare, dass sie Ihnen den vorläufigen Plan und die Termine vorlegen soll.«
»Also ein Bus wie bei einer Politkampagne«, erwiderte Dalgliesh. »Mit Plakaten, Werbesprüchen, Lautsprechern, Luftballons.«
»Wenn wir den Leuten nicht groß ankündigen, worum es geht, können wir’s auch bleiben lassen.«
»Sie werden’s schon erfahren, wenn Colin mitmacht. Wie wollen Sie ihn überhaupt nüchtern halten?«
»Er ist kein so übler Dichter, Adam. Übrigens ist er ein großer Bewunderer von Ihnen.«
»Das heißt noch lange nicht, dass er mich dabeihaben möchte. Wie wollen Sie das Ganze überhaupt nennen? Dichter auf großer Fahrt? Auf den Spuren Chaucers? Lyrik auf Rädern? Oder erinnert das zu sehr ans Essen? Vielleicht Poetenbus? Das hört sich wenigstens schlicht an.«
»Uns wird schon was einfallen. Dichter auf großer Fahrt gefällt mir.«
»Und wo wollen Sie anhalten?«
»Auf Kirchplätzen, vor Rathäusern, Schulen, Pubs, Raststätten – überall da, wo Leute zusammenkommen. Es ist ein durchaus reizvolles Vorhaben. Zuerst wollten wir einen Zug mieten, aber mit einem Bus sind wir flexibler.«
»Und billiger wird’s auch.«
Costello überging diese Anspielung. »Die Lyriker auf dem Oberdeck, Getränke und Erfrischungen unten. Lesungen von der Plattform aus. Landesweite Publicity. Rundfunk. Fernsehen. Wir beginnen hier am Embankment in London. Wir haben die Chance, dass Channel Four und selbstverständlich Kaleidoscope groß darüber berichten. Wir rechnen mit Ihnen, Adam!«
»Nein«, entgegnete Dalgliesh schroff. »Auch nicht, wenn Sie mir ein paar Luftballons schenken.«
»Aber, Adam! Sie schreiben doch diese Gedichte. Da wollen Sie doch sicherlich, dass die Leute sie auch lesen, sie zumindest kaufen. Die Öffentlichkeit interessiert sich für Sie, vor allem nach Ihrem letzten Fall, dem Mordfall Berowne.«
»Man interessiert sich für einen Dichter, der Mörder schnappt, oder für einen Polizisten, der Gedichte schreibt, aber doch nicht für dessen Gedichte.«
»Was macht das schon, solange man sich für Sie interessiert? Und sagen Sie mir bloß nicht, dass der Commissioner es nicht gerne sähe! Das wäre eine allzu billige Ausrede.«
»Okay, ich sag’s ja gar nicht. Aber ihm würde es auch wirklich nicht gefallen.«
Und außerdem fiel ihm sowieso nichts Neues mehr ein, was er sagen könnte. Er hatte immer dieselben Fragen schon unzählige Male gehört und sie wenigstens ehrlich zu beantworten versucht, wenn er schon nicht begeistert davon war.
»Wieso verschwendet ein feinfühliger Dichter wie Sie seine Zeit damit, nach Mördern zu fahnden?« – »Was ist Ihnen wichtiger, das Gedichteschreiben oder Ihr Job bei der Polizei?« – »Nützt es Ihnen, dass Sie ein Polizeidetektiv sind, oder behindert es Sie?« – »Wieso schreibt ein erfolgreicher Polizeifahnder Gedichte?« – »Was war Ihr interessantester Fall, Commander? Drängt es Sie anschließend dazu, ein Gedicht darüber zu schreiben?« – »Lebt die Frau noch, der Sie Ihre Liebesgedichte gewidmet haben, oder ist sie längst tot?« Dalgliesh fragte sich, ob man auch schon Philip Larkin bedrängt hatte, preiszugeben, wie er denn zugleich Lyriker und Bibliothekar sein könne. Oder erkundigte man sich etwa bei Roy Fuller, wie er wohl das Gedichteschreiben mit seiner Anwaltspraxis in Einklang bringe?
»Die Fragen sind doch alle voraussehbar«, sagte er. »Es würde uns allen eine Menge Unannehmlichkeiten ersparen, wenn ich die Antworten auf Band spreche. Die könnten Sie dann vom Bus aus abspielen.«
»Das wäre nun mal nicht das Gleiche. Man möchte Sie persönlich sehen. Man würde sonst denken, Sie wollen nicht, dass man Ihre Gedichte liest.«
Wollte er denn das überhaupt? Gewiss, einige Menschen sollten sie schon lesen, insbesondere eine Person. Und nachdem diese Person seine Gedichte gelesen hatte, sollte sie von ihnen angetan sein. Das war zwar betrüblich, aber immerhin wahr. Was die Übrigen anbelangte – na ja, er vermutete, er wollte schon, dass die Leute seine Gedichtsammlungen kennenlernten, aber sie sollten nicht dazu gedrängt werden, sie zu kaufen. Das war natürlich eine extravagante Einstellung, die er von Herne & Illingworth wohl kaum erwarten durfte. Er merkte, dass Bill ihn bange, geradezu flehentlich anschaute, wie ein kleiner Junge, dem man eine Schale mit Bonbons abnahm. Sein Widerstreben, bei der Werbeaktion mitzumachen, kennzeichnete einen Zug seines Wesens, den er selbst nicht mochte. Es war zweifellos unlogisch, dass er publiziert werden wollte, aber nicht besonders daran interessiert war, ob man seine Bücher auch kaufte. Wenn ihm Publizität als Begleiterscheinung seines Ruhms peinlich war, bedeutete das längst nicht, dass er frei von Eitelkeit war, sondern nur, dass er sie besser zu zügeln vermochte, quasi für sich behielt. Er hatte ja einen festen Job, konnte mit einer gesicherten Pension rechnen, und seit Neuestem besaß er auch noch das beträchtliche Vermögen seiner Tante. Er brauchte sich nicht abzustrampeln. Er war sogar ausgesprochen privilegiert, wenn er sich etwa mit Colin McKay verglich, der vermutlich in ihm – und wer könnte das Colin verübeln? – einen verschrobenen, überspannten Dilettanten sah.
Dalgliesh war erleichtert, als die Tür aufging und Nora Gurney, die Kochbuchlektorin, schwungvoll eintrat. Wenn er sie sah, musste er stets an ein intelligentes Insekt denken, wobei die hellen, leicht vorquellenden Augen hinter den großen runden Brillengläsern diesen Eindruck noch verstärkten. Sie trug die rehbraune Strickjacke mit Rippenmuster, die er gut kannte, und flache, spitz zulaufende Schuhe. Im englischen Verlagswesen war Nora Gurney zur Autorität geworden, was sich auf ihre langjährige Tätigkeit zurückführen ließ – keiner wusste noch, wann sie zu Herne & Illingworth gekommen war – und auf ihre unerschütterliche Überzeugung, dass ihr diese Macht auch gebührte. Es war zu erwarten, dass sie diese auch unter der neuen Verlagsleitung ausüben würde. Dalgliesh hatte sie zuletzt vor drei Monaten getroffen, auf einer der periodisch stattfindenden Verlagspartys, die, so weit er wusste, aus keinem besonderen Anlass veranstaltet wurden, es sei denn, man wollte den Autoren mittels der inzwischen vertrauten Weinsorten und Häppchen demonstrieren, dass der Verlag geschäftlich weiterhin reüssierte und im Grunde dieselbe altehrwürdige, liebenswerte Firma geblieben war. Auf der Gästeliste standen hauptsächlich die renommiertesten Autoren der gängigsten Sparten, eine Taktik, die auch bei der letzten Party zu einer von Unschlüssigkeit und parteilicher Befangenheit geprägten Atmosphäre beigetragen hatte. Die Lyriker hatten reichlich getrunken und sich anschließend – je nach Naturell – weinerlich oder liebestoll gebärdet. Die Romanciers hatten sich wie störrische Hunde, denen man das Zuschnappen untersagt hatte, in einem Winkel zusammengedrängt. Die Akademiker wiederum hatten Gastgeber und sonstige Gäste ignoriert und sprachgewaltig miteinander disputiert, während die Kochbuchautoren die Kanapees nach dem ersten Biss mit einem Ausdruck von Abscheu, qualvoller Überraschung oder eines nachsichtigen, abwägenden Interesses auf der nächstbesten Stellfläche deponiert hatten. Nora Gurney hatte Dalgliesh in einer Ecke des Zimmers in Beschlag genommen und ihn in ein Gespräch über die Durchführbarkeit einer Theorie verwickelt, die sie sich jüngst ausgedacht hatte. Könnte man nicht, fragte sie, da ja jeder Fingerabdruck einzigartig war, von der gesamten Bevölkerung Fingerabdrücke nehmen, die Daten in einem Computer speichern und sodann wissenschaftlich untersuchen, ob nicht gewisse Kombinationen von Linien und Rillenwirbeln auf eine kriminelle Veranlagung hindeuteten? Auf diese Weise könnte man Verbrechen doch von vornherein verhindern, statt sie wie irgendeine Krankheit zu behandeln. Dalgliesh hatte eingewandt, dass die Daten – kriminelle Tendenzen gab es ja allenthalben, man brauche sich nur anzusehen, wo überall die Partygäste ihre Autos geparkt hätten – nicht zu bewältigen seien. Hinzu kämen noch logistische und ethische Probleme, die eine Registrierung von Fingerabdrücken bei der Gesamtbevölkerung mit sich brächte, und die entmutigende Erkenntnis, dass die Kriminalität, sofern man sie überhaupt mit einer Krankheit vergleichen dürfe, leichter zu diagnostizieren als zu behandeln sei. Es war fast eine Erlösung, als eine Schriftstellerin von stattlicher Gestalt, eingezwängt in ein geblümtes Cretonne-Kostüm, das ihr das Aussehen eines wandelnden Sofas verlieh, ihn beiseitenahm, einen Packen zerknitterter gebührenpflichtiger Verwarnungen wegen Falschparkens aus ihrer prallen Handtasche zog und ingrimmig von ihm wissen wollte, was er dagegen zu tun gedenke. Die Liste der von Herne & Illingworth verlegten Kochbücher war nicht lang, aber beeindruckend. Die besten Autoren genossen ob ihrer Zuverlässigkeit, Originalität und ihres lobenswerten Stils ein unerschütterliches Ansehen. Miss Gurney hing mit wahrer Leidenschaft an ihrem Job und ihren Schützlingen. Romane und Lyrikbände waren für sie irritierende, wenngleich notwendige Nebenprodukte des Verlags, dessen Hauptaufgabe die Pflege und Veröffentlichung ihrer Protegés war. Man kolportierte, dass sie selbst eine lustlose Hobbyköchin sei, ein weiterer Hinweis auf die feste Überzeugung der Briten, die in den höheren, wenn auch minder nützlichen Bereichen menschlicher Beschäftigung weit verbreitet war, dass nämlich nichts den Erfolg so sehr schmälert wie die Beherrschung eines Metiers. Es überraschte Dalgliesh keineswegs, dass sie seine Anwesenheit als einen Glücksfall ansah und ihre Bitte, er möge doch Alice Mair einen Stapel Korrekturbögen überbringen, geradezu als Privileg betrachtete.
»Ich hätte mir denken können, dass man Sie heranzieht, um den Whistler aufzuspüren«, sagte sie.
»Nein, das ist Gott sei Dank die Sache der Kripo von Norfolk. Dass Scotland Yard eingeschaltet wird, kommt häufiger in Romanen als in der Wirklichkeit vor.«
»Trotzdem passt es mir gut in den Plan, dass Sie, aus welchem Grund auch immer, nach Norfolk fahren. Ich würde die Korrekturfahnen nur ungern der Post anvertrauen. Hat nicht Ihre Tante in Suffolk gelebt? Jemand sagte mir, dass Miss Dalgliesh verstorben sei.«
»Bis vor fünf Jahren lebte sie in Suffolk. Dann ist sie nach Norfolk verzogen. Ja, meine Tante ist unlängst gestorben.«
»Nun ja, Suffolk oder Norfolk – so groß wird der Unterschied schon nicht sein. Aber es tut mir leid, dass sie verstorben ist.« Einen Augenblick lang schien sie über die Sterblichkeit aller Menschen nachzusinnen und die beiden Grafschaften zum Nachteil beider gegeneinander abzuwägen. Schließlich fuhr sie fort: »Und sollte Miss Mair nicht zu Hause sein, dann werden Sie doch bestimmt nicht das Paket einfach vor die Tür stellen, nicht wahr? Ich weiß zwar, dass die Leute auf dem Lande ungemein vertrauensvoll sind, aber der Verlust der Korrekturbögen wäre nahezu eine Katastrophe. Möglicherweise ist ihr Bruder, Dr. Alex Mair, da, wenn Alice nicht daheim ist. Er ist der Direktor des Atomkraftwerks bei Larksoken. Aber vielleicht sollten Sie ihm das Paket nicht aushändigen. Männer sind ja zuweilen so schusselig.«
Dalgliesh wollte schon erwidern, einem der führenden Atomphysiker des Landes, dem Leiter eines Atomkraftwerks und, wenn man den Zeitungen glauben durfte, Anwärter auf den neu geschaffenen Posten eines AKW-Generalbevollmächtigten, könne man getrost einen Packen Korrekturbögen anvertrauen. »Sollte sie zu Hause sein«, sagte er stattdessen, »werde ich ihr das Paket persönlich übergeben. Wenn sie nicht daheim ist, behalte ich es, bis ich sie antreffe.«
»Ich habe ihr das mit den Korrekturbögen schon telefonisch mitgeteilt. Sie erwartet Sie also. Die Anschrift habe ich draufgeschrieben. Martyr’s Cottage. Ich nehme an, Sie werden’s schon finden.«
»Mit Straßenkarten kennt er sich aus«, bemerkte Costello mit säuerlicher Stimme. »Vergessen Sie nicht, dass er eigentlich ein Polizeifahnder ist.«
Dalgliesh sagte, er wisse, wo Martyr’s Cottage liege; er kenne auch Alexander Mair, nicht aber dessen Schwester. Selbst wenn seine Tante sehr zurückgezogen gelebt habe, so würden sich doch die Leute, die Nachbarn in einer entlegenen Gegend sind, irgendwann einmal treffen. Alice Mair sei verreist gewesen, als ihm ihr Bruder nach dem Tod von Miss Dalgliesh in der Mühle einen Beileidsbesuch abgestattet hätte.
Er übernahm das Paket, das erstaunlich groß, schwer und mit einem abschreckenden Wirrwarr von Klebebandstreifen umwickelt war, und glitt langsam mit dem Fahrstuhl zum Erdgeschoss, von wo aus er sich zu dem kleinen Verlagsparkplatz und seinem abgestellten Jaguar begab.
4
Sobald Dalgliesh die verschlungenen Tentakel der östlichen Stadtrandsiedlungen hinter sich gelassen hatte, legte er ein flottes Tempo vor und erreichte gegen 3 Uhr nachmittags die Ortschaft Lydsett. Von der Küstenstraße bog er rechts ab und kam auf einen mehr oder minder ebenen Feldweg, den mit Wasser gefüllte Gräben und golden schimmerndes Röhricht säumten. Die schweren Kolben wiegten sich im Wind. Er bildete sich sogar ein, er könne schon die Nordsee riechen, jenen unverkennbaren, aber flüchtigen Duft, der sehnsüchtige Erinnerungen an die Ferien in seiner Kindheit weckte, an seine einsamen Wanderungen als Jugendlicher, auf denen er sich mit seinen ersten Gedichten abgemüht hatte, an die hochgewachsene Gestalt seiner Tante, die, das Fernglas um den Hals gehängt, an seiner Seite ging und den Nistplätzen ihrer geliebten Vögel zustrebte.
Es war also immer noch da, das vertraute alte Gatter, und versperrte die Weiterfahrt. Dass es noch vorhanden war, überraschte ihn stets, da es für ihn keinen ersichtlichen Zweck hatte, es sei denn, zumindest symbolisch die Landspitze abzuschirmen und dem Wanderer eine Gelegenheit zum Nachdenken zu geben, ob er wirklich weiter vordringen wolle.
Das Gatter ließ sich leicht öffnen, nur das Schließen war wie immer schwierig. Er gab ihm einen Ruck und musste es etwas anheben, bis es wieder an seinem Platz war. Als er die Drahtschlinge über den Pfosten streifte, hatte er das vertraute Gefühl, die Alltagswelt hinter sich gelassen zu haben und einen Landstrich zu betreten, der ihm, mochte er ihn noch so oft besuchen, stets fremd bleiben würde.
Er fuhr über die kahle Landspitze zu dem schütteren Kiefernwäldchen, das an die Nordsee grenzte. Das einzige Haus zu seiner Linken war der alte viktorianische Pfarrhof, ein wuchtiges Backsteingebäude, zu dem die struppige Rhododendron- und Kalmienhecke nicht recht passen wollte. Rechts von ihm stieg das Gelände sanft zu den Steilhängen im Süden an. Er sah den dunkel klaffenden Zugang zu dem Betonbunker, den man nach dem Krieg nicht abgerissen hatte und der anscheinend so unverwüstlich war wie die von den Wellen glatt geschliffenen Reste der alten Befestigung, die, im Sand eingebettet, diesen Teil des Strandes prägten. Im Norden – im Hintergrund die blau gewellte See – schimmerte die verfallene Benediktinerabtei mit ihren geborstenen Bögen und Mauerstümpfen golden im Licht der Nachmittagssonne. Als er über eine kleine Anhöhe fuhr, erblickte er endlich die Flügel der Mühle und dahinter, nahe am Horizont, den riesigen grauen Klotz des Atomkraftwerks von Larksoken. Wenn man von dem Fahrweg links abbog, gelangte man zu dem Atommeiler. Aber diese Zufahrt wurde, wie er wusste, nur selten benutzt, da man für Pkws und schwere Fahrzeuge einen Zubringer weiter nördlich gebaut hatte. Die Landzunge war leer und nahezu kahl. Die wenigen kümmerlichen Bäume, vom Wind gebeugt, hatten es schwer, in dem kärglichen Boden Halt zu finden. Als er an einem weiteren verwitterten Bunker vorüberkam, hatte er das bedrückende Gefühl, die Landzunge sei einst ein Schlachtfeld gewesen. Die Toten hatte man längst fortgekarrt, aber die Luft schien noch vom Geschützdonner längst geschlagener Schlachten zu vibrieren, während über alldem der Atommeiler hochragte wie ein grandioses modernes Denkmal für den Unbekannten Soldaten.
Bei seinen früheren Besuchen in Larksoken hatte er Martyr’s Cottage gesehen, wenn er zusammen mit seiner Tante von dem kleinen Raum unter dem kegelförmigen Mühlendach aus die Landspitze betrachtet hatte. Aber näher als bis zur Zufahrt war er nie gelangt. Als er nun darauf zusteuerte, kam ihm die Bezeichnung Cottage irreführend vor. Es war ein stattliches, zweigeschossiges l-förmiges Gebäude, das sich östlich der Zufahrt erhob. Die Mauern waren teils mit Feldstein abgedeckt, teils nur verputzt. Dahinter schloss sich ein Innenhof an, der mit Yorker Steinplatten ausgelegt war. Von hier aus sah man auf einer Seite über ein etwa fünfzig Meter breites strauchbewachsenes Gelände bis hin zu den Dünen mit ihren Grashorsten und dem Meer. Niemand ließ sich blicken, als er vorfuhr. Er wollte schon an der Türglocke ziehen, hielt dann aber inne, um die Worte auf der Steintafel zu lesen, die rechts neben der Tür in die Feldsteinabdeckung eingelassen war.
In einem Cottage an dieser Stelle lebte Agnes Poley, eine protestantische Märtyrerin, die im Alter von zweiunddreißig Jahren am 15. August 1557 in Ipswich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
Prediger Salomo, Kapitel 3, Vers 15
Sonst war die Tafel schmucklos. Die tief eingemeißelten, eleganten Lettern erinnerten ihn an die Schrift Eric Gills. Ihm fiel ein, dass seine Tante einmal erzählt hatte, die Tafel sei Ende der Zwanzigerjahre, als das Cottage ausgebaut wurde, von dem damaligen Besitzer angebracht worden. Eines der positiven Ergebnisse des Religionsunterrichts, dachte er, ist, dass man später zumindest die wohlbekannten Passagen der Heiligen Schrift jederzeit präsent hat. Auch hier handelte es sich um eine, die er sich mühelos ins Gedächtnis zurückrufen konnte. Als er mit neun Jahren in der Schule einmal etwas angestellt hatte, ließ ihn die Lehrerin in Schönschrift das ganze dritte Kapitel aus dem Prediger Salomo abschreiben, da sie, die alte Sklaventreiberin, in ihrer nüchternen Strenge die Ansicht vertrat, eine Strafe solle zugleich mit einer literarischen oder religiösen Unterweisung verbunden sein. Die Worte, die er damals in seiner runden, kindlichen Schrift kopiert hatte, waren ihm in Erinnerung geblieben. Nicht schlecht gewählt, die Passage, dachte er.
Was geschieht, das ist zuvor geschehen, und was geschehen wird, ist auch zuvor geschehen; und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist.
Er schellte, und binnen weniger Sekunden öffnete Alice Mair die Tür. Er sah eine hochgewachsene, hübsche Frau, die stilvoll, teuer, aber lässig gekleidet war. Sie trug einen schwarzen Kaschmirsweater, eine rehbraune Hose und um den Hals ein Seidentuch. Er hätte auch so gewusst, wer sie war, da sie ihrem Bruder ähnelte, selbst wenn sie ein paar Jahre älter sein mochte. Dass sie einander kannten, schien für sie selbstverständlich zu sein. Sie trat beiseite, um ihn einzulassen, und sagte: »Das ist aber freundlich von Ihnen, Mr Dalgliesh, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Ich weiß, Nora Gurney ist da unerbittlich. Als sie hörte, dass Sie nach Norfolk fahren würden, waren Sie das geeignete Opfer. Bringen Sie die Korrekturbögen ruhig mit in die Küche!«
Sie hatte ein apartes Gesicht: tief liegende, weit auseinanderstehende Augen unter geraden Brauen, einen wohlgeformten, aber verschwiegen wirkenden Mund und kräftiges, grau meliertes Haar, das zu einem Chignon aufgesteckt war. Auf den PR-Fotos hatte sie, wie er sich erinnerte, reizvoller ausgesehen, wenn auch auf eine einschüchternde, intellektuelle, typisch englische Art. Doch als sie nun vor ihm stand, fand er, dass sie selbst in der legeren Atmosphäre ihres Hauses keinerlei erotische Ausstrahlung hatte, dass sie durch ihre spürbare, tief sitzende Reserviertheit weniger feminin und noch abweisender wirkte, als er sich vorgestellt hatte. Ihre steife Haltung schien auszudrücken, dass sie sich jegliche Einmischung in ihr Privatleben verbat. Sie begrüßte ihn mit einem kühlen, festen Händedruck und lächelte ihn kurz, aber auffallend liebenswürdig an. Ihre Stimme – er wusste, wie feinhörig er in dieser Beziehung war – klang nicht unangenehm, jedoch ein wenig gezwungen, als würde sie absichtlich unnatürlich hoch sprechen.
Er folgte ihr durch die Eingangsdiele in die nach hinten gelegene Küche. Sie war etwa sieben Meter lang und diente anscheinend einem dreifachen Zweck: Sie war Wohnraum, Arbeitsstelle und Büro in einem. Rechter Hand befand sich eine wohleingerichtete Küchenzeile mit einem großen Gasherd samt Dunstabzug, einem Hackklotz, wie ihn Metzger haben, einem Küchenschrank rechts neben der Tür mit einem Sortiment blinkender Töpfe und einer langen Arbeitsplatte mit einer dreieckigen Holzscheide, in der unterschiedliche Messer steckten. Mitten im Raum stand ein großer Holztisch mit einer Keramikvase voller Trockenblumen. An der Wand links war ein offener Kamin. Zwei deckenhohe Bücherregale füllten die beiden Mauernischen links und rechts davon, zwei hochlehnige, kunstvoll geflochtene Korbsessel mit Patchworkkissen standen jeweils daneben; vor einem der großen Fenster ein offener Rollsekretär, rechts davon eine Stalltür. Die obere Hälfte war offen und gab den Blick frei auf den gepflasterten Innenhof. Draußen sah Dalgliesh schön geformte Keramiktöpfe mit Küchenkräutern, die so gestellt waren, dass sie möglichst viel Sonnenlicht abbekamen. Der Raum, der nichts Überflüssiges, nichts Protziges enthielt, war gemütlich, und er überlegte, warum er so auf ihn wirkte. Lag es an dem feinen Duft nach Kräutern, nach frischem Gebäck, am leisen Ticken der Wanduhr, die die verstreichenden Sekunden anzeigte und dennoch die Zeit zu bannen schien? Am rhythmischen Rauschen des Meeres, das durch die halb offene Tür drang? Am Gefühl der Geborgenheit, das die beiden Sessel mit ihren Kissen, der offene Kamin auslösten? Oder rührte es daher, dass ihn dieser Raum an die Pfarrhausküche erinnerte, wo er, das vereinsamte Einzelkind, einst Wärme, herzliche, von keiner Gängelung getrübte Aufnahme gefunden hatte, wo man ihn mit heißem, vor Butter triefendem Toast und kleinen, sonst verbotenen Leckerbissen verwöhnt hatte?
Er legte das Paket mit den Korrekturbögen auf die Schreibtischplatte, lehnte den Kaffee ab, den Alice Mair ihm anbot, und folgte ihr zur Haustür. »Es tut mir leid wegen Ihrer Tante«, sagte sie, als sie ihn zum Wagen begleitete. »Ich meine Ihretwegen. Denn ich denke, für eine Ornithologin verliert der Tod seinen Schrecken, wenn erst einmal Sehkraft und Gehör zu schwinden beginnen. Und einfach zu entschlafen, ohne Schmerz und ohne eine Belastung für andere zu sein, ist ein beneidenswertes Lebensende. Aber Sie haben sie so lange gekannt, dass sie Ihnen unsterblich vorgekommen sein muss.«
Es ist nicht leicht, dachte er, Beileid zu äußern oder hinzunehmen; zumeist klingt es banal oder geheuchelt. Diese Worte dagegen hatten einfühlsam geklungen. Jane Dalgliesh war ihm tatsächlich unsterblich erschienen. Alte Menschen, dachte er weiter, machen unsere Vergangenheit aus. Wenn sie von uns gehen, ist es, als hätte es die Vergangenheit und damit uns nie gegeben.
»Ich glaube nicht«, erwiderte er, »dass der Tod sie je geängstigt hat. Sicher bin ich mir allerdings nicht, da ich sie nicht so gut gekannt habe. Ich wünschte, ich hätte mich mehr um sie bemüht. Sie wird mir fehlen.«
»Auch ich habe sie nicht gut gekannt«, entgegnete Alice Mair. »Vielleicht hätte auch ich mich mehr um sie bemühen sollen. Aber sie war sehr reserviert, einer jener beneidenswerten Menschen, die sich selbst genügen. Es ist anmaßend, wenn man diese Selbstständigkeit zu sprengen versucht. Vielleicht sind Sie der gleichen Meinung. Doch wenn Ihnen an Gesellschaft etwas liegt – am Donnerstagabend gebe ich ein Dinner für ein paar Leute, zumeist Arbeitskollegen von Alex im AKW. Möchten Sie kommen? So zwischen halb 8 und 8?«
Es hört sich eher nach einer Herausforderung als nach einer Einladung an, dachte er. Aber zu seiner eigenen Überraschung sagte er zu. Die Begegnung war ohnehin etwas merkwürdig verlaufen. Sie stand da und musterte ihn mit ernsthafter Eindringlichkeit, als er auskuppelte und den Wagen wendete. Er hatte den Eindruck, dass sie ganz genau beobachtete, wie er mit den Dingen umging. Zumindest, dachte er, als er ihr zuwinkte, hat sie mich nicht gefragt, ob ich nach Norfolk gekommen bin, um mich an der Jagd auf den Whistler zu beteiligen.
5
Drei Minuten später nahm er den Fuß vom Gaspedal. Vor ihm, links vom Feldweg, trottete eine kleine Schar von Kindern. Das älteste Mädchen schob einen Kinderwagen vor sich her, während zwei kleinere Mädchen sich beiderseits am Gestänge festhielten. Als das Mädchen das Motorengeräusch hörte und sich umdrehte, sah er ein schmales, zartes, von rotgoldenem Haar umrahmtes Gesicht. Jetzt erkannte er sie: Es waren die Blaney-Kinder, denen er einmal zusammen mit ihrer Mutter am Strand begegnet war. Offensichtlich war das ältere Mädchen beim Einkaufen gewesen; auf der Ablage unter dem Kinderwagen türmten sich pralle Plastiktüten. Er bremste ab. Zwar waren die Kinder wohl kaum in Gefahr – der Whistler trieb sich nur nachts und nicht bei hellem Tageslicht herum, und seit Dalgliesh von der Küstenstraße abgebogen war, hatte ihn noch kein Fahrzeug überholt –, aber das Mädchen machte einen überanstrengten Eindruck. Zudem hatten sie noch einen weiten Weg vor sich. Er kannte ihr Cottage nicht, erinnerte sich aber, dass seine Tante ihm erzählt hatte, es läge gut zwei Kilometer weiter südlich. Ihm fiel ein, was er von ihnen wusste. Ihr Vater schlug sich mehr schlecht als recht als Maler durch und verkaufte seine nichtssagenden, geschönten Aquarelle in den Cafés und Touristenläden entlang der Küste, während die Mutter krebskrank daniederlag. Ob Mrs Blaney überhaupt noch lebte? Seine erste Regung war, die Kinder in den Wagen einsteigen zu lassen, um sie heimzufahren. Aber das wäre, wie er wusste, unbedacht gewesen. Gewiss hatte man dem Mädchen – hieß es nicht Theresa? – eingebläut, sich von keinem fremden Menschen und schon gar nicht von einem Mann mitnehmen zu lassen. Und er war ja ein Fremder hier. Kurz entschlossen wendete er den Wagen und fuhr geradewegs zum Martyr’s Cottage zurück. Diesmal stand die Haustür offen. Ein Streifen hellen Sonnenlichts fiel auf den rot gefliesten Boden. Alice Mair hatte den Wagen gehört und eilte, sich die Hände abwischend, aus der Küche herbei.
»Die Blaney-Kinder sind auf dem Heimweg«, sagte er.
»Theresa schiebt einen schweren Kinderwagen vor sich her und muss noch die Zwillingsschwestern beaufsichtigen. Ich könnte sie heimfahren, wenn ich eine Frau bei mir hätte oder jemand, den sie kennen.«
»Sie kennen mich«, erwiderte Alice knapp.
Ohne ein weiteres Wort ging sie zurück in die Küche, erschien gleich darauf wieder, zog die Haustür hinter sich zu, ohne sie abzuschließen, und stieg in den Wagen. Als er den Gang einlegte, streifte er mit dem Arm ihr Knie. Er spürte, wie sie nahezu unmerklich zurückzuckte. Es war eher eine emotionale als eine physische Regung, eine kaum wahrnehmbare Geste der Reserviertheit. Er glaubte nicht, dass dieses leichte Zurückschrecken etwas mit ihm persönlich zu tun hatte, noch verwirrte ihn ihr Schweigen. Als sie dann miteinander redeten, wechselten sie nur ein paar Worte.
»Lebt Mrs Blaney noch?«, fragte er.
»Nein. Sie ist vor sechs Wochen gestorben.«
»Wie kommen sie jetzt zurecht?«
»Nicht besonders gut, fürchte ich. Aber Ryan Blaney duldet keinerlei Einmischung. Ich kann’s verstehen. Gibt er seine Abwehrhaltung auf, hat er die Hälfte aller Sozialarbeiter von Norfolk, selbst ernannte und berufsmäßige, am Hals.«
Als sie die kleine Schar eingeholt hatten, öffnete Alice Mair die Wagentür.
»Theresa«, sagte sie, »Mr Dalgliesh hier würde euch gern heimbringen. Er ist der Neffe von Miss Dalgliesh, die in der Mühle von Larksoken gewohnt hat. Einer der Zwillinge kann auf meinem Schoß sitzen. Ihr beiden kommt samt Wagen in den Fond.«
Theresa schaute Dalgliesh mit ernster Miene an und bedankte sich. Sie erinnerte ihn an Bilder, die die junge Elisabeth aus dem Hause Tudor darstellten: Wie bei ihr umrahmte rotgoldenes Haar ein auffallend erwachsen wirkendes Gesicht, das Verschwiegenheit und Selbstbeherrschung ausdrückte, und es war die gleiche schmalrückige Nase, die gleichen kühl taxierenden Augen. Die Zwillinge – ihre Gesichter hatten weichere Konturen – blickten ihre Schwester fragend an und lächelten dann scheu. Sie sahen aus, als hätte man sie in aller Eile angezogen. Zudem waren sie für den langen Marsch auf der Landzunge, selbst an einem warmen Augusttag, überaus unpassend gekleidet. Das eine Mädchen trug ein pinkfarben getüpfeltes Sommerkleidchen aus Baumwolle, das mit einer doppelten Rüschenreihe verziert war, das andere eine Art Kinderschürze über einem karierten Blüschen. Die anrührend dünnen Beinchen waren bloß. Theresa hatte Jeans und ein schmuddliges Sweatshirt an, dessen Vorderseite ein Plan der Londoner U-Bahn-Linien zierte. Vermutlich hat sie es von einem Schulausflug nach London mitgebracht, dachte Dalgliesh. Es war ihr viel zu groß. Die weiten Ärmel aus schlaffem Baumwollgewebe flatterten an ihren sommersprossigen Armen wie Stofffetzen an einem Stock. Im Gegensatz zu seinen Schwestern war der kleine Anthony dick eingemummt. Er trug eine Strampelhose, einen Wollpullover, ein wattiertes Jäckchen und eine pompongekrönte Wollmütze, die man ihm tief in die Stirn gezogen hatte. Wie ein pummeliger, herrschsüchtiger Cäsar beobachtete er, ohne zu lächeln, die überraschende Geschäftigkeit ringsum.
Dalgliesh stieg aus und versuchte ihn aus dem Kinderwagen zu hieven, scheiterte aber zunächst an den technischen Tücken des Gefährts. Da war eine Querstange, die die Beinchen des Kindes fixierte. Zudem erwies sich das massige, starre Bündel als erstaunlich schwer. Es war, als hantiere er mit einem ziemlich übel riechenden, prallen Sack. Theresa lächelte ihn daraufhin kurz, aber nachsichtig an, zog die Plastiktüten unter dem Sitz hervor, befreite gekonnt ihr Brüderchen und stemmte es gegen die linke Hüfte, worauf sie mit der anderen Hand – ein einziger kräftiger Ruck genügte – das Gefährt zusammenklappte. Dalgliesh nahm ihr das Kind ab. Theresa bugsierte die Zwillinge in den Jaguar und befahl ihnen mit unerwarteter Strenge, still zu sitzen. Anthony hingegen, der Dalglieshs Unbeholfenheit zu ahnen schien, packte ihn mit seinem klebrigen Händchen am Haar. Einen flüchtigen Augenblick lang spürte Dalgliesh, dass ihn die Kinderwange streifte, so sanft, als habe ihn ein Blütenblatt berührt. Während sie sich abmühten, saß Alice Mair ungerührt im Wagen und sah zu, machte aber keinerlei Anstalten, ihnen zu helfen. Was sie dachte, war aus ihrer Miene nicht zu schließen.
Erst als der Jaguar wieder anfuhr, wandte sie sich an Theresa und fragte freundlich: »Weiß dein Vater, dass ihr allein fortgegangen seid?«
»Daddy ist mit dem Wagen zu Mr Sparks gefahren. Die TÜV-Überprüfung ist wieder mal fällig. Mr Sparks glaubt allerdings nicht, dass er durchkommt. Aber uns ist doch die Milch für Anthony ausgegangen. Wir brauchen Milch. Außerdem auch noch Wegwerfwindeln.«
»Ich gebe am Donnerstagabend eine Dinnerparty«, sagte Alice Mair. »Möchtest du mir, wie letzten Monat, zur Hand gehen, falls dein Vater einverstanden ist?«
»Was wollen Sie denn kochen, Miss Mair?«
»Rück näher, dann sag ich’s dir ins Ohr. Mr Dalgliesh gehört nämlich zu den Gästen. Es soll eine Überraschung sein.«
Der Kopf mit dem rotgoldenen Haar neigte sich der grauhaarigen Miss Mair zu, die etwas flüsterte. Theresa nickte ernsthaft und lächelte dann, als finde sie Spaß an dieser kleinen weiblichen Verschwörung.
Alice Mair wies ihm den Weg zu dem Cottage. Nach gut einem Kilometer bogen sie zum Meer ab. Der Jaguar schaukelte und holperte zwischen hohen, wild wuchernden Brombeer- und Holunderhecken dahin. Der Weg führte nur zu Scudder’s Cottage; der Name stand in unförmigen Lettern auf einem Brett, das ans Gatter genagelt war. Jenseits des Anwesens erweiterte sich die Zufahrt zu einem unebenen, geschotterten Wendeplatz, den ein gut fünfzehn Meter langer Kieswall abschloss. Dahinter rauschte und gurgelte das Meer. Scudder’s Cottage wirkte malerisch mit seinen kleinen Fenstern und dem tief heruntergezogenen Ziegeldach. Davor prangte eine blühende Wildnis, die wohl einst ein Garten gewesen war. Theresa rannte durch das kniehohe Gras, vorbei an den üppigen, verwilderten Rosensträuchern, zur Veranda, wo sie sich reckte, um an den Hausschlüssel zu gelangen, der an einem Nagel hing. Vermutlich wurde er dort aufbewahrt, damit er nicht verloren ging, und weniger aus Sicherheitsgründen, dachte Dalgliesh, der ihr, Anthony auf dem Arm, folgte.
Im Inneren war es heller, als er angenommen hatte. Dazu trug die offen stehende rückwärtige Tür bei, die zu einem Glasanbau – mit Blick auf die Landzunge – führte. Dalgliesh bemerkte die Unordnung ringsum. Auf dem Tisch in der Mitte prangten die Überreste des Mittagessens – mit Tomatensoße beschmierte, unterschiedlich große Teller, auf einem eine angebissene Wurst, daneben eine unverschlossene Flasche Orangensaft. Auf der Lehne eines niedrigen Babystuhls am Kamin lagen, achtlos hingeworfen, Kleidungsstücke. Es roch nach Milch, nach verschwitzten Menschen, nach Holzfeuer. Aber was ihm am meisten auffiel, war ein großformatiges Ölbild, das, der Tür zugekehrt, auf einem Stuhl abgestellt war. Es war ein mit ungewöhnlicher Ausdruckskraft gemaltes Dreiviertelporträt einer Frau. Es war dermaßen dominant in dem kleinen Raum, dass er und Alice Mair es eine Weile wortlos betrachteten. Auch wenn der Maler sich bemüht hatte, jegliche Übersteigerung zu vermeiden, war es weniger ein Abbild als eine Allegorie. Hinter dem Gesicht mit den geschwungenen, vollen Lippen, den arrogant dreinblickenden Augen und dem dunklen, lockigen, wie auf Bildern der Präraffaeliten im Wind wehenden Haar sah man eine naturgetreue Darstellung der Landzunge. Die Einzelheiten waren mit der peniblen Genauigkeit der Maler des sechzehnten Jahrhunderts wiedergegeben – das viktorianische Pfarrhaus, die verfallene Abtei, die verwitterten Bunker, die verkrüppelten Bäume, die weiße, einem Kinderspielzeug gleichende Mühle und – drohend vor dem flammendroten Abendhimmel – das Atomkraftwerk. Aber es war die Frau – die Arme ausgestreckt, die Handteller dem Betrachter zugewandt, als würde sie die Landschaft höhnisch segnen –, die das Bild beherrschte. Dalgliesh fand es technisch brillant, aber auch ungemein drastisch. Es musste in einem Anfall von Hass entstanden sein. Blaneys Absicht, das Böse im Menschen darzustellen, war so offensichtlich, als trüge das Porträt einen entsprechenden Titel. Es unterschied sich von seinen sonstigen Arbeiten. Ohne die augenfällige Signatur – es war nur der Nachname – hätte Dalgliesh bezweifelt, dass es wirklich Blaneys Werk war. Er konnte sich noch gut an die blässlichen, gefälligen Aquarelle der wohlbekannten Sehenswürdigkeiten von Norfolk – Blakeney, St. Peter Mancroft, die Kathedrale von Norwich – erinnern, die Blaney für die Läden in der Umgebung anfertigte. Es hätten Kopien von Ansichtskarten sein können und waren es wohl auch. In den Restaurants und Pubs hier in der Nähe hatte er ein paar kleinere Ölbilder gesehen, die sich, nachlässig ausgeführt, die Farben sparsam aufgetragen, gleichfalls von den biederen Aquarellen unterschieden, sodass man nur schwer glauben mochte, sie stammten vom selben Maler. Doch das Porträt hob sich von all dem ab. Es war verwunderlich, dass der Künstler, der diese fein abgestufte Farbenvielfalt zustande gebracht hatte, der einer solchen Malweise mächtig war, so viel Einfühlungsvermögen besaß, sich dazu herabließ, leicht verkäufliche Souvenirs für Touristen herzustellen.
»Das haben Sie mir nicht zugetraut, oder?«
Sie waren von dem Bild so gebannt gewesen, dass sie Blaneys leises Eintreten – die Tür stand offen – nicht bemerkt hatten. Er gesellte sich zu ihnen und betrachtete das Porträt, als sähe auch er es zum ersten Mal. Seine kleinen Töchter scharten sich um ihn, wie auf eine unausgesprochene Aufforderung hin; bei älteren Kindern hätte man das als eine Bekundung von Familiensolidarität deuten können. Dalgliesh hatte Blaney zuletzt vor einem halben Jahr gesehen, als dieser, die zusammengeschnürten Malutensilien umgehängt, allein den Strand entlanggewatet war. Die Veränderung, die mittlerweile in dem Menschen vorgegangen sein musste, bestürzte ihn. Blaney war hager, gut einen Meter achtzig groß, trug zerschlissene Jeans und ein kariertes Wollhemd, das fast bis zur Taille aufgeknöpft war. Die langzehigen, knochigen Füße steckten in Sandalen. Seine Miene war düster, das rote Haar zerzaust, der Bart wirr. Die Augen waren blutunterlaufen. Wind und Sonne hatten das knochige Gesicht gegerbt. Dennoch sah man an den hervortretenden Backenknochen und den Schatten unter den Augen, dass er zutiefst erschöpft war. Dalgliesh bemerkte, wie Theresa ihre Hand zwischen seine gekrümmten Finger zwängte, während eine der Zwillingsschwestern sich an ihn schmiegte und mit beiden Armen sein Bein umklammerte. Wie abschreckend er auch auf Außenstehende wirken mochte, seine Kinder hatten keine Angst vor ihm, dachte Dalgliesh.
»Tag, Ryan«, sagte Alice Mair gelassen, ohne eine Erwiderung abzuwarten. Sie deutete mit dem Kopf auf das Porträt.
»Beeindruckend. Was haben Sie mit dem Bild vor? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Ihnen Modell saß oder es in Auftrag gegeben hat.«
»Sie brauchte mir nicht Modell zu sitzen. Schließlich kenne ich ihr Gesicht. Ich stelle es am 3. Oktober in Norwich aus, auf der Ausstellung zeitgenössischer Kunst, sofern ich’s dort hinbringen kann. Mein Lieferwagen hat nämlich den Geist aufgegeben.«
»Nächste Woche fahre ich nach London«, sagte Alice Mair.
»Ich könnte es mitnehmen und dort abgeben, wenn Sie mir die Adresse sagen.«
»Wenn Sie möchten«, entgegnete er. Auch wenn die Worte nicht gerade höflich klangen, schwang so etwas wie Erleichterung mit. »Ich stelle es verpackt und adressiert ins Atelier, links neben die Tür. Der Lichtschalter ist gleich darüber. Sie können’s abholen, wann immer Sie wollen. Sie brauchen nicht anzuklopfen.« Die letzten Worte klangen fast wie ein Befehl oder eine Warnung.
»Ich rufe Sie an, sobald ich weiß, wann ich fahre«, erwiderte Miss Mair. »Übrigens – ich glaube nicht, dass Sie Mr Dalgliesh schon kennengelernt haben. Er ist Ihren Kindern auf dem Weg begegnet und nahm sie mit.«