Inhaltsverzeichnis
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWOLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
SECHZEHNTES KAPITEL
SIEBZEHNTES KAPITEL
ACHTZEHNTES KAPITEL
NEUNZEHNTES KAPITEL
ZWANZIGSTES KAPITEL
EINUNGZWANZIGSTES KAPITEL
ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL
DREIUNDZWANZIGSTES KAPITEL
VIERUNDZANZIGSTES KAPITEL
FÜNFUNDZWANZIGSTES KAPITEL
SECHSUNDZWANZIGSTES KAPITEL
SIEBENUNDZWANZIGSTES KAPITEL
ACHTUNDZWANZIGSTES KAPITEL
NEUNUNDZWANZIGSTES KAPITEL
DREISSIGSTES KAPITEL
EINUNDDREISSIGSTES KAPITEL
ZWEIUNDDREISSIGSTES KAPITEL
DREIUNDDREISSIGSTES KAPITEL
VIERUNDDREISSIGSTES KAPITEL
FÜNFUNDDREISSIGSTES KAPITEL
SECHSUNDDREISSIGSTES KAPITEL
SIEBENUNDDREISSIGSTES KAPITEL
ACHTUNDDREISSIGSTES KAPITEL
NEUNUNDDREISSIGSTES KAPITEL
Copyright
ERSTES KAPITEL
Eine Raubvogelnase, schmal und gebogen, zwischen eng stehenden Augen. Ein scharf geschnittener Mund, kantiges Kinn. Das ist längst kein Kindergesicht mehr, auch wenn der blonde Flaum auf der Oberlippe noch keine Rasur erfordert. Zudem hat er einen kühnen Schmiss im Gesicht, eine dunkelrote Narbe zieht sich vom rechten Jochbein bis zur Oberlippe. Das Gesicht eines jungen Kriegers. Ganz bestimmt nicht das eines Mönches.
Bruder Berthold, der Bibliothekar, betrachtet ihn schon eine ganze Weile. Der ist so vertieft in seine Lektüre, dass er gar nicht merkt, wie er beobachtet wird. Gut, denkt Berthold. Gut, dass wenigstens die Bücher und das Schreiben, das Malen von Initialen und Kopieren von alten Pergamenten diesem Jungen Trost und Ablenkung geben.
»Du solltest dich bereitmachen zur None, Bruder Chrysostomus!«, sagt er sanft.
Der Kopf des Novizen fährt empor.
»Ich kann selbst auf das Stundenglas achten und nenn mich nicht Chrysostomus«, erwidert er schroff.
»Das ist nun mal dein Name hier im Kloster Mariä Heimsuchung!«
»Chrysostomus, ja! Den haben sie mir verpasst, ebenso wie die alberne Tonsur, mit der jeder aussieht wie ein Sechzigjähriger!«
Berthold sieht ihn an. Er weiß, diesem Jungen steht ein schwerer Weg bevor im Kloster. Es gab schon Wochen und Monate, wo er sich besser in dies stille und eintönige Leben mit seinen strengen Regeln zu fügen wusste. Aber jetzt… Berthold kann sich vorstellen, wie es in ihm aussieht.
Vor vier Tagen hat es einen Besuch gegeben. Der Vater dieses jungen Ordensbruders, Kuno von Hartenfels, war hergekommen, um mit dem Abt wichtige Dinge zu besprechen und seinen Sohn zu sehen. In dieser Reihenfolge!
Berthold sieht: Der Junge ballt die Fäuste, versucht, sich zu beherrschen. »Bruder Berthold, kannst du mich nicht – kannst du mich nicht noch einen Augenblick in Ruhe lassen?« Er blickt ihn an, beißt sich auf die Lippen.
Berthold zuckt die Achseln, zieht sich an sein Schreibpult zurück. Der junge Mönch steht auf und tritt ans Fenster.
Irgendwo da hinten liegt Hartenfels! Irgendwo da nennt man ihn nicht Chrysostomus, sondern Heinrich, und er müsste nicht demütig den Blick senken, wenn ihn jemand anspricht, sondern wäre der Junker, der Sohn eines Ritters, frei wie ein Vogel und glücklich an der Seite seines Zwillingsbruders …
Warum haben sie ihn hierher geschickt, warum musste er derjenige sein von den Zwillingen, der um Minuten später zur Welt kam? Sein Schicksal, besiegelt in den wenigen Augenblicken, in denen seine Mutter Atem schöpfte. Philipp hatte das Licht der Welt bereits erblickt, war der Erstgeborene. Der Zweite muss zurückstehen.
Manchmal stellt er sich vor, dass er gar nicht Heinrich ist, sondern Philipp. Dass die Amme die beiden Knaben verwechselt hat, eines Tages, nachdem sie nackt im Garten herumgekrabbelt waren. Sie glichen sich ja wie ein Ei dem anderen. Heinrich-Philipp, Philipp-Heinrich. Aber diesen Heinrich gab es nicht mehr, er ist nun Bruder Chrysostomus.
Die Bibliothek befindet sich im Dachgeschoss des Klostergebäudes. Von hier aus hat man einen Blick über das weite, hügelige Land, die fruchtbaren Ebenen zwischen Elbe und Gebirge, hinter dieser Erhöhung liegt Meißen, die große, lebensfrohe Stadt.
Es ist Frühling da draußen. Die Birken, Buchen, Fichten, Eichen, das saftige Gras der Wiesen, das sprießende Getreide, alles hat einen anderen Grünton, ein Choral aus Grün! Jetzt auf einem Pferd über die Flur jagen, zusammen mit Philipp, seinem lachenden Spiegelbild! Immer ist Heinrich der Ernstere, immer ist er es, dem etwas zustößt. Er ist es, dessen Pferd strauchelt, sodass er stürzt und sich den Arm bricht. Er ist es, der beim Schwertkampf die Deckung preisgibt und von Philipps Waffe im Gesicht getroffen wird. Manchmal betrachtet er wehmütig die Narbe an seiner Wange. – Philipp. Felix hätte sein Bruder heißen sollen, Felix, der Glückliche, der Erstgeborene, Erbe und zukünftiger Herr auf Burg Hartenfels. Manchmal versucht Heinrich, sich einzureden, dass er sie lieben könnte, diese Zurückgezogenheit des Klosterlebens, oder sich zumindest dran gewöhnen. Dann stürzt er sich, wie jetzt eben, mit solcher Verbissenheit in die Studien der Bücher und Schriftrollen, dass die anderen Novizen ihn belächeln. Was er tatsächlich liebt, sind die Geschichten: Texte in Griechisch oder Latein verfasst, in die er hineinsteigen kann, mit denen er im Geist fortreisen kann aus der Enge der Klostermauern: Geschichten von einem Hirtenjungen, der Pharao in Ägypten wurde, von einem anderen, der einen Riesen mit der Steinschleuder tötete und später König wurde, von einem Krieger, dessen Stärke in seinem Haar verborgen war und der vernichtet wurde, als man es ihm abschnitt... Dann ist er bereit, sein Schicksal anzunehmen. Aber vor Tagen kam der Vater und alles in ihm bäumte sich auf.
Es gibt im Kloster unendlich viele Regeln, einengende, unsinnige Regeln, wie er findet. So, dass man während der Mahlzeiten nicht sprechen darf. Dass man auch im strengen Winter nur Sandalen an den Füßen tragen muss. Dass man zweimal während der Nacht aufstehen muss zum Gebet – was hat Gott wohl davon, wenn ein paar Leute, denen die Augen fast zufallen, mechanisch ihre lateinischen Sätze herunterplappern? Aber damit nicht genug. Was ist das für eine unmenschliche Regel, nach der ein Sohn daran gehindert wird, mit seinem Vater zu sprechen, bevor der nicht des Langen und Breiten mit dem Abt gespeist und weiß Gott was alles beraten hat? Und selbst bei der Begegnung, als sie dann endlich stattfand, saß der hochwürdige Vater Abt dabei, die Hände in den Ärmeln seiner Kutte verborgen, ein scheinheiliges Lächeln auf dem glatten Gesicht, und hörte jedes Wort mit.
Er, Heinrich, weiß, was sein Abt für ein Mann ist: Freundlich und geschmeidig nach außen, wenn es darum geht, einen Vorteil zu erlangen, kalt und hochfahrend seinen Untergebenen gegenüber. Heinrichs Vater kennt nur die eine Seite, die angenehme. Er vertraut diesem Mann. Aber welchen Weg könnte es geben, auch nur das leiseste Misstrauen zu erwecken – wenn er und der Vater sich nicht einmal unter vier Augen sprechen dürfen?
Heinrich beißt sich auf die Lippe. Das, was sich vor vier Tagen ereignete, brennt in seinem Herzen. Er wollte auf den Vater zustürzen, ihn in die Arme schließen. Aber der Abt hatte ihn mit einer energischen Geste zurückgehalten. »Dein Vater, lieber junger Bruder Chrysostomus, bin jetzt ich. Dein leiblicher Vater hat geringeren Anteil an dir.« Und Kuno von Hartenfels hatte keinen Einwand erhoben.
Es war dann ein mattes Gespräch geworden. Die Mutter – der Bruder Philipp – die Pferde – das Land... Irgendwie hatte Heinrich den Eindruck gehabt, dass es dem Vater peinlich war, mit ihm zu reden. Sie hatten sich fast ein halbes Jahr nicht gesehen, und nun das. Immer mehr fühlte Heinrich die Entfremdung. Ja, man hatte ihn abgeschoben. Er gehörte nicht mehr dazu. Hartenfels, sein Zuhause, die Mutter, der Bruder, seine Kindheit... Alles vorbei.
Berthold räuspert sich und Heinrich fährt herum. »Was willst du mir sagen?«, fragt er feindselig. »Komm mit, weg vom Fenster, lass die Bücher, geh zum Gebet, tu deine Pflicht als Mönch, nicht wahr?«
»Ich will dir sagen, dass wir irgendwann zur None müssen, du weißt, die neunte Stunde des Tages... und dass ich verstehe, was in dir vorgeht.«
»So, tust du das?«
»Ich bin auch mit fünfzehn ins Kloster gekommen, wie du. Ich weiß, wie hart es einen jungen Menschen ankommt. Immerhin, du bist nun schon zwei Jahre hier und es könnte dir schlechter gehen. Nicht jeder genießt so viel Vorzüge wie du. Diese Bibliothek steht Novizen sonst kaum offen.«
»Außer wenn sie vom reichen Hartenfels kommen und eine beträchtliche Schenkung eingebracht haben, ich weiß!«, sagt Heinrich bitter. »Aber das macht es mir nicht einfacher. Ich bin kein Mann der Feder, sondern als Ritter geboren! Ich und mein Bruder, wir haben miteinander das Waffenhandwerk erlernt und...«
»Chrysostomus! Niemand ist als irgendetwas geboren. Und deine Eltern haben dich nun einmal für den geistlichen Stand bestimmt, um für sie zu beten.«
Heinrich ballt die Fäuste. »Nicht einmal umarmt hat er mich!«, bricht es aus ihm heraus. »Als wäre ich gar nicht sein Fleisch und Blut! Dieser schändliche Severin hat es verhindert!«
»Dass du so vom Vater Abt sprichst, habe ich überhört. Wie wir über ihn denken, Chrysostomus, ist eine andere Sache.« Er räuspert sich, schlägt die Augen nieder. »Und nun...«
»Ja, ich weiß. Bereitmachen zur None...«
»Heinrich.« Ja, manchmal spricht ihn Berthold sogar mit seinem Namen an! Der Bibliothekar legt ihm den Arm um die Schulter. Väterlicher als sein Vater – Heinrich kämpft gegen die aufsteigenden Tränen. Was soll er nur hier!
»Heinrich. Lerne, dich zu fügen. Oder du wirst unglücklicher, als es nötig ist. Gott wird dir beistehen.«
»Das hoffe ich.« Er atmet tief durch, löst sich von Berthold, geht noch einmal ans Fenster. Sein Blick wandert über Wälder und Flur, folgt der Straße, auf der er vor fast zwei Jahren hier eingezogen ist. Die Mutter hatte vergebens versucht, ihn zu beschwichtigen damals. »Sei vernünftig, es kann nur einen Erben deines Vaters geben. Das Klosterleben hat viel für sich. Du kannst für uns alle beten, wirst ein gebildeter Mann!« – Aber er wollte sein Leben selbst in die Hand nehmen, wollte nicht, dass andere über ihn bestimmten, so wie die Gemeinschaft der Ordensbrüder hier in diesem Kloster.
Plötzlich zuckt er zusammen. Sein scharfer Blick hat einen Reiter entdeckt, das Pferd im gestreckten Galopp.
Das Pferd, ein Rappe mit Silberschweif, so selten wie Silber im Minengestein, gehört seinem Vater. Dann erkennt er auch das Wappen auf der Schabracke, sein Wappen, das Wappen derer von Hartenfels: den Greif, die Tanne, die gekreuzten Lanzen.
Kommt der Vater heute noch einmal zurück? Diesmal wird er, Heinrich, sich nicht aufhalten lassen, wird als Erster an der Pforte sein! Sein Herz klopft ihm wie wild im Hals. Und in welcher Eile der Vater ist! Wie es aussieht, hat er sein Gefolge weit hinter sich gelassen. Hoffnung, eine wilde, unsinnige, brennende Hoffnung steigt in ihm auf. Vielleicht hat der Besuch bei dem Abt vor vier Tagen ja einen völlig anderen Grund gehabt, als nur zu beichten und die Geschäfte zu besprechen. Vielleicht waren ja die Zurückhaltung des Vaters, die Kälte Severins Ergebnis eines Gesprächs: Heinrich taugt nicht fürs Kloster? Heinrich kann wieder nach Haus?
»Siehst du das? Siehst du das, Berthold? Mein Vater! Irgendetwas ist geschehen! Irgendetwas – wird anders!«
Er stürzt an dem Bibliothekar vorbei, rennt durch die Bibliothek – ein schwerer Verstoß gegen die Verhaltensregeln des Klosters. Berthold sieht ihm kopfschüttelnd nach. Was macht sich der Junge für Hoffnungen? Wer einmal im Kloster ist, den lassen diese Mauern nicht mehr los – und schon gar nicht, wenn der Abt Severin heißt.
Heinrich rennt die Treppe hinunter, schubst andere Mönche beiseite, die auf dem Weg zum None-Gebet in der Kapelle sind. Stürzt über den Innenhof zum großen Tor. Er trommelt dem verdatterten Mönch, der Torwache schiebt, mit den Fäusten auf die Brust. »Öffne, öffne, öffne!« Der andere, ein Novize so wie er, weiß, dass mit Bruder Chrysostomus nicht zu scherzen ist, wenn er seine Anwandlungen von Jähzorn hat. »Wilder Stier« nennen sie ihn hinter seinem Rücken. Er stellt keine Fragen. Heinrich hilft ihm, den schweren Bolzen, der als Riegel dient, hochzuwuchten, und öffnet das Klostertor.
Der Reiter ist schon nahe, die Hufe des Pferdes schmatzen im Schlamm.
Heinrich starrt ihm entgegen. Nein, nicht der Vater! Es ist Philipp, der Bruder!
Philipp entdeckt ihn im Dunkel des Torbogens zu spät, um anzuhalten. Das schäumend nasse Pferd donnert an Heinrich vorbei, Hufeisen klirren im gepflasterten Hof. Er wendet und kommt zurück. Sie begegnen sich in der Mitte des Hofes.
Philipp gleitet aus dem Sattel des keuchenden Pferdes, sein Gesicht ist verzerrt und schweißbedeckt, als er auf den Bruder zugeht. »Heinrich! Vater ist tot!«
Heinrichs Arme, die er erhoben hatte, um seinen Zwilling in die Arme zu schließen, sacken herunter. »Was sagst du da?«, flüstert er tonlos. »Das... das kann ich nicht glauben!«
Er starrt den anderen an – sein Spiegelbild. Schüttelt den Kopf. Lacht kurz auf. »Das ist doch nur ein böser Traum, nicht wahr, Philipp? Vater... Ein Mann in den besten Jahren... Er war nie krank, er war so voll Kraft und... Vor ein paar Tagen war er noch hier...« Er verstummt.
»Er ist tot«, wiederholt Philipp. »Gott hat ihn zu sich gerufen.«
Heinrich muss die Augen schließen. Ihm ist schwindlig. Der Geruch des Pferdes, das neben ihm nervös aufs Pflaster stampft, dringt in seine Nase. Vaters Pferd! Auf einmal, einen Augenblick lang, kommt es ihm vor, als sei er mit dem Bruder zusammen auf Hartenfels, sie beide auf ihren ersten Pferden, der Vater auf Silberschweif, und er lehrt sie Volten und kunstvolle Paraden reiten, wie man sie bei einem Turnier braucht. Die Mutter steht oben am Altan und sieht zu – ängstlich, dass ihren Söhnen ja nichts zustößt. Das Pferd Silberschweif, von irgendetwas erschreckt, steigt unversehens in die Luft, aber der Vater sitzt im Sattel wie verwachsen mit dem Tier, und er lacht …
Jetzt reitet Philipp das Pferd. Philipp, der Erbe von Hartenfels …
Plötzlich stürzen Heinrich die Tränen aus den Augen. Etwas wird anders, hatte er gedacht. Oh ja. Etwas ist anders geworden. Er versucht, sich zu fassen. »Komm, Bruder. Komm mit mir.«
Später sitzen die Zwillingsbrüder in Heinrichs Klosterzelle. Heinrich hockt auf der Kante seines schmalen Bettes, die Stirn in die Hände gestützt. Den einzigen Stuhl am Studiertisch gegenüber dem Fenster hat er Philipp überlassen.
»Ich versteh es nicht«, murmelt Heinrich. »Ich habe ihn vor ganzen vier Tagen hier im Kloster gesehen. Es ging ihm gut!«
Er sieht auf, sieht seinem Bruder in die geröteten Augen. »Was ist geschehen?«
Philipp schüttelt den Kopf. »Wir wissen es nicht. Als er heimkam von seinem Besuch und vom Pferd stieg, sagte er, dass ihm nicht wohl sei. Er schlug das Abendmahl aus und legte sich ins Bett. Nach Sonnenuntergang schickte unsere Mutter die Magd, um nach ihm zu sehen. Da hatte er schwere Krämpfe. Es hat ihn förmlich geschüttelt. Mutter hat noch in der Nacht den Medikus rufen lassen. Der meinte, dass Vater lediglich unwohl am Magen sei, und hat etwas Holzkohle verordnet. Und tatsächlich wurde es nach zwei Tagen besser, die Krämpfe ließen nach, es schien vorbei zu sein. Wir warteten nur darauf, dass Vaters Appetit zurückkehrte. Er konnte wieder schlafen. Aber eigentlich war das mehr eine Ohnmacht als ein Schlaf. Gestern Abend ist die Mutter zu ihm hinaufgegangen. Und da... da war er tot... einfach so...«
»Kein Mensch stirbt einfach so!«, braust Heinrich auf. Seine Trauer schlägt plötzlich um in Wut, so ist das immer bei ihm. Immer wird er wütend, wenn etwas ihn verletzt.
Philipp betrachtet ihn stumm. Manchmal hat Heinrich das Gefühl, dass Philipp sich entschuldigen möchte dafür, dass er der Ältere ist, dass ihm das Leid tut. Als er damals als Zwölfjähriger seinen Bruder unabsichtlich im Schwertkampf verletzte und das hellrote Blut über Heinrichs Jochbein und Lippen strömte, war es Philipp, der zu weinen begann, nicht Heinrich. Der presste die Zähne zusammen.
»Was ist mit Mutter?«, fragt Heinrich jetzt.
Philipp wendet seinen Blick ab, sieht hinaus, zeigt dem Bruder sein Adlerprofil, Heinrichs eigenes Profil. »Sie wird ins Kloster gehen. Unser lieben Frauen... Du weißt schon, sie hat sich immer wohl gefühlt da, wenn sie zur Beichte ging oder zu einer längeren Andacht. Sie hat gesagt, sie möchte auf dieser Welt mit keinem Mann mehr zusammen sein.«
Heinrich zuckt die Achseln. So ist die Mutter. »Und, Philipp, was wird aus dir?«
Philipp greift in sein Wams und holt ein Dokument heraus, eine Rolle, die mit dem Wappen derer von Hartenfels gesiegelt ist. »Vaters Testament.« Er reicht es Heinrich. »Es ist schon seltsam, weißt du... dass er gerade bei seinem letzten Besuch hier ein neues aufgesetzt hat.«
Heinrich nimmt die Rolle, dreht sie hin und her. »Hältst du das für Zufall?«
Philipp schüttelt den Kopf.
»Wen hat er zum Vollstrecker ernannt?«
»Severin!«, platzt Philipp heraus.
Heinrich wiegt die Pergamentrolle auf der Hand. Sagt nach einem Moment des Schweigens: »Warum kann ich unseren Abt eigentlich nicht leiden?«
»Vater hat immer gute Geschäfte mit ihm gemacht. Und er war sein Beichtvater. Es gibt keinen Grund, ihm zu misstrauen.« Philipp klingt so, als wenn er sich selbst überzeugen müsste.
»Wirklich nicht? Trotzdem findest du es merkwürdig, das mit dem Testament, oder? Deshalb hast du es ja mitgebracht.«
Der Bruder blickt vor sich hin.
Heinrich sagt entschieden: »Du hast Severin nie näher kennen gelernt, ich schon. Ich halte ihn für einen Raffzahn. Er denkt nur ans Weltliche. In den zwei Jahren, die ich hier bin, ist der Klosterbesitz um dreißig Morgen Land gewachsen, eine ganze Hufe! Vergangenes Jahr hat er sich die Kanzel vergolden lassen. Ein Novize, der ihn bedient, hat erzählt, dass seine Gemächer voll der Kisten und Truhen mit Gold und anderen Kostbarkeiten sind. Ein selbstloser Diener Gottes!« Heinrich schnaubt verächtlich durch die Nase. »Na, dann wollen wir uns die Angelegenheit mal ansehen, was? Hast du den Siegelring dabei?«
Philipp starrt ihn an. »Wie kommst du darauf?«
»Wenn du dies Papier mitgebracht hast, dann, damit wir es lesen. Und wenn wir es lesen, müssen wir das Siegel erbrechen – und hinterher wieder verschließen. Also?«
Der Bruder lächelt schief, sein Gesicht noch verhangen von Trauer, aber doch auch verschmitzt. Aus den Taschen seines Gewandes holt er den großen Siegelring ihres Vaters hervor.
Heinrich erbricht das Siegel. »Vielleicht enterbt er dich ja und setzt mich als Erben ein«, sagt er gleichmütig.
Philipp kann nicht lachen. Er sieht den Bruder traurig an.
»Verzeih mir!« Heinrich weiß, dass er dummes Zeug geredet hat, und will nun darüber hinwegreden. »Siehst du: Einen Vorteil hat es ja, dass man mich ins Kloster gesteckt hat: Ich kann lesen.«
Sein Bruder nickt ernst. »Ja, Heinrich. Ich würde es auch gern können.«
Heinrich studiert das Dokument sorgfältig. Er kann nichts Verdächtiges darin entdecken. Philipp, Kunos ältester lebender Sohn – zwei Brüder und eine Schwester sind gestorben, bevor die Zwillinge zur Welt kamen -, wird zum Erben des befestigten Stammhauses, der dazugehörigen Gehöfte und Ländereien eingesetzt. Lediglich am Ende des Dokuments stutzt Heinrich. Eine Passage gefällt ihm nicht. »Warum wird denn Severin bis zu deiner Mündigkeit zum Verwalter gemacht?«, fragt er mit finsterem Blick.
Philipp zuckt die Achseln. »Wohl seitdem unsere Mutter ihren Entschluss verkündet hat, ins Kloster zu gehen, falls Vater etwas zustößt.«
Heinrich wirft ihm einen scharfen Blick zu. »Wie lange ist das her?«
Philipp überlegt. »Nicht lange.«
Heinrich grübelt. »Dann hat Severin den Vater bestimmt zu dieser Passage überredet. An und für sich ist es ja nicht einmal unvernünftig. Aber irgendein Haken muss an der Sache sein. Ich kann ihn bloß nicht finden, noch nicht.«
»Du bist zu misstrauisch, Bruder.«
»Das warst du doch auch, sonst hättest du das Testament nicht bei dir.«
Philipp seufzt. »Ich muss es dem Abt übergeben«, sagt er. »Das ist Vaters Wille.«
Heinrich nickt, erhebt sich, nimmt eine Kerze vom Bord, tritt vor die Tür und entzündet sie an der immer brennenden Fackel im Gang. Dann lässt er das Siegelwachs über der Flamme schmelzen, vorsichtig, damit das Pergament kein Feuer fängt, und siegelt es erneut. Philipp lässt den Ring wieder in der Tasche verschwinden und nimmt das Dokument an sich.
Heinrich blickt hinaus, berechnet den Stand der Sonne. »Es wird bald zum Komplet läuten, zum Nachtgebet. Du solltest den Abt aufsuchen, bevor er sich zur Ruhe begibt. – Begleitest du mich in die Kapelle? Wir müssen für unseren Vater beten.« Philipp nickt, steht auf. Gemeinsam durchschreiten sie den Kreuzgang im Innenhof, zwei große, ernste Jungen, Mönch und Ritter mit dem gleichen Gesicht.
ZWEITES KAPITEL
Friede seiner armen Seele! Ich werde Messen für ihn lesen lassen. Euer Vater war ein guter Mensch, gewiss wird er das Paradies erwerben.«
Severin, Abt des Klosters Mariä Heimsuchung, hat eine geschulte Stimme. Jetzt bebt sie vor Mitgefühl.
Er sitzt in seinem mit Elfenbein beschlagenen Lehnsessel, hält die versiegelte Pergamentrolle in seiner behandschuhten Hand. Hat wohl nicht vor, sie zu öffnen. Wozu auch. Er kennt ja den Inhalt, er ist in seinem Beisein von einem Klosterschreiber aufgezeichnet worden.
Die Zwillinge stehen vor ihm, aber für ihn scheint Heinrich gar nicht vorhanden, er spricht nur mit Philipp. Man merkt ihm an, dass er es eigentlich für unschicklich hält, dass der Mönch sich erlaubt, ungerufen zu ihm zu kommen. Er duldet ihn nur neben dem Bruder.
»Nun, Junker Philipp, als Euer Vormund werde ich Euch demnächst auf Hartenfels besuchen, um Euch gemeinsam mit dem Verwalter Eures Vaters einzuweisen in Euer Eigen. Ist die Mutter schon abgereist ins Kloster?«
Philipp schüttelt den Kopf. »Nein, hochwürdiger Herr Abt. Der Vater ist ja noch nicht einmal unter der Erde! Und wegen dieser – dieser Übernahme des Erbes müsst Ihr Euch nicht nach Hartenfels bemühen. Unser Verwalter ist ein redlicher Mann, der mir das gewiss auch ohne Eure Anwesenheit alles erklären wird.«
Abt Severin ist ein schöner Mann mit edlen Gesichtszügen. Aber seine Augen sind so kalt wie Quellwasser und aus diesen Augen trifft jetzt ein nicht gerade freundlicher Blick den jungen Mann. »Das, Junker, müsst Ihr schon mir als Eurem Vormund überlassen! Und auch die Redlichkeit oder Unredlichkeit eines Menschen einzuschätzen, bin ich eher in der Lage als Ihr, glaubt mir! Amt und Alter befähigen mich dazu.«
Philipp hebt abwehrend die Hände. »Herr Abt, verzeiht, ich wollte Euch nicht zu nahe treten!«, sagt er fest. »Ich will nur Umstände vermeiden. Glaubt mir, Ihr müsst Euch nicht bemühen. Der Verwalter hat meinem Vater treu gedient, warum sollte er auf einmal zum Betrüger werden?«
Severins schmale Lippen scheinen noch schmaler zu werden. Er strafft sich, schlägt sich mit der Schriftrolle ungeduldig in die offene Hand. »Unterwerft Euch meiner Führung, Junker! Ich bin Euer Vormund! Und gebt keine Widerworte!«
Heinrich mischt sich ein. »Um Vergebung, Hochwürden! Aber mein Bruder hat doch gar nicht...«
»Dass du ein vorlauter Bursche bist, Bruder Chrysostomus, das ist mir nichts Neues!«, unterbricht ihn der Abt mit schneidender Stimme. »Hat dich jemand gefragt? Klosterdisziplin, verstanden?! Ich hoffe, Junker Philipp ist als dein Zwilling nicht aus gleichem Holz geschnitzt. Ihr könnt gehen.« Er schlägt ein elegant-flüchtiges Kreuzzeichen in Richtung der beiden, dreht den Kopf zur Seite.
Heinrich und Philipp sehen sich an. Der Jüngere ist rot geworden vor Ärger. Philipp kennt das, kennt den Jähzorn des Bruders und legt ihm begütigend die Hand auf den Arm. Dann sagt er ruhig, aber entschieden: »Hochwürdiger Abt, verzeiht, aber Hartenfels wird in den Jahren bis zu meiner Mündigkeit treulich weiter den Klosterzins zahlen, und gern bin ich bereit, ein Pfund Silber draufzulegen jedes Mal zu Weihnachten, um Seelenmessen für meinen Vater lesen zu lassen und als Almosen für Eure Armen. Aber eine Inspektion meines Besitzes wird nicht stattfinden.«
»Noch so ein Querkopf?« Der Abt trommelt mit den Fingern auf die Lehne seines Sessels. Offenbar beherrscht er sich nur schwer. »Der eine wie der andere! Ite! Geht! Fort mit euch. Was ich gesagt habe, geschieht.«
Philipp lenkt ein. Wenn es hart auf hart kommt, sitzt der Abt, mit diesem Testament in der Hand, am längeren Hebel. »Herr Abt! Bitte! Schickt uns so nicht fort! Ich wollte Euch fragen, ob Ihr Heinrich – ich meine Chrysostomus – Urlaub gewährt zu der Beerdigung des Vaters!«
»Wenn seine Aufführung hier im Kloster nicht zu wünschen übrig lässt – gewiss. Besprecht das mit dem Bruder Administrator.« Eine Handbewegung, die beiden sind entlassen. Wie es Sitte ist, küssen sie den Ring des Herrn Abtes, gehen mit Verbeugungen zur Tür.
Auf dem Gang sehen sich die Jungen an.
»Oh, ich könnte ihn...« Heinrich macht mit beiden Händen die Bewegung des Hals-Zudrückens. »Verstehst du nun, was ich meine?«
Philipp nickt. »Warum ist er gleich so aus der Haut gefahren? Ich hab doch bloß Umstände vermeiden wollen!«
»Dafür hast du aber ganz schön aufgetrumpft.«
»Hab ich das? Nun ja, ich sag dir ehrlich, mir ist es zuwider, dass die Mönchsnasen in unseren Büchern herumstöbern.«
Heinrich lächelt verächtlich. »Er will dich unter Kontrolle kriegen, das ist es! Pass bloß auf! Irgendwann entlässt er unseren – ich meine euren – Verwalter, behauptet, der hätte eine Sache veruntreut, und setzt jemanden von seinen Leuten ein. Und dann wird der Hartenfels-Besitz schön zusammenschrumpfen, glaub mir. Er wird schrumpfen wie ein Apfel im Backofen. In den paar Jährchen bis zu deiner Mündigkeit wird er es zwar nicht schaffen, alles an sich zu reißen, aber -«
»Wozu muss ich überhaupt den geistlichen Vormund haben?« unterbricht der Bruder ihn. »Das ganze Testament kommt mir merkwürdig vor, nachdem ich ihn so gehört habe. Aber unser Vater hat ihm vertraut.«
»Schade, dass du das Papier im Kloster hinterlegen musst. Du hättest es sonst bei einem Notarius überprüfen lassen können.«
»Und was soll das bringen? Ein Notarius, das ist nur ein Bürger. Was kann so ein Mann gegen einen Herrn vom geistlichen Stand?«
»Täusch dich mal nicht. Ich hocke zwar hinter den Klostermauern, aber von der Welt erfährt man hier vielleicht mehr als auf einer Burg. Der junge König Friedrich, so hab ich gehört, hat mehr Notare in seinem Gefolge als Pfaffen, und von Recht und Justiz hält der sehr viel. Da kommen andere Zeiten.«
Philipp sieht ihn zweifelnd an. Was soll das jetzt mit den Notaren dieses neuen Königs? Dafür ist ihre Sache hier doch viel zu unbedeutend. Gewiss, auch er weiß von dem jungen König Friedrich, der aus Italien kommt, das »Kind aus Apulien«, der durch die deutschen Lande reist, seiner Krönung in Aachen entgegen. Es heißt, er sei ein gerechter Mann, von rascher Auffassungsgabe, der ohne langes Zaudern seine Entscheidungen trifft... Aber das Testament derer von Hartenfels – das ist mehr als einen Deut zu klein für die Kanzlei eines Königs, oder?
Er schüttelt den Kopf. »Heinrich, bleib auf dem Boden.«
Doch der blickt den Bruder ernst an.
»Friedrich ist kein gehorsamer Diener der Kirche, das wissen alle. Er macht, was er will. Bei den Klosterleuten hier hat er jedenfalls einen denkbar schlechten Ruf. Und schließlich«, er schnaubt verächtlich durch die Nase, »muss es doch jemanden geben, der auch solchen Aasgeiern wie dem Abt dieses Klosters die Flügel beschneidet!«
Philipp sieht ihn mit offenem Mund an. »Wie du von diesem Mann redest...«
»... so wirst du auch bald von ihm reden.« Heinrich bleibt fest. »Es wäre wirklich keine schlechte Idee, das Testament noch einmal zurückzufordern und überprüfen zu lassen, von wem und wo auch immer. – Du bleibst über Nacht?«
Sie sind den Wandelgang entlanggegangen, stehen jetzt an einer Durchgangstür. Irgendetwas huscht ins Dunkel.
»Was war denn das?«
»Eine Fledermaus oder ein Spitzel des Abtes«, sagt Heinrich grimmig. »Der hat seine Ohren überall.«
»Nun, wir haben nichts Unrechtes gesagt.«
»Nein. Und wenn er weiß, dass du vielleicht nicht alles so hinnimmst, wie er sich das vorstellt, dann ist das nur von Nutzen, denke ich.«
Philipp nickt. »Morgen werde ich vor dem Frühlicht aufbrechen. Die Beerdigung des Vaters muss vorbereitet werden. Lass uns lieber jetzt schon Abschied nehmen.«
Die Geschwister umarmen sich. »Wir sehen uns am Grab des Vaters, Heinrich.«
»Ja, wenn Severin mich lässt.«
»Ach, Bruder. Du hast das erste Gelübde abgelegt. Das bindet dich für drei Jahre. Und wenn das um ist – vielleicht willst du dann wieder in den weltlichen Stand zurückkehren? Der Wille des Vaters ist nicht unbedingt auch der meine. Hartenfels ist reich, es kann mehr als nur einen Erben ernähren.«
Heinrich spürt einen Kloß im Hals. »Danke für deine Liebe und Treue«, sagt er rau. »Ich will’s überlegen.«
Nichts wie fort!, denkt er. Falls die sich nicht einen Trick einfallen lassen, um mich für immer hier zu behalten.
Ein Laienbruder mit einer Fackel geleitet Philipp in den Trakt, wo es Gastzellen gibt. Heinrich sieht ihm nach, dem langen, knochigen Jungen mit dem schlaksigen Gang und dem blonden unordentlichen Haarschopf, seinem Ebenbild, bevor er sich in die Kapelle begibt, um für die Seele des Vaters Gebete zu sprechen und sich endlich den Tränen hinzugeben.
Er ahnt nicht, dass er den Bruder das letzte Mal gesund und munter sieht.
»Bruder Chrysostomus! Um Gottes Barmherzigkeit willen, schnell! Kommt zur Pforte!« Heinrich schreckt auf von dem Pergament, das er mit einer farbigen Initiale zu versehen die Aufgabe hatte – er ist ein geschickter Zeichner. Vor Schreck gleitet ihm die Feder aus der Hand und verdirbt das Blatt mit einem langen roten Strich.
»Was ist denn? Warum schreist du so?«
Ein Laienbruder steht mit weit aufgerissenen Augen in der Tür der Cella, ringt nach Atem.
»Dein Bruder... der Junker von Hartenfels...«
»Was ist mit ihm?«
»Sie bringen ihn gerade... Unterwegs... Räuber...«
Heinrich erhebt sich langsam. Ihm ist, als wenn sich eine große dunkle Wolke über ihn senken würde. »Ich komme«, sagt er mit lahmen Lippen. Räuber? Wirklich Räuber? Die Straßen, so heißt es, sollen sicherer geworden sein in der letzten Zeit, seit der junge König für Ordnung sorgt …
Im Durchgang zum Pförtnerhäuschen ein Gewimmel von Kutten.
»Der Bruder Medikus! Wo ist der Bruder Medikus?«, ruft jemand mit schriller Stimme.
»Hier! Hier bin ich!« Der kleine Mönch mit dem weißen Haarkranz um die Tonsur kommt mit geschürzter Kutte gerannt. »Gott, erbarme sich seiner Seele!«
Heinrich drängt sich durch die Mönche hindurch. Endlich merken sie, wer er ist, weichen zur Seite. Nur der Arzt kniet noch neben dem Mantel, der da auf dem Boden ausgebreitet ist.
Blut. Überall Blut. Wie kann in einem Menschen nur so viel Blut sein.
Philipp liegt auf dem Rücken. Es ist nicht eine Wunde. Mindestens drei. Der Schwertarm ist überm Handgelenk bis auf den Knochen durchtrennt. Er hat sich also zunächst verteidigt. Dann, nachdem sie ihn kampfunfähig gemacht haben, wurde er abgeschlachtet. Ein Stich in die Brust, unterhalb des Herzens. Da ist das Blut schon dunkel verkrustet. Und eine Wunde klafft am Hals. Das war wohl die tödliche.
Heinrich steht neben dem Bruder mit hängenden Armen. Es ist ihm, als wäre er unfähig, sich zu bewegen. Mein Zwilling. Mein anderes Ich. Während ich in der Cella sitze und schöne Initialen male …
»Was ist geschehen?«, hört er sich fragen und erkennt seine eigene Stimme nicht. Hört die Antworten. Räuber eben. Auf dem Waldweg bestimmt. Er hat noch entkommen können, ist halb tot auf seinem Pferd bis vor die Klostermauern geritten, um Schutz zu suchen. Der Bruder Pförtner hat ihn vom Ausguck gesehen. Da ist er schon vom Pferd gesunken. Sie haben ihn auf seinem Mantel hereingebracht. Das ist alles?
Der Bruder Medikus richtet sich auf. »De profundis clamavi!«, murmelt er und schlägt das Kreuz. »Da ist nichts mehr zu hoffen. Er ist so gut wie tot. Der hochwürdige Abt wird ihm in Articula Mortis die Letzte Ölung erteilen.«
Irgendwer bringt eine Bahre, um den Körper in die Kapelle zu schaffen.
»Lasst mich!«, sagt Heinrich. Er stößt die anderen beiseite, packt den schlaffen Körper seines Bruders, bettet ihn vorsichtig auf. Ihm ist egal, wie sehr er sich dabei mit Blut beschmiert. Philipps Leib ist noch warm, und Heinrich kommt es vor, als bewege kaum merklicher Atem seine Brust. Aber wer soll überleben bei so viel Blutverlust?
Er geht neben der Bahre her auf dem Weg zur Kapelle, seine Hand umklammert die Hand des Bruders, als könnte er ihn festhalten. Sein Kopf ist leer, wie ausgebrannt.
Ein Wiehern. Jemand führt den Rappen mit dem Silberschweif, den Stolz des Hauses Hartenfels, an ihnen vorbei zum Stall. Die Hufe klappern auf dem gepflasterten Hof. Heinrich sieht kurz auf. Merkwürdig. Die Räuber haben das mit edlem Metall beschlagene Geschirr des Tiers nicht angerührt. Auch die Satteltaschen sind da. Wie ist Philipp überhaupt entkommen? Er muss sich im letzten Moment durch die Flucht entzogen haben. Denn auch seine Gürteltasche scheint unversehrt. Man hat es nicht geschafft, ihn auszurauben. Und der Siegelring des Vaters steckt sogar am Finger der Linken.
Heinrich sieht dem Pferd nach. Links, wo man aufsteigt, ist das Fell des Rappen streifig blutverschmiert. Das Tier tänzelt an der Hand des Führenden, dreht sich. Rechts ist kein Blut. Hat Philipp zu Fuß gekämpft und ist erst später wieder aufgesessen?
»Mein armer Sohn!« Das ist die wohlklingende Stimme des Abtes. »Gott straft dich wirklich schwer. Erst den Vater, dann den Bruder zu verlieren. Aber die Wege des Herrn sind unerforschlich. Denke an Hiob und sieh es als Prüfung deines Glaubens an.«
Der Weihrauch weht Heinrich um die Nase. Sie sind in der Kapelle. Severin beginnt mit der Erteilung des Sterbesakraments. Irgendwo summen die Brüder eine Liturgie. Heinrich liegt auf den Knien, blickt mit tränenlosen Augen ins Leere.
Der Körper des Bruders wird in die Sakristei getragen.
»Lasst mich Abschied nehmen, hochwürdiger Abt«, bittet Heinrich leise. Und dann ist er mit Philipp allein. Das Gesicht des Bruders ist bleich, eingefallen, die Augen geschlossen. Hat er wirklich aufgehört zu atmen? Heinrich sieht sich suchend um, greift nach einem blanken silbernen Abendmahlskelch, der dort auf dem Bord bereitsteht, hält ihn Philipp vor die Lippen. Da! Das Silber beschlägt. Philipp ist noch nicht tot!
»Bruder! Oh mein Gott, Philipp! Geh nicht! Lass mich nicht allein!« Wieder greift Heinrich nach der Hand des anderen. Und plötzlich – ihm stockt vor Schreck fast der eigene Atem – hört er die leise, verlöschende Stimme des Bruders, er flüstert etwas.
Heinrich beugt sich über ihn, neigt das Ohr zu diesem Mund. »Was sagst du, Philipp? Was?«
»Vom Kloster... die Knechte... die Klosterknechte, sie...«
»Was war mit den Klosterknechten? Haben sie dich gefunden?«
»Haben... gekämpft... haben erschlagen«, haucht der Sterbende. »Abt Severin...« Er röchelt, sein Kopf fällt zur Seite. Nun ist er wirklich tot.
DRITTES KAPITEL
Schritt, Schritt, Schritt. Heinrich weiß nicht, wohin ihn seine Füße tragen. Er läuft von der Kapelle aus in den Klostergarten, von dort wieder nach drinnen, durchs Refektorium, den Speisesaal des Klosters, ist kurz in der Bibliothek und schaut um sich wie ein Geist. Keiner wagt, ihn anzusprechen, alle weichen ihm aus. Der starrt vor sich hin, die Hände hängen, zu Fäusten geballt, an ihm herab, und sein langnasiges, schmales Gesicht, bleich und starr, erinnert die, die den Toten gesehen haben, so sehr an den Bruder, dass es sie schaudert. Es ist, als ginge der Verstorbene herum …
Hat Philipp das wirklich gemeint, was er da vor seinem letzten Seufzer gesagt hat? Hat er sich vielleicht in seiner Todesqual nur etwas eingebildet? Und konnte er, Heinrich, das Geflüster überhaupt verstehen? Es ist so ungeheuerlich, dass es eigentlich nicht sein kann.
Heinrich ist jetzt bei den Stallungen angelangt. Er will noch einmal zu dem Rappen des Bruders, will diese merkwürdigen Blutspuren in Augenschein nehmen. Spuren, die zumindest darauf hindeuten könnten, dass Philipp keinem Raubüberfall, sondern Meuchelmördern erlegen ist, dass sie ihn für tot liegen ließen und er sich mit letzter Kraft aufgerafft hat, um hierher, zu dem Bruder, zu reiten und ihm etwas mitzuteilen.
Aber der Rappe ist abgesattelt und geputzt und steht friedlich Hafer malmend im Ständer. Alle Spuren beseitigt. Der Sattel liegt auf einer Stange. Heinrich untersucht die Taschen. Ein Geldbeutel, unversehrt. Nein, Räuber waren das nicht.
Was nützt die ganze Grübelei. »Haben gekämpft... Haben erschlagen« – das könnte genauso gut heißen, dass sie gegen die Räuber gekämpft haben. »Abt Severin...« Vielleicht wollte Philipp dem Abt noch irgendetwas sagen. Wer weiß. Sieht er, Heinrich, Gespenster?
Sein Weg führt ihn an den Quartieren der Wachmannschaft vorbei. Die Männer sind offenbar gerade herein, haben ihre Waffen geputzt und ihre Lederwämser zum Auslüften nach draußen gehängt. Von drinnen kommt aufgeregtes Stimmengewirr. Man zankt sich.
Heinrich lehnt sich an die sonnenbeschienene Mauer, schließt die Augen. Was die wohl für Sorgen haben, dass sie so lautstark disputieren! Sorgen, die verschwindend klein sind gegen seinen Kummer. Er fängt Brocken des Krawalls auf.
»Wer hätte denn gedacht, dass der sich derartig wehren kann! Ein Bengel von siebzehn!«
»Na gut, der Abt war nicht gerade zufrieden...«
»Nicht gerade zufrieden? Na, du kannst untertreiben. Ich hab ihn selten so wütend erlebt. Und mit dem Extralohn wird es ja nun auch nichts. Also ich finde, du solltest uns alle dafür entschädigen, dass wir leer ausgehen, dein Wunsch war schließlich dieser blöde Kampf!«
»Das fehlte noch!«
»Und ihn dann auch noch liegen lassen. Also, fachmännisch ist das nicht!«
»Du solltest lieber damit aufhören, ehe du dich um Kopf und Kragen bringst.«
»Wenn du alles besser weißt, dann...« Mehr hört Heinrich nicht. Er hat sich abgestoßen von dieser verfluchten Mauer und rennt davon, als säße ihm der Teufel im Nacken.
In seiner Zelle wirft er sich aufs Bett und presst die Fäuste gegen die brennenden Augen. Was er da gehört hat, ist so ungeheuerlich, dass er es kaum fassen kann. Alles in ihm sträubt sich, es zu glauben. Ein Bengel von siebzehn? Der Herr Abt, nicht gerade zufrieden? Ihn für tot liegen lassen? Er wehrt sich dagegen und doch: Es passt alles zusammen. Dies Kloster ist ein Mörderhaus! Abt Severin hat Philipp umbringen lassen!
Er weiß nicht, wie lange er so gelegen hat. Es ist Nacht geworden inzwischen und er hat alle vorgeschriebenen Gebete und Gottesdienste versäumt. Er wird in Ruhe gelassen. Vorläufig.
Die dumpfe Betäubung des ersten Schrecks ist einem eisigen Entsetzen gewichen. Einem Entsetzen, das übergegangen ist in eine wilde, kalte Wut. Für Trauer wird später Zeit sein. Jetzt muss der Tod des Bruders gesühnt werden. Nur wie? Heinrich von Hartenfels gibt es nicht mehr. Es existiert ja nur Bruder Chrysostomus. Und der ist mit Haut und Haar dem Kloster geweiht. Das also war es, worauf Severin es von Anfang an abgesehen hatte: Das ganze Erbe von Hartenfels zu schlucken. Offenbar hatte er zunächst vorgehabt, während der Zeit der Vormundschaft über Philipp sich nach und nach der besten Stücke aus dem Familienbesitz zu bemächtigen. Sicher hat irgendeiner seiner Zuträger ihr Gespräch im Wandelgang belauscht. Und der Gedanke, dass Philipp dies Testament einem Notarius zeigen könnte – der wird ihm ganz und gar nicht gefallen haben. Er merkt, dass dieser junge Mann nicht wie Wachs in seinen Händen ist, sondern seinen eigenen Kopf hat, und da greift er kurz entschlossen zur direkten Lösung: Mord. Der letzte Junker von Hartenfels ist aus dem Weg. Das Erbe gehört – wie der Mönch Chrysostomus – dem Kloster, nun, nachdem der Vater so plötzlich gestorben ist.
Der Vater? Heinrich setzt sich auf, starrt mit weit offenen Augen ins Dunkel. Der Vater hat gerade bei Severin sein Testament geändert. Und dann ist er erkrankt... Er, der gesund war wie ein Stier. Der bestimmt noch seine zwanzig Jahre pralles Leben vor sich hatte. Er ist erkrankt, nachdem er mit dem Abt zu Mittag gespeist hatte.
Ein Mord? Zwei Morde? Vielleicht kommt es irgendwann nicht mehr darauf an? Heinrich stützt den Kopf in die Hände, wiegt sich hin und her. Ich muss es wissen. Es hat keinen Zweck, sich mit finsteren Vermutungen abzuquälen. Ich muss versuchen, es herauszubekommen.
Bruder Basilius. Ich werde Bruder Basilius fragen.
Basilius, der eigentlich Friedmar heißt, arbeitet als Gehilfe des Bruders Koch. Friedmar und Heinrich, vielmehr, innerhalb dieser Mauern, Basilius und Chrysostomus, verstehen sich gut. Den meisten Mönchen versucht Heinrich aus dem Weg zu gehen, aber Friedmar kennt er seit Kindertagen. Er ist ein Bauernjunge aus dem Dorf unterhalb von Hartenfels, der zwölfte Sohn seiner Eltern, und die Zwillingsbrüder Philipp und Heinrich haben als Kinder mit ihm gespielt. Nur dass sein Eintritt ins Kloster nicht mit einer größeren Spende an die heiligen Väter verbunden war, wie das beim Eintritt von adligen Junkern dazugehörte, denn Friedmars Eltern hatten selbst nichts. Und so muss eben Friedmar den Dreck wegräumen und als Küchenjunge schuften. Aber während jeder andere den Jungen behandelt, als wäre er ein Putzlappen, den er in der Hand hält, ist Heinrich freundlich, ja sogar kameradschaftlich zu ihm. Das trägt ihm hin und wieder einen Extrabissen aus der Küche ein – denn er ist ein großer Kerl und hat immer Hunger, und die Klosterkost ist, zumindest für die normalen Brüder, nicht gerade üppig.
Die Komplet ist längst vorbei. Heinrich entzündet eine Kerze an der Fackel im Flur und steigt die Stufen hinunter zur Küche. Meistens sitzt Friedmar-Basilius da noch bei irgendeiner Drecksarbeit, die nicht warten kann bis morgen; der Bruder Koch ist ein ziemlicher Stinkstiefel und schikaniert seine Untergebenen gern ein bisschen.
Richtig. In der großen Küche des Klosters flackert noch Lichtschein. Als Heinrich die Küche betritt, sieht er Friedmar zwischen zwei trüb brennenden Öllampen hocken, zwei Holzschüsseln stehen auf der Erde vor ihm. In den Händen hat er etwas, das er, wegen des schlechten Lichts, sehr dicht vor seine Augen hält und hin und her bewegt – er ist so versunken in seine Beschäftigung, dass er Heinrichs Kommen gar nicht bemerkt.
Heinrich reckt den Hals. Was macht der da Geheimnisvolles? Dann versteht er: Der arme Kerl muss bei dieser Beleuchtung Erbsen verlesen!
»Wünschst du dir nicht die Tauben aus der Mär, die die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen sortieren?«, fragt er halblaut mit müdem Scherz – und erreicht, dass Friedmar vor Schreck eine ganze Hand voll Erbsen zur Erde fallen lässt. Die kleinen runden Dinger kullern durch die Küche.
»Oh je!«, sagt der Junge. »Da hab ich ja mein Tun mit Aufsammeln!« Dann erst blickt er auf und erkennt Heinrich. In seinem dicken, freundlichen Gesicht malt sich Bestürzung. »Lieber Junker Heinrich, ich meine, Bruder Chrysostomus! Es tut mir ja so Leid! Der Herr und Euer Bruder – Gott straft Euch hart!« Er hascht mit beiden Händen nach Heinrichs Hand, zieht sie an sich und versucht, sie zu küssen, aber das lässt der andere nicht zu.
»Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich Gottes Werk ist, was da geschehen ist!«, sagt er rau. Er hat keine Lust, sich mit langen Vorreden aufzuhalten.
Friedmar macht große Augen. »Was meint Ihr damit?«
Heinrich zieht zwei Schemel heran und fordert den Jungen auf, sich neben ihn zu setzen. Dann neigt er sich vor zu ihm und flüstert: »Ich meine, dass der Teufel beide Male seine Hand im Spiel hatte, und sein Handlanger sitzt in diesem Kloster.«
Friedmar schnappt nach Luft. Er schaut über die Schulter und bekreuzigt sich hastig. »Versündigt Euch nicht, Bruder Chry…«
»Die Sünde ist wohl eher bei den anderen, Friedmar. Und du kannst mir helfen, ein Stück davon aus dem Dunkel zu holen.«
»Aber wie denn? Ich sitze doch hier nur tagaus, tagein in dieser finsteren Küche, ich weiß nichts, ich seh nichts – was soll ich denn tun?« Heinrich spürt, der Junge hat eine Heidenangst, dass er zu irgendetwas genötigt werden soll, womit er sich in die Nesseln setzt. Er legt ihm beruhigend die Hand aufs Knie. »Du sollst gar nichts tun, niemanden ausspionieren und keine geheimen Botschaften überbringen, wenn du an so etwas denken solltest – nichts dergleichen. Ich will dir bloß einige Fragen stellen. – Also, hör zu: Als mein Vater, Gott hab ihn selig, kürzlich hier war, hat er doch mit dem Abt zusammen gegessen. Warst du da auch in der Küche?«
Friedmar, froh, dass es sich nur um ein paar Auskünfte handelt, nickt eifrig mit dem Kopf. »Ja, natürlich. Der Bruder Koch hat ja was ganz Besonderes gemacht, und unser hochwürdiger Herr Abt ist sogar selbst in die Küche gekommen, um eigenhändig noch eine Zutat für den Sud zu bringen.«
»Ha!« Heinrichs wilder Ausruf lässt Friedmar zusammenzucken.
»Was ist denn?«, fragt er ängstlich und sieht sich wieder scheu um, ob nicht doch ein anderer in der Nähe ist.
Heinrich ballt die Fäuste, zwingt sich zur Selbstbeherrschung. »Alles in Ordnung«, sagt er. »Was kam denn auf den Tisch?«
»Zuerst eine Suppe von Hühnermägen, mit Eiern abgezogen. Ich musste extra noch frischen Dill aus dem Kräutergärtlein holen.«
»Hat da der Abt schon seine Zutat angeschleppt?«
»Ob er dazu was gebracht hat, weiß ich nicht«, sagt Friedmar treuherzig, »weil ich ja zu den Kräutern musste. Ich hab ihn nur einmal gesehen, nachdem der Fisch serviert worden war, bei der Fleischspeise. Am Tag vorher hatte er sich fast mit dem Bruder Koch gestritten.«
»Der Abt mit dem Koch?«
Der Junge nickt eifrig. »Unser hochwürdiger Abt wollte unbedingt ein Wildgericht mit einem Pilzsud. Aber der Bruder Koch hat ihm erklärt, dass ja noch Schonzeit ist und kein frisches Wildbret zu haben ist. Dann haben sie sich auf einen Ochsenbraten geeinigt, weil man dazu auch Pilze reichen kann. Unser Abt hat gesagt, sein Gast isst leidenschaftlich gern Pilze, und zu dieser Jahreszeit sind sie ja noch rar, aber er hätte einen kleinen Vorrat eingelegt zu seinem eigenen Verzehr.«
»Pilze? Unbedingt Pilze? Es stimmt, mein Vater hat Pilze sehr gern gemocht. Und dann, wie weiter?«
»Na ja, wie ich gesagt habe. Nach dem Fisch ist der hochwürdige Herr in die Küche gekommen und hat eigenhändig die getrockneten Pilze in den Sud getan.«
»Und abgeschmeckt auch?«
Friedmar hebt die Schultern. »Das hab ich nicht gesehen. Ich stand ja hinten beim Spülstein und hab die Krüge ausgewaschen. Ich hab nur gehört, wie der Bruder Koch gebrummelt hat, die hohen Herren würden auch immer verdrehter. Und am meisten hat er sich nachher geärgert, weil von dem Braten und dem Sud überhaupt nichts zurückgekommen ist. Er war wohl selbst spitz auf die Reste und diese besonderen Pilze hätte er wohl für sein Leben gern mal probiert.«
»Für sein Leben gern? Hm«, knurrt Heinrich. »Und? Hatten die etwa alles aufgegessen?«
»Nein, anders. Bruder Bonifazius, der aufgetragen hatte, der verstand das auch nicht. Er sagt, der Abt selbst hätte gar nichts von dem Gericht gegessen, er habe sich vorher an den Fisch gehalten. Und Bruder Bonifazius wollte so gern die Reste … Aber dann war die Schüssel weg.«
»Wieso weg?«
»Keine Ahnung. Alles weg. Sag ich doch. Das Gericht mitsamt der Schüssel war nicht mehr vorhanden, hat der dienende Bruder gesagt, der aufräumt. Wie weggezaubert.«
»In den Abtritt wird der hochwürdige Herr Severin seine Giftpilze gezaubert haben mitsamt der Schüssel, denke ich mal«, sagt Heinrich und erhebt sich. »Danke, Friedmar, dass du alles noch so genau gewusst hast.«
»Ja – aber – was meinst du – Giftpilze?« Friedmar stammelt. »Wieso denn...«
»Freund«, sagt Heinrich und legt dem Jungen brüderlich den Arm um die Schulter, »behalt’s für dich und sei auf der Hut – aber in dieser Abtei wohnt nicht der Geist des Herrn, sondern eine der größten Todsünden hat sich hier breit gemacht, und die heißt Habgier. Und die treibt die Menschen zu allen möglichen bösen Werken.«
»Der Herr bewahre uns und führe uns nicht in Versuchung!« Friedmar, völlig verwirrt, schlägt wieder das Kreuz.
»In Ewigkeit, Amen«, stimmt Heinrich zu. Er lacht. Es ist ein bitteres, zynisches Lachen.
»Junker Heinrich, ich versteh einfach nicht, was Ihr meint«, sagt der Junge ehrlich. »Ihr wollt doch nicht sagen, diese Pilze – die hätten etwas mit dem Tod des Herrn Kuno zu tun?!«
Heinrich steht da und möchte schreien. Es hinausbrüllen vor alle Ohren: Ja, ja, der Abt hat erst meinen Vater vergiftet und dann meinen Bruder ermorden lassen, um an unser Eigen heranzukommen, es dem Kloster einzuverleiben, die stolze Burg Hartenfels, das gute Land, die Weinberge... Aber dann sieht er diesen verschüchterten Jungen an, »Bruder Basilius« – wie soll der denn mit so einem Wissen leben! Soll er weiter daran glauben, dass das Klosterleben Gott wohlgefällig ist – für ihn ist auch so schon hart genug, wie er da steht in seiner fadenscheinigen Kutte und nachts beim Licht einer Ölfunzel noch Erbsen verlesen muss.
»Lass nur, Friedmar«, sagt er. »War alles bloß ein Scherz. Ich wollte einfach nur wissen, ob mein Vater so kurz vor seinem Tod noch einen guten Tag gehabt hat. Tut mir Leid, dass ich dich bei deiner Arbeit gestört habe. Soll ich dir helfen, die Erbsen aufzusuchen?«
»Aber Junker, wo denkt Ihr denn hin! Das ist doch keine Arbeit für Euresgleichen! Gott befohlen und Gute Nacht!«
»Dominus vobiscum«, grüßt Heinrich. Geht.
VIERTES KAPITEL
Er schafft es bis zu seiner Zelle. Ihm ist kalt, er taumelt fast. Fühlt sich, als hätte auch er von dem vergifteten Gericht gegessen. Er schlottert am ganzen Leib.
Als er sich dann auf seinem Bett zusammenkrümmt, die Beine an den Körper gezogen, die Arme um die Knie geschlungen, schlagen seine Zähne aufeinander. Und während er tief durchatmet und versucht, sein rasendes Herz zu beruhigen, wird ihm klar, was mit ihm ist: Er hat Angst. Mörderische Angst. Denn er ist mit Haut und Haar in der Gewalt dieses Mannes. Der könnte ihn bei lebendigem Leibe in seine Zelle einmauern lassen, der könnte ihn grausam geißeln lassen für die geringste Verfehlung... – Aber dann versucht er, klar zu denken. Vielleicht will man ihm ja gar nicht ans Leben. Es ist ja gar nicht nötig, dass er beiseite geschafft wird, denn sie haben ihn. Er ist der Erbe von Hartenfels und er ist Mönch. Das bedeutet – da er ja das Gelübde der Armut abgelegt hat -, all sein Hab und Gut gehört dem Kloster bis auf den letzten Feldstein am Weg und auf den letzten Hemdenzipfel in der Truhe. Und einer Sache ist er sicher: Man wird ihn nach diesen Jahren des Noviziats nicht vor die Entscheidung stellen, ob er bleiben will. Man wird ihn zwingen, dazu gibt es genug Mittel und Wege. Sie lassen ihn einfach nicht mehr raus. Er ist ein namenloser Mönch und hier für immer und ewig eingesperrt und keiner wird nach ihm fragen. Sie können mit ihm machen, was sie wollen. Bisher konnte er noch hin und wieder aufmüpfig sein oder mal besondere Wünsche äußern, denn man musste sich ja gut stellen mit dieser Hartenfels-Familie. Die ist nun dahin. Ausgerottet. Die Mutter in einem Frauenkloster – ihre »Mitgift« dort war das Letzte, was Abt Severin hergeben musste. Vater und Bruder einfach aus der Welt geschafft. Chrysostomus ist allem ausgeliefert, und wenn sie ihn zu Friedmar in die Küche stecken oder ihn auf dem Feld schuften lassen: Gehorsam hat er schließlich auch gelobt.
Eingemauert. Lebendig begraben. Diese enge Zelle ist schon so etwas wie ein Grab! Ein Raum mit einem Fenster, so weit oben, dass er es gerade mit der Hand erreichen kann, eine Tür, die nur von außen zu verriegeln ist, zum Einsperren. Drinnen gibt es nichts dergleichen. Er kann keinen Augenblick für sich allein sein, wenn er es einmal möchte. Jeder kann ihn jederzeit stören.
Nein. Nein und nein. Er wird nicht wie ein braves Schaf sich demütig unter die Hand eines Meuchelmörders beugen. Er muss fort von hier. Er ist Heinrich von Hartenfels. Aber gleichzeitig kommen ihm Gewissensbisse. Er ist auch Bruder Chrysostomus, und er hat ein Gelübde abgelegt – nicht gerade voller Begeisterung, aber ein Gelübde ist so etwas wie ein Ritterwort, das man Gott dem Herrn gegeben hat. Und dergleichen bricht man nicht.
Er hebt den Kopf. Im ungewissen Licht des Mondes, das durch sein Fensterchen dringt, sieht er das hölzerne Kruzifix an der Wand. Er steht auf von seinem harten Lager, fällt vor dem heiligen Zeichen in die Knie, faltet die Hände. Er spricht keines der von der Kirche vorgeschriebenen lateinischen Gebete, sondern redet zu Gott, wie ein Kind zu seinem Vater, wie ein Vasall zu seinem Lehnsherrn reden würde, wenn er in Not ist. »Hilf mir, Herr. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Erleuchte mich mit deiner Weisheit. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll.«
Langsam löst sich der Krampf des Entsetzens, der sich wie ein Ring um sein Herz gelegt hatte, er wird ruhiger. Als er sich schließlich erhebt, kann er wieder denken, kann das Für und Wider abwägen. Das Gebet hat ihm Kraft gegeben.
Nun sitzt er auf dem Bett, den Rücken an die Wand gelehnt, und versucht, sich Klarheit zu verschaffen, was zu tun ist.
Das Gelübde, sein Wort, Gott diese drei Jahre treu zu dienen, wird er nicht brechen, das steht einmal fest. Aber bis dahin unter einem Dach mit dieser Mörderbrut zu leben... Nein, das kann niemand von ihm verlangen, täglich dem Abt und seinen Helfern über den Weg zu laufen! Aber welche andere Möglichkeit gibt es? Heinrich überlegt fieberhaft. Undenkbar, zu Severin zu gehen mit der Bitte, diesen Ort hier verlassen zu dürfen, das Gelübde in einer anderen Abtei oder einem anderen Orden zu erfüllen. Das würde ihn nur alarmieren und er würde ihm wohl gleich noch zwei Riegel mehr an der Zellentür verpassen und ihm das Essen unten durchschieben lassen. Doch fort muss er. Dann eben ohne die Zustimmung des Abtes. Er muss eine Gelegenheit zur Flucht auskundschaften.
Wenn er nur an dies Testament herankönnte! Die Überlegung, es von einem Notar prüfen zu lassen... Aber Severin wird so ein wichtiges Schriftstück ja nicht frei herumliegen lassen. Bestimmt ist es hinter sieben Schlössern verwahrt.
Heinrich bewegt unruhig den Kopf hin und her. Das Testament, gut und schön. Abt Severin ist ein Mann mit Einfluss. Alle Benediktiner, das hat er, Heinrich, hier im Kloster begriffen, kennen einander und helfen einander. Wie heißt das Sprichwort? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus! Severin ist mit Bischöfen und Kardinälen bekannt, sein Wort wird ohnehin niemand anzweifeln. Viel wichtiger wäre es, ihm die Morde nachzuweisen.
Was hat Heinrich in der Hand? Das Wort eines Sterbenden und die vage Geschichte mit diesen Pilzen. Friedmar ist ein dienender Bruder. Sein Wort würde kaum viel Geltung haben. Der Koch vielleicht... Die Klosterknechte... Meine Güte, das sind unfreie Leute, ihr Wort hat vor Gericht nicht die geringste Beweiskraft. Und vor welches Gericht des Landes sollte er wohl hintreten mit seiner Behauptung. – Halt! Wieder: Dieser neue König! Aachen! Diese Krönung. Sie soll irgendwann im Sommer stattfinden. Und bei einer Krönung wird Gerichtstag abgehalten... Mag die Prüfung des väterlichen letzten Willens zu gering sein, vor das Gericht des Königs gebracht zu werden, die Tatsache aber, dass in einem so großen und mächtigen Kloster der Benediktiner Morde befohlen und ausgeführt wurden – dies wäre doch wohl von Belang. Oder doch nicht?
Seine Gedanken verwirren sich. Es war allzu viel an diesem Tag. Plötzlich fällt die Müdigkeit über ihn her wie ein wildes Tier. Er kann kaum die Augen offen halten. Morgen. Morgen wird er versuchen, den Bibliothekar auszuhorchen nach – nach was eigentlich?
Er gähnt. Morgen wird Messe gelesen am Sarg des toten Bruders. Es heißt, die Wunden eines Erschlagenen brechen neu auf und beginnen zu bluten, wenn sich ihm sein Mörder nähert. Ob sich Severin wohl in die Nähe Philipps wagt?
Sein Schlaf ist unruhig und voll wirrer Träume, und als die Glocke zum Morgengebet läutet, ist er seit langem einmal froh, dass sie ihn weckt und herausreißt aus dem nächtlichen Alb. Und dann fällt ihm ein, dass man ja Totenmesse lesen wird für Philipp, und die ganze furchtbare Wirklichkeit legt sich ihm auf die Brust wie ein Knoten aus Dornen.
Die Brüder haben sich bereits im Konvent versammelt, als er eintritt. Die Kapuzen überm Kopf, die Arme in den Ärmeln verborgen, sehen sie aus wie gestaltlose nächtliche Schemen, und Heinrich, müde und wach zugleich, schaudert, sie zu sehen.
Vorn vor dem Altar, zwischen hoch und still brennenden Kerzen, liegt Heinrichs aufgebahrter Zwillingsbruder, und die anderen bilden eine Gasse, lassen Platz, damit er zu ihm gehen kann.
Er sinkt neben dem offenen Sarg auf die Knie, die Hände zum Gebet unter dem Kinn gefaltet. Das Leintuch ist sorgfältig hochgezogen, sodass von den schrecklichen Wunden nichts zu sehen ist. Philipps Gesicht mit der scharfen gebogenen Nase und den schmalen Lippen, dies Gesicht, das auch Heinrichs Gesicht ist, wirkt im Tode sehr männlich, sehr erwachsen. Die fahle Haut, die eingesunkenen Augen... Einen Moment lang denkt Heinrich, wie es wäre, wenn er hier liegen würde. Besser gewiss – für Hartenfels. Kein Abt dieser Welt könnte die Hand nach diesem Erbe ausstrecken, wenn es ihn, diesen Mönch, nicht geben würde.
Glockengebimmel. Zwei Novizen schwenken die Weihrauchgefäße. Von Abt Severin in blütenweißer Seidenstola und purpurnem Gewand wird die Monstranz vorausgetragen. Er nähert sich dem Toten, beugt sich huldvoll zu dem knienden Heinrich und entbietet ihm den Friedenskuss auf beide Wangen. Dem Jungen ist, als würde man ihm einen Peitschenschlag versetzen. Dieser Schurke wagt es, ihn zu umarmen! Dieser Mann, der seine Familie niedergemetzelt hat, dieser Heuchler! Er wagt sich tatsächlich in die Nähe der Bahre.
Heinrich braust das Blut in den Ohren. Er weiß nicht, was er tut. Er löst sich von Severin und reißt mit einem schnellen Griff das Laken vom Körper Philipps. Ein unterdrückter Aufschrei geht durch den Konvent. Die Brüder bekreuzigen sich, starren wie gebannt auf den Toten. Seine Hände sind gefaltet, der zerstückelte Arm in ein Tuch gewickelt. Die Wunde am Hals, ausgeblutet und bleich, wirkt wie ein offener Mund.
»Wollt Ihr nicht hinsehen, Herr Abt!«, sagt Heinrich halblaut. – War ich das, der das gesagt hat? Ihm ist schwindelig, vor seinen Augen flimmert es. Er zittert am ganzen Körper. Jedermann kennt diese Geschichte von den blutenden Wunden eines toten Opfers angesichts seines Mörders. Jedermann weiß, was hier vorgeht. Natürlich auch Severin. Sein Gesicht ist undurchdringlich, eine Maske. Unter den gesenkten Lidern hervor trifft Heinrich ein Blick tödlichen Hasses.
»Ich sehe, mein Sohn«, sagt er, und seine Stimme verrät keinerlei Erregung. »Aber warum gönnst du dem armen Verstorbenen nicht seine Ruhe? Das ist nicht gottgefällig. Ich werde ihn eigenhändig wieder bedecken.«
Die ganze Kirche scheint den Atem anzuhalten. Man könnte eine Nadel zu Boden fallen hören. Severin neigt sich über den Toten, betrachtet ihn in Ruhe. Nimmt dann das Laken und legt es langsam, fast zärtlich wieder über diesen Körper. Wendet sich dem Altar zu. Beginnt mit dem Introitus.
Nichts. Kein Tropfen Blut. Heinrich ballt die Fäuste in ohnmächtigem Zorn. Mit welcher Dreistigkeit ist dieser Verbrecher an sein Opfer herangegangen, hat es wieder zugedeckt. Natürlich. Selbst wenn es dergleichen geben sollte: Er war es ja nicht! Er hat es nur befohlen. Ausgeführt haben den Mord andere. Er hatte also gar nichts zu befürchten. Das Einzige, was Heinrich mit dieser gleichsam blindwütigen Aktion erreicht hat, ist, dass Severin ahnen wird, dass er ihn der Tat verdächtigt. Und das kann nun doch gefährlich werden. Für ihn. -

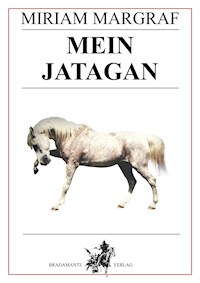

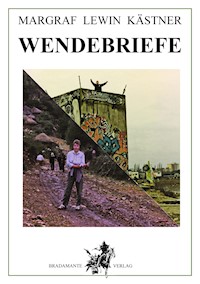













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












