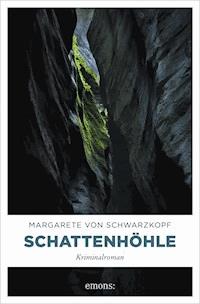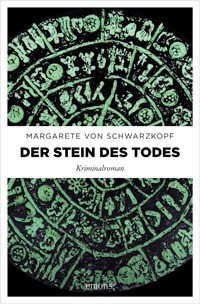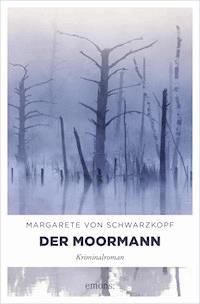
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anna Bentorp
- Sprache: Deutsch
So geheimnisvoll wie eine düstere Moorlandschaft: der Kriminalroman der Literaturkritikerin Margarete von Schwarzkopf. Kunsthistorikerin Anna Bentorp hat sich in der Abgeschiedenheit eines niedersächsischen Moores ein malerisches Häuschen gemietet, um ungestört alte Karten der Region zu studieren. Doch die Ruhe bleibt ihr verwehrt: Es häufen sich merkwürdige Todesfälle und Ereignisse, die alle im Zusammenhang mit einem verschollenen Schatz zu stehen scheinen. Immer tiefer gräbt sich Anna in die Recherche über die rätselhaften Karten, bis sie von den Geschehnissen der Vergangenheit eingeholt wird und selbst in Gefahr gerät . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margarete von Schwarzkopf, geboren in Wertheim am Main, studierte in Bonn und Freiburg Anglistik und Geschichte. Sie arbeitete zunächst für die Katholische Nachrichtenagentur, dann als Feuilletonredakteurin bei der »Welt« und viele Jahre als Redakteurin beim NDR in Hannover. Sie ist seit 1974 verheiratet und hat sechs Kinder.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich teilweise im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind authentisch, andere nicht. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/Lilly
Umschlaggestaltung: Franziska Emons, Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-290-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für TLF, insbesondere für Matilda und Elisabeth
Wanderer im schwarzen Wind; leise flüstert das dürre RohrIn der Stille des Moors. Am grauen HimmelEin Zug von wilden Vögeln folgt;Quere über finsteren Wassern.
Aus: Georg Trakl, »Am Moor«
Prolog
1788
Er fuhr aus einem Alptraum auf. Wieder hatte er diese starren, anklagenden Augen vor sich gesehen, diesen Körper, der verkrampft auf dem Boden lag, die Arme ausgestreckt, eine Blutlache um den Kopf. In seinen Traum drangen Wortfetzen und ein dumpfes Dröhnen, eine verzerrte dünne Stimme, die ihn zu rufen schien.
Mit Gewalt löste sich Reginald aus dem Traum, der sich an ihn klammerte und ihn mit Entsetzen und Angst erfüllte. Sein Gaumen fühlte sich ausgetrocknet an, seine Zunge geschwollen. Er lauschte in die Nacht. In der Ferne jaulte ein Hund. Der Nebel und der Regen dämpften die schrillen Töne, die jäh anschwollen und dann ebenso plötzlich abbrachen. Ein schweres Gefährt polterte durch die engen Straßen, ein Pferd wieherte, doch schon bald verschluckte das eintönige Rauschen des Regens auch diese Geräusche.
Mühsam stand Reginald von seinem Lager auf, auf dem er sich eigentlich nur für wenige Minuten hatte ausstrecken wollen. Doch die Müdigkeit steckte tief in seinen Knochen, und er war eingeschlafen, hineingesaugt worden in seine Erinnerungen, die ihn immer wieder in seinen Träumen überfielen. Er wankte hinüber zu seinem kleinen Schreibtisch und ließ sich auf den harten Stuhl fallen. Mit einem leichten Stöhnen versuchte er, einen klaren Kopf zu bekommen. Doch der Traum lastete schwer auf ihm, und nur mit größter Anstrengung gelang es ihm, ihn zu vertreiben und seinen Verstand zu ordnen.
Langsam tauchte er die Feder in das Tintenfass und sah hinüber zu dem Kamin, in dem ein spärliches Feuer brannte, das zuckende Schatten an die Wände warf. Dort hingen die Skizzen der Landkarten, die Zeugnis ablegten von seiner Arbeit. Er war Geograph und Kartenzeichner in Diensten der Royal Society. Aber dem dürftig möblierten Raum, den das Kaminfeuer nur unzureichend wärmte, merkte man nicht an, dass er zu den Besten seiner Zunft gehörte und erst kürzlich mit einer besonderen Aufgabe betraut worden war.
Am Nachmittag war er von einer längeren Reise aus Deutschland nach London zurückgekehrt, hatte das Gepäck neben sein Bett geworfen und wollte sich nach einem mageren Imbiss sofort daranmachen, seine Reiseerlebnisse in sein schwarzes, in Leder gebundenes Notizbuch einzutragen. Doch dann war er eingeschlafen und in seinen Träumen zurückgekehrt in das Moor, in dem er einige Wochen zugebracht hatte. Nun aber war es höchste Zeit, seine Erinnerungen an diese Zeit festzuhalten. Das Notizbuch hütete Reginald wie seinen Augapfel. Es begleitete ihn auf all seinen Reisen. Doch während der langen, stürmischen Überfahrt über den Kanal, bei der er mit einem heftigen Anfall von Seekrankheit zu kämpfen hatte, hatte er seine Eintragungen nicht fortsetzen können. Die Zeit drängte. Obgleich er nur ein Stück Brot und ein klumpiges Stück Käse zum Abendessen gegessen hatte, Reste seines Reiseproviants, hätte ihn nichts dazu bewegen können, an diesem kühlen Novemberabend des Jahres 1788 seine Wohnung zu verlassen, um in irgendeinem Gasthaus in der Nähe ein etwas üppigeres Mahl einzunehmen. Seine Erlebnisse der vergangenen Wochen brannten ihm auf den Nägeln. Eigentlich hätte er schon vor gut einem Monat wieder in London sein sollen, aber immer wieder hatte sich seine Rückreise verzögert.
Die Unruhe, die er seit seiner Ankunft in London verspürte, verstärkte sich mit jeder Minute. Von Ferne hörte er den Schlag einer Kirchturmuhr. Die Müdigkeit der langen Rückreise kroch ihm erneut in die Glieder. Seine Augenlider wurden schwer. Und plötzlich war es ihm, als stünde er wieder im fernen Moor, und aus dem Nebel des Halbschlafs erhob sich anklagend die Stimme der alten Käthe. Mit einem Ruck riss Reginald die Augen auf.
Er war in jener Nacht nicht allein bei der Hütte der alten Frau gewesen. Im Dunkel hatte jemand gelauert, und der Schatten dieses Mannes schien ihn bis hierher nach London verfolgt zu haben. Draußen in der nächtlichen Stille der großen, kalten Stadt erahnte er eine Bedrohung, die sich wie eine schwarze Welle unaufhaltsam auf ihn zubewegte. Eine dunkle Ahnung überkam ihn, dass er dem Geheimnis des Moores nicht entronnen war.
EINS
Anna betrachtete das kleine Haus am Rand des Dorfes Bresterholz mit kritischem Blick. Auf den Fotos hatte es wesentlich größer und der kleine Garten um einiges hübscher ausgesehen.
An diesem milden Junitag blies ein leichter Wind vom Moor über eine blühende Landschaft. In allen anderen Gärten von Bresterholz wuchsen Blumen in unterschiedlichsten Farben. Doch in dem kleinen Vorgarten hier standen nur ein paar windzerzauste Rosen, ein Strauch Hortensien und einige Tulpen, dazu ein Apfelbäumchen und ein etwas krummer Forsythienstrauch. Nicht gerade ein gut gepflegter Landschaftsgarten, aber doch ein halbwegs freundlicher Flecken Erde, wie Anna fand, die alles andere als eine begnadete Gärtnerin war. Sie hatte auch nicht vor, das kleine Grundstück in einen englischen Garten zu verwandeln, sondern wollte in den kommenden zwei Monaten bloß in Ruhe in dem Haus arbeiten können. Sie hatte es durch eine Anzeige in einer hannoverschen Tageszeitung gefunden, als sie nach einer Unterkunft gesucht hatte, die ihr die nötige Ruhe für ihre Arbeit an dem Katalog für die große Kartenausstellung der hannoverschen Leibniz-Bibliothek versprach, die im nächsten Jahr eröffnet werden sollte.
Zu vermieten: Haus aus dem 18. Jahrhundert, frisch renoviert und in ruhiger Lage. Ideal für Menschen, die der Hektik des Alltags entfliehen möchten. 15 Kilometer von der Nordsee entfernt, in unmittelbarer Nähe des Brester Moores.
Anna fühlte sich von der Anzeige sofort angesprochen. Sie hatte schon einige Wochen nach einem solchen Ort gesucht, fernab von ihrem eher rastlosen Leben zwischen Hannover und Hamburg, wo sie, die Kunsthistorikerin und Historikerin, als Beraterin für Museen und Galerien arbeitete. Einem Ort, an dem sie ungestört an dem Katalog für die Ausstellung »Aufbruch in die Zukunft – Karten aus der Zeit Georgs III.« arbeiten konnte.
Ihre Wohnung in Hannover lag zwar in einer eher ruhigen Gegend in der Nähe der Eilenriede, dennoch wurde sie dort durch den Alltag allzu sehr in Beschlag genommen. Und ihr winziges Apartment in Hamburg am Eppendorfer Baum bestand nur aus einem einzigen möblierten Zimmer mit Kochnische und einem Mini-Bad, kein idealer Ort, um sich intensiv mit dem riesigen Kartenwerk aus der Zeit des britischen Königs zu befassen. Zumal Anna neben einer üppigen Fotosammlung eine ganze Ladung von Kopien diverser Karten bearbeiten musste, um sie für den Katalog zu sortieren, mit Texten zu versehen und zu untersuchen, ob es wirklich Karten aus der Zeit Georgs waren, also angefertigt zwischen 1760 und 1820.
Es waren einige Fälschungen im Umlauf, vor allem Seekarten, die angeblich während der drei Reisen von James Cook entstanden und dann unter der Hand unmittelbar nach dem Tod des berühmten Seefahrers als Originale verkauft worden waren. Unter diese Kartenflut war allerdings auch das eine oder andere noch nicht weiter erforschte Original geraten, das nun der hannoverschen Bibliothek für die eigenen Bestände und für die Ausstellung angeboten wurde. Hierfür war die Provenienzforschung wichtig.
Einhundertachtzig Karten sollte die Ausstellung umfassen, darunter allein achtzig Blätter aus den Jahren zwischen 1764 und 1789 mit Darstellungen der norddeutschen Gebiete des Vereinigten Königreichs. Abgabetermin für das Manuskript mitsamt Fotohinweisen, Fußnoten und Quellenangaben sollte Mitte Dezember sein. Der Weg zum fertigen Katalog dauerte dann noch einmal zwei Monate, um die abgelichteten Karten einzubringen, diverse Vorworte und Begleitessays von illustren Kollegen einzufügen und eine genaue Auflistung der zusätzlichen Literaturangaben zu erstellen. Allerdings würde sie dafür genügend Hilfe vor Ort in Hannover erhalten. In dieser Zeit ging es eher um den Kern des Katalogs, um die sehr unterschiedlichen Karten mit ihren Abbildungen von Ländern, Kontinenten, Ozeanen, Städten und Landschaften, dazu Verkehrsrouten und regionale Randgebiete.
Für die anstehenden Arbeiten brauchte Anna Muße und nicht das Gefühl, dass ihr ständig jemand über die Schulter schaute. Vor allem einem Kollegen wollte sie nicht gerne während der Arbeit begegnen. Harald Frostauer, ehrgeiziger Historiker und selbst erklärter Fachmann für die Zeit der Personalunion zwischen England und dem Kurfürstentum, später Königreich Hannover, zwischen 1714 und 1837, konnte höchst unangenehm werden in seinem Eifer, allen seine Kenntnisse permanent unter die Nase zu reiben. Er arbeitete als Berater für Museen in ganz Deutschland und tauchte immer gerne da auf, wo Anna gerade einen Auftrag erhalten hatte. Es war kein Geheimnis, dass Frostauer sich nicht nur aus fachlichen Gründen für Anna interessierte.
Anna ließ den Blick noch einmal über das Häuschen schweifen. Es hatte in der Zeitung noch einige weitere Wohnungsangebote in ähnlich ländlicher Abgeschiedenheit gegeben. Was sie aber an diesem Haus reizte, war seine Nähe zu Moor und Meer. Die anderen Wohnungen lagen in der Lüneburger Heide und im Harz oder waren ihr schlicht zu teuer gewesen. Kurz hatte sie mit einer Gästewohnung in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert geliebäugelt, ebenfalls renoviert und saniert. Der Landsitz lag nicht weit entfernt von Bresterholz bei Bremervörde. Aber selbst wenn die Zeile »Benutzung des Schwimmbeckens im Park möglich« verführerisch klang, musste sie sich damit abfinden, dass die vierhundert Euro Miete für das kleine Haus bei Bresterholz ihrem Budget zuträglicher waren als die tausend Euro für die Gästewohnung in dem barocken Herrenhaus. Also bewarb sie sich rasch für das Haus am Moor, erhielt umgehend die Nachricht, dass sie so bald wie möglich kommen sollte, und brach schon zwei Tage nach der Buchung in Hannover auf, um sich mit ihrer Vermieterin Anke Kück zu treffen. Die allerdings ließ nun auf sich warten.
Anna stieg aus dem Auto und ging durch den kleinen Garten zum Haus. Es war aus Feld- und Backsteinen erbaut, hatte auf der Vorderfront zwei Fenster links und rechts neben der Eingangstür und drei weitere kleine im ersten Stock. Viel mehr konnte sie auf den ersten Blick nicht erkennen.
»Das Haus ist aus dem Jahr 1770«, ertönte plötzlich eine Stimme von der Straße her.
Anna drehte sich um und sah eine magere Frau um die siebzig, die von ihrem Fahrrad stieg und auf sie zukam. Sie trug ihr weißes Haar kurz geschnitten und musterte Anna mit kühlen hellblauen Augen hinter dicken Brillengläsern. Anna fuhr sich automatisch durch ihre vom Wind zerzausten Haare und fragte sich, was der Frau bei ihrem Anblick wohl durch den Kopf ging. Sie war keine Schönheit, aber sie hatte freundliche graue Augen, ein eher blasses Gesicht mit einigen Sommersprossen auf der Nase und mittellange Haare, die in der Sonne rötlich schimmerten. Sie war schlank und wirkte sportlich, selbst wenn sie nur gelegentlich Tennis spielte oder durch die Eilenriede spazierte. Auf jeden Fall sah sie jünger aus als ihre sechsundvierzig Jahre, auch wenn sie um die Augen ein paar unübersehbare Lachfältchen hatte.
»Anke Kück«, sagte die Frau und schüttelte Anna kurz und energisch die Hand.
»Anna Bentorp, guten Tag. Schön, dass es geklappt hat«, antwortete Anna.
»Sie haben Glück, dass Sie so schnell auf meine Anzeige geantwortet haben«, fuhr Anke Kück fort, ohne auf Annas Begrüßung einzugehen. »In den Tagen darauf haben sich gleich drei weitere Interessenten gemeldet, darunter sogar ein Herr aus London.« Sie lächelte kurz, kramte aus einem Leinensack einen Schlüsselbund hervor und schob den größten Schlüssel ins Haustürschloss.
Mit einem leichten Quietschgeräusch sprang die Tür auf. Anke Kück schob Anna in den Flur. »Das Haus ist, wie schon gesagt, um 1770 entstanden. Damals hieß dieser Flecken noch Brester Holz, in zwei Wörtern geschrieben, und es gab hier nur ein paar Häuser von Torfstechern, ein paar Bauernhäuser ein Stück weit entfernt, und unsere Kirche war auch schon da. In dem Haus wohnte damals ein Torfstecher mit seiner Familie. Aber dann tauchte ein ausländischer Herr auf, der sich für das Haus interessierte. Der Torfstecher zog aus, und der Fremde hat dann wohl eine Zeit lang hier gelebt.«
Anke Kück lächelte, wobei sie kaum ihre Zähne zeigte. Aber ihr Gesicht wirkte sofort etwas weicher und weniger distanziert.
»Es gibt in Osterheide noch ein zweites kleines Haus, in dem heute unser alter Pastor wohnt«, fuhr sie fort. »Das ist noch älter, und dort hat wohl damals um 1790 auch für kurze Zeit jemand aus dem Ausland gewohnt. Was die damals ins Moor getrieben hat, weiß man nicht mehr. Tja, und dann hat dieses Haus ein Vorfahre meines Mannes erstanden, weil es um 1800 hier mit der Landwirtschaft so richtig losging. Der hatte ein paar kleine Felder am Rand des Moores und auch noch ein bisschen was im Moor. Doch irgendwie hat nie jemand lange im Moorhaus gewohnt. Es soll hier nämlich spuken. So ein Quatsch.« Anke Kück lachte. »Wenn es spukt, dann im Moor, aber nicht in diesem Häuschen.«
Anna nickte nur. Sie fand die Vorgeschichte des Hauses zwar durchaus interessant, doch es drängte sie zu sehen, ob es sich überhaupt für ihre Zwecke eignete.
Hinter der Eingangstür lag ein schmaler dunkler Gang, rechts und links befand sich je eine Tür und am Ende des Ganges eine dritte. Hinter der linken Tür verbarg sich eine kleine Küche, deren alte Schränke mit Glasfront aus den fünfziger Jahren stammten, wie Anna erkannte. Eine ihrer Tanten besaß noch heute so eine Küche, die jetzt wieder als modern galt. Retrolook, wie ihre Tante Christine ihr stolz erklärt hatte. Immerhin war die Küche ausgestattet mit einem neuen Herd, einem sanft brummenden Kühlschrank, einer Waschmaschine, einer Spülmaschine und einer Mikrowelle auf einer hölzernen Arbeitsplatte. Das Waschbecken dagegen stammte ebenfalls aus älteren Zeiten.
»Ja, das ist aber völlig in Ordnung«, sagte Anke Kück, als sie Annas skeptischen Blick sah. »Die Wasserleitungen sind alle erneuert – wir hatten letzten Winter einen Rohrbruch.«
Der Boden der Küche aus schwarz-weißen Kacheln besaß nostalgischen Charme, den die Decke mit ihren schweren schwarzen Balken verstärkte. In den Küchenschränken entdeckte Anna solides, spülmaschinenfestes Geschirr für sechs Personen und einige dicke Kaffeebecher, eine Teekanne und eine große Kaffeekanne. Was wollte sie mehr? Sie musste ja glücklicherweise nicht ihre eigene stetig wachsende Sammlung von Trinkbechern in ihrem Kurzzeitdomizil unterbringen. Etwa hundert dieser Becher hatte sie im Laufe der Zeit zusammengetragen. Ihre Freunde lächelten über diesen Spleen, aber unterstützten ihn sogar noch. Erst vor wenigen Wochen hatte sie einen »Muggel-Becher« mit Harry-Potter-Insignien geschenkt bekommen, und die Zierde ihrer Sammlung war ein überaus kitschiger Becher mit dem Konterfei der britischen Königin anlässlich ihres sechzigsten Krönungsjubiläums. Aus ihm hatte Anna noch nie getrunken. Da zog sie einen etwas schlichteren Becher aus Südafrika vor, geschmückt mit einem tönernen Elefantenrüssel.
Töpfe und Pfannen schienen ebenfalls ausreichend vorhanden zu sein, und es gab auch einen Wasserkocher. Zufrieden ging sie hinter Anke Kück aus der Küche und sah sich im Geiste schon an dem kleinen Küchentisch mit Blick auf das Apfelbäumchen im Vorgarten ihren Morgenkaffee schlürfen. Vielleicht sollte sie doch ein oder zwei ihrer Becher aus Hannover holen? Den Elefantenbecher und den Becher mit den dicken Hasen, dessen Henkel Keramikkarotten waren? Platz genug gab es hier. Aber sicher würde sie in der Umgebung noch einige weitere Becher für ihre Sammlung entdecken.
Anke Kück war ihr mittlerweile flott vorausgeeilt. Hinter der rechten Tür auf der anderen Seite des Ganges lag ein Zimmer, das wohl früher als Haushaltsraum genutzt worden war. Jetzt standen darin ein mächtiger Eichentisch mit einer neuen Schreibtischlampe in modernem Design, ein Stuhl, ein Bücherregal, eine hübsche alte Kommode und in der Ecke ein Ohrensessel, wie ihn Anna zuletzt bei ihrer inzwischen fast neunzigjährigen Tante Brigitte, der ältesten Schwester ihrer Mutter, gesehen hatte.
»Das Zimmer könnte ich als Arbeitszimmer nutzen«, sagte sie. »In der Anzeige stand, es gibt Internet im Haus, ist das richtig?«
Anke Kück musterte sie mit leicht zusammengekniffenen Augen. »Wir leben doch nicht in der Steinzeit. Ja, Internet gibt es wohl bei uns im Dorf und auch hier im Haus. Allerdings ist es nicht immer ganz zuverlässig. Handys funktionieren ebenso, aber auch hier kann es manchmal schwierig sein. Dieses Haus hat dicke Mauern, da ist die Verbindung nicht immer optimal.« Damit marschierte sie zum hinteren Teil des Hauses und öffnete die dritte Tür. »Das Wohnzimmer«, erklärte sie.
Anna gefiel, was sie sah. Vor dem Kamin, in dem dekorativ ein paar kunstvoll aufgetürmte Holzscheite lagen, standen zwei Sessel, ein kleines Sofa und ein Couchtisch mit einer Vase, gefüllt mit einem bunten Strauß Feldblumen. Von der Decke hing eine Kugellampe, und die Stehlampe neben dem Sofa sah neu aus.
In einer Ecke entdeckte sie auf einem Tischchen einen modernen Fernsehapparat und ein weiteres Bücherregal, in dem etwa zwanzig Bücher standen, darunter Romane von Ken Follett und Dan Brown, Charlotte Link und Jussi Adler-Olsen, ein Bildband über Worpswede und ganz oben auf dem Regal einige alte, in Leder gebundene Bücher, die Annas Neugierde weckten. Sie nahm eines davon in die Hand und schlug es auf. Es war eine Ausgabe von Laurence Sternes Roman »Tristram Shandy« aus dem Jahr 1780. Der Name des einstigen Besitzers stand auf der zweiten Seite, aber sie konnte den Namen nicht entziffern, weil die Buchstaben verwischt waren.
Daneben stand ein weiteres Buch im Ledereinband. Es war Jonathan Swifts 1704 erschienenes »A Tale of a Tub«, ebenfalls in einer Ausgabe aus dem Jahr 1780. Und als drittes und letztes Buch in dieser Sammlung erkannte Anna Georg Forsters Werk »A Voyage round the World«, das der Naturforscher, Reiseschriftsteller, spätere Revolutionär und Begleiter von James Cook bei dessen zweiter Weltumseglung nach seiner Rückkehr im Jahr 1777 veröffentlicht hatte. Und dieses Buch stammte tatsächlich aus dem Erscheinungsjahr. Anna staunte. Drei überaus wertvolle Bücher im Regal eines kleinen Hauses am Rande des Moores. Wie kamen sie hierher? Wer war ihr ursprünglicher Besitzer?
»Von wem stammen denn diese drei Bücher?«, fragte sie Anke Kück.
Diese zuckte mit den Achseln. »Die haben wir entdeckt, als wir das Haus vor fünfzig Jahren von meinem Onkel Adalbert geerbt haben. Im Keller stand eine alte Kiste, und darin waren allerlei lose Blätter, Skizzen von irgendwelchen Landschaften und diese drei Bücher. Eigentlich waren es noch mehr Bücher, aber mein Bruder hat die anderen in Stade bei einem Antiquar verkauft. Die Bücher haben einen guten Preis gebracht. Schon komisch, was Leute für so alte Schinken zahlen. Diese drei haben wir behalten, weil sie schon etwas mitgenommen aussehen und ganz gut in dieses alte Haus passen.«
Damit schien das Thema für Anke Kück erledigt. Anna stellte den Forster zurück neben die beiden anderen Bücher und beschloss, die Bücher irgendwann in aller Ruhe noch einmal anzuschauen. Dieses erste Werk von Swift kannte sie nicht aus eigener Anschauung; sie hatte bislang nur »Gullivers Reisen« gelesen. Doch sie hatte davon gehört und wusste, dass Swift darin Kritik an bestimmten Institutionen in seinem Land und an der Heuchelei adliger und politischer Kreise, vor allem an der Regierung unter der damaligen Königin Anne, übte. Ihre Nachfolge trat im Jahr 1714 dann der Kurfürst von Hannover an, der erste Georg auf dem englischen Thron, Urgroßvater »ihres« Georgs III., des Kartensammlers.
An den grau gestrichenen Wänden des Wohnzimmers hingen ein paar Drucke von Gemälden Worpsweder Künstler, darunter Paula Modersohn-Becker, und eine schön gerahmte Landkarte, die offenbar Teile des hiesigen Moores zeigte. Anna versuchte zu erkennen, wann die Karte entstanden war, und glaubte die Zahl 1803 zu entziffern. Es war sicherlich kein Original, aber eine sehr gute Kopie. Durch die Schiebetür im hinteren Teil des Wohnzimmers gelangte man auf eine kleine Terrasse und in den rückwärtigen Bereich des Gartens. Auch hier wuchsen nur wenige Blumen, dazu ein Birnbaum und ein Haselnussstrauch. Jenseits des Gartenzauns erstreckte sich eine Wiese, auf der ein paar Pferde standen.
»Eine von unseren Weiden«, sagte Anke Kück. »Milchwirtschaft lohnt sich nicht mehr. Die Wiese haben wir an Gerd Meier verpachtet, der selbst reitet und ein paar Pferde von Städtern hält, die alle naselang mal hierherkommen, um Ferien auf dem Land zu machen.« Sie schnaubte verächtlich. »Aber immerhin verdient Gerd damit ein paar Euro. Er hat fünf Kinder. Die wollen ja auch eine Chance haben.« Damit war auch dieses Thema für sie abgehakt.
In einer Ecke des Wohnzimmers führte eine Treppe nach oben. »Bei der Renovierung haben wir das so gelassen«, erklärte Anke Kück. »Oben sind zwei Schlafzimmer und das Bad.« Nicht ohne Stolz fügte sie hinzu: »Und das ist ganz neu.«
Die beiden kleinen Schlafzimmer machten einen gemütlichen Eindruck mit ihren gestreiften Vorhängen und jeweils einem breiten Bett mit einer bunten Tagesdecke, einem einfachen Kleiderschrank und einer Wäschekommode. Sie waren fast identisch, wobei in dem einen Zimmer blau gestreifte, in dem anderen grün gestreifte Vorhänge hingen. Und zu Annas geheimer Freude stand in jedem der beiden Zimmer ebenfalls ein Ohrensessel, allerdings wesentlich zierlicher als das Ungetüm in ihrem künftigen Arbeitszimmer. Ideal für abendliche Lesestunden, sollte sie Zeit dafür haben. Das Bad sah wie erwartet frisch saniert aus. Dusche, Waschbecken, WC, klein, aber sauber und hübsch gekachelt mit hellblauen Fliesen.
»Wer nutzt denn das Haus, wenn Sie es nicht vermieten?«, fragte sie, als sie die Holztreppe wieder ins Wohnzimmer hinunterstiegen.
»Im Winter wohnt hier niemand«, sagte Anke Kück. »Aber von Mai bis November wollen wir in Zukunft an Feriengäste vermieten. Bis zum letzten Jahr hat hier eine Verwandte meines Mannes gelebt. Aber dann ist sie krank geworden und zurück nach Hannover gezogen. Das Haus hat davor viele Jahrzehnte praktisch leer gestanden. Alles war vergammelt, voller Mäuse und sogar Ratten. Mein Onkel hat es nie bewohnt, sondern auch geerbt, von seiner Mutter. Keiner wollte hier leben außer dieser verrückten Verwandten aus Hannover, die immer mit ihrem Fernglas durchs Moor gezogen ist und angeblich Vögel beobachtet hat.«
Anke Kück zuckte mit den Achseln. Anna wurde nicht recht schlau aus dieser Frau, die einerseits recht mitteilsam wirkte, aber dabei immer irgendetwas zu verschweigen schien. Vielleicht war es aber auch ein Hauch von Skepsis gegenüber der »Städterin«, der sie viel, aber nicht alles erzählen wollte. Anke Kück holte Luft und sprach weiter.
»Mein Mann will mit dem Haus nichts zu tun haben. Er puzzelt lieber an seinen alten Treckern herum und lässt mich alles andere erledigen. Am liebsten hätte er das Haus verkauft. Aber dann hat ihm jemand geraten, er solle mal lieber warten. Wissen Sie, Häuser auf dem Land gewinnen derzeit an Wert. Angeblich. Und so haben wir das Haus halt immer noch an der Backe. Muss immer was dran repariert werden. Mal ist es das Dach, mal der alte Kamin. Und dann der Rohrbruch. Die Verwandte von meinem Mann, die Greta, hat allen Leuten erzählt, es habe hier gespukt und im Keller habe es in der Wand geklopft. Kein Wunder bei den alten Rohren, die bis zum letzten Sommer hier im Haus waren. Die gute Greta ist einfach ein bisschen verrückt. Hat immer so auf Vogelforscherin getan, war in Wirklichkeit aber eine von diesen Sondengängern, die jetzt überall losmarschieren und hoffen, auf irgendwelche vergrabenen und verschütteten Altertümer zu stoßen. So wie vor ein paar Jahren in Harzhorn bei Göttingen, wo man ein römisches Schlachtfeld entdeckt hat.«
Anna staunte, dass Anke Kück darüber so gut informiert zu sein schien. Sie kannte nicht viele Leute, die diesen aufregenden Fund in den Medien verfolgt hatten.
»Und? Gefällt Ihnen das Haus?« Anke Kück war im Vorgarten stehen geblieben, wartete aber keine Antwort ab. »Das nächste Geschäft liegt im Dorf. Wenn Sie größere Einkäufe machen wollen, dann müssen Sie nach Bremervörde fahren oder nach Stade. Aber das liegt eine gute halbe Stunde von hier. Bremervörde ist nur fünfzehn Minuten entfernt.«
»Ja, das Haus ist genau das Richtige für mich«, antwortete Anna. »Ich muss morgen noch mal nach Hannover fahren, um ein paar Sachen zu holen. Aber ab morgen Abend bin ich dann hier.«
»Mich erreichen Sie am besten per Telefon, Festnetz ist besser als Handy, das ich nicht immer dabeihabe, oder kommen Sie vorbei, falls noch was sein sollte. Wir wohnen nicht in Bresterholz, sondern im Nachbarort Osterheide. Der ist zwei Kilometer von hier entfernt. Mein Mann, der Heiner, geht nicht so gerne ans Telefon. Und Handys findet er total schrecklich. Deshalb habe nur ich eins für den Notfall. Na ja, ich habe ihn wenigstens überreden können, einen neuen Fernseher mit Flachbild anzuschaffen. Da guckt er dann die Bundesliga und ich Krimis. Der Heiner würde am liebsten noch mit der Pferdekarre umherfahren. Na ja, er geht jetzt auch auf die achtzig zu. Da wird wohl manch einer sonderlich. Übrigens, Sie sollten sich ein Fahrrad anschaffen. Diese Gegend ist berühmt für ihre schönen Fahrradwege.« Nach diesem Redeschwall drückte Anke Kück ihr den Schlüsselbund in die Hand, schwang sich auf ihr Rad, hob zum Abschied winkend die Hand und fuhr davon.
Anna atmete tief durch. Auf einmal roch sie das warme Gras, den Duft der Rosen und etwas anderes – die dunkle, schwere Erde des Moores. Das nächste Haus, ein paar hundert Meter entfernt an der Straße, die durch den Ort führte, war von hier aus kaum zu sehen, da es hinter einer Straßenbiegung lag. Das vermittelte Anna ein seltsam prickelndes Gefühl von Isolation. Doch das störte sie nicht. Sie hoffte nur, dass das Internet funktionierte und sie schon bald mit ihren Recherchen beginnen konnte.
Zwei Stunden später hatte sie ihre Koffer ins Haus getragen und ihre Kleidungsstücke, vor allem Jeans und Blusen, in den Kleiderschrank des Schlafzimmers mit den blau gestreiften Vorhängen eingeordnet – das andere Zimmer mit den grün gestreiften Vorhängen würde sie eventuell als Gästezimmer nutzen können. Und dann saß sie auch schon wieder im Auto nach Hannover, um dort Bücher, Karten, ihren Laptop und all das einzupacken, was sie für ihre Arbeit an dem Katalog zu »Aufbruch in die Zukunft« brauchen würde – plus zwei Kisten mit gutem Weißwein und einer großen Einkaufskiste voller Lebensmittel, um in den nächsten Tagen über die Runden zu kommen. Als sie losfuhr, warf sie noch einen Blick auf das kleine Haus, das still in der Mittagssonne lag. Ein Gefühl der Vorfreude überkam sie, gemischt mit einer vagen Ahnung, dass die kommenden Wochen die eine oder andere Überraschung für sie bereithielten. Und vielleicht barg dieses so harmlos aussehende Haus am Rand des Moores ja auch ein Geheimnis? Anna konnte es kaum mehr erwarten, in das Moorhaus zurückzukehren.
1788
Reginald starrte in das flackernde Kaminfeuer. Er musste sich zusammenreißen. Der Schluck Branntwein aus einer leicht angestaubten Flasche, die er in einer Ecke seines Schranks aufbewahrte, half ihm, seine Nerven ein wenig zu beruhigen und die Spukgestalten zumindest fürs Erste zu bannen. Mit neu gewonnener Energie tauchte er die Feder wieder in die Tinte.
London, Dienstag, 18. November 1788
Das Wetter hier ist, wie so oft um diese Jahreszeit, furchtbar. Wind, Regen, vor allem aber der klebrige Nebel, der von der Themse aufsteigt. Aber drüben in Deutschland war das Wetter auch nicht besser. Und das kleine Haus am Rand des Moores, in dem ich die letzten Tage vor meinem Aufbruch nach London noch einmal gewohnt habe, besaß nicht einmal einen ausreichend großen Kamin, um die Mauern zu wärmen. Die Reise war beschwerlich, das Schiff, mit dem ich übersetzte, klein und ziemlich heruntergekommen. Der Kapitän, ein schlecht gelaunter Schotte, der Engländer offenbar noch weniger mochte als die stürmische See, war auch nicht eben dazu geeignet, die Stimmung an Bord aufzuheitern. Als ich ihm erklärte, ich sei Ire, wurde er etwas freundlicher, aber viel nützte es nicht. Ihm stieß wohl übel auf, dass ich für die Royal Society arbeite. Doch dauerte die Überfahrt ja glücklicherweise nicht ewig.
Nun bin ich wieder in London. Mein Kopf schwirrt noch von all den Dingen, die ich erlebt habe. Vor allem aber bin ich von einer großen Unruhe erfüllt: Seit meiner Ankunft habe ich das unangenehme Gefühl, dass ich verfolgt werde. Bereits in Deutschland fühlte ich mich bei meiner Arbeit beobachtet. Mein Kollege und Assistent Jonathan Spyrer hat angeblich nichts davon gespürt. Im Gegenteil. Er klagte darüber, dass wir beide allein an diesem feuchten Flecken am Moor irgendwo zwischen Bremervörde und Worpswede seien, nur um den innigsten Wunsch unseres Königs Georg zu erfüllen, nämlich das gesamte Gebiet seiner deutschen Besitzungen in dieser Region zu vermessen und zu kartographieren. Als dann dieser Ingenieur aus Hannover auftauchte, war Jonathan erleichtert. Ich hingegen weniger. Aber davon später mehr.
Eigentlich sollten uns Ingenieure aus Hannover zur Seite stehen, doch an dem kleinen Landstrich, der uns zugewiesen worden war, hatten sie wenigInteresse. Sie zog es eher in die Gegend von Stade etwa zwanzig Meilen weiter nördlich, immerhin eine hübsche Stadt, die seit gut siebzig Jahren zum Kurfürstentum Hannover gehört und damit Teil ist dieser seltsamen Verbindung zwischen England und Deutschland unter der Herrschaft unserer Könige aus dem Haus Hannover. Ich war nach Deutschland geschickt worden, um mit diesen Männern vom Ingenieurcorps zusammenzuarbeiten, doch sie ignorierten mich weitgehend und taten mich als weltfremden Zeichner ab. Das war mir nur recht. Ich spreche leidlich gut Deutsch, da ich einmal ein paar Monate in Hannover und für kurze Zeit in Göttingen gelebt habe. Mir hat Hannover, diese kleine Stadt, gefallen, aus der die Familie unseres gnädigen Königs stammt. Im Vergleich zu London wirkt sie wie ein Dorf. Der Vorteil davon ist, dass man sich schnell dort zurechtfindet und auch die umgebende Landschaft recht gefällig wirkt. Unser König Georg zeigt allerdings nicht das geringste Interesse, je dorthin zu reisen. Wie anders als sein Großvater, der selige Georg II., und dessen Vater Georg I. Diese beiden Könige hingen sehr an ihrer deutschen Heimat. Dank meiner Deutschkenntnisse konnte ich verstehen, was die hannoverschen Ingenieure hinter meinem Rücken redeten. Wenn sie ahnen würden, was der »weltfremde Zeichner« entdeckt hat …
Doch ich schweife ab. Diese Unruhe, die ich seit jenen merkwürdigen Ereignissen im Moor bei Bremervörde spüre, drängt mich dazu, nun so rasch wie möglich meineEntdeckungen zu notieren, meine Skizzen aufzuarbeiten und alles an jene Menschen weiterzuleiten, denen ich in London noch trauen kann. Ich diene meinem König treu und lasse mich nicht von den Machenschaften seines Sohnes, des Thronfolgers, beirren. Jeder weiß, dass der Prince of Wales seinen Vater mit jedem Mittel kompromittiert, dass er überall Spitzel hat und vor allem eines will: Geld. Egal, aus welchen Quellen. Und meine Entdeckung wäre wunderbar für seinen leeren Geldbeutel. Man munkelt, dass er etliche Leute hat, die ihm Geldquellen erschließen sollen. Vielleicht träumt er auch von Schatzinseln in der fernen Südsee, durch die James Cook gesegelt ist. Wer weiß.
Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich seit bestimmten Ereignissen in Deutschland fast niemandem hier mehr trauen kann. Sogar meine Wirtin, Mrs Gregory, hat mich bei meiner Ankunft eigenartig begrüßt und mir nicht in die Augen geschaut. Gott gebe, dass ich mir dieses Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden, nur einbilde. Aber was ich im Moor erlebt habe, war kein Hirngespinst. Der Auftrag meines Königs erwies sich als weitaus delikater, als ich je geglaubt hätte, und wenn seine Widersacher entdecken, was ich gefunden habe, dann ist viel verloren, im schlimmsten Fall mein Leben. Denn sie werden sicher vor nichts zurückschrecken, um ihr Ziel zu erreichen.
Das Kerzenlicht flackerte, als Reginald die Feder beiseitelegte, den Kopf hob und wieder in die Nacht lauschte. Doch er vernahm nur das einschläfernde Rauschen des Regens und gelegentlich den Schrei eines Nachtvogels. Auch in dem schmalen Haus herrschte Stille. Das war ungewöhnlich, da Mrs Gregory abends häufig noch in der Küche mit ihrer Magd Betty stritt oder ihr kleiner Hund Feathers aus unersichtlichen Gründen kläffte. Vielleicht weil eine Ratte durch die Küche huschte oder einfach, weil er ein streitsüchtiger Spitz war, eine Rasse, die es erst seit Kurzem in England gab, von Königin Charlotte, der Ehefrau Georgs III., höchstpersönlich eingeführt.
Reginald schloss das Notizbuch, schob es unter einen Haufen loser Blätter auf dem Tisch und stand auf. Die Unruhe, die er für kurze Zeit überwunden hatte, lähmte ihn erneut. Irgendetwas schien da draußen in der Stille der Nacht zu lauern. Reginald war von Haus aus eher ruhig und gelassen, aber diese Nacht zerrte an seinen Nerven, machte ihn fahrig und lenkte ihn ab.
Er ging in die Ecke des Zimmers, wo er bei seiner Rückkehr sein Gepäck neben das Bett hatte fallen lassen, und holte mehrere Skizzen aus seiner Reisetasche hervor. Doch er fühlte sich zu müde, um sie näher zu studieren, zumal das Licht in der Kammer zu wünschen übrig ließ. Mrs Gregory sparte mit Kerzen, und Reginald hatte noch keine Gelegenheit gehabt, den Vorrat selbst aufzufrischen. Vorsichtig schob er die Skizzen unter sein Bett. Morgen würde er damit beginnen, sie zu übertragen, die ersten Karten maßstabsgerecht zu entwerfen und das Tagebuch fortzuführen.
Nie hätte er gedacht, dass er, der Junge aus Dublin, je in ein solches Abenteuer geraten würde. Sein Leben war eigentlich immer in vorhersehbaren Bahnen verlaufen. Reginald war am 14. Oktober achtundzwanzig Jahre alt geworden, ein schlanker Mann von mittlerer Größe mit wachen dunkelblauen Augen und kastanienbraunem Haar, das er zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden hatte. Seiner Kleidung, obwohl sauber und gepflegt, sah man an, dass sie viel getragen und nicht aus bestem Stoff gefertigt war. Seine Schuhe zeigten verkrustete Spritzer von braunem Lehm.
Schon als Junge hatte er begonnen, sich täglich Notizen zu machen, den Alltag in Dublin zu schildern, seine schulischen Erfahrungen oder die Launen seines Vaters, eines gebildeten, melancholischen Mannes, der zu Wutausbrüchen neigte. Dennoch schätzte er seinen Vater, der ihn an seinem umfassenden Wissen gerne teilhaben ließ und dabei überraschend viel Geduld bewies. Reginald schmückte seine Tagebücher mit Bildern von Dubliner Straßenszenen und Gebäuden, mit Impressionen der umliegenden Landschaft, vor allem der Strände bei Howth und der Landschaften der Wicklow Mountains, wohin er gelegentlich mit seinen Eltern zu Verwandtenbesuchen fuhr. Für ihn waren das Höhepunkte in seinem eher eintönigen Leben, das geprägt war von der Schule und dem wenig inspirierenden Alltag in seinem Elternhaus. Seine Mutter unterstützte ihren einzigen Sohn in seiner Begeisterung für das Zeichnen, der Vater dagegen zeigte sich wenig beeindruckt von Reginalds Zeichenkünsten, sah darin nicht nur eine Zeitverschwendung, sondern eine geradezu sündhafte Vergeudung von Papier und Stiften. Doch der Familienfrieden war wiederhergestellt, als Reginald am Trinity College aufgenommen wurde. Allerdings durfte nicht ruchbar werden, dass er ursprünglich auf Betreiben seiner Mutter katholisch getauft worden war und erst danach den Segen der Staatskirche erhalten hatte, der sein Vater angehörte. Denn das Trinity College, 1592 von Königin Elisabeth gegründet, nahm nur Protestanten in seine illustren Reihen auf. Aber da Reginald nicht Theologie, sondern Naturwissenschaften studierte, fragte ihn keiner nach seiner Religion.
Der Sprung von Dublin nach London wäre ihm wohl trotz seiner guten Leistungen nie gelungen, wäre nicht Sir Alexander Weight, ein alter Freund des Vaters, eines Abends im März des Jahres 1781 bei Reginalds Eltern erschienen und hätte fast beiläufig erzählt, dass König Georg eine große Leidenschaft habe: Karten. Egal, ob Weltkarten oder kleinere ländliche Teile seines stetig wachsenden Reiches – alles wollte der Monarch vermessen und kartographiert haben. Als Sir Alexander an jenem Abend in Dublin von der Begeisterung des Königs für Karten aller Art berichtete, lag es erst knapp zwei Jahre zurück, dass der sagenumwobene James Cook auf seiner dritten großen Seereise auf Hawaii erschlagen worden war. Damit hatte sich ein Jugendtraum Reginalds in Luft aufgelöst – er wäre allzu gerne mit Kapitän Cook auf Weltreise gegangen und hätte nicht nur Karten gezeichnet, sondern auch Flora und Fauna in aller Welt in Bildern festgehalten, ähnlich dem Deutschen Georg Forster, der auf der zweiten Reise dabei gewesen war. Doch Sir Alexander Weight hatte einen anderen Vorschlag für den Sohn seines alten Freundes: »Warum gehst du nicht nach London? Dort werden fähige junge Männer gesucht, die für den König durch die Lande reisen und kartographieren. Der König ist vor allem an Gegenden interessiert, die landwirtschaftlich nutzbar erscheinen und die man kultivieren könnte. Nicht umsonst wird er ›Farmer George‹ genannt. Gärten und Landwirtschaft interessieren ihn, und er möchte gerne, dass jeder Winkel seines Reichs aufgezeichnet wird.«
Dank der Vermittlung von Sir Alexander zog Reginald tatsächlich ein Jahr später nach London und machte sich bald einen Namen aufgrund seiner präzisen Skizzen und seines Sinns für genaue Daten. Seit sechs Jahren lebte er nun schon hier. Viel Geld verdiente er nicht mit seiner Arbeit. Aber immerhin hatte er weite Teile des Vereinigten Königreichs gesehen, war nach Hannover geschickt worden, um dem dortigen Ingenieurcorps bei seiner Arbeit zuzuschauen, und besuchte danach noch einige Monate die Universität Göttingen, die Georgs Großvater Georg II. gegründet hatte. Dort lernte er Gelehrte kennen wie den sonderlichen, aber faszinierenden Georg Christoph Lichtenberg und den Dichter Gottfried August Bürger. Reginald mochte den deutschen Teil des durch die Personalunion von 1714 entstandenen Zusammenschlusses des Vereinigten Königreichs mit dem Kurfürstentum Hannover recht gerne. Und so hatte er sich gefreut, als man ihn im Frühling des Jahres 1788 mit der Aufgabe betraute, in den Moorgebieten südlich von Stade die Landschaft zu vermessen und zu skizzieren.
Zusammen mit seinem Assistenten Jonathan war er frohgemut an einem milden Julitag in London aufgebrochen und hatte dank des guten Wetters, das die Seereise begünstigte, knapp zehn Tage später sein Ziel erreicht, einen winzigen Ort im Moor bei Bremervörde. Das Moorgebiet nannte sich Brester Moor, die Gruppe der zusammengewürfelten Häuser und wenigen Bauernhöfe, die sich am Rande des Moores um eine Kirche scharten, hieß Brester Holz. Dort bezog er sein Quartier in einem kleinen Haus am Ortsrand, umgeben von einem Gärtchen voller Blumen und Apfelbäume. Trotz der herben Landschaft wirkte dieser Ort an jenem Sommertag fast idyllisch. Und schon am nächsten Tag begann er mit seiner Arbeit. Alles ließ sich gut an, doch dann …
Reginald seufzte. Wie sollte er seine Entdeckungen vermitteln, wem durfte er davon berichten, was würde das für ihn selbst bedeuten? Gab es eine Art Komplott, dessen Opfer er war? Doch dann fiel ihm die alte Frau wieder ein, deren starrer Todesblick ihn in seinen Träumen verfolgte, und er ahnte, dass er sich nicht getäuscht hatte. Es musste jemanden geben, der an den Geheimnissen des Moores interessiert war und vor nichts zurückschreckte. Plötzlich überkam ihn bleierne Müdigkeit. Mühsam schleppte er sich in sein Bett, und wenig später schlief er fest, während draußen der Regen rauschte und in der Ferne wieder der Hund jaulte, der schon wenige Stunden zuvor die abendliche Stille gestört hatte.
Reginald träumte, dass er nach langer Zeit seine inzwischen verwitwete Mutter in Dublin besuchte und sie ihm allerlei Fragen stellte, vor allem darüber, weshalb er mit seinen achtundzwanzig Jahren noch nicht verheiratet sei, als ihn ein heftiges Pochen an der Tür aus der sehr realistisch anmutenden Situation rettete, sich eine passende Antwort auf die drängende Frage seiner Mutter auszudenken. Verwirrt fuhr er hoch.
»Mr Fitzgibbon, Mr Fitzgibbon!« Die schrille Stimme seiner Vermieterin, einer Frau um die fünfzig, die bereits drei Ehemänner überlebt hatte, drang durch seine Benommenheit. »Eine Nachricht für Sie!«
Reginald erhob sich taumelnd – er hatte gestern Abend wohl doch mehr als nur einen Schluck von dem Branntwein zur Beruhigung seiner Nerven getrunken und zu wenig gegessen. Mrs Gregory stand vor der Tür und hielt ihm einen versiegelten Umschlag entgegen. Die Nachricht darin lautete kurz und bündig, er solle sich umgehend bei Sir Albert Demphurst, seinem Auftraggeber, im British Museum melden. Reginald kam das ein wenig merkwürdig vor, da sich der Sitz der Royal Society, für die er arbeitete, seit einigen Jahren im Somerset House unweit der Themse befand. Aber vielleicht wollte ihm Demphurst entgegenkommen und ihn nicht durch die halbe Stadt schicken, um ihn, wie Reginald vermutete, zu seiner Arbeit in Deutschland zu befragen.
Er zog sich rasch an, tauchte das Gesicht in eine Schüssel mit kaltem Wasser und schob sich den letzten Kanten Brot zwischen die Zähne. Auf dem Rückweg würde er im »St. George and the Dragon« dann in Ruhe frühstücken.
Kurz überlegte er, ob er seine Aufzeichnungen mitnehmen sollte. Doch dann entschied er sich dagegen. Demphurst wollte sich gewiss nicht mit Skizzen abgeben, und es schien Reginald verfrüht, den freundlichen älteren Herrn mit seinen anderen Entdeckungen zu konfrontieren. Ohnehin hatte er vor, die Society zu bitten, ihn noch einmal nach Deutschland zu schicken, sobald es das Wetter erlaubte, damit er Details in seine Zeichnungen einfügen konnte. In Wahrheit plante er, seinen eigenen Erkundungen nachzugehen.
Ehe er die Wohnung verließ, versteckte er das Notizbuch hinter einem lockeren Stein über dem Kamin und die Skizzen unter seiner Matratze. Er traute Mrs Gregory nicht, die er schon gelegentlich dabei erwischt hatte, wie sie in seinen Sachen wühlte, angeblich, »um Ordnung zu schaffen«.
Als er eine halbe Stunde später im British Museum im Montagu House ankam, in dem seit 1759 die umfangreichen Sammlungen des Arztes Hans Sloane ausgestellt wurden, wartete niemand auf ihn.
»Sir Albert befindet sich derzeit auf einer Reise durch Yorkshire«, wurde ihm beschieden. »Er wird erst in zwei Wochen wieder zurück sein.«
Reginald war nur für den Bruchteil einer Sekunde überrascht, dann durchzuckte ihn eine dumpfe Ahnung. So schnell er konnte, eilte er durch den feinen Nieselregen, der das Kopfsteinpflaster der Gassen in Rutschbahnen verwandelte, zu seiner Wohnung zurück. Mrs Gregory war nirgends zu sehen, als er das schmale Haus erreichte. Er stürmte die Treppe hinauf in den zweiten Stock.
Die Tür seiner Wohnung stand weit offen, die wenigen Möbel waren umgestürzt, die Matratze aus dem Bett gerissen; auf dem Boden lagen Skizzen früherer Aufträge, das umgestürzte Tintenfass hatte den Tisch mit einer dunkelblauen Lache überzogen, der Inhalt seiner Reisetasche, die er gestern noch nicht ausgepackt hatte, häufte sich in der Ecke. In dem Nebenraum, in dem er seine kleine Bibliothek aufgebaut hatte, waren die Regale umgeworfen worden und die Bücher in wildem Chaos auf dem Boden verteilt.
Doch das Schlimmste war, dass die Skizzen unter der Matratze fehlten. Er hoffte nur, dass die Diebe damit nichts anzufangen wussten, was immer sie damit vorhatten. Es waren in den Augen von Laien ja nur Skizzen, auch wenn sie Reginald viel bedeuteten.
Zorn loderte in ihm auf, als er auf die Verwüstung starrte. Und Ärger über sich selbst. Er war auf einen der ältesten Tricks der Welt hereingefallen, indem er, ohne das Schreiben weiter zu prüfen, der angeblichen Aufforderung seines Arbeitgebers blindlings Folge geleistet hatte. Bittere Galle stieg in seiner Kehle hoch. Seine Ahnungen hatten ihn also nicht getrogen. Und seine Wirtin, die geldgierige Annabell Gregory, mischte gewiss bei diesem Ränkespiel mit.
Doch noch war nicht alles verloren. Sein Notizbuch hatten die Schurken nicht entdeckt. Es befand sich wohlbehalten in der kleinen Nische über dem Kamin, gut verborgen hinter dem rußgeschwärzten Stein. Die Notizen darin würden es ihm ermöglichen, die Skizzen noch einmal zu erarbeiten. Dieser Gedanke erfüllte ihn mit neuer Energie. Noch war nichts verloren.
Er musste diesen Ort verlassen, solange es noch möglich war. Bei dem einen Einbruch würde es nicht bleiben; der oder die Räuber, deren Auftraggeber er zu erraten glaubte, würden wiederkommen. Denn sie hatten beileibe nicht alles gefunden, was sie offenbar gesucht hatten.
Den größten Schmerz der Enttäuschung bereitete ihm die Erkenntnis, dass ihn offenbar sein Assistent Jonathan, dem er vertraut hatte, ans Messer geliefert hatte. Jonathan, der angeblich nichts von den sonderbaren Vorfällen im Moor gespürt und ihn immer zu beschwichtigen versucht hatte, wenn er von diesem »Kribbeln« berichtete, als ob ihn etwas vor einer Gefahr warnte. Denn nur Jonathan wusste, dass Reginald nicht nur brav seinen Auftrag erfüllt, sondern etwas entdeckt hatte, das ungewöhnlich war. Und Jonathan hatte allzu oft mit diesem Kartographen aus Hannover zusammengesteckt, den Reginald instinktiv abgelehnt hatte. Vielleicht hatte er nur gutgläubig irgendetwas ausgeplaudert, aber Reginald glaubte eher, dass Jonathan für ein paar Münzen seine Seele verkaufen würde.
Im Rückblick auf bestimmte Geschehnisse im August und frühen September überraschte ihn diese späte Erkenntnis nun nicht mehr. Er neigte zwar nicht zu Misstrauen und wirkte manchmal etwas zerstreut, aber er war weder naiv noch töricht.
Doch alle diese Gedanken nutzten ihm in diesem Augenblick wenig. Er musste handeln. Und handeln hieß in diesem Fall erst einmal, unterzutauchen.
ZWEI
Anna brauchte drei Tage, um sich in dem Haus einzurichten. Ihre Bücher verstaute sie in den Regalen im Arbeitszimmer und im kleinen Wohnzimmer; die großformatigen Mappen mit den Karten legte sie auf den Küchentisch, den sie als Ablagetisch ins Arbeitszimmer geschoben hatte. Am zweiten Tag regnete es, und sie nutzte die Zeit, um den Laptop und den Drucker anzuschließen, die Kartenmappen chronologisch zu ordnen und das Haus genauer unter die Lupe zu nehmen. Es hatte sogar einen Speicher, zu dem eine ausklappbare Holztreppe führte. Aber offenbar war dieser Speicher eher als Abstellraum für Koffer gedacht, denn er konnte nicht ausreichend hoch sein, dass man darin stehen konnte. Sie brauchte diesen Raum ohnehin nicht. Und es gab ja noch den Keller.
Aber als sie die Tür, die vom Flur nach unten führte, öffnete, reizte es sie wenig, die schmale Treppe hinunterzusteigen. Die schwache Glühbirne an der Kellerdecke erzeugte weniger Licht als vielmehr an den Wänden tanzende Schatten, und es roch nach Morast und Moder. Anna beschloss, ihre Lebensmittelvorräte und die Weißweinflaschen lieber in den Küchenschränken unterzubringen. Sie musste ihren kleinen Vorrat an Flaschen nicht in den kühlen Keller schaffen. Ohnehin trank Anna sehr mäßig. Eine Flasche reichte für eine Woche. Anke Kück hatte veranlasst, dass gleich am ersten Tag ein Getränkelieferant kam und mehrere Kästen mit Mineralwasser ins Haus schleppte. Auch die fanden Platz in der Küche. Für die Aufbewahrung von Vorräten müsste sie also nicht extra in den Keller hinunter. Anna schloss die Kellertür energisch. Keller, nein danke!
Am zweiten Tag tauchte Anke Kück mit einem selbst gebackenen Streuselkuchen bei ihr auf. Glücklicherweise hatte Anna in weiser Voraussicht ihre Kaffeemaschine aus Hannover mitgebracht. In der Küche gab es lediglich einen Filteraufsatz und eine bauchige Kaffeekanne, auf die man diesen soliden Keramikaufsatz stellte.
Sie setzten sich ins Wohnzimmer, in das der von Regenwolken bedeckte Himmel kaum Tageslicht hineindringen ließ und alle Farben dämpfte. Anna nutzte den Besuch ihrer Vermieterin und befragte sie zur Geschichte des Ortes, zu seinen Bewohnern und zu dem Moor, von dem sie bei ihrer ersten Begegnung erzählt hatte, dort würde es spuken.
Anke Kück winkte ab. »Ach, wissen Sie, ich weiß nicht so viel darüber. Da sollten Sie andere wie Pastor Burmeister befragen. Und spuken? Na ja, es gibt ein paar saftige Gruselgeschichten, aber ich glaube eher, dass manch einer im Suff gemeint hat, im Moornebel irgendwelche Geiser zu sehen. Ich persönlich halte da nicht viel von.«
Erneut fiel Anna auf, dass der Redefluss ihrer Vermieterin um manche Themen einen Bogen machte. Auch ihr Interesse an Annas Leben und Arbeit hielt sich in Grenzen.
»Ach, Kunst und Geschichte haben Sie studiert, ist ja spannend«, kommentierte sie Annas kurze Angaben zu ihrer Biographie. »Und geschieden und kinderlos sind Sie? Das ist aber schade. Unser Sohn lebt zwar auch nicht mehr hier, aber er hat immerhin drei Kinder und arbeitet in Bremen als Automechaniker in einer großen Werkstatt. Unsere Enkel sind jetzt zehn, sieben und drei Jahre alt, alles Jungs, die aber viel zu selten hierherkommen …«
Nach knapp anderthalb Stunden weiteren Geplauders verabschiedete sich Anke Kück mit den Worten: »Na, dann muss ich mal wieder. Wenn Sie noch was brauchen oder Fragen haben, melden Sie sich einfach bei mir.«
Anna dankte ihr für den köstlichen Kuchen, dessen Reste sicherlich noch für die nächsten beiden Tage reichen würden.
»Nich dafür.« Anke Kück stieg auf ihr Fahrrad und fuhr durch den feinen Nieselregen davon.
An dem Tag arbeitete Anna nicht mehr und sah am Abend im Fernsehen einen Schwarz-Weiß-Krimi, der in einer englischen Moorgegend spielte. »Tod im Torf« hieß der uralte Film. Anna mochte Horrorfilme, aber dieser ging ihr fast zu nahe, da die Moorlandschaft sie an das Brester Moor erinnerte, das sie ja noch näher erkunden wollte. Danach träumte sie von formlosen Wesen im Moor und glaubte, in ihrem Traum ein fernes Klagen zu hören.
Am dritten Tag kam die Sonne wieder heraus, und Anna beschloss, sich vor ihrem Gang ins Dorf doch noch den Keller anzusehen. Ihre Abneigung dagegen kam ihr beim hellen Sonnenlicht albern vor.
Das schwache Licht fiel auf die steinerne Treppe, die ohne Geländer in die Tiefe führte. Vorsichtig stieg Anna Stufe um Stufe hinunter. Die Treppe mündete in einen leeren Raum. Der Boden sah aus wie festgestampfte Erde, war aber aus Stein. Zwei Türen gingen von ihm ab. Ihre Vermieterin hatte Anna gesagt, dass sich in dem einen Raum die Heizung, eingebaut in den achtziger Jahren, und der Schaltkasten für die Elektrizität befänden.
In dem anderen Raum stand ein klappriges Regal, wie Anna es aus ihrer Kindheit kannte. Ihre Großmutter hatte auf einem solchen Gerüst die Gläser mit eingemachten Pflaumen, Birnen und Quitten aufbewahrt. Noch vor Kurzem hatte Anna ein solches Glas wiederentdeckt, als sie bei ihrer Mutter in Köln die Abstellkammer aufräumte. Auf dem Glas stand die Jahreszahl »1968«. Als Anna es öffnete, sah es so aus, als ob man die darin eingemachten Pflaumen noch essen könnte. Sie hatte den Inhalt des Glases dann aber doch entsorgt. Wenig später hatte sie gelesen, dass Stadtarchäologen im Keller eines baufälligen Hauses in Hannover ein Glas eingemachter weißer Bohnen aus dem Jahr 1944 entdeckt hatten, das den Krieg und die Zerstörung Hannovers überlebt hatte. Der Archäologe hatte der staunenden Journalistenschar erzählt, dass die Bohnen durchaus noch essbar gewesen seien – nach siebzig Jahren.
Auf diesem Regal aber standen keine Gläser mehr, stattdessen lag eine dicke Staubschicht darauf. Überall in dem Keller roch es nach feuchter Erde, auch wenn die Wände wie der Boden aus solidem Stein zu sein schienen. In den zweiten Raum mit der Heizung ging sie nicht hinein. Nichts Aufregendes oder gar Gruseliges gab es in diesem unterirdischen Gemäuer, und doch war sie froh, als sie die Treppe wieder hinaufstieg und wenig später vor der Haustür die frische Luft einatmete.
Sie mochte Keller nicht. Ihr Onkel Ernst hatte einen riesigen Keller besessen, in dem er vor allem seine Alkoholvorräte lagerte. Wenn Anna ihn und seine Frau Hildrun in der Nähe von Hameln besucht hatte, musste sie immer in den Keller, um irgendwelche Flaschen heraufzuholen. Sie hatte diese Besuche in dem alten Haus mit dem halb verwilderten Garten gehasst. Onkel Ernst war ein Vetter ihres Vaters und Tante Hildrun seine dritte Ehefrau. Sie roch immer stark parfümiert, vermutlich um damit ihren eigenen Alkoholgeruch zu überdecken. Inzwischen war Onkel Ernst gestorben, Tante Hildrun lebte in einem Heim mit betreutem Wohnen, der riesige Weinkeller war aufgelöst worden, das Haus verkauft. Die Erben der beiden, Annas Vater und ihre Tante Beatrix, hatten Tabula rasa gemacht und alles verkauft. Ihr Vater wohnte inzwischen auf Mallorca, war mit seinen achtundsiebzig Jahren noch sehr rüstig und mittlerweile mit seiner langjährigen Freundin Bella verheiratet. Ihre Mutter dagegen wohnte wieder in Köln, kümmerte sich um ihre eigene uralte Tante und ihre Schwester Brigitte, spielte leidenschaftlich gerne Bridge und arbeitete ehrenamtlich.
Anna sah ihren Vater einmal im Jahr, wenn sie für ein paar Tage nach Mallorca flog, um auszuspannen. Ihre Mutter besuchte sie fast alle sechs Wochen für ein Wochenende. Zu ihren beiden Geschwistern, ihrem fünf Jahre älteren Bruder Sebastian, der als Neurologe in Hamburg lebte, und ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Lara, so benannt nach Mutters Lieblingsfilm »Doktor Schiwago«, die als Bibliothekarin in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt arbeitete, hatte sie ein nicht sehr enges, aber freundliches Verhältnis. Anna galt als Außenseiterin der Familie. Ihre Ehe mit Magnus, einem Kollegen, der Neuere Geschichte an der Universität Göttingen unterrichtete, hatte gerade mal vier Jahre gehalten, war nach einer Trennungszeit von drei Jahren vor einem Jahr geschieden worden, und Magnus hatte zwei Monate danach wieder geheiratet. Aber immerhin hatten sie sich als gute Freunde getrennt, und Anna rief Magnus sogar gelegentlich an, um ihn bei speziellen historischen Fragen um Hilfe zu bitten.
Sie trat auf die sonnenüberflutete Straße, die ins Dorf führte. Von ihrer Vermieterin wusste sie, dass Bresterholz aus einem Zusammenschluss von ehemaligen kleinen Bauernhöfen bestand, deren Besitzer meistens keine Landwirtschaft mehr betrieben, sondern die Flächen an den einzigen Großbauern der Gegend, Karl Heinz Fichte, verpachteten. Der wohnte in einem stattlichen modernen Haus am Rande von Bresterholz, hielt sich aber meist in Stade oder Hamburg auf, wo er Wohnungen und Büros besaß. Auch die Flächen der Kücks, ungefähr zwanzig Hektar, hatte er gepachtet und wollte sie ihnen seit Jahren abkaufen. Doch sie weigerten sich. »Der will keinen richtig anständigen Preis zahlen«, meinte Anke.
Anna ging in Richtung Dorf und kam an der kleinen Kirche von Bresterholz vorbei, die einen Besuch wert sein sollte. Sie war umgeben von einem Friedhof, auf dem aber niemand mehr beigesetzt werden konnte. »Wegen Überfüllung«, hatte Anke Kücks trockener Kommentar gelautet. Anna interessierte sich für alte Grabsteine und nahm sich vor, dem Friedhof einen gesonderten Besuch abzustatten. Wie sie gehört hatte, stammten die ältesten Grabsteine aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, als die Kirche von »Brester Holz«, wie der Ort damals hieß, die einzige im näheren Umfeld gewesen war und als Gotteshaus auch für die umliegenden Orte Osterheide, Geestermoor, Vleethenhaus und Aspenvelde diente.
Anna schlenderte an dem kleinen Bahnhof vorbei, an dem die Züge von Bremerhaven nach Buxtehude und umgekehrt alle zwei Stunden in Bresterholz hielten und diejenigen Dorfbewohner beförderten, die ringsum in anderen Orten zwischen Bremerhaven und Buxtehude arbeiteten. Der Bahnhof war einst der Stolz des Ortes gewesen, und Anna konnte an dem hübschen Haus aus Backstein noch einen Rest der guten alten Zeit erkennen, als es hier noch einen Kartenschalter und einen Schrankenwärter gegeben hatte und nicht nur einen Automaten, der mit Graffiti beschmiert war. Die ehemalige Dorfschule, auch das wusste Anne von Anke Kück, diente heute als einzige Dorfkneipe. Sie hieß »Zur Moorbirke«, gepachtet von einem Ehepaar aus Stade, das vor acht Jahren nach Bresterholz gezogen war, weil es hier mit seinen fünf Kindern preiswerter wohnen konnte als in der Stadt. Die Kneipe hielt sich mehr schlecht als recht, war aber im Sommer aufgrund ihrer Terrasse bei Durchreisenden, Touristen und dann auch bei den Bresterholzern beliebt. Im Winter, so Anke Kück, war da »eher tote Hose«. Immerhin gab es in Bresterholz auch einen Lebensmittelladen, der sich gegen die Konkurrenz der Einkaufszentren in der Umgebung behauptet hatte. Dorthin steuerte Anna jetzt. Der Laden hatte von sieben Uhr bis achtzehn Uhr geöffnet und offerierte neben Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen auch Kuchen und frischen Kaffee.
Anna stieß die Tür auf. Vor der Ladentheke standen zwei Frauen. Die eine nickte Anna freundlich zu, die andere sah sie misstrauisch an. Die Frau hinter der Theke dagegen begrüßte Anna herzlich.
»Sie müssen Ankes Mieterin sein. Wie schön, dass Sie vorbeikommen«, rief sie. »Wie gefällt Ihnen das Moorhaus?«
»Es ist sehr gemütlich«, sagte Anna.
»Gut, dass es jetzt wieder genutzt wird. Häuser sollten nicht so lange leer stehen«, erwiderte die Frau, der offenbar der Laden gehörte. »Übrigens, ich bin Birthe Hoffmann, und diese beiden Damen sind Elsa Wirtz und Beate Steffens.« Elsa Wirtz nickte Anna nochmals zu, sagte aber nichts, während Beate Steffens, die etwa in Annas Alter war, aber durch ihre schief geschnittene, rot gefärbte Frisur älter aussah als Mitte vierzig, nur kurz brummte: »Na, hoffentlich gibt es bei Ihnen nicht auch einen Rohrbruch.«
Anna fand diese Äußerung befremdlich, erinnerte sich aber, dass Anke Kück von einem Rohrbruch gesprochen hatte. »Ja, hoffentlich nicht. Das wäre übel«, antwortete sie höflich.
»Aber falls das passieren sollte, könntest du dich darüber doch eigentlich freuen, Beate. Dein Mann ist schließlich Klempner«, sagte Birthe Hoffmann.
»Nee, der geht aber nicht gerne in das olle Haus«, erwiderte Beate. »Ist irgendwie gruselig da unten im Keller. Da schickt er lieber die Kollegen aus Bremervörde her.«
»Das ist doch nur dummer Aberglaube. Das klingt eher nach deinem Schwiegervater mit seiner Spökenkiekerei.« Birthe Hoffmann wandte sich an Anna und sagte mit einem entschuldigenden Lächeln: »Hören Sie nicht auf Beate. Es soll komische Geräusche in dem Haus gegeben haben – aber das kann auch an den alten Rohren liegen. Die klopfen manchmal. Und spuken tut es nur im Moor.«
Das hatte Anna bereits von Anke Kück gehört und wunderte sich, dass auch Birthe das erwähnte. »Ich glaube nicht an Geister«, sagte sie lächelnd. »Auch wenn das Haus alt ist. Aber vielleicht sollte ich mal ins Moor gehen«
»Es lohnt sich. Es ist sehr schön dort«, warf Elsa ein. »Allerdings natürlich nicht nachts. Sie sollten bei diesem Wetter einen Spaziergang machen. Die Wege sind gut ausgeschildert, und es ist ja auch nicht mehr wie vor zweihundert Jahren. Da sind manchmal Leute im Moor verschwunden.«
»Gibt es denn hier auch Moorleichen?« Annas Interesse war geweckt.
»Wir haben noch keine gefunden, obwohl so ein Moorarchäologe schon ein paarmal hier war und danach gesucht hat. Der meinte, jedes Moor hat seine Leichen, und er hatte von dieser alten Sage gehört, nach der vor langer Zeit jemand im Moor verschwunden ist und seitdem als Moormann dort einen Schatz hütet. Er wird der Rote Piet genannt wegen seiner angeblich roten Haare«, sagte Birthe. »Den Roten Franz aus dem Moor bei Versen hat es ja wirklich gegeben. Der ist ja sogar in Hannover im Museum. Aber ein Moormann als Schatzhüter bei uns im Moor? Wenn Sie mich fragen, ist das alles dumm Tüch. Keine Leiche und kein Schatz. Und Gespenster gibt es hier nicht. Unsere Toten liegen alle brav auf dem Friedhof. Jedenfalls die von früher. Jetzt ist da kein Platz mehr, und die müssen rüber nach Bremervörde oder Stade oder Bederkesa.«
Sie wandte sich an Elsa. »So, willst du nun den restlichen Käsekuchen oder nicht?«
Elsa nickte, Birthe packte drei große Stücke Käsekuchen ein, und mit einem etwas schüchternen »Denn man tschüs« verschwand Elsa aus dem Laden. Beate murmelte etwas, packte ihre beiden Einkaufstüten und folgte ihr.
Birthe sah den beiden mit einem sonderbaren Ausdruck hinterher. Seufzend wandte sie sich dann an Anna. »Was kann ich für Sie tun?«
Anna wies auf einen der Käselaibe in der Theke. »Zehn Scheiben davon, eine Leberwurst bitte und einen Liter Milch. Und ein frisches Brot.«
Birthe reichte ihr alles, Anna packte es in ihre Stofftasche, bezahlte und wollte gerade den Laden verlassen, als Birthe sagte: »Wenn Sie möchten, dann trinken Sie mal einen Kaffee mit mir. Sie kennen ja noch niemanden hier, und es kann ganz schön einsam in unserem Dorf sein. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge über Bresterholz und über diese Gegend erzählen. Ich bin hier geboren worden, und mein verstorbener Mann stammte auch von hier. Also alteingesessen, wie man so sagt.«
Anna bedankte sich. Sie fand Birthe, die nur wenige Jahre älter war als sie, sympathisch. »Das tut mir leid, dass Sie Ihren Mann verloren haben«, sagte sie etwas verlegen.
»Danke. Ralf ist schon seit fünf Jahren tot. Er ist bei einem Feuer umgekommen. Freiwillige Feuerwehr. Das Feuer ist in der Scheune von Piet Carstens ausgebrochen. Dem hat man sogar versuchten Versicherungsbetrug vorgeworfen. In Wahrheit aber haben da ein paar Jungs mit Streichhölzern gespielt und wollten sich ein gemütliches Lagerfeuer machen. Da ist das Stroh in Flammen aufgegangen. Einer der Jungen wäre fast verbrannt, der Sohn von Karl Heinz Fichte, der Herbert. Trägt heute noch eine Narbe davon. Aber er hat überlebt und die beiden anderen Jungs auch. Nur meinen Ralf, den hat es erwischt. Rauchvergiftung, als er den Herbert aus der Scheune gezerrt hat. Und sein Herz war ja auch nicht mehr so gesund, er war schon viel älter als ich.«
Birthe starrte einen Augenblick vor sich hin. »Die Eltern von dem Herbert waren ziemlich verzweifelt und wollten irgendwie was Gutes für mich tun, weil ihr Sohn wohl der Anführer von den drei Jungs war und sie überredet hat, das Feuer zu machen. Die haben mir die Miete für den Laden für immer erlassen. Das Haus hier gehört ihnen ja. Und über dem Laden ist meine Wohnung. Das bringt mir zwar den Ralf nicht zurück, aber ich kann ganz gut allein über die Runden kommen. Unserer Tochter Susanne haben sie dann auch noch die Ausbildung bezahlt. Die ist Apothekerin in Stade.«
Da soll noch einer sagen, dass nur in Städten etwas passiert, dachte Anna.
»Dieser Scheunenbrand hat uns alle ziemlich erschüttert.« Birthe wirkte für einen Augenblick nachdenklich. Dann aber lächelte sie. »Alles lange her!«