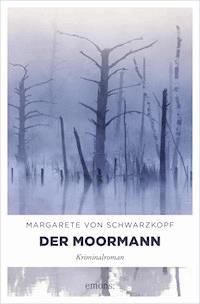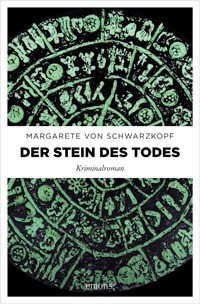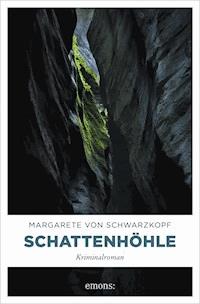
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anna Bentorp
- Sprache: Deutsch
Spannende Historie und lebendige Kunstgeschichte, eingebettet in einen wendungsreichen Kriminalroman. Kunsthistorikerin Anna Bentorp stößt in einem Schloss im Ith auf ein ebenso kostbares wie mysteriöses Bild, das einen Hinweis auf einen verschollenen Schatz gibt. Dessen Schicksal ist eng verflochten mit einer sagenumwobenen Höhle – und mit dem Tod mehrerer Menschen. Anna taucht tief in eine verstörende Vergangenheit ein, doch sie kann nicht verhindern, dass es weitere Tote gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margarete von Schwarzkopf, geboren in Wertheim am Main, studierte in Bonn und Freiburg Anglistik und Geschichte. Sie arbeitete zunächst für die Katholische Nachrichtenagentur, dann als Feuilletonredakteurin bei der »Welt« und viele Jahre beim NDR als Redakteurin für Literatur und Film. Heute arbeitet sie als freie Journalistin, Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: emoji/photocase.de Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-423-0 Originalausgabe
Die Zitate auf Seite 170 und 304 stammen aus: Sir Walter Scott, »Waverley– Band1«, Verlag Tredition und Projekt Gutenberg, übersetzt von Erich Walter. Die Zitate auf Seite244 stammen aus: Heinrich Heine, »Die Harzreise– Reisebilder«, Kapitel4, Artemis& Winkler Verlag, 1969.
Immer wieder in Liebe für TLF
My native land
Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land!
Whose heart hath ne’er within him burn’d,
As home his footsteps he hath turn’d
From wandering on a foreign strand!
Sir Walter Scott, »The Lay of the Last Minstrel«, 1805
Erste Gedichte
Ein weißes Schloß in weißer Einsamkeit.
In blanken Sälen schleichen leise Schauer.
Todkrank krallt das Gerank sich an die Mauer,
und alle Wege weltwärts sind verschneit.
Darüber hängt der Himmel brach und breit.
Es blinkt das Schloß. Und längs den weißen Wänden
hilft sich die Sehnsucht fort mit irren Händen…
Die Uhren stehn im Schloß: es starb die Zeit.
Prolog
Er hatte das Feuer oben auf dem Hügel vor den Höhlen mehrere Nächte hintereinander gesehen. Doch als er an einem Morgen hinaufgestiegen war, um zu erkunden, was dahintersteckte, fand er nur noch Asche. Keine Spur von denjenigen, die das Feuer entzündet hatten. Ihm fiel die alte Sage ein, die davon erzählte, dass diese Höhlenfeuer immer ein Unglück ankündigten. Aber James MacNeill glaubte nicht an Spukgeschichten. Dahinter musste ein Mensch stecken, vielleicht einer der Deserteure, die sich angeblich in den Höhlen versteckt hielten, oder ein Dorfbewohner, der seinen Schabernack mit dem Aberglauben der Bewohner im Tal trieb. Doch seit gestern Abend war kein Feuerschein mehr zu sehen. Darauf hatte James gewartet, denn er wollte ungestört bei den Höhlen sein.
Der Aufstieg in dieser Januarnacht war anstrengender, als er gedacht hatte. Er führte sein Pferd Keeper am Zügel und kämpfte sich den Weg durch das Dickicht und das scharfe Wintergras. Als er endlich vor dem Eingang der Höhle angekommen war, holte er tief Luft. Mit zitternden Händen entzündete er die Fackel, die er vor zwei Tagen hinter einem Stein in der Nähe des Eingangs versteckt hatte. Noch konnte er im fahlen Licht des Halbmondes die Umrisse des Höhleneinganges erkennen. Er band sein Pferd locker an einen Strauch, um möglichst rasch von diesem Ort wieder verschwinden zu können, und tastete sich in das Halbdunkel des schmalen Felsdurchbruchs. Die Fackel warf zuckende Schatten auf die rötlichen Steinwände. Aus dem Inneren wehte ein kühler Luftzug. Es roch nach Stein und Erde und nach irgendetwas, das er nicht einordnen konnte. Moder? Moos? Wasser, das sich in den Felsspalten sammelte? Ihm blieb keine Zeit für Überlegungen. Er musste die in einem tiefen Felsspalt versteckten Bilder bergen, sein Pferd beladen und sich auf den langen Weg aus dieser unwirtlichen Gegend machen, in der er vier Jahre gelebt hatte.
Unten im Tal lag das Schloss, in dem er nach ihrer Flucht aus Schottland mit seiner Frau Alexandra Unterschlupf gefunden hatte. Seit ihrem Tod vor drei Monaten, kurz nach der Geburt ihrer Tochter Elisabeth, hatte sich etwas verändert in der Atmosphäre dort, wobei er schon seit geraumer Zeit ein wachsendes Unbehagen verspürt hatte. Die Mauern des Schlosses waren für ihn immer mehr zum Gefängnis geworden.
Alexandras Vetter Rudolf von Rödelshausen und seine Frau Dorothea verbargen ihre wahren Gefühle für ihn, den schottischen Flüchtling, nicht länger hinter geheuchelter Freundlichkeit. Sie hatten ihn nur bei sich aufgenommen, weil Alexandras Mutter die Schwester von Rudolfs Mutter und damit Rudolfs Tante gewesen war. Aber als er und Alexandra Ende Mai des Jahres 1746 in Schloss Hammelsberg aufgetaucht waren, begleitet von ihren beiden Dienern William und Seamus und der Zofe Beatrice, hatte er von Anfang an gespürt, dass Rudolf sie nur sehr zögernd aufnahm. Vielleicht fürchtete er Spione, die in Hannover melden könnten, dass er einem der Überlebenden der verhängnisvollen Schlacht bei Culloden vom 16.April– und zudem noch einem nahen Verwandten der MacLachlan, die dem siegreichen Herzog von Cumberland ein besonderer Dorn im Auge waren– Asyl gewährte.
James fror plötzlich. Die Luft in der Höhle erschien ihm eisig. Hier hatte er kurz nach seiner Ankunft in Schloss Hammelsberg drei seiner insgesamt sechs aus Schottland geretteten Bilder versteckt, eingewickelt in dickes Sackleinen. Er traute der deutschen Verwandtschaft seiner Frau nicht. Diese Bilder könnten, sollte er je wieder in seine Heimat zurückkehren, die Basis für eine gesicherte Existenz sein, denn sie waren von großem Wert. Die drei anderen Bilder würde er im Schloss zurücklassen. Das war eine mehr als angemessene Bezahlung für das Asyl, das ihm Alexandras Verwandtschaft gewährt hatte.
Er wandte sich zum Eingang der Höhle um. Draußen schien die tiefschwarze Nacht den Atem anzuhalten. Die Mondsichel war von einer Wolke verschluckt worden. Nur der Januarwind strich leise durch die dürren Baumwipfel. Nichts regte sich. Oder doch? War da ein Knacken, ein Wispern?
James lauschte angestrengt in die Stille. Ein leises Schnauben vor dem Höhleneingang, das hohle Brechen eines Astes. Er atmete auf. Das Schnauben stammte von seinem Pferd, das sicherlich gerade auf einen Zweig getreten war.
Er hatte seine Flucht seit dem Tod seiner Frau Mitte Oktober geplant, niemanden in seine Pläne eingeweiht und selbst seinem treuen Diener William nichts verraten. Bei Nacht und Nebel wollte er aufbrechen, doch zuvor den Schatz aus seinem Versteck holen. James hatte die Höhle rein zufällig als ein ideales Versteck entdeckt. Hier, so glaubte er, waren die Gemälde sicher vor der Gier seiner Verwandten. Wie enttäuscht war Rudolf gewesen, als er feststellte, dass James anstelle von Säcken voller Goldmünzen nur einige Bilder in seinem Reisegepäck hatte. Rudolf selbst besaß eine stattliche Sammlung niederländischer und italienischer Maler, doch davon waren die meisten entweder zweitklassige Kopien oder Werke weniger berühmter Künstler. Deshalb hatte er Alexandra gleich nach ihrer Ankunft gefragt, ob es sich denn gelohnt hätte, diese Bilder auf der Flucht mitzunehmen. Und Alexandra, die viel Liebenswürdigkeit, aber keine Menschenkenntnis besaß, hatte sanft gelächelt und geantwortet: »Oh ja! Diese Werke sind wahre Schätze.«
Rudolf und seine Frau Dorothea ahnten nicht, dass James außer den Bildern einen Schatz von ungeheurem Wert, den »Star of Scotland«, bei sich trug. Er war ein Familienerbe der MacNeills, ein Geschenk, das König KarlII., Enkel des ersten Stuartkönigs Jakob, der Urgroßmutter von James mütterlicherseits gemacht hatte. Sicherlich war die schöne junge Frau eine der vielen Geliebten des Königs gewesen, ehe sie einen seiner schottischen Vertrauten heiratete, dem sie acht Kinder schenkte, darunter die spätere Großmutter von James. Der »Star of Scotland« hatte auch die Begehrlichkeit des Herzogs von Cumberland geweckt. Doch als seine Soldaten in die Burg der MacNeill eindrangen, war die Familie verschwunden und der »Star of Scotland« mit ihr.
Als James nun Rudolfs unverhohlen gierigen Blick auf die Bilder gesehen hatte, verbarg er die drei wertvollsten Gemälde tief im Schoß der Höhle. Durch einen schmalen Eingang gelangte man in einen schlauchartigen Gang, der an seinem Ende steil nach unten stürzte. In diesem finsteren Abgrund lagen unzählige Menschenknochen. Die Legenden erzählten, dass die Bärenhöhle einst als Opferhöhle gedient habe.
James’ Gedanken wanderten noch einmal zurück in die Vergangenheit. Er hatte gehofft, in diesem deutschen Schloss, das weitab von größeren Straßen lag, ein Refugium für sich und seine Frau zu finden, bis sich die Stürme in seiner Heimat gelegt hatten und der Zorn GeorgsII. auf die Schotten verflogen war. James gehörte zu den Anführern des Jakobitenaufstandes gegen den britischen König aus dem Haus Hannover. Die Chance für eine Rückkehr der katholischen Stuarts schien gekommen, als Charles Edward Stuart, genannt »Bonnie Prince Charles«, 1745 mit französischer Unterstützung aufbrach, um zunächst Schottland und danach ganz Großbritannien zu erobern.
Die anfänglichen Siege ließen die Hoffnung aufkeimen, dass Charles Stuart den König aus dem Haus Hannover verdrängen könnte, doch am 16.April 1746 besiegte das englische Heer unter seinen Heerführern George Wade und Wilhelm Augustus Herzog von Cumberland, dem dritten Sohn GeorgsII., die Schotten auf dem Moor von Culloden, unweit von Inverness. Nach der Schlacht ging der Herzog, der später unrühmlich als »Butcher Cumberland« in die Annalen eingehen sollte, drakonisch gegen die Clans vor. James MacNeill, der die kurzen heftigen Kämpfe leicht verwundet überlebt hatte, musste als »Rebell« um sein Leben fürchten.
Mit Mühe gelang es ihm nach der Schlacht, seine Burg bei Drumnadrochit am Loch Ness zu erreichen und mit seiner Frau Alexandra, den Dienern William Fraser und Seamus Connor und der Kammerzofe Beatrice den sechsjährigen Sohn Alistair nach Glasgow zu geleiten. Dort übergaben sie den Jungen der Obhut von James’ Cousine Claire, verheiratet mit einem Astronomen in königlichen Diensten und insgeheim eine Anhängerin der Stuarts. Claire und Hugh de Abreville hatten keine eigenen Kinder und nahmen den kleinen Alistair liebevoll auf.
In den Jahren seit der Schlacht von Culloden und der Flucht aus Schottland erhielten James MacNeill und seine Frau regelmäßig Nachrichten über das Wohlergehen ihres Sohnes. Jeden Monat ritt William nach Hameln und holte dort in der Poststation die Briefe mit verschlüsselter Anschrift und ebenso verschlüsseltem Absender ab. Alistair ging es laut dieser Briefe von Claire de Abreville gut, seine Zieheltern sorgten sich aufopfernd um ihn. Dennoch nagte der Kummer um den verlorenen Sohn an James und Alexandra.
Als Alexandra dann eines Morgens vor gut einem Jahr verkündete, sie sei schwanger– und dies trotz ihres fortgeschrittenen Alters von Mitte dreißig–, wichen die Schatten der Sehnsucht und des Verlustes für einige selige Momente. Aber dieses Glück währte nicht lange. Alexandras Schwangerschaft verlief ohne Probleme, auch die Geburt der kleinen Elisabeth Ende September mit Hilfe einer robusten Hebamme aus dem nahe liegenden Dorf machte kaum Schwierigkeiten. Doch wenige Tage nach der Geburt des kräftigen Mädchens mit dem rötlichen Haarschopf erkrankte Alexandra, bekam hohes Fieber und starb Mitte Oktober trotz aller Bemühungen eines aus Hameln herbeigerufenen Medicus.
Kurz vor ihrem Tod hielt sie ihre kleine Tochter noch einmal in den Armen und flüsterte: »Bring unser Kind nach Hause, Jamie. Dieses Schloss und diese Gegend werden von zu vielen Schatten beherrscht.«
Nach einem Monat der Tränen und der Verzweiflung beschloss James, nach Schottland heimzukehren, selbst auf die Gefahr hin, dass ihn dort ein ungewisses Schicksal erwartete. Es drängte ihn, seinen Sohn wiederzusehen. Er wollte heimlich verschwinden, denn er fürchtete, dass Rudolf ihn nicht ohne Weiteres gehen lassen würde. Seine Tochter ließ er schweren Herzens zunächst zurück. Es erschien ihm zu gefährlich, die kleine Elisabeth den Strapazen dieser gefahrvollen Reise auszusetzen. Und wenn ihm etwas zustieße, dann wäre seine Tochter bei Rudolf und seiner Frau zumindest in Sicherheit.
James schob alle diese Gedanken beiseite. Er würde an diesem 21.Januar des Jahres 1751 alleine aufbrechen, selbst ohne seinen treuen Diener William, dem er mehr traute als Seamus. Er hatte ihm in dessen Kammer einen Brief in einem Buch hinterlassen. William würde ihn rasch finden, denn er war ein begeisterter Leser, und die Ausgabe von »Robinson Crusoe«, in die James die Nachricht gesteckt hatte, lag auf einem Stapel von Büchern auf dem Tisch neben dem Bett. William sollte noch einen Auftrag erfüllen und ihm dann folgen.
James drehte sich noch einmal kurz um, um einen letzten Blick in die Höhle zu werfen. Das flackernde Licht der Fackel und die wabernden Schatten an den gefurchten Wänden weckten dunkle Erinnerungen an die Schlacht von Culloden in ihm. Er sah wieder das blutige Schlachtfeld, hörte die Todesschreie und die verzweifelten Rufe der Verwundeten. Er wusste damals schon, dass dies das Ende der Clans bedeutete. Im fallenden Licht jenes Apriltages sah er den Sieger von Culloden, den Herzog von Cumberland, mit kaltem Blick und zufriedenem Lächeln über das Feld reiten.
James riss sich mühsam aus seinen Erinnerungen. Es war Zeit für einen Neuanfang. Er schlug das Kreuzzeichen und bückte sich, um die Bilder hochzuheben. Sie waren nicht schwer, nur unhandlich.
Der Fluch der Höhlen
Stefan Arendt rieb sich zufrieden die Hände. Heute würde sein Glückstag sein und sich die wochenlange Recherche für seine Doktorarbeit im Sir-Walter-Scott-Archiv in Edinburgh auszahlen. Und »auszahlen« war nicht im übertragenen Sinn gemeint. Als er an diesem Morgen Anfang September vor seiner Göttinger Studentenwohnung in einem schlichten Mietshaus nahe der Stadtmitte in sein Auto stieg, malte er sich aus, wie er schon sehr bald einen wesentlich schickeren Wagen fahren würde. Nicht mehr diese alte Klapperkiste, die er billig von einem früheren Kommilitonen erstanden hatte. Wie gut, dass ihn sein alter Studienfreund Constantin von Lengsfeld seiner Großmutter für eine ihrer kulturellen Veranstaltungen empfohlen hatte und er auf Schloss Hammelsberg einen Vortrag über seine Studienergebnisse halten durfte. Das alles fügte sich wunderbar.
Stefan warf einen kurzen Blick auf den Rücksitz seines Wagens. Dort lagen sein Laptop und daneben sein Vortrag in einer Plastikhülle. Das Schicksal meinte es gut mit ihm. Vor einigen Wochen hatte er im Scott-Archiv alte Briefe und Tagebucheintragungen entdeckt, die er zunächst nicht als spektakulär empfunden hatte. Doch dann dämmerte ihm, dass er auf etwas gestoßen war, das nicht nur eine literarische Überraschung, sondern auch anders nutzbar sein könnte. Bei näherer Betrachtung erwiesen sich die Dokumente, die er bei der Recherche für seine Arbeit zu Scotts 1814 erschienenem ersten Roman »Waverley« zwischen angestaubten Büchern und in halb vergessenen Archivmappen gefunden hatte, als der Stoff, aus dem er nebenbei eine Menge Geld schlagen könnte.
Stefan grinste und bog von Göttingen kommend auf die B240 in Richtung Hameln ab. Sein Ziel, das stattliche Schloss Hammelsberg aus der Zeit der Weserrenaissance, lag etwas südlich von Hameln in der Nähe von Hammelshausen.
Was für alberne Namen, dachte Stefan. Er schaltete das Autoradio ein– immerhin hatte diese Kiste eine halbwegs ordentliche Anlage– und nickte zu den Beats der Songs, die »1Live« sendete.
Das einzig Ärgerliche an dieser ungefähr zweistündigen Fahrt war der kräftige Dauerregen, der sein geplantes Treffen hoffentlich nicht beeinträchtigen würde. Eigentlich erwartete ihn Baronin Rödelshausen erst am nächsten Tag, aber Stefan wollte heute schon einen Deal unter Dach und Fach bringen, die Nacht dann in Eschershausen verbringen und am nächsten Tag vergnügt zum Schloss fahren, um vor den erlesenen Gästen der Baronin seinen Vortrag zu halten.
Schon immer hatte er es verstanden, sich hie und da ein erkleckliches Sümmchen Geld nebenbei zu »verdienen«. Dazu gehörte, dass er Kommilitonen bei ihren Arbeiten half, Spickzettel mit den richtigen Antworten an den Mann brachte und den Prüflingen hinterher Geld für sein Schweigen abknöpfte. Falls sie vorhatten, ihn zu verpfeifen, drohte er mit anonymen Tipps an die Univerwaltung. Auch die Warnung von Betroffenen, ihn mitauffliegen zu lassen, störte Stefan nicht. Er wusste genau, dass keines dieser armen Würstchen seine Drohung je wahr machte.
Als Schüler hatte er sein Taschengeld noch ganz brav durch Nachhilfeunterricht in Englisch und Latein aufgebessert, bis er dann in der letzten Klasse mit ersten kleinen Erpressungen begonnen hatte. Auch an der Uni nahm manch ein weniger begabter Kommilitone Stefans Angebot, ihm etwas zu »helfen«, gerne an– und blutete später dafür.
Doch das war alles nichts im Vergleich zu dem, was er nun plante. Er bewunderte sich selbst dafür, dass er nach seinen Entdeckungen in Edinburgh über bestimmte Ereignisse in dieser Region so rasch erkannt hatte, wen er melken konnte. Es ging um höchst delikate Informationen, die insbesondere drei Menschen betrafen. Mit detektivischem Spürsinn hatte er deren Namen recherchiert. Das Schicksal spielte ihm in die Hände, als er erfuhr, dass alle drei Personen an diesem Septemberwochenende in Hammelsberg anwesend sein würden. Ein paar Anrufe, ein bisschen Internetrecherche, und schon konnte er seinen Coup planen.
Sein Vortrag könnte ein ganz neues Licht auf die Geschichte von Hammelsberg und die Geschehnisse in den Höhlen im 18.Jahrhundert werfen. Er staunte immer wieder, dass die Vergangenheit auch in der Gegenwart Menschen in einen Strudel zu reißen vermochte. Ein saftiger Skandal in der eigenen Familiengeschichte konnte, selbst wenn das Geschehen weit zurücklag, auch jetzt noch zu unangenehmen Konsequenzen führen. Darauf baute Stefan. Niemand hörte gerne, dass er von einem Mörder abstammte oder von einem Betrüger, von einem Kriegsverbrecher oder von einem Hochstapler, zumal wenn man eine bestimmte gesellschaftliche Position innehatte.
Stefan spürte nicht den geringsten Skrupel. Er würde sich ihre Angebote anhören und dann seine Forderungen erhöhen. Keiner durfte vom anderen wissen.
Er verließ die B240 und fuhr auf die schmale Landstraße, die nach Hammelshausen führte. Vor einem Jahr hatte er noch nicht gewusst, dass es einen Ort namens Hammelshausen und ein Schloss namens Hammelsberg überhaupt gab. Allerdings hatte ihm ein Onkel vor langer Zeit von der Bärenhöhle und der Einhornhöhle erzählt, sie aber in der Nähe von Eschershausen verortet. Doch dann war Stefan im Zusammenhang mit seiner Forschung auf beide Namen gestoßen. Er war schon sehr gespannt auf diese Höhlen. Dort sollte er den ersten seiner »Ansprechpartner« treffen.
Sie hatten am Vortag miteinander telefoniert. Die Stimme des Mannes am anderen Ende der Leitung hatte vernünftig und fast liebenswürdig geklungen. Stefan hatte ihm in kurzen Worten erklärt, was seine Recherchen für ihn bedeuten könnten.
Die Antwort hatte gelautet: »Falls Sie Beweise dafür haben sollten, wäre es in der Tat in meinem Interesse, wenn wir uns treffen und etwas aushandeln. Vielleicht wären Sie bereit, einige Ihrer Informationen ein wenig in meinem Sinne zu verändern, natürlich gegen ein Extraentgelt.«
Das klang doch schon mal sehr gut.
Mit der zweiten Person wollte sich Stefan am nächsten Tag im Café Ithblick in Eschershausen treffen, mit dem Dritten musste er noch einen Treffpunkt vereinbaren. Zur Not konnte er im Schloss vor dem Vortrag mit ihm sprechen. Er hatte geplant, gegen sechzehn Uhr dort zu sein. Dann blieben ihm noch vier Stunden bis zum abendlichen Ereignis.
Kurz vor Hammelshausen fing sein Auto an zu stottern. Fluchend hielt er an. Der Motor streikte mal wieder, wie so oft bei Regen. Meist lief er nach einer Pause von zwei Stunden wieder. Stefan blickte auf die Uhr. Ihm blieb noch eine Stunde, um den Treffpunkt mit der Nummer eins auf seiner Liste zu erreichen. Die Bärenhöhle. Laut seiner Berechnung konnte er sein Ziel gut zu Fuß erreichen, vielleicht sogar schneller als mit dem Wagen. Dumm war nur, dass er ihn in dieser Kurve stehen lassen musste.
Er stieg aus und versuchte, den Wagen ein Stückchen zu schieben, gab aber rasch auf. Es herrschte so wenig Verkehr, dass er nicht fürchtete, irgendjemand könnte sein Auto rammen. Er wollte möglichst schnell zur Höhle und danach wieder zurück, um vor Einbruch der Dunkelheit in Eschershausen einzutreffen. In zwei Stunden würde sein Auto erfahrungsgemäß wieder fit sein und er um einige tausend Euro reicher. Schnell packte er seinen Laptop und die Plastikmappe mit den Notizen in seine alte, abgeschabte Ledertasche und marschierte los.
Er hatte zwar eine Karte der Gegend dabei, doch der Weg war auch ohne sie leicht zu finden. Man konnte querfeldein bis zum Koboldhügel gehen und von da aus hinauf zu den Höhlen, auf die Schilder am Wegesrand hinwiesen. Stefan wusste, dass es dort oben vier Höhlen gab, aber nur die Bärenhöhle und die Einhornhöhle waren auf den Wegweisern vermerkt. Warum ihn sein Gesprächspartner unbedingt dort treffen wollte, war ihm nicht ganz klar. Aber wahrscheinlich kamen bei diesem Wetter keine Spaziergänger vorbei, und man war ungestört.
Mittlerweile hatte der Regen nachgelassen, die Sonne kämpfte sich durch die Wolkenschwaden. Stefan fühlte sich gelassen und heiter. Es war die beste Entscheidung seines Lebens gewesen, in Edinburgh für seine Doktorarbeit zu recherchieren und sich nicht auf die digital gespeicherten Werke und die Sekundärliteratur in der Göttinger Universitätsbibliothek zu verlassen.
Die Sonne hatte ihren Kampf gegen die Wolken aufgegeben, und der Regen setzte erneut ein. In großen Tropfen peitschte er Stefan ins Gesicht, als er über die Wiese auf den Hügel zuging. Bei seinem Aufstieg zur Bärenhöhle rutschte er immer wieder aus, wobei ihm mehrmals seine Tasche aus der Hand glitt, aber irgendwann hatte er es geschafft. Genau fünf Minuten vor der verabredeten Zeit stand er vor der Bärenhöhle. Der Regen war in ein stetes Nieseln übergegangen.
Stefan sah sich um. Keine sehr romantische Gegend. Felsen, ein paar dürre Sträucher, unter ihm auf dem Hügel Bäume und viele verstreute Felsbrocken. Kein Vogellaut. Nur aus dem Dorf, das sich im Regendunst versteckte, drangen ab und zu das Krähen eines Hahns und Hundegebell. Das Schloss sah man von hier aus nicht. Es lag nur knapp anderthalb Kilometer entfernt in der Talmulde, aber die Baumwipfel verdeckten die Sicht.
Er lauschte eine Weile dem leichten Rauschen des Regens und dem Wind, der säuselnd durch die Sträucher fuhr, bis er beschloss, sich im Eingang der Bärenhöhle unterzustellen und dort auf seine Verabredung zu warten.
Der kräftige Schlag traf ihn völlig überraschend. Er sank in die Knie, seine Aktentasche rutschte ihm aus der Hand und fiel auf den harten Boden. Der nächste Schlag warf ihn nieder, und er traf mit dem Gesicht heftig auf dem felsigen Grund auf. Er versuchte, sich nach seinem Angreifer umzudrehen und dabei die Arme schützend vors Gesicht zu halten, aber er konnte seine Beine nicht mehr bewegen. Er erkannte nur einen riesigen Schatten, der sich über ihn beugte. Dann verlor er das Bewusstsein.
Als er wieder zu sich kam, spürte er felsigen Boden unter sich. Er öffnete die Augen, doch um ihn herum herrschte tiefste Schwärze. Offenbar lag er in einer Felsenkammer, denn als er mühsam eine Hand ausstreckte, stieß er an feuchtes Gestein. Seine Lippen fühlten sich ausgetrocknet an, seine Kehle brannte, sein Kopf pochte. Er stöhnte und versuchte, sich ein Stückchen aufzurichten, glitt aber wieder in seine liegende Stellung zurück. Ihm drohten erneut die Sinne zu schwinden.
Anruf einer alten Dame
Anna Bentorp fluchte leise. Der Regen prasselte von allen Seiten auf die Straße, sodass der Scheibenwischer seine liebe Mühe hatte, mit den Wassermassen fertigzuwerden. Mit verkrampftem Rücken, zusammengekniffenen Augen und wie am Lenkrad festgeschraubten Händen saß Anna in ihrem kleinen roten Auto und schlidderte mit wachsender Nervosität über die Landstraße zwischen Hameln und dem kleinen Hammelshausen im Ith. An sich ein Katzensprung, nur knappe vierzig Kilometer lagen zwischen den beiden Orten. Doch an diesem Septembertag schien sich die Natur gegen sie verschworen zu haben.
Anna war am Morgen vergnügt und energiegeladen in Hannover aufgebrochen und hatte sich auf die Fahrt in den Ith, einen Teil des Weser-Leine-Gebirges, gefreut. Vor Jahren hatte sie einmal einen Ausflug in diese hügelige Landschaft gemacht, in Eschershausen in einem Gasthof gut zu Mittag gegessen und abends auf der Rückfahrt in Hameln noch eine Freundin besucht. Alles kein Problem. Damals. Heute aber hätte Anna den Wagen am liebsten auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt und das Ende der Regenfluten abgewartet. Doch sie musste weiter, da sie spätestens zur Teezeit in Schloss Hammelsberg erwartet wurde.
»Und das hat die Wettervorhersage als leichten Nieselregen bezeichnet«, murmelte sie ärgerlich. Außer ihr gab es kaum ein anderes Auto weit und breit. Kein Wunder. An diesem grauen Nachmittag wirkte die Welt wie ausgestorben. Die Straße machte plötzlich einen leichten Bogen, und Anna geriet ins Schleudern. Sie hatte nicht aufgepasst und den Polo übersehen, der am Straßenrand in der Kurve stand.
»Verdammter Idiot!«, schimpfte sie, als sie ihren Wagen wieder unter Kontrolle hatte und an dem hellblauen Auto vorbeigezogen war. Sie drehte sich kurz um und hoffte, einen Blick auf dessen Fahrer zu erhaschen, der seinen Wagen leichtsinnig in der Kurve geparkt hatte, aber sie konnte niemanden entdecken und fuhr weiter, froh, dass sie mit dem Schrecken davongekommen war.
Wenige Minuten später tauchte im fahlen Dunst des nachmittäglichen Dämmerlichtes das Schild auf, das sie sehnsüchtig erwartete: »Hammelshausen, drei Kilometer«. Schloss Hammelsberg lag knappe zwei Kilometer hinter dem Ort, also nur noch fünf Kilometer bis zum Ziel. Anna entspannte sich. Sie drehte das Autoradio lauter und lauschte den wunderbaren Klängen von Beethovens Violinkonzert, und tatsächlich ließ auch der Regen allmählich nach. Ihre Laune verbesserte sich schlagartig.
Hammelshausen, das sie wenig später erreichte, entpuppte sich als ein Sprengel mit Fachwerkhäusern und einigen Gebäuden aus Backstein. Sie fuhr über die Hauptstraße, vorbei an mehreren Geschäften, einem Café, durch dessen große Frontscheibe sie einige Leute an weiß gedeckten Tischen sah, an einer kleinen Post und an der Kirche, einem äußerlich eher schmucklosen Bau mit einem Hahn auf der Kirchturmspitze. Allerdings wies das Kirchenportal schöne Verzierungen auf, und die hohen, schmalen Fenster der kleinen Kirche blitzten in den zaghaften Sonnenstrahlen, die sich hinter den Wolken hervortasteten.
Ein Schild mit der Aufschrift »Zum Höhlenmann« wies auf ein Lokal hin, das wohl etwas abseits von der Hauptstraße lag, ein weiteres Schild zeigte an, dass das Heimatmuseum Hammelshausen in zweihundert Metern Entfernung läge. Dann war sie auch schon durch den Ort durch, und ein Hinweis kurz hinter der Ortsausfahrt machte sie darauf aufmerksam, dass Schloss Hammelsberg zu den Sehenswürdigkeiten dieser Gegend zählte.
Sie selbst war noch nie hier gewesen, aber ihre Kölner Patentante, der sie diese Reise ins feuchte Hügelgebiet des Ith verdankte, hatte ihr vor einiger Zeit davon vorgeschwärmt: »Ein herrlicher Bau, ganz Weserrenaissance, entstanden um1620, mit einem bezaubernden Garten und einer riesigen Bibliothek. Carola von Rödelshausen ist zudem eine großartige Gastgeberin. Die Konzerte in ihrem Schloss waren legendär, doch seit dem Tod ihres Mannes Ernst lädt sie leider nur noch selten Musiker ein, dafür aber oft andere Kulturschaffende.«
Amelie hatte mit ihren begeisterten Schilderungen gar nicht mehr aufhören wollen, bis Anna, die ihre Patentante sehr liebte, aber gleichzeitig auch ein wenig anstrengend fand, sie freundlich unterbrochen hatte: »Amelie, ich kann dir in wenigen Tagen berichten, ob es dort immer noch so schön ist, wie du sagst. Vielleicht solltest du selbst mal wieder hinfahren.«
Amelie hatte eine Sekunde geschwiegen. Dann sagte sie mit leiser Stimme: »Ach Anna, mein Liebling, du weißt doch, dass ich mein Haus nur noch für Kurzausflüge verlassen kann.«
Anna schämte sich. Sie vergaß immer wieder, dass ihre früher so lebensfrohe und umtriebige Tante seit einem Schlaganfall vor vier Jahren an den Rollstuhl gefesselt war. Sie hatte eine Entschuldigung gemurmelt und versprochen, Amelie bald in Köln zu besuchen.
Amelie Feldmann bewohnte noch immer ihr kleines Haus im Kölner Süden, in dem sie Möbel aus der Biedermeierzeit, Erstausgaben zahlreicher Klassiker und einige wertvolle alte Gemälde wie ihren Augapfel hütete. Anna hatte schon lange vor, sich diese Bilder einmal näher anzuschauen. Aber ihre Besuche bei ihrer Patentante reichten nie dazu aus, die Gemälde ausführlich zu begutachten. Seit ihrer Kindheit mochte Anna ein Bild ganz besonders, das bei ihrer Tante im Wohnzimmer über dem Kamin hing, der längst nicht mehr benutzt wurde. Es war das Porträt einer jungen, zarten Frau, gemalt 1758 von einem unbekannten Künstler. Es zeigte Amelies Urururgroßmutter Katharina, die mit einem Kölner Schmied verheiratet gewesen war. Ihr einziger Sohn Alexander hatte die Schmiede damals nicht übernommen, sondern war Arzt geworden. Leider gab es weder von ihm noch von seinem Vater Wilhelm Porträts.
Das Haus hatte Amelies Großvater Immanuel Feldmann um 1900 erstanden, und es brauchte dringend ein paar Renovierungen. Zum Beispiel war die Treppe in den ersten Stock mit einem schäbigen roten Läufer voller Löcher belegt, bei dem sich die Haltestangen ständig lösten. Anna nannte diese Treppe immer die »Todesstiege«. Aber Annas Ermahnungen, diesen Schaden zu beheben, fruchteten nichts. Bei ihrem längst anstehenden Besuch wollte sie das Thema jedoch noch einmal aufgreifen. Jetzt war Anna gespannt auf Tante Amelies älteste Freundin.
Die Herrin von Schloss Hammelsberg Carola von Rödelshausen war mit ihrem Vetter dritten Grades, Baron Ernst von Rödelshausen, verheiratet gewesen und hatte deshalb ihren Geburtsnamen behalten. Carola hatte das Schloss mit in die Ehe gebracht. Sie war das einzige überlebende Kind ihrer Eltern. Ihre beiden Brüder Heinrich und Friedrich waren einige Jahre älter als sie gewesen und in den letzten Wochen des Krieges gefallen. Heinrich war damals zweiundzwanzig Jahre alt, Friedrich neunzehn. Viel mehr wusste Anna nicht über ihre Gastgeberin.
Sie dachte an den Abend vor drei Wochen zurück. Zu später Stunde, als sie gerade mit einem Buch auf dem Sofa den Tag ausklingen ließ, hatte ihr Festnetztelefon geklingelt. Anna war aus ihrer Lektüre aufgeschreckt. Wer rief sie noch so spät ausgerechnet auf ihrem Festnetz an? Eigentlich nutzte kaum mehr jemand diese Nummer. Als sie den Hörer abhob, hatte sie zunächst ein Rauschen gehört, durch das dann eine weibliche Stimme drang, nicht mehr jung, sondern rauchig und angenehm dunkel.
»Anna Bentorp?«, schallte es an ihr Ohr.
»Ja, das bin ich«, antwortete Anna etwas verwirrt.
»Entschuldigen Sie diese späte Störung. Aber ich habe erst heute Abend Ihre Patentante Amelie in Köln erreichen können, die mir Ihre Nummer gegeben hat.« Das leise Lachen der Anruferin klang seltsam dumpf. »Ich heiße Carola von Rödelshausen und bin eine uralte Freundin Ihrer Tante aus Schultagen und kenne auch Ihre Mutter flüchtig.« Einen Moment schwieg die Frau. Dann seufzte sie und sagte: »Ja, und da ich mich ohnehin bei Ihnen melden wollte, hatte ich keine Lust, lange zu warten, obgleich es schon so spät ist. Ich weiß, dass Sie eine viel beschäftigte Frau sind, und vielleicht hätte ich Sie morgen nicht erreicht.«
Anna nickte unwillkürlich. Vor wenigen Tagen hatte sie die Texte für den Katalog einer Ausstellung mit Schätzen aus den Mooren Niedersachsens für das hannoversche Landesmuseum fertiggestellt und wartete nun auf die Korrekturfahnen. Moore waren ein Teil ihres Lebens geworden.
Im vergangenen Jahr hatte sie einen Katalog für eine Ausstellung mit Kartenwerken aus der Zeit König Georgs III. für die Leibniz-Bibliothek in Hannover erstellt und war dabei in einem Moor in ein Abenteuer geraten, das für sie fast tödlich geendet hatte. Obwohl das Erlebnis schon ein Jahr zurücklag, hatte es noch immer Nachwirkungen. Anna träumte häufig von dem Moor und wachte schweißgebadet auf.
Neben ihren Arbeiten an Katalogen begutachtete sie für Museen und auch für Privatsammler Bilder und wurde zu Vorträgen eingeladen. Ja, man konnte schon mit Fug und Recht sagen, dass sie viel beschäftigt war und dringend Erholungsphasen brauchte– so wie heute Abend.
Darum klang sie etwas ungeduldig, als sie fragte: »Weshalb möchten Sie mich denn so dringend sprechen?« Es war inzwischen fast Mitternacht, und Anna sehnte sich nach ihrem Bett.
Carola von Rödelshausen räusperte sich. »Ich möchte Sie nach Schloss Hammelsberg einladen, und zwar für Freitag, den 7.September, falls Sie Zeit haben.«
»Um was geht es denn?«, fragte Anna. »Und warum laden Sie mich ein? Sie kennen mich doch gar nicht.«
Wieder dieses leise Lachen. »Nun, zum einen lade ich gerne Menschen auf mein Schloss ein, die mit Kultur zu tun haben. Ihre Patentante hat Sie mehrmals erwähnt, Sie wären eine Bereicherung für dieses Wochenende. Es kommt auch noch mein Sohn, der Anwalt in Frankfurt ist und sich um Copyright-Fragen in der Kunst kümmert. Dann wird ein Archäologe dabei sein, der in den Höhlen der Umgebung zusammen mit einem Geologen und einem Prähistoriker forscht, dazu noch ein renommierter Höhlenforscher und als besondere Attraktion ein aufstrebender junger Student der Anglistik, der gerade in Göttingen promoviert. Er wird am Samstag einen Vortrag zu einem spannenden Thema halten. Offenbar hat er bei seinen Recherchen für seine Doktorarbeit über Sir Walter Scott etwas herausgefunden, das mit unserer abgelegenen Gegend zu tun hat. Er hat eine große Überraschung und Sensation angekündigt. Am Freitag empfange ich die ersten Gäste, am Samstagabend werden wir dann eine kleine, aber feine Gruppe sein, um den Vortrag zu hören.«
Carola von Rödelshausen holte tief Luft, bevor sie weitersprach. »Ich möchte Sie gerne dazu einladen, aber ich habe auch einen Hintergedanken. Sie sind ja inzwischen eine recht bekannte Frau, seit Sie diese Schätze bei Bresterholz entdeckt und die Abenteuer rund um den legendären Moormann erlebt haben, und Sie kennen sich mit Bildern aus. Seit Jahrzehnten möchte ich den Dachboden im Schloss entrümpeln. Ich vermute dort oben einige recht wertvolle Bilder, die mein Großvater Wilhelm unter anderem aus Flandern und England mitgebracht hat. Einen Teil der Bilder aus den Wohnräumen des Schlosses hat dann mein Vater zu Beginn des letzten Krieges dort oben versteckt. Natürlich hängt im Schloss immer noch einiges, auf das Sie einen kritischen Blick werfen könnten. Wir haben aber keinen genauen Überblick, da sich nie jemand wirklich damit beschäftigt hat. Ganz sicher bin ich mir nicht, was da oben wirklich noch liegt. Es gibt viele Gerüchte, aber was daran wahr ist, könnten Sie vielleicht entschlüsseln helfen. Ich möchte Sie deshalb fragen, ob Sie nicht Lust dazu hätten. Natürlich liegt auf dem Dachboden viel Plunder herum, vom Staub der Jahrzehnte bedeckt. Man munkelt auch, dass sich irgendwo im Schloss ein Gemälde des jungen Lucas Cranach befindet, das einer meiner Vorfahren erstanden hat. Wäre das nicht eine Sensation, wenn wir das Bild finden würden, das schon seit mehr als einhundert Jahren vermisst wird?« Wieder lachte sie.
Anna hatte während Carola von Rödelshausens Worten rasch einen Blick in ihren Terminkalender geworfen. Den restlichen August hatte sie mit einem Besuch bei ihrer Schwester in Frankfurt und einem Bummel durch die Toskana mit ein paar Tagen am Meer in der Maremma verplant. Am 17.September musste sie wieder zurück in Hannover sein, wo sie einen Vortrag über die im Brester Moor und anderen Mooren Norddeutschlands entdeckten Schätze halten sollte. Und am 24.September stand eine Reise nach Irland an, wo sie gemeinsam mit irischen Kollegen die Echtheit eines zufällig im Trinity College entdeckten Gemäldes von Caspar David Friedrich überprüfen sollte. Vor allem aber wollte sie Deirdre O’Brian treffen, die Nachfahrin jenes Mannes, der im 18.Jahrhundert das Brester Moor kartografiert und dabei die Schätze des Moormannes gefunden hatte. Deirdre schrieb gerade an einer Biografie ihres Vorfahren und hatte Anna eingeladen, sie dabei zu unterstützen. So weit ihre Planungen. Aber um den 7.September herum war alles noch frei.
Mit einem leichten Zögern sagte sie: »Ja, ich komme gerne und sehe mir auch Ihre Bilder vom Dachboden an. Und natürlich schaue ich mich auch ansonsten im Schloss um. Manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, was heißt, dass gelegentlich Bilder gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie schon ewig irgendwo hängen. Aber wie lange ich bleiben kann, weiß ich noch nicht.«
»Ach, eine gute Woche wird es schon dauern, bis Sie sich das alles angesehen haben«, antwortete Carola von Rödelshausen fröhlich. »Und der Vortrag am 8.September wird Sie sicherlich interessieren. Allerlei Geheimnisse um das Werk des großen Walter Scott und dazu noch die vielen Legenden über die Höhlen in unserer Gegend– das müsste Sie doch reizen. Ich schicke Ihnen die Details zu und freue mich auf Ihren Besuch.«
Anna war verdutzt, welches Tempo Carola von Rödelshausen vorlegte. Das wäre einer wesentlich jüngeren Frau würdig gewesen. Falls sie tatsächlich eine Freundin von Tante Amelie aus deren Schultagen war, dann musste sie ebenfalls Mitte achtzig sein. Anna fühlte sich zwar immer noch etwas überrumpelt, gab aber ihre Adresse durch, auch ihre E-Mail-Adresse, worauf die alte Dame nur bemerkte: »E-Mails schreibe ich nicht, Briefe sind wesentlich zuverlässiger.« Wenig später legte sie nach einigen freundlichen Grüßen und Wünschen für eine ruhige Nacht auf.
Anna holte tief Luft, erhob sich etwas steif von ihrem Sofa und ging ins Badezimmer, um sich bettfertig zu machen. Aber einschlafen konnte sie nicht. Deshalb stand sie wieder auf und schaltete ihren Laptop ein. Stichwort: Schloss Hammelsberg.
Das Schloss war 1620 nach dem Vorbild von Schloss Bevern bei Holzminden von Baron Wilhelm Ludwig von Rödelshausen erbaut worden. 1752 brannte es fast völlig nieder, wurde dann aber von dem damaligen Schlossherren Rudolf von Rödelshausen wiederaufgebaut, wenn auch nicht im alten Umfang. Glücklicherweise hatte der damalige Schlossherr einen Großteil der Kunstwerke aus dem Schloss aufgrund von geplanten Umbauten in eine Scheune gerettet, die nicht niederbrannte. Bei den Umbauten, so munkelte man, habe ein betrunkener Arbeiter das Schloss in Brand gesetzt. Andere Vermutungen lauteten jedoch, dies sei Brandstiftung gewesen. Der Racheakt eines unzufriedenen Pächters. Wie auch immer. Schloss Hammelsberg galt als das kleinste aller Schlösser in der Tradition der Weserrenaissance, die prächtige Anwesen wie Schloss Corvey, Schloss Bückeburg und die Hämelschenburg hervorgebracht hatte. Im 19.Jahrhundert war es mehrfach renoviert, im 20.Jahrhundert modernisiert worden, und 1988 hatte Carola von Rödelshausen nach dem Tod ihres Mannes das alte Gebäude noch einmal vollständig sanieren lassen.
Einmal im Monat, an jedem dritten Sonntag, öffnete die Baronin das Schloss für Besucher, die dann staunend durch die Säle und Gemächer zogen und vor allem den Park bewunderten, in dem mehrere Springbrunnen mit wasserspeienden Delphinen, Nymphen und anderen mythologischen Wasserwesen standen und wo in den kleinen Pavillons Tee serviert wurde.
Ein wenig überraschte sie ein kleiner Absatz in diesem Bericht: »Im Jahr 2000 veranstaltete Baron Philip von Rödelshausen eine Landpartie nach dem Vorbild ähnlicher Events in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit Verkaufsständen aller Art und erweiterter Gastronomie. Es blieb jedoch bei dem einmaligen Ereignis. Aber der Schlosspark steht weiterhin zwischen April und Oktober Besuchern offen.« Diese Landpartie schien wohl ein Fehlschlag gewesen zu sein.
Das nahe gelegene Dorf Hammelshausen hatte knapp achthundert Einwohner, eingerechnet den Weiler Motzhausen und einige verstreute Bauernhöfe, konnte aber immerhin mit einer kleinen Kirche aus dem frühen 17.Jahrhundert aufwarten, mit einer Handvoll klassischer Fachwerkhäuser, darunter das Gasthaus »Zum Höhlenmann«, und mit einem Heimatmuseum, in dem sich die Knochen eines in dieser Gegend entdeckten Dinosauriers befanden.
Das Museum zeigte laut Internet auch interessante Steine aus den umliegenden Fels- und Höhlenformationen, ein paar alte Bauernmöbel, Geschirr und Alltagsgegenstände und einen schottischen Dudelsack aus dem 18.Jahrhundert. Keiner wusste mehr genau, wie er in das Museum geraten war, aber laut einer Überlieferung hatte um 1750 ein schottischer Edelmann im Schloss gelebt. Der Dudelsack sollte aus seiner Hinterlassenschaft stammen. Viel mehr konnte Anna in dieser Nacht dem Internet über Hammelsberg und Hammelshausen nicht entlocken.
In den kommenden Tagen dachte sie nur selten an die Einladung. Vor ihrem Besuch in Frankfurt und ihrem Italientrip wollte sie nach Köln zu ihrer Mutter fahren, die mit ihren fast achtzig Jahren noch erstaunlich fit war und sich in den Kopf gesetzt hatte, an einer Safari teilzunehmen. Anna sollte ihr beim Packen helfen.
»Ist doch nur eine Studienreise«, beruhigte ihre Mutter sie. Dennoch fürchtete Anna, dass ihre energische Mutter im fernen Namibia einen Hitzekoller erleiden könnte. Sie sagte aber nichts, denn ihre Mutter konnte so stur wie ein Maulesel sein. Eigentlich hatte sie auch bei Tante Amelie vorbeischauen wollen, die sie ebenfalls schon mehrfach gebeten hatte, einige ihrer Bilder zu begutachten.
»Für die Versicherung, die endlich auf den neuesten Stand gebracht werden muss, und für mein Testament«, pflegte sie zu sagen. Aber es reichte Anna, sich fast drei Tage um ihre liebenswerte, eigensinnige Mutter zu kümmern. Da blieb keine Zeit für ihre Tante.
Etwas erschöpft kehrte sie nach Hannover zurück, wo sie jäh wieder an ihr nächtliches Telefonat mit Carola von Rödelshausen erinnert wurde. In ihrem Briefkasten steckte ein dicker Brief. Sie riss das Kuvert auf. Als Erstes entnahm sie ihm eine Broschüre mit dem Titel »Die Höhlenwelt von Hammelshausen«, als Nächstes eine hübsche Postkarte mit einem Foto des Schlosses vor knallblauem Himmel und schließlich einen Umschlag. In ihm befanden sich ein Brief und eine Einladung auf Büttenpapier.
Carola von Rödelshausen gibt sich die Ehre, Anna Bentorp zu einem Vortragsabend mit Stefan Arendt am 8.September 2018 nach Schloss Hammelsberg zu bitten. Thema des Vortrags:
Wahrheit und Mythos von »Waverley«– Neue Quellen der Werke von Sir Walter Scott
Drinks ab neunzehn Uhr, Beginn der Veranstaltung: zwanzig Uhr. Danach Abendessen in kleinerem Kreis.
Der Brief enthielt eine ausführliche Wegbeschreibung von Hannover über Hameln zu Schloss Hammelsberg und noch einmal die Bitte, Anna möge doch ihren fachkundigen Rat bei der Entrümpelung des Dachbodens zur Verfügung stellen, »auf dem sicherlich manch ein schönes Bild hinter zerbrochenen Möbeln und alten Kisten zu finden sein wird«.
Anna musste grinsen. Manch ein schönes Bild hinter Gerümpel, dachte sie und spürte plötzlich Lust auf diesen Auftrag. Vielleicht hing ja auch noch »manch ein schönes Bild« in den weniger benutzten Räumen des Schlosses.
Rasch suchte sie aus ihrem Vorrat an Postkarten aus aller Welt und vielen Museen ein Bild mit ihrem Lieblingswerk, dem heiligen Georg des italienischen Malers Paolo Uccello, heraus und schrieb kurz und bündig: »Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Vortrag und auf die Entdeckung vieler Meisterwerke auf dem Dachboden von Schloss Hammelsberg.«
Der Gedanke an die Höhlen im Ith faszinierte und ängstigte sie zugleich. Als Kind war sie einmal beim Besuch der Drachenhöhle auf Mallorca ihren Eltern fast verloren gegangen.
Nach zwei erholsamen Wochen in Italien war Anna am 4.September nach Hannover zurückgekehrt. Heute, am 7.September, war sie aufgebrochen, um in aller Ruhe nach Hammelshausen und Hammelberg zu fahren. Sie hatte für die Strecke knapp zwei Stunden Fahrtzeit gerechnet, doch kurz hinter Hameln schien die Welt in einer Flut von Regen zu verschwinden. Und so war es früher Nachmittag geworden, als sie jetzt auf die von Pappeln gesäumte kleine Straße einbog, die zum Schloss führte.
Das Schloss tauchte wie eine Fata Morgana aus dem Regendunst auf. Die hellgrauen Mauern und der mächtige runde Turm schimmerten matt im durch dicke Wolken gedämpften Tageslicht. Einige Fenster waren schon erleuchtet und verliehen dem Schloss etwas Heimeliges.
Als Anna den Wagen auf dem mit Kies bedeckten Rondell vor dem Eingangsportal zwischen einem Oldsmobile und einem nagelneuen Mercedes abgestellt hatte, sprang ihr mit lautem Gebell ein Labrador entgegen, gefolgt von einem Irischen Wolfshund, der langsam und majestätisch auf sie zukam. Er betrachtete Anna aus seinen hellblauen Augen und schien zufrieden mit dem Ergebnis seiner Musterung. Anna strich dem riesigen Hund sanft über den Kopf, was den Labrador dazu bewegte, sein Bellen einzustellen und sich ebenfalls an sie zu schmiegen. Einen Moment stand sie regungslos zwischen den beiden Hunden, bis die Tür aufging und eine alte Dame heraustrat.
»Willkommen«, rief sie. Anna erkannte ihre Stimme vom Telefon. »Wie ich sehe, haben Sie sich schon mit Alisha und Cú bekannt gemacht.« Carola von Rödelshausen kam lächelnd auf sie zu.
Sie war etwas kleiner als Anna, hatte ein schmales, von vielen feinen Falten durchzogenes Gesicht, eine gebogene Nase und tiefblaue Augen. Ihre weißen Haare trug sie modisch kurz geschnitten. Ihr Händedruck war erstaunlich fest, ihr forschender Blick erinnerte Anna unwillkürlich an den Ausdruck in den hellen Augen des Irischen Wolfshundes.
Ehe sie antworten konnte, nahm Carola von Rödelshausen sie beim Arm und sagte: »Um Ihr Gepäck wird sich Max kümmern. Kommen Sie erst einmal ins Wohnzimmer und trinken Sie einen Tee oder Kaffee. Die Fahrt war bei dem Wetter sicherlich nicht sehr angenehm.«
Anna sagte nur kurz: »Danke, sehr gerne«, und schon hatte die Baronin sie ins Schloss geführt.
In der Eingangshalle lag ein prächtiger Berberteppich auf den schwarz-weißen Fliesen, an den Wänden hingen ein paar Geweihe, aber vor allem einige imposante Landschaftsgemälde, die Anna ins 18.Jahrhundert datierte, und auf der mächtigen Kommode stand eine Meißener Vase mit Gladiolen. Gerne hätte sie einen intensiveren Blick auf die Bilder geworfen, doch sie wurde so freundlich wie energisch durch eine weitere Tür in einen von alten Möbeln und Wandteppichen überbordenden Raum geschoben und zu einer Sitzgruppe mit Chintz bezogener Sessel und einem Biedermeiersofa geführt. Dort saßen bereits einige Menschen, die sich höflich erhoben, als Anna auf sie zutrat.
Der etwas korpulente ältere Mann mit dem sorgfältig gestutzten Bart war gewiss Philip von Rödelshausen, die große Frau neben ihm mit den auffallend blonden Haaren und einem unzufriedenen Zug um die künstlich aufgepolsterten Lippen wohl seine Frau Barbara, die drei anderen Gäste konnte Anna nicht einordnen. Doch dann fiel ihr Blick auf eine Gestalt, die lässig am Kamin lehnte und sich nun mit einem strahlenden Lächeln auf sie zubewegte.
»Anna, wie schön, dich endlich einmal wiederzusehen!«
Anna durchfuhr es siedend heiß. Vor ihr stand Richard Bernhard, Kunsthändler und Antiquar aus Hannover, der Mann, der im vergangenen Jahr tief in die Affären um das Geheimnis des Brester Moors verwickelt gewesen war, im Frühsommer einen Prozess wegen Steuerhinterziehung und anderer kleinerer Delikte überstanden hatte und mit einer Bewährungsstrafe und der Zahlung einer saftigen Geldsumme davongekommen war. Anna hatte ihn seit der Eröffnung der Ausstellung über die Karten aus der Zeit Georgs III. in der hannoverschen Leibniz-Bibliothek im Frühling nicht mehr gesehen und auch nicht versucht, ihn zu kontaktieren.
Der keltische Hund
Nach dem ersten Treffen im Wohnzimmer, oder besser Salon, hatten sich die Gäste rasch zerstreut, und auch Richard war blitzschnell verschwunden. Die Baronin entschuldigte sich. Um achtzehn Uhr würde man sich zu Drinks im Salon mit anschließendem Essen wieder treffen. Dafür hatte Max Anna unter seine Fittiche genommen, der »Mann für alle Jahreszeiten«, wie ihn die Baronin nannte: Chauffeur, Butler, Gärtner, und das seit zehn Jahren.
Max Greve, ein Mann von Mitte fünfzig mit dicken schwarzen Augenbrauen, einem kantigen Gesicht und grauen, kurz geschorenen Haaren, hatte Anna auf ihre Bitte hin hinauf zum Dachboden geführt. Sie wollte sich schon einmal mit ihrem »neuen Arbeitsfeld« vertraut machen. Die Baronin hatte ihr bereits erklärt, dass die Männer, die sie für das Entrümpeln engagiert hatte und die schon am Samstag die ersten ausrangierten Möbelstücke vom Boden räumen sollten, die Bilder in einen kleinen Raum neben der Küche tragen würden, wo Anna sie dann in Ruhe studieren könne. In dem kleinen Zimmer stand ein großer Tisch, auf dem Lupen und Mikroskope bereitlagen und allerlei Putzzeug, vor allem Staublappen und Terpentin. Anna seufzte. Also dann an die Arbeit.
Der Dachboden schien sich endlos weit zu erstrecken. Anna hatte noch nie einen so großen Speicher gesehen. Durch den Raum flirrten Staubflocken, und die Glühbirnen an der Decke spendeten bei Weitem nicht ausreichend Licht, um die Ecken zu erleuchten. Im vorderen Teil häuften sich bereits zum Teil zerbrochene oder zumindest stark beschädigte alte Möbel, die abtransportiert werden sollten, darunter Gartenmöbel, Bettgestelle und Beistelltische. Im hinteren Teil des Dachbodens befanden sich laut Max zwei große Kammern, in denen etliche Gemälde lagerten und noch einige Möbel, die man wahrscheinlich restaurieren könne. Anna hatte fürs Erste genug gesehen und wollte nicht durch den staubigen Dachboden bis zu den Kammern gehen. Das hatte Zeit bis morgen. Sie warf noch einen Blick auf die ramponierten Möbel und entdeckte darunter ein Kasperletheater und ein Schaukelpferd ohne Schweif und mit gebrochenen Kufen. Irgendwie berührte sie dieser Anblick und stimmte sie wehmütig.
Als sie wenig später in ihrem hübschen Zimmer mit Himmelbett und einem altrosa gekachelten Bad saß und durch das Fenster hinaus auf den Park schaute, verflog dieses Gefühl weitgehend, aber ein letzter Hauch von Nostalgie ließ sich nicht völlig vertreiben. Was war nur los mit ihr? Wurde sie allmählich zu einem Spökenkieker wie der alte Steffen Steffens, den sie in Bresterholz erlebt hatte? Anna empfand wenig Lust, sich ständig an ihre Moorabenteuer zu erinnern. Das lag alles schon ein gutes Jahr zurück.
Im Mai, als der Raps und der Rhododendron blühten, war sie noch einmal für einen halben Tag nach Bresterholz gefahren und hatte ihre frühere Vermieterin Anke Kück besucht, die inzwischen das Moorhaus, in dem Anna gewohnt hatte, völlig umgestaltet hatte und es erfolgreich als Wochenendhaus vermietete. Der Garten war gepflegt, der Keller wirkte dank der weiß gestrichenen Wände und der neuen Lampen nicht mehr unheimlich. Ein Durchbruch verband das Wohnzimmer nun mit dem alten provisorischen Arbeitszimmer, in dem Anna im vergangenen Jahr an dem Katalog für die Ausstellung über Karten aus der Zeit König GeorgsIII. von Großbritannien und Hannover gearbeitet hatte, wodurch der untere Stock hell und großzügig wirkte.
Ankes Angebot, das Häuschen selbst für längere Zeit wieder zu mieten, lehnte Anna dankend mit der Begründung ab, dass neue Aufgaben an anderen Orten auf sie warteten. Doch sie schloss, auch um Anke Kück nicht zu kränken, nicht ganz aus, irgendwann einmal wieder ein paar Tage in dem Häuschen zu verbringen, 2019 vielleicht…
Das Willkommensessen am Abend mit der Baronin, ihrem Sohn Philip, dessen Frau Barbara, die den Mund meist nur öffnete, um sich über irgendetwas zu beschweren, zwei uralten Freunden der Baronin– Sebastian von Roth und Magnus Brecht–, einem mit Philip befreundeten Kunstexperten aus Frankfurt, Caspar Hermanns, der sich im Laufe des Abends nach etlichen Gläsern Rotwein mit Richard Bernhard zunächst stritt, dann verbrüderte, und dem Enkel Constantin von Lengsfeld, einem stillen jungen Mann mit guten Manieren, war sehr harmonisch und gemütlich verlaufen. Die Baronin erzählte ihr, dass am nächsten Tag noch einige Gäste und vor allem der Vortragende im Laufe des frühen Nachmittags erwartet würden. Was Anna eigentlich viel lieber gewusst hätte, war, woher die Baronin Richard kannte. Doch sie war nicht dazu gekommen, ihr diese Frage zu stellen, und Richard war so intensiv mit dem Frankfurter Kunsthändler ins Gespräch vertieft, dass sie ihn auch nicht danach hatte fragen können. Zudem hatte Philips Frau offensichtlich ein Auge auf Richard geworfen und versuchte mit ihm zu flirten, was ihren Mann nicht weiter zu stören schien. Zumindest lächelte Philip und kümmerte sich mehr um seine Mutter und die beiden alten Herren als um seine übertrieben stark geschminkte Frau.
Anna war gegen Richards Charme und sein gutes Aussehen auch keineswegs immun, traute ihm aber nicht mehr. Sie unterhielt sich mit Constantin, der ihr wesentlich sympathischer war als Caspar Hermanns, der allzu oft versuchte, ihr seine klobige Hand auf die Schulter zu legen. Glücklicherweise verzogen er und Richard sich dann in eine Ecke des Wohnzimmers, wo nach dem Essen Espresso gereicht wurde. Anna lauschte Constantins begeisterten Berichten von seinem Studium der englischen Literatur und seinen Reisen nach London. Vor allem aber schwärmte er von seinem Kommilitonen Stefan Arendt, der einige Zeit in Edinburgh studiert hatte.
Irgendwann wurde Constantins Wortschwall mühsam. Ohnehin senkte sich eine Schwere über den Raum. Zu viel Wein, zu viel Cognac, dazu die Hitze, die der Kamin an diesem Septemberabend ausstrahlte. Allmählich übermannte sie die Müdigkeit. Max, der immer aufmerksame Diener, der neben der Tür zum Flur stand, kam auf sie zu und bot ihr an, sie zu ihrem Zimmer im zweiten Stock zu begleiten. Cú verabschiedete sich von ihr mit einem Schwanzwedeln. Die Standuhr im Flur schlug Mitternacht, als Max sie zu ihrem Zimmer führte. Sein Ausdruck wirkte genauso emotionslos wie am Nachmittag, als er mit ihr hinauf zum Dachboden gegangen war. Doch als er die Tür zu Annas Zimmer öffnete, lächelte er plötzlich, was sein Gesicht völlig veränderte und ein Leuchten in seine dunklen Augen zauberte.
»Verzeihen Sie bitte meine direkte Art, aber ich habe gesehen, dass Cú Sie offenbar ins Herz geschlossen hat. Das kommt selten vor. Cú ist ein Hund mit besonderen Eigenschaften, der sich Menschen selten so schnell nähert.«
»Woher kommt sein Name?«, fragte Anna, die den Hund auch mochte.
»›Cú‹ heißt auf Gälisch ›Hund‹. Der große irische Sagenheld Cúchullain soll immer einen solchen Hund bei sich gehabt haben. Sein eigener Name lautet übersetzt: ›Hund des Culann‹. Diese Hunderasse ist uralt.«
Anna war überrascht. »Interessieren Sie sich für keltische Mythologie?«
Die Frau vom Dachboden
Anna erwachte jäh. Ein heftiges Poltern hatte sie aus ihren Träumen gerissen. Mühsam blinzelte sie. Ihr Kopf brummte ein wenig, aber ihr seltsames Gefühl vom gestrigen Tag war verschwunden. Sicherlich hatte es bloß an ihrer Müdigkeit gelegen. Aber heute war ein neuer Tag, an dem sie einen ersten Blick auf die Bilder auf dem Dachboden werfen würde und am Nachmittag dann sicher noch Gelegenheit hatte, mit Richard nach nunmehr fast vier Monaten ausführlicher zu reden. Es war Zeit für eine offene Aussprache.
Anna spähte zum Fenster hinaus in den Park, dessen Bäume und Sträucher in vielen Schattierungen zwischen Zartgrün und Dunkelgrün glänzten. Dann zog sie sich rasch an und ging die breiten Treppen hinunter zu einem Raum neben dem Esszimmer, in dem, wie Max ihr gesagt hatte, das Frühstück serviert wurde. Das zarte Sonnenlicht flutete durch die beiden Fenster mit Aussicht auf den Vorplatz des Schlosses. Dort stand ein Lastwagen, in den zwei kräftige Männer mit Getöse die zerbrochenen Möbel vom Dachboden warfen. Kein Wunder, dass dieses Poltern selbst in ihr Zimmer auf der rückwärtigen Seite des Schlosses gedrungen war.
Während sie genüsslich ihre erste Tasse Kaffee trank, der in einer dickbauchigen Thermoskanne auf dem Tisch stand, schlug die Uhr in der Schlosshalle zehnmal. Sie hatte sehr lange geschlafen und fast ein schlechtes Gewissen.
Die Schlossköchin Astrid kam mit einem breiten Lächeln zur Tür herein und fragte sie nach ihren Frühstückswünschen. Obwohl das Essen am Vorabend recht opulent gewesen war, verspürte Anna Hunger und bat um Rührei und Toast.
Wenig später tauchte Carola von Rödelshausen auf. Sie trug einen schwarzen Rollkragenpullover mit einem roten Schal und eine schwarze Cordhose. Sie schmunzelte, als sie sah, mit welcher Inbrunst Anna den Kaffee trank.
»Nun, gut geschlafen? Wenn Sie fertig sind, würde ich gerne mit Ihnen auf den Dachboden steigen und Ihnen die beiden Schatzkammern zeigen. Mein Vater hatte in den letzten Kriegstagen angeordnet, eine Reihe von Bildern dort oben abzustellen. Zumindest diejenigen, die er für besonders kostbar hielt. Er meinte wohl, da oben seien sie sicherer als unten im Schloss. Wenn Sie mich fragen, keine geniale Idee. Das Schloss hätte ja auch von einer Bombe getroffen werden können. Hameln hat noch im April 1945 schwere Treffer abgekommen, und wir liegen nicht so weit von Hameln entfernt. Man hatte ihm vorgeschlagen, die wertvolleren Bilder in den Höhlen einzulagern. Doch dagegen hat mein Vater sich gesträubt. Er fand die Höhlen irgendwie zu schaurig.«
Die Baronin hielt inne und schenkte sich aus einer Porzellankanne grünen Tee ein. Mit einem Unterton des Bedauerns sagte sie: »Ich vertrage Kaffee nicht mehr so gut, deshalb habe ich auf Tee umgestellt. Aber manchmal sehne ich mich nach einer ordentlichen Tasse Kaffee am Morgen.« Sie trank einen kleinen Schluck. »Es wird Zeit, dass der Dachboden einmal gründlich inspiziert wird. In den letzten Jahren wurde er immer mehr zur Rumpelkammer. Jetzt haben wir dort den Holzwurm, und vor Kurzem wohnte oben ein Marder, den wir sehr mühsam in eine Falle locken und dann aussetzen konnten.« Sie lächelte und schob die Tasse von sich. »Grüner Tee! Na ja, das Alter fordert seinen Tribut.«
Die Tür öffnete sich, und Astrid erschien mit dem frischen Rührei.
»Wo sind denn alle anderen heute Morgen?«, fragte Anna, während sie Butter auf die Toastscheibe strich.
Die Baronin nahm noch einen Schluck aus der Teetasse. »Mein Sohn hat die Männer in seinen Rover gepackt und macht mit ihnen eine kleine Rundfahrt. Er wird ihnen wohl auch ein oder zwei der Höhlen zeigen. Einige dieser Höhlen sind noch nicht genauer erforscht. Seine Frau ist natürlich hiergeblieben.« Der Ausdruck im Gesicht der alten Dame sprach Bände. »Ja, und Constantin sitzt in seinem Zimmer und schreibt an einem Essay für die Uni zum Thema ›Frühromantische Dichter in England‹.« Sie stellte die Tasse ab. »Constantin ist zwar schon siebenundzwanzig, aber er wird erst im nächsten Jahr seine Masterarbeit beginnen. Was er mit diesem Studium anfangen will, ist mir unklar. Er ist der älteste Sohn meiner Tochter Eleonore, die in Aachen wohnt. Er hat noch zwei jüngere Schwestern, die beide in München studieren. Constantin ist ein Träumer, ganz anders als sein Freund Stefan Arendt.«
Anna aß ihr Rührei auf, dann schob sie den Teller beiseite. »Wir könnten loslegen«, sagte sie.
Die Baronin erhob sich langsam. »Ich sollte Treppenlifte in diesem Koloss anbringen lassen«, seufzte sie und ging vor Anna durch die Tür, die Max, der urplötzlich erschienen war, für beide aufhielt.
Heute wirkte sein Gesicht wieder völlig emotionslos. Kein Lächeln, kein Zwinkern. Er half der Baronin die Treppen hinauf und stieß die schmale Tür zum Dachboden auf.
Durch die kleinen Fenster fiel etwas mehr Licht als gestern, und über dem Holzboden tanzten wieder Staubflocken. Die Entrümpler hatten schon mehr als die Hälfte der Möbel aus dem vorderen Teil des Dachbodens fortgeschafft. Die Baronin beachtete den inzwischen merklich geschrumpften Berg an ausgesonderten Möbeln nicht weiter, sondern ging zielstrebig in den hinteren Teil des Dachbodens. Anna bewunderte die Energie der alten Dame.
Während sie ihr folgte, sah sie sich in dem riesigen Dachboden um. An den schrägen Wänden standen Schränke und Regale, dazwischen Zinkwannen und Kisten, Lampen ohne Schirm, ein Schaukelstuhl, zerbrochene Vasen, Kommoden ohne Füße, Matratzen und Haufen alter Bücher, die aus zerrissenen Bücherkartons gepurzelt waren.
»Das alles werden die Männer noch holen, vielleicht nicht mehr heute, aber spätestens am Montag.« Carola von Rödelshausen sah die Gegenstände fast verächtlich an. »Was für ein überflüssiges Zeug!«
Anna dachte an das Kasperletheater und seufzte. Nicht alles überflüssig, aber vieles Opfer der Zeit.
Schließlich hatten sie den hinteren Teil des Speichers erreicht. In der Wand, an der ein Schrank und eine Truhe standen, befanden sich zwei Türen, durch Vorhängeschlösser gesichert. Die Baronin holte zwei kleine Schlüssel aus ihrer Hosentasche und öffnete die beiden Schlösser, die jeweils mit einem leichten Plopp aufsprangen.
Max stieß die erste Tür auf. Dahinter lag ein dunkler Raum von etwa fünfundzwanzig Quadratmetern. Von der Decke hing eine nackte Birne, die Max anknipste. Sehr viel Licht spendete die verstaubte Birne nicht, aber es reichte, um sich in der Kammer umschauen zu können. An den Wänden hingen zahlreiche Spinnweben, und auch in den Ecken baumelten Spinnennetze, in denen noch ein paar Opfer klebten.
»Wie lange war denn niemand mehr hier?«, fragte Anna die Baronin, die im Türrahmen stehen geblieben war und mit zusammengekniffenen Augen die Kammer musterte.
»Sicher mehr als zwanzig Jahre. Oder, Max, waren Sie je hier oben?«
Max schüttelte den Kopf und antwortete mit einem kleinen Hüsteln: »Nein, Baronin, ich weiß nur, dass mein Vorgänger hier wohl gelegentlich versucht hat, die Spinnen zu vertreiben. Aber auch das muss mindestens zwanzig Jahre her sein.«
Die Baronin nickte. »Ich habe nie Lust verspürt, auf dem Dachboden zu sein. Als Kind habe ich geglaubt, dass in diesen beiden Kammern Gespenster hausen, weil man oft Geräusche von hier oben hören konnte. Außerdem hatte mir mein Vater verboten, auf dem Dachboden zu spielen. Eigentlich ein idealer Spielplatz, gut und gerne fünfhundert Quadratmeter groß. So viel Platz hatten wir nirgendwo sonst im Schloss.« Sie lächelte. »Nun, aber jetzt wollen wir mal sehen, was auf uns wartet oder besser auf Sie, liebe Anna!«
An den Wänden aus rohem Stein lehnten knapp zwei Dutzend in Leinentücher dicht verpackte Bilder unterschiedlicher Größe. Am anderen Ende des Raumes standen zwei mannshohe Spiegel mit trübem Glas, deren Rahmen früher wohl golden geschimmert hatten. In einer anderen Ecke lehnte ein Paravent aus völlig zerschlissenem Stoff, direkt daneben lag ein Kronleuchter auf dem Boden. Die Luft war stickig und staubig. Anna musste hüsteln.
»Gut, hier sind etwa zwanzig Bilder«, sagte die Baronin mit energischer Stimme. »Dann gehen wir jetzt in die andere Kammer. Da müssten noch mehr sein.«