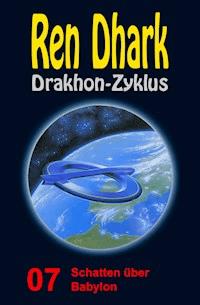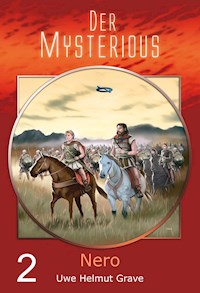
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nero macht man für den Brand Roms verantwortlich. Doch Arc Doorn weiß es besser. Und er weiß auch, wie der Teufel in die Welt kam: mit einem Ringraumer… Seit fast zweieinhalb Jahrtausenden lebt Arc Doorn unerkannt auf der Erde. Wir werden Zeuge, wie er Menschen begegnet, die Geschichte schrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mysterious
Band 2
Nero
Roman von
Uwe Helmut Grave
nach einem Exposé von
Hajo F. Breuer
Inhalt
Titelseite
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Empfehlungen
Ren Dhark Extra
Der zweite Krieg der Welten
T93
Impressum
Prolog
Als ich damit begann, den Bericht »Der Mysterious« anzulegen, geschah dies in der Absicht, die Abenteuer dieses außergewöhnlichen Mannes irgendwann einmal als Buch zu veröffentlichen. Nach meinen ersten Gesprächen mit Arc Doorn alias Arcdoorn wurde mir allerdings schon bald klar, daß ein Band wohl nicht ausreichen würde. Seine Lebensgeschichte beinhaltete Stoff für mindestens vier oder fünf, vielleicht sogar sechs Bücher – ein Mehrteiler, der mir eines Tages möglicherweise den Pulitzerpreis einbringen könnte, vorausgesetzt, ich bekam für die Veröffentlichung das Okay von Ren Dhark, von der terranischen Regierung und natürlich von Arc Doorn selbst.
Die langen Nächte an Bord der POINT OF eigneten sich hervorragend für ausführliche Zwiegespräche von Mann zu Mann, beziehungsweise von Mensch zu Worgun. Seit Doorn anno 348 v. Chr. im heutigen Dänemark gelandet war, hatte er eine Menge erlebt. Seinen Flash hatte Dalon mitgenommen, seine Tasche mit Werkzeug und Nadelstrahler büßte er später bei einem Schiffsunglück ein. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Waffe hatte man ihn als »Thor der Blitzeschleuderer« vergöttert – seit dem Verlust des Strahlers war er nichts weiter als ein gewöhnlicher Mensch.
Da die Drüsen seines selbstgewählten menschlichen Körpers einwandfrei funktionierten, konnte er Geschlechtsverkehr ausüben wie alle anderen Menschen, und dank seines enormen Begriffsvermögens lernte er problemlos die verschiedensten Sprachen und paßte sich den unterschiedlichen Sitten der Volksstämme an. Seinem Haarwuchs ließ er freien Lauf, so daß er mit den langen roten Locken und seinem dichten roten Bart ein wenig der Sagengestalt »Rübezahl« ähnelte, ein Eindruck, der durch seine für damalige Zeiten überdurchschnittliche Körpergröße von 1,82 Meter noch verstärkt wurde. Kein Wunder, daß sein Anblick manch ängstlichem Erdenbewohner Furcht einjagte. Die Griechen nannten ihn »Hephaistion« (Feuerkopf).
Doorn begegnete dem griechischen Forscher Aristides, König Philipp II. und dessen Sohn Alexander sowie Alexanders Lehrer, dem Philosophen Aristoteles. Aristoteles und Arcdoorn/Hephaistion, der in seinem »früheren Leben« als Worgun ja Philosophielehrer war, freundeten sich an.
Hephaistion unterstützte den König mit Rat und Tat im Kampf gegen die Athener. Das Endergebnis waren gerechte Friedensverhandlungen. Auch bei weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen konnte Philipp II. mit Hephaistions Unterstützung rechnen, der allerdings gegen sinnlose Gemetzel protestierte und stets auf humanen Konfliktlösungen bestand.
Doch die Zeit blieb nicht stehen. Der König ließ sich scheiden. Der herangewachsene Alexander rebellierte gegen seinen Vater. Seine Mutter Olympias inszenierte einen Mord an ihrem Exmann – der inzwischen eine blutjunge Frau geehelicht hatte –, und Alexander rief sich zum neuen König aus.
Obwohl Hephaistion alias Arcdoorn stets versuchte, besänftigend auf Alexander einzuwirken, folgten nach der Machtübernahme blutige Jahre. Insbesondere unter dem Einfluß von Wein war Alexander nicht mehr Herr seiner Sinne (die Bezeichnung »Alkoholiker« kannte man damals noch nicht). Mehr und mehr entwickelte sich der junge König zum Despoten – allen Heldensagen, die man in späteren Jahrhunderten über ihn entwickelte, zum Trotz. Letztendlich litt Alexander alkoholbedingt unter Größenwahn und ließ sich im Norden (des heutigen) Pakistans sogar als Gott verehren.
Ungefähr zu dieser Zeit fiel ein glühendes Rad, das einen Feuerschweif hinter sich herzog, vom Himmel – und nur Arcdoorn wußte, was es war: ein Ringraumer ohne Intervallfeld, der viel zu schnell in die Atmosphäre eintauchte und eine Bruchlandung wohl kaum vermeiden konnte. Alexanders Soldaten weigerten sich nach dieser Beobachtung, weiterzuziehen. Als auch noch Hephaistion in einem Vieraugengespräch erklärte, Alexander verlassen zu wollen und eigene Wege zu gehen, täuschte Alexander den Tod seines Gefährten vor, um nicht gänzlich sein Gesicht zu verlieren. Während Alexander sein unweigerliches Ende vorausahnte, auch weil er nicht mehr mit Hephaistions Unterstützung rechnen konnte, verschwand Arcdoorn im Dunkel der Nacht und machte sich auf die Suche nach dem abgestürzten Ringraumer…
Bernd Stranger, an Bord der POINT OF im Dezember 2062
1.
»Wo ist deine Enkelin? Rede, oder ich drücke dir die Luft ab!«
Durbar funkelte den alten Sigha Maharjan zornig an. Seine mächtige Hand umschloß Sighas faltigen Hals immer fester. Der dürre Greis hatte seinem größeren und stärkeren Widersacher nichts entgegenzusetzen. Jeder noch so geringfügige Versuch, sich zu wehren, hätte ihn das Leben gekostet.
»Kundai ist in den Wald gelaufen, als sie euch kommen sah«, keuchte Sigha. »Ich habe ihr befohlen, daheim zu bleiben, im Schutz des Dorfes, aber sie ist ein ungehorsames Kind. Schon als ihre Eltern noch lebten, hat sie nie gehorcht.«
»Eine junge schöne Tigerin, die gern ihre Krallen zeigt«, bemerkte Birman, der hinter Durbar stand, grinsend. »Aber wir werden sie schon zähmen.«
»Dafür müssen wir sie erst einmal einfangen«, erwiderte ein dritter Mann namens Chandra. »Zum Glück kennen wir uns in den umliegenden Wäldern besser aus als die Kleine.«
»Es war klug von ihr, zu flüchten«, meinte Durbar und ließ Sigha Maharjan los. »Wer hätte sie denn hier beschützen sollen? Du etwa, alter Mann?«
Er spie verächtlich aus und verließ die Hütte. Die Jagd auf Kundai begann…
*
Birman, Chandra und ihr Anführer Durbar lebten von Einbrüchen und Raubüberfällen. Sie waren die meistgesuchten Mörder in diesem Landstrich im Norden Indiens, im Jahre 326 vor Christus, aber man hatte sie für ihre abscheulichen Taten noch nicht zur Rechenschaft ziehen können. Keiner wußte, wo ihr Versteck lag. Gerüchte von einer Höhle hinter einem Wasserfall machten die Runde. Angeblich horteten sie dort ihre Beute und waren längst reiche Männer, die nur noch zum Vergnügen auf Raubzug gingen.
Nicht zum erstenmal suchten sie das abgeschiedene Bergdorf Paschupari heim. Anfangs hatten sie sich nur nachts in den Ort geschlichen, um zu stehlen. Später hatten sie damit angefangen, den Bewohnern in Ortsrandnähe aufzulauern und sie zu überfallen. Dabei hatten sie jedesmal rücksichtslos von ihren Schwertern Gebrauch gemacht. Die Herstellung von Eisen war in jenen Jahren eine aufwendige Angelegenheit. Werkzeuge aus Metall gab es in diesem Landstrich nur vereinzelt, eiserne Waffen noch seltener.
Die drei Wegelagerer waren immer skrupelloser geworden. Eines Morgens hatten sie gewartet, bis die jungen Männer aus dem Dorf zur Jagd aufgebrochen waren – und dann hatten sie eine Spur der Verwüstung durch den kleinen Ort gezogen. Die Alten, Kranken und Frauen hatten keine Chance gegen sie gehabt…
Hinterher war ein mit primitiven Waffen ausgestatteter Suchtrupp losgezogen, um der Mörderplage endlich Herr zu werden. Nur knapp die Hälfte der mutigen Männer hatte diese gefährliche Exkursion überlebt. Durbar und seine beiden Komplizen hatten die Gruppe aus dem Hinterhalt mit Pfeilen und Speeren angegriffen und letztlich auch ihre scharfgeschliffenen Schwerter eingesetzt.
Sie kannten keine Gnade, auch heute nicht, am Tag ihrer Rückkehr ins Dorf. Als man sie beim Verlassen von Sighas Hütte gefangennehmen wollte, bahnten sie sich rücksichtslos ihren Fluchtweg. Bald klebte frisches Blut an ihren Schwertklingen; dabei war das von ihrem letzten Überfall noch nicht einmal trocken.
Eigentlich hatte Durbar nicht so bald wieder nach Paschupari zurückkehren wollen, aber dann hatte ihm jemand von der Schönheit der Tochter des Dorfältesten erzählt – und seither hatte er es sich in den Kopf gesetzt, sie zu entführen.
Kaum hatten die drei Wegelagerer das Dorf verlassen, kam Kundai Maharjan aus ihrem Versteck hervor. Wie schon beim ersten Überfall hatte sie sich unter den Bodenbrettern verborgen.
Es entsetzte sie, daß es schon wieder unschuldige Tote gegeben hatte.
»Ich hätte mit ihnen gehen sollen«, sagte sie zu ihrem Großvater.
Der Greis schüttelte sein weißes Haupt. »Das werde ich niemals zulassen! Jeder im Dorf ist verpflichtet, die anderen Bewohner mit seinem Leben zu verteidigen. Du stehst unter dem Schutz von uns allen.«
»Aber ihr könnt mich nicht beschützen, weiser Sigha. Liefere mich aus, sonst nimmt das Blutvergießen nie ein Ende.«
»Das wird auch nicht aufhören, wenn wir dich ihm übergeben. Nur der Tod der drei Gottlosen setzt ihrem Treiben ein Ende. Leider lebt in Paschupari niemand, der es mit ihnen aufnehmen kann.«
Die schöne Kundai schlug verzweifelt die Hände vors Gesicht. »Warum lassen uns die Götter im Stich? Ich werde beten, daß sie uns einen Retter schicken – einen mutigen Mann mit der Kraft eines Elefanten.«
»Vielleicht ist er ja schon auf dem Weg hierher«, machte Sigha ihr Hoffnung. »Immerhin gaben uns die Götter ein Zeichen. Leider ist es uns bisher noch nicht gelungen, es zu deuten. Selbst unser allwissender Heiler konnte uns keine Erklärung für das flammende Rad geben, das wir alle am Himmel sahen.« Er schlug vor, das ganze Dorf mit ins Gebet einzubeziehen. »Wir könnten den Göttern ein Opfer bringen.«
»Das ist nicht nötig«, entgegnete Kundai mit entschlossener Miene. »Ich opfere mich selbst. Unser Retter kann von mir verlangen, was er will. Ich werde mich jedem seiner Wünsche fügen.«
»Schweig, dummes Kind!« befahl ihr der Dorfälteste. »Wenn Raschid deine törichten Worte hört, wird er dich verstoßen. Du bist ihm seit eurem feierlichen Gelöbnis versprochen und wirst nach der Heiratszeremonie in seine Hütte ziehen. Willst du ihn denn nicht mehr? Wer soll sich dann um dich kümmern, wenn ich nicht mehr bin?«
»Natürlich will ich Raschid, weiser Sigha, ich liebe ihn über alles. Doch bestimmt wird er meine Entscheidung verstehen, schließlich geschieht es zum Wohle des Dorfes.« Sie seufzte leise. »Was rede ich da? Unsere Gebete sind sowieso noch nie erhört worden. Raschid braucht daher keine Angst zu haben, daß jemals ein Fremder in mein Leben tritt.«
*
Durbar stieß einen lauten Fluch aus. Rund ums Dorf hatten er und seine Leute den Wald zu Füßen der Bergausläufer abgesucht, ohne Kundai Maharjan zu finden. Allmählich dämmerte es ihm: Der alte Mann hatte ihn belogen.
»Das wird er mir büßen!« schimpfte Durbar. »Es ist schon zu spät, um zur Höhle oder ins Dorf zurückzukehren, darum schlagen wir unser Nachtlager dort drüben in der Ruine auf. Morgen früh besuchen wir dann ein paar gute alte Freunde in Paschupari…!«
Als Anführer des Trios durfte er als einziger die ganze Nacht durchschlafen. Birman und Chandra mußten abwechselnd Wache halten. Zwar war in diesem unwirtlichen Teil des Waldes, den die Bewohner der umliegenden Dörfer mieden wie die Cholera, nicht mit nächtlichen Überfällen zu rechnen, dafür aber mit Schlangen, Giftspinnen, Skorpionen und diebischen Affenhorden.
Nach dem Erwachen schmerzten ihnen die Knochen vom harten Nachtlager, ihre Körper wiesen blaue Flecken auf, sie fühlten sich müde und zerschlagen, und ihre ungewaschene Kleidung roch noch schlimmer als am Abend zuvor – ein Zustand, den man gemeinhin als Morgengrauen bezeichnete. Daß sie aus der Ferne von mehreren Jägern aus Paschupari heimlich beobachtet wurden, ahnten sie nicht. Die kleine Gruppe hatte die Spur der drei Wegelagerer aufgenommen und sie aufgestöbert. Näher heran trauten sich die Dörfler jedoch nicht; die Erinnerung an die letzte blutige Auseinandersetzung steckte noch allen in den Gliedern.
Leise diskutierten sie miteinander.
»Der Platz ist ideal für einen Überraschungsangriff.«
»Das sehe ich genauso. Wenn wir sie aus dem Hinterhalt angreifen…«
»… sind wir nicht besser als sie selbst. Ich bin für einen Kampf Mann gegen Mann.«
»Und ich bin nicht lebensmüde. Es ist jetzt wirklich nicht der richtige Augenblick für Heldentaten. Die Götter verlangen ihren Tod – eine andere Erklärung für das Flammenrad gibt es nicht. Wir müssen ihnen gehorchen.«
»Richtig. Wenn wir den Willen der Götter erfüllen wollen, müssen wir die drei umbringen, egal wie. Im ehrlichen Zweikampf würden wir nur wieder versagen. Selbst wenn wir ihnen einen Hinterhalt legen, ist es nicht sicher, ob wir es schaffen, sie zu erledigen – aber unsere Chance ist größer.«
»Trotzdem… mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, sie einfach so abzuschlachten, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu wehren.«
»Eine Möglichkeit, die viele unserer Freunde und Angehörigen nicht hatten. Oder hast du das schon vergessen, Raschid?«
Der Mann, der laufend seine Bedenken äußerte, war kein geringerer als Kundais Verlobter. Ausgerechnet er, dem am meisten daran gelegen war, Durbar und seine Mordbrenner vom Dorf und vor allem von seiner künftigen Frau fernzuhalten, hatte Skrupel. Seine Begleiter hingegen hatten einfach nur Angst, was angesichts der zurückliegenden schrecklichen Ereignisse nur zu verständlich war.
»Seht doch!« flüsterte Raschid den anderen zu und deutete auf die Ruine. »Es hat noch jemand die Nacht zwischen den Mauerresten verbracht.«
Alle schauten in die Richtung, in die er deutete. Hinter einem von Pflanzen überwucherten Steinhaufen trat ein kräftiger Mann hervor, der Durbar von der Größe her durchaus ebenbürtig war. Das Auffälligste an ihm waren seine helle Haut, seine wallenden roten Haare und sein dichter Vollbart von gleicher Farbe.
*
Birman sah den Fremden als erster und machte seine Weggefährten auf ihn aufmerksam. Alle drei zückten ihre Waffen und gingen näher an ihn heran.
»Puh, der Kerl stinkt vielleicht!« bemerkte Chandra abfällig, obwohl auch er nicht gerade nach exotischen Pflanzen duftete.
In der Tat strömte der Rotbärtige einen strengen Eigengeruch aus. Auf seiner Wanderung hatte er tagelang keine Gelegenheit gehabt, sich ausreichend zu waschen – was ihm nicht viel ausmachte, er mochte es, wie er roch, und wem es nicht paßte, der konnte ja wegriechen.
Der Fremde trug einen Bauchgürtel, an dem seitlich ein kunstvoll gearbeitetes Schwert hing. Obwohl er sich hätte bedroht fühlen müssen, beließ er die Waffe in der Scheide.
»Ich will keinen Streit«, sagte er in der Sprache des großen Reiches im Westen, die die Räuber leidlich beherrschten.
»Wir schon«, erwiderte Durbar mit breitem Grinsen. »Hast du was Wertvolles bei dir?«
»Außer meinem Schwert, das mir der große König Alexander schenkte, besitze ich kaum mehr als etwas leichtes Wandergepäck«, antwortete er wahrheitsgemäß und bückte sich nach einem Bündel, das am Boden lag, verdeckt von einem klobigen Stein. »Falls ihr Hunger habt, teile ich gern meine Wegzehrung mit euch.«
»Nicht nötig, wir nehmen uns, was wir brauchen«, entgegnete Chandra und entriß ihm das Bündel.
»Und dein Schwert nehmen wir natürlich auch«, sagte Birman. »Gib es uns, dann lassen wir dich am Leben.«
»Teilt euch mein Essen und zieht friedlich eurer Wege – dann lasse ich euch am Leben«, machte ihnen der Rotbart den Gegenvorschlag und lächelte dabei so freundlich, als habe er gerade etwas furchtbar Nettes zu ihnen gesagt.
Durbar trat einen Schritt auf ihn zu. Er überragte den hochgewachsenen Fremden noch knapp um eine Haupteslänge.
»Bist du dir eigentlich darüber im klaren, daß hier drei gegen einen stehen?« fragte Durbar ihn.
Der Fremde nickte. »Das ist nicht fair, du hast recht. Vielleicht sollten wir das ungleiche Verhältnis abändern, damit beide Seiten die gleiche Chance haben.«
»Woran denkst du dabei? An einen Zweikampf? Vergiß es! Ich wäre schön dumm, würde ich mich auf so etwas einlassen. Warum das Risiko eingehen, eine Auseinandersetzung zu verlieren, wenn man einen leichten Sieg davontragen kann?«
»Du verstehst mich offenbar falsch«, entgegnete der Rothaarige. »Ich wollte nicht meine Chance aufbessern, sondern eure. Wie wäre es, wenn ihr euch noch ein paar Mann Verstärkung holt? Oder soll ich einen Arm auf meinem Rücken festbinden?«
Durbar war stark, aber nicht sehr helle. Der Zorn kochte in ihm hoch – die gewollte Provokation zeigte Wirkung. Wutentbrannt packte er sein Schwert mit beiden Händen, hob es über seinen Kopf, holte aus…
Als ihm bewußt wurde, daß er für einen Augenblick ohne Deckung dastand, war es bereits zu spät. Sein Gegner zog schnell wie der Blitz das Schwert aus der Scheide und rammte es ihm durch die Brust, mit einer solchen Wucht, daß die blutige Spitze am Rücken wieder austrat.
Durbars Gesichtszüge veränderten sich. Sein Grinsen erstarb, wandelte sich zur Grimasse.
Ein Ausdruck der Ratlosigkeit lag in seinen Augen, so als wolle er eine Frage stellen, als habe er noch nicht so richtig begriffen, was gerade geschehen war. Dann wurde es ihm bewußt, und sein Mienenspiel wechselte von Verdutztheit zu blankem Entsetzen…
Mit einem Ruck zog der Fremde das Schwert aus Durbars Körper. Der riesenhafte Raubmörder kippte der Länge nach rückwärts um. Daß sein Schädel auf einem Stein aufschlug, spürte er nicht mehr, denn er war schon tot, bevor er den Boden berührte.
Den Namen Alexander hatte Durbar noch nie zuvor gehört – und er würde auch nie mehr erfahren, wer der Mann war, dessen Waffe ihn ums Leben gebracht hatte.
*
Nicht nur bei den Worgun war es eine altbekannte Kampfstrategie, als erstes den stärksten Feind auszuschalten und sich dann mit den schwächeren Gegnern zu befassen. Und Truppen ohne Anführer waren leichter zu besiegen als Truppen mit Anführer, deshalb war es stets wichtig, zuerst den Kopf der Schlange abzuschlagen.
Anscheinend hatten Birman und Chandra von derlei erfolgreichen Strategien noch nie etwas gehört, oder sie ignorierten sie einfach. Obwohl das mörderische Trio seinen Planer und Denker verloren hatte und zu einem Duo zusammengeschrumpft war, flohen die beiden nicht kopflos, sondern kämpften mit aller Verbissenheit gegen den unbekannten Mann, mit dem sie die Nacht in der Ruinenstadt verbracht hatten, ohne seine Anwesenheit bemerkt zu haben.
Hephaistion hätte gern einen bequemeren Schlafplatz gewählt. Doch als die Dunkelheit über ihn hereingebrochen war, hatte er sich spontan für die von Pflanzen überwucherten Ruinen entschieden, dort war es ihm am sichersten vorgekommen. Daß er am nächsten Morgen in unmittelbarer Nähe einer gefürchteten Räuberbande aufwachen würde, hatte er nicht ahnen können.
Weil er unnötige Gewalt verabscheute, hatte Hephaistion nicht Seite an Seite mit König Alexander auf den Schlachtfeldern gekämpft. Trotzdem beherrschte er die Kunst des Schwertkampfes perfekt. Viele Jahre hatte er mit seiner schweren Waffe geübt, bis er gelernt hatte, sie sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Arm geschickt zu führen. Sein hartes Training machte sich jetzt bezahlt. Der menschgewordene Worgun wechselte das Schwert gekonnt von einer Hand zur anderen und hielt auf diese Weise den fortwährenden Attacken seiner Angreifer sogar dann stand, wenn sie ihn von zwei Seiten her in die Zange nahmen.