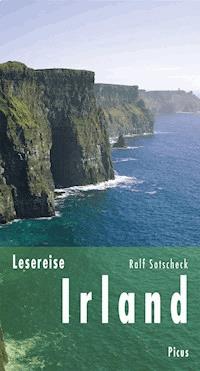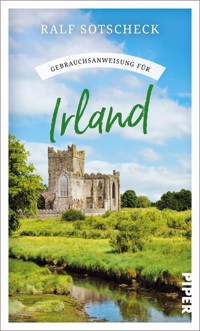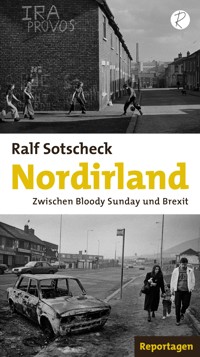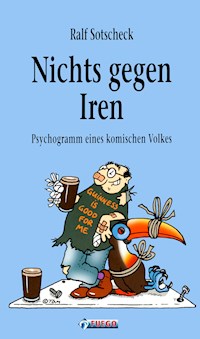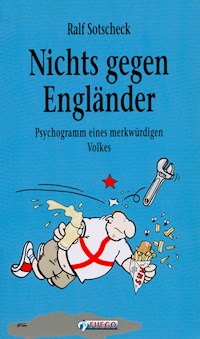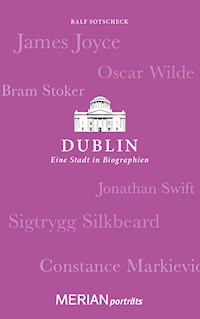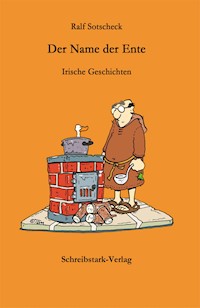
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schreibstark-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten aus Irland, die manchmal unglaublich, aber immer wahr sind – und ziemlich lustig. Größtenteils jedenfalls. Ralf Sotscheck ist Berliner, lebt aber seit 1985 auf der Grünen Insel und arbeitet als Korrespondent für taz, die tageszeitung und andere Medien. „Einen Sotscheck zu sehen gilt als großes Glück; man muss sich sogleich den Bauch reiben und ein Guinness bestellen. Im Glase sieht man dann Dinge, die es gar nicht gibt – schönes Wetter oder funktionierende irische Behörden.“ Friedrich Küppersbusch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Das doppelte Komplottchen
Der Name der Ente
Lange Nächte, kurze Röcke
Der Blumenkohl, das höhere Wesen
Sockenkauf mit Pediküre
Mit Halsband schneller schwanger
Händeschütteln mit Untoten
Biographien:
Ralf Sotscheck
Der Name der Ente
Mit Illustrationen von©TOM
und einem Vorwort von Michael Ringel
Schreibstark-Verlag
Saalburgstr. 30
61267 Neu-Anspach
llustrationen: ©TOM
Coverrückseite/Photo: Burghard Mannhöfer
Buchsatz/Layout: Marc Debus
Danksagung
Ohne Marc Debus und Patrick Steinbach wäre das Buch nicht zustande gekommen. Dafür danke ich ihnen, ebenso wie ©TOM für die Zeichnungen und Michael Ringel für das Vorwort. Ringel und seiner Kollegin Harriet Wolff sowie Christian Bartel und Lars Klaaßen, den Hütern der Wahrheitseite in der taz, gebührt mein Dank dafür, dass sie mir jeden Montag ein Stückchen Wahrheit abgeben. Bei Áine bedanke ich mich für die moralische und kulinarische Unterstützung. Und zu guter Letzt Dank an die freiwilligen und unfreiwilligen Protagonisten der Geschichten.
Ralf Sotscheck
Für Seán und Conor
Das doppelte Komplottchen
Von Michael Ringel
Drei Dinge können Iren besonders gut: saufen, singen und Geschichten erzählen. Ein Glück, dass Ralf Sotscheck nicht singen kann. Sonst wäre er zu perfekt.
An dieser Stelle soll endlich ein Geheimnis gelüftet werden, das der gebürtige Berliner und geborene Ire seit Jahrzehnten sorgfältig vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen versucht.
Zwei der drei klassischen keltischen Eigenarten beherrscht Ralf Sotscheck meisterlich. Dass er ein phänomenaler Erzähler ist, weiß jeder Leser seiner Berichte, Kolumnen und mehr als dreißig Bücher, die er bislang veröffentlicht hat. Besonders gut versteht er sich aber auf das „Ralfen“, wie es in Freundeskreisen ebenso ehrfürchtig wie angsterfüllt genannt wird, wenn der Dunkelbierfürst auf den Wellen des Durstes über die Irische See heranreitet und seine Heimatstadt Berlin unsicher macht.
Dann muss der Wahrheit-Redakteur jedes Mal eine Art Warn-Mail an Freunde und Autoren schicken und zum sogenannten „S-Day“ laden, der lange Jahre zum Beispiel im Schöneberger Felsenkeller stattfand: „Mütter, schließt eure Töchter in die Kabäuschen! Väter, ladet die Meuchelpuffer! Kerle und Dirnen, seid fest im Trunke und hart im Nehmen! Es ist S-Day!“
Nicht einen Abend, nein, mindestens zwei Tage dauert solch ein „S-Day“, auch weil der Herrscher der Sperrstunde einer der größten Taxiabbesteller in der Geschichte des Absturzes ist. Immer wieder kommt es vor, dass der brutale Baron der Buddel einem bestellten Droschkenkutscher verstohlen einen Schein in die Hand drückt, damit niemand den nächtlichen Ort des Gelages verlässt.
Wie aber kann ein Einzelner diese übermenschliche Anstrengung verkraften? Und dabei auch noch glänzende gesundheitliche Werte vorweisen? Was der kugelige Mann nach jedem Arztbesuch triumphierend verkündet. Was ist sein Geheimnis? Erstmals misstrauisch wurden diverse Opfer des Sotscheck’schen Sinnestaumels, als der damalige taz-Sportredakteur Matti Lieske eines Tages felsenfest behauptete, mit dem Schenk der Hölle in Berlin unterwegs gewesen zu sein, während ein Kollege ebenso standhaft schwor, ihn zur gleichen Zeit in Dublin besucht zu haben.
Plötzlich stand es glasklar vor Augen, all die Zeichen waren immer schon da gewesen: Da gibt es mit Dublin an der Ost- und Fanore an der Westküste Irlands zwei Wohnorte. Die zwei Pässe. Die zwei Kinder. Die zwei Seelen, ach, in seiner Brust. Denn einerseits pflegt der überaus liebenswürdige Ralf Sotscheck Freundschaften mit inniger Herzlichkeit, andererseits führt er ständig seine besten Freunde mit durchtriebenem Schabernack hinters Licht. Einerseits ist er enorm großzügig und freigiebig, andererseits sind seine Vorstellungen von Finanzangelegenheiten – gelinde gesagt – abenteuerlich.
Es gibt nur eine Erklärung, es sind zwei: Ralf und – nennen wir ihn hier – Rolf Sotscheck. Seit Jahren schmieden die eineiigen Zwillinge ein doppeltes Komplottchen, in das nur wenige Menschen eingeweiht sind, wie beispielsweise Ralfs irische Frau Áine. Sie lernte beide Sotschecks in den siebziger Jahren in Berlin kennen. Der eine war Lastwagenfahrer, und der andere schrieb erste Texte für die taz. Der eine erarbeitete die Grundversorgung, und der andere sorgte für die notwendige geistige Nahrung. Es muss ein schwieriger Moment gewesen sein, als die Brüder die Frau ihrer Träume endlich in ihr Geheimnis einweihten und sie sich gemeinsam entscheiden mussten, wer wen heiraten durfte.
Endlich aber versteht man die mysteriösen Vorgänge im Domizil der Sotschecks. Als Gast im Dubliner Stadtteil Drumcondra wird man als Erstes mahnend mit dem Satz empfangen: „Es gibt eine Regel hier: Alles, was im Haus geschieht, bleibt im Haus und dringt nicht nach draußen“, während ein Zimmer stets für Besucher gesperrt ist, weil es angeblich „zu vollgestellt“ sei, wie es heißt. Mit den heutigen Kenntnissen ein schlagender Beweis für die Täuschung und eine Vorsichtsmaßnahme, falls sie auffliegt.
Seit frühester Jugend stecken Ralf und Rolf Sotscheck unter einer Decke. Was eine weitere Eingeweihte bestätigen könnte, wenn sie es denn wollte. Doch Mutter Ruth Sotscheck gilt als größte Entweder-oder-Überhörerin Berlins. Stellt man ihr zum Beispiel die Frage: „Gehen wir zum Chinesen oder zum Italiener?“, dann antwortet sie stets gleich raffiniert: „Ja.“ Eindeutig eine lang geübte, familiäre Vermeidungsstrategie, damit sie um die Frage: „War das jetzt Ralf oder Rolf?“ herumkommt.
Doch es gibt ein Dokument, das die Sotscheck-Verschwörung entlarvt. Immer wieder erzählt Ralf Sotscheck, dass er ein Hertha-Frosch der ersten Stunde sei und man in einer Sendung der „Sportschau“ mit Ernst Huberty habe sehen können, wie nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln im Berliner Olympiastadion ein Junge mit einer riesigen Hertha-Fahne aufs Feld stürmte. Der kleine Junge, der die Fahne schwenkte, sei er gewesen. Sieht man sich allerdings im Deutschen Rundfunkarchiv die verwackelten Aufnahmen aus den sechziger Jahren an, entdeckt man nicht einen, sondern tatsächlich zwei Fußballfrösche. Einer allein hätte die Riesenfahne gar nicht tragen können.
Es ist ein gigantisches Täuschungsmanöver, das bis heute anhält. Ralf und Rolf sind insgeheim immer gemeinsam unterwegs – selbst auf der Toilette, wo beide sich an einem S-Day abstimmen über Personen, Gesprächsthemen und Abläufe am Tisch. Trinkt der eine, verschnauft der andere. Was ihnen durch einen Trick gelingt, gilt Ralf Sotscheck doch als der größte Nichtraucher aller Zeiten, dabei raucht er wie ein Schlot, sodass er zur Tarnung ab und zu verschwinden und am stillen Ort zwei Zigaretten (!) auf einmal paffen kann.
Auf diese Weise hat Sotscheck es sogar zu einer eigenen Figur im täglichen Cartoon-Streifen „touché“ des Zeichners ©Tom auf der Wahrheit-Seite der taz gebracht: „Raucher-Ralle“. Der seit dem Jahr 2010 auch als drei Meter zehn hohes Monument auf dem Vordach des Kasseler Hauptbahnhofs steht und „wie Hermann der Cherusker im Hermannsdenkmal sein Schwert eine glühende Zigarette in den Himmel reckt“, wie die für das Raucherdenkmal verantwortliche Caricatura Kassel schreibt. Ein weiterer Hinweis auf die Doppelexistenz, hieß doch Hermann Arminius wie Ralf Rolf.
Um zu erfahren, warum beide Sotschecks ihre Umgebung so lange schon täuschen konnten, muss man allerdings in ihre Jugend zurückblicken. Wie Klassenbücher und andere Dokumente belegen, sollten beide Brüder einst in den Schulchor aufgenommen werden. Singen aber, das ist für einen Sotscheck ungefähr so erfreulich, wie mit einem stummen Diener Brüderschaft zu trinken. Deshalb haben sie sich irgendwann entschlossen, ein doppeltes Leben im halben zu führen. Wenn nur einer von beiden singt, wird geteiltes Leid zum halben.
Nur so ist es möglich, dass sich ein Sotscheck derart viel hinter die Binde gießen kann und zugleich immer neue Geschichten auf Lager hat. Und wo könnte das besser funktionieren als im Land der trunkenen Erzähler, in dem die Brüder Sotscheck ihre Bestimmung gefunden haben. Und von denen ihre Geschichten auch im vorliegenden Band mit aller Kraft des Doppelherzens zeugen.
(Michael Ringel ist Wahrheit-Redakteur der taz)
Der Name der Ente
Ich war ein dünnes Kind. Freunde und Bekannte, die mich damals noch nicht kannten, halten das für Fake News. Es stimmt aber. Ich war in Berlin-Lankwitz, wo ich aufwuchs, bekannt als der Knabe, hinter dem die Mutter mit einer Stulle herlief. Wenn ich unterwegs irgendetwas mit offenem Mund bestaunte, schob sie mir Brot hinein.
Etwas subtiler war der Trick mit dem Blechteller und den drei Enten. Die Vögel waren auf den Boden des Tellers aufgedruckt, und um sie zu sehen, musste ich den Brei aufessen. „Noch ein Löffel, und wir können Eulalie sehen“, ermutigte mich meine Mutter. Ein weiterer Löffel, und Genoveva würde auftauchen. Es klappte, bis ich überlief und den Brei wieder auskotzte, was meine Mutter in die Verzweiflung trieb.
Ich musste jeden Abend auf die Waage. Andere Eltern maßen das Wachstum ihrer Sprösslinge mit Strichen an der Wand, ich bekam einen Eintrag in die Wiegekarte, die eigentlich für Babys bis zum Alter von zwölf Monaten vorgesehen ist.
Neulich, beim Aufräumen, fiel mir der Blechteller wieder in die Hände. Er ist zwar etwas verrostet, und die Enten sind ziemlich verblasst, aber noch gut sichtbar. Eulalie und Genoveva erkannte ich sofort. Wie aber hieß die dritte Ente? Ich rief meine Mutter an. Sie ist inzwischen 95 Jahre alt, aber geistig fit. Euphrosine“, sagte sie wie aus der Pistole geschossen.
Wie ist sie bloß auf die Namen gekommen? „Eulalie“ heißt ein Gedicht von Edgar Alan Poe, Er hatte den Namen gewählt, weil er den Buchstaben L liebte. Seine Frauengestalten hießen Annabel Lee, Leonore, Ulalume. Genoveva hingegen, deren Name auf das walisische Gwenhwyfar zurückgeht, was „schönes Gesicht“ bedeutet, war eine heilige Jungfrau aus dem 5. Jahrhundert, sie ist Schutzpatronin von Paris.
Und „Euphrosine“ heißt eine Oper des französischen Komponisten Étienne Nicolas Méhul, sie wurde 1790 im Salle Favart in Paris uraufgeführt. Meine Mutter hatte damals mit Sicherheit noch nie von Poe oder Gwenhwyfar gehört, und von Méhul vermutlich bis heute nicht, was aber keine große Wissenslücke ist.
Ich rief sie erneut an und fragte nach. Ihr Vater, der Ingenieur bei einem großen Elektro-Unternehmen war und sich stets ordentlich mit Anzug und Fliege kleidete, habe ihr, als sie Kind war, Geschichten erzählt, in denen die drei Namen ständig vorkamen, sagte sie: „Und die Namen habe ich mir gemerkt.“ Ich kann von Glück sagen, dass ich nicht als Mädchen geboren wurde, da ich in dem Fall wohl einen Entennamen hätte.
Neulich habe ich meine Mutter wieder mal in Berlin besucht. Ihre Freude hielt sich in Grenzen. „Meine Güte, bist du dick“, jammerte sie. „Eines Tages wirst du platzen. Und wer kümmert sich dann um meine Angelegenheiten?“ Meine Ausrede, dass ich endlich meine Magersucht überwunden habe, ließ sie nicht gelten. Man kann es ihr einfach nicht recht machen.
Die Rückreise nach Irland am nächsten Tag heiterte mich keineswegs auf. Da es in aller Herrgottsfrühe losgehen sollte, gönnte ich mir ein Taxi zum Flughafen. Der wohl arabische Fahrer, mit dem Kopf ans Seitenfenster gelehnt, redete ununterbrochen. Aber nicht mit mir. Für ein Telefongespräch schien mir die Konversation zu einseitig. Betete er? Ich tat es jedenfalls in Anbetracht seines Fahrstils, zu dem ein ständiger Wechsel der Fahrspur, aggressives Auffahren und regelmäßiges Hupen gehörte.
Später bekam ich übrigens eine Nachricht von meinem irischen Kreditkarteninstitut. Man hatte die Zahlung für das Taxi verweigert, weil einem eifrigen Sachbearbeiter „die Sache komisch vorgekommen“ sei. Jetzt habe ich vermutlich einen arabischen Clan am Hals. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Wider Erwarten erreichten der Araber und ich den Berliner Flughafen unbeschadet. Es gibt genügend Geschichten über dessen teuflisches Design, und sie sind alle wahr. Taxis können am neuen Terminal 2 nicht halten, so dass man vom Terminal 1 zu einer zünftigen Wanderung über viele Treppen und lange Flure aufbrechen muss. Am Ende landete ich am selben Flugsteig wie ein Jahr zuvor, als man noch recht zügig im Terminal 1 abgefertigt wurde. Das erschien den Flughafenbetreibern offenbar zu komfortabel. Schließlich hatten sie einen schlechten Ruf zu verteidigen.
Was hingegen tadellos funktionierte, war der Seifenspender auf der Herrentoilette. Leider hielt der Sensor meinen achtlos hingeworfenen Mantel für eine Hand, so dass ich staunend mitansehen musste, wie mein Kleidungsstück gründlich eingeseift wurde.
Im Flugzeug saß eine ältere Blondine auf meinem Platz und wollte partout nicht weichen. Erst als ihr der Steward mit strengem Blick erklärte, dass sie den Gang-, und nicht den Fensterplatz gebucht hatte, machte sie mir unter Verwünschungen Platz. Der Mann in der Mitte war offenbar ein Kokser. Er zog sich alle 20 Sekunden die Maske von der Nase, schniefte, und setzte sie wieder auf.
Nachdem ich endlich in Dublin angekommen und nach einer knappen Stunde zu Hause war, machte ich es mir mit einem Gläschen Wein im Sessel gemütlich. Das Möbel ist ein Erbstück, die Fußraste lässt sich elektrisch ausfahren und die Rückenlehne absenken, so dass man fast wie in einem Bett liegt.
Dann fiel der Strom aus. Hatte der Fluch, mit dem mich die Blondine im Flugzeug belegt hatte, gewirkt? Jedenfalls ließ sich der Sessel ohne Strom nicht mehr in die Normalposition bringen. Ich saß fest. Als ich vorsichtig herausrutschen wollte, kippte der Sessel nach vorne und warf mich ab, so dass ich wie ein Maikäfer rücklings auf dem Boden landete. Ich bin dann einfach liegen geblieben und merkte mir das Datum, damit ich in den nächsten Jahren an diesem Tag gar nicht erst aufstehe und schon gar nicht irgendwo hinfliege.