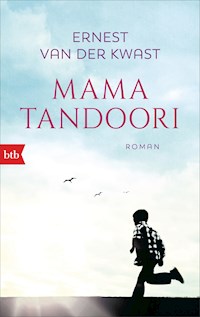4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Kunstwelt ist in Aufregung: ein neuer Rembrandt wurde entdeckt – das Porträt eines unbekannten jungen Mannes. Doch der Konservator Peter Lindke widerspricht dieser Zuschreibung. Als er in einer Fernsehsendung erklärt, warum dieses Gemälde niemals von Rembrandt stammen könne, wird er gefeuert. Als wäre das nicht schon genug, muss er feststellen, dass seine Ehe sich in einer Krise befindet und dass seine Zugehfrau größere Probleme hat. Er nimmt sie unter seine Fittiche und bringt ihr Leben wieder auf eine geordnete Bahn. Als sie dann allerdings mit Ilyas auftaucht, einem Jungen mit dem Gesicht eines gequälten Poeten und 20 000 Euro Schulden, steht Peter vor einem Dilemma: Sollte er auch Ilyas helfen und würde das seinem Leben einen Sinn geben? Oder sollte er doch lieber alles daran setzen, seine Ehe zu retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Die Kunstwelt ist in heller Aufregung: Ein neuer Rembrandt wurde entdeckt – das Porträt eines unbekannten jungen Mannes. Doch der Kurator Peter Lindke widerspricht dieser Zuschreibung. Als er in einer Fernsehsendung erklärt, warum dieses Gemälde niemals von Rembrandt stammen könne, wird er vom Museum gefeuert. Als wäre das nicht schon genug, erkennt er, dass seine Ehe sich in einer Krise befindet. Noch größere Probleme scheint nur Dschemine zu haben, die im Hause Lindke für Sauberkeit und gebügelte Wäsche sorgt.
Peter nimmt sie unter seine Fittiche und bringt ihr Leben wieder in geordnete Bahnen. Als sie dann allerdings mit Ilyas auftaucht, einem Jungen mit dem Gesicht eines gequälten Poeten und 20 000 Euro Schulden, steht Peter vor einem Dilemma: Soll er auch Ilyas helfen, und wird das seinem Leben endlich einen Sinn geben? Oder sollte er doch lieber alles daransetzen, seine Ehe zu retten?
Zum Autor
ERNEST VAN DER KWAST wurde 1981 in Mumbai geboren und ist halb indischer, halb niederländischer Herkunft. Seine Romane sind internationale Bestseller. In Deutschland erschienen bisher seine Romane »Fünf Viertelstunden bis zum Meer«, »Die Eismacher« und »Mama Tandoori« sowie sein Erzählband »Versteckte Wunder«. Ernest van der Kwast lebt mit seiner Familie in Rotterdam.
ERNESTVANDERKWAST wurde 1981 in Mumbai geboren und ist halb indischer, halb niederländischer Herkunft. Seine Romane sind internationale Bestseller. In Deutschland erschienen bisher seine Romane »Fünf Viertelstunden bis zum Meer«, »Die Eismacher« und »Mama Tandoori« sowie sein Erzählband »Versteckte Wunder«. Ernest van der Kwast lebt mit seiner Familie in Rotterdam.
ERNEST VAN DER KWAST
DER PERFEKTE MANN
Roman
Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Ilyas« bei De Bezige Bij, Amsterdam.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe Oktober 2023
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Ernest van der Kwast
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Getty Images/Sahin Kafire/EyeEm; © Shutterstock/Krasovski Dmitri; pics five
Autorenfoto: © Stephan Vanfleteren
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-28164-9V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
EINS
Bald würde die Dämmerung einsetzen, alles badete in einem unwirklichen, bläulichen Licht. Am Horizont ein Schleier warmer Farben. Peter Lindke war ausgestiegen und betrachtete beim Tanken die weite Wiesenlandschaft.
Vor seinen Augen wurde das Grün des Grases langsam geschluckt. Hätte er nicht im harten, weißen Licht der Tankstelle gestanden, sondern im saftigen Gras voller Klee und Butterblumen, wäre auch er im alles beherrschenden Blau aufgegangen. Ein einsamer Mann, der langsam davontreibt. Er dachte an dicke Pinselstriche, Weiß, das in Rosa übergeht, dann zu Orangegelb changiert und zuletzt ganz zu Rot: ein Horizont in Flammen. Alles andere – die Bäume, die Kühe, die schnurgeraden Gräben – war in einen saphirfarbenen Schimmer gehüllt. In diesem Licht verschwand alles, alles und jeder.
Es hatte mit Staubteilchen und Wasserdampf in der Atmosphäre zu tun, aber auch mit der Wellenlänge der Farben. Während die Sonne hinter dem Horizont versank, verbreitete sich am Himmel das Blau, es streute und kroch in alles hinein, wie Tinte. Als wolle die Natur dieses Bild einfangen und benutze dazu jedes Mittel, doch selbst das größte Himmelsgewölbe war nicht imstande, diesen bezaubernden Moment festzuhalten.
Das Dunkel fraß schon an den Dingen, als Peters Frau Kee an der Zapfsäule stand. Fassungslos schaute sie sich um, völlig perplex. Sie war kurz auf die Toilette gegangen, hatte sich die Hände gewaschen und war dann zurückgekommen, um zu erkennen, dass ihre Familie sich in Luft aufgelöst hatte. Einfach weg. Kein Auto, kein Mann, keine Kinder. Nur der Betrag auf der Zähleruhr erinnerte noch an sie, das heißt: an ihren Mann: 83 Euro, 02 Cent. Nie konnte Peter etwas genau machen, richtig, perfekt. Ihre Hände tasteten in ihren Taschen. Sie fluchte. Ihr Handy lag noch im Auto.
Zwei Kilometer entfernt fuhr jetzt ein Ford Focus auf der Autobahn zurück in die Stadt, wo die Lindkes seit Kurzem in einem sozial gemischten Quartier ein Reihenhaus bewohnten. Ein »chancenreiches Viertel«, wie das im Planersprech der Stadtverwaltung hieß. Neubau in traditionellem Baustil inmitten von Sozialwohnungen aus den achtziger Jahren. Backstein und Holz versus Hartfaser und Aluminium. Der Teil der Familie im Auto bestand aus zwei Söhnen und Peter Lindke, Kurator der Abteilung für niederländische Barockmalerei am örtlichen Museum, Vater und Ehemann. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, doch immerhin ziemlich oft. Am Rand der A 12 stand seine Frau.
»Verdammt noch mal, Peter, verdammte Scheiße noch mal!«
Sie waren ins Grüne gefahren. Zwei Tage nachdem der Sturm das Land lahmgelegt hatte. Der Zugverkehr war unterbrochen gewesen, und Lastwagen auf der Autobahn waren umgemäht worden. In manchen Straßen im Osten des Landes hatte es Dachziegel geregnet. Zu viert waren sie in den Wald gefahren und hatten die Sturmschäden besichtigt. Riesige Birken und Eichen hatte der Wind gefällt; ihre Wurzeln baumelten in der Luft wie Eingeweide aus einem Kadaver. Die Wege waren übersät mit Zweigen, dreißig Meter hohe Kiefern standen schief aneinandergedrückt wie Dominosteine.
Auf einer sandigen Lichtung hatte Kee die Thermoskanne aus ihrem Rucksack geholt. Der Tee dampfte im Becher, und abwechselnd nahmen sie kleine Schlucke. Die Sonne schien, unterbrochen von Inseln bleifarbener Wolken. Sie sagten nicht viel und redeten leise, wie das Rascheln von Blättern.
Nach und nach wurden die Schatten länger. Als sie zum Auto zurückgingen, folgten ihnen Riesen, bereit, sich jeden Moment auf sie zu stürzen.
Am Wochenende flohen Peter und Kee gern aus der Stadt, den Kindern jedoch war das ein Graus. Fast alles, was ihr Vater und ihre Mutter vorschlugen, nervte sie tödlich. Selbst ihre eigenen Namen fanden sie megapeinlich.
Tristen und Ewan. Keltische Namen. Ihre Söhne sollten wackere junge Burschen werden, die im Leben nichts umwarf. Davon hatten Kee und Peter geträumt, als sie ihnen die Namen gaben, doch auf diesem Gebiet war wenig zu erhoffen. Tristen und Ewan ähnelten nicht nur einander, sondern auch all ihren Schulkameraden: Sie waren Durchschnitt, in nichts von der Masse verschieden.
Wenn sie sich wieder mal langweilten, hielt Peter seinen Söhnen Tizian als leuchtendes Beispiel vor. Zwölf Jahre war der tapfere Junge aus Pieve di Cadore gewesen, als er nach Venedig ging, um in der Werkstatt von Giovanni Bellini Heilige und Dogen zu malen. Mit vierzehn war Rembrandt van Rijn bei Jacob van Swanenburgh in die Lehre gekommen, Jan Lievens war sogar erst acht Jahre alt, als er der Schüler Joris van Schootens wurde. Wie fühlte es sich wohl an, wenn ein Leben so früh schon festlag, ohne eine Möglichkeit zu entkommen? Manchmal, wenn Peter seine Kinder auf dem Rücksitz betrachtete, überkam ihn leichte Wehmut. Dann sehnte er sich nach der Zeit, als es seine Familie noch nicht gab.
Nachdem sie den Parkplatz im Nationalpark Veluwezoom verlassen hatten, war Kee auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Die Jungs hatten den Laptop aufgeklappt und sich einen Film angesehen. Peter bohrte unbemerkt in der Nase und brauchte zwei Minuten dafür, seinen Zeigefinger von einem kleinen Schleimfaden zu befreien, der zuletzt völlig unbeabsichtigt auf der Windschutzscheibe landete.
Von der zuschlagenden Wagentür war Kee wach geworden. Sie richtete sich auf und schaute nach draußen, Richtung Tankstellenshop. Vor längerer Zeit hatte hier einmal ein Mann mit dem Lieferwagen zwei Fahrzeuge und eine Zapfsäule gerammt, was zu einer Explosion geführt hatte und einem Stau, der zwölf Kilometer Autobahn blockierte. Jetzt waren Würstchen im Schlafrock im Angebot.
Als Peter gerade den Tank zuschraubte, hatte Kee kurz entschlossen die Schuhe angezogen. »Ich geh noch schnell auf die Toilette«, hatte sie gesagt. Tristen und Ewan reagierten nicht, ganz im Bann des leuchtenden Bildschirms vor ihnen. »Hört ihr?«
Ihr Ältester gab ein genervtes »Ja-ha!« von sich.
Sie hatte jetzt keine Lust, lang rumzudiskutieren und zu fragen, was sie gerade gesagt hatte. Sie stieg aus, verschwand im Toilettenhäuschen neben der Tankstelle und leerte ihre Blase über einer brillenlosen Kloschüssel. Das Toilettenpapier war feucht. Auf die weiß beschichtete Spanplatte hatte jemand einen Schwanz gekritzelt – einfache Linien, unnatürliche Proportionen, so wie ein kleines Kind eine Blume malt.
Es war nicht zu fassen. Hatten ihre Männer sie wirklich vergessen? Sie starrte auf den Beschleunigungsstreifen, aber kein blauer Ford kam ihr von dort rückwärts entgegen. Mit hundert Stundenkilometern fuhr das Auto über die A 12 Richtung Rotterdam. Erlaubt waren hundertzwanzig, doch Peter fuhr nicht gerne schnell. Noch etwas, das er nicht gut konnte.
Kee holte tief Luft und hob vor einem heranfahrenden Auto die Hand. Sie war keine Frau, die in Panik geriet. Panik war von allen Emotionen die unergiebigste.
»Hallo«, sagte sie zu dem aussteigenden Fahrer.
»Hallo«, antwortete der erstaunt, vielleicht auch etwas erschrocken.
»Darf ich mir kurz Ihr Handy ausleihen?«, fragte sie und fügte sofort hinzu: »Mein Mann und die Kinder sind ohne mich weitergefahren.« Die beste Art, Peinlichkeit zu vermeiden, ist, ihr zuvorzukommen.
Einen Moment lang schien der Mann ihr nicht zu glauben, doch er entsperrte sein Handy und überreichte es ihr. Sie wählte ihre eigene Nummer und wartete auf den Klingelton am anderen Ende.
»Und?«, fragte der Mann, der inzwischen die Tankklappe geöffnet hatte, aber keine Anstalten machte, Benzin zu zapfen.
»Es geht niemand ran.«
»Ist es vielleicht auf stumm geschaltet?«
»Nein, sie hören es nicht.« Sie klang aufgebrachter, als sie eigentlich wollte.
»Einfach noch mal probieren.«
Das tat sie, doch wieder bekam sie nur ihre Mobilbox. Sie wollte das Handy schon auf den Boden schmeißen, doch gerade noch rechtzeitig fiel ihr ein, dass es nicht ihr eigenes war. Sie konnte Impulse sehr gut unterdrücken, besser jedenfalls als Peter und die Kinder.
»Wie unangenehm«, sagte der Mann.
»Ja.«
Kee schätzte ihn auf Mitte dreißig. Er trug ein tailliertes Jackett zu einer Jeans. IT-Fachmann, dachte sie. Oder Unternehmensberater. Nichts Interessantes jedenfalls.
»Aber schon komisch.«
»Was?«
Wollte der Mann damit andeuten, ihre Familie hätte sie mit Absicht hier stehen lassen? Er hatte bestimmt keine Kinder – und keinen Partner, der einmal mit Scheiße an der Brille zur Arbeit gefahren war. »Ist dir die Brille ins Klo gefallen?«, hatte sie Peter gefragt, als der von der Toilette zurückkam. Peter war es ein Rätsel, woher sie das wusste. Er hatte sein Geschäft gemacht und dann mit der Bürste die Schüssel geschrubbt, doch beim Vornüberbeugen war ihm die Brille hinuntergefallen. Ein brauner Fleck klebte an dem Glas, ein Fleck, der am Abend, als er von der Arbeit nach Hause kam, immer noch da war.
Beim dritten Versuch ging endlich jemand ran. Es war Ewan. »Ja?«, sagte er.
»Ihr habt mich vergessen!«, rief Kee. Sie wollte noch mehr rufen, aber sie hielt sich zurück. Der Mann sah sie an, als spiele sie in einem Film. Vielleicht wartete er auf Drama, auf Tränen.
»Papa – Mama am Telefon«, hörte sie Ewan sagen. Aber im Hintergrund hörte sie Peter: »Ich hab jetzt die Hände am Steuer!« Einen Moment lang gab es nur Rauschen, dann kam Tristen ans Handy. »Fuck«, sagte er nach einer Weile. »Fuck. Mama steht noch an der Tankstelle.«
Als sie das Gespräch beendet hatte, gab sie dem Mann das Handy zurück.
»Sie kommen.«
»Schön.«
»Ja.«
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Die Frage prallte an ihr ab. Es ging den Mann nichts an, wie sie sich fühlte. Oder versuchte er, sie von ihrer Aufregung herunterzubringen? Sah er, dass sie innerlich kochte? Mit Fragenstellen kann man Leute beruhigen, hatte sie in einem Artikel gelesen, den sie kürzlich illustriert hatte.
»Vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte sie schließlich.
»Kein Problem.«
Unaufhörlich raste der Verkehr an ihnen vorüber. Leute auf dem Weg nach Hause. Langsam wurde es richtig dunkel.
»Es ist das erste Mal«, sagte sie.
Sie fühlte sich genötigt, freundlich zu bleiben, das Gespräch am Laufen zu halten, doch sofort schämte sie sich für ihre Bemerkung. Deren Dämlichkeit. Natürlich war es das erste Mal, dass sie ohne ihre Familie an der A 12 stand. Schließlich stand sie nicht einmal jede Woche mutterseelenallein hier herum.
»Ist er im Stress?«
»Wer?«
»Ihr Mann.«
Versuchte der Typ immer noch, sie zu beruhigen? Das ging dann gründlich daneben.
»Wir alle vergessen ab und zu mal was«, sagte der Mann, als er endlich den Benzinschlauch packte. »Letzte Woche hab ich noch irgendwo meinen Regenschirm liegen lassen.«
Der Mann nervte sie, er nervte sie fürchterlich.
»Als ich aus dem Haus ging, hat es geregnet …«
»Ich bin kein Regenschirm«, sagte sie barsch. Sie war eine Frau, Ehefrau und Mutter. Vor allem anderen aber war Kee Hamelink eine erfolgreiche Illustratorin. Sie gestaltete Buchcover, arbeitete für Zeitungen und Zeitschriften und auch für die Werbung, aber das alles wollte sie dem Mann nicht erzählen. Sie wollte anonym bleiben. Eine Frau, die von ihrer Familie an der Tankstelle vergessen worden war, war schon mehr Information als genug.
Ein Hybrid-Toyota kam auf sie zu, stellte sich aber an eine andere Zapfsäule.
»Wie alt sind Ihre Kinder?«
Etwas Derartiges hatte sie noch nie erlebt. Warum fragte dieser Mann ständig weiter? Sah sie so aus, als hätte sie ein Bedürfnis zu plaudern? In der Kassenschlange im Supermarkt fragte nie jemand sie etwas. Auf dem Schulhof sprachen andere Eltern sie manchmal an, aber dann blieb es bei Höflichkeitsfloskeln. Sie war gesellig, aber nicht offen. Sie stammte aus einem kleinen Nest in Zeeuws-Vlaanderen, die Häuser und Bauernhöfe lagen dort weit auseinander. Ihre Jugend hatte aus Stille bestanden, unterbrochen vom Geräusch großer Traktoren und dem Läuten von Kirchenglocken.
Plötzlich wurde Kee klar, dass der Mann jetzt ihre Nummer hatte: War das gefährlich? Sollte sie von ihm verlangen, die Nummer zu löschen? Das war das Wagnis, wenn man jemanden um Hilfe bat: Der andere konnte das ausnutzen. Andererseits, dachte Kee, hatte sie jetzt auch seine. Das konnte sie genauso gut ausnutzen. Sie könnte ihm Nachrichten schicken, mitten in der Nacht anrufen, und, sobald er ranging, kreischen wie am Spieß
Was hatte der Mann sie gleich wieder gefragt? Wie alt ihre Kinder waren. Warum wollte er das wissen? Das genaue Alter war ziemlich egal, sie waren in einem schwierigen Alter, das war Kee wichtig: Sie bekamen Bauchschmerzen, wenn ihnen etwas gegen den Strich ging, und stöhnten im Schlaf bei der geringsten atmosphärischen Störung im Haus und in der Ehe der Eltern.
»Ziemlich jung«, sagte sie zu guter Letzt. Damit musste der Mann sich zufriedengeben.
Er drückte die Zapfpistole. Die Zahlen der Preisanzeige schnurrten drauflos. Warum stand sie noch hier?
Der Mann hatte ihr sein Telefon geliehen, sie hatte sich ordentlich bedankt. Jetzt konnte sie gehen.
»Ich heiße Paul.«
»Hallo, Paul«, sagte sie.
Musste sie ihm jetzt ihren eigenen Namen nennen? Gehörte das dazu? Paul hatte ihr geholfen, darum musste sie seine Fragen beantworten, ihm ihren Namen sagen. Das war der Preis. Uneigennützige Hilfe existierte nicht.
»Kee.«
»Hallo, Kee.«
Er schaute sie an. Nicht mehr wie eine Schauspielerin. Er schaute sie an, als könne man sich an sie heranmachen, als sei sie zu haben. Sie war eine Frau, deren Mann sie an der Tankstelle vergessen hatte. Einen Moment lang erwiderte sie seinen Blick. Wie eine Frau, die ihrem Mann etwas heimzahlen will. Sie konnte sehen, dass sie Paul damit verwirrte.
Sie war nicht zu haben. Sie war seit vierzehn Jahren verheiratet und konnte Impulse sehr gut unterdrücken. Aber trotzdem … Wenn sie das andere Geschlecht in Männer einteilte, mit denen sie es tun könnte, und solche, mit denen sie es nicht tun könnte, gehörte Paul eindeutig zur ersten Kategorie. Er war gut gebaut und hatte schönes, glänzendes Haar. Er war mindestens fünf Jahre jünger als sie. Ja, mit ihm könnte sie Sex haben. Aber er durfte keine Fragen stellen. Was sie mochte. Ob er sie an den Haaren ziehen dürfe. Ob sie gekommen war. Er musste die Klappe halten.
Sie sollte jetzt besser zu den Parkplätzen auf der anderen Seite der Tankstelle gehen und dort auf Peter und die Kinder warten. Doch das tat sie nicht. Sie versuchte, noch einmal verlockend zu blicken. Zu haben. Aber es klappte nicht. Der Moment war vorüber.
Ihr war kalt. Ihre Jacke lag im Auto, zusammen mit ihrem Handy. Auf einmal hatte sie schrecklichen Appetit auf ein Würstchen im Schlafrock.
Die Zahlen der Tankanzeige standen jetzt still. Paul drückte zweimal hintereinander die Zapfpistole, wie ein Cowboy. Genau siebzig Euro.
ZWEI
»Ich will das nicht«, sagte Peter. »Ich will nicht schon wieder zu den Rietvelds.«
Ihre neuen Nachbarn waren ziemlich ambitioniert. Kurz nach dem Umzug hatten sie die Lindkes »zu einem kleinen Mittagsimbiss« eingeladen. Danach waren sie bei ihnen zu Besuch gekommen. Peter dachte, damit wäre die Sache erledigt, aber zu seinem Schrecken hatten sie jetzt eine neue Einladung. Diesmal zu einem Abendessen am Sonntag.
»Hast du was gegen sie?«, fragte Kee.
»Es kommt mir so vor, als würden sie uns die ganze Zeit was vorspielen.«
»Was vorspielen?«
»Sie tun, als hätten sie unheimlich gerne Besuch, aber in Wahrheit finden sie es schrecklich.«
Er und Kee saßen auf dem Sofa.
Auf dem Teppich spielten die Jungen mit Lego.
»Sie wollen einfach ihre Möbel etwas mehr schonen«, erwiderte Kee.
»Hast du gemerkt, wie sie uns ansehen? Als wären wir eine tödliche Gefahr.«
Eine interessante Interpretation, fand Kee. Die Familie als Bedrohung.
»Es sind unsere Nachbarn!«
»Sie wohnen zwei Häuser weiter.«
Kee seufzte.
»Wir müssen absagen. Jetzt, solange es noch geht. Wenn wir Sonntagabend hingehen, müssen wir sie sonst wieder einladen.«
»Und – wäre das so schlimm?«
»Es wird noch viel schlimmer! Denn dann laden sie uns wieder ein, und wir müssen uns revanchieren. Und immer so weiter, und sie kochen immer aufwendiger, und wir müssen das auch tun.«
»Es ist kein Rüstungswettlauf.«
»Von wegen! Es fängt an mit belegten Broten und einem Glas Milch, und ehe du dichs versiehst, musst du ein veganes Vier-Gänge-Menü auf den Tisch zaubern.«
»Sie sind Vegetarier.«
»Ja, noch!«
»Worauf willst du hinaus?«
»Im Nullkommanichts haben wir hier eine Kommune. Dann musst du am Wochenende was mit ihnen unternehmen: zu einem Erntedankfest oder einem interkulturellen Gardening-Projekt gehen. Und nicht, weil dir das so viel Spaß macht, sondern weil du dazu verpflichtet bist, weil du ja einmal die Woche mit ihnen zusammen isst.«
»Und – bist du jetzt fertig?«
Nein, das war er noch lange nicht. »Danach schlagen sie vor, gemeinsam in Urlaub zu fahren. Campen an der Algarve. Zwei Zelte nebeneinander und jeden Abend billigen Wein aus dem Tetra Pak. Privatsphäre verboten! Du darfst kein Kreuzworträtsel lösen, kein Buch lesen, dir nicht den Schlafsack über den Kopf ziehen. Das geht nicht, denn dann werden der Nachbar und seine Frau mit der Eintönigkeit ihrer Beziehung konfrontiert und mit der Leere …«
»Jetzt ist aber gut!«
Ewan stand neben dem Sofa, in der Hand ein Raumschiff aus Lego. »Streitet ihr euch?«
Peter schüttelte den Kopf. »Nein, wir haben eine Diskussion.«
»Das ist keine Diskussion. So diskutiert man nicht.«
»Wie würdest du es denn nennen?«
»Ein absurdes Gespräch. Geradezu lächerlich.«
»Wir haben eine Meinungsverschiedenheit, und die tragen wir aus, mit Worten, ohne uns mit dem Messer zu massakrieren. Das nenne ich ›diskutieren‹.«
»Aber wir diskutieren nicht!«
»Wollen wir jetzt darüber diskutieren, ob wir eine Diskussion haben oder nicht?«
»Wir haben keine Diskussion.«
Peter packte die Zeitung und schlug sie auf. »Da spiel ich nicht mehr mit!«
»Streitet ihr euch jetzt doch?«, fragte Ewan.
Keiner von beiden antwortete.
»Ich glaub schon«, sagte Tristen. Er hatte die Legosteine beiseitegelegt. Peter versteckte sich hinter der Zeitung, doch Kee war den Blicken der Kinder hilflos ausgesetzt. Als sie kleiner waren, hatte sie noch versucht, es ihnen zu erklären: »Genauso wie ihr haben auch wir ab und zu Streit.« Aber das ließ sich nicht vergleichen, bei ihnen war es etwas ganz anderes: Nichts war schlimmer als streitende Eltern.
»Tschuldigung«, sagte Kee leise.
»Macht nichts«, sagte Peter, der glaubte, sie meine ihn. Er ließ die Zeitung sinken. »Es geht mir auch nicht um das Essen. Ich hab einfach keine Lust, geschlagene drei Stunden mit Gutmenschen von Mitte dreißig herumzusitzen.«
Kee empfand das genauso. Doch nicht das Theaterspielen der Nachbarn bereitete ihr Sorgen, vielmehr das von Peter und ihr.
»Mit ein bisschen Glück dauert es diesmal nicht so lange«, sagte sie. »Die Kinder müssen am nächsten Tag in die Schule, da wird es nicht spät.«
»Wetten, dass wir erst um halb neun wieder nach Haus dürfen?«
»Dürfen wir so lange aufbleiben?«, fragte Tristen, der etwas vom Gespräch mitbekommen hatte. Er versuchte, zwei Legosteine auseinanderzubekommen.
»Fett!«, jubelte Ewan. »Wir dürfen später ins Bett!«
An seiner Hand setzte das Raumschiff sich in Bewegung und schwebte durchs Wohnzimmer. Als würde es durch ein Vakuum gleiten, einen Raum ohne Unverständnis, ohne Schmerz, ohne Wut, angetrieben nur von einem Hauch Fantasie und einer Hand, klein wie ein Seestern.
Der Sonntag kam. Es regnete fast ununterbrochen. Am Abend waren überall auf der Straße riesige, dunkle Pfützen. Tristen hielt einen Strauß Sternanemonen in der Hand. Er hatte die Schlacht gewonnen und durfte den Nachbarn die Blumen überreichen, er, und nicht Ewan.
Anna, die ältere der beiden Töchter, öffnete die Tür, ihre jüngere Schwester im Schlepptau. Mädchen mit zerzausten, blonden Haaren.
»Hallo, Kitty«, sagte Peter zu der Jüngeren.
»Sie heißt Rosa«, berichtigte Anna.
»Oh, ich dachte, sie heißt Kitty.«
»Nein, so heißt unser Spielzeug.«
Kee schüttelte den Kopf.
Aus dem Wohnzimmer näherte sich das Ticken von hohen Absätzen. »Zieht ihr bitte die Schuhe aus?«
»Hallo, Ellen«, sagte Peter.
Die Jungs streiften sich die Turnschuhe von den Füßen und rannten an ihnen vorbei.
»Sollen wir auch unsere Schuhe ausziehen?«
»Bei Regen tun wir das immer.«
Nachdem Peter dem Kommando gefolgt war, bekam er drei Küsse.
Er ging ins offene Wohnzimmer, um Edward zu begrüßen. Ellens Ehemann stand an der Kochinsel. Die Anrichte war aus mattgrauem Granit. Bei ihrem letzten Besuch hatte Edward lang und breit darüber referiert: Teures deutsches Design, aber Fettflecken drangen im Nu in die poröse Oberfläche. Die gesamte Inneneinrichtung wirkte wie aus einem hippen Einrichtungsmagazin: grünes Sofa, umhäkelter Sitzpuff und ein Schubladenschränkchen aus bunt glasiertem Ton. Gebrauchsgegenstände, aber völlig ungeeignet für Kinder, zumindest für tobende Jungs. Zu Hause hatte Peter Kee vorgeschlagen, ihre Kinder diesmal an die Leine zu nehmen, aber sie hatte nicht darauf reagiert.
Er stützte sich auf die Anrichte, bemerkte aber sofort, wie Edward auf seine Hand starrte. Beim letzten Mal hatte er Peter so nervös gemacht, dass der für heute eine Frage einstudiert hatte: »Und – wie läuft’s so in eurer Beziehung, zwischen dir und der Anrichte?«
Edward bekam die Frage nicht mit. »Bierchen oder lieber einen Wein?«, fragte er, den Kopf halb im Kühlschrank. »Ich hab da was Feines aus Südafrika, ein edles Tröpfchen.«
Die Anrichte war leer und blitzsauber – ein Operationstisch. Es musste noch gekocht werden. Das würde ein langer Abend.
Edward schenkte Peter und sich einen Schluck ein. »Blumen«, deklamierte er mit der Nase im Glas, »und ein Hauch heller Früchte.«
Peter versuchte, den Blumenduft wahrzunehmen, aber er roch nichts Besonderes. Für ihn roch jeder Weißwein mehr oder weniger gleich, Rotwein übrigens auch. Eine Gruppe professioneller Weinkenner hatte einmal blind französische Spitzenweine verkostet: Grand Crus, außergewöhnliche Jahrgänge. Man hatte ihnen erzählt, es handle sich um Rotwein, doch in den Gläsern befand sich lediglich weißer. Keiner der sogenannten Experten hatte etwas gemerkt.
Peter beschloss, seine Frage noch einmal zu stellen, wurde aber diesmal von den Frauen übertönt, die ebenfalls Wein wollten. Im nächsten Moment saßen sie am Tisch und prosteten sich zu.
»Auf nette Nachbarn«, sagte Ellen.
»Und noch viele gemeinsame Runden«, sagte Kee.
»Wie lange wohnen wir jetzt eigentlich hier?«
»Anderthalb Monate. Ihr wart ein paar Tage früher als wir.«
»Herrje, wie die Zeit vergeht!«
»Und – wie gefällt’s euch bisher so?«
»Wir sind noch dabei, die Gegend zu erkunden«, erklärte Edward. »Es ist herrlich, im Wald hier in der Nähe spazieren zu gehen. Da gibt es einen Streichelzoo, und in einem Laden bei den Mühlen am See haben wir Zimt gekauft.«
Er war Brandschutzberater für petrochemische Unternehmen. Peter hatte geschwiegen, als Edward ihm seinen Beruf genannt hatte. Was sollte man zu so jemandem sagen? Welche Frage würde keine langweilige Antwort provozieren? Ellen hatte einen interessanteren Beruf: Sie war Chirurgin in einer Universitätsklinik, Spezialgebiet: Brustrekonstruktion. Bei ihrem ersten Treffen hatte sie Peter von Operationsfäden erzählt, die dünner waren als ein Menschenhaar. Während sie Wasser einschenkte oder einen belegten Kräcker zum Mund führte, hatte Peter ihre Hände betrachtet. Kein Zögern, kein Zittern. So stellte er sich die Hand eines altholländischen Meisters vor – tadellos sicher, perfekte Pinselstriche.
»Ich hab ein tolles Yogastudio in der Nähe entdeckt«, sagte Ellen zu Kee. »Du musst unbedingt mal mitkommen.«
»Ich hab noch nie Yoga gemacht.«
»Eine Probestunde ist gratis. Wollen wir jetzt gleich was ausmachen?« Ellen zückte ihr Handy.
Peter warf einen Blick auf seine Frau, die in der Tasche nach ihrem Telefon kramte. Erst ein »kleiner Mittagsimbiss«, dachte er, dann ein Abendessen, danach Yoga und Campingurlaub. Und zu guter Letzt dann ein Mord.
»Ich jogge zweimal die Woche«, sagte Edward.
»Schön«, sagte Peter.
»Magst du mal mitlaufen?«
Er wurde von den Kindern gerettet. Aus dem ersten Stock ertönte lautes Kreischen.
»Oje«, sagte Edward. »Eins von den Mädchen weint.«
Ellen stand auf und ging nach oben. Kurz darauf kam sie mit Rosa auf dem Arm zurück. Die schluchzte. »Sie haben meine Puppe an die Wand geschmissen«, sagte sie wütend.
Es geht los, dachte Peter. Das Beste wäre jetzt aufstehen, Kinder unter den Arm, Schuhe anziehen und wegrennen.
»Jungs sind nun mal wilder als Mädchen«, erklärte Ellen ihrer Tochter. Es klang wie ein Plädoyer für frühzeitige Kastration.
Peter spürte, wie sich seine Schultern verkrampften, und er verfluchte sich selbst. Warum hatten sich Edward und Ellen ausgerechnet sie ausgesucht? Warum luden sie nicht jemand anderen ein? Nachbarn ohne Kinder, Leute, die sich auch in einer Wohnung mit Designermöbeln wohlfühlten. Möglicherweise hatte es mit ihren Berufen zu tun, seinem und Kees: Sie waren zwar nicht direkt Künstler, aber Kee war Illustratorin, und er arbeitete in einem Museum.
»Soll ich mal ein paar Takte mit den Jungs reden?«, fragte Kee. »Sie schlagen ja öfter mal über die Stränge, aber das hier geht natürlich nicht.«
»Anna ist da aber auch ganz gut drin«, erwiderte Edward. Er versuchte, höflich zu bleiben, aber man sah ihm an, dass er es absolut unmöglich fand, wenn Puppen an die Wand geschmissen wurden.
Kee stand auf. »Kommst du mit?«, fragte sie Rosa. Das Mädchen zögerte, ließ sich dann aber ihrer Mutter aus dem Arm nehmen.
Jetzt war Peter mit Edward und Ellen allein. Er hatte keine Lust, seine einstudierte Frage noch mal anzubringen. Stattdessen nahm er einen Schluck Wein. Am anderen Ende des Tischs tat Ellen dasselbe.
»So«, sagte Edward und schob seinen Stuhl zurück. »Dann werde ich mal loslegen.«
Für einen Moment dachte Peter, Ellen würde jetzt ebenfalls aufstehen. Dass die beiden ihn am Tisch allein lassen würden. Den Aussätzigen. Aber so schlimm kam es denn doch nicht. »Wusstest du«, fragte Ellen stattdessen, »dass Anna in der Schule schon eine beste Freundin hat?«
»Super«, erwiderte Peter, aber das war zu schnell.
»Sie heißt Heba. Ihre Eltern kommen aus Syrien und sind vor ein paar Jahren geflüchtet.«
»Echt super!«
Ellen guckte entsetzt. Peter erkannte, dass sein Timing komplett falsch war.
Edward, der anderen zum Glück nie zuhörte, sagte: »Ein herziges Mädchen mit einer großen Brille. Sehr höflich.« Er nahm eine Zwiebel und schnitt sie behutsam in winzige Stückchen. »Ihr Vater kam ganz verlegen zu mir und meinte, dass Heba kein Schweinefleisch essen darf, weil sie Muslima ist. Da habe ich erklärt, wir sind Vegetarier. War sofort alles in Butter.«
Wenn Kee jetzt mit am Tisch gesessen hätte, hätte sie gesagt, dass Peter das nie könnte, ein Gespräch führen und dabei Zwiebeln schneiden. Das würde ihn mindestens einen Finger kosten.
»Ein paarmal in der Woche spielen sie zusammen.«
»Rosa findet es auch schön, wenn Heba da ist.«
Peter betrachtete die zerkleinerte Zwiebel. Das Brett wurde sofort beiseitegeräumt, die Anrichte mit einem Lappen gewienert.
»In Spakenburg hätte Anna nie eine Freundin gefunden, die Heba heißt.»
Edward schüttelte den Kopf. »Das einzig Nichtholländische in Spakenburg ist der örtliche Chinese.«
»Mei Wah.«
»Wah Mei, oder?«
»Wir sind beide aus Spakenburg.«
Peter sagte nicht, dass er das wusste, weil sie es schon beim letzten Mal erzählt hatten. Er schwieg und lauschte der Geschichte ihrer Jugend. Beide hatten dieselbe Kleinstadtschule besucht. Edward auf seiner Puch, Ellen auf dem Fahrrad. Nachdem sie miteinander geknutscht hatten, durfte Ellen sich an seinem Arm festhalten, und zusammen sausten sie über den Radweg. Die jungen Liebenden waren immer zusammengeblieben.
Ellen war zum Studieren nach Rotterdam gekommen, und Edward war ihr gefolgt. Vor dem Haus hier hatten sie in einer Mietwohnung in Rotterdam-Blijdorp gewohnt, direkt neben dem Vroesenpark, wo Anna und Rosa laufen gelernt hatten. Sie hatten sich gefragt, ob die Stadt ein geeigneter Ort sei, Kinder aufwachsen zu lassen, aber nach Spakenburg wollten sie nicht mehr zurück. Sie hatten sich an das urbane Leben gewöhnt und liebten die kleinen Bars und Restaurants, die großen Plätze und Einkaufsstraßen, die Wege am Wasser, wo Kinder neben ihren joggenden Eltern Roller fahren konnten. Als sich die Gelegenheit ergab, eine Neubauwohnung zu kaufen, hatten sie sofort zugegriffen.
Ihre Reihenhauswohnungen befanden sich an einem Ort, wo vor noch nicht so langer Zeit einige mehrstöckige graue Mietshäuser gestanden hatten. An deren Stelle waren fünfundzwanzig Einfamilienhäuser gekommen, mit Pocketgarten und eigenem Parkplatz auf einem abgeschlossenen Innenhof. Nicht alle Mietwohnungen waren abgerissen worden, einige hatte man auch verschont. So war ein Mix aus Alt und Neu, Wohnen zur Miete und Wohnen im Eigentum entstanden. In Edwards Worten: »Kopftuchmädchen und Bakfiets-Muttis.« Er sagte das, ohne rassistisch zu sein. Wie seine Frau war er offen und tolerant. Das galt für jeden, der sich in diesem Neubauprojekt niedergelassen hatte. Leute, die nur bio einkauften, auf dem Fahrrad zur Arbeit fuhren und am Wochenende in die Natur zogen.
Sie waren nicht dabei gewesen, doch als vor einigen Jahren die ersten alten Mietshäuser abgerissen worden waren, der Schutt abtransportiert war und der erste Pfahl für das erste Reihenhaus in den Boden gerammt wurde, hatte der verantwortliche Stadtdezernent Worte der Hoffnung gesprochen: Die Stadt brauche mehr starke Schultern, sagte er zu der Handvoll Leute, die auf der sandigen Baustelle standen. »Der Wohnungsmarkt ist aus dem Gleichgewicht. Das Angebot entspricht nicht mehr der Nachfrage. Es gibt zu viele billige Wohnungen und zu wenige für mittlere und höhere Einkommen. Dieses Neubauprojekt schafft einen Ausgleich. Es sorgt dafür, dass gut ausgebildete Familien, Familien mit breiten Schultern, in Rotterdam bleiben. Es sorgt für ein besseres Viertel, für eine bessere Stadt.«
Die Pfähle wurden gerammt, die Wände hochgezogen, die Fenster eingebaut. Hunderte von Händen verputzten, strichen, fugten und kitteten. Dann kamen die Umzugswagen, die neuen Bewohner, die Kinder, die Haustiere (sechs Hunde, zehn Katzen, vier Kaninchen und dreizehn Stabheuschrecken). Niemand fragte sich, wo die früheren Bewohner geblieben waren. Hatte man die auf andere Viertel verteilt? Wohnten sie jetzt irgendwo im Umland? Waren jetzt die Gemeinden dort für ihre Probleme zuständig?
Die Alteingesessenen, deren Strom- und Wasserleitungen nicht aus den Wänden gerissen, deren Treppenhäuser nicht demoliert und deren Kloschüsseln nicht zertrümmert worden waren, betrachteten die neuen Nachbarn mit ihren starken Schultern wie einen fremden Volksstamm. Von jenseits des Horizonts waren sie gekommen und nahmen alles in Beschlag: ihre Parkbänke, ihre Straßen und Plätze. Eindringlinge waren es, und für manche auch Feinde. Bessergestellte, die sie spüren ließen, dass sie arm waren, dass ihre Kinder weniger Chancen hatten. Zuvor war ihr Viertel nämlich sehr wohl im Gleichgewicht gewesen: Niemand hatte Geld oder größeres Eigentum, alle hatten Sorgen.
Jetzt war dieses Gleichgewicht gestört, zerstört durch Leute mit zwei Autos, mit Lastenfahrrädern, mit Waveboards, Skateboards und E-Boards, mit Badminton- und Tennisschlägern, Basketbällen und Fußbällen, mit Rollerskates, Wasserpistolen und Trampolinen, groß wie Teiche. Mit massenhaft Zeug, Zeug und noch mal Zeug.
Die Sonne war untergegangen, die blaue Stunde vorüber. Lampen und Bilder waren aufgehängt worden, gerahmte Fotos in den Wohnungen drapiert. Anderthalb Monate waren vergangen. Und hier saßen sie nun, zwei Neubewohnerfamilien mit starken Schultern beim Essen an einem Sonntagabend.
»Ich finde es ist ein echter Saustall draußen«, sagte Ellen. »Überall liegen leere Dosen und Chipstüten herum.«
»Samir und Yassin werfen alles auf die Straße«, bestätigte Tristen.
»Ich hab es auch gesehen, auf dem Ketelplein: Yassin hatte seine Cola ausgetrunken und hat die Flasche einfach auf den Boden geschmissen«, fügte Ewan hinzu.
»Das sind die Jungen von gegenüber aus den Mietwohnungen«, erklärte Kee. »Die wohnen da mit ihrer Mutter.«
»Gehen die auch auf die Kompass?«, fragte Ellen.
»Nein, die sind auf einer anderen Schule«, sagte Tristen. »Auf der Neue Welt, glaube ich.«
Das war die Schule, für die keines der Elternpaare aus den neuen Häusern sich entschieden hatte. Kee hatte sie sich immerhin angesehen, die Unterrichtsmethode auch interessant gefunden, mit viel Aufmerksamkeit für Bewegung, Technik und Kultur. Aber die Schule war komplett mit Migrantenkindern besetzt. Wie offen und tolerant der neue Volksstamm auch war, wie nobel seine Ideale, so eine Schule kam für niemand von ihnen infrage.
Die Kompass-Schule war lange Zeit eine Schule für Kinder fast ausschließlich nichteuropäischer Herkunft gewesen, aber vor einigen Jahren hatte ein Umschwung stattgefunden. Eltern von Kindern, die bei der Platzverlosung für die beliebten – überwiegend weißen – Grundschulen kein Glück gehabt hatten, hatten ihren Sohn oder ihre Tochter dort angemeldet. Es gab dort noch längst kein ausgeglichenes Verhältnis, aber, so hatte man in der WhatsApp-Gruppe »Welche Grundschule für mein Kind?« besprochen, die neuen Bewohner könnten der Kompass einen Schubs in die richtige Richtung geben. Darum – und auch, weil es sich um eine christlich-protestantische Schule handelte – hatten die meisten Neubewohner sich für die Kompass entschieden.
Peter war ein digitaler Analphabet und benutzte schon sein Handy so selten wie möglich, aber er wusste, wie man eine WhatsApp-Gruppe schnellstmöglich verließ.
»Sind das die Bengel, die neulich das Fahrrad geklaut haben?«, fragte Edward.
»Nein, das waren andere«, antwortete Kee. »Und die haben das Fahrrad am Abend zurückgegeben.«
»Ja, nachdem ein paar Eltern auf dem Ketelplein Krach geschlagen und mit der Polizei gedroht haben.«
In der WhatsApp-Gruppe »Nachbarn – allgemeine Angelegenheiten« war das sicher ausführlich diskutiert worden, aber deren Nachrichten hatte Peter auf stumm geschaltet.
»Ich frag mich, ob wir nicht was gegen den vielen Müll draußen unternehmen sollten«, sagte Ellen. »Das ist echt ein Problem. Ich sehe überall Ratten.«
»Das kommt von dem Essen, das auf die Straße gekippt wird. Ganze Brote, Töpfe voll Reis und anderes Zeug.«
Peter blickte starr auf seinen Teller. Sie waren beim Hauptgericht angekommen. »Sehr lecker«, sagte er. »Was ist das?« Doch niemand hatte Lust, das Thema zu wechseln, nicht mal die Kinder.
»Wer kippt denn einen Topf Reis auf die Straße?«, fragte Anna.
»Moslems«, sagte Ewan. »Die dürfen kein Essen wegwerfen, darum geben sie es Enten und Gänsen. Hat Mohsin mir erzählt.«
Peter hatte Knollensellerie entdeckt, aber es konnten auch Kartoffelwürfelchen sein.
»Mohsin ist bei Ewan in der Klasse«, erklärte Kee.
»Er spielt Fußball und will später zu Real Madrid.«
»Sind seine Eltern auch Geflüchtete?«
»Nein, sie stammen aus Marokko.«
An Peters Gabel hing ein Stück Gemüse: weiß, fast durchsichtig. Er führte es zum Mund. »Interessant«, sagte er nach einer Weile.
»Samir und Yassin werfen auch Steine nach den Enten«, erzählte Tristen, der sich alle Mühe gab, das Gemüse aufzuessen. Sein kleiner Bruder schob es auf dem Teller hin und her, nahm aber keinen Bissen.
»Wir müssen ein Vorbild sein«, erklärte Ellen. »Wir müssen ihnen zeigen, dass man Plastikflaschen auch in den Mülleimer werfen kann.«
»Wir dürfen aber keine Cola.«
»Wir auch nicht«, erwiderte Anna.
»Das ist schwarzer Winterrettich«, sagte Edward zu Peter, der behutsam auf seinem Mundinhalt kaute. »Ein Knollengewächs. Man kann ihn auch roh essen.«
»Schwarzer Winterrettich?«
»Kennst du das nicht?«
War schwarzer Winterrettich ein besseres Gesprächsthema als Kinder nichteuropäischer Herkunft, die Plastikflaschen auf den Boden schmeißen? Peter grübelte, bekam aber keine Gelegenheit, sich zu entscheiden.
»Mir schmeckt das nicht, das ist echt widerlich«, sagte Ewan.
»Du musst deinen Teller leer essen«, erwiderte Tristen.
»Halt die Klappe.«
»Soll ich dich füttern?« Tristen hielt seinem Bruder eine Gabel Winterrettich an den Mund.
»Bleib mir weg mit diesem ekligen Zeug.«
Die goldigen Töchter saßen natürlich brav auf ihren Stühlen. Anna pikte mit der Gabel ein Stück Kartoffel auf. Sie war ein gutes Vorbild.
Peter und Kee sahen einander an. Wie sollten sie ihre Söhne bändigen? Wer von ihnen sollte jetzt eingreifen?
Da geschah, was seit dem ersten Essen bei den Rietvelds wie ein Damoklesschwert über ihnen geschwebt hatte: Mit der Folgsamkeit der Jungs war es vorbei. Ewan verpasste seinem Bruder eine Kopfnuss, und Tristen schlug zurück. Der Schlag ging daneben, traf aber Edwards Weinglas, der deswegen so plötzlich zurückwich, dass er mit dem Stuhl an die weiße Wand hinter ihm knallte.
Peters Blick ging zu dem Rinnsal, mit dem der Wein auf den Boden tropfte, dann weiter zu Edward, der blitzschnell einen Lappen gepackt hatte, erst den Tisch abtupfte, dann auf den Knien den polierten Betonboden trocken wischte und sich dann wieder hinsetzte, als sei nichts geschehen. Als kämpfe er nicht gegen einen Nervenzusammenbruch.
»Hinter dir«, sagte Ellen, als stünde dort eine gefährliche Bestie.
»Was?«
»Hinter dir. Die Wand.«
Kann man bei Nachbarn Heimweh nach seinem Zuhause bekommen?, fragte sich Peter. Oder ist das dann kein Heimweh, sondern eine soziale Behinderung?
Edward drehte sich um und inspizierte die Delle in der frisch verputzten Wand. Das kriegte kein Lappen mehr hin.
Jetzt musste wirklich ein anderes Thema aufs Tapet kommen. Peter suchte Kees Blick, aber sie schaute nicht zurück. Er kannte diesen Blick. Sie verschloss sich vor ihm, vor ihrer gesamten Umgebung.
»Er hat mich an der Tankstelle stehen gelassen.«
Edward murmelte etwas Unverständliches, aber das war nicht mehr wichtig.
Ellen starrte Kee an. Alle starrten auf Kee, auch die Kinder.
»An der A 12«, erklärte sie, »an einer Texaco-Tankstelle. Peter ist ohne mich weitergefahren.«
Er kicherte. Sie meinte es witzig, als Ablenkung, da war er sich sicher.
»Und ich stand da, ohne Jacke, ohne Geld, ohne Handy.«
»Ich hab sie nicht stehen gelassen«, sagte Peter. Er sprach ganz ruhig, er wollte nicht defensiv klingen. Es gab nichts, wofür er sich verteidigen musste. »Wir hatten nicht gemerkt, dass sie ausgestiegen war, um auf die Toilette zu gehen. Die Jungs auch nicht. Ich hab drinnen bezahlt, bin wieder eingestiegen und losgefahren.«
»Ohne mich.«
Peter schaute zu seinen Söhnen, aber die fühlten sich nicht angesprochen.
»Ich stand neben der Zapfsäule, und sie fuhren über die Autobahn.« Eine Träne kullerte Kee über die Wange.
Für so was war es noch zu früh, dachte Peter. Es war erst die dritte Verabredung mit den Rietvelds. Konnten sie sich das nicht für den Campingurlaub an der Algarve aufheben, wenn sie am Feuer mal zu viel getrunken hätten und die Kinder im Zelt lägen?
Ellen hatte Kee die Hand auf die Schulter gelegt.
»Die Jungs haben sich einen Film angesehen, und ich …«, sagte Peter, »ich war aufs Fahren konzentriert.« Er versuchte zu lächeln, zu retten, was noch zu retten war. Das war nicht viel. Vielleicht nur ein Bild: das Bild, das die anderen von ihnen hatten, von ihrer Familie.
Doch Kee hatte keine Lust mehr, Theater zu spielen. »Er hat mich vergessen wie einen Regenschirm.«
»Grundgütiger!«, sagte Edward.
»Ich war in Gedanken versunken, ich hab an meine Arbeit gedacht.«
Ellen schien zu niesen, aber es war Empörung.
»Es ist sehr stressig momentan«, sagte Peter. Jetzt verteidigte er sich doch. Er saß auf der Anklagebank. »Ich dachte an ein Gemälde von Rembrandt. Oder eigentlich ist es überhaupt nicht von Rembrandt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.«
Edward blickte ihn scharf an. Es war offensichtlich, dass er ihm nicht glaubte. Wie kann man seine Frau vergessen? Man ließ seine Frau an der Tankstelle stehen, wenn man sie nicht mehr ertragen konnte. Wenn man sie hasste.
»Und als ich angerufen habe, ist er nicht rangegangen.«
»Grundgütiger!«, entfuhr es Edward noch einmal.
Das Leben war eine Kettenreaktion. Kinder gerieten aneinander, worauf ihren Eltern das Gleiche passierte. Oder war es umgekehrt? Verhielten sich Kinder unmöglich, weil ihre Eltern sich in einem fort stritten?
»Sie hat uns auf ihrem Handy angerufen«, sagte Peter. »Meins hat einen ganz anderen Klingelton.« Doch egal, was er jetzt vorbrachte, es war vergebens. Er glaubte selbst nicht mehr an seine Worte. Sein Lächeln war verschwunden. Er war müde. Es war Sonntagabend, und er hatte schon jetzt keine Energie mehr für die Woche. Die Termine, die Besprechungen, die Mails, die er beantworten musste.
Die beiden Mädchen saßen immer noch still auf ihrem Stuhl. Waren sie so friedlich, weil ihre Eltern sich lieb hatten und einander stets unterstützten?
Peter fragte sich, wie oft Edward und Ellen wohl Sex hatten. Bestimmt öfter als er und Kee, viel öfter. Kee und er waren Pandas. Sie machten es zweimal pro Jahr. Aber auch das war eher ein Thema für am Lagerfeuer. Bei Holzscheiten, die in den frühen Morgenstunden nachglühten.
Edwards Blick hielt Peter noch immer gefangen. Aggressiv. Er schaute ihn an, als wollte er ihn entlarven, den Betrüger, den Lügner.
Niemand sagte etwas, niemandem kam eine Idee.
»Die Anrichte«, sagte Peter da plötzlich zu Edward, als fiele es ihm gerade erst ein. »Wie steht’s mit deiner Beziehung zu der? Läuft es jetzt besser?«
Alle blickten zur Anrichte, auf den grauen Granit deutscher Herstellung, alle, bis auf Peters Frau. Die schaute mit Tränen in den Augen zu ihrem Mann.
DREI
Es gibt Paare, bei denen fantasiert ein Partner darüber, den anderen umzubringen. Es gibt Paare, die sich unausgesetzt streiten. Es gibt auch welche, die fast nicht mehr miteinander sprechen, einander mit tagelangem Schweigen bestrafen. Es gibt Paare, bei denen der Mann zwanghaft anderen Frauen hinterhersieht oder bei denen die Frau gern die Aufmerksamkeit anderer Männer erregt. Es gibt Ehepaare, die haben nur einander. Bei manchen pflegt der eine massenhaft Freundschaften und der andere hat niemanden. Bei anderen Paaren wird der Mann in Gesellschaft seiner Frau ein langweiliger Tropf. Bei wieder anderen verliert die Frau schon nach einem Jahr Ehe ihr Strahlen. Es gibt Paare, die einander nicht mehr küssen, nicht mehr berühren und sich auch nicht mehr ansehen. Es gibt andere, bei denen die Frau dem Mann ihren Körper verweigert. Bei manchen Paaren bekommt nur der Mann einen Orgasmus. Bei anderen weiß der eine genau, dass der andere fremdgeht. Es gibt Paare, die bleiben wegen der gemeinsamen Wohnung zusammen. Andere tun das wegen der Nachbarn. Es gibt Ehepaare, bei denen die Frau immer ein paar Meter vorausgeht, so wie es auch welche gibt, bei denen der Mann seiner Frau nie die Türe aufhält. Es gibt Paare, die wachsen langsam auseinander, wie ein gespaltener Baum. Es gibt Paare, die nicht zusammenpassen. Es gibt Paare, die sich nie hätten kennenlernen dürfen.
Vor einigen Jahren hatten Peter und Kee eine Paartherapie gemacht. Ewan war damals vier, Tristen zwei Jahre älter. Zu der Zeit verspürte Peter immer weniger Lust, nach der Arbeit nach Hause zu kommen. Jeden Tag graute ihm mehr davor. Manchmal blieb er einfach länger im Museum, oder er trat auf dem Heimweg so langsam wie möglich in die Pedale. Ein Schneck auf dem Fahrrad, aber zuletzt kam er doch immer wieder nach Hause. Ihm fiel einfach nichts ein, wo er sonst hätte hinsollen. In die Kneipe? Zu einem Freund? Hatte er überhaupt welche?
Eines Tages hatte er an einer Bushaltestelle angehalten und sich in das Wartehäuschen gesetzt. Er hatte die vorbeifahrenden Autos beobachtet und sich mit den wartenden Menschen verbunden gefühlt, aber als der Bus kam und alle einstiegen, war das Gefühl der Verbundenheit mit einem Mal weg. Er hatte noch zwei Busse davonfahren lassen.
Zu Hause saß Kee mit den Kindern am Tisch. Die Jungs hatten ihr Fleisch schon gegessen und starrten auf die Kartoffeln auf ihrem Teller. Sein Essen war kalt. Zuerst war es still. Dann fragte Kee, warum er so spät komme. Peter antwortete nicht.
»Ich hab dich was gefragt.«
»Ich hab an einer Bushaltestelle gesessen.«
Kee legte ihre Gabel neben den Teller. »Hattest du einen Platten?«
»Nein, ich hab da einfach gesessen.«
Sie hatte eine Maschine Wäsche durchlaufen lassen, sie hatte mit den Kindern gebastelt, sie hatte eingekauft, sie hatte gekocht.
»Ich hatte keine Lust, nach Hause zu kommen«, erklärte er. Er wollte nicht lügen, er hatte keine Kraft mehr für Lügen.
Er hatte erwartet, dass Kee wütend werden würde, und es hatte auch sie selbst erstaunt, dass sie das nicht wurde. Für einen Moment, bevor sie in Tränen ausbrach, sah sie alles ganz deutlich: die Flecken auf der Tischdecke, die Teller, die kalten Kartoffeln, ihren Mann, ihre Kinder. Sie wollte nicht hier sein. Sie hatte auch keine Lust mehr.