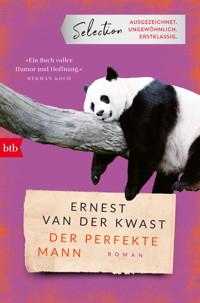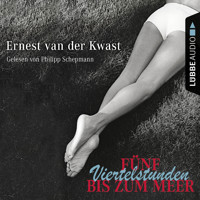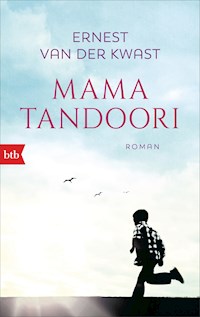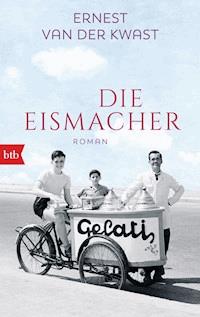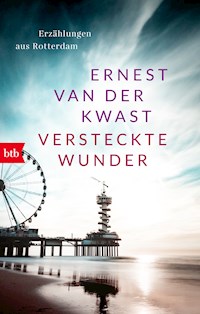
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diese Stadt birgt Tausende verborgene Geschichten.«
Vom Fensterputzer des größten Gebäudes der Niederlande, der drei Monate älter ist, wenn das letzte Fenster geputzt wird und dann wieder anfängt, bis hin zur Poletänzerin in einem Nachtclub, die den Autor bei ihrem Auftritt ansieht, wie es noch keine Frau getan hat. Er stellt dem Leser Menschen vor, die man nicht kennt, die einen aber umso mehr verzaubern: einen Taxifahrer mit Tourette-Syndrom; einen Feuerspucker, der es mit einem Panzer aufnimmt; einen Pianisten, der zwischen gebrauchten Waschmaschinen und Staubsaugern Konzerte gibt. Ein Buch voller Menschlichkeit und wunderbarer Geschichten, die dazu anregen, besser hinzusehen und zuzuhören.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Vom Fensterputzer des höchsten Gebäudes der Niederlande, der drei Monate älter ist, wenn das letzte Fenster geputzt wird, und dann wieder anfängt, bis hin zur Poletänzerin in einem Nachtclub, die den Ernest van der Kwast bei ihrem Auftritt ansieht, wie es noch keine Frau getan hat. Er stellt dem Leser Menschen vor, die man nicht kennt, die einen aber umso mehr verzaubern: einen Taxifahrer mit Tourette-Syndrom; einen Koch, der sieben Kinder hat und nie zu schlafen scheint; einen Pianisten, der zwischen gebrauchten Waschmaschinen und Staubsaugern Konzerte gibt. Ein Buch voller Menschlichkeit und wunderbarer Geschichten, die dazu anregen, besser hinzusehen und zuzuhören und eine Liebeserklärung des Autors an seine Heimatstadt.
Zum Autor
ERNEST VAN DER KWAST wurde 1981 in Bombay geboren und ist halb indischer, halb niederländischer Herkunft. Seine Romane sind internationale Bestseller. In Deutschland erschienen bisher »Fünf Viertelstunden bis zum Meer«, »Die Eismacher« und »Mama Tandoori«. Ernest van der Kwast lebt mit seiner Familie in Rotterdam.
Ernest van der Kwast
VERSTECKTE WUNDER
Erzählungen aus RotterdamAus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Het wonder dat niet omvalt« bei De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Juli 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2016 by Ernest van der Kwast
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Frans Blok / EyeEm/Getty Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-22245-1V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Hammach Abderrahman (1. 1. 1961 – 16. 8. 2015)
DER PIANIST VON PIEKFEIN
Ich kenne die Geschichte nur vom Hörensagen. Ich war nicht dabei, habe nichts gesehen. Was ich schildere, ist mir so zu Ohren gekommen. An einem grauen Werktag wird im Gebrauchtwarenladen Piekfein im Mariniersweg ein altes Klavier angeliefert. Es ist ein schwarzes Pianino von der Firma Gerhald Adel. Niemand im Laden weiß, was das Instrument wert ist, ob Mechanik und Saiten noch in Ordnung sind. Doch der vierzigjährige Ako Taher geht zu dem Klavier, öffnet den Deckel, nimmt Ober- und Unterrahmen ab. Er entfernt überall den Staub, dann setzt er sich auf den Hocker und beginnt zu spielen. Zuerst bleibt dem Filialleiter der Mund offen stehen, die Münder der übrigen Verkäufer folgen. Ako Taher arbeitet noch nicht lange bei Piekfein, er verdankt seine Stelle einem Reintegrationsprojekt der städtischen Abfallentsorgungs- und Grünflächenbetriebe. Vier Jahre lang hat er in einem »Service Team« gearbeitet. Harken, kehren, Unkraut jäten. Bis seine Hände kaputt und sein Wille gebrochen waren.
Einst hat Ako Taher am Konservatorium von Bagdad Klavier studiert und von einer Karriere als Konzertpianist geträumt. Doch dann bricht der Zweite Golfkrieg aus, und Ako Taher muss flüchten. Er fährt in einem Lastwagen, einem Bus, er reitet auf einem Pferd, er geht und geht und geht. Irgendwann ist er in den Niederlanden, in einem Asylbewerberzentrum in Rockanje. Dort steht ein Klavier, aber er darf nicht darauf spielen. Was er darf, ist schwere Arbeiten verrichten, für 25 Gulden in der Woche.
Jahre vergehen – zehn Jahre, um genau zu sein –, dann sitzt er endlich wieder an einem Klavier. Das Spielen fällt ihm schwer, alles ist blockiert. Er meldet sich am Rotterdamer Konservatorium an, doch zuerst muss er seine Schulden abzahlen. So landet er in dem »Service Team«, so gehen seine Hände kaputt, so wird sein Wille gebrochen.
Und so kommt er schließlich zu Piekfein. Der Mann, der zu Pferd vor dem Krieg geflohen ist, der die Straßen von Abfall gesäubert hat. Ich war nicht dabei, ich habe die Münder nicht offen stehen sehen. Ich habe die Musik nicht gehört. Debussy? Chopin? Oder war es Satie? Ako Taher verzaubert die Menschen. Er berührt etwas in ihnen. Der Pianist von Piekfein wird von Radio Rijnmond entdeckt. Die Zeitungen folgen. Kaffeekonzerte werden veranstaltet. Und nun spielt er, wie er es sich einst erträumt hat. Wenn auch nicht im Goldenen Musikvereinssaal in Wien, sondern zwischen Möbeln, Waschmaschinen und Staubsaugern. Langsam heilt eine Wunde.
SATTELBEZUG
»Hopp, hopp, rollen!« Die Frauen beginnen mit Froschsprüngen. Gesäß auf dem Sattel, Füße auf dem Boden. Tatjana Wechgelaar blickt ihnen nach. Sie ist bei der Stiftung Wilskracht Werkt – Willenskraft Wirkt – für die Radfahrschule zuständig. Ab der vierten Stunde dürfen die Frauen einen Fuß aufs linke oder rechte Pedal stellen, stoßen sich aber weiterhin mit dem anderen Fuß ab. »Auf das Gleichgewicht kommt es an«, erklärt die platinblonde Tatjana. »Treten kann jeder Trottel.«
Die Kursteilnehmerinnen sind fast alle ausländischer Herkunft. Frauen, die nie auf einem Fahrrad gesessen haben, die kaum das Haus verlassen und »den ganzen Tag Baklava futtern«, meint Tatjana. Sie bringt ihnen das Radfahren bei. Mit Froschsprüngen, Theorie und speziellen Tricks. Einige brauchen zwei Monate, andere ein Jahr.
Der Unterricht findet zweimal wöchentlich statt, in Rotterdam-Süd und -Nord. Er dauert jedes Mal zwei Stunden und fällt nie aus, auch nicht bei Regen oder Minustemperaturen. Aber Wetterbedingungen sind nicht das größte Hindernis. »Das ist der Sattel«, sagt Tatjana. »Bei fast allen Teilnehmerinnen schmerzt das Gesäß, und natürlich die edlen Teile«, flüstert sie. Das liegt teilweise an mangelnder Übung, bei manchen Schülerinnen aber auch am Übergewicht. Ein Sattelbezug mit Gelfüllung von Action schafft Abhilfe. Fast alle Frauen haben einen. Eine der Damen besitzt sogar drei, die sie übereinander auf den Sattel zieht. »Es tut ihr trotzdem noch weh«, sagt Tatjana, die ihre Schülerinnen gern »Küken« nennt – auch wenn sie hundertfünfzig Kilo wiegen.
Vor drei Jahren, nachdem ihr vorheriger Arbeitgeber sie für überflüssig erklärt hatte, hat sie bei Wilskracht Werkt angefangen. Es gab bereits ein Fahrradprojekt, das aber nicht besonders gut lief. »Ich dachte: Da klemm ich mich mal dahinter«, erzählt Tatjana. Und das hat sie getan. Im vergangenen Jahr hat sie nicht weniger als hundert Frauen das Radfahren in der Stadt beigebracht. Außerdem konnte sie das Sozialamt als Auftraggeber gewinnen. »Das Fahrrad vergrößert den Aktionsradius«, erklärt Tatjana, »und damit gleichzeitig die Chance auf eine Stelle, zum Beispiel in der häuslichen Pflege.« Deshalb übernimmt das Sozialamt die Kosten. Wer keine Sozialhilfe bezieht, zahlt zehn Euro pro Monat, »dafür bekommt man aber auch acht Doppelstunden«, sagt die Radlehrerin.
In der ganzen Stadt wirbt sie für ihren Kurs, klappert Läden, Moscheen und Metzgereien ab und legt ihre Faltprospekte aus, sogar in der Beschneidungsklinik für Jungen. Überall heißt man die blonde Radlehrerin herzlich willkommen. »In der Zwart Jansstraat kennt mich jeder«, sagt sie. Das ist die belebte Ladenstraße, durch die gegen Ende des Kurses alle fahren müssen, der Härtetest. Danach sind sie reif für die Prüfung, vor der manche Teilnehmerinnen schlaflose Nächte haben. »Aber alle bestehen«, sagt Tatjana stolz.
Das Zeugnis gibt den Frauen Selbstvertrauen und Mut. »Wir stellen fest, dass sie dann auch an anderen Kursen teilnehmen, eine Sprache erlernen oder den Umgang mit dem Computer.«
Ich frage, ob nie etwas passiert. »Ach, natürlich«, antwortet Tatjana. »Sie stoßen regelmäßig zusammen, oder es fällt mal wieder eine hin.« Sie beobachtet einen Moment ihre Küken, die gegen den Wind ankämpfen, mit wehenden Haaren oder Kopftüchern. »Es ist im Grunde eine Metapher für das Leben«, meint sie. »Hinfallen, sich aufraffen, weitermachen.« Sie hört die schrecklichsten Geschichten, von Frauen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind und alles zurücklassen mussten. »Sie sind unglaublich stark, manche haben sieben Kinder«, sagt Tatjana. »Sie mussten irgendein Fossil aus der Verwandtschaft heiraten, aber sie finden die Kraft, sich von ihm zu trennen und sich allmählich zu emanzipieren und Rad fahren zu lernen.«
Glücklicherweise wird auch viel gelacht. Für die meisten Frauen ist die Fahrradstunde eine Abwechslung. Sie bringen Gebäck mit und zeigen den anderen, wie in ihrem Land getanzt wird. »Manche sind sogar regelrecht niedergeschlagen, wenn sie bestanden haben.« Nicht ohne Grund wird die Lehrerin auf der Straße immer wieder stürmisch umarmt, von Frauen, die ihre Kinder nun mit dem Rad zur Schule bringen oder mit ihrem Mann an der Rotte entlang radeln können.
»Jeder kann es lernen«, sagt Tatjana. »Ob dick oder dünn, aus der Türkei oder Ghana, jung oder alt.« Im vergangenen Jahr hatte sie zum Beispiel eine vierundsechzigjährige Niederländerin in ihrer Gruppe, und seit Kurzem bringt sie einem kleinen Jungen mit Down-Syndrom das Radfahren bei. Inzwischen hat auch der erste Mann bei Tatjana die Radfahrprüfung bestanden.
Nicht alle haben genug Geld für ein Fahrrad, weshalb sie manchmal auch bei der Suche nach einem kostenlosen gebrauchten Rad hilft. Doch danach müssen sie allein in die weite Welt hinaus, die Küken von Tatjana Wechgelaar.
ENGEL MIT ZIGARETTE
Ich sitze mit Tineke Speksnijder in ’t Hof van Jericho in Kralingen. Ihre erste Handlung ist das Anzünden einer Zigarette. Der Barkeeper drückt beide Augen zu. »Auf den Tischen stehen zwar Aschenbecher, aber eigentlich ist es verboten.« Vielleicht ist es die Gunst der frühen Stunde, wir sind die ersten Gäste. Und unser Tisch steht am Fenster.
Eigentlich ist es verboten. Auch in De Schouw, wo Tineke schon seit über zehn Jahren Bardame ist – für mich die schönste der Stadt. Sie ist der Engel aus der Kurzgeschichte Arbeit in Jesus’ Sohn des amerikanischen Schriftstellers Denis Johnson: »Und wer machte da den Ausschank? Niemand anders als eine junge Frau, an deren Namen ich mich nicht erinnere. Aber ich weiß noch, wie sie ausschenkte; es war, als würde dein Geld sich verdoppeln […] und sie schenkte uns die himmlischsten Doppelten ein, die man sich denken kann, ganze Cocktailgläser voll bis zum Rand, und ließ fünfe gerade sein.«
Auch in De Schouw wird jedes Glas bis zum Rand gefüllt. Wer Rotwein trinken möchte, tut gut daran, kein weißes Hemd anzuziehen. Tineke Speksnijder ist vielleicht nicht mehr ganz jung, doch das spielt nach zwei Gläsern keine Rolle mehr. Und wo sieht man noch einen Engel mit Zigarette?
Hinter der Theke trinkt sie nicht. Und auf Flirtversuche von Gästen geht sie nicht ein. Trotzdem hat sie in der Kneipe viele Freunde gefunden. »Ich hab’s gern gemütlich«, sagt Tineke. »Deshalb bin ich Barfrau. Und deshalb bin ich gegen das Rauchverbot. Dann steht man da allein hinter dem Tresen, während alle draußen rauchen.«
Dort wird einfach geraucht, egal, wie viele Bußgelder verhängt werden. Immer ist die Kneipe völlig verqualmt, und in dieser Wolke versetzt der Engel Alt und Jung in einen Rausch aus Glück und Gemütlichkeit. In De Schouw ist niemand einsam.
»Ich werde dich nie vergessen«, schreibt Denis Johnson über seinen Engel. »Dein Mann wird dich mit einem Verlängerungskabel prügeln, und der Bus wird abfahren und dich stehen lassen, aufgelöst in Tränen; aber du warst meine Mutter.«
Ich hoffe, dass nie jemand Tineke auch nur ein Haar krümmen und dass der Bus sie immer mitnehmen wird. Was ich sagen will: Tausend Männer werden sie nie vergessen.
PLASTIKPOKALE
»Es gibt zwei Vorurteile über Menschen, die Singvögel halten«, erklärt Herman Chin A Fung. »Dass sie um Geld wetten und dass sie arbeitslos sind. Beides stimmt nicht.« Herman ist Vorsitzender des Surinamer Singvogelvereins De Euromast. Wir stehen an einem kalten Sommertag auf dem Parmentierplein in Rotterdam-Süd. Hier trainieren die Mitglieder des Vereins mit ihren Vögelchen, und hier werden Wettkämpfe abgehalten. »Ein weiteres Vorurteil ist«, sagt Herman, »dass es dabei um die Qualität des Gesangs geht.« Er schüttelt den Kopf. »Von einem Vogel, der zwei Minuten wunderbar singt und dann still ist, hat man nichts. Es geht darum, wie oft sie singen. Egal, wie falsch oder schrill.«
Heute werde ich die Singvögel des Vereins De Euromast nicht hören, denn es ist kalt und nieselt. Bei Temperaturen unter siebzehn Grad holt man sie nicht aus dem Wagen. »Wenn es in Surinam regnet«, sagt Herman, während wir unter einem kleinen Vordach stehen, »lassen wir die Vögel in ihren Käfigen einfach draußen.«
Surinam. Das Land der Singvögel. Fast jeder Haushalt besitzt einen. Viele Vögel werden auch in die Niederlande geschmuggelt. »Ich bin dagegen, aber das heißt nicht, dass ich noch nie einen geschmuggelten Vogel gekauft hätte«, gibt der Vorsitzende des Singvogelvereins ehrlich zu. Sein neuester Vogel stammt jedoch aus Brasilien, und den hat er selbst dort abgeholt. Einen Picolet. Kosten ohne das Flugticket: 450 Euro. Doch das darf seine Frau nicht wissen.
Zu Wettkämpfen fahren die Mitglieder nach Den Haag und Amsterdam, wo ebenfalls Singvogelvereine von Einwanderern aus Surinam aktiv sind. Wenn die Konkurrenten von De Euromast nach Rotterdam kommen, gibt es jedes Mal Streit über einen anderen Mast, den Sendemast, der auf dem Parmentierplein steht. Es ist der höchste frei stehende Sendemast der Niederlande, mehr als zweihundert Meter hoch. »Mitglieder von anderen Vereinen klagen, dass ihre Vögel durch diesen Mast gestresst würden«, berichtet Herman, »dabei geht kaum Strahlung davon aus. Unsere Vögel sind einfach besser.«
Bei Wettkämpfen gewinnt man kein Geld, sondern Pokale. »Sehr große Pokale«, betont Herman. »Wenn ein Surinamer zwischen einem kleinen goldenen Pokal und einem riesigen aus Plastik wählen kann, entscheidet er sich für den großen.« Einige der Mitglieder haben aber zum Leidwesen ihrer Frauen inzwischen schon um die achtzig Pokale gewonnen. »Deshalb gibt es manchmal auch ein Kilo Saatkörner oder leckeres Roti als Preis«, sagt Herman. Über die Saatkörner freuen sich die Frauen allerdings auch nicht. Die landen dann wieder auf dem Küchenboden oder werden im ganzen Wohnzimmer verteilt. Ein Vereinsmitglied sagt: »Wir haben es sehr schwer zu Hause.«
Es ist offensichtlich: Singvogelsport ist Männersache. Doch die Vögel selbst kommen ohne Frau nicht aus. »Schon einen Tag vor dem Wettkampf muss man sie aufgeilen«, erklärt Herman. Dafür wird das Weibchen in einem eigenen Käfig immer weiter von dem des Männchens entfernt. Die Devise »Kein Sex vor dem Wettkampf« wird sehr ernst genommen. Nur ist zu befürchten, dass sie auch für die Mitglieder des Singvogelvereins De Euromast gilt.
SCHÖNHEITSCHIRURG
Die vertikale Stadt ist da. 149 Meter hoch, 160 000 Quadratmeter Fläche, 7588 Räume und 60 000 Quadratmeter Fenster. Unterschiedliche Funktionen wurden miteinander kombiniert: Wohnen, Arbeiten, Erholung, Shopping – rund um die Uhr kann man sich in dem Gebäude aufhalten. Stefan Molenaar betritt es oft, fährt dann aber sofort mit dem Aufzug zur obersten Etage und steigt die Treppe zum Dach hinauf. Was ihn interessiert, ist die äußere Hülle, sind die 600 000 Quadratmeter Fenster. Er ist einer der Fensterputzer des Bauwerks mit Namen De Rotterdam, bezeichnet sich selbst jedoch lieber als Fassaden-Schönheitschirurg. Er reinigt die Fenster und kann auch gleich Reparaturen ausführen. Kratzer auf dem Glas, Dellen im Aluminium – Stefan Molenaar heilt die Wunden des Turms.
Irgendwann hat er bei einem Bekannten angefangen, der Fensterputzer war. Wie man es sich vorstellt, mit Leiter und Schwamm. Heute arbeitet er in einer Gondel, die an vier Stahlkabeln hängt, aber ein Schwamm ist immer noch dabei. »Und vier Eimer Wasser«, sagt Stefan. Damit machen er und ein Kollege eine Tour, das heißt, sie putzen einen vier Fenster breiten Streifen des oberen Abschnitts, 37 der 44 Stockwerke. »Für die gesamte Fassade brauchen wir drei Monate«, erklärt der Fensterputzer, »aber es ist ja auch das größte Gebäude der Niederlande.«
Der Verband Metallfenster und Fassaden empfiehlt, die Fenster drei- bis viermal jährlich reinigen zu lassen. Sobald das letzte Fenster von De Rotterdam geputzt wurde, kommt also das erste wieder an die Reihe. »Das ist eine Empfehlung«, meint Stefan. »Vielleicht ist man auch mit einmal jährlich zufrieden. Hier kommen Beamte rein«, fährt er lächelnd fort, »die würden sonst den ganzen Tag nur aus dem Fenster starren.«
Die Aussicht vom Dach ist überwältigend. Die Stadt als Luftaufnahme, als Raster von Straßen. Im Zentrum scheinen Hochhäuser die Wolken zu berühren, dahinter liegen die Wohnviertel und hier und da ein Büschelchen Grün oder ein Pfützchen Wasser. Schon als das Gebäude noch im Bau war, mussten im unteren Bereich Fenster geputzt werden. Damals hat Stefan sich noch abgeseilt wie ein Bergsteiger. »Bei schönem Wetter kann man Delft und Den Haag sehen, aber es macht auch Spaß, auf andere Türme runterzugucken«, sagt der Fensterputzer. Ich frage ihn, ob er manchmal etwas Besonderes sieht. Er antwortet, alles sei etwas Besonderes.
In Rotterdam gibt es ungefähr siebenhundert Fensterputzer, aber nur eine Handvoll arbeitet in solchen Höhen wie Stefan Molenaar. In einsamen Höhen, wo der Wind stärker ist als unten und die Gondel quietscht und pendelt. Wenn er das letzte Fenster geputzt hat, ist er drei Monate älter, und dann kann er von vorn anfangen. Ich finde das großartig. Sisyphos mit einem Schwamm, an einem senkrechten Abhang aus funkelndem Glas.
WIE ROSEN
Die Straße ist sein Arbeitsplatz. Doktor Mau hat keine Praxis und kein Wartezimmer. Drei Tage pro Woche findet man ihn draußen: Donnerstag, Freitag und Samstag. An den übrigen Tagen steht der Doktor in der Küche und bereitet neun verschiedene Sorten Sambal zu, insgesamt hundertsechzig Gläschen, die er dann im Fahrradanhänger durch die Stadt transportiert. Von einer Caféterrasse zur nächsten, von Platz zu Park. Überall dorthin, wo Menschen sind, genauer gesagt: wo Frauen sind. Doktor Mau hat eine Schwäche für Frauen. In seinen eigenen Worten: »Ich liebe ledige Frauen.« Aus dem Mund eines gewöhnlichen Doktors würde man das kaum hören, aber Doktor Mau ist ja auch Sambal-Doktor.
Zuerst hatte er versucht, die Stadt mit sauer eingelegten Limonen zu erobern. Es hat ihn beinahe umgebracht. Niemand wollte sauer eingelegte Limonen, niemand außer ihm selbst. Er aß sie dreimal täglich, bis der Vorrat aufgebraucht war. Danach kam er auf die Idee, Sambal zuzubereiten. Frohen Mutes fuhr er mit seinen Gläschen zum Markt auf der Binnenrotte, doch dort wollte man seine Lizenz sehen. Doktor Mau schüttelte den Kopf. Mit so etwas wie Lizenzen gibt er sich nicht ab. Er ist eine Märchengestalt. Wie seine Kolleginnen und Kollegen in den Wäldern – die Feen, die Zwerge, die Prinzessinnen in gläsernen Pantöffelchen – braucht er keine Papiere. Doch die uniformierten Männer blieben unerbittlich und verbannten den Doktor in die Problemviertel der Stadt. Nur wollte dort kein Mensch Sambal kaufen. In seiner Ratlosigkeit folgte Doktor Mau schließlich Männern aus Pakistan, die mit einem Strauß Rosen in der Hand durch die Stadt gingen. Von einer Caféterrasse zur nächsten. Er lernte von ihnen. Seitdem verkauft er Sambal wie Rosen.
Vor langer, langer, langer Zeit hieß Doktor Mau Maurice und war Security-Mitarbeiter. Ein dunkles Kapitel in seinem Leben. Ein Security-Mitarbeiter darf Frauen nicht ansprechen, es sei denn, sie wollen einen halben Kleiderständer mitgehen lassen. Sein heutiger Broterwerb ist für ihn ein Geschenk des Himmels. Auch was den Absatz betrifft. Gott sei Dank, denn hundertsechzig Gläschen Sambal zu essen, das würde auch der Doktor nicht überleben.
Fragt man Doktor Mau nach seinem Geheimnis, antwortet er: »Qualität.« Aber das sagt man auf der Binnenrotte auch. Deshalb lässt er die Leute kosten. So viel sie wollen. Pikanten Picalilly, Ketjap Sambal, Zwiebelsambal, Birambi-Chutney. Für jeden Topf findet sich ein Deckel. Und wenn sich jemand nicht entscheiden kann, sagt Doktor Mau: »Dann nehmen Sie doch alle.« Er lächelt, wie er die Frauen anlächelt. Er weiß: Für manchen Topf finden sich mehrere Deckel. Viele Deckel.
LINKES BEIN
»Ist das schön hier!«, dachte Paulo Nunes, als er 2009 zum ersten Mal den Spielplatz im Weena betrat, um dort zu arbeiten. Doch im nächsten Moment fragte er sich: »Wo sind die Kinder?« Paulo suchte und fand die Kinder auf den Plätzen des Stadtviertels. Sie lungerten auf Bänken herum, kippten Cola in sich hinein und machten Dummheiten. Der Sport- und Spielbetreuer ging zu ihnen, stellte sich vor und sagte, an welchen Tagen er auf dem Spielplatz im Weena zu finden sein würde.
Die Kinder kamen, und das Wunder ist, dass sie noch heute kommen. Paulo spielt Fußball mit ihnen, aber auch Basketball, Handball und Hockey, mit den Allerkleinsten Fangen und Verstecken. Im Winter gibt es außerdem eine Schlittschuhbahn. »Im Januar haben wir Schneemänner gebaut«, erzählt Paulo. Für die ganz Wilden, die mit Schneebällen werfen wollten, hat er aus Dosen eine Burg errichtet.