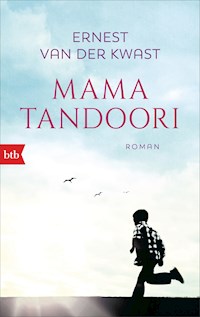5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Liebe auf der Zunge zergeht.
Im Norden Italiens, inmitten der malerischen Dolomiten, liegt das Tal der Eismacher, in dem sich die Einwohner auf die Herstellung von Speiseeis spezialisiert haben. Giuseppe Talamini behauptet gar, die Eiscreme wurde hier erfunden. Und er muss es wissen, schließlich haben sich die Talaminis seit fünf Generationen dieser Handwerkskunst verschrieben. Jedes Jahr im Frühling siedeln sie nach Rotterdam über, wo sie während der Sommermonate ein kleines Eiscafé betreiben. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt: zartschmelzendes Grappasorbet, sanftgrünes Pistazieneis, zimtfarbene Schokolade. Dennoch beschließt der ältere Sohn Giovanni, mit der Familientradition zu brechen, um sein Leben der Literatur zu widmen. Denn er liebt das Lesen so sehr wie das Eis. Bis ihn eines Tages sein Bruder aufsucht: Luca, der das Eiscafé übernommen hat, ist inzwischen mit Sophia verheiratet, in die beide Brüder einst unsterblich verliebt waren. Und er hat eine ungewöhnliche Bitte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ERNEST VAN DER KWAST wurde 1981 in Bombay geboren und ist halb indischer, halb niederländischer Herkunft. Mit seinem ersten Buch, Mama Tandoori, schrieb er sofort einen Bestseller. Der autobiografische Roman verkaufte sich in den Niederlanden und in Italien mehr als 100.000 Mal und wurde als Theaterstück adaptiert.
Auf Deutsch erschien bisher Fünf Viertelstunden bis zum Meer, ein herzerwärmender Roman, der auch hierzulande in der Presse gefeiert wurde und auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand.
Mit Die Eismacher gelang Ernest van der Kwast schließlich der absolute Durchbruch. Er ist einer der meistverkauften Romane in den Niederlanden und wird in zahlreiche Sprachen übersetzt. Van der Kwast lebte eine Zeit lang in Südtirol, inzwischen wieder in Rotterdam (und spricht übrigens fließend Deutsch).
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich freue mich, Sie in meinem Buch willkommen heißen zu dürfen, in der fröhlichen, ereignisreichen Geschichte der Familie Talamini. Einer Dynastie von Eismachern, die ihre Geheimnisse seit fünf Generationen an ihre Nachkommen weitergeben.
Die Idee zu diesem Buch entstand in den norditalienischen Alpen. Dorthin hatte ich mich 2003 zurückgezogen, um an meinem ersten Roman zuarbeiten und um mich vor meiner Mutter zu verstecken (aber das ist eine andere Geschichte). Es waren lange und auch ein wenig einsame Tage in einem kleinen Zimmer in Bozen. Ich hatte nur eine einzige italienische Telefonnummer aus den Niederlanden mitgebracht: die der Eismacher aus Rotterdam. Als ich ihnen von meinem Plan erzählte, in Südtirol zu schreiben, hatten sie gesagt, dass sie ganz in der Nähe überwinterten. Und dass ich unbedingt anrufen sollte, wenn ich einmal den Wunsch nach einer warmen Mahlzeit verspüren sollte. Schon nach vier Tagen rief ich an und bekam gleich erklärt, wie ich fahren musste. Mit dem Zug über Franzensfeste nach Toblach, wo Gustav Mahler drei Sommer lang inmitten von Wiesen voller Klee und Kuhglockengeläut Sinfonien komponiert hatte. Doch nun war Winter, die einzige Jahreszeit, zu der die Eismacher in Italien sind; auf den Wiesen lag der Schnee einen Meter hoch. Der Eismacher aus Rotterdam erwartete mich in seinem weißen Landrover. »Wir wohnen auf Gold, aber wir kommen nicht ran«, war das Erste, was er sagte. Dann gab er Gas, und schon fuhren wir durch eine Wintermärchenlandschaft. Durchs Gebirge, durch Wälder und durch den reichen Skiort Cortina d’Ampezzo, wo Frauen in Pelzmänteln die Gehwege bevölkerten. Schließlich erreichten wir ein Tal, das Cadore. Mit einer ausladenden Geste verkündete der Mann am Steuer: »HIER LEBEN DIE EISMACHER.« Ein Satz wie aus einem Mythos. In Italien, ganz weit im Norden, lag also ein von hohen Gipfeln mit ewigem Schnee umgebenes Tal, in dem die Eismacher lebten – ich hatte das Gefühl, eine Entdeckung zu machen, wie Charlie, als er die Schokoladenfabrik besichtigte. Ich betrat das Tal der Eismacher.
Wie verabredet, blieb ich über Nacht. Die Frau des Eismachers legte mir eine Wärmflasche ins Bett. Wir hatten über die Familien aus dem Cadore-Tal gesprochen, die in vielen Ländern Eiscafés besaßen, »in Deutschland, in Österreich, in den Niederlanden.« Dorthin fuhren sie in jedem Frühjahr und kehrten im Winter zurück. Allein in Deutschland gehörten nicht weniger als dreitausend Eiscafés Italienern aus dem Cadore. Und so waren die Dörfer im Sommer verlassen, die Kneipen und Kirchen blieben leer, beim Bäcker und Metzger stand niemand an. All das schien mir ein großartiger Hintergrund für einen Roman zu sein.
In den folgenden Jahren besuchte ich noch mehrmals die Eismacher im Cadore-Tal und lauschte ihren Geschichten. Von dem Eismacher, der behauptete, sein Ururgroßvater habe das Speiseeis erfunden; von dem Eismacher, der aus Sparsamkeit per Fahrrad nach Italien zurückkehrte; von dem Eismacher, der kein Eis mochte. Und von dem Gold, das tief unter der Erde lag, zu tief, um es fördern zu können. Und da wusste ich, dass ich einen Roman schreiben musste. Nicht über die Familie, die ich besucht hatte, sondern über eine Familie, in der all diese Geschichten zusammenkamen, und noch mehr, Erfundenes und Historisches. Über die Männer, die vor hundertfünfzig Jahren in den Bergen gefrorenen Schnee ernteten, Spitzhacken in den Händen, Atemwolken wie Nebel. Über die Eistransporte von Norwegen nach England, wo der Italiener Carlo Gatti Eis in Muschelschalen verkaufte. VOR ALLEM ABER HANDELT MEIN ROMAN VON FAMILIENBANDEN, von zwei Brüdern, die das Eiscafé ihrer Eltern übernehmen sollen. Man erwartet von ihnen, dass sie die Tradition fortsetzen, doch der ältere Sohn entscheidet sich für ein anderes Leben. Er übt Verrat.
Nach einer Lesung in den Niederlanden kam eine ältere Dame zu mir und beglückwünschte mich zu meinem Buch. Sie meinte, ich hätte etwas Beachtliches geleistet: »In einer Familie von Eismachern aufzuwachsen, kann nicht leicht gewesen sein, aber es ist toll, dass Sie ein Buch darüber geschrieben haben.« Für einen Schriftsteller gibt es kein schöneres Kompliment, als dass Leser seine Fiktion für Wirklichkeit halten, dass seine Geschichten zum Leben selbst werden. Ich bin kein Eismacher, trotzdem glaube ich, dass kein anderer meiner Romane so autobiografisch ist wie Die Eismacher. In diesem Buch geht es um die dünnen, fast unsichtbaren Fäden, die an uns ziehen, das haarfeine Spinngewebe, das alles, was hinter uns liegt, verbindet. Um den Kampf, den es kostet, von der Familie loszukommen, von den Erwartungen. Um die große Reise, die wir unternehmen, um wir selbst zu werden.
Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen. Betreten Sie es, das Tal der Eismacher!
ERNEST VAN DER KWAST
INTERVIEW MIT ERNEST VAN DER KWASTvon Elsbeth Grievink
© ADRIAAN VAN DER PLOEG
WARUM EIS?
2002 verbrachte ich meinen ersten Winter in Bozen, Italien, um in Ruhe schreiben zu können. Nach drei Wochen begann ich, mich einsam zu fühlen und rief die einzige Telefonnummer an, die ich bei mir hatte: die von Guiseppe und Anita, den Besitzern vom Eissalon Venezia in Rotterdam. Den Sommer über sind die beiden in Rotterdam, die Winter verbringen sie zu Hause im Cadore-Tal in Norditalien. So wie eigentlich alle dort: Den Sommer über ist die Gegend völlig verlassen, im November kehrt wieder Leben in die Dörfer ein. Die Pizzeria macht wieder auf, vor dem Bäcker bildet sich eine Schlange, beim Metzger wird wieder getratscht. Dies und die Tatsache, dass die Eisherstellung über Generationen hinweg vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, fand ich eine wunderbare Grundlage für einen Roman.
WIE SAH DEINE RECHERCHE AUS?
Ich habe mit vielen Eismachern gesprochen, in Salons mitgeholfen, das Grün von Erdbeeren entfernt, Bananen geschält, püriert und umgefüllt. Ich habe die Internationale Eis-Messe besucht, Fabriken für Eismaschinen besichtigt und Bücher gelesen, wie Elizabeth Davids Harvest of the Cold Months und Pim Reinders’ Licks, Sticks and Bricks. Und viel probiert. Das war das Schönste.
WO ESSEN WIR DAS BESTE EIS?
Ohne Zweifel bei Roberto Coletti von Roberto Gelato in Utrecht. Der kann aus allem Eis machen – sogar aus Holz. In Ragusa auf Sizilien gibt es die Gelateria Divini, wo sie fantastisches Ricotta-Eis haben. Und in Bozen, wo ich schließlich meiner Freundin Kathrin begegnet bin, saßen wir Ewigkeiten in der Gelateria Avalon. Da haben sogar Kathrins Wehen eingesetzt.
WAS HAST DU VON DEN RECHERCHEN MITGENOMMEN?
Rezepte wollte mir niemand geben, aber Geschichten schon. Die nahmen häufig mythische Formen an. So weiß niemand, wer das Eis erfunden hat. Im Cadore-Tal behaupten unterschiedliche Eismacher, dass es ihr Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war. Und es gibt den Mythos, dass Marco Polo 1296 mit Eisrezepten aus China zurückkam. Aber auch die Geschichte vom Eismacher aus Den Haag, der von seiner eigenen Eismaschine erwürgt wurde, weil sich seine Krawatte unglücklicherweise darin verfing, fasziniert mich maßlos.
HAST DU AUCH EINE EISMASCHINE?
Ja, eine alte Gaggia, die ich irgendwann einmal gebraucht in Italien gekauft habe. Meine italienische Schwiegermutter macht leckere Marmelade aus den Erdbeeren in ihrem Garten – die Marmelade verwende ich gerne als Basis für ein Sorbet. In der Marmelade schmeckst du richtig den Sommer.
DEINE LIEBLINGSSORTE?
Vanille. Gutes Vanilleeis ist wie der Hintern von Sophia Loren in ieri, oggi, domani, um es mit den Worten des Vaters der beiden Protagonisten in meinem Buch zu sagen: rund, fest und cremig.
© ELSBETH GRIEVINK UND ELLE ETEN
»Lesen ist wie Eisessen. Und dieses Buch istDIE KIRSCHE!«
Ursula Bergenthal, Cheflektorin btb
Im Norden Italiens, inmitten der malerischen Dolomiten, liegt das Tal der Eismacher, in dem sich die Einwohner auf die Herstellung von Speiseeis spezialisiert haben. Giuseppe Talamini behauptet gar, die Eiscreme wurde hier erfunden. Und er muss es wissen, schließlich haben sich die Talaminis seit fünf Generationen dieser Handwerkskunst verschrieben. Jedes Jahr im Frühling siedeln sie nach Rotterdam über, wo sie während der Sommermonate ein kleines Eiscafé betreiben. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt: zartschmelzendes Grappasorbet, sanftgrünes Pistazieneis, zimtfarbene Schokolade. Dennoch beschließt der ältere Sohn Giovanni, mit der Familientradition zu brechen, um sein Leben der Literatur zu widmen. Denn er liebt das Lesen so sehr wie das Eis. Bis ihn eines Tages sein Bruder aufsucht: Luca, der das Eiscafé übernommen hat, ist inzwischen mit Sophia verheiratet, in die beide Brüder einst unsterblich verliebt waren. Und er hat
eine ungewöhnliche Bitte …
WIE MEIN VATER sein Herz an eine 83 Kilo schwere HAMMERWERFERIN VERLOR
Kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag hat sich mein Vater verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick, Liebe, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommt, ein Blitz, der einen Baum fällt. Meine Mutter rief mich an. »Beppi hat den Verstand verloren«, sagte sie. Es geschah während einer Liveübertragung von den Olympischen Spielen in London. Genauer gesagt, beim Finale der Hammerwerferinnen. Mein Vater hat auf dem Dach eine Satellitenschüssel anbringen lassen, mit der er mehr als tausend Kanäle empfangen kann. Ganze Tage sitzt er vor dem Fernseher, einem fantastischen Flachbildgerät, und zappt sich in konstant hohem Tempo durch die Programme. Japanische Fußballspiele huschen vorüber, arktische Naturfilme, spanisches Autorenkino, Reportagen über Naturkatastrophen in El Salvador, Tadschikistan, auf den Fidschi-Inseln. Und natürlich verstörend betörende Frauen aus aller Welt. Die offenherzigen brasilianischen Moderatorinnen, die fast nackten griechischen Showgirls, die Nachrichtensprecherinnen, deren Texte nicht nur wegen der Sprache (Mazedonisch? Slowenisch?), sondern auch wegen dieser glänzenden, vollen Lippen völlig an einem vorbeirauschen.
Meistens hält es meinen Vater fünf oder sechs Sekunden bei den Sendern, die er besucht. Aber manchmal bleibt er auch hängen und sieht einen ganzen Abend und die halbe Nacht Berichte über die Wahlen in Mexiko oder eine Serie von Dokumentarfilmen über die tropischen Gewässer Polynesiens, grün wie Edelsteine.
Es war ein türkischer Sportsender, an dem mein Vater strandete. Gerade hatte er wieder mit seinem schwieligen Daumen auf die Senderwahltaste der Fernbedienung gedrückt; die ägyptische Seifenoper, die in fünf Sekunden so viele Frauen mit dramatischem Mienenspiel ins Bild gebracht hatte, reizte ihn nicht. Beppi drückte also auf die Taste, die einmal schwarz gewesen war, dann grau, und nun weiß war, fast durchscheinend. Da wurde er vom Blitz getroffen. Auf dem Bildschirm erschien seine Prinzessin: eine Haut, so weiß wie Sahne, korallenrote Haare, die Oberarme eines Metzgers. Sie betrat den Wurfkreis des Olympiastadions, hob den Hammer, brachte ihn über die linke Schulter in Schwung, ließ ihn kreisen, drehte sich ein-, zwei-, drei-, vier-, fünfmal und schleuderte die eiserne Kugel mit aller Kraft, die in ihr steckte, von sich weg. Ein Meteorit, der den Eintritt in die Erdatmosphäre überstanden hatte und funkelnd durch die stahlblaue Londoner Luft fegte. Der Einschlag, ein braunes Loch im penibel gemähten Rasen.
Mein Vater ließ die Fernbedienung fallen. Der Deckel des kleinen Fachs auf der Unterseite löste sich, eine Batterie rollte über den Holzfußboden. Der türkische Kommentator äußerte sich lobend über den Wurf, doch von den wohlklingenden Worten bekam mein Vater nichts mit. Die Wiederholung zeigte ihm noch einmal seine breitschultrige Ballerina, ihre Pirouette, die immer schneller wurde und in einer kurzen, aber erstaunlich anmutigen Verbeugung endete.
Es war, als hätte er sich mitgedreht. Schneller und schneller. Und jetzt saß er auf seinem Sofa, verliebt und zerschmettert, als hätte das vier Kilo schwere Wurfgerät ihn getroffen.
Sie hieß Betty Heidler und hielt den Weltrekord, den sie vor mehr als einem Jahr bei einem internationalen Wettkampf in Halle um 112 Zentimeter verbessert hatte. Es war ein warmer Maitag gewesen: fast kein Wind, Sonnenbrillen, kurze Ärmel. Die Athletin betrat federleichten Schrittes den Wurfkreis mit den grünen Netzen und warf fast beiläufig eine astronomische Weite. Die Kugel schlug keinen Krater, sondern sprang noch ein paarmal in Flugrichtung weiter, wie die flachen Kiesel, die Kinder im Sommer über das Wasser des nahe gelegenen Hufeisensees hüpfen lassen. Zwischen den großen Wettkämpfen war die Werferin Polizistin, in einer dunkelblauen Uniform mit vier Sternen auf den Schulterklappen, das rote Haar straff zu einem Knoten hochgesteckt. Polizeihauptmeisterin Heidler.
In London warf Betty Heidler eine Weite, die für die Bronzemedaille reichte; wegen eines Fehlers im Messsystem wurde ihr Wurf aber zunächst nicht gewertet. Es dauerte vierzig Minuten, bis der Fall geklärt war. Diese vierzig Minuten waren für meinen Vater wie ein romantischer Film. Verzückt himmelte er die rothaarige Hammerwerferin an, die immer wieder in Nahaufnahme zu sehen war, manchmal den Tränen nah. Ihre Konkurrentin, die korpulente Chinesin Zhang Wenxiu, hatte sich schon die rote Fahne mit den gelben Sternen um die breiten Schultern gelegt und begann eine Ehrenrunde zu laufen.
»Nein! Nicht diese Tausend-Kilo-Chinesin!«, rief mein Vater.
Der türkische Kommentator drückte sich etwas nuancierter aus, doch auch er war der Ansicht, dass nicht Zhang Wenxiu, sondern Betty Heidler Anrecht auf Bronze habe. Übrigens wog die chinesische Athletin in Wirklichkeit 113 Kilo, womit sie aber immer noch dreißig Kilo schwerer war als die rothaarige Werfnymphe.
»Nimm die Fahne ab«, sagte mein Vater. »Aufgequollener, aufgedunsener Fleischklops.« Und als Betty Heidler ins Bild kam: »Nicht weinen, Prinzesschen. Nicht traurig sein, liebe, schnellfüßige Frau.«
Es war ein Epitheton ornans, unbewusst aus der Vergangenheit heraufgeholt, aus der Zeit vor fünfunddreißig Jahren, als ich das Gymnasium besuchte und zum Schrecken aller plötzlich mit den farbenfrohen Adjektiven des blinden Dichters um mich warf. Nach Ansicht meines Vaters liegen da die Ursprünge der heutigen Fremdheit zwischen mir und der Familie. Oder wie er es gerne zusammenfasst: »Dann ist es nie wieder gut geworden.« Meine Epitheta konnten ihn verrückt machen: Ich sprach von den schönmähnigen Mädchen, mit denen ich flirtete, den dunkelumwölkten Gebäuden, die meine Mutter nicht sehen wollte, dem weinpurpurnen Kirscheis, das er herstellte. Und jetzt gebrauchte er selbst ein solches Adjektiv für seine weißarmige Hammerwerferin.
Die Regie schob einen Werbespot für Haarspray ein. Zu sehen war eine Braut mit einer Frisur, die wahrscheinlich mindestens eine Woche ihre Form behalten würde.
»Betty! Komm zurück!«, rief mein Vater dem flachen Bildschirm zu, auf dem gestochen scharf und in Zeitlupe das Spray auf die kastanienbraunen Locken der lächelnden Braut verstäubt wurde. Sein Daumen machte automatisch eine Bewegung, der schwielige, alte Daumen, der sich so viele Jahre lang wie ein Haken um den metallenen Stiel des Spatalone gelegt hatte, des großen Löffels, mit dem das Eis aus den Zylindern der Cattabriga geschöpft wird.
»O Betty«, seufzte mein Vater, so wie schon viele Männer den gleichen Namen schmachtend ausgesprochen haben mussten. Betty Garrett, Betty Hutton, Betty Grable. Bezaubernde Schauspielerinnen, fast vergessene Namen.
Der Film mit der Hammerwerferin ging weiter. Sie saß auf einer Bank auf dem rotorangenen Tartan der Arena und machte ein unglückliches Gesicht. Der Kommentator schnatterte ununterbrochen; manchmal glaubte mein Vater Namen von Athleten zu erkennen, aber es konnten auch türkische Wörter sein. Er wusste, dass der Satellit zahllose andere Kanäle im Angebot hatte, die ebenfalls diese Wettkämpfe übertrugen. Auf Dänisch, auf Deutsch, auf Italienisch, auf Niederländisch. Doch die Fernbedienung lag auf dem Boden, und er wollte nicht zappen, er wollte keine Sekunde verpassen.
Sah er da eine Träne? Einen silbernen Tropfen unter ihrem linken Auge? Es war ein Film, und er musste etwas zu ihr sagen, er musste sie trösten. Meine Mutter stand in der Tür des kleinen Zimmers, in dem der Fernseher wie ein Bild an der Wand hängt. Sie hatte ihren Mann sprechen hören und aus der Küche gerufen: »Beppi? Was ist?«
Mein Vater heißt Giuseppe Battista Talamini, aber meine Mutter nennt ihn schon ihr Leben lang Beppi.
»Ich liebe dich«, sagte mein Vater.
Es war zwanzig, dreißig, vielleicht sogar vierzig Jahre her, dass meine Mutter diese Wörter zuletzt aus dem Mund meines Vaters gehört hatte.
»Bitte?«
»Ich liebe dich«, antwortete mein Vater. »Ich finde dich schön.«
Meine Mutter schwieg. Betty Heidler hatte immer noch Tränen in den Augen.
»Deine Sommersprossen, deine starken Arme … Ich möchte deine Muskeln küssen.«
»Was hast du? Fühlst du dich nicht gut?«
Die Erkenntnis kam schrittweise. Der erste Teil seiner Antwort war an den Bildschirm gerichtet, der zweite an seine Ehefrau in der Tür: »Du bist die Liebe meines Lebens. Geh weg!«
Schließlich reichte die Juryvorsitzende, eine Frau mit breiter Armbinde, Betty Heidler die Hand. Langsam, als würde Eis schmelzen, ging ein Lächeln über Bettys Gesicht. Darauf folgte auch eine Umarmung. Das geschah aber erst, als meine Mutter schon wieder in der Küche stand, vor ihrem Herd, auf dem in einer einsamen Pfanne Gehacktes brutzelte. Morgen war Samstag: pasticcio, Gläser gefüllt mit leichtem Rotwein, der Nachmittag wie ein Fleck, der sich ausbreitet. Es ist ein allseits bekanntes Geheimnis, dass Lasagne, genau wie Tiramisu, besser schmeckt, wenn man sie eine Nacht ruhen lässt.
Aus dem Fernsehzimmer waren Freudenschreie zu hören. »Ja! Sie hat gewonnen! Betty hat Bronze gewonnen! Ja! Ja!« Als mein Vater vor Glück auf den Boden zu stampfen und zu springen begann wie ein Kind, rief meine Mutter mich an.
Im Frühling und Sommer ruft sie immer mich an, wenn irgendetwas ist. Mein Bruder Luca arbeitet dann. Mein Gedächtnis ruft das Bild automatisch ab: Wenn ich am Telefon die Stimme meiner Mutter höre, sehe ich Luca in Rotterdam an der Eismaschine stehen.
Ich arbeite auch, kann aber meistens Anrufe entgegennehmen.
»Wo bist du?«, fragt meine Mutter. Es sind immer ihre ersten Worte.
»Ich bin in Fermoy, in Irland.«
Am anderen Ende bleibt es einen Moment still. Für meine Mutter, vierundsiebzig Jahre alt, ist das Mobiltelefon immer noch gewöhnungsbedürftig. Sie selbst hat nie eins in der Hand gehabt. Dass man einander überall und jederzeit erreichen kann, bleibt für sie in ihrer Küche in Venas di Cadore, mitten in den Bergen, eine Quelle der Verwunderung. Manchmal ruft sie mich an, wenn ich am anderen Ende der Welt bin, und ich melde mich mit verschlafener Stimme. »In Brisbane, in Australien«, sage ich dann. Die Stille nutze ich, um meine Augen auf die Leuchtzeiger meiner Armbanduhr auf dem Nachttisch einzustellen. Daran, dass ich immer an einem anderen Ort bin, hat sie sich lange vor dem Aufkommen des Mobiltelefons gewöhnen müssen.
Ich habe ein Zuhause, aber es fühlt sich nicht so an. Auf der Fensterbank stehen keine Pflanzen und im Kühlschrank keine Milch. Keine Zeitung wird zugestellt. Es gibt zwar Vorhänge und Handtücher, aber keine Obstschale. Die israelische Dichterin Nurit Zarchi schreibt in ihrem kurzen Gedicht »Heute wollte ich«: »Müde will ich auf dem Rand der Welt Platz nehmen, Rast machen./Trotzdem gehe ich weiter, damit man nicht merkt/Wie klein der Abstand ist zwischen mir und den Unbehausten.« Der Abstand zwischen mir und meiner Familie ist groß, weil dieser andere so klein ist. Winzig, fast nicht vorhanden, an manchen Tagen versagt das Messsystem.
»Wie ist das Wetter in Irland?«
Ihr Interesse am Wetter ist obsessiv. Als sie noch in Rotterdam im Eiscafé arbeitete, schlug sie die Zeitung grundsätzlich auf der Seite mit dem Wetterbericht auf. Und wenn in der Schlange im Supermarkt über Schauer oder Kälte gesprochen wurde, spitzte sie die Ohren. Jetzt ist sie im Ruhestand und das Eiscafé weit weg, trotzdem muss sie sich bei jedem nach dem Wetter erkundigen. Dem Wetter von heute, von morgen, von übermorgen, von nächster Woche. Egal wo, es kann ja immer in Richtung Rotterdam ziehen. In ihrer Vorstellung ist der Himmel über den Niederlanden ein Wirbel, in dem alles zusammenkommt, vor allem aber Regen, Kälte und Sturm. Der feine Flügelschlag des Schmetterlings in Brasilien verursacht über dem Eiscafé einen Hagelschauer biblischen Ausmaßes.
»Sonnig«, antworte ich. »Anhaltend freundliches, sommerliches Wetter, morgens stellenweise Nebel.« Und ich füge hinzu: »Keine dunkelumwölkten Gebäude.«
Sie schweigt, aber ich weiß, dass sie lächelt. Meiner Mutter fällt es leichter, meine Entscheidung für ein anderes Leben zu akzeptieren. So, wie sie alles über das Wetter wissen will, so liebe ich eben die Poesie und mein Vater Werkzeug. Mein Bruder ist praktisch der Einzige, der noch Eis macht.
»Beppi hat den Verstand verloren«, erklärt sie dann. Sie wiederholt, was sie ihn hat sagen hören. Als sie zu den Muskeln kommt, die mein Vater küssen will, muss ich lachen.
»Vielleicht ist es Alzheimer«, überlegt meine Mutter. »Fausto Olivo zieht sich die Unterhose über den Kopf. Der Arzt sagt, er leidet an Demenz.« Fausto ist der alte Eismacher von La Venezia in Leiden. Er ist erst seit ein paar Jahren im Ruhestand. Sein ältester Sohn setzt die Tradition fort.
»Frau Olivo hat erzählt, dass Fausto sie für die Nachbarin hält und sie dauernd in den Hintern kneift.«
Meine Mutter weiß mehr über Alzheimer als über Mobiltelefone.
Sie schweigt einen Moment. Vielleicht betrachtet sie die Fotos auf den Küchenschränken, das Porträt ihres Enkels, der vor einer Woche nach Mexiko abgereist ist.
»Sie hat rotes Haar«, sagt sie dann. »Die neue Liebe deines Vaters hat lange, rote Haare.«
Ich denke an die Frauen, die ich hier auf der Straße gesehen habe. In Irland gibt es viele Rothaarige. Sie erröten schneller, weil ihre Haut dünner ist und das Rot des Blutes leichter durch die obersten Schichten scheint. Aber sie schauen meistens noch schneller weg. Eine Ausnahme war die junge Frau, die beim Fermoy International Poetry Festival die Gäste empfing. Sie stand hinter einer kleinen Theke und trug unter ihrer Bluse einen rosa BH, das konnte ich sehen, wie die Milchstraße aus Sommersprossen auf ihrer Haut. Als ich wieder aufsah, blickte ich in ihre Augen, die nicht auswichen, nicht einmal blinzelten. Sie hatte gesehen, wohin ich geschaut hatte. Es waren meine Augen, die schließlich aufgaben. Ich blickte auf das Formular auf der Theke.
»Was soll ich zu ihm sagen?«, fragt meine Mutter. »Ich hab ihn oft trübsinnig gesehen, ich weiß, dass er den Frühling fürchtet, dass es ihm schwer fällt, das Leben zu genießen, weil er meint, dass es vorbei ist. Ich muss ihm seine Sachen zurechtlegen, sonst zieht er jeden Tag dasselbe an.«
Manche Menschen werden in ihrem Leben immer schöner, ihr Charakter wird von den Jahren verfeinert wie kostbarer Wein, und alles, was lange Zeit in ihnen gereift ist, Gelerntes, Erfahrungen, die großen Ereignisse, all das zusammen hat sich in ein Elixier verwandelt, das vielleicht das Leben nicht verlängert, ihm aber Glanz verleiht. Auch mein Vater hat nichts vergessen, nur haben die Jahre seinen Charakter verdorben.
»Er redet immer noch mit dem Fernseher«, sagt meine Mutter. »Willst du’s hören? Soll ich mit dem Telefon zu ihm gehen?«
»Lass mal«, antworte ich, aber ich höre, dass sie schon die Küche verlässt.
»Morgen früh rufe ich den Arzt an«, verkündet sie. »Dann muss er eben mal samstags kommen. Es ist ein Notfall.«
»Es ist Unsinn sagt die Vernunft«, zitiere ich. »Es ist was es ist sagt die Liebe.«
»Bitte?«
Mein Blick bleibt einen Moment an dem Kunstwerk in meinem Hotelzimmer hängen, einem Aquarell von einer Grasebene, auf der ein Junge, schon weit entfernt, vom Betrachter wegläuft.
»Das ist ein Gedicht«, antworte ich. »Über die Liebe. Was es ist.«
»Es ist Wahnsinn«, sagt meine Mutter. »Er umarmt den Fernseher!«
In meinen Hotelzimmern versuche ich auch manchmal, mit den Flachbildschirmen in Kontakt zu kommen, die mich begrüßen. »Dear Mr. Giovanni Talamini, it is a pleasure to welcome you to Ascot Hotel.« »Welcome! G. Talamini, enjoy your stay in Radisson Blu.« »Welcome to Crowne Plaza Hotel. Dear Talamini, it is a privilege to have you staying at the Crowne Plaza Hotel. To continue please press button ok.«
»Das glaubt man doch einfach nicht«, höre ich im Telefon. Es gibt eine kurze Störung, vielleicht überschneiden sich gerade die Funksignale, die mit ihren Worten und die mit Betty Heidler, auf dem Weg aus dem Weltraum ins Fernsehzimmer in Venas di Cadore. »Dann ist es mir wirklich lieber, wenn er einfach über sein Leben jammert und über dein Leben.«
Das Gedächtnis tut endlich seine Arbeit: Ich sehe meinen Bruder im Eiscafé stehen, die weiße Mütze auf dem Kopf, in der rechten Hand die Spatola, den kleinen, flachen Löffel, mit dem er das Eis für die Kunden portioniert. Es ist schon spät am Abend, aber mild. Schwarze Vögel sausen durch die Luft, noch höher nimmt ein Airbus Kurs auf Amerika, das Licht in der Kabine ist heruntergedreht, doch das kann man vom Boden aus nicht sehen. Auf der Straße sind junge Frauen unterwegs, manche in Röckchen oder in kurzen Hosen, deren Taschen unter dem Jeansstoff herausschauen; Lucas Blick bleibt an ihren Hintern hängen. Seine Frau schläft, sie liegt wie eine Schwimmerin, den einen Arm vorgestreckt, den anderen eng am Körper. Auf der Terrasse sitzen die letzten Gäste, junge Männer und Frauen, die nach dem Kino noch Lust auf eine Waffel mit Erdbeere und Mango haben, der alte Mann, der in einem Milchshake kurz vor Mitternacht Trost findet.
DIE ENTDECKUNG DES EISES durch meinen Urgroßvater im JAHR 1881
Der Vater des Vaters meines Vaters hieß ebenfalls Giuseppe Talamini. Er hatte gewelltes Haar, eine große Nase und dunkelblaue Augen, aus denen der Schalk herausschaute. Es wird erzählt, dass er bei einem Unfall mit einer entlaufenen Kuh ums Leben gekommen ist. Die Kuh, ein neunhundert Kilo schweres Tier von der Tiroler-Grauvieh-Rasse, hatte den Zaun ihrer Weide umgetrampelt, lief den steilen Hang oberhalb des Bauernhofs hinunter und stieg überraschend auf das Dach des kleinen Heustadels, in dem mein Urgroßvater in völliger Zurückgezogenheit und Stille sein tägliches Schläfchen hielt.
Die silbergraue Kuh brach durch das hölzerne Dach und zerquetschte meinen sechsundsiebzigjährigen Urgroßvater. Wahrscheinlich war er nicht sofort tot, sondern hat trotz schwerer Verletzungen noch eine Weile gelebt. Als er nicht zum Abendessen erschien, ging man auf die Suche, fand ihn aber erst, als die Sonne hinter den Bergen verschwunden war. Die Kuh lag noch auf ihm und leckte an seinen Sachen. Sein Gesicht hatte einen auffallend friedlichen Ausdruck, er schien zu lächeln.
Die Kuh, die sich beide Vorderbeine gebrochen hatte, wurde noch am Abend vom Bauern geschlachtet. Dann wurde es langsam Nacht, die Füchse kamen aus dem Wald, Hunde bellten in der kalten Bergluft. Am nächsten Morgen redeten alle über den plötzlichen Tod Guiseppe Talaminis, doch so seltsam dieser Tod auch gewesen sein mochte, man war sich schnell darüber einig, dass er zum Leben meines Urgroßvaters passte. Zu einem Leben voll unerwarteter Wendungen und sonderbarer Ereignisse, einem Leben, an das er immer große Ansprüche gestellt hatte, bis zu seinem Tod. Vielleicht erklärte das dieses Lächeln in seinem Gesicht.
Woran dachte mein Urgroßvater, als er unter der Kuh lag und niemand kam, um ihn zu befreien, als er spürte, wie sich das Leben aus ihm zurückzog? Woran denkt man, wenn man weiß, dass man sterben wird? Oberst Aureliano Buendía dachte vor dem Erschießungskommando an jenen fernen Nachmittag, an dem sein Vater ihn mitnahm, um das Eis kennenzulernen. In Guiseppe Talaminis Geist stiegen ähnliche Bilder auf.
Es war der Sommer, in dem die Wölbungen unter dem Kleid des Nachbarsmädchens Maria Grazia enorme Rundungen wurden. Ein unzüchtiges Wunder.
Sie waren zusammen aufgewachsen, hatten im Wald Tannenzapfen gesucht und Hand in Hand unter dem wolkenlosen Himmel ihrer Jugend gelegen. Maria Grazia liebte die Sonne und die Sonne ihre Honighaut. In Gedanken nannte Guiseppe sie girasole, Sonnenblume. Während die Sonne langsam wie eine Milliardenjährige den Himmel nach Westen überquerte, bewegte Maria Grazia ihren Körper Zentimeter für Zentimeter weiter. Sie wollte so viele Sonnenstrahlen wie möglich auffangen und den Schatten keine Chance geben. Guiseppe rührte sich nie vom Fleck, weshalb die beiden wie übergroße Uhrzeiger im Gras lagen.
Dann kam der letzte Sommer, in dem sie Kinder waren. Guiseppe wagte das Nachbarsmädchen nicht mehr anzusehen. Maria Grazias Brüste schienen in der Sonne zu wachsen. Sie wurden von Tag zu Tag runder und voller, Brote, die im Backofen aufgingen. Er fantasierte sich ihre Brustwarzen in verschiedenen Farben zurecht. An einem Tag waren sie rosa wie ihre Lippen, an einem anderen weiß und durchscheinend wie ihre Handflächen oder dunkel wie Haselnüsse. Wenn am Nachmittag von den Bergen her ein leichter Wind wehte, zeichneten sich zwei Spitzen unter dem Stoff ihrer Bluse ab. Während die Zikaden sangen und die Maikäfer summten, schwiegen Maria Grazia und Guiseppe im hohen Gras. Sie hielten sich an der Hand und schauten in den reinen Himmel. Alles war wie immer und alles war anders.
So kam es, dass Guiseppe am Ende des Sommers an der Tür vorbeiging, an die er jeden Morgen geklopft hatte. Er begleitete seinen Vater, der Holzfäller war und gerne vor sich hin pfiff. Manchmal erkannte Guiseppe eine Melodie und pfiff mit. Ende September wurden die Bäume auf den Berghängen geschlagen, zwanzig Meter hohe Lärchen mit kerzengeraden Stämmen. Es war schwere Arbeit und nicht ungefährlich, man konnte nie ganz sicher sein, wie ein Baum fallen würde. Schlagen, hacken, spalten. Der kahle Klang, zurückgeworfen von zahllosen anderen Stämmen. Dann das dumpfe Dröhnen und das Beben der Erde, als würde eine Lokomotive vorbeifahren. An einem anderen Hang, in einem anderen Jahr, war ein Baum auf den Holzfäller gestürzt. Der Mann war auf der Stelle tot.
Auch Guiseppe arbeitete mit der Axt, er half beim Entasten der Bäume. Danach sägten sein Vater und er die Stämme in fünf Meter lange Stücke. Schweiß, der sich mit den Spänen mischte, Harz, das überall am Körper klebte. Der Geruch war beißend und reizte die Augen. Noch niemals war Giuseppe so müde gewesen wie nach den langen Tagen im Wald.
Um Weihnachten, wenn alles von jungfräulichem Schnee bedeckt war, wurden die zurechtgesägten Stämme mit dem Schlitten zum Fluss hinuntergeschafft, dem Piave, der in einem großen Bogen in südlicher Richtung bis nach Venedig fließt, fast zweihundert Kilometer. Im seichten Wasser wurden die Stämme zu großen Flößen zusammengebunden, die bald zu Hunderten stromabwärts glitten, von Flößern gelenkt. Tage später erreichten sie Venedig, wo die Stämme tief in den schlammigen Sandboden getrieben wurden, pro Quadratmeter acht Pfähle. Guiseppe konnte sie sich nicht wirklich vorstellen, die ins Wasser gebaute Märchenstadt, die unzähligen Brücken, Kirchen und Paläste mit hohen Decken, die Fresken, die unsterbliche Geschichten erzählten, an besonderen Abenden erleuchtet von tropfenden Kerzen in silbernen Kandelabern.
Doch jetzt war der Winter noch fern, nur auf den hohen Gipfeln lag Schnee. Eines Morgens weckte ihn sein Vater früher als sonst. Draußen war es dunkel, eine sternklare Nacht. Guiseppe hörte die Stimmen anderer Männer aus dem Dorf, er erkannte den tiefen Bass des Nagelschmieds Antonio Zardus. Die Männer sprachen leise, hohe Silhouetten beugten sich zueinander hin, es war wie bei einer Verschwörung. Sie fuhren mit der Postkutsche. Sieben Mann, Guiseppe war der jüngste. Als sie das Dorf hinter sich ließen, lächelten die anderen ihn an. Er sah die mondweißen Zähne der Freunde seines Vaters.
Sie schwiegen und horchten auf das Hufgeklapper, bis die Sonne über den Bergen aufging. Golden und rosenfingerig, Homers Morgenröte. Guiseppe erkannte jetzt auch andere Gesichter. Neben ihm saß der Kesselflicker, genau gegenüber der Schlosser. Alle waren starke Männer.
»Schau«, sagte sein Vater und zeigte auf einen Berghang, auf dem zwei Rehe zwischen den Fichten standen, reglos wie Standbilder, aufgeschreckt vom Lärm der Kutsche. Ein unteilbarer Augenblick, schon waren sie im Wald verschwunden.
Antonio Zardus brach ein Brot, der Schlosser schnitt Scheiben von einem großen Stück Dörrfleisch ab. Sie aßen genussvoll, mit offenem Mund. Auf dem Holzboden der Kutsche lagen Spitzhacken und Schaufeln, rüttelnd und rutschend im Rhythmus des Trabs. Guiseppe konnte sich nicht vorstellen, was sie vorhatten. Als sein Vater ihn weckte, hatte er nur gesagt, dass er mitkommen sollte. Er war aufgestanden und hatte sich blitzschnell angezogen.
»Sie haben fast zehn Jahre dran gebaut«, hörte er jemanden sagen. »Die Trupps haben aufeinander zu gearbeitet, auf beiden Seiten über tausend Mann.« Es war Enrico Zangrando, der mehr Kühe besaß als Haare auf dem Kopf. Die anderen Männer klopften ihm manchmal auf die Glatze, weil das so schön klatschte. Er hatte sehr viel Land geerbt, wollte aber nicht über den anderen stehen.
»Es ist der längste Eisenbahntunnel der Welt«, erklärte Enrico. »Fünfzehn Kilometer lang, quer durchs Gotthardmassiv. Zuerst haben sie Bohrmaschinen mit Druckluft benutzt, aber das Gestein war zu hart. Dann haben sie Dynamit genommen.«
Es waren furchtbare Explosionen gewesen, ohrenzerreißend, Kriegslärm. Der Bedarf an Dynamit war so groß, dass an der Nordseite, nah beim Urnersee, eine Sprengstofffabrik gebaut wurde. Sprenglöcher wurden gebohrt, einen Meter tief, und darin das Dynamit gezündet. Giftige Gase füllten den Tunnel und riefen Entzündungen der Augen und Atemwege hervor. Siebenundvierzig Männer kamen bei Explosionen ums Leben, bis am 28. Februar 1880 ein Bohrer die verbliebene Felswand durchdrang. Arbeiter reichten sich durch das Loch die Hände, Hämmer und Spitzhacken erweiterten es, dann endlich kletterte der erste Mann hindurch. Es war fast unwirklich, als beträte er eine andere Welt.
»Wir können durch die Berge reisen«, sagte Enrico. Vor hundert Jahren war man zum ersten Mal mit einem Heißluftballon durch die Luft gefahren, aber dies war genauso großartig. Nicht über, sondern quer durch den Berg, durch den Fuß, den breitesten und schwersten Teil. Giuseppe musste sich zurückhalten, um Enrico nicht mit Fragen zu überfallen. War er schon mit der Eisenbahn durch den Tunnel gefahren? Wie lange dauerte das? Wie sah das Licht am Ende aus? Die anderen Männer schauten unbewegt vor sich hin, nur sein Vater zwinkerte ihm zu. Giuseppe überließ sich einen Moment dem Rhythmus der Kutsche und träumte mit offenen Augen vom Gotthardtunnel, durch den er sauste wie ein Komet durch den endlosen, dunklen Raum.
In Venas di Cadore stand Maria Grazia am Fenster und schaute hinaus. Sie wollte dem Haus entfliehen und sich ins Gras legen, aber die Nachbarn hatten ihre Wiesen gemäht. Die Brüste taten ihr weh. Sie hatte auf der Straße Männer starren sehen, Blicke, die an ihrem Körper kleben blieben. Zu Hause, in ihrem Zimmer, hielt sie ihre Brüste stundenlang in den Händen. Auch ihre Hüften waren gewachsen und taten fast genauso weh. Sie wurde eine Frau und brauchte einen Mann; einen Mann, der sie festhielt.
Die Kutsche mit den beiden glänzenden Rappen fuhr bergauf, eine lange, gewundene Straße. Giuseppe wusste nicht, wo sie waren, aber nach der Stimmung in der Kutsche zu urteilen, näherten sie sich ihrem Ziel. Enrico Zangrando krempelte sich die weißen Ärmel hoch, die anderen folgten seinem Beispiel. Sie hoben ihre Werkzeuge auf, die Spitzhacken und Schaufeln. Dann saßen alle ganz gerade.
Sie hielten neben einem Gleis an. Darauf stand ein Zug mit acht Waggons, die großen Schiebetüren waren geöffnet. Giuseppe sprang aus der Kutsche und schaute sich um. Sie waren auf einem Sattel zwischen zwei Bergkämmen, die Sonne war nicht zu sehen, erst am späten Nachmittag würde sie hinter einem der Kämme hervorkommen. So weit das Auge reichte, lag Schnee, bestimmt einen halben Meter tief, darunter sickerte und floss das Wasser talwärts. Eiskaltes Wasser, in das die Männer bis zu den Knien hineinstiegen und stehen blieben, bis ihre Knochen zu schmerzen anfingen, weil es gut für den Kreislauf sein sollte.
Es war gefrorener Schnee, und sie sollten die Waggons damit beladen. Giuseppe traute kaum seinen Augen. Sie hackten große Brocken aus dem Schnee und harkten sie mit ihren Spitzhacken hangabwärts zum Gleis, wie Bauern Heu zusammenrechen. Die Brocken wurden schmutzig, kleine Steinchen und Erde blieben daran hängen, aber das machte anscheinend nichts.
Manchmal stützte sich Giuseppe einen Moment auf den Stiel seiner Hacke und beobachtete die anderen. Der Nagelschmied schwitzte und dampfte, Giuseppe sah den Dunst von seinen entblößten Armen aufsteigen, die Haut über den gewaltigen Muskeln glänzte. Auch die übrigen Männer arbeiteten in Dunstwolken. Er wagte sich nicht zu bewegen, um das Bild nicht zu zerstören: die Arbeiter mit ihren schwarzen Händen auf dem blendenden Schnee, die Waggons, die damit beladen wurden. Er hatte Angst, dass alles weg sein würde, wenn er sich bewegte. Ein Traum, der plötzlich endet.
Enrico rief seinen Namen und fragte, ob er von Mädchen träume. Die anderen Männer lachten laut, auch sein Vater.
Nach zwei Stunden machten sie Pause. Drei Waggons waren voll beladen, die Schiebetüren geschlossen. Sie ruhten sich auf dem Stamm einer gefällten Lärche aus, ein Krug wurde weitergereicht, aber Giuseppe hatte keinen Durst. Er hatte mehrmals eine Handvoll Schnee aus der weißen Decke herausgehackt und sich in den Mund gesteckt. Seine Finger prickelten danach noch minutenlang von der Kälte.
Beim ersten Mal hörte ihn niemand, weil er seine Frage flüsterte. Als er sie dann laut zu wiederholen wagte – warum sie eigentlich gefrorenen Schnee in Waggons laden müssten –, schauten ihn alle an. Giuseppe war jung, und er war neugierig, nicht nur auf die gewöhnlichen Dinge; hinter manchem vermutete er eine ganze Welt, von der er nichts wusste, strahlendes Licht am Ende des Tunnels.
»Wir ernten ihn«, erklärte sein Vater. »Wir fahren den Schnee ein.«
Bei dem Wort »ernten« dachte er an Kartoffeln, Rüben, Äpfel, nicht an Schnee in den Bergen. Giuseppe schaute die Waggons mit den geschlossenen Türen an. Er verstand immer noch nichts.
Enrico übernahm das Erklären. »Sie machen Eis damit«, sagte er.
»Eis?«
»Nicht das Eis, das du kennst, auf dem man gehen und Schlittschuh laufen kann.«
»Anderes Eis?«
»Verschiedene Geschmäcker. Erdbeere, Vanille, Mokka.« Und nach einer Pause: »Es wird in den Städten verkauft, und es schmeckt noch besser als eine Frau.«
Es war, als würde in seinem Kopf Licht ausgegossen, das seinen Geist ausfüllte.
»In Wien hab ich Eis gegessen, das aus Apfelsinen aus Spanien gemacht war«, fuhr Enrico fort.
»Kann nicht sein«, sagte Antonio mit seiner Bassstimme voller Überzeugung.
Enrico ging nicht darauf ein. »Es wurde auf der Straße verkauft, aus Messingschalen auf einem Karren.«
Wie manche Menschen sich verlieben, wie in einem Fieberanfall und unvergesslich, so verlangte es Giuseppe plötzlich nach dem Eis, das Enrico Zangrando beschrieb. Noch Jahre später hätte er das Gespräch Wort für Wort wiederholen können.
»Man isst es mit einem kleinen Löffel, und es schmilzt im Mund.«
Er versuchte, es sich vorzustellen, ein Löffel Erdbeere, der in seinem Mund schmolz, doch seine Fantasie versagte. Der Schritt von dem gefrorenen, schmutzigen Schnee zu dem betörenden, königlichen Eis war zu groß. Als Kind hatte er, wie alle Kinder es irgendwann tun, voller Erwartung den nachts gefallenen Schnee gekostet. Wie Wasser, aber unsauber und metallisch – die universale Enttäuschung des Schneegeschmacks. Die stille Pracht auf den Wegen und Wiesen hatte ihn getäuscht. Er erinnerte sich, wie sein kleiner Bruder, als er zwei Jahre alt war und den Schnee vom Vorjahr vergessen hatte, aus dem Fenster schaute und sagte: »Ich will es streicheln.« Als wäre der Schnee ein Fell, das die Welt vor der Kälte schützte.
Enrico erzählte von der Herstellung, den verschiedenen Schritten. Eine Art Alchemie. Wie der gefrorene Schnee mit einem kleinen Hammer zerbröckelt und in eine Holztonne geschüttet wird, rings um einen Metallzylinder, wobei man Salz hinzugibt, um den Schmelzpunkt abzusenken. Wie der Brei, aus dem das Speiseeis werden soll, in den Zylinder der mechanischen Eismaschine gegossen wird, wie der Eismacher schließlich die Kurbel zu drehen beginnt und das Rührwerk die Masse zur kalten Zylinderwand befördert und wieder abstreift. Drehen, drehen, drehen. Wie sich am Rand das erste Eis bildet, noch spröde. Wie Luftbläschen in die Masse gelangen und wie sie an Umfang zunimmt. Drehen, drehen. Wie die Farbe langsam heller wird. Rosa Erdbeereis, graugrünes Pistazieneis, zimtfarbenes Schokoladeneis. Drehen.
»Bis es fest und dick und köstlich ist.«
Genau so erzählen manche von der Liebe, vom Liebesspiel. Es kann sehr genau geschildert werden, ist aber in der Beschreibung nie so gut wie in Wirklichkeit.
»Kommt«, sagte der Nagelschmied. »Wir müssen wieder.«
Einer nach dem anderen stand auf, nur Giuseppe blieb sitzen. Es war, als hätte er sich mitgedreht, wie sein Nachkomme und Namensvetter sich mehr als hundert Jahre später mit Betty Heidler und ihrer Kugel drehen sollte. Er saß auf dem Baumstamm, als hätte auch ihn das Verlangen zerschmettert.
Sein Vater zog ihn hoch. »An die Arbeit, Junge«, sagte er aufmunternd. »Ich helfe dir schon.« Gleich darauf hörte Giuseppe ihn ein Volkslied pfeifen.
Giuseppe war nicht müde, er war jung und stark, vielleicht nicht so stark wie Antonio Zardus, der angeblich Münzen verbiegen konnte. Er fühlte sich überwältigt, betäubt von dem, was er gehört hatte, von den süßen Geschmäckern in den Messingkästen des Eiskarrens in Wien. Seine Fantasie schlug mit den Flügeln und versuchte, sich über den Schneehang zu erheben, über die Berge. Vielleicht wäre es gelungen, hätte er gewusst, wie eine Frau schmeckt, dann hätte er sich eine Vorstellung davon machen können, was noch besser war. Jetzt sah er nur, was er schon wusste, dass hinter den Bergen andere Berge lagen.
Was er nicht wusste, was auch die anderen Männer nicht wussten, nicht einmal Enrico Zangrando, das war, dass sie zu einem größeren Ganzen gehörten. An unzähligen Orten auf der Welt wurde die Ernte der kalten Monate eingebracht. In Boston hatte Frederic Tudor, Sohn eines reichen Anwalts und verliebt in das Risiko, ein Eisimperium aufgebaut. Gerade einmal dreiundzwanzig Jahre alt, kaufte er sein erstes Schiff, eine Brigg, um damit Eis zu der karibischen Insel Martinique zu transportieren; die Eisblöcke stammten von dem kleinen See auf dem Landgut seines Vaters. Alle erklärten ihn für verrückt, die Zeitungen spotteten über seine Unternehmung. Während der dreiwöchigen Fahrt schmolz zwar ein beträchtlicher Teil des Eises, doch es gelang Frederic Tudor, den Inselbewohnern das restliche Eis aus Massachusetts zu verkaufen. Könnte man sich nur ihre Gesichter vorstellen, ihre Blicke, ungläubiges Staunen, Entzücken, als die durchscheinenden Blöcke aus dem Frachtraum des Schiffes gehoben werden, das 2400 Kilometer zurückgelegt hat. Es ist das Jahr 1806.
Der Verlust lag bei Tausenden Dollar, und auch im Jahr darauf, als Frederic Tudor mit einem gefrorenen See im Rumpf eines Schiffes nach Havanna segelte, machte er, wie es sich für einen Glücksspieler gehört, hohe Schulden. Nach der Rückkehr kam er ins Schuldgefängnis und wurde vor der nächsten Fahrt vom Sheriff zum Stapelplatz begleitet. Dort lag sein Schiff, das den anmaßenden Namen Trident trug.
Tudor experimentierte mit verschiedenen Isoliermaterialien für die Frachträume seiner Schiffe: Heu, Hobelspänen und Sägemehl, den braunen Spelzen von Reis. Den Durchbruch für seine Ice Company brachte aber die Erfindung des Eispfluges. Bis dahin wurden per Hand Blöcke aus den Eisdecken der Gewässer Neuenglands gesägt, jetzt konnte man mit Hilfe von Pferden zur Massenproduktion übergehen. Die dunklen, anmutigen Tiere wurden vor einen Pflug mit einer Reihe von Stahlblättern gespannt. Ein Mann führte das Pferd, ein zweiter lenkte den Pflug. So entstand ein Furchenraster aus perfekten Rechtecken; ein sogenanntes Floß aus vielen dieser Rechtecke wurde mit einem Meißel von der Eisdecke losgestemmt und mit Haken ans Ufer gezogen, wo man schließlich die einzelnen Tafeln abtrennte. An den Ufern der Flüsse und Seen wurden Eishäuser gebaut, aber auch in den Häfen ferner Länder. Tausende Männer fanden so in den Wintermonaten Arbeit; sie gingen mit Sägen und Äxten oder Eispflügen und Eismeißeln auf zugefrorene Gewässer, um sie in riesige Schachbretter zu verwandeln.
Im Jahr 1833 segelte die Brigg Tuscany mit hundertachtzig Tonnen Eis im Bauch von Boston nach Kalkutta. Vier Monate war der Zweimaster unterwegs, bis er im September den Golf von Bengalen erreichte und den heiligen Fluss Ganges hinauffuhr. Die Nachricht von dem Eisschiff verbreitete sich wie ein Lauffeuer; viele hielten sie für eine Lügengeschichte, schon seit Monaten herrschten Temperaturen von über dreißig Grad im Schatten. Trotzdem waren bei der Ankunft noch hundert Tonnen übrig: kristallklares, bläulich schimmerndes Eis.
Es war der Beginn des massenhaften Transports von Wasser aus Neuengland nach Indien. In Kalkutta wurde ein Eishaus mit doppelten Mauern aus weißem Stein erbaut, der Indienhandel brachte der Tudor Ice Company bald die höchsten Gewinne. Der Glücksritter, der ausgelacht worden war und zwei Jahre seines Lebens im Schuldgefängnis verbracht hatte, wurde sagenhaft reich und bekam den Beinamen The Ice King of the World. Seine Schiffe fuhren nach Brasilien, Australien und China.
Andere Firmen wie die New Yorker Knickerbocker Ice Company und die Philadelphia Ice Company drängten auf den Markt. Bahnstrecken wurden gebaut, um die Transportzeiten zu verkürzen, Eiszüge fuhren durchs ganze Land, glutrote Kohlen im Kessel der Lokomotive, die Ladung in den Waggons durchscheinend und kalt.
Zwischen Norwegen und England entwickelte sich ein florierender Eishandel. Von Männern mit schwarzen Mützen und Hüten auf dem Kopf wurden mit Zangen riesige Eisblöcke aus den großen Seen gefischt. Auf langen hölzernen Gleisen glitten sie in die Laderäume von Schiffen, die sie nach London und zu anderen englischen Häfen brachten. So konnte Carlo Gatti, ein italienischsprachiger Schweizer, in der britischen Hauptstadt mehrere Eisstände eröffnen. Zuerst hatte er mit dem Verkauf von Maronen und Waffeln sein Glück versucht, doch dann kam er auf die Idee, Speiseeis herzustellen. Er begann mit ein paar Eiskarren auf der Straße, eröffnete aber bald einen Stand auf dem lebhaften Hungerford Market. Dort verkaufte er Eis in Muschelschalen für einen Penny das Stück. Später wurden die Muscheln durch kleine Gläser ersetzt, die im Volksmund »penny-licks« hießen. Bis dahin war Speiseeis ein Luxus für Wohlhabende gewesen; Carlo Gatti machte die gefrorene Köstlichkeit für das einfache Volk erschwinglich. Es war, als würde er das Tor zu einem Traum aufstoßen.
Sehr viel näher, hinter den Bergen, die Giuseppe Talaminis Welt begrenzten, im österreichischen Saalfelden, arbeiteten ebenfalls Männer mit Spitzhacken und harkten große Brocken gefrorenen Schnee zu einem bereitstehenden Zug. Wer mit einem Heißluftballon in den weiten, wolkenlosen Himmel aufgestiegen wäre, hätte sie vielleicht sehen können, die Männer, die an verschiedenen Orten, ohne voneinander zu wissen, im Schnee schufteten und sich nach einer warmen Mahlzeit sehnten.
Giuseppes Gruppe arbeitete noch vier Stunden, dann waren die Waggons voll, und zwischen den Bergkämmen stand die Sonne hoch am Himmel. Die Pferde bekamen einen Bissen Schnee, die Männer bestiegen einer nach dem anderen die Kutsche. Sie schwiegen, sie waren müde. Bald nickten sie ein, den Kopf auf der Schulter des Nachbarn. Nur Giuseppes Augen waren weit geöffnet. Das Tor zu dem Traum stand einen Spalt offen, und er wollte nichts lieber als eintreten.
WARUM Giuseppe Talamini in die NEUE WELT FLOH
Aus dem Nachbarsmädchen war eine Frau geworden. Schnell war es gegangen, ein Leib, der aus allen Nähten platzte. Aber sie hatte sich in eine Schönheit verwandelt, vollschlank und sinnlich, und sie schämte sich nicht für ihren neuen Körper. Maria Grazia suchte nun selbst die Blicke von Männern, auf der Straße oder beim Bäcker. Sie war sich ihrer Wirkung bewusst, wenn sie den Mund ganz leicht geöffnet hielt, so dass sich die Lippen gerade nicht berührten. Es war eine der schönsten Kombinationen, die es gibt: anmutig und herausfordernd.
Wenn Giuseppe sie auf der Straße sah, schaute er sofort weg. Er hatte Angst vor ihr; ein kurzer Blick auf ihr offenes, welliges Haar reichte, um sein Herz aus dem Takt zu bringen. Sie sprachen kein Wort mehr miteinander, aber seine rechte Hand vermisste ihre linke Hand, die Hand, die er endlose Sommer lang gehalten hatte.
Der Vater des Vaters meines Vaters wohnte in dem Haus, in dem auch ich aufgewachsen bin. Es steht am Rand des Dorfes, das damals kaum kleiner war als heute. Die meisten Häuser haben dicke, Jahrhunderte alte Mauern. Nur leben heute weniger Menschen in ihnen. Nicht nur in den Häusern, auch auf den Straßen ist weniger Leben. Die Menschen meiner Generation sind fortgezogen, in Städte und Metropolen. Mein Bruder kehrt in jedem Herbst, wenn die Eissaison vorbei ist, mit seiner Frau in die Berge zurück, aber er ist eine Ausnahme. Venas di Cadore wird ein Dorf von alten Männern und Frauen, ein Dorf, das sich langsam leert.
Als mein Urgroßvater jung war und von Eis träumte, war Venas noch ein Dorf von Bauern und Handwerkern. Es kam vor, dass ein Glücksritter sein Köfferchen packte und den Ozean überquerte, aber die große Auswanderungswelle kam erst später. Man blieb, wo man geboren worden war, und starb, wo man gelebt hatte. Familien vergrößerten sich, statt immer kleiner zu werden oder auseinanderzufallen. In dem Haus, in dem Luca und ich beide ein eigenes Zimmer hatten, wohnten mein Urgroßvater, seine Geschwister, die Eltern und die Großmutter zu acht. Giuseppe war der älteste Sohn, die Älteste im Haus war die Großmutter, weit über siebzig und wach. Ein volles Haus, gefüllt mit dem Klang von Stimmen und Töpfen.
Als der Herbst sich ankündigte, rief der Vater seinen Sohn zu sich. »Ich habe Arbeit für dich«, sagte er. »Bruno sucht jemanden, der ihm hilft.«
Giuseppe fing an zu strahlen. Bruno war der Sägemüller, der jedes Jahr im Herbst nach Wien ging, um gebratene Maroni zu verkaufen. Die Straßen rochen danach, die prachtvollen Straßen mit stattlichen Häusern; es war ein überwältigender Duft, der im Gedächtnis alte Winter aufleben ließ. Er verlockte die Menschen wie unwiderstehlicher Sirenengesang, sie blieben stehen, aßen Maroni aus Papiertüten und merkten nicht, dass ihre Fingerspitzen ein klein wenig schwarz wurden. Aber Wien war auch die Stadt, in der Eis aus Messingschalen verkauft wurde.
Bruno kam am Nachmittag ins Haus und begutachtete Giuseppes Schultern. Giuseppe und er mussten einen Bratofen für die Maroni mitnehmen.
»Ja«, sagte der Sägemüller und klopfte ihm auf den Rücken, als kaufte er eine Kuh. Giuseppe sah, wie seine Mutter ihn anschaute. Sie war stolz, aber auch still. Sie wollte es hinausschieben, wollte ihn noch bei sich behalten, den Jungen, den sie großgezogen, dem sie durchs Haar gestrichen hatte, wenn er sich fürchtete. Sie fand ihn hübsch, unglaublich hübsch, und hätte es ihm gern ins Ohr geflüstert, so wie sie es früher jeden Tag getan hatte.
Sie gingen zu Fuß, die meisten Menschen reisten noch so; Entfernungen waren damals größer, oft war man wochenlang von einem Ort zum anderen unterwegs. Von Venas nach Wien brauchte man auf Schusters Rappen drei Wochen. Der Ofen war entsetzlich schwer, sie wechselten sich mit dem Tragen ab. An den ersten Tagen trug Bruno ihn weitere Strecken. Er war ein Riese, ein Titan wie Atlas. Sie übernachteten bei Bauern, die wettergegerbte Gesichter und schlechte Zähne hatten. Manchmal lagen sie gleich neben den Kühen. Vor Sonnenaufgang wuschen sie sich mit dem kalten Wasser aus den Bergen.
Nach einer Woche fiel Giuseppe das Tragen leichter, die Last schien an Gewicht verloren zu haben. In Wirklichkeit waren seine Muskeln gewachsen. An den ersten Tagen hatte er gedacht, er würde es mit dem Ofen auf dem Rücken nicht bis nach Wien schaffen. Als er in der Millionenstadt ankam, war sein Nacken stark wie der eines Stiers.
Sie brieten Maroni an einer Ecke des Volksgartens, nicht weit von dem bekannten Café Landtmann, in dem Künstler und Politiker verkehrten und auch Sigmund Freud Kaffee trank. Giuseppe lernte das Handwerk des Maronibraters an einem Tag. Es war auch nicht schwierig, das Wichtigste war, dass die Maroni nicht verkohlten und dass man sich selbst nicht die Finger am Eisen verbrannte. Am nächsten Tag holte Bruno einen zweiten Bratofen, den er im Vorjahr eingelagert hatte. Damit stellte er sich an einer anderen Stelle auf, und so erfüllten sie die Gegend mit Rauch und dem Duft von Maroni, verlockten Anwohner und Spaziergänger, die aus allen Richtungen kamen, sich anstellten und ungeduldig auf ihre Portion warteten. Auf den magischen Moment, wenn sie die geschwärzte Schale aufbrechen konnten und ihnen der süße Duft in die Nase stieg. Eine Auster, die Bernstein enthielt. Die Leute bliesen in ihre Hände, während sie aßen und weitergingen.
Es schneite. Dicke Flocken fielen auf die Strickmützen der Mädchen, Eltern zogen ihre kleinen Kinder auf Schlitten hinter sich her. Er war im vorigen Winter mit Maria Grazia auf einem Schlitten einen Hang hinuntergefahren. Sie waren gestürzt. Ein Fuß tief im Schnee, ihre roten Wangen nur einen Kuss von seinem Mund entfernt, aber sie waren Kinder, Nachbarsjunge und Nachbarsmädchen, und rannten schnell hinter dem Schlitten her, der weitergefahren war.
In der weißen Welt von Wien dachte er an die neuen Formen ihres Körpers. Er konnte sie in seiner Fantasie stundenlang betrachten. Dafür hatte er zu bestimmten Tageszeiten reichlich Gelegenheit, wenn niemand auf den Straßen zu sein schien und die Stille des Schnees ohrenbetäubend war.
Ein paar Tage später kam die Kälte. Kreideweißes Licht am Morgen und schneidender Wind. Passanten wärmten sich an seinem Ofen. Und dann waren die Maronen aufgebraucht. Er verkaufte die letzte Portion an einen steinalten Mann.
»Danke«, sagte der Greis mit papierdünner Stimme.
Giuseppe hatte inzwischen ein wenig Deutsch gelernt. Er lebte »weit weg« und war »zu Fuß« nach Wien gekommen. »Jawohl, den ganzen Weg.« Die Leute hatten ihn angestarrt, als wäre er auf dem Wasser gewandelt. Mit einem Ofen auf dem Rücken.
»Wir können wieder heim«, sagte Bruno. »Deine Mutter hat dich sicher sehr vermisst.«
Giuseppe nickte. Er konnte es kaum erwarten, wollte aber erst noch zu einem Italiener, mit dem er vor einer Woche beim Maronibraten gesprochen hatte. Er war ein Eismacher, der in Wien lebte. Giuseppe konnte ihm eine Eismaschine abkaufen.
»Weißt du, wie sie funktioniert?«, fragte der Mann, als sie in seiner Werkstatt standen.
Giuseppe dachte an Enrico Zangrandos Worte. Drehen, drehen, drehen. Die helle Glut, die ganz von selbst durch die Eismasse bricht.
»Das wichtigste ist ein gutes Rezept«, erklärte der Eismacher.
»Wie komme ich an ein gutes Rezept?«
»Die besten sind geheim, aber eins kann ich dir geben. Wenn du damit zurechtkommst, musst du einfach etwas anderes ausprobieren.« Als er weitersprach, dämpfte er die Stimme, vielleicht ohne es zu merken. »Alles ist möglich, man kann aus allem Eis machen.«
Worte eines Propheten.
Der Mann war klein und drahtig, Anfang fünfzig. Er hatte einen langen, für seine Herkunft recht vornehmen Namen, Massimiliano, aber in Wien nannten ihn alle Max. Den Weg, den Giuseppe gegangen war, hatte er unzählige Male zurückgelegt, nach Wien im Frühjahr, wenn sich die Gipfel und Grate scharf gegen den leeren, hellblauen Himmel abzeichneten, zurück im Herbst. Doch jetzt hatte er auch eine Wohnung in der Stadt, über der Werkstatt, die inzwischen ihm gehörte.
Als erster Eismacher war Antonio Tomeo Bareta nach Wien gekommen. Er stammte aus Zoldo, einem kleinen Dorf in den Dolomiten nicht weit von Venas di Cadore, und hatte 1865 eine offizielle Konzession für den Verkauf von »Gefrorenem« in der österreichischen Hauptstadt erhalten. Bareta war später nach Leipzig gegangen und hatte dort ein Unternehmen mit vierundzwanzig Eiswagen geführt; schließlich ließ er sich in Budapest nieder, wo er mehrere Eiscafés eröffnete und sechzig Eisverkäufer beschäftigte, die mit seinen Karren durch die Stadt zogen, Männer mit einheitlichen Mützen und ledernen Geldtaschen am Gürtel. Die Wiener Konzession verkaufte er an Massimiliano.
Giuseppe trug die Eismaschine ganz allein zu seinem Dorf, Bruno brauchte ihm nicht zu helfen. Es war eine Holztonne mit einem Metallzylinder und einer Handkurbel.
Nach ihrer Rückkehr bot Bruno ihm Arbeit in seiner Sägemühle an. Aber Giuseppe wollte kein Holz sägen. Sein Vater schüttelte den Kopf. »Was willst du denn sonst tun?«, fragte er. »Du bist ein Mann, du musst arbeiten.«
»Ich will Eis machen«, verkündete Giuseppe.
»Im Winter?«
»Es wird bald Frühling.«
»Du hast den Verstand verloren!«
Die Großmutter mischte sich ins Gespräch. »Das liegt in der Familie«, sagte sie. »Mein Mann hat seinen Verstand in der Hochzeitsnacht verloren.«
Stimmen füllten das Haus. Nur Giuseppes Mutter schwieg, seine Geschwister flüsterten. Sie standen im Flur und betrachteten voller Neugier den glänzenden Zylinder in der Holztonne. Der jüngste Bruder drehte ganz vorsichtig die Kurbel und rannte dann schnell weg.
Massimiliano hatte ihm ein Rezept für Kirsch-Sahneeis gegeben, aber es war Februar. Die ersten Kirschen würden erst im Juni, allerfrühestens Ende Mai reifen. Auf dem Land von Enrico Zangrando stand ein alter Baum; jeden Sommer kletterte Giuseppe heimlich hinein und aß Kirschen, bis er trunken von ihrer Süße herausfiel.
Seine Mutter kaufte jedes Jahr Kirschen auf dem Markt und machte Marmelade daraus, die Gläser standen im Keller. Mit der Marmelade wurden dicke Scheiben Brot bestrichen.
Giuseppe bat um drei Gläser. Seine Mutter gab ihm fünf, den ganzen Vorrat.
Im ersten Morgenlicht brach er in die Berge auf, den großen Korb, in dem er im Sommer Heu von den steilsten Hängen hinuntertrug, auf dem Rücken. Es wurde ein warmer, sonniger Tag, aber Giuseppe machte erst Halt, als er unter seinen Schuhen Schnee knirschen hörte. Er war auf zweitausend Metern Höhe am Antelao, dem König der Dolomiten. Viel höher, auf der Nordseite des pyramidenförmigen Gipfelmassivs, lagen zwei Gletscher, sie glitzerten in der Sonne wie eine Halskette. Giuseppe setzte den Korb ab und begann zu graben. Er war der einzige Mensch weit und breit, alle Geräusche hallten von den Felsen wider. Was er tat, kam ihm nicht vor wie Ernten, sondern wie Diebstahl.
Er stahl dem König Schnee.
SIE WOLLEN WISSEN WIE ES WEITER GEHT?
www.btb-verlag.de
Deutsche Erstausgabe Mai 2016
btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2015 by Ernest van der Kwast
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel De Ysmakers bei De Bezige Bij, Amsterdam / Antwerpen
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © azureforest/Getty Images, Shutterstock/Picsfive
Schrift: © The Fell Types are digitally reproduced be Igino Marini.
www.iginomarini.com
Begeisterte Pressestimmen zu DIE EISMACHER
»Man verliebt sich augenblicklich in die
eiscremebunten Figuren dieser
herzerwärmenden Familiengeschichte!«
JAN
»Ein wunderschöner Roman über eine
italienische Familie von Eiscrememachern.
BEZAUBERND, LIEBEVOLL, SINNLICH –
beim Lesen läuft einem immer wieder das
Wasser im Mund zusammen.«
De Telegraaf
»Bei der zweiten Lektüre dieses wunderbaren
Romans merkt man erst, wie RAFFINIERT
die teils EINENGENDEN FAMILIENBANDE
und die Sehnsucht des Einzelnen nach Freiheit
über die Generationen hinweg MITEINANDER
VERZAHNT sind und einander bedingen.«
NRC Handelsblad
»Ein mitreißender, bewegender Roman über
die tiefe Beziehung zweier Brüder.«
Algemeen Dagblad
»Eine
wunderbar poetische
FAMILIENSAGA.«
Glamour
»DIE LEIDENSCHAFT
dafür, gute Eiscreme herzustellen,
DIE KUNST,
neue Geschmacksrichtungen zu kreieren,
DIE GESCHICHTE
der traditionellen Eismacher, die das Eis aus
dem Schnee der Berge herstellten -
all dies verleiht diesem Pageturner seinen
EINZIGARTIGEN CHARME.«
Dagblad van het Noorden
»Stil, Timing, das Flair der Sprache - van der Kwast ist einer der BESTEN!«
Vrij Nederland
»Sinnlich und bewegend zugleich.«
Humo
»Dieses Buch reißt seine Leser mit wie eine Lawine.
Van der Kwast beschreibt sowohl die Verbundenheit einer
Familie als auch die Zwänge, die Traditionen mit
sich bringen. Und er erzählt die Geschichte in einem
schmetterlingsleichten Ton.«
de Persdienst
Abonnieren Sie unseren Newsletter unter:
www.btb-verlag.de/newsletter
Besuchen Sie uns auf www.btb-verlag.de oder facebook.com/btbverlag