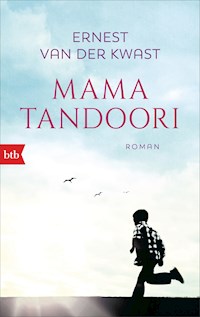
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Vater hegt keinerlei Zweifel: es wird ein Mädchen. Die Geburtsanzeige für Eva van der Kwast liegt bereits beim Drucker. Als dann sehr zur Bestürzung der Eltern in einer Klinik in Bombay 1981 der kleine Ernest das Licht der Welt erblickt, nimmt ein nicht ganz unbelastetes Verhältnis zwischen Sohn und Eltern seinen Lauf.
In seinem autobiografisch gefärbten Roman präsentiert Ernest van der Kwast einen bunten Reigen von Charakteren, von Bollywood Star Onkel Sharma bis zu seiner Tante Jasleen, einer einstmals erfolgversprechenden Siebenkämpferin. Allen voran aber seine Mutter, die Matriarchin des Klans, geliebt und gefürchtet, eine Tyrannin mit dem Herzen einer Löwin. Eine Frau von eisernem Willen, beinahe absurder Gründlichkeit und bei aller Stärke erfüllt von einer tiefen Traurigkeit um ihren behinderten Sohn Ashirwad. Sie ist es, bei der alle Fäden der Geschichte zusammenlaufen. »Mama Tandoori« lässt einen Staunen, Nachdenken und Lachen - ein wunderbar witziges Famlienporträt, das mitten ins Herz trifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Der Vater hegt keinerlei Zweifel: es wird ein Mädchen. Die Geburtsanzeige für Eva van der Kwast liegt bereits beim Drucker. Als dann zu seiner Bestürzung in einer Klinik in Bombay der kleine Ernest das Licht der Welt erblickt, nimmt ein nicht ganz unbelastetes Verhältnis zwischen Sohn und Eltern seinen Lauf.
In seinem autobiografisch gefärbten Roman präsentiert Ernest van der Kwast einen bunten Reigen von Charakteren, von Bollywood Star Onkel Sharma bis zu seiner Tante Jasleen, einer einstmals erfolgversprechenden Siebenkämpferin. Allen voran aber seine Mutter, die Matriarchin des Klans, geliebt und gefürchtet, eine Tyrannin mit dem Herzen einer Löwin. Eine Frau von eisernem Willen, beinahe absurder Gründlichkeit und bei aller Stärke erfüllt von einer tiefen Traurigkeit um ihren behinderten Sohn Ashirwad. Sie ist es, bei der alle Fäden der Geschichte zusammenlaufen.
Zum Autor
ERNEST VAN DER KWAST wurde 1981 in Bombay geboren und ist halb indischer, halb niederländischer Herkunft. Seine Romane sind internationale Bestseller. In Deutschland erschienen bisher »Fünf Viertelstunden bis zum Meer« und »Die Eismacher«. Ernest van der Kwast lebt mit seiner Familie in Rotterdam.
Ernest van der Kwast
MAMA TANDOORI
RomanAus dem Niederländischenvon Andreas Ecke
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die niederländische Originalausgabe erschien unter dem Titel »MAMA TANDOORI« bei De Bezige Bij, Amsterdam.
Copyright © 2010 by Ernest van der Kwast
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv © Trevillion/Elisabeth Ansley
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18756-9V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
ZWEI KOFFER
Alles begann mit zwei Koffern. Meine Mutter kam 1969 mit zwei Koffern voller Armbänder, Halsketten und Ohrringe in die Niederlande. Sie fand eine Stelle als Krankenpflegerin und ein Zimmer im Schwesternwohnheim. Die Koffer versteckte sie unterm Bett, nach Ansicht von Indern der beste Ort für die Aufbewahrung wertvoller Dinge. »Einbrecher schauen nie unter Betten«, vertraute sie mir einmal an. Mein Vater flüsterte mir ins Ohr: »In Indien hat fast niemand ein Bett.«
Jahrelang blieben die zwei Koffer unter dem Bett meiner Mutter liegen. Bis mein Vater, ein linkischer Mann mit Segelohren, ein typischer Holländer, sich in die Exotin verliebte, die meine Mutter in seinen Augen war. Ich weiß nicht, was genau sich zwischen den beiden abgespielt hat, und will es eigentlich auch nicht wissen. Belassen wir es hierbei: Die Koffer zogen irgendwann in ein winziges Häuschen in der Bloemstraat um und landeten dort unter einem Doppelbett.
Mein Vater studierte Medizin und vergrub sich den ganzen Tag bis zu den Segelohren in seinen Lehrbüchern. Meine Mutter arbeitete als Krankenpflegerin und sorgte fürs tägliche Brot. Oder in ihrem Fall: fürs tägliche Naan. »Dein Vater war so arm wie eine Ratte in Delhi«, vertraute meine Mutter mir an. Mein Vater flüsterte mir ins Ohr: »Wäre ich bloß eine Ratte in Delhi.«
Das Häuschen in der Bloemstraat war hellhörig, stand schief und müffelte noch schlimmer als die Achselhöhlen meines Vaters. So jedenfalls lautet die Version meiner Mutter. Es gibt keine Möglichkeit mehr, sie zu verifizieren. Die Häuser in der Bloemstraat sind abgerissen worden; wo meine Eltern gewohnt haben, steht heute ein Koloss von einem Etagenhaus. Die Zeit ist ein schrecklicher Allesfresser, ein unersättlicher Omnivor. Der Gestank unter den Achseln meines Vaters scheint allerdings unvergänglich zu sein. Nach Ansicht meiner Mutter hängt das mit seinem Beruf zusammen. Er ist Pathologe.
»Was rieche ich da?«, hat meine Mutter bei Tisch oft gefragt.
»Mmh«, sagte mein Vater. »Tandoori Chicken.«
»Ich rieche Leichen!«, schrie meine Mutter. »Der Gestank von Toten verdirbt mein Essen!«
Mein Vater hielt seine Nase über den Teller. »Köstlich«, erwiderte er. »Tandoori Chicken.«
»Es kommt aus deinen Achselhöhlen!«, brüllte meine Mutter. »Der Leichengeruch setzt sich unter deinen Achseln fest! Du sollst die Arme an den Körper drücken!«
Wenn ich an früher denke, sehe ich, wie mein Vater am Kopfende des Tisches sitzt, die Oberarme krampfhaft an den Brustkorb drückt und unbeholfen mit dem Besteck hantiert.
In meiner Jugend habe ich meinen Vater nie an seinem Arbeitsplatz besucht, aus Angst, er könnte mit den Armen bis zu den Achseln in einer Leiche verschwunden sein.
Das hellhörige, schiefe, stinkende Häuschen in der Bloemstraat war keine Dauerlösung, schon bald wurde ein neues Domizil gesucht. Meine Mutter fand es in der Jericholaan im schicken Rotterdamer Stadtteil Kralingen. Nummer 81 war ein Stadthaus mit drei Stockwerken, einem großzügigen Garten und einem Mieter, Herrn Gerritsen. Ich habe Herrn Gerritsen nie kennenlernen dürfen. Als ich geboren wurde, war er schon aus dem Haus geflohen, wobei er mit schriller Stimme »Sie ist der Teufel! Sie ist der Teufel!« rief.
Das Haus in der Jericholaan kostete ein Vermögen, doch es gelang meiner Mutter, den Preis herunterzuhandeln. Sie handelte jeden Preis herunter, ob es um Kleidung, Möbel, Küchengeräte oder Hühnerfilet ging. Herunterhandeln war ihr Hobby, mehr noch: ein Sport. Meine halbe Jugend habe ich in Läden und Kaufhäusern damit verbracht, auf den Moment zu warten, in dem der Verkäufer nachgab. Ich erinnere mich, wie meine Mutter in einem Bettengeschäft sagte: »In Indien bekommt man dafür hundert Etagenbetten.« Ich hütete mich zu sagen, dass es in Indien gar keine Etagenbetten gibt, sondern tat, was mir befohlen worden war. Ich legte mich auf eine Matratze, von der ich mich erst auf ein Zeichen meiner Mutter wieder erheben durfte. Das kam um sechzehn Uhr dreißig, sechs Stunden, nachdem wir das Geschäft betreten hatten. Der Verkäufer sah aus wie nach einem Boxkampf über zwölf Runden. Um die Lippen meiner Mutter spielte ein triumphierendes Lächeln. Sie hatte einen Preisnachlass von achtzig Prozent ausgehandelt.
Auch der Makler, der ihr das Haus in der Jericholaan verkaufte, zog den Kürzeren. Es heißt, dass meine Mutter die beiden Koffer gegen das Haus eintauschen wollte. Der Makler begriff nicht, was sie meinte. »Sie können nur mit Geld bezahlen«, erklärte er, worauf meine Mutter in Zorn geriet. »Sie beleidigen mich!«, rief sie. »In Indien kann man mit diesen beiden Koffern eine ganze Stadt kaufen!«
Der Makler starrte die Koffer an, auf seiner Stirn bildeten sich tiefe Falten, sein Blick verfinsterte sich. Vielleicht dachte er darüber nach, ob er doch einen anderen Beruf hätte ergreifen sollen. Ich glaube, Menschen, die meiner Mutter begegneten, mussten zu der Überzeugung gelangen, dass sie in ihrem Leben den falschen Weg eingeschlagen hatten.
Meine Mutter deutete das Schweigen des Maklers als Ausdruck von Interesse. Sie zählte die Schmuckstücke in den Koffern auf: Nasenringe, Fußkettchen, Armbänder, Ohrringe, Halsketten, sogar ein goldenes Diadem.
Der Makler blickte hilfesuchend meinen Vater an, der sich jedoch an sein Sprechverbot hielt. Mein Vater durfte lediglich atmen und nicken (dies natürlich nur zu Äußerungen meiner Mutter).
Vorsichtig nannte der Makler den Angebotspreis. Meine Mutter schüttelte den Kopf, teilte die Summe durch zwei, zog zehntausend ab, rechnete das Zwischenergebnis in Rupien um, teilte den Betrag ein weiteres Mal durch zwei und nannte das Endergebnis.
Mein Vater fing den Makler auf und flüsterte ihm ins Ohr: »Halb so schlimm, alles halb so schlimm. Bedenken Sie, dass Sie nicht mit ihr verheiratet sind.«
Es folgten noch viele weitere Besichtigungen, und jedes Mal versuchte meine Mutter, den Preis herunterzuhandeln. Der Makler fiel nicht mehr in Ohnmacht, musste sich aber nach jeder Besichtigung auf den steinernen Stufen vor der Haustür ausruhen. Auch er hat vermutlich ausgesehen wie nach einem Boxkampf über zwölf Runden.
Schließlich verkaufte meine Mutter den Inhalt der beiden Koffer an die führenden Juweliere von Rotterdam. Vom Erlös bezahlte sie das Haus Jericholaan 81.
Wer an dieser Transaktion zweifelt, sollte gute Reflexe haben, er könnte sonst einen kräftigen Schlag mit dem Nudelholz kassieren. In meiner Kindheit war es nicht ungewöhnlich, dass wir kein Roti aßen, weil das Nudelholz kaputt war.
In meiner Erinnerung sehe ich meinen Vater mit einem Eisbeutel auf dem Kopf und höre ihn murmeln: »Wäre ich bloß eine Ratte in Delhi, wäre ich bloß eine Ratte in Delhi …«
Unter dem Bett meiner Eltern in der Jericholaan lagen nun keine Koffer mehr. Stattdessen andere wertvolle Dinge wie ein geerbtes Mikroskop und säckeweise Basmati-Reis. Mein Vater hatte sein Studium inzwischen abgeschlossen und arbeitete als Arzt im Praktikum. Für ein Gehalt, das nach Ansicht meiner Mutter dem Lohn eines Gepäckträgers im Bahnhof von Bombay entsprach.
Bombay – die Stadt, in der ich geboren wurde. Bis heute ist es mir ein Rätsel, warum ich nicht wie meine beiden Brüder in den Niederlanden zur Welt kam. Warum meine Mutter mir in Bombay das Leben schenkte, während mein Vater in Rotterdam war. Eigentlich kann ich es mir nur mit einem sensationellen Sparpreis erklären. Sonderangebote üben auf meine Mutter eine überwältigende Anziehungskraft aus, so wie ein rotes Tuch den Stier in Fahrt bringt.
Ich stelle mir folgendes Szenario vor: Air India lässt Kinder gratis mitfliegen. Hin gilt das Angebot »drei zum Preis von einem«. Und zurück sogar »vier zum Preis von einem«. Nur müsste mein Vater dann zu Hause bleiben. Und das hat er getan, ob freiwillig oder nicht.
Kaum hatte ich Mutters Bauch verlassen, rief Onkel Sharma meinen Vater an. Der glaubte nach dem Gespräch, ich wäre ein Mädchen. »Da saßen Vögelchen auf der Leitung«, flüsterte er mir einmal ins Ohr, nachdem meine Mutter mir anvertraut hatte, er sei stocktaub und höre nur, was er hören wolle. »Deodorant ist ein Wort, das dein Vater nie hört. Seife ist ein Wort, das dein Vater nie hört. Würdest du bitte duschen? ist ein Satz, den dein Vater nie hört.«
Doch ich schweife ab. Zurück zu den zwei Koffern. Sie hatten die Gestalt eines imposanten Stadthauses in Kralingen angenommen. Meine Eltern bewohnten das Hochparterre und den ersten Stock, Herr Gerritsen das Dachgeschoss. Das ging so lange gut, bis meine Mutter das Wort »Mieterschutz« lernte. Es entschlüpfte dem Mund von Herrn Gerritsen. Meine Mutter explodierte. »Mieterschutz!«, rief sie, als wäre das eine gefährliche Geschlechtskrankheit. »Raus aus meinem Haus! Sofort raus aus meinem Haus!« Aber Herr Gerritsen blieb. Jedenfalls noch drei Tage.
Am ersten Tag verbrannte meine Mutter im Garten hinterm Haus schwarze Müllsäcke. Während der Rauch den Himmel verdunkelte, rief sie: »Fort mit dir, Geist! Böser Geist von Herrn Gerritsen, verschwinde!« Außerdem stand sie um drei Uhr in der Nacht auf und klopfte mit einem Besenstiel an die Decke. Dabei sprach sie eine traditionelle Formel, die in Indien rezitiert wird, wenn jemand eine tödliche Krankheit im Endstadium hat.
Am zweiten Tag radelte meine Mutter zum Erlebnisbauernhof im Kralinger Wäldchen und stahl dort Mist von der Kuh. Beinahe wurde sie erwischt, weil sie nur frischen Mist haben wollte. Ein Vorschulkind schlug Alarm. »Mama! Mama! Die Frau da steckt die Kacke von Bella in ihre Tasche!« Sicher zu Hause angekommen, zog meine Mutter die Gummihandschuhe an und begann, für ihren Mieter Plätzchen zu backen.
Am dritten Tag litt Herr Gerritsen unter Durchfall, und meine Mutter drehte das Wasser ab. Zusätzlich hämmerte sie ununterbrochen mit dem Besenstiel an die Decke und rezitierte die traditionelle Formel.
Am vierten Tag bereitete meine Mutter ein Festmahl zu, um sämtlichen Hindugöttern für Herrn Gerritsens plötzlichen Auszug zu danken.
So stieg der Wert der beiden Koffer auf den eines Stadthauses ohne Mieter.
Meine Eltern wohnten zehn Jahre in der Jericholaan, die Familie vergrößerte sich nicht weiter. Meine Mutter hatte aufgehört zu arbeiten, denn drei Söhne machten genug Arbeit. Mein Vater war approbiert worden und hatte eine Stelle als Assistenzarzt. Er verdiente nun so viel »wie ein Rikschaläufer in Bangalore«.
Ich hatte eine gute Kindheit, vielleicht aber nur, weil ich zu jung war, um die Bedeutung all dessen zu erfassen, was um mich herum vorging. Ich glaubte, dass wir eine normale Familie wären, dass zu jeder Familie eine Mutter wie meine gehörte und ein Vater, der »wäre ich bloß eine Ratte« murmelte. Wenn nicht in Delhi, dann in Rotterdam, Deventer oder Goes.
Mein ältester Bruder ist geistig behindert. Er ist der Einzige, der es bis heute für normal hält, dass Väter beim Essen die Arme an den Oberkörper pressen, dass Müllsäcke im Garten verbrannt und Makler mit einem Nudelholz attackiert werden. So geschehen, als das Haus Jericholaan 81 verkauft werden sollte, ein Jahrzehnt nach dem Einzug meiner Eltern.
Meine Mutter hatte ein Auge auf ein noch besseres Haus geworfen. Eine Villa mit Garage, Terrasse und Aussicht auf den Kralingse Plas, den See im Kralinger Wäldchen. »Die können wir uns unmöglich leisten«, sagte mein Vater, worauf meine Mutter entgegnete: »Die kannst du dir unmöglich leisten.«
Meine Mutter plante, das Haus Jericholaan 81 mit so hohem Gewinn zu verkaufen, dass der Erlös für die Villa ausreichen würde. Der Makler, an den sie sich wandte, war ein anderer als beim Kauf des Hauses. Wahrscheinlich arbeitete der Makler von damals inzwischen als Bibliothekar, in tiefer Stille, zwischen endlosen Reihen von Büchern.
Der neue Makler bezeichnete die Summe, die meine Mutter für das Haus verlangte, als »exorbitant«. Meine Mutter erweckte den Eindruck, das Wort nicht zu kennen und deshalb ein Wörterbuch holen zu wollen. Doch als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, hatte sie ein Nudelholz in der Hand. »Exorbitant?!«, schrie sie, als wäre auch das eine Geschlechtskrankheit. »Raus aus meinem Haus!«
»Rennen«, sagte mein Vater.
Der Makler sprang vom Stuhl auf und floh aus dem Haus.
Mein ältester Bruder rief: »Los, Mama, los!«
Mein anderer Bruder und ich schwiegen beschämt. Zu dem Zeitpunkt wussten wir bereits, dass wir keine normale Familie waren.
Der Makler kam nicht wieder, und meine Mutter beschloss, den Verkauf des Hauses selbst in die Hand zu nehmen. Wir sahen nun jede Woche jemand anderen aus dem Haus fliehen. Meine Mutter war in ihrer Jugend eine vielversprechende Leichtathletin gewesen, auf ihrem Nachtschränkchen standen große Pokale. Sie waren glanzlos und rostig geworden, doch die Beine meiner Mutter hatten sich ihre Spannkraft erhalten, selbst mit vierzig konnte sie noch erstaunlich gut sprinten. Manchmal packte sie einen potenziellen Käufer auch am Kragen und schleuderte ihm ihr Standardargument in einer speziellen Variante ins Gesicht: »Zu diesem Preis bekommt man in Indien nicht mal eine Wellblechhütte!«
Das Parkett in der Diele war bereits etwas abgewetzt, als eines Tages ein älterer Herr ein Angebot machte, mit dem meine Mutter leben konnte. Zur Höhe des Betrags kursieren zwei verschiedene Angaben. Die meines Vaters, die meiner Mutter. Da sie immer recht hatte, muss die Summe doppelt so hoch wie der Kaufpreis der Villa gewesen sein …
Die Villa wurde gekauft. Ein Bekannter meiner Mutter machte den Umzug mit seinem blauen Lieferwagen. Richtige Umzugsunternehmen waren zu teuer, in Indien gab es so etwas gar nicht. Und so fuhr ein alter Lieferwagen siebenunddreißig Mal zwischen der Jericholaan und der Tiberiaslaan hin und her. Meine Mutter hatte im Lauf der Jahre eine geradezu krankhafte Sammelwut entwickelt. Hingebungsvoll wie eine Heilsarmee-Soldatin erbarmte sie sich des Sperrmülls anderer Leute. Was sie an der Straße abstellten, nahm meine Mutter mit nach Hause. Kaputte Radios, rostige Fahrräder, angestoßene Möbel, alles schleppte sie in die Jericholaan. Irgendwann würde sie die Sachen nach Indien schaffen und Menschen damit glücklich machen. Das war ihr Traum. Sie war davon überzeugt, dass die Ärmsten der Armen, die Parias, die nichts als ihren Körper besitzen, sich über alles freuen. Auch über einen Fernseher ohne Bildschirm.
Die frühen Jahre meiner Mutter sind ein dunkler Fleck. Ich weiß kaum etwas darüber, die Scham verschließt ihren Mund. Doch manchmal wacht sie nachts aus einem Albtraum auf, einem Traum von einem Leben in Armut, vor langer Zeit. Dann öffnet ein Schrei ihren Mund, und das Schwarz der Nacht ist tröstlich und hundertmal heller als der dunkle Fleck ihrer frühen Erinnerungen.
Die Anwohner der Tiberiaslaan verfolgten hinter ihren Lamellen ängstlich das Umzugsgeschehen. In ihren Augen muss der blaue Lieferwagen das Gegenteil eines Müllwagens gewesen sein. Immer wieder wurde eine Fuhre Hausrat auf dem Gehweg abgeladen, elektrische Geräte, Fahrräder und Möbel türmten sich bald zu einem Berg auf. Einem Berg, der immer noch auf dem Gehweg lag, als der nächste Morgen dämmerte. Der Umzug dauerte da schon länger als achtundzwanzig Stunden. Nach jeder Fahrt rief mein Vater: »Nie wieder ziehe ich um!«
Noch dreimal sollten meine Eltern umziehen, oder vielmehr zweieinhalbmal.
An dem Tag, an dem mein Debütroman erschien, dem 24. Februar 2005, verkündeten meine Eltern, dass sie nach Kanada auswandern würden. Meinem Vater war eine Stelle in Toronto angeboten worden, mit deutlich höherem Gehalt. Nach indischen Begriffen durchschnittlich, meinte meine Mutter.
Wie die königliche Familie reist, so reisten meine Eltern nach Toronto: in verschiedenen Flugzeugen. Der Grund dafür hatte wenig mit monarchischen Gepflogenheiten zu tun. Meine Mutter brauchte drei Monate für das Einpacken von Krempel in Kartons. Während mein Vater jenseits des Atlantiks lebte und arbeitete, bereitete meine Mutter Tag und Nacht das Verschiffen ihrer Sammlung vor. Tagsüber klapperte sie mit dem Fahrrad Rotterdamer Supermärkte ab und nahm mit, was sie an leeren Kartons bekommen konnte. Nachts wurden die Kartons gefüllt. Was für den Transport von Schokoladenstreusel, Kaffee oder Obst benutzt worden war, enthielt nun gesammelten Müll, von ausrangierten Telefonen bis zu verschlissenen Fahrradsätteln.
Mit zwei Koffern war meine Mutter von Indien in die Niederlande ausgewandert; als sie nach Kanada zog, reichten zwei Container nicht aus. Die ganze Aktion war eine logistische Herausforderung und glich mehr dem Organisieren des Nachschubs für eine Armee.
Mein Vater empfing meine Mutter in ihrem neuen, aber nur vorläufigen Zuhause, einer Wohnung in einem Stadtviertel, in dem man hauptsächlich Männern in schwarzen Lederhosen begegnete. Mein Vater hatte nicht selbst ein Haus oder eine Wohnung kaufen dürfen. Nach Ansicht meiner Mutter war er dazu nicht fähig. Deshalb hatte er sich mit einer Mietwohnung begnügt. »Zwischen lauter Schwulen!«, rief meine Mutter.
»Sie ist billig«, erwiderte mein Vater, der inzwischen selbst glaubte, er wäre bettelarm. Für ihn war es am einfachsten, ihre Version seiner Lebensgeschichte zu akzeptieren: Seine Frau hatte aus Indien Juwelen mitgebracht, mit denen sie ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus erwarb. Er verdiente so viel wie ein Schneider in Bhopal … Wenn er sich daran hielt, herrschten Ruhe und Frieden, so dass er wie jeder andere Mann auf dem Sofa Zeitung lesen konnte, ohne mit einem Nudelholz bedroht zu werden.
Meine Mutter fand schnell eine neue Wohnung in der Bloor Street, im exklusiven Rosedale-Apartment-Komplex (mit Schwimmbad, Fitnessstudio und Bibliothek). Beim Umzug bildeten sich lange Schlangen vor den vier Aufzügen, mit denen den ganzen Tag Kartons zum 23. Stock hinaufgeschafft wurden. »Wollen Sie einen Supermarkt eröffnen?«, fragte eine ältere Dame meine Mutter. Der Concierge war weniger naiv und erkannte deshalb sofort, welche Art Frau meine Mutter war. Eine, vor der man sich in Sicherheit bringen musste.
George war ein kleiner, ältlicher Mann mit Hornbrille und saß am Empfang der Apartment-Anlage. Seine Arbeit bestand darin, Bewohner zu begrüßen (»Good morning, Miss Henderson!« »Have a nice day, Mister Glennon!«) und hin und wieder einen Anruf entgegenzunehmen. Es war die ideale Stelle für George. Er konnte den ganzen Tag auf seinem Stuhl sitzen; so verging die Zeit, so plätscherten seine Tage in Richtung Ruhestand. Bis meine Mutter in sein Leben trat. Wie alle Bewohner von Rosedale bezahlte sie »Servicegebühren«, aber nur sie zog daraus den Schluss, dass George ein servant sei, wie es sie in indischen Oberschicht-Haushalten gibt. Eine Art Edelsklave also.
»Georrrge«, pflegte meine Mutter in gebieterischem Ton zu sagen, »can you pick up those banana boxes and bring them to my apartment?« Oder: »My flowers are dying, don’t forget to water them today.« Oder: »My husband really needs deodorant.«
Die Folge war, dass George sich versteckte, sobald die Stimme meiner Mutter durch die marmorne Eingangshalle schallte. Es gab noch andere Concierges, doch die fragte meine Mutter höchstens: »Do you know where George is?« Sie behaupteten dann, er käme erst am Nachmittag oder am Abend.
Strenge Winter und lange Sommer gingen ins Land. Und dann vernahm George die vielleicht schönste Nachricht seines Lebens: dass meine Eltern umziehen würden. Er hockte unter der Empfangstheke, als er meine Mutter zu einer Nachbarin sagen hörte: »We’re going to move.« Sie zählte die Vorteile der neuen Eigentumswohnung auf: zwei Badezimmer, höhere Decken, ein Wintergarten. George sprang auf, und ihm kamen die Tränen, als meine Mutter hinzufügte: »Of course we’ll miss George terribly …«
Nach drei Jahren Rosedale fand meine Mutter, es sei an der Zeit, wieder umzuziehen. Sie hatte eine noch nicht fertig ausgebaute Luxus-Eigentumswohnung ganz in der Nähe des Mount Sinai Hospital entdeckt. Von dort konnte mein Vater zu Fuß zur Arbeit gehen. Bisher fuhr er täglich zwanzig Minuten mit dem Rad, im Verkehr einer Millionenstadt. Auch bei Schnee oder fünfzehn Grad unter Null. Das Fahrrad hatte meine Mutter aus der Rosedale-Tiefgarage gestohlen. Dort standen zwei verlassene Fahrräder mit einer dicken Staubschicht auf den Sätteln, eins für meine Mutter, eins für meinen Vater. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ein Schloss, das mit einer Feile geöffnet wird. Mein Vater steht Schmiere, wobei er vor sich hin murmelt; er betet zu sämtlichen indischen Göttern: »Lasst meine Frau ihren Verstand wiederfinden.« Meine Mutter feilt unbeirrbar weiter. Sie tut nichts Unrechtes, sie erbarmt sich zweier Fahrräder. Und wenn ich die Augen öffne, sehe ich diese Zeilen vor mir. Ich hoffe, dass ich nichts Unrechtes tue, ich erbarme mich meiner Eltern.
Während es George von Tag zu Tag besser ging, wählten meine Eltern bei der Immobilienfirma den Marmor für die Badezimmer aus, das Holz für die Parkettböden, die Farben für die Wände. Auch die Küche konnten sie ihren Wünschen entsprechend zusammenstellen: Arbeitsplatten aus Granit oder Edelstahl, rote oder zitronengelbe Schränke. Vier Monate später war alles fertig, und die Übergabe ihres nagelneuen Apartments im 40. Stockwerk fand statt.
Doch meine Eltern zogen nicht um. Die offizielle Begründung lautete, das Wohnzimmer sei zu klein, das neue Schwimmbad habe keine Fenster, und so gut wie alle Nachbarn seien Chinesen. Nicht, dass meine Mutter etwas gegen Chinesen im Besonderen hätte. Sie hat nur etwas gegen Menschen, die sie nicht verstehen, und deren Anzahl übersteigt deutlich die aller Chinesen auf der Welt.
Der wirkliche Grund war der, dass meine Mutter den Umzug zu teuer fand. Der Überseetransport von Rotterdam nach Toronto war vom Arbeitgeber meines Vaters bezahlt worden, den Umzug innerhalb Torontos mussten meine Eltern selbst finanzieren. Meine Mutter hatte es sehr eilig, die Schlüssel des neuen Apartments wieder loszuwerden, nachdem sie sich bei mehreren Umzugsunternehmen nach den Preisen erkundigt hatte. »Penny-wise and pound-foolish«, sagen die Briten, ein Ausdruck, der das Verhalten meiner Mutter perfekt charakterisiert. Das Schicksal meines Vaters erscheint dadurch noch tragischer.
Meine Eltern hatten das Glück, dass ihr Apartment im Rosedale-Komplex noch nicht verkauft war. George war untröstlich. Als meine Mutter sagte: »I have such good news. We’re not going to move«, brach er zusammen. Eine Woche musste George im Krankenhaus verbringen. Dann durfte er wieder arbeiten, doch er ist nie wieder der alte geworden.
Während George im Krankenhaus lag, suchte meine Mutter einen neuen Makler. Den Makler, der ihr Rosedale-Apartment hatte verkaufen sollen, wollte sie nämlich nicht mehr beauftragen. Indische Logik ist grundsätzlich mit keiner anderen vergleichbar.
Ein neuer Makler war schnell gefunden, ein Käufer nicht. In den Vereinigten Staaten erschienen die ersten Zeitungsberichte über Immobilienkäufer, die ihre Hypotheken nicht mehr abzahlen konnten, und meine Mutter verlangte für das neue Apartment hunderttausend Kanadische Dollar mehr als den ursprünglichen Kaufpreis. »Es ist das einzige Apartment in der Anlage, das noch zu haben ist«, lautete ihr Argument. Der Makler verschluckte sich und schaute meinen Vater an, dessen Sprechverbot aber weiterhin in Kraft war.
Es grenzte an ein Wunder, dass sich nach sieben Monaten doch ein Käufer fand. Ein Millionär aus Shanghai erwarb das Apartment für seine Tochter. Bald würde die Chinesin über das Walnuss-Parkett schreiten, das meine Eltern ausgesucht hatten, die roten Küchenschränke mit reichlich Platz für Kochgeschirr öffnen, das dort niemals auf den Herd kommen sollte, und auf den grauen Marmor des Badezimmers tröpfeln, von dem mein Vater immer geträumt hatte.
So stieg der Wert der beiden Koffer noch einmal um hunderttausend Kanadische Dollar.
Später wurde noch eine weitere Eigentumswohnung besichtigt. Jedenfalls von meiner Mutter. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt gerade aus beruflichen Gründen in Europa und besuchte mich in Italien. Zum ersten Mal hielt er seinen Enkel in den Armen. Und der Enkel kotzte zum ersten Mal auf das Hemd seines Großvaters. »Das liegt am Leichengeruch«, erklärte meine Mutter am Telefon. Mein Vater flüsterte seinem Enkel ins Ohr: »Heirate niemals eine Inderin, und du wirst lange und glücklich leben.«
Mein Sohn, anderthalb Monate alt, Hände wie Seesterne, schaute mit großen Augen ins Leere. Er wusste von nichts, und alles, was er hörte und sah, würde er wieder vergessen. Irgendwann würde ich ihm von seiner Oma erzählen, die darauf verzichtete, ihr erstes Enkelkind zu bewundern, weil ihr das Flugticket zu teuer war, aber mit einem Makler ein Penthouse besichtigte. »Sie hat wieder etwas Neues im Auge«, sagte mein Vater beim Essen. Seine Arme waren entspannt, trotzdem hantierte er unbeholfen mit dem Besteck. »Es soll drei Millionen Dollar kosten.«
Ich schloss die Augen und sah meine Mutter. Sie steigt vor einer Apartment-Anlage von dem gestohlenen Rad und lehnt es an die Wand. Dann bückt sie sich, um das Gummiband abzunehmen, das ihr rechtes Hosenbein von der Kette fernhält. In der glänzenden Eingangshalle wartet der Makler. Sie steckt das Gummiband schnell in die Jackentasche und gibt ihm die Hand. Kurz darauf stehen sie im Fahrstuhl und rauschen aufwärts. Der Makler öffnet die Tür des Penthouse, dahinter ist unendlich viel Platz. Meine Mutter tritt ein. Und auf dem Höhepunkt der Immobilienblase und der Kreditkrise besichtigt sie die Badezimmer, die Schlafzimmer, die Designerküche, das Wohnzimmer mit Aussicht auf den Ontariosee.
Niemand hat jemals den Inhalt der beiden Koffer gesehen, die Juwelen, die Armbänder, die Halsketten und Ohrringe.
»Eine Pracht«, sagt meine Mutter.
DER LETZTE MUND
Zweimal war meine Mutter auf der Titelseite einer Zeitung abgebildet, und einmal beinahe. Das erste Mal im Jahr 1966, drei Jahre bevor sie in die Niederlande kam. Die Times of India druckte ein Foto ab, auf dem einige Pflegerinnen am Krankenbett eines großen Filmstars standen. Eine dieser Krankenpflegerinnen war meine Mutter. Besser gesagt: eine der grauen Wolken war meine Mutter. Die Überschriften hatten an Schwärze eingebüßt, das Foto an Schärfe. Geblieben war ein großer, dunkler Fleck (der Filmstar) und zahllose graue Pünktchen (sechs oder sieben bildschöne indische Krankenschwestern). Diese Ausgabe der Times of India wurde im Bankschließfach meiner Mutter aufbewahrt.
Ganz selten holte meine Mutter die Zeitung aus dem Schließfach, um sie Besuchern zu zeigen. Man konnte die Leute, die uns besuchten, in zwei Gruppen einteilen: diejenigen, die das Titelblatt der Times of India nicht zu sehen bekamen, und diejenigen, die es andächtig wie ein Kultbild betrachten mussten. Oft zeigte ein Besucher auf die falschen Pünktchen, doch meine Mutter korrigierte den Fehler nie. Dafür war sie zu stolz.
Ich wusste, welche Ansammlung von Pünktchen meine Mutter war. Im Raum mit den Schließfächern hatte sie mir einmal ins Ohr geflüstert: »Siehst du diese grauen Tüpfelchen, die immer heller werden? Das bin ich. Ich halte die Hand von Prithviraj Kapoor.« Meine Mutter war die Ansammlung von Pünktchen unmittelbar am Bett des Filmstars.
Die andere Titelseite, auf der meine Mutter abgebildet war, durfte niemand zu Gesicht bekommen. Ich selbst habe die Zeitung nur an dem Tag gesehen, als sie bei uns abends durch den Briefschlitz fiel, Donnerstag, den 12. Dezember 1996. In meiner Erinnerung war es ein kalter, weißer Tag, der Wind scharf wie eine Sense. Auf dem Kralingse Plas waren viele Eisläufer unterwegs. Ich hatte mir die Holzschlittschuhe eines Nachbarn ausgeliehen und stellte mir vor, ich wäre Bart Veldkamp, der Olympiasieger. Vom Ufer aus schaute mir meine Mutter zusammen mit meinem ältesten Bruder zu. Mein ältester Bruder kann nicht eislaufen, weil er auch nicht lesen, schreiben, rechnen oder die Uhrzeit ablesen kann. Er kann aber gut niesen, jedenfalls, wenn er einen Niesanfall hat.
Am 12. Dezember 1996 hatte mein ältester Bruder einen Niesanfall. Alle paar Sekunden schien seine Nase zu explodieren, und einmal pro Minute schallte das Signal eines Schiffshorns über den Kralingse Plas: Mein Bruder schnäuzte sich in seinen Jackenärmel.
Einmal bekam er in einem Restaurant einen Niesanfall, als das Hauptgericht serviert wurde. Tacos mit braunen Bohnen und saurer Sahne. Wenn unsere Familie einmal auswärts aß, gingen wir immer zum Mexikaner Popocatépetl im Alten Hafen. Bevor wir aufbrachen, musste jeder von uns einen halben Liter Leitungswasser trinken, denn im Popocatépetl durften wir nichts zu trinken bestellen. Meine Mutter fand die Getränkepreise in Restaurants exorbitant hoch. Für den Preis von einem Gläschen Cola im Restaurant bekam man im Supermarkt zwei Anderthalb-Liter-Flaschen Cola, im Sonderangebot manchmal sogar drei. Wenn der Kellner an unseren Tisch kam und fragte, ob er uns schon etwas zu trinken bringen dürfe, mussten wir im Chor »Nein, danke« sagen. Auch mein Vater. Das Essen fand meine Mutter ebenfalls teuer, aber ums Essen kam man in einem Restaurant nun mal nicht herum.
Im Popocatépetl, dem Restaurant meiner Jugend, wurde mein ältester Bruder von einem furchtbaren Niesanfall heimgesucht. Kaum hatte uns der Kellner guten Appetit gewünscht, flog der Rotz durch die Gegend und landete auf den Tacos.
»Das schmeckt man nicht durch«, sagte meine Mutter und aß seelenruhig weiter.
Mein ältester Bruder biss auch etwas von einem Taco ab, nieste es aber gleich wieder aus.
Mein Vater verlor die Geduld. »Hör auf!«, rief er wütend. »Hör auf!«
»Das mache nicht ich«, sagte mein Bruder, der nicht lesen, schreiben, rechnen oder die Uhr ablesen kann, »das macht das selbst.« Und er zeigte auf seinen Körper.
Meine Mutter hatte den Fotografen kommen sehen. Er hatte die beiden umkreist wie ein Raubtier die Beute. »Eine braune Frau«, sagte meine Mutter, wobei sie mit der Abendzeitung wedelte. »Er wollte eine braune Frau im Schnee fotografieren!«
»Vincent Mentzel«, bemerkte mein Vater stolz. »Kein Geringerer als Vincent Mentzel hat dich fotografiert!«
»Wer?«
»Vincent Mentzel. Er hat sogar die Königin fotografiert.«
»Wenn ich diesen Vincent Mentzel erwische«, rief meine Mutter, »verpasse ich ihm eins mit dem Nudelholz.«
Das Problem bestand darin, dass meine Mutter nicht für ein Foto gekleidet war; die Sachen, die sie trug, waren mehr als fadenscheinig. Meine Mutter ist eine kleine Inderin von großer Sparsamkeit. Der israelische Schriftsteller Meir Shalev schreibt in seinen Erinnerungen: »Mit dem Duschwasser wurde die Wäsche gewaschen, mit dem Waschwasser der Boden gewischt und mit dem Wischwasser der Garten gewässert.« Die Sachen, die meine Mutter am 12. Dezember 1996 anhatte, waren zuerst von meinem ältesten, danach von meinem mittleren Bruder getragen worden und zu guter Letzt von mir auf Spielplätzen und in Baugruben verschlissen. Auf der Titelseite des NRC Handelsblad prangte meine Mutter in Lumpen, die man eher an einer Pennerin erwartet hätte. Und neben ihr auf dem Foto mein ältester Bruder: Rotz am Kinn, Rotz an der Jacke und Rotz an den Fäustlingen.
»Wie soll ich mich noch aus dem Haus wagen?«, fragte sie. Wir wohnten schließlich in der Tiberiaslaan in Kralingen, jeder dort las NRC Handelsblad. Jeder hatte das Foto meiner Mutter gesehen. Die braune Frau in Lumpen. Die Frau, die sie nicht sein wollte und doch hin und wieder war, weil die Macht der Vergangenheit nun einmal überwältigend ist. Armut, Krieg und neun ältere Geschwister haben mehr als nur einen Kratzer im Charakter meiner Mutter hinterlassen.
»Ich war der letzte Mund«, erzählte sie mir irgendwann und fügte flüsternd hinzu, Moslems hätten die Heimat ihrer Familie erobert. Meine Mutter wurde in einer schweren Zeit als zehntes Kind geboren. Als sie drei Wochen alt war, musste die ganze Familie flüchten. Die Mutter meiner Mutter war so verängstigt, dass ihre Brüste keine Milch mehr produzierten. Der letzte Mund suchte Nahrung, fand aber nichts. Keinen Tropfen. Das Leben meiner neugeborenen Mutter wurde von einer Ziege gerettet. Ihre älteste Schwester sorgte dafür, dass sie mehrmals am Tag gierig am Euter dieser Ziege saugen konnte. Pucha, so lautete der Kosename meiner Mutter, so wurde sie von ihren neun älteren Geschwistern genannt. Pucha, nach dem Geräusch ihres saugenden Mundes an den Zitzen der Ziege. Puchapuchapucha. Eine Geschichte, die mich verfolgt, die auch mir sagt, wo ich herkomme.
Jahre später wurde ich selbst von Vincent Mentzel für die Zeitschrift des Theaterfestivals De Parade fotografiert. Den ganzen Sommer sollte ich im Rahmen des literarischen Programms aus eigenen Werken vorlesen: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. Während die Kamera immer wieder blitzte und klickte, erschien allmählich ein Lächeln um meine Lippen.
»Wunderbar«, sagte Mentzel. »Schön, sehr natürlich.«
Ich dachte an meine Mutter, die mit dem Nudelholz ausholt.
Zu erwähnen ist noch die Titelseite, auf der meine Mutter beinahe abgebildet worden wäre. Es war eine etwas kleinere Zeitung, nicht das Handelsblad, nicht die Times of India, sondern De Ster van Kralingen, ein wöchentlich erscheinendes Anzeigenblatt in unserem Stadtteil. Außer Berichten über Hundertjährige oder vermisste rote Kater enthielt es vor allem zahlreiche Inserate örtlicher Lebensmittelhändler mit Hinweisen auf Schnäppchen und Sonderangebote. Es war das Lieblingsblättchen meiner Mutter, sie verschlang es Woche für Woche.





























