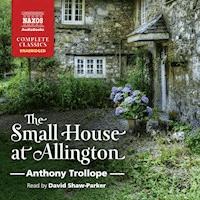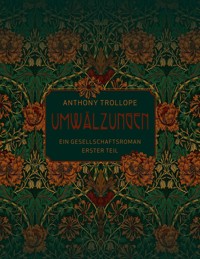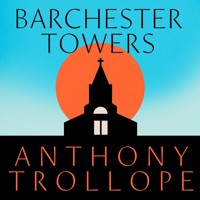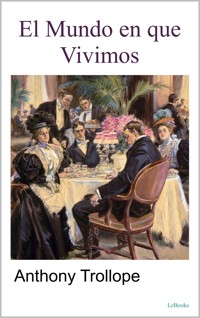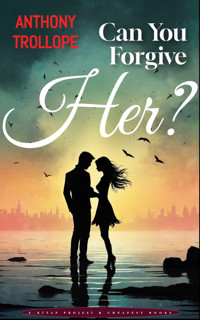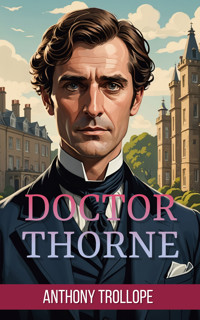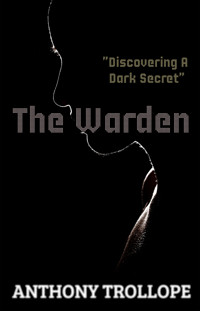1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Premierminister von Anthony Trollope ist ein faszinierender politisch-psychologischer Roman, der die Machtstrukturen, Intrigen und moralischen Spannungen des viktorianischen Englands eindrucksvoll beleuchtet. Im Zentrum steht Plantagenet Palliser, ein kluger und gewissenhafter Mann, der widerwillig das Amt des Premierministers übernimmt. Er ist ein Politiker von höchster Integrität, dessen Idealismus und Pflichtbewusstsein ihn in eine Welt führen, in der Ehrgeiz, Opportunismus und gesellschaftlicher Druck oft stärker wiegen als moralische Überzeugungen. Seine Frau, Lady Glencora, steht in lebhaftem Gegensatz zu ihm. Mit ihrem Temperament, ihrer gesellschaftlichen Anziehungskraft und ihrem Drang nach Unabhängigkeit bringt sie Farbe und Unruhe in das politische und private Leben ihres Mannes. Ihr Einfluss ist ebenso inspirierend wie gefährlich – sie versteht es, die Grenzen zwischen privater Leidenschaft und öffentlicher Wirkung mit Eleganz, aber auch mit Risiko zu überschreiten. Parallel dazu entfaltet sich die tragische und zugleich fesselnde Geschichte von Emily Wharton, einer jungen Frau aus einer angesehenen Familie, die sich gegen den Willen ihres Vaters in den ehrgeizigen und undurchsichtigen Ferdinand Lopez verliebt. Ihre Entscheidung zieht sie in ein Netz aus Täuschung, gesellschaftlicher Ächtung und persönlicher Reue – ein Spiegelbild der zerstörerischen Macht von Stolz und sozialem Ehrgeiz. Trollope verbindet in Der Premierminister meisterhaft politische Analyse mit feiner Charakterzeichnung. Mit scharfem Blick für menschliche Schwächen und die Mechanismen sozialer Macht schildert er, wie persönliche Ideale im Strudel öffentlicher Verantwortung auf die Probe gestellt werden. Das Werk gilt als ein Höhepunkt viktorianischer Erzählkunst – ein vielschichtiges, zeitloses Porträt von Macht, Moral und Menschlichkeit, das auch moderne Leser durch seine psychologische Tiefe und erzählerische Eleganz fesselt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Premierminister
Inhaltsverzeichnis
Band I
Kapitel I. Ferdinand Lopez
Es ist sicher hilfreich für jemanden, zu wissen, wer seine Großväter und Großmütter waren, wenn er den Ehrgeiz hat, in den höheren Kreisen der Gesellschaft mitzumischen, und es ist auch nützlich, über sie so reden zu können, als wären sie zu ihrer Zeit selbst wichtige Leute gewesen. Zweifellos haben wir alle großen Respekt vor denen, die sich aus eigener Kraft in der Welt hochgearbeitet haben; und wenn wir hören, dass der Sohn einer Wäscherin Lordkanzler oder Erzbischof von Canterbury geworden ist, empfinden wir theoretisch und abstrakt gesehen eine größere Ehrfurcht vor einem solchen selbstgemachten Magnaten als vor einem, der sozusagen in ein juristisches oder kirchliches Amt hineingeboren wurde. Aber dennoch muss der Sprössling der Wäscherin große Schwierigkeiten wegen seiner Herkunft gehabt haben, es sei denn, er war sowohl in jungen als auch in alten Jahren ein wirklich großer Mann. Nachdem das Ziel endgültig erreicht und die Ehre, die Titel und der Reichtum tatsächlich errungen sind, kann ein Mann vielleicht mit etwas Humor, sogar mit etwas Zuneigung, über die Waschzuber seiner Mutter sprechen – aber während der Kampf noch andauert und der Kämpfende fest davon überzeugt ist, dass er nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn er als Gentleman angesehen wird, ist es schwierig, sich nicht zu schämen, die alten Familienverhältnisse nicht zu verheimlichen und auf keinen Fall zu schweigen. Und die Schwierigkeit ist sicherlich nicht geringer, wenn glückliche Umstände und statt harter Arbeit und eigenen Verdiensten einen Anwärter auf eine hohe gesellschaftliche Position über seinen natürlichen Platz erhoben haben. Kann man von einem solchen Menschen erwarten, dass er beim Abendessen mit einer Herzogin über den kleinen Laden seines Vaters spricht oder die Schusterahle seines Großvaters ans Tageslicht bringt? Und doch ist es schwierig, ganz zu schweigen! Es ist vielleicht nicht notwendig, dass wir alle ständig über unsere Herkunft sprechen. Wir mögen im Allgemeinen zurückhaltend sein, was unsere Onkel und Tanten angeht, und vielleicht lassen wir sogar unsere Brüder und Schwestern in unseren alltäglichen Gesprächen unerwähnt. Aber wenn jemand niemals seine Angehörigen gegenüber denen erwähnt, mit denen er zusammenlebt, wird er geheimnisvoll und fast schon verdächtig. Es wird bekannt, dass niemand etwas über einen solchen Menschen weiß, und sogar Freunde bekommen Angst. Es ist sicherlich praktisch, wenn man, und sei es nur einmal im Jahr, auf einen Blutsverwandten anspielen kann.
Ferdinand Lopez, der in anderer Hinsicht viel Grund zur Freude hatte, litt unter den Problemen, die ich versucht habe zu beschreiben, was seine Vorfahren anging. Er wusste selbst nicht viel, aber das Wenige, das er wusste, behielt er ganz für sich. Er hatte keinen Vater oder keine Mutter, keinen Onkel, keine Tante, keinen Bruder oder keine Schwester, nicht einmal einen Cousin, den er seinem besten Freund gegenüber beiläufig erwähnen konnte. Zweifellos litt er darunter, aber mit spartanischer Konsequenz verbarg er sein Leid so gut vor der Welt, dass niemand wusste, dass er litt. Diejenigen, mit denen er zusammenlebte und die oft darüber spekulierten und sich viele Gedanken darüber machten, wer er war, ahnten nicht, dass die Verschwiegenheit des schweigsamen Mannes eine Last für ihn selbst war. Zu keinem besonderen Zeitpunkt seines Lebens, zu keiner Zeit, die man mit dem Finger zeigen könnte, hat er sich auffällig zurückgehalten, etwas zu sagen, was in dem Moment ganz normal gewesen wäre. Er hat nie gezögert, ist nie rot geworden oder hat sich sichtlich bemüht, etwas zu verbergen; aber es blieb die Tatsache, dass, obwohl viele Männer und nicht wenige Frauen Ferdinand Lopez sehr gut kannten, keiner von ihnen wusste, woher er kam oder wie seine Familie aussah.
Er war jedoch von Natur aus ein zurückhaltender Mann, der nie auf seine eigenen Angelegenheiten zu sprechen kam, es sei denn, er verfolgte damit ein Ziel, dessen Weg ihm klar vor Augen stand. Schweigen über eine Angelegenheit, die für die meisten Männer ein alltägliches Thema ist, fiel ihm daher weniger schwer als anderen, und das Ergebnis war weniger peinlich. Der gute alte Jones, der seinen Freunden im Club von jedem Pfund erzählt, das er bei den Pferderennen verliert oder gewinnt, der fast öffentlich mit Marys Gunst prahlt und über Lucys Kälte jammert, der Berichte über den Stand seines Geldbeutels, seines Magens, seines Stalls und seiner Schulden veröffentlicht, konnte uns trotz aller Vorsicht nicht verheimlichen, dass sein Vater Anwaltsgehilfe war und sein erstes Geld mit dem Diskontieren kleiner Wechsel verdient hatte. Jeder weiß das, und Jones, der beliebt sein will, ärgert sich über die unglückliche Bekanntheit. Aber Jones ist von einer Last befreit, die seine armen Schultern gebrochen hätte und die selbst Ferdinand Lopez, der ein starker Mann ist, oft nur schwer ertragen kann, ohne zusammenzuzucken.
Alle waren sich einig, dass Ferdinand Lopez ein „Gentleman“ war. Johnson sagt, dass jede andere Ableitung dieses schwierigen Wortes als die, die es als „Mann von edler Abstammung“ bezeichnet, abwegig ist. Es gibt viele, die sich bei der Definition des Begriffs für ihren eigenen Gebrauch immer noch an Johnsons Diktum halten – aber sie halten sich daran mit gewissen unausgesprochenen Zugeständnissen für mögliche Ausnahmen. Die Chancen stehen sehr gut für den Mann von guter Herkunft, aber es kann Ausnahmen geben. Es wurde allgemein nicht geglaubt, dass Ferdinand Lopez von guter Herkunft war – aber er war ein Gentleman. Und dieser höchst wertvolle Rang wurde ihm zuerkannt, obwohl er in einem Beruf tätig war – oder zumindest gewesen war –, der an sich keine solche Garantie für eine hohe Stellung bietet, wie sie angeblich durch die Anwaltschaft und die Kirche, durch den Militärdienst und durch die Medizin gewährt wird. Er war an der Börse tätig gewesen und war immer noch in einer Weise, die seinen Freunden nicht ganz klar war, in der City geschäftlich tätig.
Zu der Zeit, um die es hier geht, war Ferdinand Lopez dreiunddreißig Jahre alt, und da er früh ins Leben gestartet war, war er schon lange in der Welt unterwegs. Man wusste von ihm, dass er eine gute englische Privatschule besucht hatte, und es wurde berichtet, basierend auf der einzigen Aussage eines ehemaligen Schulkameraden, dass in der Schule das Gerücht kursierte, seine Schulgebühren würden von einem alten Herrn bezahlt, der nicht mit ihm verwandt war. Im Alter von siebzehn Jahren wurde er an eine deutsche Universität geschickt, und mit einundzwanzig tauchte er in London in einem Börsenmaklerbüro auf, wo er bald als begabter Sprachwissenschaftler und sehr kluger Kerl bekannt war – frühreif, nicht besonders vergnügungssüchtig, arbeitsfähig, aber für Arbeitgeber kaum vertrauenswürdig, nicht weil er unehrlich war, sondern weil er lieber Herr als Diener sein wollte. Tatsächlich war seine Zeit als Angestellter sehr kurz. Es lag nicht in seiner Natur, für andere zu arbeiten. Bald war er für sich selbst tätig, und eine Zeit lang dachte man, er würde ein Vermögen machen. Dann wurde bekannt, dass er sein reguläres Geschäft aufgegeben hatte, und man nahm an, dass er alles verloren hatte, was er jemals verdient oder besessen hatte. Aber niemand, nicht einmal seine eigenen Bankiers oder sein eigener Anwalt – nicht einmal die alte Frau, die sich um seine Wäsche kümmerte –, wusste jemals wirklich, wie es um seine Finanzen stand.
Er war zweifellos ein gutaussehender Mann – seine Schönheit war von einer Art, die Männer gerne leugnen und Frauen gerne großzügig anerkennen. Er war fast zwei Meter groß, sehr dunkelhäutig und sehr dünn, mit regelmäßigen, gut geschnittenen Gesichtszügen, die dem Physiognomiker wenig verrieten, außer vielleicht die große Gabe der Selbstbeherrschung. Sein Haar war kurz geschnitten, und er trug keinen Bart außer einem pechschwarzen Schnurrbart. Seine Zähne waren perfekt in Form und Weiß – eine Eigenschaft, die zwar in einer allgemeinen Auflistung persönlicher Attraktivitätsmerkmale einen hohen Stellenwert haben mag, aber im unbewussten Urteil seiner Bekannten einen Mann im Allgemeinen nicht besonders hervorhebt. Aber um den Mund und das Kinn dieses Mannes herum lag etwas Weiches, vielleicht im Spiel seiner Lippen, vielleicht in seinem Grübchen, das das Gefühl der Härte, das durch die kantige Stirn und die kühnen, unerschrockenen, kämpferischen Augen hervorgerufen wurde, in gewissem Maße milderte. Diejenigen, die ihn kannten und mochten, versöhnten sich mit seinem unteren Gesichtsbereich. Die meisten, die ihn kannten und nicht mochten, empfanden und verübelteten – auch wenn sie in neun von zehn Fällen vielleicht nicht einmal sich selbst gegenüber ihre Verärgerung zum Ausdruck brachten – die Kampfeslust seines festen Blicks.
Denn er gehörte im Grunde zu den Menschen, die in ihrem Innersten ständig sich selbst verteidigen und andere angreifen. Er konnte einer Frau an einer Straßenkreuzung keinen Penny geben, ohne ihr mit seinem Blick deutlich zu machen, wie ungerecht ihre Forderung war, und seine Freiheit von jeglicher Verpflichtung ließ ihn so oft über die Kreuzung gehen, wie er wollte. Er konnte sich nicht in einen Eisenbahnwagen setzen, ohne seinem Nachbarn gegenüber zu zeigen, dass es in allen gemeinsamen Angelegenheiten des Reisens, wie der Anordnung der Füße, der Platzierung der Taschen und dem Öffnen der Fenster, die Pflicht des Nachbarn sei, sich zu fügen, und seine, dies zu verlangen. Er kämpfte jedoch eher um den Geist als um die Sache selbst. Die Frau mit dem Besen bekam ihren Penny. Der Herr gegenüber durfte, nachdem er mit einem Blick seine Unterwerfung zum Ausdruck gebracht hatte, mit seinen Beinen und dem Fenster machen, was er wollte. Ich würde nicht sagen, dass Ferdinand Lopez zu bösartigen Handlungen neigte, aber er war herrisch und hatte gelernt, seine Herrschaft mit seinen Augen auszuüben.
Der Leser muss sich noch ein oder zwei weitere, noch kleinere Details über diesen Mann gefallen lassen, dann darf der Mann seinen eigenen Weg gehen. Niemand in seiner Umgebung wusste, wie viel Sorgfalt er auf seine Kleidung verwendete und wie sehr er darauf achtete, dass niemand davon erfuhr. Selbst sein Schneider hielt ihn für extravagant, was die Anzahl seiner Mäntel und Hosen anging, und seine Freunde betrachteten ihn als einen jener glücklichen Menschen, denen es von Natur aus leicht fällt, sich gut zu kleiden, oder denen es fast unmöglich ist, sich schlecht zu kleiden. Wir alle kennen diesen Typen – meistens ein kleiner Mann, der sich selten und leise bewegt und immer so aussieht, als wäre er gerade in einer Hutschachtel nach Hause geschickt worden. Ferdinand Lopez war kein kleiner Mann und bewegte sich ziemlich frei, aber zu keinem Zeitpunkt – egal, ob er in die Stadt ging oder aus ihr herauskam, zu Pferd oder zu Fuß, zu Hause über seinen Büchern saß oder sich in den Wirbeln des Tanzes bewegte – war er anders gekleidet als mit perfekter Sorgfalt. Geld und Zeit machten es möglich, aber die Leute dachten, dass es mit ihm wuchs, so wie seine Haare und seine Nägel. Und er ritt immer ein Pferd, das gute Kenner davon, was ein Parkpferd sein sollte, begeisterte – kein tänzelndes, unruhiges, kicherndes, seitwärts gehendes, nutzloses Garran, sondern ein gut gebautes, gut gezäumtes Tier mit perfekten Gangarten, auf dem ein Reiter, wenn es ihm gefiel, so ruhig wie eine Statue auf einem Denkmal sitzen konnte. Ferdinand Lopez gefiel es oft, ruhig auf dem Pferd zu sitzen; und doch sah er nicht wie eine Statue aus, denn in ganz London war bekannt, dass er ein guter Reiter war. Er lebte auch luxuriös – ob er dabei wohlhabend war oder nicht, wusste niemand –, denn er besaß einen eigenen Brougham und während der Jagdsaison hatte er zwei Pferde in Leighton. Früher glaubte man, er sei ruiniert, aber diejenigen, die sich für solche Dinge interessierten, hatten herausgefunden – oder glaubten zumindest, es herausgefunden zu haben –, dass er seinen Schneider regelmäßig bezahlte, und nun herrschte die Meinung vor, dass Ferdinand Lopez ein vermögender Mann sei.
Einige wenige wussten, dass er Zimmer in einer Wohnung in Westminster bewohnte, aber nur sehr wenige wussten genau, wo sich diese Zimmer befanden. Unter all seinen Freunden war niemand bekannt, der sie jemals betreten hatte. Er war in maßvoller Weise gastfreundlich, das heißt, er war zwar nicht oft zu Gast, aber wenn sich die Gelegenheit bot, dann war er ein liebenswürdiger Gastgeber. Als Schauplatz für diese Festlichkeiten wählte er jedoch einen Club, eine Taverne oder vielleicht im Sommer ein Flussufer. Für einige wenige – wenn, wie vermutet, Männer und Frauen inmitten von Sommerblumen am Ufer zusammenkamen – war er ein höflicher und effizienter Gastgeber, denn er hatte die seltene Gabe, solche Dinge gut zu machen.
Die Jagdzeit war vorbei, und der Ostwind wehte immer noch, und ein großer Teil der Londoner Gesellschaft war über die Osterfeiertage außerhalb der Stadt, als Ferdinand Lopez an einem unangenehmen Morgen mit der Metropolitan Railway von der Westminster Bridge in die Stadt fuhr. Es war seine Gewohnheit, dorthin zu fahren, wenn er fuhr – nicht täglich wie ein Geschäftsmann, sondern nach Bedarf, wie ein Kapitalist oder ein Mann des Vergnügens –, in seiner eigenen Kutsche. Aber dieses Mal ging er zum Flussufer hinunter und dann vom Herrenhaus in einen schmuddeligen kleinen Hof namens Little Tankard Yard in der Nähe der Bank von England. Durch einen schmalen, dunklen, langen Gang gelangte er in ein kleines Büro im hinteren Teil eines Gebäudes, in dem ein schmieriger Herr mit einem neuen Hut auf einem Ohr an einem Schreibtisch saß, der vielleicht um die vierzig Jahre alt war. Der Raum war sehr dunkel, und der Mann blätterte in einem Hauptbuch. Ein Fremder, der mit den Gepflogenheiten der Stadt nicht vertraut war, hätte vielleicht gesagt, dass er untätig war, aber zweifellos füllte er seinen Geist mit dem Wissen, das es ihm ermöglichen würde, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Auf der anderen Seite des Schreibtisches saß ein kleiner Junge, der Briefe abschrieb. Das waren Herr Sextus Parker – allgemein Sexty Parker genannt – und sein Angestellter. Herr Parker war ein sehr bekannter Gentleman, der derzeit an der Börse hoch angesehen war. „Was, Lopez!“, sagte er. „Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun?“
„Komm doch rein“, sagte Lopez. In Herr Parkers sehr kleinem Büro gab es ein noch kleineres Büro, in dem sich ein Safe, ein kleiner wackeliger Pembroke-Tisch, zwei Stühle und ein alter Waschtisch mit einem zerknüllten Handtuch befanden. Lopez ging voraus in dieses Heiligtum, als kenne er den Ort gut, und Sexty Parker folgte ihm.
„Ein mieser Tag, nicht wahr?“, sagte Sexty.
„Ja, ein fieser Ostwind.“
„Er schneidet einen in zwei Teile, und gleichzeitig scheint die heiße Sonne. Man sollte zu dieser Jahreszeit Winterschlaf halten.“
„Warum machst du dann keinen Winterschlaf?“, fragte Lopez.
„Das Geschäft läuft zu gut. Das ist der Grund. Man muss dranbleiben, wenn es läuft. Nicht jeder kann das machen wie du – seine reguläre Arbeit aufgeben und sich nach Lust und Laune hier und da eine Stunde Zeit nehmen, um etwas Besseres zu machen. Ich würde mich nicht trauen, so etwas zu machen.“
„Ich glaube nicht, dass du oder irgendjemand sonst weiß, was ich mache“, sagte Lopez mit einem Blick, der Beleidigung andeutete.
„Das ist mir auch egal“, sagte Sexty, „ich hoffe nur, dass es etwas Gutes für dich ist.“ Sexty Parker kannte Herr Lopez nun schon seit einigen Jahren gut und war selbst ein überheblicher Mann – um ehrlich zu sein, sogar ein bisschen ein Tyrann – und keineswegs geneigt, nachzugeben, wenn er nicht unter Druck gesetzt wurde. Er hatte oft sein „Glück“ bei seinem Freund versucht, wie er selbst gesagt hätte. Aber ich bezweifle, dass er sich an einen Fall erinnern konnte, in dem er sich zum Erfolg beglückwünschen konnte. Jetzt versuchte er es erneut, aber mit zitternder Stimme, nachdem er einen Blick in die Augen seines Freundes erhascht hatte.
„Wohl kaum“, sagte Lopez. Dann fuhr er fort, ohne seine Stimme oder den Ausdruck seiner Augen zu verändern: „Ich sage dir, was ich jetzt von dir will. Ich will, dass du diesen Scheck für drei Monate unterschreibst.“
Sexty Parker öffnete den Mund und die Augen und nahm das Stück Papier entgegen, das ihm gereicht wurde. Es war ein Schuldschein über 750 Pfund, der, wenn er ihn unterschrieb, ihn am Ende der festgelegten Laufzeit zur Zahlung dieses Betrags verpflichtete, sofern er nicht anderweitig beglichen wurde. Sein Kumpel Herr Lopez bat ihn tatsächlich um die Unterstützung seines Namens, um einen Kredit in Höhe des genannten Betrags aufzunehmen. Das war eine Art von Gefallen, um den man fast auf Knien bitten musste – und den Herr Sextus Parker, wenn er darum gebeten worden wäre, sicherlich abgelehnt hätte. Und nun bat Ferdinand Lopez, den Sextus Parker in letzter Zeit als einen wohlhabenden Mann angesehen hatte, ihn darum, und zwar keineswegs auf Knien, sondern, wie man sagen könnte, mit vorgehaltener Pistole. „Ein Gefälligkeitswechsel!“, sagte Sexty. „Du bist doch nicht knapp bei Kasse, oder?“
„Ich werde dir im Moment nicht viel über meine Angelegenheiten erzählen, aber ich erwarte trotzdem, dass du tust, worum ich dich bitte. Ich nehme nicht an, dass du meine Fähigkeit, 750 Pfund aufzutreiben, anzweifelst.“
„Oh nein, natürlich nicht“, sagte Sexty, der angesehen worden war und diese Prüfung nicht gut überstanden hatte.
„Und ich nehme nicht an, dass du mich ablehnen würdest, selbst wenn ich knapp bei Kasse wäre, wie du es nennst.“ Es hatte zuvor schon Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern gegeben, in denen Lopez wahrscheinlich der Stärkere gewesen war, und die Erinnerung daran, zusammen mit dem immer noch andauernden prüfenden Blick, lastete schwer auf dem armen Sexty.
„Oh nein, ich hatte nicht vor, dich abzuweisen. Ich denke, man kann über so etwas schon ein wenig überrascht sein.“
„Ich weiß nicht, warum du überrascht sein solltest, denn solche Dinge sind sehr verbreitet. Ich habe zufällig einen Anteil an einem Darlehen übernommen, der meine unmittelbaren Mittel etwas übersteigt, und brauche daher ein paar Hundert. Es gibt niemanden, den ich mit mehr Anstand darum bitten könnte als dich. Wenn du keine Bedenken hast, unterschreib einfach.“
„Oh, ich habe keine Angst“, sagte Sexty, nahm seinen Stift und schrieb seinen Namen auf den Schein. Aber noch bevor er die Unterschrift beendet hatte, als sein Blick vom Gesicht seines Begleiters auf das unangenehme Stück Papier unter seiner Hand fiel, bereute er, was er tat. Er hielt seine Unterschrift fast auf halbem Weg an. Er zögerte, hatte aber nicht genug Mut, seine Hand anzuhalten. „Es scheint trotzdem eine verdammt seltsame Transaktion zu sein“, sagte er, während er sich in seinem Stuhl zurücklehnte.
„Das ist doch das Normalste auf der Welt“, meinte Lopez, nahm den Schein gemächlich in die Hand, faltete ihn und steckte ihn in sein Portemonnaie. „Waren unsere Namen noch nie zusammen auf einem Stück Papier?“
„Wenn wir beide etwas davon hatten.“
„Du hast dabei nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Schönen Tag noch und vielen Dank – auch wenn ich diese Angelegenheit nicht für so wichtig halte wie du.“ Dann ging Ferdinand Lopez und Sexty Parker blieb allein in seiner Verwirrung zurück.
„Meine Güte, das ist seltsam“, sagte er zu sich selbst. „Wer hätte gedacht, dass Lopez ein paar hundert Pfund braucht? Aber es muss schon stimmen. Er wäre nicht so gekommen, wenn es nicht stimmen würde. Ich hätte das aber nicht tun sollen! Ein Mann sollte so etwas niemals tun – niemals, niemals!“ Und Herr Sextus Parker war sehr unzufrieden mit sich selbst, sodass er, als er an diesem Abend zu seiner geliebten Frau und seiner kleinen Familie in Ponders End nach Hause kam, ihnen gegenüber keineswegs freundlich war. Denn diese Summe von 750 Pfund lastete auf ihm, während er zu Abend aß, und lag wie ein Albtraum auf seiner Brust, während er schlief.
Kapitel II. Everett Wharton
Am selben Tag aß Lopez mit seinem Kumpel Everett Wharton in einem neuen Club namens „The Progress” zu Abend, in dem sie beide Mitglieder waren. Der “Progress” war zwar ein neuer Club, der erst seit knapp drei Jahren existierte, aber dennoch alt genug, um viele der Hoffnungen seiner frühen Jugend mit dem Alter und der Untätigkeit verblassen zu sehen. Denn der Progress hatte vor, Großes für die Liberale Partei zu tun – oder besser gesagt, für die politische Liberalität im Allgemeinen –, hatte aber in Wahrheit wenig oder gar nichts erreicht. Er war mit großer Begeisterung gegründet worden, und eine Zeit lang hatten einige leidenschaftliche Politiker geglaubt, dass durch diese Institution Männer mit Genialität, Temperament und natürlicher Kraft, aber ohne Reichtum – womit sie immer sich selbst meinten – sichere Sitze im Parlament und wahrscheinlich auch einen Anteil an der Regierung erhalten würden. Aber solche Ergebnisse waren nicht erzielt worden. Es hatte an etwas gefehlt – einem Mangel, der zwar spürbar, aber noch nicht definiert war – was sich bisher als fatal erwiesen hatte. Die jungen Männer sagten, das liege daran, dass kein alter Hase, der wusste, wie man die Fäden zieht, hervortreten und den Club in die richtigen Bahnen lenken würde. Die alten Männer meinten, das liege daran, dass die jungen Männer anmaßende Welpen seien. Es bestand jedoch kein Zweifel daran, dass die Partei des Fortschritts nachgelassen hatte und dass die liberalen Politiker des Landes, obwohl ein spezieller neuer Club zur Förderung ihrer Ansichten gegründet worden war, derzeit nicht viel vorankamen. „Was wir brauchen, ist Organisation“, sagte einer der führenden jungen Männer. Aber die Organisation war noch nicht in Sicht.
Trotzdem machte der Club weiter wie andere Clubs auch, und die Leute aßen zu Abend, rauchten, spielten Billard und taten so, als würden sie lesen. Einige wenige energiegeladene Mitglieder hofften immer noch, dass ein guter Tag kommen würde, an dem ihre großen Ideen verwirklicht werden könnten – aber die meisten Mitglieder waren zufrieden damit, zu essen, zu trinken und Billard zu spielen. Es war ein recht guter Club – mit ein paar liberalen Adligen, ein paar Dutzend Parlamentsabgeordneten, denen man eingeredet hatte, dass sie ihre Parteipflichten vernachlässigen würden, wenn sie ihren Beitrag nicht zahlten, und der üblichen Mischung aus Rechtsanwälten, Stadtkaufleuten und Müßiggängern. Für Ferdinand Lopez, der beim Essen wählerisch war und seine eigene Meinung über Weine hatte, war es jedenfalls gut genug. Man hatte ihn sagen hören, dass es in London keinen Club gebe, der diesem in puncto Ruhe und Komfort gleichkäme; aber seine Zuhörer wussten nicht, dass er in der Vergangenheit im T–––– und im G–––– abgelehnt worden war. Das waren Zufälle, die Lopez geschickt im Hintergrund zu halten wusste. Sein jetziger Begleiter, Everett Wharton, war ebenso wie er selbst Gründungsmitglied gewesen – und Wharton gehörte zu denen, die gehofft hatten, im Club ein Sprungbrett für eine hohe politische Karriere zu finden, und die nun oft mit müßiger Energie über die Notwendigkeit einer Organisation sprachen.
„Ich persönlich“, sagte Lopez, „kann mir kein eitleres Ziel vorstellen als einen Sitz im britischen Parlament. Was hat man davon? Die wenigen, die erfolgreich sind, arbeiten sehr hart für wenig Geld und ohne Dank – oder fast genauso hart für kein Geld und ebenso wenig Dank. Die vielen, die scheitern, sitzen stundenlang untätig herum, müssen sich die ermüdende Aufgabe antun, Plattitüden anzuhören, und genießen dafür das mittlerweile absolut wertlose Privileg, in ihren Briefen mit “M.P.„ (Member of Parliament) bezeichnet zu werden.“
„Jemand muss doch Gesetze für das Land machen.“
„Ich sehe dafür keine Notwendigkeit. Ich denke, dem Land würde es außerordentlich gut gehen, wenn es wüsste, dass in den nächsten zwanzig Jahren keine alten Gesetze geändert und keine neuen Gesetze erlassen würden.“
„Du hättest die Korngesetze nicht aufgehoben?“
„Es gibt jetzt keine Korngesetze mehr, die man aufheben könnte.“
„Und auch nicht die Einkommenssteuer ändern?“
„Ich würde nichts ändern. Aber egal, ob Gesetze geändert oder beibehalten werden, es ist beruhigend für mich, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Es hat tatsächlich einen Vorteil, im Parlament zu sein.“
„Man kann doch nicht verhaften.“
„Nun, das stimmt schon, und es gibt noch einen weiteren Vorteil. Es hilft einem Mann dabei, einen Sitz als Direktor bestimmter Unternehmen zu bekommen. Die Leute sind immer noch so dumm, dass sie einem Vorstand vertrauen, der sich aus Parlamentsmitgliedern zusammensetzt, und deshalb sind die Mitglieder natürlich willkommen. Aber wenn du ins Parlament willst, warum sprichst du das nicht mit deinem Vater ab, anstatt darauf zu warten, was der Club für dich tun kann?“
„Mein Vater würde für so was keinen Shilling bezahlen. Er war selbst nie im Parlament.“
„Und deshalb verachtet er es.“
„Ein bisschen vielleicht. Niemand hat jemals härter gearbeitet als er oder war auf seine Weise erfolgreicher; und nachdem er gesehen hat, wie einer nach dem anderen seiner jüngeren Kollegen Mitglied des Parlaments wurde, während er bei den Anwälten blieb, ist er vielleicht ein bisschen eifersüchtig.“
„So wie ich dein Leben zu Hause sehe, würde ich denken, dass dein Vater alles für dich tun würde – mit der richtigen Führung. Es besteht wohl kein Zweifel, dass er es sich leisten könnte?“
„Mein Vater hat mir in seinem ganzen Leben nie etwas über seine eigenen finanziellen Angelegenheiten erzählt, obwohl er viel über meine spricht. Niemand war jemals verschlossener als mein Vater. Aber ich glaube, dass er sich fast alles leisten könnte.“
„Ich wünschte, ich hätte so einen Vater“, sagte Ferdinand Lopez. „Ich glaube, ich würde es schaffen, herauszufinden, wie viel er kann, und das auch irgendwie nutzen.“
Wharton hätte seinen Freund fast gefragt – er hatte fast den Mut aufgebracht, ihn zu fragen –, ob sein Vater viel für ihn getan hatte. Sie standen sich sehr nahe, und in einer Sache, die Lopez sehr interessierte, hatten sie ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Aber der jüngere und schwächere der beiden konnte sich nicht ganz dazu durchringen, eine Frage zu stellen, die ihm unangenehm erschien. Lopez hatte in all ihrer Zeit zusammen nie angedeutet, dass er kindliche Wünsche hatte oder gehabt haben könnte. Er war so, als wäre er selbstständig geschaffen worden, unabhängig von der Muttermilch oder dem Geld seines Vaters. Jetzt hätte man die Frage fast ganz natürlich stellen können. Aber sie wurde nicht gestellt.
Everett Wharton war seinem Vater eine Last – aber keine quälende Last, wie es manche Söhne sind. Seine Fehler waren nicht derart, dass sie seinem Vater alle Freude raubten und ihn mit grauen Haaren und voller Kummer ins Grab brachten. Der alte Wharton musste sich nie fragen, ob er seinen Sohn nun endlich in den tiefsten Abgrund fallen lassen oder doch wieder versuchen sollte, ihn auf die Beine zu bringen, ihm erneut zu vergeben, erneut seine Schulden zu bezahlen, erneut zu versuchen, die Schande zu vergessen und alles auf das Konto der unbesonnenen Jugend zu schreiben. Wäre das der Fall gewesen, hätte der junge Mann meiner Meinung nach, wenn nicht beim ersten oder zweiten Sturz, dann sicherlich beim dritten den Abgrund erreicht; denn Herr Wharton war ein strenger Mann und in der Lage, zu einer klaren Entscheidung über Dinge zu kommen, die ihm am nächsten und sogar am liebsten waren. Aber Everett Wharton hatte sich einfach als unfähig erwiesen, sein eigenes Brot zu verdienen. Er hatte sich nie geweigert, dies zu tun, sondern war einfach unfähig gewesen. Er hatte weder mit Worten noch mit Taten erklärt, dass er, da sein Vater ein reicher Mann und er der einzige Sohn war, deshalb nichts tun würde. Aber er hatte sich dreimal versucht und jedes Mal nach nur kurzer Probezeit seinem Vater und seinen Freunden versichert, dass ihm die Sache nicht zusagte. Er verließ Oxford ohne Abschluss, weil ihm das Studium nicht lag, und ging zu einer Bank, aber nicht als einfacher Angestellter, sondern mit dem ausdrücklichen Vorschlag seines Vaters, der von einem Partner unterstützt wurde, dass er sich zu Reichtum und einer großen Position in der Wirtschaft hocharbeiten sollte. Aber nach sechs Monaten war ihm klar, dass das Bankwesen „ein Gräuel” war, und er begann sofort eine Ausbildung bei einem Anwalt. Er blieb dabei, bis er als Anwalt zugelassen wurde – denn man kann auch mit sehr wenig kontinuierlicher Arbeit als Anwalt zugelassen werden. Aber nachdem er zugelassen worden war, war ihm die Einsamkeit seiner Kanzlei zu viel, und mit fünfundzwanzig Jahren erkannte er, dass die Börse der richtige Ort für Talente und Energien wie die seinen war. Was genau in dem Jahr, in dem er in die Stadt ging, schiefgelaufen war, wussten nur er und sein Vater – es sei denn, Ferdinand Lopez wusste auch etwas davon. Aber mit sechsundzwanzig gab er auch die Börse auf, und nun, mit achtundzwanzig, hatte Everett Wharton entdeckt, dass eine parlamentarische Karriere das war, wozu ihn seine Natur und sein besonderes Genie bestimmt hatten. Wahrscheinlich hatte er dies seinem Vater vorgeschlagen und war auf eine kalte Ablehnung gestoßen.
Everett Wharton war ein gutaussehender, männlicher Typ, 1,80 Meter groß, mit breiten Schultern, hellem Haar und einem großen, seidigen, buschigen Bart, der ihn älter aussehen ließ, als er war. Weder durch seine Sprache noch durch sein Aussehen würde man ihn jemals für einen Dummkopf halten, aber seine Körperhaltung und sein Gesichtsausdruck zeigten, dass es ihm an Zielstrebigkeit mangelte. Er war sicher kein Dummkopf. Er hatte viel gelesen, und obwohl er meistens vergaß, was er gelesen hatte, blieben ihm aus seinen Lektüren gewisse nebulöse Erkenntnisse, die durch das Denken anderer Menschen entstanden waren und die es ihm ermöglichten, über die meisten Themen zu sprechen. Man kann nicht sagen, dass er viel selbst nachgedacht hätte – aber er dachte, dass er dachte. Er glaubte von sich, dass er sich ziemlich intensiv mit Politik beschäftigt hatte und dass er das Recht hatte, viele Staatsmänner als Dummköpfe zu bezeichnen, weil sie nicht das sahen, was er sah. Er hatte die große Frage der Arbeit und alles, was mit Gewerkschaften, Streiks und Aussperrungen zu tun hatte, ziemlich gut im Griff. Er wusste, wie die Kirche von England abgeschafft und neu aufgebaut werden sollte. Er hatte klare Vorstellungen von Finanzfragen und sah ganz genau, wie der Fortschritt in Richtung Kommunismus vorangetrieben werden sollte, damit keine Gewalt diesen Fortschritt stören würde und im Laufe der Jahrhunderte jedes Verlangen nach persönlichem Eigentum durch eine so allgemeine Menschenliebe überwunden und ausgelöscht werden würde, dass sie kaum noch als Tugend angesehen werden könnte. In der Zwischenzeit schaffte er es nie, seine Schneiderrechnung regelmäßig aus der Zuwendung von 400 Pfund pro Jahr zu bezahlen, die ihm sein Vater gab, und träumte immer von den Annehmlichkeiten eines stattlichen Einkommens.
Er war zweifellos ein beliebter Mann – sehr beliebt bei Frauen, denen gegenüber er stets höflich war, und allgemein beliebt bei Männern, denen gegenüber er freundlich und gutmütig war. Obwohl er sich dessen selbst nicht bewusst war, lag er seinem Vater sehr am Herzen, der auf seine stille Art die Offenheit und Arglosigkeit eines Charakters, der seinem eigenen sehr entgegengesetzt war, fast bewunderte und auf jeden Fall mochte. Der Vater hatte zwar nie ein Wort gesagt, um seinem Sohn zu schmeicheln, aber in Wahrheit schrieb er ihm mehr Talent zu, als er tatsächlich besaß, und selbst wenn er ihn zu verachten schien, hörte er sich die Tiraden des jungen Mannes fast mit Befriedigung an. Everett lag auch seiner Schwester sehr am Herzen, die das einzige andere lebende Mitglied dieses Zweigs der Familie Wharton war. Auf diesen Seiten wird viel über sie gesagt werden, und es ist zu hoffen, dass der Leser Interesse an ihrem Schicksal findet. Aber hier, wo es um den Bruder geht, genügt es vielleicht zu sagen, dass die Schwester, die mit unendlich viel besseren Gaben ausgestattet war als er, den etwas prätentiösen Ansprüchen ihres weniger edlen Bruders Glauben schenkte.
Tatsächlich war es vielleicht ein Unglück für Everett Wharton gewesen, dass einige Leute an ihn geglaubt hatten – und ein weiteres Unglück, dass andere es für lohnenswert gehalten hatten, vorzugeben, an ihn zu glauben. Zu letzteren gehörte wahrscheinlich auch der Freund, mit dem er gerade im Progress zu Abend aß. Ein Mann kann einem anderen schmeicheln, wie Lopez es gelegentlich bei Wharton tat, ohne dass dies eine vorsätzliche Lüge wäre. Es liegt im Interesse eines Mannes, mit einem anderen gut auszukommen, und so lernt der eine allmählich und vielleicht unbewusst, wie er die Schwächen des anderen ausnutzen kann. Für Lopez war es jetzt äußerst wichtig, mit allen Mitgliedern der Familie Wharton gut auszukommen, da er um die Hand der Tochter des Hauses warb. Er glaubte sich ihrer Zuneigung bereits fast sicher zu sein. An der Zustimmung des Vaters zu einer solchen Ehe hatte er jedoch mehr als nur Zweifel. Aber der Bruder war sein Freund – und unter solchen Umständen ist es fast gerechtfertigt, einem Bruder zu schmeicheln.
„Ich sage Ihnen, woran es liegt, Lopez“, sagte Wharton, als sie kurz nach zehn Uhr gemeinsam aus dem Club schlenderten, „die Menschen von heute machen sich nicht die Mühe, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich interessant sind oder sein sollten. Pope wusste das sehr gut, als er sagte: ‚Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch.‘ Aber die Leute lesen Pope heute nicht mehr, oder wenn sie es tun, machen sie sich nicht die Mühe, ihn zu verstehen.“
„Die Leute sind zu sehr damit beschäftigt, Geld zu verdienen, mein Lieber.“
„Genau das ist es. Geld ist eine sehr schöne Sache.“
„Sehr schön“, sagte Lopez.
„Aber das Streben danach ist erniedrigend. Wenn ein Mensch vier, sechs oder sogar acht Stunden am Tag Geld verdienen könnte und dann seine Gedanken davon befreien könnte, so wie ein Büroangestellter die Kopien und Geschäftsbücher aus seinem Kopf verbannt, dann ...“
„Er würde auf diese Weise niemals Geld verdienen – und es behalten.“
„Und deshalb ist das Ganze erniedrigend. Ein Mensch hört auf, sich für die großen Interessen der Welt zu interessieren oder sich ihrer Existenz überhaupt bewusst zu sein, wenn seine ganze Seele in spanischen Anleihen steckt. Sie wollten einen Bankier aus mir machen, aber ich fand, dass mich das umbringen würde.“
„Es würde mich umbringen, glaube ich, wenn ich mich auf spanische Anleihen beschränken müsste.“
„Du weißt, was ich meine. Du kannst mich jedenfalls verstehen, auch wenn ich befürchte, dass du schon zu weit gegangen bist, um die Idee, ein Vermögen zu machen, aufzugeben.“
„Ich würde sie morgen aufgeben, wenn ich ein fertiges Vermögen bekommen könnte. Ein Mann muss schließlich essen.“
„Ja, er muss essen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher“, sagte Wharton nachdenklich, „ob er sich Gedanken darüber machen muss, was er isst.“
„Es sei denn, das Rindfleisch wird ohne Meerrettich serviert!“ Als die beiden Männer sich zum Abendessen hinsetzten, war die vom Steward des Clubs bereitgestellte Menge dieses Gemüses bereits aufgebraucht, und Wharton hatte sich darüber beschwert.
„Ein Mann hat ein Recht auf das, wofür er bezahlt hat“, sagte Wharton mit gespielter Ernsthaftigkeit, „und wenn er solche Versäumnisse unbemerkt hinnehmen würde, würde er der Menschheit insgesamt einen Schaden zufügen. Ich werde mich nicht in eine Falle locken lassen, denn ich mag Meerrettich zu meinem Rindfleisch. Nun, ich kann mich nicht weiter darum kümmern, da ich noch viel zu lesen habe, bevor ich mich an Morpheus wende. Wenn du meinen Rat befolgen willst, gehst du direkt zum Gouverneur. Was auch immer Emily davon hält, ich glaube nicht, dass sie dich sehr ermutigen wird, wenn du nicht so vorgehst. Sie hat ihre eigenen vornehmen Vorstellungen, die vielleicht gar nicht so abwegig sind, wenn ein Mann ein Mädchen heiraten will.“
„Gott bewahre, dass ich irgendetwas an deiner Schwester für falsch halten könnte!“
„Ich selbst finde das nicht. Frauen sind im Allgemeinen oberflächlich – aber manche sind ehrlich oberflächlich und manche unehrlich. Emily ist auf jeden Fall ehrlich.“
„Warte einen Moment.“ Dann schlenderten sie Arm in Arm die breite Straße entlang, die von der Pall Mall zur Duke of York's Column führt. „Ich wünschte, ich könnte deinen Vater besser einschätzen. Er ist immer höflich zu mir, aber er sieht mich mit einem kalten Blick an, der mich denken lässt, dass ich nicht in seiner Gunst stehe.“
„Er ist zu allen so.“
„Ich scheine bei ihm nie über die Oberfläche hinauszukommen. Du hast sicher schon gehört, wie er in meiner Abwesenheit über mich gesprochen hat?“
„Er sagt nie viel über andere.“
„Aber ein Wort würde mir zeigen, wie die Lage ist. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich der Letzte bin, der neugierig darauf ist, was andere über mich denken. Tatsächlich ist mir das nicht so wichtig, wie es einem Mann eigentlich sein sollte. Die Meinung der Welt ist mir völlig egal, und ich würde niemals die Gesellschaft einer netten Person ablehnen, nur weil diese Person mich hinter meinem Rücken schlechtmacht. Was ich schätze, ist die Freundlichkeit des Menschen und nicht seine Zuneigung oder Abneigung mir gegenüber. Aber hier geht es um das wichtigste Ziel meines Lebens, und es könnte für mich von großem Vorteil sein, zu wissen, ob ich bei ihm gut oder schlecht ankomme, um mich entsprechend verhalten zu können.“
„Du hast in den letzten drei Monaten dreimal in Manchester Square zu Abend gegessen, und ich kenne keinen anderen Mann – schon gar keinen anderen jungen Mann –, der einen so starken Beweis für die Vertrautheit meines Vaters erhalten hat.“
„Ja, und ich bin mir meiner Vorteile bewusst. Aber ich war dort als Ihr Freund, nicht als sein Freund.“
„Meine Freunde interessieren ihn nicht die Bohne. Ich wollte Charlie Skate zum Essen einladen, aber mein Vater wollte ihn um keinen Preis dabei haben.“
„Charlie Skate ist pleite und wettet beim Billard. Ich bin respektabel – zumindest denkt das dein Vater. Dein Vater macht sich mehr Sorgen um dich, als dir bewusst ist, und möchte dir sein Haus so angenehm wie möglich machen, solange es dir zugute kommt. Was dich betrifft, so mag er mich sogar, weil er denkt, dass ich mehr Geld verdiene, als ich ausgebe. Trotzdem sieht er mich eher als deinen Freund denn als seinen eigenen. Obwohl er mich in drei Monaten dreimal zum Essen eingeladen hat – und ich weiß seine Gastfreundschaft echt zu schätzen –, hat er wohl nie ein gutes Wort für mich gesagt. Ich wünschte, ich wüsste, was er wirklich denkt.“
„Er sagt, er weiß nichts über dich.“
„Ach so, ist das alles? Dann kann er dir nichts Böses wollen. Wenn er das nächste Mal so was sagt, frag ihn mal, von wie vielen Leuten, die bei ihm essen, er das auch behaupten kann. Gute Nacht, ich will dich nicht länger aufhalten. Aber ich kann dir eins sagen: Wenn wir es schaffen, richtig mit ihm umzugehen, bekommst du vielleicht deinen Sitz im Parlament und ich meine Frau – natürlich nur, wenn sie mich will.“
Dann trennten sie sich, aber Lopez blieb auf dem Weg stehen und ging neben dem alten Militärclub auf und ab, während er nachdachte. Er kannte seinen Freund, den jüngeren Wharton, natürlich sehr gut, schätzte dessen gute Eigenschaften und war sich dessen Schwächen voll bewusst. Durch seine Fragen hatte er genug herausgefunden, um sich sicher zu sein, dass Emilys Vater seinem Vorschlag ablehnend gegenüberstehen würde. Zuvor hatte er kaum Zweifel gehabt, aber jetzt war er sich sicher. „Er weiß nicht viel über mich“, sagte er nachdenklich zu sich selbst. „Nun, nein, das tut er nicht – und es gibt nicht viel, was ich ihm erzählen könnte. Natürlich ist er weise, soweit man das sagen kann. Aber auch weise Menschen machen manchmal dumme Sachen. Selbst die vorsichtigsten Banker der Stadt lassen sich ihr Geld abluchsen, selbst die gewissenhaftesten Matronen lassen sich ihre Tugend abluchsen, selbst die erfahrensten Staatsmänner lassen sich ihre Prinzipien abluchsen. Und wer kann schon wirklich die Chancen berechnen? Männer, die aussichtslose Hoffnungen hegen, setzen sich in der Regel durch, ohne verletzt zu werden – und der fünfte oder sechste Erbe erhält einen Titel.“ So viel sagte er, spürbar, wenn auch zu sich selbst, mit seiner inneren Stimme. Dann fragte er sich – unmerklich, ohne innere Stimme – welche Chance er wohl hätte, das Mädchen für sich zu gewinnen, und er wagte fast, sich einzureden, dass er in dieser Hinsicht nicht verzweifeln müsse.
In Wahrheit liebte er das Mädchen und verehrte sie, weil er sie für besser, höher und edler als andere Menschen hielt – wie es ein Mann tut, wenn er verliebt ist; und weil er das glaubte, hatte er jene Zweifel an seinem eigenen Erfolg, die eine solche Verehrung hervorruft.
Kapitel III. Herr Abel Wharton, Q.C.
Lopez war kein Mann, der untätig herumsaß, wenn er etwas zu tun hatte. Als er es leid war, auf demselben Stück Pflaster hin und her zu laufen und dabei der kalten Ostwind ausgesetzt zu sein, ging er nach Hause und dachte im Bett über dieselbe Angelegenheit nach. Selbst wenn er die Liebeserklärung des Mädchens erhalten würde, könnte er ohne die Zustimmung des Vaters seinem Ziel weiter denn je entfernt sein. Herr Wharton war ein Mann alter Manieren, der sich selbst und seine Tochter betrogen fühlen würde und der auch denken würde, dass ein allgemeiner Verstoß gegen die guten Sitten begangen worden wäre, wenn seine Tochter ohne seine vorherige Zustimmung um ihre Hand gebeten würde. Sollte er sich absolut weigern, dann könnte der Kampf, auch wenn es ein verzweifelter Kampf wäre, vielleicht mit einer anderen Strategie geführt werden; aber nachdem er die Angelegenheit gründlich überdacht hatte, hielt Lopez es für angebracht, sofort zum Vater zu gehen. Dabei würde er kein dummes Zittern verspüren. Was auch immer er empfinden mochte, wenn er mit dem Mädchen sprach, er hatte genug Selbstvertrauen, um den Vater fragen zu können, wenn auch nicht mit Zuversicht, so doch zumindest ohne Beklommenheit. Er dachte, dass der Vater wahrscheinlich beim ersten Anlauf weder ganz zustimmen noch ganz ablehnen würde. Der Charakter des Mannes war so, dass er wahrscheinlich nicht gleich eine klare Antwort geben würde. Der Liebhaber dachte, dass er vielleicht die Zeit der Unsicherheit, die dadurch entstehen würde, nutzen könnte.
Herr Wharton war – und das schon seit sehr vielen Jahren – ein Barrister, der an den Equity-Gerichten praktizierte, oder vielmehr an einem einzigen Equity-Gericht, denn während seiner nun beinahe fünfzig Jahre währenden Berufslaufbahn hatte er dieses eine Vizekanzlergericht kaum je verlassen – ein Gericht, das weit eher unter dem Namen Herr Whartons bekannt war als unter dem des weniger bedeutenden Richters, der dort nun den Vorsitz führte. Sein Leben war ein sehr eigentümliches, ein sehr arbeitsreiches, aber wohl auch ein sehr befriedigendes gewesen. Er hatte seine Praxis früh begonnen und trug bis fast zu seinem sechzigsten Lebensjahr die einfache Robe. Zu jener Zeit hatte er ein großes Vermögen angehäuft, hauptsächlich durch seine berufliche Tätigkeit, zum Teil aber auch durch den sorgfältigen Umgang mit seinem kleinen Erbteil und dem Vermögen seiner Frau. Man wusste, dass er reich war, doch niemand kannte das Ausmaß seines Reichtums. Als er sich schließlich dazu entschloss, die Seidenrobe anzunehmen, erklärte er im Freundeskreis, dies geschehe als vorbereitender Schritt zu seinem Rückzug. Die veränderte Arbeitsweise passe nicht mehr zu seinem Alter, und – wie er sagte – sei sie auch nicht mehr einträglich. Er wolle die Seide als eine Ehrung für seine späten Jahre annehmen, um so zum Mitglied des Rats seiner Anwaltskammer zu werden. Doch nun arbeitete er bereits seit zwölf oder vierzehn Jahren mit der Seidenrobe – beinahe ebenso hart wie in jüngeren Tagen und mit nahezu ebenso lohnenden finanziellen Ergebnissen; und obwohl er von Monat zu Monat seine Absicht bekundete, keine neuen Mandate mehr anzunehmen, und inzwischen gelegentlich tatsächlich Aufträge ablehnte, war er doch weiterhin präsent – mit einem Verstand, der so klar war wie eh und je, und mit einem Körper, der offenbar kaum Ermüdungserscheinungen zeigte.
Herr Wharton hatte erst mit vierzig geheiratet, und seine Frau war nun seit zwei Jahren tot. Er hatte sechs Kinder gehabt, von denen nur noch zwei übrig waren, um ihm im Alter Gesellschaft zu leisten. Er war fast fünfzig gewesen, als seine jüngste Tochter geboren wurde, und war daher nun ein alter Vater eines kleinen Kindes. Aber er gehörte zu den Männern, die in ihrer Jugend nie sehr jung und im Alter nie sehr alt sind. Er konnte immer noch munter auf seinem Pony im Park reiten und tat dies jeden Morgen seines Lebens, nach einer frühen Tasse Tee und vor dem Frühstück. Und er konnte jeden Tag von seiner Kanzlei nach Hause laufen und sonntags zu Fuß die Parks umrunden. Zweimal pro Woche, mittwochs und samstags, aß er in dem alten Anwaltsclub, dem Eldon, zu Abend und spielte nach dem Essen bis zwölf Uhr Whist. Das war die große Zerstreuung und, wie ich finde, der Hauptreiz seines Lebens. Mitte August fuhren er und seine Tochter normalerweise für einen Monat nach Wharton Hall in Herefordshire, dem Sitz seines Cousins Sir Alured Wharton – und das war die einzige Pflicht in seinem Leben, die ihm lästig war. Aber man hatte ihm eingeredet, dass es für seine Gesundheit, die seiner Frau und die seiner Tochter wichtig sei, dass er jeden Sommer für eine Weile die Stadt verlasse – und wohin sollte er sonst gehen? Sir Alured war ein Verwandter und ein Gentleman. Emily mochte Wharton Hall. Es war das Richtige. Er hasste Wharton Hall, aber er kannte keinen Ort außerhalb Londons, den er nicht noch mehr hasste. Einmal hatte man ihn überredet, den Rhein hinaufzufahren, aber er hatte das Experiment einer Auslandsreise nie wiederholt. Emily fuhr manchmal mit ihren Cousinen ins Ausland, und während dieser Zeit verbrachte der alte Anwalt vermutlich einen Großteil seiner Zeit im Eldon. Er war ein schlanker, dünner, kräftig gebauter Mann mit spärlichem hellbraunem Haar, das noch kaum ergraut war, mit kleinen grauen Backenbartstoppeln, klaren Augen, buschigen Augenbrauen und einer langen, hässlichen Nase, von der junge Anwälte behaupteten, man könne einen kleinen Wasserkessel daran aufhängen, und mit einer beträchtlichen Vehemenz im Gespräch, wenn er in einer Diskussion widersprochen wurde. Denn trotz seiner bekannten Gelassenheit konnte Herr Wharton in einer Diskussion sehr hitzig werden, wenn die Natur des Falles dies erforderte. In einem Punkt waren sich alle, die ihn kannten, einig. Er war ein gründlicher Anwalt. Viele zweifelten an seiner Redegewandtheit, und einige behaupteten, er habe das Ausmaß seiner eigenen Fähigkeiten gut gekannt, indem er darauf verzichtete, die höheren Ehren seines Berufs anzustreben; aber niemand zweifelte an seinem juristischen Fachwissen. Er hatte einmal ein Buch geschrieben – über die Verpfändung von Handelsaktien; aber das war in seiner Jugend gewesen, und seitdem hatte er sich nie wieder mit Literatur beschäftigt.
Er war zweifellos ein Mann, vor dem die Leute im Allgemeinen Angst hatten. Am Whist-Tisch wagte es niemand, ihn zu kritisieren. Vor Gericht widersprach ihm nie jemand. In seinem eigenen Haus, obwohl er sehr ruhig war, fürchteten sich die Bediensteten, ihn zu verärgern, und waren aufmerksam auf seine kleinsten Wünsche. Wenn er sich herabließ, mit einem Bekannten im Park auszuritten, war es immer klar, dass der alte Wharton das Tempo bestimmte. Sein Name war Abel, und sein ganzes Leben lang war er als „der fähige Abe” bekannt – ein stiller, weitsichtiger, geiziger, gerechter alter Mann, dem es jedoch keineswegs an Mitgefühl für die Leiden oder Freuden der Menschheit mangelte.
Es war Ostern, und die Gerichte tagten nicht, aber Herr Wharton war wie selbstverständlich um zehn Uhr in seinem Arbeitszimmer. Er kannte keinen wirklichen häuslichen Komfort anderswo – außer vielleicht am Whist-Tisch im Eldon. Er aß, trank und schlief in seinem eigenen Haus am Manchester Square, aber man konnte kaum sagen, dass er dort lebte. Dort war sein Geist nicht wach, und dort übte er seine Fähigkeiten nicht aus. Wenn er nach dem Abendessen aus dem Speisesaal kam, um sich zu seiner Tochter zu gesellen, bat er sie, ihm ein Lied vorzusingen, und setzte sich dann mit einem Buch hin. Aber er las nie in seinem eigenen Haus, sondern fiel unweigerlich in einen süßen und ruhigen Schlaf, aus dem er erst geweckt wurde, wenn seine Tochter ihn vor dem Schlafengehen küsste. Dann ging er im Zimmer auf und ab, schaute auf seine Uhr und schlurfte eine halbe Stunde lang unruhig herum, bis sein Gewissen ihm erlaubte, sich in sein Zimmer zurückzuziehen. In seinem eigenen Haus hatte er keine Beschäftigungen. Aber von zehn Uhr morgens bis fünf oder oft sogar bis sechs Uhr abends war sein Geist mit irgendeiner Arbeit beschäftigt. Es war nicht mehr nur das Recht, wie es früher der Fall gewesen war. In der Schublade des alten Möbelstücks, das direkt rechts neben seinem Sessel stand, waren verschiedene Bücher versteckt, die er manchmal vor seinen Mandanten zu sehen schämte – Gedichte und Romane und sogar Märchen. Denn es gab nichts, was Herr Wharton in seiner Kanzlei nicht lesen konnte, obwohl es nichts gab, was er in seinem eigenen Haus lesen konnte. Er hatte ein großes, angenehmes Zimmer, in dem er sitzen und vom Erdgeschoss der Stone Buildings auf die Gärten des Inns blicken konnte – und hier, im Zentrum der Metropole, aber in völliger Ruhe, was die Außenwelt betraf, hatte er sein Leben gelebt und lebte es immer noch.
Ungefähr um die Mittagszeit des Tages, nachdem Lopez seinen überraschenden Besuch bei Herr Parker gemacht und dann mit Everett Wharton zu Mittag gegessen hatte, kam er bei Stone Buildings vorbei und wurde in das Zimmer des Anwalts geführt. Sein scharfer Blick entdeckte sofort das Buch, das Herr Wharton halb versteckt hatte, und sah darauf Herr Mudies verdächtigen Zettel. Anwälte kaufen ihre Gesetzbücher sicher nicht bei Mudie, und Lopez wusste sofort, dass sein hoffentlich zukünftiger Schwiegervater einen Roman gelesen hatte. Er hätte ihm so eine Schwäche nicht zugetraut, aber für sein Vorhaben war das gut. Ein alter Anwalt, der seine Vormittage mit so was verbrachte, musste doch eine weiche Stelle in seinem Herzen haben. „Guten Tag, Sir“, sagte Herr Wharton und stand von seinem Stuhl auf. „Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Sir.“ Obwohl er einen Roman gelesen hatte, waren sein Tonfall und sein Auftreten sehr kühl. Lopez war noch nie zuvor in Stone Buildings gewesen und war sich nicht ganz sicher, ob er mit seinem Besuch dort nicht vielleicht eine Beleidigung begangen hatte. „Nehmen Sie Platz, Herr Lopez. Kann ich Ihnen in meiner Eigenschaft irgendwie behilflich sein?“
Es gab vieles, was er „auf seine Weise“ als Vater tun konnte – aber wie sollte er das ansprechen und den Fall klarstellen? Lopez wusste nicht, ob der alte Mann bisher jemals solche Gefühle vermutet hatte, wie er sie jetzt offenbaren wollte. Er hatte in dem Haus am Manchester Square enge Beziehungen gepflegt und sich sicherlich bei einer gewissen Frau Roby sehr beliebt gemacht, die Frau Whartons Schwester und ständige Begleiterin gewesen war, in der Berkeley Street, gleich um die Ecke vom Manchester Square, gewohnt hatte und viel Zeit mit Emily Wharton verbracht hatte. Sie waren täglich zusammen, als hätte Frau Roby die Rolle einer zweiten Mutter übernommen, und Lopez war sich bewusst, dass Frau Roby von seiner Liebe wusste. Wenn zwischen Frau Roby und dem alten Anwalt echtes Vertrauen herrschte, musste der alte Anwalt es auch wissen – aber was das anging, fühlte sich Lopez im Dunkeln.
Mit einem alten Vater zu reden ist nicht unangenehm, wenn der Liebhaber weiß, dass er seit sechs Monaten wohlwollend beäugt und sogar akzeptiert wird. Er wird auf die Schulter geklopft, umschmeichelt und in die Familie aufgenommen werden. Ihm wird gesagt werden, dass seine Mary oder seine Augusta die beste Tochter der Welt war und daher sicherlich auch die beste Ehefrau sein wird, und er selbst wird bei dieser besonderen Gelegenheit wahrscheinlich mit uneingeschränktem Lob bedacht werden – und alles wird angenehm sein. Aber das Thema ist echt schwierig anzusprechen, wenn vorher kein Licht darauf geworfen wurde. Ferdinand Lopez war aber nicht der Typ, der zitternd am Abgrund stehen blieb, wenn ein Sprung nötig war – und deshalb wagte er den Sprung. „Herr Wharton, ich habe mir erlaubt, Sie hier aufzusuchen, weil ich mit Ihnen über Ihre Tochter sprechen möchte.“
„Über meine Tochter!“ Die Überraschung des alten Mannes war echt. Nachdem er einen Moment nachgedacht hatte, war ihm natürlich klar, worum es bei dem Besuch wohl gehen würde. Aber bis zu diesem Moment hatte er seine Tochter und Ferdinand Lopez in seinen Gedanken nie miteinander in Verbindung gebracht. Und nun, da ihm dieser Gedanke gekommen war, sah er den Freier mit strengem und unfreundlichem Blick an. Dem Freier war klar, dass der erste Eindruck dieser Angelegenheit für den Vater schmerzhaft war.
„Ja, Sir. Ich weiß, wie groß meine Anmaßung ist. Aber nachdem ich mich dennoch getraut habe, ich würde kaum sagen, eine Hoffnung zu hegen, sondern vielmehr in einen Zustand geraten zu sein, in dem ich nur durch Hoffen glücklich sein kann, hielt ich es für das Beste, sofort zu Ihnen zu kommen.“
„Weiß sie davon?“
„Von meinem Besuch bei dir? Nein, nichts.“
„Von deinen Absichten, von deinem Heiratsantrag im Allgemeinen? Muss ich davon ausgehen, dass sie damit einverstanden ist?“
„Überhaupt nicht.“
„Hast du ihr irgendwas davon erzählt?“
„Kein Wort. Ich bin hier, um dich um deine Erlaubnis zu bitten, ihr einen Heiratsantrag zu machen.“
„Du meinst, sie hat überhaupt keine Ahnung von deiner – deiner Vorliebe für sie.“
„Das kann ich nicht sagen. Es ist kaum möglich, dass ich sie so lieben gelernt habe, ohne dass sie sich dessen bewusst ist.“
„Was ich meine, ohne um den heißen Brei herumzureden: Hast du ihr den Hof gemacht?“
„Wer kann schon sagen, was Werben bedeutet, Herr Wharton?“
„Verdammt noch mal, Sir, ein Gentleman weiß das. Ein Gentleman weiß, ob er mit den Gefühlen eines Mädchens gespielt hat, und ein Gentleman wird, wenn er gefragt wird, wie ich Sie gefragt habe, auf jeden Fall die Wahrheit sagen. Ich will keine Definitionen. Haben Sie ihr den Hof gemacht?“
„Ich denke, Herr Wharton, dass ich mich wie ein Gentleman verhalten habe, und dass du das zumindest anerkennen wirst, wenn du genau erfährst, was ich getan und was ich nicht getan habe. Ich habe mich bemüht, mich deiner Tochter zu empfehlen, aber ich habe nie ein Wort der Liebe zu ihr gesagt.“
„Weiß Everett davon?“
„Ja.“
„Und hat er das unterstützt?“
„Er weiß davon, weil er mein engster Freund ist. Wer auch immer diese Dame gewesen sein mag, ich hätte es ihm erzählt. Er hängt sehr an mir und würde, glaube ich, mich ohne Weiteres als seinen Bruder bezeichnen. Ich habe gestern ganz offen mit ihm darüber gesprochen, und er sagte mir, ich solle auf jeden Fall zuerst mit dir sprechen. Ich habe ihm voll und ganz zugestimmt, und deshalb bin ich hier. Sein Verhalten hat Sie sicherlich nicht verärgert, und ich glaube auch nicht, dass mein Verhalten Sie verärgert hat.“
Seine würdevolle Haltung und sein ruhiger, selbstbewusster Mut beeindruckten den alten Anwalt. Er hatte das Gefühl, dass er nicht wütend werden und in zweideutiger Sprache darüber reden konnte, was ein „Gentleman“ tun oder nicht tun würde. Er mochte diesen Mann als Schwiegersohn vielleicht überhaupt nicht mögen – und im Moment dachte er, dass dies der Fall war –, aber dennoch hatte der Mann ein Recht auf eine höfliche Antwort. Wie sollten Liebende sich den Damen ihrer Liebe respektvoller nähern als auf diese Weise? „Herr Lopez“, sagte er, „Sie müssen mir verzeihen, wenn ich sage, dass Sie für uns vergleichsweise ein Fremder sind.“
„Das ist ein Zufall, der leicht zu beheben wäre, wenn dein Wille in dieser Hinsicht so stark wäre wie meiner.“
„Aber vielleicht ist das nicht der Fall. In solchen Angelegenheiten muss man klar sein. Das Glück einer Tochter ist eine sehr ernste Angelegenheit – und manche Leute, zu denen ich mich auch zähle, sind der Meinung, dass Gleich und Gleich sich gerne heiratet. Ich möchte, dass meine Tochter heiratet – nicht nur in meinem eigenen Umfeld, weder höher noch niedriger –, sondern jemanden aus meiner eigenen Gesellschaftsschicht.“
„Ich weiß nicht recht, Herr Wharton, ob das mich ausschließen soll.“
„Nun, um ehrlich zu sein, weiß ich nichts über dich. Ich weiß nicht, wer Ihr Vater war – ob er Engländer war, ob er Christ war, ob er Protestant war – nicht einmal, ob er ein Gentleman war. Das sind Fragen, die ich unter anderen Umständen niemals stellen würde; es wären Dinge, die mich nichts angehen würden, wenn Sie nur ein Bekannter wären. Aber wenn man mit einem Mann über seine Tochter spricht ...!“
„Ich erkenne dein Recht auf Auskunft uneingeschränkt an.“
„Und ich weiß nichts über deine finanziellen Verhältnisse – überhaupt nichts. Ich weiß, dass du wie ein vermögender Mann lebst, aber ich nehme an, dass du dein Geld verdienst. Ich weiß nichts darüber, wie du es verdienst, nichts über die Sicherheit oder die Höhe deiner Einkünfte.“
„Diese Dinge sind natürlich Gegenstand von Nachforschungen, aber darf ich annehmen, dass du keine Einwände hast, die durch zufriedenstellende Antworten auf solche Fragen ausgeräumt werden könnten?“
„Ich werde meine Tochter niemals freiwillig jemandem geben, der nicht der Sohn eines englischen Gentleman ist. Das mag ein Vorurteil sein, aber das ist meine Meinung.“
„Mein Vater war sicherlich kein englischer Gentleman. Er war Portugiese.“ Indem er dies zugab und sich damit sofort einem klar formulierten Einwand aussetzte – einem Einwand, der, obwohl er zugegeben wurde, weder einen Fehler noch eine Schande mit sich brachte –, hatte Lopez das Gefühl, einen gewissen Vorteil erlangt zu haben. Er konnte die Tatsache, dass er der Sohn eines portugiesischen Elternteils war, nicht überwinden, aber indem er dies offen zugab, dachte er, er könnte eine gegenwärtige Diskussion über Angelegenheiten vermeiden, die vielleicht unangenehmer wären, auf die er aber nicht eingehen müsste, wenn der Vater seine Herkunft als klärend für die Frage betrachten würde. „Meine Mutter war eine Engländerin“, fügte er hinzu, „aber mein Vater war definitiv kein Engländer. Ich hatte nie das Glück, einen von beiden kennenzulernen. Ich war schon Waise, bevor ich überhaupt wusste, was es heißt, Eltern zu haben.“