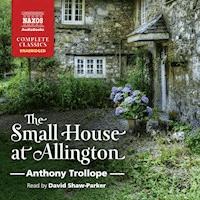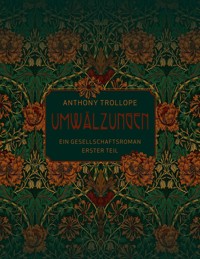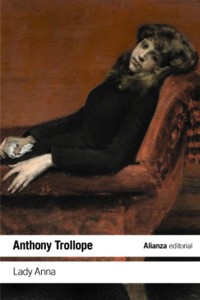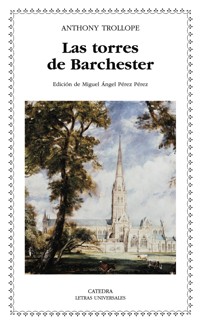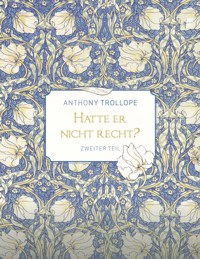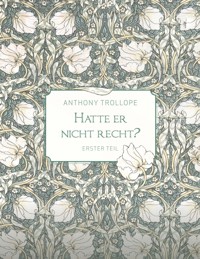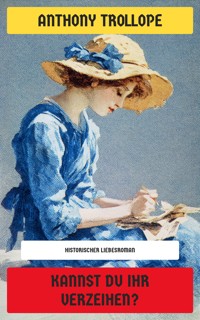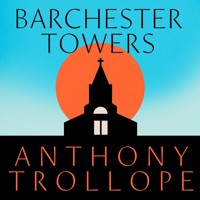0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das Pfarrhaus von Framley" von Anthony Trollope ist ein feinsinniges Porträt des viktorianischen Englands und Teil der berühmten Barchester-Serie des Autors. Der Roman entfaltet ein soziales Panorama, das sich auf Intrigen und Machtkämpfe innerhalb der kirchlichen und gesellschaftlichen Hierarchien zentriert. Im Fokus steht der ambitionierte junge Pfarrer Mark Robarts, dessen Bestrebungen, in die höheren Kreise aufzusteigen, ihn in moralische und soziale Konflikte führen. Trollopes meisterhafter Stil zeichnet sich durch seine präzise Charakterbildung und den subversiven, gleichzeitig humorvollen Erzählton aus, der die Leser in die Feinheiten des viktorianischen Lebens eintauchen lässt. Anthony Trollope, geboren 1815 in London, ist ein herausragender Vertreter des viktorianischen Romans. Seine Erfahrungen als Beamter bei der britischen Post ermöglichten ihm tiefe Einblicke in die sozialen Strukturen seines Heimatlandes, die er literarisch zu verarbeiten wusste. Trollopes realistische Darstellungsweise und sein scharfer Blick auf gesellschaftliche Dynamiken beeinflussten die Entstehung von "Das Pfarrhaus von Framley", wobei persönliche Beobachtungen und sein Faible für das Landleben eine wesentliche Rolle spielten. Für den modernen Leser bietet "Das Pfarrhaus von Framley" nicht nur ein akkurates historisches Abbild, sondern auch eine universelle Studie menschlicher Ambitionen und Schwächen. Erfahrene und neue Leser von Trollopes Werken werden gleichermaßen fasziniert sein von der reichen Textur und der zeitlosen Thematik, die dieser Roman bietet. Ein Muss für Liebhaber detaillierter Gesellschaftsstudien und beachtlicher literarischer Erkundungen, das zum Nachdenken anregt und den Leser in eine vergangene Epoche versetzt. "Das Pfarrhaus von Framley" ist ein edles Beispiel viktorianischer Literatur, das weiterhin seine lesenswerte Relevanz behält. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Pfarrhaus von Framley
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I. „Omnes Omnia Bona Dicere”
Als der junge Mark Robarts das College verließ, hätte sein Vater wohl sagen können, dass alle Leute anfingen, ihm nur Gutes zu wünschen und sein Glück zu loben, einen Sohn mit so einem tollen Charakter zu haben. Dieser Vater war Arzt und lebte in Exeter. Er war ein Gentleman ohne eigenes Vermögen, hatte aber eine gut gehende Praxis, die es ihm ermöglichte, seine Familie zu versorgen und ihr eine Ausbildung zu bieten, die alle Vorteile mit sich brachte, die man in diesem Land mit Geld bekommen konnte. Mark war sein ältester Sohn und sein zweites Kind; und die ersten ein oder zwei Seiten dieser Erzählung müssen damit verbracht werden, eine Aufzählung der guten Dinge zu geben, die diesem jungen Mann durch Zufall und sein Verhalten zuteil geworden waren.
Sein erster Schritt im Leben ergab sich daraus, dass er, als er noch sehr jung war, als Privatschüler in das Haus eines Geistlichen geschickt wurde, der ein alter und enger Freund seines Vaters war. Dieser Geistliche hatte noch einen weiteren, und zwar nur einen weiteren Schüler – den jungen Lord Lufton; und zwischen den beiden Jungen hatte sich eine enge Freundschaft entwickelt. Während sie beide dort waren, hatte Lady Lufton ihren Sohn besucht und dann den jungen Robarts eingeladen, seine nächsten Ferien in Framley Court zu verbringen. Dieser Besuch fand statt und endete damit, dass Mark mit einem Brief voller Lob von der verwitweten Adligen nach Exeter zurückkehrte. Sie sei begeistert gewesen, einen solchen Gefährten für ihren Sohn zu haben, und äußerte die Hoffnung, dass die Jungen während ihrer Ausbildung zusammenbleiben könnten. Dr. Robarts war ein Mann, der viel Wert auf den Umgang mit Adligen legte und keineswegs geneigt war, einen Vorteil zu verschenken, der sich für sein Kind aus einer solchen Freundschaft ergeben könnte. Als der junge Lord daher nach Harrow geschickt wurde, ging Mark Robarts ebenfalls dorthin.
Dass der Lord und sein Freund sich oft stritten und gelegentlich sogar prügelten – ja, dass sie sogar drei Monate lang nicht miteinander sprachen –, beeinträchtigte die Hoffnungen des Doktors in keiner Weise. Mark verbrachte immer wieder zwei Wochen in Framley Court, und Lady Lufton schrieb stets in den höchsten Tönen von ihm. Dann gingen die Jungs zusammen nach Oxford, und auch hier hatte Mark Glück, was eher an seinem sehr anständigen Lebensstil lag als an irgendwelchen tollen Erfolgen im Studium. Seine Familie war stolz auf ihn, und der Doktor erzählte seinen Patienten immer gern von ihm, nicht weil er ein Musterschüler war und Medaillen und Stipendien bekommen hatte, sondern wegen seines super Verhaltens. Er bewegte sich in den besten Kreisen, machte keine Schulden, war gesellig, vermied aber die niederen Gesellschaftsschichten, trank gerne ein Glas Wein, war aber nie betrunken, und vor allem war er einer der beliebtesten Männer an der Universität. Dann stellte sich die Frage nach dem Beruf für diesen jungen Hyperion, und zu diesem Thema wurde Dr. Robarts selbst nach Framley Court eingeladen, um die Angelegenheit mit Lady Lufton zu besprechen. Dr. Robarts kehrte mit der festen Überzeugung zurück, dass die Kirche der beste Beruf für seinen Sohn sei.
Lady Lufton hatte Dr. Robarts nicht umsonst den weiten Weg aus Exeter kommen lassen. Die Pfarrei von Framley war eine Pfründe der Familie Lufton, und die nächste Ernennung würde in den Händen von Lady Lufton liegen, sollte sie vor dem 25. Geburtstag des jungen Lords frei werden, und in den Händen des jungen Lords, sollte sie danach frei werden. Aber die Mutter und der Erbe waren bereit, Dr. Robarts ein gemeinsames Versprechen zu geben. Da der derzeitige Amtsinhaber über siebzig Jahre alt war und die Pfarrei 900 Pfund pro Jahr einbrachte, gab es keinen Zweifel daran, dass der Beruf des Geistlichen die richtige Wahl war. Und ich muss noch sagen, dass die Witwe und der Doktor in ihrer Wahl durch das Leben und die Prinzipien des jungen Mannes bestätigt wurden – soweit ein Vater in der Wahl eines solchen Berufs für seinen Sohn bestätigt werden kann und soweit ein Laie, der eine Pfründe innehat, in einer solchen Zusage bestätigt werden kann. Hätte Lady Lufton einen zweiten Sohn gehabt, hätte dieser wahrscheinlich die Pfründe erhalten, und niemand hätte das für falsch gehalten – schon gar nicht, wenn dieser zweite Sohn jemand wie Mark Robarts gewesen wäre.
Lady Lufton selbst war eine Frau, die viel über religiöse Themen nachdachte und auf keinen Fall bereit gewesen wäre, jemanden in eine Pfarrei zu versetzen, nur weil dieser jemand ein Freund ihres Sohnes gewesen war. Sie neigte zur Hochkirche und erkannte, dass der junge Mark Robarts die gleiche Neigung hatte. Sie wünschte sich sehr, dass ihr Sohn sich mit seinem Pfarrer gut verstand, und durch diesen Schritt würde sie das auf jeden Fall sicherstellen. Sie wollte unbedingt, dass der Pfarrer jemand war, mit dem sie gut zusammenarbeiten konnte, und vielleicht hoffte sie insgeheim, dass er sich ein bisschen ihrem Einfluss unterordnen würde. Wenn sie einen älteren Mann genommen hätte, wäre das wahrscheinlich nicht so gut geklappt, und wenn ihr Sohn das Zeug dazu gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht geklappt. Deshalb wurde beschlossen, dass der junge Robarts die Stelle bekommen sollte.
Er machte seinen Abschluss – nicht mit Bravour, aber ganz so, wie sein Vater es wollte; dann reiste er acht oder zehn Monate lang mit Lord Lufton und einem College-Dozenten und wurde fast unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Hause zum Priester geweiht.
Die Pfarrei von Framley liegt in der Diözese Barchester, und angesichts der Hoffnungen, die Mark in diese Diözese setzte, war es kein Problem, ihm dort eine Vikariatsstelle zu verschaffen. Aber diese Stelle durfte er nicht lange ausüben. Er war noch kein Jahr dort, als der arme alte Dr. Stopford, der damalige Pfarrer von Framley, zu seinen Vorfahren ging und die Erfüllung seiner großen Hoffnungen auf seine Schultern fiel.
Aber bevor wir zu den eigentlichen Ereignissen unserer Geschichte kommen, muss noch mehr über sein Glück erzählt werden. Lady Lufton, die, wie ich schon sagte, viel über kirchliche Angelegenheiten nachdachte, ging mit ihren hochkirchlichen Prinzipien nicht so weit, dass sie das Zölibat für Geistliche befürwortete. Im Gegenteil, sie war der Meinung, dass ein Mann ohne Frau kein guter Gemeindepfarrer sein könne. Nachdem sie ihrem Liebling also eine Stellung in der Welt und ein Einkommen verschafft hatte, das den Bedürfnissen eines Gentleman entsprach, machte sie sich daran, ihm eine Partnerin zu suchen, die diese Segnungen mit ihm teilen konnte. Und auch hier stimmte er, wie in anderen Dingen auch, mit den Ansichten seiner Gönnerin überein – allerdings nicht, weil sie ihm diese in derselben deutlichen Weise mitgeteilt hatte, wie sie die Frage der Pfarrei angesprochen hatte. Dafür war Lady Lufton viel zu sehr mit weiblicher List begabt. Sie erzählte dem jungen Pfarrer nie, dass Fräulein Monsell die verheiratete Tochter Ihrer Ladyschaft nach Framley Court begleitet hatte, damit er, Mark, sich in sie verlieben würde; aber genau das war der Fall.
Lady Lufton hatte nur zwei Kinder. Die älteste Tochter war seit vier oder fünf Jahren mit Herr George Meredith verheiratet, und diese Fräulein Monsell war eine liebe Freundin von ihr. Und nun steht mir die große Schwierigkeit des Romanciers bevor. Fräulein Monsell – oder besser gesagt Frau Mark Robarts – muss beschrieben werden. Als Fräulein Monsell wird unsere Geschichte nicht lange auf sie eingehen müssen. Und doch werden wir sie Fanny Monsell nennen, wenn wir sagen, dass sie eine der angenehmsten Gefährtinnen war, die man einem Mann als zukünftige Partnerin in seinem Zuhause und Besitzerin seines Herzens zur Seite stellen konnte. Und wenn hohe Prinzipien ohne Schärfe, weibliche Sanftmut ohne Schwäche, eine Liebe zum Lachen ohne Bosheit und ein wahrhaft liebevolles Herz eine Frau dazu qualifizieren, die Frau eines Pfarrers zu sein, dann war Fanny Monsell für diese Position qualifiziert. Von ihrer Statur her war sie etwas größer als üblich. Ihr Gesicht wäre schön gewesen, wenn ihr Mund nicht so groß gewesen wäre. Ihr Haar, das üppig war, hatte eine leuchtende braune Farbe; auch ihre Augen waren braun und damit das markante Merkmal ihres Gesichts, denn braune Augen sind nicht alltäglich. Sie waren flüssig, groß und voller Zärtlichkeit oder Heiterkeit. Mark Robarts hatte immer noch sein gewohntes Glück, als ein solches Mädchen nach Framley gebracht wurde, um ihn zu umwerben. Und er umwarb sie – und gewann sie. Denn Mark selbst war ein gutaussehender Kerl. Zu dieser Zeit war der Pfarrer etwa fünfundzwanzig Jahre alt, und die zukünftige Frau Robarts war zwei oder drei Jahre jünger. Auch kam sie nicht ganz mit leeren Händen in das Pfarrhaus. Man kann nicht sagen, dass Fanny Monsell eine Erbin war, aber sie hatte ein Vermögen von einigen tausend Pfund geerbt. Das war so geregelt, dass die Zinsen aus dem Geld seiner Frau die hohe Lebensversicherung bezahlten, die der junge Robarts abgeschlossen hatte, und ihm darüber hinaus genug übrig blieb, um sein Pfarrhaus im besten Stil eines Geistlichen einzurichten und ihn freudig auf den Weg ins Leben zu schicken.
So viel hat Lady Lufton für ihren Schützling getan, und man kann sich gut vorstellen, dass der Arzt aus Devonshire, der nachdenklich vor dem Kamin in seinem Wohnzimmer saß und auf sein Leben zurückblickte, wie Menschen eben auf das Ergebnis ihres Lebens zurückblicken, mit diesem Ergebnis sehr zufrieden war, was seinen ältesten Sprössling, Reverend Mark Robarts, den Pfarrer von Framley, betraf.
Aber bisher wurde noch wenig über unseren Helden selbst gesagt, und vielleicht ist es auch nicht nötig, viel zu sagen. Hoffen wir, dass er nach und nach auf die Bühne tritt und dem Betrachter sein inneres und äußeres Wesen offenbart. Hier reicht es vielleicht zu sagen, dass er weder ein geborener Engel war, noch ein geborener Teufel. Er war so, wie ihn seine Erziehung gemacht hatte. Er hatte großes Potenzial für Gutes – und auch für Böses, genug, um es notwendig zu machen, dass er Versuchungen abwehren musste, wie nur Versuchungen abgewehrt werden können. Es wurde viel unternommen, um ihn zu verderben, aber im üblichen Sinne des Wortes war er nicht verdorben. Er hatte zu viel Taktgefühl und zu viel gesunden Menschenverstand, um sich selbst für das Vorbild zu halten, für das ihn seine Mutter hielt. Selbstüberschätzung war vielleicht nicht seine größte Gefahr. Hätte er mehr davon gehabt, wäre er vielleicht ein weniger angenehmer Mensch gewesen, aber sein Weg hätte dadurch vielleicht sicherer gewesen sein können. Er war männlich, groß und blond, mit einer breiten Stirn, die eher Intelligenz als Nachdenklichkeit verriet, mit klaren, weißen Händen, mandelförmigen Fingernägeln und der Fähigkeit, sich so zu kleiden, dass niemand jemals bemerken konnte, ob seine Kleidung gut oder schlecht, schäbig oder schick war.
So war Mark Robarts, als er im Alter von fünfundzwanzig Jahren oder etwas älter Fanny Monsell heiratete. Die Hochzeit wurde in seiner eigenen Kirche gefeiert, da Fräulein Monsell kein eigenes Zuhause hatte und die letzten drei Monate in Framley Court gewohnt hatte. Sie wurde von Herr George Meredith zum Altar geführt, und Lady Lufton selbst sorgte dafür, dass die Hochzeit so ablief, wie sie sein sollte, mit fast ebenso viel Sorgfalt, wie sie sie bei der Hochzeit ihrer eigenen Tochter an den Tag gelegt hatte. Die Trauung, das eigentliche Binden des Eheknaufs, wurde vom hochwürdigen Dekan von Barchester vollzogen, einem geschätzten Freund von Lady Lufton. Und Frau Arabin, die Frau des Dekans, war auch dabei, obwohl die Strecke von Barchester nach Framley lang ist, die Straßen holprig sind und es keine Bahnverbindung gibt. Und Lord Lufton war natürlich auch da; und die Leute meinten, er würde sich bestimmt in eine der vier hübschen Brautjungfern verlieben, von denen Blanche Robarts, die zweite Schwester des Pfarrers, allgemein als die mit Abstand Schönste galt. Und da war noch eine weitere, jüngere Schwester von Mark – die zwar nicht bei der Zeremonie mitwirkte, aber anwesend war – und über die keine Vorhersagen gemacht wurden, da sie damals erst sechzehn Jahre alt war, die aber hier erwähnt wird, da meine Leser sie später noch kennenlernen werden. Ihr Name war Lucy Robarts. Dann gingen der Pfarrer und seine Frau auf Hochzeitsreise, während der alte Vikar sich um die Seelen von Framley kümmerte. Zu gegebener Zeit kehrten sie zurück, und nach einer weiteren Pause wurde ihnen ein Kind geboren, dann noch eines, und danach kam die Zeit, in der unsere Geschichte beginnt. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich sagen, dass alle Leute Recht hatten, als sie dem Arzt aus Devonshire alle möglichen guten Dinge wünschten und ihn dafür lobten, dass er so einen Sohn hatte.
„Du warst heute im Haus, nehme ich an?”, fragte Mark seine Frau, während er sich in einem Sessel im Wohnzimmer vor dem Kamin ausstreckte, bevor er sich für das Abendessen fertig machte. Es war ein Novemberabend, und er war den ganzen Tag unterwegs gewesen, und in solchen Fällen ist die Neigung, sich mit dem Anziehen Zeit zu lassen, sehr groß. Ein willensstarker Mann geht direkt von der Haustür in sein Zimmer, ohne der Versuchung des Kamins im Wohnzimmer zu erliegen.
„Nein, aber Lady Lufton war hier.“
„Voller Argumente zugunsten von Sarah Thompson?“
„Genau so, Mark.“
„Und was hast du über Sarah Thompson gesagt?“
„Sehr wenig, was von mir selbst kam, aber ich habe angedeutet, dass du der Meinung bist oder dass ich der Meinung bin, dass eine der regulär ausgebildeten Lehrerinnen besser wäre.“
„Aber Ihre Ladyschaft war nicht einverstanden?“
„Nun, das würde ich nicht unbedingt sagen, obwohl ich denke, dass sie vielleicht nicht zugestimmt hat.“
„Ich bin mir sicher, dass sie das nicht getan hat. Wenn sie etwas durchsetzen will, setzt sie das sehr gerne durch.“
„Aber Mark, ihre Standpunkte sind ja meistens so gut.“
„Aber weißt du, in dieser Schulangelegenheit denkt sie mehr an ihre Schützling als an die Kinder.“
„Sag ihr das, und ich bin sicher, sie wird nachgeben.“ Und dann schwiegen beide wieder. Und nachdem sich der Pfarrer, soweit das vor dem Kamin möglich war, gründlich aufgewärmt hatte, drehte er sich um und begann mit der Operation à tergo.
„Komm, Mark, es ist zwanzig nach sechs. Willst du dich anziehen?“
„Ich sag dir was, Fanny: Sie muss ihren Willen in Bezug auf Sarah Thompson bekommen. Du kannst sie morgen besuchen und ihr das sagen.“
„Ich bin mir sicher, Mark, dass ich nicht nachgeben würde, wenn ich es für falsch hielte. Und sie würde das auch nicht erwarten.“
„Wenn ich diesmal darauf bestehe, werde ich beim nächsten Mal sicherlich nachgeben müssen, und dann könnte das nächste Mal wahrscheinlich wichtiger sein.“
„Aber wenn es falsch ist, Mark?“
„Ich habe nicht gesagt, dass es falsch ist. Außerdem muss man, wenn es falsch ist, und sei es nur in einem winzigen Maße, damit leben. Sarah Thompson ist sehr respektabel; die einzige Frage ist, ob sie unterrichten kann.“
Die junge Frau hatte, obwohl sie es nicht sagte, den Eindruck, dass ihr Mann sich irrte. Es stimmt, dass man Unrecht hinnehmen muss, sogar viel Unrecht. Aber niemand muss Unrecht hinnehmen, das er beheben kann. Warum sollte er, der Pfarrer, zustimmen, eine unfähige Lehrerin für die Kinder der Gemeinde zu akzeptieren, wenn er eine fähige beschaffen konnte? In einem solchen Fall – so dachte Frau Robarts bei sich – hätte sie die Angelegenheit mit Lady Lufton ausgefochten. Am nächsten Morgen tat sie jedoch, wie ihr geheißen, und teilte der Dowager mit, dass alle Einwände gegen Sarah Thompson zurückgezogen würden.
„Ah! Ich war mir sicher, dass er mir zustimmen würde“, sagte Ihre Ladyschaft, „wenn er erst einmal erfahren würde, was für eine Person sie ist. Ich wusste, dass ich es nur erklären musste“ – und dann putzte sie sich heraus und war sehr gnädig; denn um ehrlich zu sein, mochte Lady Lufton es nicht, wenn man ihr in Angelegenheiten, die die Gemeinde betrafen, widersprach.
„Und, Fanny“, sagte Lady Lufton in ihrer freundlichsten Art, „du gehst am Samstag doch nirgendwo hin, oder?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Dann musst du zu uns kommen. Justinia wird hier sein, weißt du“ – Lady Meredith hieß Justinia – „und du und Herr Robarts solltet besser bis Montag bei uns bleiben. Er kann am Sonntag das kleine Bücherzimmer ganz für sich allein haben. Die Merediths reisen am Montag ab, und Justinia wird nicht glücklich sein, wenn du nicht bei ihr bist.“ Es wäre unfair zu sagen, dass Lady Lufton beschlossen hatte, die Robartses nicht einzuladen, wenn sie in Bezug auf Sarah Thompson nicht ihren Willen bekommen würde. Aber das wäre das Ergebnis gewesen. So wie es war, war sie jedoch sehr freundlich, und als Frau Robarts eine kleine Ausrede vorbrachte und sagte, sie müsse wegen der Kinder am Abend nach Hause zurückkehren, erklärte Lady Lufton, dass es in Framley Court genug Platz für Baby und Kindermädchen gäbe, und regelte die Angelegenheit auf ihre Weise mit ein paar Kopfnicken und drei Klopfern mit ihrem Regenschirm. Das war an einem Dienstagmorgen, und am selben Abend, vor dem Abendessen, setzte sich der Pfarrer wieder auf denselben Stuhl vor dem Kamin im Wohnzimmer, sobald er gesehen hatte, dass sein Pferd in den Stall geführt worden war.
„Mark“, sagte seine Frau, „die Merediths kommen am Samstag und Sonntag nach Framley, und ich habe versprochen, dass wir hinfahren und bis Montag bleiben werden.“
„Das ist doch nicht dein Ernst! Meine Güte, wie ärgerlich!“
„Warum? Ich dachte, es würde dir nichts ausmachen. Und Justinia würde es als unfreundlich empfinden, wenn ich nicht da wäre.“
„Du kannst fahren, meine Liebe, und wirst natürlich auch fahren. Aber für mich ist das unmöglich.“
„Aber warum, Liebling?“
„Warum? Gerade eben habe ich in der Schule einen Brief beantwortet, der mir aus Chaldicotes zugestellt wurde. Sowerby besteht darauf, dass ich für etwa eine Woche dorthin komme, und ich habe zugesagt.“
„Eine Woche nach Chaldicotes, Mark?“
„Ich glaube, ich habe sogar zehn Tagen zugestimmt.“
„Und zwei Sonntage weg sein?“
„Nein, Fanny, nur einen. Sei nicht so kritisch.“
„Nenn mich nicht kritisch, Mark, du weißt, dass ich das nicht bin. Aber es tut mir so leid. Genau das wird Lady Lufton nicht gefallen. Außerdem warst du letzten Monat schon zwei Sonntage in Schottland.“
„Im September, Fanny. Und das ist kritisch.“
„Oh, aber Mark, lieber Mark, sag das nicht. Du weißt, dass ich das nicht so meine. Aber Lady Lufton mag diese Chaldicotes nicht. Du weißt, dass Lord Lufton das letzte Mal, als du dort warst, bei dir war, und wie verärgert sie war!“
„Lord Lufton wird diesmal nicht dabei sein, denn er ist noch in Schottland. Und der Grund, warum ich hingehe, ist folgender: Harold Smith und seine Frau werden dort sein, und ich bin sehr daran interessiert, mehr über sie zu erfahren. Ich habe keinen Zweifel, dass Harold Smith eines Tages in der Regierung sein wird, und ich kann es mir nicht leisten, die Bekanntschaft mit einem solchen Mann zu vernachlässigen.“
„Aber Mark, was willst du von einer Regierung?“
„Nun, Fanny, natürlich muss ich sagen, dass ich nichts will, und in gewisser Weise ist das auch so, aber trotzdem werde ich hingehen und die Harold Smiths treffen.“
„Könntest du nicht vor Sonntag zurück sein?“
„Ich habe versprochen, in Chaldicotes zu predigen. Harold Smith wird in Barchester einen Vortrag über den australasiatischen Archipel halten, und ich soll eine Wohltätigkeitspredigt zum gleichen Thema halten. Sie wollen mehr Missionare entsenden.“
„Eine Wohltätigkeitspredigt in Chaldicotes!“
„Und warum nicht? Das Haus wird ziemlich voll sein, weißt du, und ich wage zu behaupten, dass die Arabins auch da sein werden.“
„Das glaube ich nicht. Frau Arabin versteht sich vielleicht mit Frau Harold Smith, obwohl ich das bezweifle, aber ich bin mir sicher, dass sie Frau Smiths Bruder nicht mag. Ich glaube nicht, dass sie in Chaldicotes bleiben würde.“
„Und der Bischof wird wahrscheinlich ein oder zwei Tage lang da sein.“
„Das ist viel wahrscheinlicher, Mark. Wenn dich die Freude, Frau Proudie zu treffen, nach Chaldicotes führt, habe ich nichts mehr zu sagen.“
„Ich mag Frau Proudie nicht mehr als du, Fanny“, sagte der Pfarrer mit einer gewissen Verärgerung in der Stimme, denn er fand, dass seine Frau zu streng mit ihm war. „Aber es ist allgemein üblich, dass ein Pfarrer ab und zu seinen Bischof trifft. Und da ich dorthin eingeladen wurde, vor allem um zu predigen, während all diese Leute dort sind, konnte ich nicht wirklich ablehnen.“ Dann stand er auf, nahm seinen Kerzenhalter und flüchtete sich in sein Ankleidezimmer.
„Aber was soll ich Lady Lufton sagen?“, fragte ihn seine Frau im Laufe des Abends.
„Schreib ihr einfach eine Nachricht und sag ihr, dass ich versprochen habe, nächsten Sonntag in Chaldicotes zu predigen. Du kommst doch mit, oder?“
„Ja, aber ich weiß, dass sie verärgert sein wird. Du warst das letzte Mal nicht da, als sie Gäste hatte.“
„Das lässt sich nicht ändern. Sie muss es Sarah Thompson anlasten. Sie sollte nicht erwarten, immer zu gewinnen.“
„Es hätte mir nichts ausgemacht, wenn sie, wie du es nennst, wegen Sarah Thompson verloren hätte. In diesem Fall hättest du dich durchsetzen sollen.“
„Und in diesem anderen Fall werde ich meinen Willen durchsetzen. Es ist schade, dass es solche Unterschiede gibt, nicht wahr?“
Da merkte die Frau, dass es besser wäre, nichts mehr zu sagen, so verärgert sie auch war, und bevor sie zu Bett ging, schrieb sie die Nachricht an Lady Lufton, wie ihr Mann es ihr empfohlen hatte.
Kapitel II. Die Framley-Gruppe und die Chaldicotes-Gruppe
Es wird notwendig sein, dass ich ein Wort oder zwei über einige der Personen verliere, die in den vorangegangenen Seiten genannt wurden, ebenso über die Orte, an denen sie lebten. Über Lady Lufton selbst ist vielleicht bereits genug gesagt worden, um sie meinen Lesern vorzustellen. Das Anwesen von Framley gehörte ihrem Sohn; doch da Lufton Park – ein altes, baufälliges Haus in einer anderen Grafschaft – bisher der Familiensitz der Luftons gewesen war, war Framley Court ihr als Wohnsitz auf Lebenszeit zugewiesen worden. Lord Lufton selbst war noch unverheiratet; und da er in Lufton Park keinen eigenen Haushalt führte – das Haus war in der Tat seit dem Tod seines Großvaters unbewohnt geblieben –, lebte er bei seiner Mutter, wenn es ihm beliebte, sich in jener Gegend aufzuhalten. Die Witwe hätte ihn gern öfter gesehen, als er es ihr gestattete. Er besaß eine Jagdhütte in Schottland, ein Appartement in London und eine Reihe von Pferden in Leicestershire – sehr zum Missfallen des Landadels in seiner Umgebung, der der Meinung war, dass ihre eigene Fuchsjagd ebenso gut sei wie jede andere in ganz England. Seine Lordschaft jedoch zahlte seinen Beitrag an das Jagdrevier von Ost-Barsetshire und hielt sich dann für berechtigt, seinen eigenen Neigungen in Bezug auf seine Vergnügungen zu folgen.
Framley selbst war ein angenehmer Ort auf dem Land, der zwar nichts von herrschaftlicher Würde oder Pracht hatte, aber alles bot, was für ein komfortables Landleben nötig war. Das Haus war ein niedriges, zweistöckiges Gebäude, das zu verschiedenen Zeiten erbaut worden war und keinerlei Anspruch auf einen bestimmten Baustil erhob; aber die Zimmer waren, obwohl nicht hoch, warm und gemütlich, und die Gärten waren gepflegter und ordentlicher als alle anderen in der Grafschaft. Tatsächlich war Framley Court nur wegen seiner Gärten berühmt. Ein Dorf gab es streng genommen nicht. Die Hauptstraße schlängelte sich anderthalb Meilen lang durch die Weiden, Gebüsche und von Wäldern gesäumten Felder von Framley, wobei keine 200 Meter davon in einer geraden Linie verliefen; und es gab eine Querstraße, die durch das Anwesen führte, wodurch es zu einem Ort namens Framley Cross kam. Hier stand das „Lufton Arms”, und hier, in Framley Cross, trafen sich gelegentlich die Jagdhunde, denn die Wälder von Framley wurden trotz der Schulschwänzermanier des jungen Lords bejagt; und ebenfalls in Framley Cross lebte der Schuhmacher, der das Postamt betrieb.
Die Kirche von Framley war nur eine Viertelmeile entfernt und lag direkt gegenüber dem Haupteingang von Framley Court. Es war nur ein armseliges, hässliches Gebäude, das vor etwa hundert Jahren errichtet worden war, als alle Kirchen, die damals gebaut wurden, armselig und hässlich waren; außerdem war es nicht groß genug für die Gemeinde, von der einige Mitglieder deshalb in die dissidenten Kapellen, die Sions und Ebenezers, getrieben wurden, die sich auf beiden Seiten der Gemeinde niedergelassen hatten, wobei Lady Lufton der Meinung war, dass ihr Lieblingspfarrer nicht so energisch war, wie er sein könnte. Daher lag Lady Lufton sehr daran, dass eine neue Kirche gebaut wurde, und sie drängte sowohl ihren Sohn als auch den Pfarrer mit ihrer Beredsamkeit, dieses gute Werk in Angriff zu nehmen.
Hinter der Kirche, aber in ihrer Nähe, standen die Jungenschule und die Mädchenschule, zwei separate Gebäude, deren Errichtung Lady Luftons Tatkraft zu verdanken war; dann kam ein hübscher kleiner Lebensmittelladen, dessen ordentlicher Besitzer der Küster und Gemeindeschreiber war, und dessen ordentliche Frau die Kirchenvorsteherin. Sie hießen Podgens und waren bei Ihrer Ladyschaft sehr beliebt, da sie beide als Bedienstete im Haus gearbeitet hatten. Und hier bog die Straße plötzlich nach links ab und entfernte sich sozusagen von Framley Court; und gleich hinter der Kurve lag das Pfarrhaus, so dass ein kleiner Gartenweg vom hinteren Teil des Pfarrhausgrundstücks zum Friedhof führte und die Podgens in eine isolierte Ecke ihres eigenen Grundstücks abschottete – von wo aus der Pfarrer sie und ihre Kohlköpfe, um ehrlich zu sein, gerne verbannt hätte, hätte er die Macht dazu gehabt. Denn war nicht schon immer der kleine Weinberg Nabots ein Dorn im Auge der benachbarten Machthaber?
Der Machthaber in diesem Fall hatte genauso wenig Entschuldigung wie Ahab, denn nichts am Pfarrhaus hätte perfekter sein können als sein Pfarrhaus. Es hatte alles, was ein Haus für einen bescheidenen Gentleman mit bescheidenen Mitteln brauchte, und nichts von dem teuren Überfluss, den unbesonnene Gentlemen verlangen oder der selbst unbesonnene Mittel erfordert. Und dann passten die Gärten und Koppeln genau dazu, und alles war in gutem Zustand – nicht gerade neu, so dass es noch roh und ungeschützt war und nach Handwerkern roch, sondern genau in dem Stadium seiner Existenz, in dem die Neuheit einer gemütlichen Gemütlichkeit weicht.
Es gab kein anderes Dorf in Framley. Hinter dem Hof, an einer der Kreuzungen, gab es noch ein oder zwei kleine Läden und ein sehr gepflegtes Häuschen, in dem die Witwe eines ehemaligen Vikars wohnte, eine weitere Schützling von Lady Lufton; und es gab ein großes, auffälliges Backsteinhaus, in dem der derzeitige Vikar wohnte; aber dieses war eine ganze Meile von der Kirche entfernt und noch weiter von Framley Court, an der Kreuzung, die von Framley Cross weg in Richtung der Villa führt. Dieser Herr, Reverend Evan Jones, hätte aufgrund seines Alters der Vater des Vikars sein können; aber er war seit vielen Jahren Vikar von Framley gewesen; und obwohl Lady Lufton ihn persönlich nicht mochte, weil er in seinen Prinzipien der Low Church angehörte und unansehnlich war, drängte sie dennoch nicht auf seine Entlassung. Er hatte zwei oder drei Schüler in diesem großen Backsteinhaus, und wenn er diese und sein Vikariat verlieren würde, könnte es für ihn schwierig werden, sich anderswo niederzulassen. Aus diesem Grund wurde Reverend E. Jones Gnade gewährt, und trotz seines roten Gesichts und seiner ungeschickten großen Füße wurde er einmal alle drei Monate mit seiner unscheinbaren Tochter zum Essen nach Framley Court eingeladen.
Abgesehen davon gab es in der Gemeinde Framley außerhalb der Grenzen von Framley Court kaum ein Haus, außer denen der Bauern und Landarbeiter, und doch war die Gemeinde sehr groß.
Framley liegt im östlichen Teil der Grafschaft Barsetshire, die, wie jeder weiß, politisch gesehen eine der konservativsten Grafschaften Englands ist. Sicher, auch hier gab es Rückfälle, aber in welcher Grafschaft gab es die nicht? Wo können wir in diesen unechten Zeiten noch hoffen, die alte landwirtschaftliche Tugend in ihrer ganzen Reinheit zu finden? Aber zu diesen Rückfälligen zählt leider auch Lord Lufton. Nicht, dass er ein gewalttätiger Whig wäre oder überhaupt ein Whig. Aber er verspottet und verhöhnt die alten Gepflogenheiten der Grafschaft; wenn er auf dieses Thema angesprochen wird, erklärt er, dass Herr Bright, was ihn betrifft, gerne für die Grafschaft sitzen kann, wenn er möchte; und er behauptet, dass er als Peers leider kein Recht habe, sich überhaupt für diese Frage zu interessieren. All dies wird zutiefst bedauert, denn früher gab es keinen Teil der Grafschaft, der so eindeutig konservativ war wie der Bezirk Framley, und tatsächlich kann die Witwe bis heute gelegentlich noch mithelfen.
Chaldicotes ist der Landsitz von Nathaniel Sowerby, Esq., der zur gegenwärtig angenommenen Zeit einer der Abgeordneten für die westliche Division von Barsetshire ist. Doch kann diese westliche Division sich keines der edlen politischen Merkmale rühmen, die ihren Zwillingsbruder zieren. Sie ist entschieden whiggistisch gesinnt und wird in politischen Dingen beinahe ausschließlich von ein oder zwei großen Whig-Familien beherrscht. Es wurde bereits erwähnt, dass Mark Robarts im Begriff stand, Chaldicotes einen Besuch abzustatten, und es wurde angedeutet, dass seine Frau darüber nicht allzu erfreut war. Dies entsprach zweifellos der Wahrheit; denn sie, die liebe, kluge, vortreffliche Ehefrau, wusste wohl, dass Herr Sowerby nicht der geeignetste Freund für einen jungen Geistlichen war, und wusste ebenso, dass es im ganzen County nur ein weiteres Haus gab, dessen Name Lady Lufton ebenso zuwider war. Die Gründe hierfür waren, man darf wohl sagen, vielfältig. Zunächst einmal war Herr Sowerby ein Whig und verdankte seinen Parlamentssitz hauptsächlich dem Einfluss jenes großen Whig-Autokraten, des Herzogs von Omnium, dessen Residenz noch gefährlicher war als die von Herr Sowerby und den Lady Lufton als die Verkörperung Luzifers auf Erden betrachtete. Herr Sowerby war zudem unverheiratet – ebenso wie Lord Lufton, was seiner Mutter großen Kummer bereitete. Zwar war Herr Sowerby bereits fünfzig Jahre alt, während der junge Lord erst sechsundzwanzig zählte, doch gleichwohl begann Ihre Ladyschaft, sich Sorgen zu machen. In ihren Augen war jeder Mann verpflichtet zu heiraten, sobald er imstande war, eine Frau zu unterhalten; und sie hegte die Vorstellung – ein ganz privates Glaubensbekenntnis, dessen sie sich selbst kaum bewusst war –, dass Männer im Allgemeinen dazu neigten, diese Pflicht aus eigennützigen Vergnügungen zu vernachlässigen, dass die Bösen die Unschuldigen in dieser Nachlässigkeit bestärkten und dass viele überhaupt nicht heiraten würden, gäbe es nicht einen unsichtbaren Zwang, der von Seiten des anderen Geschlechts auf sie ausgeübt wurde. Der Herzog von Omnium war das Haupt all dieser Sünder, und Lady Lufton fürchtete sehr, ihr Sohn könne durch Herr Sowerby und Chaldicotes dem verderblichen Einfluss des Omnium verfallen. Und dann war Herr Sowerby allgemein als ein sehr armer Mann mit einem sehr großen Besitz bekannt. Man sagte, er habe viel für Wahlkämpfe verschwendet und noch mehr beim Glücksspiel verloren. Ein beträchtlicher Teil seines Eigentums war bereits in die Hände des Herzogs übergegangen, der es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, alles in seiner Umgebung aufzukaufen, was zum Verkauf stand. Ja, seine Feinde behaupteten gar, er sei so gierig nach Grundbesitz in Barsetshire, dass er einen jungen Nachbarn ins Verderben treiben würde, nur um dessen Land zu erwerben. Was – oh, was, wenn er auf diese Weise in den Besitz auch nur eines Teils der schönen Ländereien von Framley Court gelangen sollte? Was, wenn er sie alle an sich brächte? Es ist kaum verwunderlich, dass Lady Lufton Chaldicotes nicht mochte.
Die Chaldicotes, wie Lady Lufton sie nannte, waren in jeder Hinsicht das Gegenteil von dem, was eine Gruppe ihrer Meinung nach sein sollte. Sie mochte fröhliche, ruhige, wohlhabende Leute, die ihre Kirche, ihr Land und ihre Königin liebten und nicht zu sehr darauf aus waren, in der Welt von sich reden zu machen. Sie wünschte sich, dass alle Bauern in ihrer Umgebung ihre Pacht ohne Probleme bezahlen konnten, dass alle alten Frauen warme Flanellunterröcke hatten, dass die Arbeiter durch gesunde Ernährung und trockene Häuser vor Rheuma verschont blieben und dass sie alle ihren Pastoren und Herren – sowohl den weltlichen als auch den geistlichen – gehorsam waren. Das war ihre Vorstellung von Liebe zu ihrem Land. Sie wollte auch, dass die Wälder voller Fasane, die Stoppelfelder voller Rebhühner und die Ginsterbüsche voller Füchse waren; auch auf diese Weise liebte sie ihr Land. Während des Krimkrieges hatte sie sich sehnlichst gewünscht, dass die Russen besiegt würden – aber nicht von den Franzosen unter Ausschluss der Engländer, wie es ihr zu sehr der Fall zu sein schien, und schon gar nicht von den Engländern unter der Diktatur von Lord Palmerston. Tatsächlich hatte sie nur wenig Vertrauen in diesen Krieg, nachdem Lord Aberdeen abgesetzt worden war. Wenn nur Lord Derby hätte kommen können! Aber nun zu dieser Chaldicotes-Clique. Letztendlich waren sie nicht besonders gefährlich, denn Herr Sowerby ging seinen unverheirateten Ausschweifungen, wenn überhaupt, in London nach und nicht auf dem Land. Wenn man von ihnen als Gruppe spricht, war der Hauptschuldige Herr Harold Smith oder vielleicht seine Frau. Er war auch Mitglied des Parlaments und, wie viele dachten, ein aufstrebender Mann. Sein Vater war viele Jahre lang Debattierer im Unterhaus gewesen und hatte ein hohes Amt inne. Harold hatte sich in jungen Jahren für das Kabinett vorgesehen, und wenn harte Arbeit in seinem Beruf den Erfolg garantieren konnte, sollte er ihn früher oder später erreichen. Er hatte schon mehr als eine untergeordnete Position inne gehabt, war im Finanzministerium und ein oder zwei Monate lang im Marineministerium tätig gewesen und hatte die Beamtenwelt mit seinem Fleiß beeindruckt. Die letzten paar Monate hatte er unter Lord Aberdeen gearbeitet, mit dem er sich zurückziehen musste. Er war ein jüngerer Sohn und hatte kein großes Vermögen. Die Politik als Beruf war daher für ihn von großer Bedeutung. In jungen Jahren hatte er eine Schwester von Herr Sowerby geheiratet; da die Dame etwa sechs oder sieben Jahre älter war als er und nur eine magere Mitgift mitbrachte, meinten die Leute, Herr Harold Smith habe in dieser Angelegenheit nicht besonders klug gehandelt. Herr Harold Smith war persönlich bei keiner Partei besonders beliebt, obwohl einige ihn für äußerst nützlich hielten. Er war fleißig, gut informiert und insgesamt ehrlich, aber er war auch eingebildet, langatmig und pompös.
Frau Harold Smith war das genaue Gegenteil ihres Mannes. Sie war eine kluge, aufgeweckte Frau, für ihr Alter – sie war jetzt über vierzig – gut aussehend, mit einem ausgeprägten Sinn für den Wert aller weltlichen Dinge und einer ausgeprägten Vorliebe für alle Freuden der Welt. Sie war weder fleißig noch gut informiert, vielleicht auch nicht ganz ehrlich – welche Frau hat jemals die Notwendigkeit oder den Vorteil politischer Ehrlichkeit verstanden? –, aber sie war weder langweilig noch hochnäsig, und wenn sie eingebildet war, zeigte sie es zumindest nicht. Sie war eine enttäuschte Frau, was ihren Mann betraf, denn sie hatte ihn in der Hoffnung geheiratet, dass er sofort politisch wichtig werden würde, und bis jetzt hatte Herr Smith die Prophezeiungen seiner frühen Jahre noch nicht ganz erfüllt.
Und wenn Lady Lufton von den Chaldicotes sprach, schloss sie in ihren Gedanken eindeutig den Bischof von Barchester, seine Frau und seine Tochter mit ein. Da Bischof Proudie natürlich ein Mann war, der sich sehr der Religion und religiösem Denken verschrieben hatte, und Herr Sowerby selbst keinerlei besondere religiöse Gefühle hegte, schien es auf den ersten Blick keinen Grund für viel Umgang zu geben, und vielleicht gab es auch nicht viel davon; aber Frau Proudie und Frau Harold Smith waren seit vier oder fünf Jahren – seitdem die Proudies in die Diözese gekommen waren – enge Freundinnen, und deshalb wurde der Bischof normalerweise nach Chaldicotes mitgenommen, wenn Frau Smith ihren Bruder besuchte. Nun war Bischof Proudie keineswegs ein Würdenträger der Hochkirche, und Lady Lufton hatte ihm nie verziehen, dass er in diese Diözese gekommen war. Sie hatte instinktiv große Achtung vor dem Bischofsamt, aber von Bischof Proudie selbst hielt sie kaum mehr als von Herrn Sowerby oder von jenem Übeltäter, dem Herzog von Omnium. Immer wenn Herr Robarts argumentierte, dass es von Vorteil sei, den Bischof zu treffen, wenn man irgendwohin reise, verzog Lady Lufton leicht die Oberlippe. Sie konnte nicht in Worte fassen, dass Bischof Proudie – denn man musste ihn zweifellos als Bischof bezeichnen – nicht besser war, als er sein sollte, aber durch dieses Verziehen ihrer Lippen machte sie denjenigen, die sie kannten, deutlich, dass dies ihr innerstes Gefühl war.
Und dann wurde bekannt – zumindest hatte Mark Robarts davon gehört, und die Information erreichte bald Framley Court –, dass Herr Supplehouse Teil der Chaldicotes-Gruppe werden sollte. Nun war Herr Supplehouse für einen jungen, hochkirchlichen, konservativen Landpfarrer mit Gentleman-Manieren ein noch schlechterer Begleiter als Harold Smith. Er war auch im Parlament und wurde in den ersten Tagen des Russischen Krieges von einem Teil der großstädtischen Tagespresse als der einzige Mann gepriesen, der das Land retten könne. Lasst ihn in das Ministerium, hatte der Jupiter gesagt, dann gäbe es noch Hoffnung auf Reformen, noch eine Chance, dass Englands alter Ruhm in diesen gefährlichen Zeiten nicht völlig in Vergessenheit geraten würde. Und so holte das Ministerium, das von Herrn Supplehouse nicht viel Rettung erwartete, aber wie üblich bereit war, sich den Jupiter hinter sich zu stellen, diesen Gentleman zu sich und gab ihm einen Platz unter ihnen. Aber wie kann ein Mann, der geboren wurde, um eine Nation zu retten und ein Volk zu führen, sich damit zufrieden geben, den Stuhl eines Unterstaatssekretärs zu besetzen? Supplehouse war nicht zufrieden und machte bald klar, dass sein Platz viel höher war als jeder, der ihm bisher angeboten worden war. Die Siegel hoher Ämter oder Krieg bis aufs Messer waren die Alternative, die er einem stark beanspruchten Chef der Angelegenheiten anbot – ohne zu bezweifeln, dass der Chef der Angelegenheiten den Wert des Anspruchstellers erkennen und eine gesunde Furcht vor dem Jupiter vor Augen haben würde. Aber der stark beanspruchte Leiter der Angelegenheiten wusste, dass er selbst für Herr Supplehouse und den Jupiter einen zu hohen Preis zahlen könnte, und dem Retter der Nation wurde gesagt, er könne seinen Tomahawk schwingen. Seitdem schwang er seinen Tomahawk, aber nicht mit der erwarteten Wirkung. Er war auch sehr eng mit Herr Sowerby befreundet und gehörte eindeutig zum Kreis der Chaldicotes. Und es gab noch viele andere, die mit diesem Stigma behaftet waren, deren Sünden eher politischer oder religiöser als moralischer Natur waren. Aber sie waren Lady Lufton ein Dorn im Auge, die sie als Kinder des Verlorenen betrachtete und die mit mütterlicher Trauer litt, als sie erfuhr, dass ihr Sohn zu ihnen gehörte, und die den ganzen Zorn einer Gönnerin empfand, als sie hörte, dass ihr geistlicher Schützling sich dieser Gesellschaft anschließen wollte. Frau Robarts konnte wohl sagen, dass Lady Lufton verärgert sein würde.
„Du wirst doch nicht vor deiner Abreise bei uns vorbeikommen, oder?”, fragte seine Frau am nächsten Morgen. Er wollte an diesem Tag nach dem Mittagessen losfahren und mit seinem eigenen Wagen selbst fahren, um vor dem Abendessen das etwa vierundzwanzig Meilen entfernte Chaldicotes zu erreichen.
„Nein, ich glaube nicht. Was hätte ich dort zu suchen?“
„Nun, ich kann es nicht erklären, aber ich denke, ich sollte vorbeikommen: vielleicht etwas frech, um ihr zu zeigen, dass ich, da ich mich entschlossen hatte zu gehen, keine Angst hatte, ihr das zu sagen.“
„Angst! Das ist Unsinn, Fanny. Ich habe keine Angst vor ihr. Aber ich sehe keinen Grund, warum ich mir ihre unangenehmen Bemerkungen antun sollte. Außerdem habe ich keine Zeit. Ich muss zu Jones gehen, um die Aufgaben zu besprechen, und dann habe ich mit den Vorbereitungen genug zu tun, um rechtzeitig loszukommen.“
Er besuchte Herr Jones, den Vikar, ohne Gewissensbisse, da er eher damit prahlte, all die Parlamentsmitglieder zu treffen, die dort sein würden, und den Bischof, der auch dabei sein würde. Herr Evan Jones war nur sein Vikar, und als er mit ihm darüber sprach, konnte er so tun, als sei es für einen Pfarrer ganz normal, seinen Bischof im Haus eines Abgeordneten des Landkreises zu treffen. Und man könnte geneigt sein zu sagen, dass es angemessen war: Nur warum konnte er nicht in demselben Ton mit Lady Lufton darüber sprechen? Und dann, nachdem er seine Frau und seine Kinder geküsst hatte, fuhr er los, zufrieden mit seinen Aussichten für die kommenden zehn Tage, aber bereits in Erwartung einiger Unannehmlichkeiten bei seiner Rückkehr.
In den folgenden drei Tagen traf Frau Robarts Ihre Ladyschaft nicht. Sie unternahm zwar keine besonderen Schritte, um eine solche Begegnung zu vermeiden, aber sie ging auch nicht absichtlich zu dem großen Haus hinauf. Sie ging wie üblich zu ihrer Schule und machte ein oder zwei Besuche bei den Bäuerinnen, betrat aber nicht das Gelände von Framley Court. Sie war mutiger als ihr Mann, aber selbst sie wollte den unheilvollen Tag nicht vorwegnehmen. Am Samstag, kurz bevor es dämmerte, als sie gerade daran dachte, sich auf den fatalen Sprung vorzubereiten, kam ihre Freundin Lady Meredith zu ihr.
„Also, Fanny, wir haben wieder das Pech, Herr Robarts zu verpassen“, sagte Ihre Ladyschaft.
„Ja. Hast du jemals etwas so Unglückliches erlebt? Aber er hatte Herr Sowerby versprochen, bevor er hörte, dass du kommst. Bitte glaube nicht, dass er gegangen wäre, wenn er davon gewusst hätte.“
„Es hätte uns leidgetan, ihn von einer so viel unterhaltsameren Gesellschaft fernzuhalten.“
„Jetzt bist du unfair, Justinia. Du willst damit sagen, dass er nach Chaldicotes gefahren ist, weil es ihm dort besser gefällt als in Framley Court, aber das ist nicht der Fall. Ich hoffe, Lady Lufton denkt das nicht.“
Lady Meredith lachte und legte ihren Arm um die Taille ihrer Freundin. „Verlier nicht deine Eloquenz, wenn du ihn mir gegenüber verteidigst“, sagte sie. „Du wirst sie für meine Mutter brauchen.“
„Aber ist deine Mutter wütend?“, fragte Frau Robarts und zeigte mit ihrem Gesichtsausdruck, wie sehr sie auf echte Neuigkeiten zu diesem Thema gespannt war.
„Nun, Fanny, du kennst Ihre Ladyschaft genauso gut wie ich. Sie schätzt den Pfarrer von Framley so sehr, dass sie ihn den Politikern in Chaldicotes nur ungern überlässt.“
„Aber Justinia, der Bischof wird auch da sein, wie du weißt.“
„Ich glaube nicht, dass diese Überlegung meine Mutter mit der Abwesenheit des Herrn versöhnen wird. Er sollte sehr stolz sein, dass man so viel von ihm hält, das weiß ich. Aber komm, Fanny, ich möchte, dass du mit mir zurückgehst, dann kannst du dich zu Hause umziehen. Und jetzt gehen wir zu den Kindern.“
Als sie dann zusammen nach Framley Court gingen, ließ Frau Robarts ihre Freundin versprechen, dass sie ihr beistehen würde, falls der abwesende Geistliche ernsthaft angegriffen werden sollte.
„Gehst du gleich auf dein Zimmer?“, fragte die Frau des Pfarrers, sobald sie die Veranda betreten hatten, die zum Flur führte. Lady Meredith wusste sofort, was ihre Freundin meinte, und beschloss, dass der schlimme Tag nicht hinausgezögert werden sollte. „Wir sollten besser reingehen und es hinter uns bringen“, sagte sie, „dann können wir den Abend in Ruhe genießen.“ Also wurde die Tür zum Wohnzimmer geöffnet, und dort saß Lady Lufton allein auf dem Sofa.
„Also, Mama“, sagte die Tochter, „du darfst Fanny wegen Herr Robarts nicht zu sehr schimpfen. Er ist gegangen, um vor dem Bischof eine Wohltätigkeitspredigt zu halten, und unter diesen Umständen konnte er vielleicht nicht ablehnen.“ Das war eine Übertreibung von Lady Meredith – zweifellos mit viel Gutmütigkeit vorgetragen, aber dennoch eine Übertreibung, denn niemand hatte damit gerechnet, dass der Bischof am Sonntag in Chaldicotes bleiben würde.
„Wie geht es dir, Fanny?“, sagte Lady Lufton und stand auf. „Ich werde sie nicht schimpfen, und ich weiß nicht, wie du solchen Unsinn reden kannst, Justinia. Natürlich bedauern wir sehr, dass Herr Robarts nicht da ist, zumal er auch letzten Sonntag nicht da war, als Herr George bei uns war. Ich mag es wirklich, Herr Robarts in seiner eigenen Kirche zu sehen, und ich mag keinen anderen Geistlichen dort so sehr. Wenn Fanny das als Schelte auffasst, warum ...“
„Oh nein, Lady Lufton, und es ist so nett von dir, das zu sagen. Aber Herr Robarts tat es so leid, dass er diese Einladung nach Chaldicotes angenommen hatte, bevor er hörte, dass Herr George kommen würde, und ...“
„Oh, ich weiß, dass Chaldicotes tolle Sachen zu bieten hat, die wir nicht bieten können“, sagte Lady Lufton.
„Das war es wirklich nicht. Aber er wurde gebeten, zu predigen, wissen Sie, und Herr Harold Smith ...“ Die arme Fanny machte es nur noch schlimmer. Wäre sie weltklug gewesen, hätte sie das kleine Kompliment, das in Lady Luftons erster Zurechtweisung enthalten war, angenommen und dann geschwiegen.
„Oh ja, die Harold Smiths! Sie sind unwiderstehlich, das weiß ich. Wie könnte ein Mann es ablehnen, an einer Feier teilzunehmen, die sowohl von Frau Harold Smith als auch von Frau Proudie bereichert wird – selbst wenn seine Pflicht ihn dazu zwingen würde, fernzubleiben?“
„Aber Mama ...“, sagte Justinia.
„Nun, meine Liebe, was soll ich denn sagen? Du würdest doch nicht wollen, dass ich lüge. Ich mag Frau Harold Smith nicht – zumindest nicht nach dem, was ich über sie gehört habe, denn ich hatte seit ihrer Heirat noch nicht das Glück, sie kennenzulernen. Es mag eingebildet klingen, aber um ehrlich zu sein, denke ich, dass Herr Robarts bei uns in Framley besser aufgehoben wäre als bei den Harold Smiths in Chaldicotes – selbst wenn Frau Proudie mit im Paket enthalten wäre.“
Es war fast dunkel, daher konnte man die Röte im Gesicht von Frau Robarts nicht sehen. Sie war jedoch eine zu gute Ehefrau, um solche Äußerungen ohne einen Anflug von Ärger in ihrem Herzen hinzunehmen. Sie konnte ihren Mann in ihrem Inneren tadeln, aber es war für sie unerträglich, dass andere ihn in ihrem Beisein kritisierten.
„Er wäre zweifellos besser dran“, sagte sie, „aber Lady Lufton, man kann nicht immer genau dorthin gehen, wo man am besten dran ist. Gentlemen müssen manchmal ...“
„Nun gut, meine Liebe, das reicht. Er hat dich jedenfalls nicht mitgenommen, und deshalb werden wir ihm vergeben.“ Und Lady Lufton küsste sie. „So wie es ist“, und sie flüsterte den beiden jungen Frauen leise zu, „so wie es ist, müssen wir uns sogar mit dem armen alten Evan Jones abfinden. Er wird heute Abend hier sein, und wir müssen uns fertig machen, um ihn zu empfangen.“
Und so gingen sie. Lady Lufton war im Grunde ihres Herzens gut genug, um Frau Robarts umso mehr zu mögen, weil sie sich für ihren abwesenden Gatten eingesetzt hatte.
Kapitel III. Chaldicotes
Chaldicotes ist ein viel prächtigeres Haus als Framley Court. Wenn man sich die alten Spuren ansieht und nicht die heutigen, ist es sogar ein echt beeindruckender Ort. Es gibt einen alten Wald, der nicht ganz zum Anwesen gehört, aber daran angrenzt und Chace of Chaldicotes heißt. Ein Teil dieses Waldes liegt direkt hinter dem Herrenhaus und verleiht dem Ort Charakter und Berühmtheit. Der Chace of Chaldicotes – zumindest der größte Teil davon – ist, wie jeder weiß, Eigentum der Krone und soll jetzt, in diesen utilitaristischen Zeiten, abgeholzt werden. Früher war es ein großer Wald, der sich über die Hälfte des Landes erstreckte, fast bis nach Silverbridge, und hier und da sind noch immer Teile davon zu sehen, aber der größte verbleibende Teil, bestehend aus jahrhundertealten, hohlen Eichen und weitläufigen, verdorrten Buchen, steht in den beiden Gemeinden Chaldicotes und Uffley. Die Leute kommen immer noch von weit her, um die Eichen von Chaldicotes zu sehen und das Rascheln ihrer Füße in den dicken Herbstblättern zu hören. Aber bald werden sie nicht mehr kommen. Die Giganten vergangener Zeiten müssen Weizen und Rüben weichen; ein rücksichtsloser Finanzminister, der alte Traditionen und die Schönheit des Landes ignoriert, verlangt Geld aus dem Land, und der Chace of Chaldicotes wird von der Erdoberfläche verschwinden.
Ein Teil davon ist jedoch Privatbesitz von Herrn Sowerby, dem es trotz all seiner finanziellen Schwierigkeiten bisher gelungen ist, diesen Teil seines väterlichen Erbes vor der Axt und der Versteigerung zu bewahren. Das Haus von Chaldicotes ist ein großes Steingebäude, wahrscheinlich aus der Zeit Karls II. Es ist an beiden Fronten über eine schwere doppelte Steintreppe zu erreichen. Vor dem Haus führt eine lange, feierliche, gerade Allee durch eine doppelte Reihe von Linden zu den Toren der Lodge, die im Zentrum des Dorfes Chaldicotes stehen; aber auf der Rückseite öffnen sich die Fenster zu vier verschiedenen Ausblicken, die durch den Wald führen: vier offene grüne Wege, die alle an einem großen Eisentor zusammenlaufen, der Barriere, die das Privatgelände vom Chace trennt. Die Sowerbys sind seit vielen Generationen Förster des Chaldicotes-Jagdgebiets und haben somit fast ebenso viel Autorität über den Kronwald wie über ihren eigenen. Aber jetzt soll all dies ein Ende haben, denn der Wald wird abgeholzt werden.
Es war fast dunkel, als Mark Robarts die Lindenallee entlang zur Haustür fuhr, aber man konnte leicht erkennen, dass das Haus, das neun Monate im Jahr tot und still wie ein Grab war, jetzt in allen seinen Teilen lebendig war. In vielen Fenstern brannten Lichter, aus den Ställen drangen Stimmen, Bedienstete gingen geschäftig hin und her, Hunde bellten, und der dunkle Kies vor der Eingangstreppe war von vielen Kutschenrädern zerfurcht.
„Oh, sind Sie das Herr Robarts?“, sagte ein Stallbursche, der das Pferd des Pfarrers am Kopf packte und seinen Hut berührte. „Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Euer Ehren?“
„Sehr gut, Bob, danke. Alles in Ordnung in Chaldicotes?“
„Alles bestens, Herr Robarts. Hier ist gerade viel los, mein Herr. Der Bischof und seine Frau sind heute Morgen angekommen.“
„Oh – ah – ja! Ich hab gehört, dass sie hier sein sollten. Sind auch junge Damen dabei?“
„Eine junge Dame. Fräulein Olivia, so nennen sie sie, Euer Hochwürden.“
„Und wie geht es Herr Sowerby?“
„Sehr gut, Eure Eminenz. Er, Herr Harold Smith und Herr Fothergill – das ist der Geschäftsmann des Herzogs, wie Sie wissen – steigen gerade dort im Stallhof von ihren Pferden ab.“
„Zurück von der Jagd, Bob?“
„Ja, mein Herr, gerade zurückgekommen, in dieser Minute.“ Und dann ging Herr Robarts ins Haus, sein Reisekoffer folgte ihm auf der Schulter eines Dieners.
Man sieht also, dass unser junger Pfarrer in Chaldicotes sehr gut bekannt war, so sehr, dass der Stallbursche ihn kannte und mit ihm über die Leute im Haus plauderte. Ja, er war dort gut bekannt, viel besser, als er den Leuten in Framley zu verstehen gegeben hatte. Nicht, dass er jemanden absichtlich und offen getäuscht hätte, nicht, dass er jemals etwas Falsches über Chaldicotes gesagt hätte. Aber er hatte zu Hause nie damit geprahlt, dass er und Sowerby enge Verbündete waren. Er hatte ihnen auch nicht erzählt, wie oft Herr Sowerby und Lord Lufton sich in London trafen. Warum sollte man Frauen mit solchen Dingen belästigen? Warum sollte man eine so hervorragende Frau wie Lady Lufton verärgern? Außerdem war Herr Sowerby jemand, dessen Freundschaft nur wenige junge Männer ablehnen wollten. Er war fünfzig und hatte vielleicht nicht das gesündeste Leben geführt, aber er kleidete sich jugendlich und sah normalerweise gut aus. Er hatte eine Glatze, eine schöne Stirn und funkelnde, feuchte Augen. Er war ein kluger Mann, ein angenehmer Begleiter und immer gut gelaunt, wenn es ihm passte. Er war auch ein Gentleman von hoher Bildung und guter Herkunft, dessen Vorfahren in dieser Grafschaft bekannt waren – länger, wie die Bauern in der Umgebung prahlten, als die aller anderen Landbesitzer dort, außer vielleicht den Thornes von Ullathorne oder den Greshams von Greshamsbury – viel länger als die de Courcys von Courcy Castle. Der Herzog von Omnium hingegen war, vergleichsweise gesehen, ein Neuling. Außerdem war er Mitglied des Parlaments, befreundet mit einigen einflussreichen Leuten und anderen, die es werden könnten; ein Mann, der über die Welt reden konnte, als würde er sich wirklich auskennen. Und außerdem, wie auch immer sein Lebensstil sonst sein mochte, in Gegenwart eines Geistlichen verhielt er sich selten so, dass er den Geschmack der Geistlichen verletzte. Er fluchte nicht, sprach nicht über seine Laster und verspottete nicht den Glauben der Kirche. Auch wenn er selbst kein Kirchenmann war, wusste er zumindest, wie man mit denen zusammenlebt, die es waren.
Wie war es möglich, dass jemand wie unser Pfarrer die Vertrautheit mit Herr Sowerby nicht schätzte? Es mag ja sein, sagte er sich, dass eine Frau wie Lady Lufton die Nase über ihn rümpfte – Lady Lufton, die zehn Monate im Jahr in Framley Court verbrachte und während dieser zehn Monate, und übrigens auch während der zwei Monate, die sie in London verbrachte, niemanden außerhalb ihres eigenen Kreises sah. Frauen würden solche Dinge nicht verstehen, sagte sich der Pfarrer; selbst seine eigene Frau – so gut, nett, vernünftig und intelligent sie auch war – selbst sie würde nicht verstehen, dass ein Mann in der Welt alle möglichen Menschen treffen müsse und dass es heutzutage für einen Geistlichen nicht angebracht sei, ein Einsiedler zu sein. So argumentierte Mark Robarts, als er sich vor seinem eigenen Gewissen dafür rechtfertigen musste, dass er nach Chaldicotes gefahren war und seine Freundschaft mit Herr Sowerby vertieft hatte. Er wusste, dass Herr Sowerby ein gefährlicher Mann war; er wusste, dass er bis über beide Ohren verschuldet war und dass er den jungen Lord Lufton bereits in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hatte; sein Gewissen sagte ihm, dass es für ihn als Soldat Christi gut wäre, sich nach anderen Freunden umzusehen. Trotzdem ging er nach Chaldicotes, zwar nicht zufrieden mit sich selbst, aber sich selbst viele Argumente wiederholend, warum er zufrieden sein sollte.
Er wurde sogleich in das Empfangszimmer geführt, wo er Frau Harold Smith, Frau und Fräulein Proudie sowie eine Dame vorfand, die er noch nie zuvor gesehen hatte und deren Name ihm zunächst nicht genannt wurde.
„Ist das Herr Robarts?“ sagte Frau Harold Smith, erhob sich, um ihn zu begrüßen, und verbarg ihre gespielte Unkenntnis unter dem Schleier der Dunkelheit. „Und Sie sind wirklich vierundzwanzig Meilen über die Straßen von Barsetshire gefahren an einem Tag wie diesem, nur um uns bei unseren kleinen Schwierigkeiten beizustehen? Nun, Dankbarkeit können wir Ihnen jedenfalls versprechen.“
Dann reichte der Pfarrer Frau Proudie die Hand, in jener ehrerbietigen Weise, wie sie einem Vikar gegenüber der Gattin seines Bischofs gebührt; und Frau Proudie erwiderte den Gruß mit all der lächelnden Herablassung, die eine Bischofsgattin einem Vikar gegenüber an den Tag legen sollte. Fräulein Proudie war nicht ganz so höflich. Wäre Herr Robarts noch unverheiratet gewesen, hätte auch sie süß lächeln können; doch sie hatte ihre Lächeln zu lange an Geistliche verschwendet, um sie nun an einen verheirateten Landpfarrer zu verschwenden.
„Und in welchen Schwierigkeiten, Frau Smith, kann ich Ihnen helfen?“
„Wir haben hier sechs oder sieben Herren, Herr Robarts, und die gehen immer vor dem Frühstück auf die Jagd und kommen nie zurück – ich wollte sagen – bis nach dem Abendessen. Ich wünschte, es wäre so, denn dann müssten wir nicht auf sie warten.“
„Außer Herr Supplehouse, wissen Sie“, sagte die unbekannte Dame mit lauter Stimme.
„Und der ist meistens in der Bibliothek und schreibt Artikel.“
„Er wäre besser beschäftigt, wenn er versuchen würde, sich wie die anderen den Hals zu brechen“, sagte die unbekannte Dame.
„Nur würde ihm das nie gelingen“, sagt Frau Harold Smith. „Aber vielleicht, Herr Robarts, sind Sie genauso schlimm wie die anderen; vielleicht gehen auch Sie morgen auf die Jagd.“
„Meine liebe Frau Smith!“, sagte Frau Proudie in einem Ton, der leichten Vorwurf und gemildertes Entsetzen ausdrückte.
„Oh! Das habe ich vergessen. Nein, natürlich werden Sie nicht auf die Jagd gehen, Herr Robarts; Sie werden sich nur wünschen, Sie könnten es.“
„Warum kann er das nicht?“, sagte die Dame mit lauter Stimme.
„Meine liebe Fräulein Dunstable! Ein Geistlicher auf der Jagd, während er im selben Haus wie der Bischof wohnt? Denken Sie an die Anstandsregeln!“
„Oh – ah! Dem Bischof würde das nicht gefallen – oder? Sagen Sie mir doch mal, mein Herr , was würde der Bischof mit Ihnen machen, wenn Sie doch auf die Jagd gehen würden?“
„Das würde von seiner momentanen Laune abhängen, meine Dame“, sagte Herr Robarts. „Wenn er sehr streng wäre, würde er mich vielleicht vor den Toren des Palastes enthaupten lassen.“
Frau Proudie richtete sich in ihrem Stuhl auf, was deutlich machte, dass ihr der Ton des Gesprächs missfiel; und Fräulein Proudie heftete ihren Blick mit Nachdruck auf ihr Buch, was erkennen ließ, dass sowohl Fräulein Dunstable als auch deren Gespräch ihrer Beachtung nicht würdig waren.
„Wenn diese Herren heute Abend nicht vorhaben, sich das Genick zu brechen“, sagte Frau Harold Smith, „würde ich mir wünschen, dass sie uns das mitteilen. Es ist bereits halb sieben.“ Daraufhin gab Herr Robarts ihnen zu verstehen, dass an diesem Tag keine solche Katastrophe zu erwarten sei, da Herr Sowerby und die anderen Jäger sich im Stallhof befanden, als er die Tür öffnete.
„Dann, meine Damen, können wir uns genauso gut ankleiden“, sagte Frau Harold Smith. Doch als sie zur Tür ging, öffnete sich diese, und ein kleiner Herr betrat mit langsamen, leisen Schritten den Raum; Herr Robarts konnte ihn jedoch in der Dämmerung noch nicht erkennen. „Oh! Bischof, sind Sie das?“, sagte Frau Smith. „Hier ist einer der Koryphäen Ihrer Diözese.“ Und dann tastete sich der Bischof durch die Dunkelheit zum Pfarrer vor und schüttelte ihm herzlich die Hand. „Er habe sich sehr gefreut, Herrn Robarts in Chaldicotes zu treffen“, sagte er, „wirklich sehr gefreut. Würde er nicht nächsten Sonntag für die Papua-Mission predigen? Ah, das habe er, der Bischof, gehört. Das sei eine gute Sache, eine ausgezeichnete Sache.“ Und dann drückte Dr. Proudie sein Bedauern darüber aus, dass er nicht in Chaldicotes bleiben und die Predigt hören könne. Es war offensichtlich, dass sein Bischof ihm seine Vertrautheit mit Herr Sowerby nicht übel nahm. Aber dann spürte er in seinem Herzen, dass ihm die Meinung seines Bischofs nicht besonders wichtig war.
„Ah, Robarts, ich freue mich, dich zu sehen“, sagte Herr Sowerby, als sie sich vor dem Abendessen auf dem Teppich im Wohnzimmer trafen. „Kennst du Harold Smith? Ja, natürlich kennst du ihn. Nun, wer ist noch da? Oh! Supplehouse. Herr Supplehouse, ich möchte dir meinen Freund Herr Robarts vorstellen. Er ist es, der dir nächsten Sonntag den Fünf-Pfund-Schein aus der Tasche ziehen wird, für diese armen Papua, die wir christianisieren wollen. Das heißt, wenn Harold Smith diese Arbeit nicht schon bei seinem Vortrag am Samstag erledigt. Und, Robarts, du hast natürlich den Bischof gesehen“, sagte er flüsternd. „Es ist toll, Bischof zu sein, nicht wahr? Ich wünschte, ich hätte nur halb so viel Glück wie du. Aber, mein Lieber, ich habe einen großen Fehler gemacht: Ich habe keinen unverheirateten Pfarrer für Fräulein Proudie. Du musst mir helfen und sie zum Abendessen mitnehmen.“ Dann ertönte der große Gong, und sie gingen paarweise davon.
Beim Abendessen saß Mark zwischen Fräulein Proudie und der Dame, die er als Fräulein Dunstable kennengelernt hatte. Die erste mochte er nicht besonders und war trotz der Bitte seines Gastgebers nicht geneigt, ihr gegenüber den Junggesellenpfarrer zu spielen. Mit der anderen Dame hätte er sich gerne während des Abendessens unterhalten, nur dass alle anderen am Tisch offenbar dasselbe vorhatten. Sie war weder jung noch schön noch besonders damenhaft, aber sie schien eine Beliebtheit zu genießen, die Herr Supplehouse neidisch gemacht haben muss und die Frau Proudie sicher nicht ganz gefiel – die sie aber genauso feierte wie die anderen. So konnte unser Pfarrer nur einen kleinen Teil der Aufmerksamkeit der Dame auf sich ziehen.
„Bischof“, sagte sie über den Tisch hinweg, „wir haben Sie den ganzen Tag so vermisst! Wir hatten niemanden, mit dem wir ein Wort wechseln konnten.“