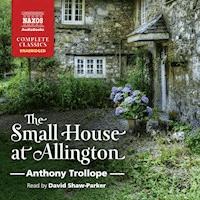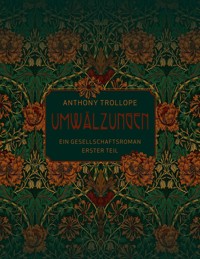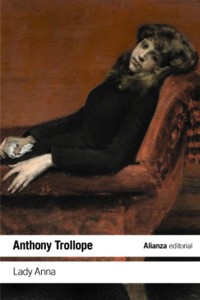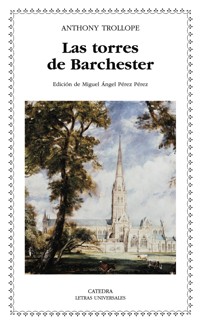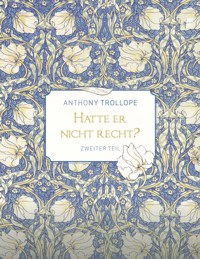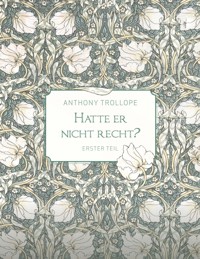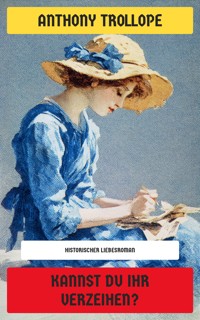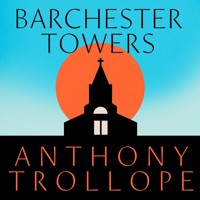1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der meisterhaften Erzählung 'Die letzte Chronik von Barset' entfaltet Anthony Trollope ein komplexes Geflecht aus sozialen und moralischen Konflikten im viktorianischen England. Der Roman, letzter Teil der Barsetshire-Serie, konzentriert sich auf das Schicksal des Pfarrers Josiah Crawley, der fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt wird. Mit scharfsinniger Beobachtungsgabe schildert Trollope das Ringen der Figuren mit gesellschaftlichem Druck und persönlichem Anstand, während sie innerhalb des streng hierarchischen Systems navigieren. Der Roman überzeugt durch seinen genau beobachteten Realismus und seine dichte psychologische Darstellung. Anthony Trollope, einer der bedeutendsten Erzähler der viktorianischen Epoche, hatte ein besonderes Talent dafür, die Spannungen und Zwiespalte des Alltagslebens offenzulegen. Seine Arbeit als Postbeamter führte ihn in viele Winkel Englands und inspirierte seine detaillierten Beschreibungen provinzieller Gesellschaften. Trollopes Fähigkeit, soziale Sitten und Zwänge mit einem Hauch von Ironie und Mitgefühl zu schildern, spiegelt sich in 'Die letzte Chronik von Barset' wider. Sein Verständnis für die Schwächen, aber auch für die Tugenden seiner Figuren, zeugt von seiner tiefen Einsicht in menschliche Verhaltensweisen. Dieses Buch ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der an gesellschaftlichem Realismus und an den Feinheiten des viktorianischen Romans interessiert ist. Trollopes erzählerische Kunst zieht den Leser in die vielschichtige Welt von Barsetshire hinein und eröffnet ihm einen Blick auf die moralischen und sozialen Herausforderungen einer vergangenen Ära. Es ist ein Werk, das sowohl Liebhaber klassischer Literatur begeistern wird als auch jene, die sich für historische und kulturelle Studien interessieren. Mit 'Die letzte Chronik von Barset' schließt Anthony Trollope eine literarische Reihe ab, die noch immer durch ihre Aktualität und Einsichtskraft beeindruckt. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die letzte Chronik von Barset
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I.
„Ich kann es einfach nicht glauben, John“, meinte Mary Walker, die hübsche Tochter von Mr. George Walker, Anwalt in Silverbridge. Die Kanzlei hieß Walker und Winthrop, und sie waren angesehene Leute, die alle Anwaltsgeschäfte erledigten, die in diesem Teil von Barsetshire für die Krone zu tun waren, für den Herzog von Omnium, der in dieser Gegend ziemlich wichtig ist, arbeiteten und insgesamt ziemlich stolz waren, wie es Provinzanwälte oft sind. Die Walkers wohnten in einem großen Backsteinhaus mitten in der Stadt, gaben Dinnerpartys, zu denen die Gentlemen des Landkreises nicht selten herabließen, zu kommen, und bestimmten auf sanfte Weise die Mode in Silverbridge. „Ich kann mich einfach nicht dazu bringen, das zu glauben, John“, sagte Miss Walker.
„Du musst dich dazu bringen, es zu glauben“, sagte John, ohne den Blick von seinem Buch zu nehmen.
„Ein Geistlicher – und noch dazu so ein Geistlicher!“
„Ich sehe nicht, was das damit zu tun hat.“ Als er das sagte, nahm John den Blick von seinem Buch. „Warum sollte ein Geistlicher nicht genauso wie jeder andere zum Dieb werden? Ihr Mädchen scheint immer zu vergessen, dass Geistliche letztendlich auch nur Menschen sind.“
„Ich denke, dass ihr Verhalten wahrscheinlich besser ist als das anderer Männer.“
„Ich bestreite das entschieden“, sagte John Walker. „Ich behaupte, dass es in diesem Moment mehr Geistliche mit Schulden in Barsetshire gibt als Anwälte oder Ärzte. Dieser Mann war immer verschuldet. Seit er in der Grafschaft ist, glaube ich nicht, dass er je den Mut hatte, sich in der Hauptstraße von Silverbridge blicken zu lassen.“
„John, das geht dir zu weit“, sagte Mrs. Walker.
„Aber Mutter, dieser Scheck wurde einem Metzger ausgestellt, der ein paar Tage zuvor gedroht hatte, im ganzen Landkreis Plakate aufzuhängen, auf denen er seine Forderungen bekannt geben würde, wenn das Geld nicht sofort bezahlt würde.“
„Umso schämender für Mr. Fletcher“, sagte Mary. „Er hat als Metzger in Silverbridge ein Vermögen gemacht.“
„Was hat das damit zu tun? Natürlich möchte ein Mann sein Geld haben. Er hatte dreimal an den Bischof geschrieben und einen Mann nach Hogglestock geschickt, um seine kleine Rechnung zu begleichen, sechs Tage hintereinander. Wie du siehst, hat er es schließlich bekommen. Natürlich muss ein Händler auf sein Geld achten.“
„Mama, glaubst du, dass Mr. Crawley den Scheck geklaut hat?“ Mary stellte die Frage, während sie sich neben ihre Mutter stellte und sie mit besorgten Augen ansah.
„Ich möchte mich dazu lieber nicht äußern, meine Liebe.“
„Aber du musst doch etwas denken, wenn alle darüber reden, Mama.“
„Natürlich denkt meine Mutter, dass er es getan hat“, sagte John und wandte sich wieder seinem Buch zu. „Es ist unmöglich, dass sie etwas anderes denken könnte.“
„Das ist nicht fair, John“, sagte Mrs. Walker, „und ich will nicht, dass du mir Gedanken unterstellst oder mir Worte in den Mund legst. Die ganze Angelegenheit ist sehr schmerzhaft, und da dein Vater mit den Ermittlungen beschäftigt ist, denke ich, dass es besser ist, in diesem Haus so wenig wie möglich darüber zu sprechen. Ich bin sicher, dass dein Vater genauso denken würde.“
„Natürlich werde ich vor ihm nichts darüber sagen“, sagte Mary. „Ich weiß, dass Papa nicht möchte, dass darüber gesprochen wird. Aber wie soll man umhin, über so etwas nachzudenken? Es wäre so schrecklich für uns alle, die wir der Kirche angehören.“
„Das sehe ich überhaupt nicht so“, sagte John. „Mr. Crawley ist nicht mehr als jeder andere Mann, nur weil er Geistlicher ist. Ich hasse diese ganze Heuchelei. Es gibt viele Leute hier in Silverbridge, die denken, man solle die Angelegenheit nicht weiterverfolgen, nur weil der Mann eine Position innehat, die sein Verbrechen schlimmer macht, als es bei einem anderen der Fall wäre.“
„Aber ich bin mir sicher, dass Mr. Crawley überhaupt kein Verbrechen begangen hat“, sagte Mary.
„Meine Liebe“, sagte Mrs. Walker, „ich habe gerade gesagt, dass ich es vorziehen würde, wenn du nicht darüber sprichst. Papa wird gleich hier sein.“
„Das werde ich nicht, Mama, nur ...“
„Nur! Ja, nur!“, sagte John. „Sie würde bis zum Abendessen weiterreden, wenn jemand da wäre, der ihr zuhört.“
„Du hast doppelt so viel gesagt wie ich, John.“ Aber John hatte den Raum bereits verlassen, bevor die letzten Worte seiner Schwester ihn erreichen konnten.
„Weißt du, Mama, es ist einfach unmöglich, nicht daran zu denken“, sagte Mary.
„Das kann ich mir vorstellen, meine Liebe.“
„Und wenn man die Leute kennt, macht es das noch schlimmer.“
„Aber kennst du sie? Ich habe noch nie in meinem Leben mit Mr. Crawley gesprochen, und ich glaube, ich habe sie auch noch nie gesehen.“
„Ich kannte Grace sehr gut – damals, als sie zum ersten Mal in Fräulein Prettymans Schule kam.“
„Armes Mädchen. Sie tut mir leid.“
„Sie bemitleiden? Bemitleiden ist nicht das richtige Wort, Mama. Mein Herz blutet für sie. Und doch glaube ich keine Sekunde lang, dass er den Scheck gestohlen hat. Wie sollte das möglich sein? Denn auch wenn er vielleicht Schulden hatte, weil sie so sehr, sehr arm waren, wissen wir doch alle, dass er ein ausgezeichneter Geistlicher war. Als die Robartses das letzte Mal hier zu Abend gegessen haben, habe ich Mrs. Robarts sagen hören, dass sie kaum jemanden kenne, der ihm in seiner Frömmigkeit und Hingabe an seine Pflichten gleichkomme. Und die Robartses wissen mehr über sie als jeder andere.“
„Man sagt, der Dekan sei sein guter Freund.“
„Wie schade, dass die Arabins gerade jetzt weg sind, wo er in solchen Schwierigkeiten steckt.“ Und so redeten Mutter und Tochter weiter über die Frage der Schuld des Geistlichen, obwohl Mrs. Walker zuvor den Wunsch geäußert hatte, dass nichts mehr darüber gesagt werden solle. Aber Mrs. Walker neigte, wie viele andere Mütter auch, dazu, mit ihrer Tochter freier zu reden als mit ihrem Sohn. Während sie so redeten, kam der Vater aus seinem Büro herein, und das Thema wurde fallen gelassen. Er war ein Mann zwischen fünfzig und sechzig Jahren, mit grauen Haaren, eher klein und etwas korpulent, aber dennoch mit jener persönlichen Anmut ausgestattet, die eine komfortable Position und der Respekt anderer im Allgemeinen zu verleihen scheinen. Ein Mann, den die Welt hoch schätzt, trägt sich selten armselig.
„Ich bin sehr müde, meine Liebe“, sagte Mr. Walker.
„Du siehst müde aus. Komm und setz dich ein paar Minuten hin, bevor du dich umziehst. Mary, hol die Pantoffeln deines Vaters.“ Mary rannte sofort zur Tür.
„Danke, mein Schatz“, sagte der Vater. Und dann flüsterte er seiner Frau zu, sobald Mary außer Hörweite war: „Ich fürchte, dieser unglückliche Mann ist schuldig. Ich fürchte, er ist es! Ich fürchte, er ist es!“
„Oh Himmel! Was wird aus ihnen werden?“
„Was in der Tat? Sie war heute bei mir.“
„Wirklich? Und was hast du ihr gesagt?“
„Ich habe ihr zuerst gesagt, dass ich sie nicht sehen kann, und sie gebeten, nicht mit mir darüber zu sprechen. Ich habe versucht, ihr klar zu machen, dass sie sich an jemand anderen wenden soll. Aber es hat nichts gebracht.“
„Und wie ist es ausgegangen?“
„Ich habe sie gebeten, zu dir zu gehen, aber sie hat abgelehnt. Sie meinte, du könntest nichts für sie tun.“
„Und glaubt sie, dass ihr Mann schuldig ist?“
„Nein, ganz und gar nicht. Sie hält ihn für schuldig! Nichts auf der Welt – und auch nichts im Himmel, wie ich es verstehe – würde sie dazu bringen, das für möglich zu halten. Sie kam zu mir, nur um mir zu sagen, wie gut er war.“
„Dafür liebe ich sie“, sagte Mrs. Walker.
„Ich auch. Aber was bringt es, sie zu lieben? Danke, meine Liebe. Vielleicht hole ich dir irgendwann deine Pantoffeln.“
Das ganze County war in Aufruhr wegen der angeblichen Schuld des Reverend Josiah Crawley – das ganze County, beinahe ebenso erregt wie die Familie von Mr. Walker aus Silverbridge. Das ihm zur Last gelegte Verbrechen war der Diebstahl eines Schecks über zwanzig Pfund, den er aus einem Notizbuch entwendet haben soll, das in seinem Haus liegen gelassen oder verloren worden war, und den er, so hieß es, als Zahlungsmittel an einen gewissen Fletcher, einen Metzger in Silverbridge, weitergegeben habe, bei dem er Schulden hatte. Mr. Crawley war in jenen Tagen der ständige Hilfspfarrer von Hogglestock, einer Pfarrei im nördlichsten Zipfel von Ost-Barsetshire; ein Mann, von dem alle, die ihn kannten, wussten, dass er sehr arm war – ein unglücklicher, grüblerischer, enttäuschter Mann, auf den die Lasten der Welt stets doppelt zu drücken schienen. Doch war er als Geistlicher stets geachtet worden, seit ihm sein alter Freund Mr. Arabin, der Dekan von Barchester, die kleine Pfarrei übertragen hatte, die er nun innehatte. Obgleich grüblerisch, unglücklich und enttäuscht, war er ein fleißiger, gewissenhafter Seelsorger unter den armen Leuten, in deren Mitte sein Schicksal ihn gestellt hatte; denn in der Pfarrei Hogglestock lebten nur wenige Bauern, die gesellschaftlich über Tagelöhner, Ziegelbrenner und dergleichen hinausgingen. Mr. Crawley hatte nunmehr etwa zehn Jahre seines Lebens in Hogglestock verbracht; und in diesen Jahren hatte er unermüdlich gearbeitet, um seiner Pflicht gerecht zu werden, bemüht, den Menschen um ihn her vielleicht zu viel vom Geheimnis, aber auch etwas vom Trost der Religion zu lehren. Dass er in seiner Gemeinde beliebt gewesen sei, kann man von ihm nicht sagen. Er war kein Mann, der sich in irgendeiner Stellung beliebt zu machen verstand. Ich sagte bereits, dass er grüblerisch und enttäuscht war. Er war noch mehr als das; er war mürrisch, bisweilen beinahe wahnsinnig. Es hatte Tage gegeben, an denen selbst seine Frau nicht anders mit ihm umgehen konnte, als mit einem offen eingestandenen Geisteskranken. Und das war den Bauern bekannt, die untereinander von ihrem Pfarrer sprachen, als sei er ein Irrer. Doch unter den Ärmsten, unter den Ziegelbrennern von Hoggle End – einem gesetzlosen, trunksüchtigen, schrecklich rohen Menschenschlag – genoss er hohes Ansehen; denn sie wussten, dass er ein hartes Leben führte, wie sie selbst; dass er hart arbeitete, wie sie; und dass die Welt draußen ihm ebenso rau begegnete wie ihnen; und es lag eine offenkundige Aufrichtigkeit in seiner Frömmigkeit, ein sichtbares Ringen, seine Pflicht trotz der Misshandlungen der Welt zu erfüllen, das selbst bei den Rohesten Eindruck hinterließ; so dass Mr. Crawleys Name bei vielen in seiner Gemeinde in hohem Ansehen stand, trotz der unglücklichen Eigenart seines Wesens. Dies war der Mann, der nun beschuldigt wurde, einen Scheck über zwanzig Pfund gestohlen zu haben.
Bevor jedoch die Umstände des mutmaßlichen Diebstahls dargelegt werden, muss ein paar Worte über Mr. Crawleys Familie gesagt werden. Es heißt, eine gute Ehefrau sei die Krone ihres Mannes, aber Mrs. Crawley war für ihn viel mehr als eine Krone gewesen. Was das ganze Innenleben des Mannes betraf – all das, was nicht auf der Kanzel oder in der Seelsorge verbracht wurde –, war sie Krone, Thron und Zepter in einem gewesen. Dass sie mit ihm und für ihn die Nöte der Armut und die Schwierigkeiten eines Lebens ertragen hatte, das kein Lächeln kannte, ist vielleicht nicht so sehr zu ihren Ehren zu werten. Sie hatte sich ihm in guten wie in schlechten Zeiten angeschlossen, und es war ihre offensichtliche Pflicht, solche Dinge zu ertragen; Ehefrauen müssen sie immer ertragen, da sie bei der Heirat wissen, dass sie dieses Risiko eingehen müssen. Mr. Crawley hätte Bischof werden können, und Mrs. Crawley hatte, als sie ihn heiratete, vielleicht gedacht, dass dies sein Schicksal sein würde. Stattdessen war er nun, kurz vor seinem fünfzigsten Lebensjahr, ein ewiger Vikar mit einem Einkommen von 130 Pfund pro Jahr – und einer Familie. Das war Mrs. Crawleys Glück im Leben gewesen, und natürlich ertrug sie es. Aber sie hatte noch viel mehr getan. Sie hatte sich sehr bemüht, zufrieden zu sein, oder besser gesagt, zufrieden zu wirken, als er am unglücklichsten und launischsten war. Sie hatte sich bemüht, ihre eigene Überzeugung, dass er halb wahnsinnig war, vor ihm zu verbergen und ihn gleichzeitig mit dem Respekt zu behandeln, der einem geachteten Familienvater gebührt, und mit der vorsichtigen, maßvollen Nachsicht, die einem kranken und eigensinnigen Kind gebührt. In all den schrecklichen Schwierigkeiten ihres Lebens war ihr Mut größer gewesen als seiner. Das Metall, aus dem sie gemacht war, war zu einem Stahl gehärtet worden, der sehr selten und fein war, dessen Seltenheit und Feinheit er jedoch nicht zu schätzen wusste. Er hatte ihr oft gesagt, dass sie keinen Stolz habe, weil sie sich herabgelassen hatte, für ihn und für ihre Kinder Dinge anzunehmen, die sehr notwendig waren, die sie aber nicht kaufen konnte. Er hatte ihr gesagt, sie sei eine Bettlerin, und es sei besser zu hungern als zu betteln. Sie hatte die Zurechtweisung ohne ein Wort der Antwort ertragen, hatte dann erneut für ihn gebettelt und selbst den Hunger ertragen. Nichts an ihrer Armut war ihr in den vergangenen Jahren eine Schande gewesen, aber jeder Zufall ihrer Armut war für ihn nach wie vor eine lebende Schande, wie schon immer.
Mr. und Mrs. Crawley.
Sie hatten viele Kinder gehabt, von denen drei noch am Leben waren. Von der ältesten, Grace Crawley, werden wir in der folgenden Geschichte noch viel hören. Sie war zu dieser Zeit neunzehn Jahre alt, und es gab Leute, die sagten, dass sie trotz ihrer Armut, ihrer schäbigen Kleidung und ihrer etwas dünnen, unreifen, unrunden Figur, die ihr keine Fülle verlieh, das hübscheste Mädchen in dieser Gegend sei. Sie lebte jetzt in einer Schule in Silverbridge, wo sie seit einem Jahr als Lehrerin arbeitete; und viele in Silverbridge sagten, dass sich ihr sehr vielversprechende Aussichten eröffneten – dass der junge Major Grantly von Cosby Lodge, der zwar Witwer mit einem kleinen Kind war, aber dennoch der Blickfang aller Frauen in und um Silverbridge, die Schönheit in ihrem schmalen Gesicht entdeckt hatte und dass Grace Crawleys Glück sozusagen trotz des vorherrschenden Unglücks ihrer Familie gemacht war. Bob Crawley, der zwei Jahre jünger war, ging jetzt auf die Marlborough School, von wo aus er nach Cambridge gehen und dort auf Kosten seines Patenonkels, Dekan Arabin, studieren sollte. Auch darin sah die Welt einen Glücksfall. Aber für Mr. Crawley war nichts ein Glücksfall. Bob, der in der Schule sehr gut abgeschnitten hatte, würde vielleicht auch in Cambridge gut abschneiden – vielleicht sogar Großes leisten. Aber Mr. Crawley hätte es fast vorgezogen, dass der Junge auf den Feldern arbeitete, anstatt eine so offensichtlich wohltätige Ausbildung zu erhalten. Und dann seine Kleidung! Wie sollte er mit Kleidung ausgestattet werden, die für die Schule oder das College geeignet war? Aber der Dekan und Mrs. Crawley kümmerten sich darum und ließen Mr. Crawley völlig im Dunkeln, wie Mrs. Crawley es gewohnt war, ihn zu lassen. Dann gab es noch eine jüngere Tochter, Jane, die noch zu Hause wohnte und ihr Leben zwischen dem Arbeitstisch ihrer Mutter und dem Griechisch ihres Vaters verbrachte, wo sie Wäsche flickte und lernte, Jamben zu scannen – denn Mr. Crawley war in seinen jungen Jahren ein reifer Gelehrter gewesen.
Und nun hatte sie alle dieses schreckliche, vernichtende Unglück getroffen. Dass der arme Mr. Crawley sich in Silverbridge nach und nach in Schulden verstrickt hatte, aus denen er sich unmöglich befreien konnte, war in Silverbridge und Hogglestock allgemein bekannt. Viele wussten, dass Dekan Arabin gegen seinen Willen Geld für ihn bezahlt hatte und dass er sich deswegen mit dem Dekan gestritten oder zumindest versucht hatte, sich mit ihm zu streiten – obwohl das Geld teilweise durch seine eigenen Hände geflossen war. Es gab einen Gläubiger, Fletcher, den Metzger von Silverbridge, der in letzter Zeit besonders hart mit dem armen Crawley ins Gericht gegangen war. Dieser Mann, der in seinen Geschäften nicht ohne Gutmütigkeit gewesen war, hatte Geschichten über die Freundlichkeit des Dekans und ähnliches gehört und lautstark seine Meinung geäußert, dass der ewige Vikar von Hogglestock mehr Stolz zeigen würde, wenn er sich von einem reichen Geistlichen Geld leihen würde, als wenn er weiterhin einem Metzger unterworfen bliebe. Und so war ein Gerücht entstanden. Daraufhin hatte der Metzger wiederholt Briefe an den Bischof geschrieben – an Bischof Proudie von Barchester, der zunächst seinen Kaplan gebeten hatte, darauf zu antworten, und Mr. Crawley ziemlich unverblümt mitgeteilt hatte, was er von einem Geistlichen hielt, der Fleisch aß und nicht dafür bezahlte. Aber nichts, was der Bischof sagen oder tun konnte, brachte Mr. Crawley dazu, den Metzger zu bezahlen. Für einen Mann wie Mr. Crawley war es echt schlimm, diese Briefe von einem Mann wie Bischof Proudie zu bekommen; aber die Briefe kamen und verursachten schmerzhafte Wunden, aber dann war es auch wieder vorbei. Und schließlich kam aus der Metzgerei die Drohung, dass, wenn das Geld nicht bis zu einem bestimmten Datum bezahlt würde, gedruckte Plakate im ganzen Landkreis aufgehängt würden. Alle, die in Silverbridge davon hörten, waren sehr wütend auf Mr. Fletcher, denn niemand dort hatte jemals zuvor erlebt, dass ein Händler einen solchen Schritt unternommen hatte; aber Fletcher schwor, dass er durchhalten würde, und verteidigte sich damit, dass Mr. Crawley vor sechs oder sieben Monaten, im Frühjahr, zwar Geld in Silverbridge gezahlt hatte, aber ihm nichts gezahlt hatte – ihm, der nicht nur sein frühester, sondern auch sein langjährigster Gläubiger war. „Er hat im März Geld vom Dekan bekommen“, sagte Mr. Fletcher zu Mr. Walker, „und er hat zwölf Pfund zehn an Green und siebzehn Pfund an Grobury, den Bäcker, gezahlt.“ Es waren diese siebzehn Pfund an Grobury, den Bäcker, für Mehl, die den Metzger so fest entschlossen machten, dem armen Geistlichen eins auszuwischen. „Und er hat Geld an Hall und an Mrs. Holt und an viele andere gezahlt, aber er ist nie in die Nähe meines Ladens gekommen. Hätte er sich auch nur blicken lassen, hätte ich nicht so viel darüber gesagt.“ Und dann, einen Tag vor dem genannten Termin, war Mrs. Crawley nach Silverbridge gekommen und hatte dem Metzger zwanzig Pfund in vier Fünf-Pfund-Scheinen gezahlt. Bis dahin war Fletcher, der Metzger, erfolgreich gewesen.
Etwa sechs Wochen später begann man Nachforschungen über einen bestimmten Scheck über zwanzig Pfund anzustellen, den Lord Lufton bei seiner Bank in London ausgestellt hatte und der im Frühjahr von Mr. Soames, Lord Luftons Geschäftsmann in Barsetshire, zusammen mit einem Taschenbuch, in dem er aufbewahrt worden war, verloren gegangen war. Soames glaubte, dieses Taschenbuch bei Mr. Crawley zu Hause vergessen zu haben, und war sogar zum Zeitpunkt des Verlusts so weit gegangen, seine absolute Überzeugung zu äußern, dass er es dort vergessen hatte. Er hatte die Gewohnheit, Mr. Crawley im Namen von Lord Lufton alle sechs Monate eine Pacht in Höhe von zwanzig Pfund und vier Shilling zu zahlen. Lord Lufton besaß die großen Zehnten von Hogglestock und zahlte dem Amtsinhaber jährlich einen Betrag von vierzig Pfund und acht Schilling. Dieser Betrag wurde in der Regel pünktlich von Mr. Soames per Post überwiesen. Bei der jetzt erwähnten Gelegenheit hatte er einen Grund, Hogglestock zu besuchen, und hatte das Geld persönlich an Mr. Crawley gezahlt. Daran gab es keinen Zweifel. Aber er hatte es mit einem Scheck bezahlt, den er selbst auf seine Bank in Barchester ausgestellt hatte, und dieser Scheck war am nächsten Morgen auf dem üblichen Weg eingelöst worden. Als er in sein Haus in Barchester zurückkam, stellte er fest, dass sein Portemonnaie fehlte, und schrieb Herrn Crawley einen Brief, um sich zu erkundigen. Außer dem von Lord Lufton ausgestellten Scheck über zwanzig Pfund war kein Geld darin gewesen. Herr Crawley antwortete auf diesen Brief mit einem weiteren, in dem er mitteilte, dass in seinem Haus kein Portemonnaie gefunden worden sei. All dies hatte sich im März ereignet.
Im Oktober zahlte Mrs. Crawley die zwanzig Pfund an Fletcher, den Metzger, und im November wurde Lord Luftons Scheck über die Bank von Barchester bis zu Mr. Crawley zurückverfolgt. Ein Ziegelhersteller aus Hoggle End, der von Mr. Crawley sehr geschätzt wurde, hatte an der Kasse dieser Bank in Barchester – natürlich nicht der Bank, auf die der Scheck ausgestellt war – um Wechselgeld gebeten und es auch bekommen. Zuerst wurde dem Mann die Wechselgeldauszahlung verweigert, aber als er am nächsten Tag den Scheck vorlegte, auf dessen Rückseite der Name von Mr. Crawley stand, zusammen mit einer Notiz von Mr. Crawley selbst, wurde ihm das Geld dafür gegeben; und genau diese Banknoten wurden am nächsten Tag von Mrs. Crawley an Fletcher, den Metzger, weitergegeben. Auf Nachfrage erklärte Mr. Crawley, dass der Scheck ihm von Mr. Soames im Namen der ihm von Lord Lufton geschuldeten Pacht gezahlt worden sei. Der Fehler dieser Aussage wurde jedoch sofort offensichtlich. Da war der Scheck, von Mr. Soames selbst unterzeichnet, über den genauen Betrag – zwanzig Pfund vier Shilling. Wie er selbst erklärte, hatte er in seinem ganzen Leben noch nie Geld im Namen von Lord Lufton mit einem von dessen Lordschaft ausgestellten Scheck bezahlt. Der von Lord Lufton ausgegebene und verlorene Scheck sei eine private Angelegenheit zwischen ihnen gewesen. Seine Lordschaft habe lediglich Wechselgeld in seiner Tasche gewünscht, und sein Vertreter habe es ihm gegeben. Es stellte sich schnell heraus, dass Mr. Crawley mit seiner Erklärung, warum er im Besitz des Schecks war, völlig falsch lag.
Daraufhin wurde er sehr mürrisch und sagte nichts mehr. Aber seine Frau, die nichts von seiner ersten Aussage gewusst hatte, trat vor und erklärte, dass sie glaube, der Scheck über zwanzig Pfund sei Teil eines Geschenks gewesen, das Dekan Arabin ihrem Mann im vergangenen April gemacht hatte. Dieses Geschenk habe große Unruhe ausgelöst, und sie habe sich kaum getraut, mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Grobury, der Bäcker, hatte mit einer Zwangsvollstreckung gedroht, von der der Dekan gehört hatte. Dann hatte es im Dekanat einige Szenen zwischen ihrem Mann und dem Dekan und Mrs. Arabin gegeben, von denen sie später viel von Mrs. Arabin gehört hatte. Mrs. Arabin hatte ihr erzählt, dass Geld gegeben und schließlich wieder genommen worden war. Das war auch ganz offensichtlich, denn Rechnungen in Höhe von mindestens fünfzig Pfund waren bezahlt worden. Als die Drohung des Metzgers ihren Mann erreichte, hatte das einen sehr schlimmen Effekt auf ihn gehabt. All das erzählte Mrs. Crawley dem Anwalt Mr. Walker, als er seine Nachforschungen vorantrieb. Die arme Frau erzählte jedenfalls alles, was sie wusste. Ihr Mann hatte ihr eines Morgens, als ihn die Drohung des Metzgers schwer belastete, in einer Stimmung erzählt, die es ihr unmöglich machte, ihm weitere Fragen zu stellen, dass er noch Geld übrig habe, obwohl es Geld war, von dem er gehofft hatte, dass er es nicht verwenden müsse; und er hatte ihr die vier Fünf-Pfund-Scheine gegeben und ihr gesagt, sie solle nach Silverbridge gehen und den Mann zufriedenstellen, der so eifrig auf sein Geld wartete. Sie hatte das getan und hatte keinen Zweifel daran, dass das Geld vom Dekan kam. Das war die Geschichte, wie sie von Mrs. Crawley erzählt wurde.
Aber wie konnte sie die Aussage ihres Mannes bezüglich des Schecks erklären, die sich als völlig falsch herausgestellt hatte? All dies spielte sich zwischen Mr. Walker und Mrs. Crawley ab, und der Anwalt ging sehr behutsam mit ihr um. Zu Beginn der Untersuchung hatte er lediglich die Wahrheit herausfinden und den Geistlichen von jedem Verdacht befreien wollen. Da er nun aber verpflichtet war, die Angelegenheit offiziell weiterzuverfolgen, hätte er Mrs. Crawley nicht empfangen, wenn er sich dem Drängen dieser Dame hätte entziehen können. „Herr Walker“, hatte sie schließlich gesagt, „Sie kennen meinen Mann nicht. Niemand außer mir kennt ihn. Es fällt mir schwer, Ihnen von all unseren Problemen zu erzählen.“ „Wenn ich sie lindern kann, vertrauen Sie mir, dass ich das tun werde“, sagte der Anwalt. „Ich glaube, niemand auf dieser Welt kann sie verringern“, sagte die Dame. „Die Wahrheit ist, Sir, dass mein Mann oft nicht weiß, was er sagt. Als er erklärte, dass ihm das Geld von Herrn Soames gezahlt worden sei, war er ganz sicher davon überzeugt. Es gibt Zeiten, in denen er in seinem Elend nicht weiß, was er sagt – in denen er alles vergisst.“
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Mr. Walker Mr. Crawley nichts Unehrliches unterstellt, und er unterstellte ihm auch jetzt nichts. Der arme Mann hatte wahrscheinlich das Geld vom Dekan erhalten und darüber gelogen, weil er nicht zugeben wollte, dass er Geld von seinem reichen Freund angenommen hatte, und weil er dachte, dass es keine weiteren Nachforschungen geben würde. Er war sehr dumm gewesen, und damit hätte sich die Sache erledigt. Mr. Soames war in seiner Überzeugung keineswegs so gutmütig. „Wie sollte mein Portemonnaie in die Hände von Dekan Arabin gelangt sein?“, sagte Mr. Soames fast triumphierend. „Und dabei war ich mir damals sicher, dass ich es bei Crawley zu Hause vergessen hatte!“
Mr. Walker schrieb einen Brief an den Dekan, der gerade in Florenz war, auf dem Weg nach Rom, von wo aus er weiter ins Heilige Land reisen wollte. Es kam ein Brief von Mr. Arabin zurück, in dem er schrieb, dass er Mr. Crawley am 17. März fünfzig Pfund gegeben habe und dass die Zahlung mit fünf Banknoten der Bank of England zu je zehn Pfund erfolgt sei, die er seinem Freund in der Bibliothek des Dekanats übergeben habe. Der Brief war sehr kurz und könnte vielleicht sogar als fast schon knapp bezeichnet werden. Mr. Walker, der in seiner Sorge, das Beste für Mr. Crawley zu tun, einfach eine Frage zur Art der Transaktion zwischen den beiden Herren gestellt hatte, sagte, dass die Antwort des Dekans zweifellos ein kleines Rätsel aufklären würde, das derzeit in Bezug auf einen Scheck über zwanzig Pfund bestand. Der Dekan hatte in seiner Antwort einfach die oben genannten Fakten dargelegt, aber er schrieb an Mr. Crawley, um zu erfahren, worin diese neue Schwierigkeit tatsächlich bestand, und bot ihm jede ihm mögliche Hilfe an. Er erklärte alle Umstände bezüglich des Geldes, so wie er sich daran erinnerte. Die vorab gezahlte Summe hatte definitiv fünfzig Pfund betragen, und es waren definitiv fünf Banknoten der Bank of England gewesen. Er hatte die Banknoten in einen Umschlag gesteckt, den er nicht verschlossen, sondern an Herrn Crawley adressiert hatte, und diesen Umschlag seinem Freund übergeben. Er fuhr fort, dass Frau Arabin geschrieben hätte, aber dass sie mit ihrem Sohn in Paris sei. Mrs. Arabin würde während seiner Abwesenheit im Heiligen Land in Paris bleiben und ihn bei seiner Rückkehr in Italien treffen. Da sie so viel näher war, äußerte der Dekan die Hoffnung, dass Mrs. Crawley sich bei Problemen an sie wenden würde.
Der Brief an Mr. Walker war eindeutig, was das Geld des Dekans anging. Mr. Crawley hatte den Scheck von Lord Lufton nicht vom Dekan bekommen. Woher hatte er ihn dann? Die arme Frau musste sich an den Anwalt wenden, um mehr Infos von ihrem Mann zu bekommen. Ach, wer kann schon sagen, wie schrecklich die Szenen zwischen diesem armen Paar gewesen sein müssen, als die Frau versuchte, die Wahrheit von ihrem unglücklichen, halb wahnsinnigen Mann zu erfahren! Dass ihr Mann die ganze Zeit ehrlich gewesen war, daran hatte sie nicht den geringsten Zweifel. Sie zweifelte nicht daran, dass er zumindest ihr gegenüber versuchte, die Wahrheit zu sagen, soweit es sein armes, gequältes, unvollkommenes Gedächtnis ihm erlaubte, sich daran zu erinnern, was wahr und was nicht wahr war. Das Ergebnis von allem war, dass der Mann erklärte, er glaube immer noch, dass das Geld vom Dekan zu ihm gekommen sei. Er habe es bei sich behalten, weil er es nicht verwenden wollte, wenn er es vermeiden konnte. Er habe es vergessen – so sagte er manchmal –, da er von Arabin verstanden hatte, dass er fünfzig Pfund bekommen sollte, und mehr erhalten hatte. Wenn es nicht vom Dekan kam, dann hatte es ihm der Fürst des Bösen geschickt, um ihn völlig zu ruinieren; und manchmal schien er zu glauben, dass der verhängnisvolle Scheck auf diese Weise zu ihm gelangt war. In allem, was er sagte, war er furchtbar verwirrt, widersprüchlich, unverständlich – er redete fast wie ein Verrückter – und endete immer damit, dass er erklärte, die Grausamkeit der Welt sei zu viel für ihn gewesen, dass sich die Wasser über seinem Kopf sammelten, und er betete um Gottes Gnade, ihn aus der Welt zu nehmen. Es versteht sich von selbst, dass seine arme Frau in diesen Tagen eine Last auf ihren Schultern trug, die mehr als genug war, um jede Frau zu erdrücken.
Schließlich gab sie Herrn Walker gegenüber zu, dass sie die zwanzig Pfund nicht erklären könne. Sie würde selbst noch einmal an den Dekan schreiben, aber sie hoffte kaum auf weitere Hilfe von dort. „Die Antwort des Dekans ist ganz klar“, sagte Mr. Walker. „Er sagt, dass er Mr. Crawley fünf Zehn-Pfund-Scheine gegeben hat, und diese fünf Scheine haben wir bis zu Mr. Crawley zurückverfolgt.“ Daraufhin konnte Mrs. Crawley nichts weiter sagen, als die Unschuld ihres Mannes zu beteuern.
Kapitel II.
Ich muss den Leser bitten, Major Grantly aus Cosby Lodge kennenzulernen, bevor er die Familie von Mr. Crawley in ihrem Pfarrhaus in Hogglestock kennenlernt. Es wurde gesagt, dass Major Grantly ein Auge auf Grace Crawley geworfen habe – was allen Männern und Frauen in dieser Gegend Anlass gab, anzudeuten, dass die Crawleys trotz ihrer Frömmigkeit und Bescheidenheit sehr gerissen seien und dass einer der Grantlys – gelinde gesagt – sehr weichherzig sei, obwohl im ganzen County Barsetshire bekannt war, dass es keine Familie gab, die sich besser mit den Angelegenheiten dieser Welt und der nächsten auskannte als die Familie, deren angesehener Oberhaupt und Patriarch Archdeacon Grantly war. Mrs. Walker, die gutmütigste Frau in Silverbridge, hatte ihrer Tochter gegenüber zugegeben, dass sie das nicht verstehen könne – dass sie an Grace Crawley überhaupt nichts Besonderes finden könne. Mr. Walker hatte mit den Schultern gezuckt und seine feste Überzeugung geäußert, dass Major Grantly außer seiner Halbpension und dem Vermögen seiner verstorbenen Frau, das nur sechstausend Pfund betrug, keinen einzigen Schilling besitze. Andere, die bösartig waren, hatten erklärt, Grace Crawley sei kaum besser als eine Bettlerin und könne unmöglich die Manieren einer Dame erworben haben. Fletcher, der Metzger, hatte sich gefragt, ob der Major die Schulden seines zukünftigen Schwiegervaters bezahlen würde, und Dr. Tempest, der alte Pfarrer von Silverbridge, dessen vier Töchter alle noch unverheiratet waren, hatte seine alte Nase gerümpft und angedeutet, dass Majore mit Halbpension nicht so leicht eine Ehe eingehen würden.
So und so ähnlich hatten sich die Männer und Frauen in Silverbridge geäußert. Aber die Angelegenheit war auch außerhalb von Silverbridge diskutiert worden und hatte sich als höchst unwillkommenes Thema in die Familienkonklaven des Archidiakons eingeschlichen. Für diejenigen, die dies aufgrund des öffentlichen Ansehens und des guten Rufs dieses Mannes noch nicht wissen, sei gesagt, dass Erzdiakon Grantly zu dieser Zeit, wie schon seit vielen Jahren zuvor, Erzdiakon von Barchester und Rektor von Plumstead Episcopi war. Er war immer ein reicher und wohlhabender Mann gewesen – obwohl er auch seine schweren Probleme hatte, wie wir alle –, die hauptsächlich darauf zurückzuführen waren, dass er nicht die höhere kirchliche Beförderung bekommen hatte, die seine Seele begehrte und für die ihn sein ganzes Leben besonders geeignet gemacht hatte. Jetzt, in seinem hohen Alter, hatte er aufgehört zu begehren, aber er hatte nicht aufgehört zu murren. Er hatte aufgehört, für sich selbst etwas zu begehren, aber er begehrte immer noch viel für seine Kinder; und für ihn war eine Ehe wie diese, die nun für seinen Sohn vorgeschlagen wurde, fast mit der Bitterkeit des Todes verbunden. „Ich glaube, das würde mich umbringen“, hatte er zu seiner Frau gesagt; „bei Gott, ich glaube, das wäre mein Tod!“
Eine Tochter des Erzdiakons hatte eine großartige Heiratsallianz geschlossen – so großartig, dass ihre Geschichte damals der gesamten Aristokratie des Landkreises bekannt war und von keinem, der sich gut über die Details des Adels informierte, ganz vergessen worden war. Griselda Grantly hatte Lord Dumbello geheiratet, den ältesten Sohn des Marquis von Hartletop – den mächtigsten englischen Adligen, wenn man nach der Größe seines Landbesitzes, der Anzahl seiner Burgen, seinem hohen Titel und seinen Orden und Ordenbändern als Zeichen der Macht urteilt –, und war nun selbst Marquise von Hartletop und Mutter eines kleinen Lord Dumbello. Die Besuche der Tochter im Pfarrhaus ihres Vaters waren zwangsläufig selten, was auf ihre veränderte Lebenssituation zurückzuführen war. Eine Marquise von Hartletop hat besondere Pflichten, die es ihr kaum erlauben, sich häufig der alltäglichen Gesellschaft ihrer Eltern, die beide Geistliche waren, zu widmen. Dass dies so sein würde, hatten Vater und Mutter verstanden, als sie das glückliche Mädchen in eine höhere Welt entließen. Aber seit ihrer hochkarätigen Hochzeit hatte sie hin und wieder ihren gekrönten Kopf für eine Nacht oder so auf eines der alten Kissen des Pfarrhauses gelegt, und bei solchen Gelegenheiten hatten alle Plumsteadianer ihre Herablassung lautstark gelobt. Nun kam es, dass, als dieser zweite und heftigere böse Windstoß das Pfarrhaus erreichte – die erneute Nachricht von Major Grantlys Verliebtheit in Miss Grace Crawley, die bei ihrer Wiederholung etwas Bestätigendes an sich zu haben schien –, zufällig gerade in diesem Moment Griselda, Marquise von Hartletop, die väterliche Villa beehrte. Es versteht sich von selbst, dass der Vater nicht zögerte, den Rat seiner Tochter und die Hilfe seiner Schwester in Anspruch zu nehmen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Mutter ebenso schnell den Rat ihrer Tochter eingeholt hätte, wenn sie in dieser Angelegenheit ganz auf ihre eigenen Neigungen angewiesen gewesen wäre. Mrs. Grantly hatte ihre Tochter immer sehr geliebt und war sehr stolz auf den großen Erfolg gewesen, den Griselda im Leben erreicht hatte; aber in den letzten Jahren hatte sich das Kind als Frau von der Mutter entfernt, und es war, was nicht ungewöhnlich war, zu einem Bruch des engen Vertrauens gekommen, das in früheren Jahren zwischen ihnen bestanden hatte. Griselda, Marquise von Hartletop, war mehr denn je eine Tochter für den Erzdiakon, auch wenn er sie vielleicht nie sah. Nichts konnte ihm die Ehre einer solchen Nachkommenschaft nehmen – nichts, auch wenn es tatsächlich zu einer Entfremdung zwischen ihnen gekommen war. Bei Mrs. Grantly war das aber anders. Griselda hatte sich sehr gut geschlagen, und Mrs. Grantly hatte sich darüber gefreut, aber sie hatte ihr Kind verloren. Jetzt war der Major, der es auch gut gemacht hatte, wenn auch in viel geringerem Maße, immer noch ihr Kind, bewegte sich im gleichen Lebensbereich wie sie, war immer noch in hohem Maße von der Großzügigkeit seines Vaters abhängig, ein Nachbar in der Grafschaft, ein häufiger Besucher im Pfarrhaus und ein Besucher, der ohne all die Schwierigkeiten empfangen werden konnte, die mit den seltenen Besuchen von Griselda, der Marquise, in ihrem Elternhaus verbunden waren. Und aus diesem Grund hätte Mrs. Grantly, so sehr sie sich auch über die Vorstellung einer Heirat ihres Sohnes mit einer Frau wie Grace Crawley ärgerte, die in der Welt so wenig Ansehen genoss, die Angelegenheit nicht vor ihrer Tochter zur Sprache gebracht, wenn sie nach ihren eigenen Wünschen hätte handeln können. Eine Marquise in der Familie ist zweifellos eine große Stütze, aber es gibt Ratgeber, die so stark sind, dass wir ihnen nicht vertrauen wollen, aus Angst, dass wir selbst von ihrer Stärke überwältigt werden könnten. Mrs. Grantly war keineswegs bereit, ihren Einfluss in die Hände ihrer adeligen Tochter zu legen.
Aber die adelige Tochter wurde gefragt und gab ihren Rat. Anlässlich des aktuellen Besuchs in Plumstead hatte sie zugestimmt, zwei Nächte im Pfarrhaus zu übernachten, und am zweiten Abend sollte ihr Bruder, der Major, aus Cosby Lodge kommen, um sie zu treffen. Vor seiner Ankunft wurde die Angelegenheit mit Grace Crawley besprochen.
„Das würde mir das Herz brechen, Griselda“, sagte der Erzdiakon mitleidig, „und deiner Mutter auch.“
„Es gibt nichts gegen den Charakter des Mädchens einzuwenden“, sagte Mrs. Grantly, „und der Vater und die Mutter sind von Geburt an vornehme Leute; aber eine solche Ehe wäre für Henry sehr unpassend.“
„Um die Sache noch schlimmer zu machen, gibt es diese schreckliche Geschichte über ihn“, sagte der Erzdiakon.
„Ich glaube nicht, dass da viel dran ist“, meinte Mrs. Grantly.
„Ich kann es nicht sagen. Man weiß es nicht. Heute wurde mir in Barchester erzählt, dass Soames die Klage gegen ihn vorantreibt.“
„Wer ist Soames, Papa?“, fragte die Marquise.
„Er ist Lord Luftons Geschäftsmann, meine Liebe.“
„Oh, Lord Luftons Geschäftsmann!“ In der Stimme der Dame lag ein Hauch von Spott, als sie Lord Luftons Namen erwähnte.
„Mir wurde gesagt“, fuhr der Erzdiakon fort, „dass Soames behauptet, der Scheck sei aus einem Taschenbuch genommen worden, das er versehentlich in Crawleys Haus vergessen habe.“
„Du willst doch nicht sagen, Erzdiakon, dass du glaubst, Mr. Crawley – ein Geistlicher – hätte ihn gestohlen!“, sagte Mrs. Grantly.
„Das sage ich nicht, meine Liebe. Aber selbst wenn Mr. Crawley so ehrlich wie die Sonne wäre, würdest du nicht wollen, dass Henry seine Tochter heiratet.“
„Sicher nicht“, sagte die Mutter. „Das wäre eine unpassende Ehe. Das arme Mädchen hat keine Vorteile.“
„Er kann nicht mal seine Bäckereirechnung bezahlen. Ich fand es schon immer falsch von Arabin, so jemanden in einer Gemeinde wie Hogglestock unterzubringen. Natürlich konnte die Familie dort nicht leben.“ Der hier erwähnte Arabin war Dr. Arabin, Dekan von Barchester. Der Dekan und der Erzdiakon hatten Schwestern geheiratet, und die Familien standen sich sehr nahe.
„Es ist ja bisher nur ein Gerücht“, sagte Mrs. Grantly.
„Fothergill hat mir erst gestern erzählt, dass er sie fast jeden Tag sieht“, sagte der Vater. „Was sollen wir tun, Griselda? Du weißt, wie eigensinnig Henry ist.“ Die Marquise saß ganz still da, schaute ins Feuer und antwortete nicht sofort auf diese Frage.
„Es bleibt dir nichts anderes übrig, als ihm zu sagen, was du denkst“, meinte die Mutter.
„Wenn seine Schwester mit ihm reden würde, könnte das viel bewirken“, meinte der Erzdiakon. Mrs. Grantly sagte dazu nichts, aber Mrs. Grantlys Tochter wusste genau, dass ihre Mutter ihr nicht so sehr vertraute wie ihr Vater. Lady Hartletop sagte nichts, sondern saß weiterhin mit ausdruckslosem Gesicht da und starrte ins Feuer. „Ich denke, wenn du mit ihm sprichst, Griselda, und ihm sagst, dass er seiner Familie Schande bereiten würde, würde er sich schämen, diese Ehe einzugehen“, meinte der Vater. „Er würde sich, da er mit Lord Hartletop verbunden ist, ...“
„Ich glaube nicht, dass ihm das was ausmachen würde“, meinte Mrs. Grantly.
„Das glaube ich auch nicht“, sagte Lady Hartletop.
„Ich bin mir sicher, dass er das fühlen sollte“, meinte der Vater. Alle schwiegen und saßen da und schauten ins Feuer.
„Ich nehme an, Papa, du gibst Henry ein Einkommen“, meinte Lady Hartletop nach einer Weile.
„Ja, das tue ich – achthundert pro Jahr.“
„Dann sollte ich ihm wohl sagen, dass das von seinem Verhalten abhängt. Mama, wenn du bitte die Glocke läuten würdest, ich schicke dann nach Cecile und ziehe mich oben um.“ Dann ging die Marquise nach oben, um sich umzuziehen, und etwa eine Stunde später kam der Major mit seinem Dogcart an. Auch ihm wurde erlaubt, sich oben umzuziehen, bevor man ihn auf sein großes Vergehen ansprach.
„Griselda hat recht“, sagte der Erzdiakon zu seiner Frau aus seinem Ankleidezimmer heraus. „Sie hatte immer recht. Ich habe noch nie eine junge Frau mit mehr Verstand als Griselda kennengelernt.“
„Aber du willst doch nicht sagen, dass du Henry auf jeden Fall sein Einkommen streichen würdest?“ Mrs. Grantly zog sich ebenfalls an und antwortete aus ihrem Schlafzimmer.
„Ich weiß es wirklich nicht. Als Vater würde ich alles tun, um eine solche Heirat zu verhindern.“
„Aber was, wenn er sie trotz deiner Drohung heiratet? Und das würde er, wenn er es einmal gesagt hat.“
„Ist das Wort eines Vaters dann nichts wert, und das eines Vaters, der seinem Sohn achthundert Pfund im Jahr zur Verfügung stellt? Wenn er dem Mädchen sagt, dass er ruiniert wäre, könnte sie ihn nicht daran festhalten.“
„Mein Lieber, sie wissen genauso gut wie ich, dass du nach drei Monaten nachgeben würdest.“
„Aber warum sollte ich nachgeben? Um Himmels willen!“
„Natürlich würdest du nachgeben, und natürlich würden wir die junge Frau hier aufnehmen, und natürlich würden wir das Beste daraus machen.“
Die Vorstellung, Grace Crawley als Tochter im Pfarrhaus von Plumstead zu haben, war für den Erzdiakon unerträglich, und er zeigte seine Ablehnung durch einen noch vehementeren Tonfall und indem er sich seiner geliebten Frau noch näherte. Ganz ohne Kleidung stand er in der Tür zwischen den beiden Räumen und versicherte seiner Frau lautstark, dass er sich niemals zu einer solchen Demütigung hinreißen lassen würde, wie sie es vorgeschlagen hatte. „Ich kann dir also sagen, dass ich, wenn sie jemals hierherkommt, dafür sorgen werde, dass ich nicht da bin. Ich werde sie hier niemals empfangen. Du kannst tun, was du willst.“
„Genau das kann ich nicht. Wenn ich tun könnte, was ich wollte, würde ich dem sofort ein Ende setzen.“
„Mir kommt es so vor, als wolltest du ihn ermutigen. Ein Kind von etwa sechzehn Jahren!“
„Mir wurde gesagt, sie sei neunzehn.“
„Was macht es schon aus, wenn sie neunundfünfzig wäre? Denk daran, wie sie erzogen wurde. Denk daran, was es bedeuten würde, wenn wir alle Crawleys für immer in unserem Haus hätten, mit all ihren Schulden und ihrer Schande!“
„Ich weiß nicht, ob sie jemals in Ungnade gefallen sind.“
„Du wirst schon sehen. Die ganze Grafschaft hat von der Sache mit den zwanzig Pfund gehört. Schau dir das liebe Mädchen oben an, das uns so viel Trost gespendet hat. Glaubst du, es wäre angemessen, dass sie und ihr Mann jemanden wie Grace Crawley an unserem Tisch treffen?“
„Ich glaube nicht, dass ihnen das irgendwie schaden würde“, sagte Mrs. Grantly. „Aber dazu wird es nicht kommen, da Griselda's Mann nie zu uns kommt.“
„Er war vorletztes Jahr hier.“
„Und ich war noch nie in meinem Leben so genervt von einem Mann.“
„Dann bevorzugst du wohl die Crawleys. Das ist das Ergebnis von Eleanors Erziehung.“ Eleanor war die Frau des Dekans und Mrs. Grantlys jüngere Schwester. „Es war mir immer ein Leid, dass ich Arabin in die Diözese geholt habe.“
„Ich habe dich nie gebeten, ihn zu holen, Erzdiakon. Aber niemand war so froh wie du, als er Eleanor einen Heiratsantrag machte.“
„Nun, kurz gesagt, ich werde Henry heute Abend sagen, dass er, wenn er sich mit diesem Mädchen lächerlich macht, nicht mehr auf mein Einkommen zählen kann. Er hat selbst etwa sechshundert Pfund im Jahr, und wenn er sich selbst ruinieren will, sollte er besser in den Süden Frankreichs oder nach Kanada oder wohin auch immer er will ziehen. Hierher soll er nicht kommen.“
„Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er das Mädchen nicht heiratet“, sagte Mrs. Grantly.
„Das sollte er besser nicht. Bei Gott, das sollte er besser nicht!“
„Aber wenn er es doch tut, wirst du ihm als Erste vergeben.“
Als er das hörte, knallte der Erzdiakon die Tür zu und zog sich in sein Badezimmer zurück. Im Moment war er echt sauer auf seine Frau, aber er war so an solche Wutausbrüche gewöhnt und wusste genau, dass sie eigentlich nichts bedeuteten, dass sie ihn nicht unglücklich machten. Der Erzdiakon und Mrs. Grantly waren nun seit mehr als einem Vierteljahrhundert verheiratet und hatten sich eigentlich nie gestritten. Er hatte tiefsten Respekt vor ihrem Urteilsvermögen und vertraute bedingungslos auf ihr Verhalten. Sie hatte ihn noch nie gekränkt oder ihn dazu gebracht, die Stunde zu bereuen, in der er sie zu Mrs. Grantly gemacht hatte. Aber sie hatte verstanden, dass sie das Privileg einer Frau mit ihrer Zunge nutzen konnte, und sie nutzte es – nicht ganz zu seinem Wohlgefallen. In diesem Fall war er umso verärgerter, als er das Gefühl hatte, dass sie Recht haben könnte. „Es wäre eine echte Schande, und ich würde ihn nie wieder sehen“, sagte er sich. Und doch wusste er, während er das sagte, dass er nicht die Charakterstärke hätte, einen längeren Streit mit seinem Sohn durchzustehen. „Ich würde sie nie wieder sehen – nie, nie!“, sagte er sich. „Und dann eine solche Chance, die er im Haus seiner Schwester haben könnte.“
Major Grantly war ein erfolgreicher Mann gewesen – mit einer Ausnahme: Er hatte die Mutter seines Kindes innerhalb eines Jahres nach seiner Heirat und wenige Stunden nach der Geburt des Kindes verloren. Als sehr junger Mann hatte er in Indien gedient und war mit dem Victoria-Kreuz ausgezeichnet worden. Dann hatte er eine Frau mit etwas Geld geheiratet und den aktiven Dienst in der Armee aufgegeben, mit dem einvernehmlichen Rat seiner eigenen Familie und der seiner Frau. Er hatte einen kleinen Posten in der Grafschaft seines Vaters angenommen, aber die Frau, für deren Wohlbefinden er dies getan hatte, war gestorben, bevor sie ihn sehen konnte. Trotzdem zog er dorthin, ging viel auf die Jagd und betrieb ein wenig Landwirtschaft, machte sich in der Gegend beliebt und hielt den guten Namen der Grantlys erfolgreich aufrecht, bis es ihm leider einfiel, sein wohlwollendes Auge auf die arme Grace Crawley zu werfen. Seine Frau war nun seit genau zwei Jahren tot, und da er noch keine dreißig war, konnte niemand leugnen, dass es richtig war, dass er wieder heiratete. Niemand bestritt das. Sein Vater hatte angedeutet, dass er das tun sollte, und großzügig geflüstert, dass er möglicherweise etwas tun könnte, wenn eine kleine Erhöhung des derzeitigen Einkommens des Majors nötig wäre. „Was nützt es, es zu behalten?“, hatte der Erzdiakon in liberaler Nachmittagsstimmung gesagt. „Ich will es nur für deinen Bruder und dich.“ Der Bruder war Geistlicher.
Und die Mutter des Majors hatte ihm dringend geraten, ohne Zeitverlust wieder zu heiraten. „Mein lieber Henry“, hatte sie gesagt, „du wirst nie wieder jünger sein, und Jugend ist doch etwas Wertvolles. Was die liebe kleine Edith angeht, so ist sie als Mädchen fast kein Hindernis. Kennst du die beiden Mädchen in Chaldicotes?“
„Was, Mrs. Thornes Nichten?“
„Nein, das sind nicht ihre Nichten, sondern ihre Cousinen. Emily Dunstable ist sehr hübsch, und was das Geld angeht ...!“
„Aber was ist mit ihrer Herkunft, Mutter?“
„Man kann nicht alles haben, mein Lieber.“
„Was mich betrifft, möchte ich lieber alles oder nichts haben“, hatte der Major lachend gesagt. Dass er danach an Grace Crawley dachte – an Grace Crawley, die kein Geld und keine besondere Herkunft hatte und nicht einmal schön war, zumindest laut Mrs. Grantly, die nicht einmal die übliche Ausbildung einer Dame genossen hatte –, war zu schade. Emily Dunstables Ausbildung hatte es an nichts gefehlt, und man rechnete damit, dass sie am Tag ihrer Hochzeit mindestens zwanzigtausend Pfund haben würde.
Der Kummer der Mutter war umso schmerzlicher, als sie sich mit einem kleinen Plan hinsichtlich Fräulein Emily Dunstable befasst hatte und anfangs, wie sie meinte, den Weg zum Erfolg klar vor sich sah – zum Erfolg trotz der abfälligen Worte, die ihr Sohn ihr gegenüber geäußert hatte. Das Haus der Thornes in Chaldicotes – oder, wie man wohl richtiger sagen sollte, das Haus von Dr. Thorne, denn Dr. Thorne war der Ehemann von Mrs. Thorne – war in jenen Tagen das angenehmste Haus in ganz Barsetshire. Niemand empfing so viele Gäste wie die Thornes, und niemand verstand es, so viel Geld auf so angenehme Weise auszugeben. Die großen Familien des Landkreises – die Pallisers und die De Courcys, die Luftons und die Greshams – waren zweifellos vornehmer, und einige von ihnen vielleicht auch wohlhabender als die Thornes von Chaldicotes – wie man sie nannte, um sie von den Thornes von Ullathorne zu unterscheiden; aber keine dieser Familien war so liebenswürdig im Umgang, so freigebig in ihrer Gastfreundschaft oder so ungezwungen in ihrer Lebensweise wie der Doktor und seine Frau. Als Chaldicotes, ein sehr altes Landgut, durch die Wechselfälle des Lebens in ihren Besitz gelangt war und von ihnen neu möbliert, neu dekoriert, neu bepflanzt, mit neuen Gewächshäusern und Warmwasseranlagen versehen worden war, hatten viele der alteingesessenen Familien des Landkreises zunächst die Nase über sie gerümpft. Die liebe alte Lady Lufton hatte dies getan und war sehr betrübt gewesen – ohne jedoch ein Wort über ihren Kummer zu verlieren –, als ihr Sohn und ihre Schwiegertochter sich von ihr abwandten und den Verlockungen der Frau des Doktors erlagen. Auch die Grantlys hatten sich zunächst zurückgehalten, zum Teil zweifellos beeinflusst durch ihre liebe und enge alte Freundin Fräulein Monica Thorne von Ullathorne, eine Dame der ganz alten Schule, die, so gut wie Gold und so gütig wie die Nächstenliebe sie auch war, es nicht ertragen konnte, dass eine dahergelaufene Mrs. Thorne, die nie einen Großvater gehabt hatte, im Landkreis zu Ehre und Ansehen gelangen sollte – einzig und allein wegen ihres Reichtums. Fräulein Monica Thorne hielt stand, aber Mrs. Grantly gab nach, und nachdem sie einmal nachgegeben hatte, stellte sie fest, dass Dr. Thorne, Mrs. Thorne, Emily Dunstable und das Haus Chaldicotes zusammen überaus reizvoll waren. Und der Major war einmal mit ihr dort gewesen, hatte sich sehr angenehm gezeigt, und es hatte sich zweifellos eine kleine, aufkeimende Liebesgeschichte zwischen ihm und Fräulein Dunstable angebahnt, über die Mrs. Thorne, die alles lenkte, sehr erfreut zu sein schien. Dies war geschehen, nachdem Mrs. Grantly zum ersten Mal den Namen Emily Dunstable gegenüber ihrem Sohn erwähnt hatte, aber noch bevor sie auch nur das leiseste Gerücht über seine Neigung zu Grace Crawley vernommen hatte; sie war daher berechtigt gewesen zu hoffen – ja beinahe zu erwarten –, dass Emily Dunstable ihre Schwiegertochter werden würde, und war umso mehr betrübt, als sich ihr plötzlich diese schreckliche Gefahr namens Crawley offenbarte.
Kapitel III.
An dem Abendessen im Pfarrhaus nahm nur die Familie Grantly teil. Die Marquise hatte in einem Brief mitgeteilt, dass sie es so bevorzugte. Der Vater hatte vorgeschlagen, die Thornes aus Ullathorne, sehr alte Freunde, und die Greshams aus Boxall Hill einzuladen, und hatte sogar versprochen, sich zu bemühen, die alte Lady Lufton ins Pfarrhaus zu holen, da Lady Lufton in früheren Jahren eine enge Freundin von Griselda gewesen war. Aber Lady Hartletop wollte lieber nur mit ihren lieben Eltern zusammen sein. Sie würde sich freuen, ihren Bruder Henry zu sehen, und hoffte, mit ihm einen kurzen Besuch in Hartlebury, dem Wohnort ihres Mannes in Shropshire, zu vereinbaren – zu diesem letzten Hinweis sei jedoch gleich gesagt, dass darüber nichts mehr gesprochen wurde, nachdem die Verbindung mit Crawley vorgeschlagen worden war. Und es gab noch einen sehr heiklen Punkt, den die Tochter in einer Bitte an ihren Vater angesprochen hatte, nämlich dass sie nicht aufgefordert werden möge, ihren Großvater, den Vater ihrer Mutter, Mr. Harding, einen Geistlichen aus Barchester, der mittlerweile hochbetagt war, zu besuchen. „Papa wäre nicht gekommen“, sagte Mrs. Grantly, „aber ich denke, ich denke wirklich ...“ Dann hielt sie inne.
„Dein Vater hat manchmal seltsame Ansichten, meine Liebe. Du weißt, wie gerne ich ihn hier habe.“
„Das macht nichts“, sagte Mrs. Grantly. „Lass uns nicht mehr darüber reden. Natürlich können wir nicht alles haben. Mir wurde gesagt, dass das Kind seine Pflicht in seinem Lebensbereich erfüllt, und ich denke, wir sollten damit zufrieden sein.“ Dann ging Mrs. Grantly in ihr Zimmer und weinte dort. Vor dem Abendessen wurde mit dem Major nichts über das unangenehme Thema der Crawleys gesprochen. Er traf seine Schwester im Salon und durfte ihre edle Wange küssen. „Ich hoffe, Edith geht es gut, Henry“, sagte die Schwester. „Sehr gut, und dem kleinen Dumbello geht es hoffentlich auch gut?“ „Ja, danke, sehr gut.“ Dann schien es nichts mehr zu geben, worüber die beiden reden konnten. Der Major erkundigte sich nie nach der hochrangigen Familie und ließ auch nicht erkennen, dass er sich von der Frau eines Marquis beeindruckt fühlte. Jede Bewunderung dieser Art, die Griselda erhielt, kam von ihrem Vater, und so hatte sie unbewusst gelernt, zu denken, dass ihr Vater besser erzogen war als die anderen Mitglieder ihrer Familie und von Natur aus besser geeignet, sich in diesem heiligen Kreis zu bewegen, in den sie selbst erhoben worden war. Wir brauchen uns nicht weiter mit dem Abendessen aufzuhalten, das eine langweilige Angelegenheit war. Mrs. Grantly bemühte sich, die Familienfeier genau so zu gestalten, wie sie auch verlaufen wäre, wenn ihre Tochter den Sohn eines benachbarten Gutsherrn geheiratet hätte, aber sie selbst war sich dieser Anstrengung bewusst, und die Tatsache, dass es eine Anstrengung war, führte zum Scheitern. Die Bediensteten des Pfarrers behandelten die Tochter des Hauses mit besonderer Ehrfurcht, und die Marquise selbst bewegte sich, sprach, aß und trank mit einer kühlen Würde, die ihr, wie ich glaube, zur zweiten Natur geworden war, die aber deshalb nicht weniger bedrückend war. Selbst der Erzdiakon, der an dem, was seiner Frau so unangenehm war, eine gewisse Freude hatte, war erleichtert, als er nach dem Abendessen mit seinem Sohn allein war. Er war erleichtert, als sein Sohn aufstand, um seiner Mutter und seiner Schwester die Tür zu öffnen, aber gleichzeitig war ihm bewusst, dass er vor einer äußerst schwierigen und möglicherweise katastrophalen Aufgabe stand. Sein lieber Sohn Henry war kein Mann, den man mit sanften Worten zu irgendetwas überreden oder von irgendetwas abbringen konnte. Er hatte seinen eigenen Willen und war bisher ein erfolgreicher Mann gewesen, der in seiner Jugend nur wenige jugendliche Probleme gehabt hatte – der seinen Vater nie dazu veranlasst hatte, strenge elterliche Autorität anzuwenden – und war nun nicht geneigt, sich zu beugen. „Henry“, sagte der Erzdiakon, „was trinkst du da? Das ist Portwein, aber er ist nicht ganz so, wie er sein sollte. Soll ich eine andere Flasche bestellen?“
„Für mich reicht es, Sir. Ich nehme nur ein Glas.“
„Ich trinke zwei oder drei Gläser Rotwein. Aber ihr jungen Leute seid so verzweifelt maßvoll geworden.“
„Wir trinken unseren Wein zum Abendessen, Sir.“
„Übrigens, wie gut Griselda aussieht.“
„Ja, das stimmt. Für Frauen ist es immer leicht, gut auszusehen, wenn sie reich sind.“ Wie würde dann Grace Crawley aussehen, die so arm wie die Armut selbst war und die arm bleiben würde, wenn sein Sohn dumm genug wäre, sie zu heiraten? Das waren die Gedanken, die dem Erzdiakon durch den Kopf gingen. „Ich halte nicht viel von Reichtum“, sagte er, „aber es ist immer gut, wenn die Frau oder Tochter eines Gentleman genug hat, um ihre Stellung im Leben zu behaupten.“
„Das Gleiche gilt doch für die Frau und die Tochter eines jeden, Sir.“
„Du weißt, was ich meine, Henry.“
„Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das tue, Sir.“
„Vielleicht sollte ich es gleich offen sagen. Deine Mutter und ich haben ein Gerücht gehört, das wir zwar nicht glauben, das uns aber trotzdem unglücklich macht, selbst wenn es nur ein Gerücht ist. Man sagt, dass es in Silverbridge eine junge Frau gibt, der du dich immer mehr näherst.“
„Gibt es einen Grund, warum ich mich nicht in eine junge Frau in Silverbridge verlieben sollte? – Obwohl ich hoffe, dass jede junge Frau, in die ich mich verlieben könnte, es auf jeden Fall wert ist, als junge Dame bezeichnet zu werden.“
„Das hoffe ich, Henry, das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich.“
„So viel verspreche ich dir, Sir, aber mehr kann ich nicht versprechen.“
Der Erzdiakon sah seinem Sohn ins Gesicht, und sein Herz sank ihm in die Hose. Die Stimme und die Augen seines Sohnes schienen ihm zwei Dinge zu sagen. Sie schienen ihm erstens zu sagen, dass das Gerücht über Grace Crawley wahr war, und zweitens, dass der Major entschlossen war, sich seine Torheit nicht ausreden zu lassen. „Aber du bist doch mit niemandem verlobt, oder?“, fragte der Erzdiakon. Der Sohn antwortete zunächst nicht, woraufhin der Vater seine Frage wiederholte. „Angesichts unserer beider Positionen, Henry, finde ich, du solltest mir sagen, ob du verlobt bist.“
„Ich bin nicht verlobt. Wenn ich es wäre, hätte ich die erste Gelegenheit genutzt, um es dir oder meiner Mutter zu sagen.“
„Gott sei Dank. Jetzt, mein lieber Junge, kann ich mich klarer ausdrücken. Die junge Frau, deren Namen ich gehört habe, ist die Tochter von Herrn Crawley, dem ewigen Vikar in Hogglestock. Ich wusste, dass da nichts dran sein konnte.“
„Aber es ist doch was dran, Sir.“
„Was ist daran dran? Halte mich nicht auf die Folter, Henry. Was meinst du damit?“
„Es ist ziemlich schwierig, bei einem solchen Thema so ins Kreuzverhör genommen zu werden. Wenn du sagst, dass du dankbar bist, dass an dem Gerücht nichts dran ist, muss ich dich unterbrechen, da du sonst später vielleicht behaupten könntest, ich hätte dich getäuscht.“
„Aber du hast doch nicht vor, sie zu heiraten?“
„Ich habe jedenfalls nicht vor, mich dazu zu verpflichten, es nicht zu tun.“
„Willst du mir etwa sagen, Henry, dass du in Fräulein Crawley verliebt bist?“ Dann folgte eine weitere Pause, während der der Erzdiakon schweigend dasaß und auf eine Antwort wartete; doch der Major sagte kein Wort. „Soll ich also annehmen, dass du beabsichtigst, dich herabzuwürdigen, indem du ein junges Mädchen heiratest, das unmöglich irgendeinen der Vorzüge einer standesgemäßen Erziehung genossen haben kann? Ich sage nichts über die Unklugheit dieser Verbindung; nichts über ihren Mangel an Vermögen; nichts darüber, dass du eine ganze Familie erhalten müsstest, die in bitterer Armut lebt; nichts über die Schulden und den Ruf des Vaters, auf dem, wie ich höre, im Augenblick ein sehr schwerwiegender Verdacht lastet – ein Verdacht auf – auf – auf etwas, das ich leider wohl beim Namen nennen muss: schlichten Diebstahl.“
„Eindeutiger Diebstahl, ganz sicher, wenn er schuldig wäre.“
„Ich sage nichts von all dem; aber wenn man die junge Frau selbst betrachtet ...“
„Sie ist einfach das gebildetste Mädchen, das ich je kennengelernt habe.“
„Henry, ich habe das Recht zu erwarten, dass du ehrlich zu mir bist.“
„Ich bin ehrlich zu dir.“
„Willst du dieses Mädchen fragen, ob sie dich heiraten will?“
„Ich finde, du hast kein Recht, mir diese Frage zu stellen, Sir.“
„Ich hab auf jeden Fall das Recht, dir zu sagen, dass ich, wenn du dich und mich so sehr blamierst, mich verpflichtet fühle, dir alle Unterstützung zu entziehen, die dir durch meine – meine – meine weitere Hilfe zuteilwerden würde.“
„Willst du mir damit sagen, dass du mir mein Einkommen strecken wirst?“
„Auf jeden Fall.“
„Dann, Sir, würden Sie sich mir gegenüber äußerst grausam verhalten. Sie haben mir geraten, meinen Beruf aufzugeben.“
„Nicht, damit du Grace Crawley heiraten kannst.“
„Ich beanspruche das Recht eines Mannes meines Alters, in einer Angelegenheit wie der Heirat zu tun, was mir gefällt. Miss Crawley ist eine Dame. Ihr Vater ist Geistlicher, genau wie meiner. Der älteste Freund ihres Vaters ist mein Onkel. Es gibt nichts auf der Welt, was gegen sie spricht, außer ihrer Armut. Ich glaube, ich habe noch nie von einer solchen Grausamkeit seitens eines Vaters gehört.“
„Na gut, Henry.“
„Ich habe mich immer bemüht, meine Pflicht dir gegenüber zu erfüllen, Sir, und auch meiner Mutter gegenüber. Du kannst mich so behandeln, wenn du willst, aber das wird keinen Einfluss auf mein Verhalten haben. Du kannst mir morgen mein Taschengeld streichen, wenn du möchtest. Ich hatte mich noch nicht entschlossen, Miss Crawley einen Antrag zu machen, aber ich werde es nun morgen früh tun.“