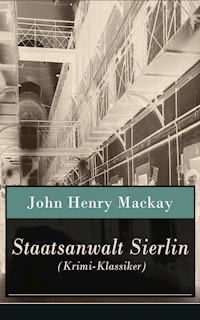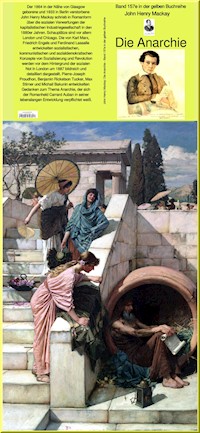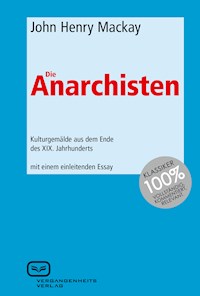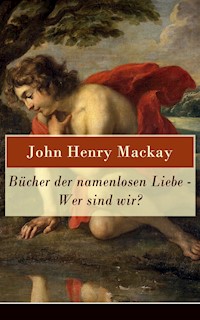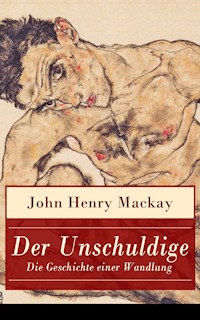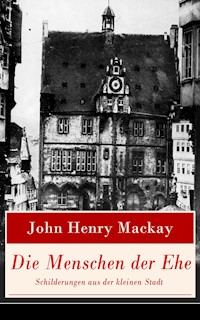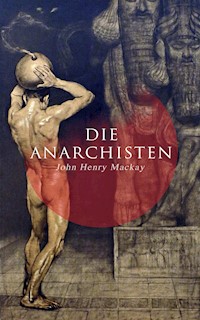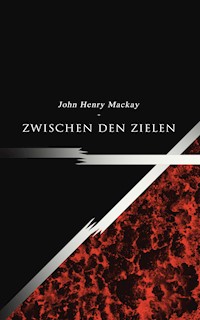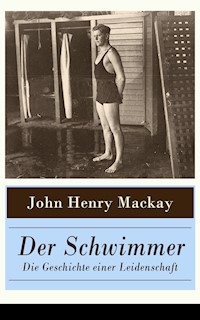15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer namenlosen Liebe aus der Friedrichstraße schildert ein Jahr im Leben des 15-jährigen Ausreißers Günther, der beginnt, als Strichjunge zu arbeiten. Erzählt wird aus der Sicht des Buchhändlers Hermann Graff, der sich in Günther verliebt und sich durch die daraus erwachsenden Schwierigkeiten – für Günther ist er nicht mehr als ein Freier – zunehmend über seine sexuellen Neigungen klarer wird. John Henry Mackay lebte ab 1892 in Berlin und kannte die Welt, die er in "Der Puppenjunge" beschrieb, aus eigener Erfahrung. Magnus Hirschfeld lobte an dem Roman die "formvollendete Sprache" und den "tiefen psychologischen Gehalt". Christopher Isherwood bekannte noch 1985 beim Erscheinen der englischen Übersetzung (The Hustler), er habe das Buch »immer sehr geliebt« – es zeichne, wie er aus eigener Erfahrung wisse, trotz mancher melodramatischen Übersteigerung ein authentisches Bild der sexuellen Unterwelt Berlins. Bekannt wurde John Henry Mackay (1864 –1933), der deutsche Dichter mit dem schottischen Namen, als Biograf und Wiederentdecker von Max Stirner sowie als Autor von Romanen wie "Die Anarchisten" und "Der Schwimmer". Anfang des 20. Jahrhunderts verfasste er außerdem unter dem Pseudonym Sagitta eine Reihe kleinerer "Bücher der namenlosen Liebe", auf die 1926 der Roman "Der Puppenjunge" folgte, der durch seine lebendigen Beschreibungen der schwulen Halbwelt Berlins bestach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ich singe die Liebe, die Ihr begraben,
Die Ihr in Acht gethan und in Bann!
Ich singe die Liebe des Mannes zum Knaben,
Die Liebe des Knaben sing’ ich zum Mann.
SAGITTA
JOHN HENRY MACKAY (1864-1933), der deutsche Schriftsteller mit dem schottischen Namen, in Greenock bei Glasgow geboren, aber in Deutschland aufgewachsen, lebte ab 1892 in Berlin, wo er 1933 starb.
Ab 1905 verfaßte er unter dem Pseudonym SAGITTA seine BÜCHER DER NAMENLOSEN LIEBE (Gesamtausgaben 1913 und 1924), denen 1926 der Roman DER PUPPENJUNGE. Die Geschichte einer namenlosen Liebe aus der Friedrichstraße folgte.
JOHN HENRY MACKAY
(SAGITTA)
Der Puppenjunge
Die Geschichte einer namenlosen Liebeaus der Friedrichstraße
Mit einen Nachwort vonHubert Kennedy
Männerschwarm Verlag
Bibliothek rosa WinkelBand 17
Die Originalausgabe erschien 1926als »siebentes in der Reihe von
Sagittas Büchern der namenlosen Liebe«als »Privat-Ausgabe«.
Die orthographischen Eigenheitensind beibehalten.
Umschlaggestaltung:Carsten Kudlik (Bremen)
© 2022 Männerschwarm Verlag
Salzgeber Buchverlage GmbH
Prinzessinnenstraße 29 – 10969 Berlin
Druck: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISSN 0940–6247
ISBN 978-3-86300-349-4
»Wenn sich einmal Einer in mich verlieben würde,den würde ich aber ordentlich hochnehmen!« –
Ausspruch des Puppenjungen und Zuhälters
Arthur Klemke, genannt ›der feine Atze‹,
aus der Friedrichstraße in Berlin.
»Trotter, trotter ... toujours trotter! ...«
Ausspruch des Petit Jésus André Devie
von den großen Boulevards in Paris.
Inhalt
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Vierteil Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Fünfter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Hubert Kennedy
ERSTER TEIL
1
Pünktlich zur festgesetzten Zeit lief der aus dem Norden des Reiches kommende Vier-Uhr-Nachmittagszug in die Halle des Stettiner Bahnhofs ein.
Die Reisenden entquollen ihm, drängten und stauten sich an den Sperren, verteilten sich – erwartet oder nicht erwartet – in dem weiten Raume, um endlich in dünnen Strömen von den verschiedenen Ausgängen aufgesogen zu werden und in dem Leben dort draußen unterzutauchen und zu verschwinden.
Die Halle lag wieder leer, wie eine halbe Stunde zuvor.
Nur in ihrer Mitte stand noch wie verloren ein Junge von etwa fünfzehn oder sechzehn Jahren und blickte unschlüssig um sich. Er trug einen grauen, schlechtsitzenden und zerknitterten Anzug, plumpe Stiefel, eine gelbe Sportmütze und in der Hand einen vielfach mit Bindfaden umschnürten Pappkarton.
Endlich schien er gefunden zu haben, was er suchte. Entschlossen ging er auf die Aufbewahrungsstelle für Handgepäck zu, gab sein Stück ab, wurde, als er gleich bezahlen wollte, prompt – denn er war jetzt in Berlin – angeschnarrt: »Erst beim Abholen!« und stand eine Minute später am Eingang des Bahnhofs, die große Stadt und ihr brausendes Leben vor sich.
Wieder zögernd und noch wartend. Denn was er hier sah, dies Fluten und Treiben der Menschen; dies Gewirr von Fuhrwerken aller Art; dies Lärmen und Toben, alles getaucht in den Dunst von Rauch und die Schwüle dieses Frühlings-Nachmittags, war ihm völlig neu und betäubte ihn.
Aber nicht allzu lange.
Wie vorhin raffte er sich auf, wandte sich instinktiv nach rechts und setzte entschlossen seinen Fuß auf das Pflaster Berlins, das von diesem Augenblick an für die Zeit des nächsten Jahres seine eigentliche Heimat werden sollte.
Er ließ sich drängen und stoßen, gelangte in eine Straße, die so lang war, daß sie nie ein Ende zu haben schien, bog in sie ein, blieb vor jedem vierten Laden stehen, ließ sich weiter treiben und schieben, um endlich, wie gebannt, vor der Auslage eines Herrenausstattungsgeschäftes stehen zu bleiben. Dort lagen unter einer Unmenge anderer herrlicher Dinge auch Strohhüte. So einen, er fühlte es, mußte er haben. Aber welchen? – Den mit den dicken Rippen oder den mit dem bunten Bande? – Der Preis war bei beiden angeschrieben und der gleiche: drei Mark. Er konnte sich nicht entschließen. Beide gefielen ihm. Dann siegte der bunte.
So nahm er denn all den Mut zusammen, der ihm seit seiner Flucht von gestern noch geblieben, rollte seine gelbe Mütze in die Seitentasche seines Jackets und wies dem jungen Verkäufer wortlos das Gewünschte. Der Hut wurde ihm aufgestülpt, paßte und wurde sein.
Glücklich wieder draußen, betrachtete er sich noch eine Zeit lang in dem Spiegelfenster des Ladens, fand sich schön und trottete befriedigt weiter.
Diese Straße nahm tatsächlich kein Ende. Er ging und ging; blieb stehen, ging weiter; kam an eine breite Brücke, an der gebaut wurde; sah ein schwarzes Wasser unter ihr, eine mächtige Bahnhofshalle sich über die Straße spannen; sah diese enger und enger werden, um sich dann ganz plötzlich nach rechts und links in eine ganz breite und freie, mit Bäumen in der Mitte und hohen Häusern zu beiden Seiten, zu weiten – er war unter den Linden.
Es war noch früh am Tage, kaum sechs, und noch ganz hell. Die breite Straße war in ihrer Mitte und besonders an ihrer Südseite belebt und alle Bänke zwischen den Bäumen an diesem herrlichen Frühlingsnachmittag von Menschen besetzt.
Der Junge fand noch einen Platz auf der äußersten Ecke einer der Bänke. Er war nun müde von der langen Bahnfahrt, dem Weg durch die fremden Straßen bis hierher, von all dem Neuen und Ungewohnten.
Zwischen den Droschken, die dicht vor ihm auf dem Fahrdamm hielten, durch sah er in das unaufhörliche Fluten der Automobile, die sich hier stauten, wenn die Durchfahrt in die Friedrichstraße für einen Augenblick gesperrt war. Sie hielten und zogen wieder an, glitten dahin und verschwanden; und ihre Hupen tönten grausig. Omnibusse, schwer mit Menschen beladen, hielten und schwankten weiter um die Ecke, ungeheuren Tieren ähnlich, die sich ihren Weg durch das Gewimmel von Kleinzeug bahnten. Motor- und Fahrräder aber flitzten nur so durch das Gewoge und der Junge staunte und starrte und konnte sich nicht genug wundern, daß sie und die Menschen, die so sorglos zwischen allen durch über den Damm gingen, nicht zermalmt wurden unter diesen dicken Rädern von Eisen und Gummi.
Als er sich satt gesehen, blickte er auf. Ein mächtiges, gelbes Haus lag ihm gerade gegenüber. Als seine Augen an ihm niederglitten, las er über seinem Eingang – dem Eingang zu einer hohen Halle, wie es schien – auf einem Halbbogen in schwarzen Buchstaben das Wort PASSAGE.
Passage! – Das Wort hatte er schon einmal gehört, und kein Anderer als Max, Max Friederichsen, konnte es ihm genannt haben (an jenem Nachmittag). Der hatte immerzu von der Friedrichstraße und der Passage gesprochen und dabei so merkwürdig gelächelt ...
Er beugte sich vor, um besser sehen zu können. Ja, es war offenbar der Eingang zu einer anderen Straße. Menschen strömten in Massen hinein und wieder heraus und standen dort umher.
Er wollte doch einmal sehen, wohin man kam, wenn man da hinein ging.
Er erhob sich, mußte warten, bis der Verkehr die Überschreitung des Fahrdamms gestattete und betrat nun die Halle. Denn eine Halle war es, wie er nun sah, sehr hoch und über ihr ein Dach von Glas. An ihren beiden Seiten lagen Verkaufsläden.
Mit ihrer Besichtigung begann er zunächst wieder. Die ersten interessierten ihn nicht. Schokolade und Zigarren gab es auch anderswo. Dann aber, gleich rechts, wo die Menschen sich zu Knäueln ballten, tat sich ihm eine unerhörte Pracht auf: da standen und hingen hinter hohen Scheiben wunderbare Bilder, deren Farbenglanz das Auge blendete: Bilder von schönen Frauen und stolzen Männern in kostbaren Gewändern und bunten Uniformen, von süßen Kindern und holden Mädchen. Und: ganz im Hintergrunde erhob sich – er hatte sich durchgedrängt, um Alles sehen zu können – magisch beleuchtet, ganz in Weiß und über Menschenmaß hinaus, die hehre Gestalt eines Weibes mit blondem Haar, einer Krone auf dem Haupte, Schild und Schwert in den Händen, und blickte siegreich in die Ferne. Er wußte nicht, was sie vorstellen sollte. Aber das wußte er, daß es das Schönste war von Allem, was er heute und überhaupt jemals gesehen und er konnte sich gar nicht trennen von dem bezaubernden Anblick.
Endlich riß er sich doch los und ging weiter. Nach Dem, was er eben gesehen, vermochten ihn die Läden nicht mehr so zu reizen.
Nur vor einem mit seltsamen Geräten und kleinen Maschinen, Drähten und Spiralen und fremden und unverständlichen Namen auf den Preiszetteln stand er wieder lange, ohne zu begreifen, was diese Apparate bedeuteten.
Was drückten und drängten aber die Menschen hier so? – Das war ja noch schlimmer, als in der Straße vorhin. Und was wollte denn der Kerl nur von ihm, der nun schon die ganze Zeit neben ihm stand und immer vor sich hin zu sprechen schien? – Immer wieder, wenn er abrückte, stellte er sich wieder neben ihn und stieß ihn, absichtlich oder unabsichtlich, mit dem Ellbogen an, ihn dabei von der Seite anschielend. Ein ekelhafter Kerl mit hohlen Augen und vorstehenden Backenknochen.
Der Junge verließ das Schaufenster mit den unverständlichen Dingen und ging auf die andere Seite hinüber. Da war ein Kasten mit Zaubergeräten: Würfelbechern, geheimnisvollen Kartenspielen, einem Totenschädel – solchen Dingern, mit denen einmal auf dem Dorfe ein herumziehender Magier und Gaukler sie ergötzt hatte. Daran mußte er denken, als er sie hier vor sich sah.
Aber gestoßen wurde er auch hier. Da stand wieder Einer dicht neben ihm. Nicht der von eben, sondern ein Großer, Dicker, der zwar Nichts sagte, aber ihn vertraulich anlächelte. Was wollte der nun wieder von ihm? – Es wurde ihm ganz unheimlich zumute.
Wieder ging er weiter, nun in der Mitte der hastenden, treibenden Menschenflut. Die Halle machte einen Knick und weitete sich oben zu einer hohen Kuppel: ein Café mit einem Vorbau lag hier. Musik drang heraus. Er blieb stehen, um zuzuhören.
Und wieder war ihm, als stünde Jemand neben oder hinter ihm und schaue ihn an. Er wagte schon gar nicht mehr, aufzusehen, aus Angst, wieder diesen Blicken zu begegnen. – Was wollten nur alle diese Menschen von ihm – es konnte ihn doch keiner kennen! – Wurde er schon verfolgt? – Aber das war ja nicht möglich. Wer sollte wohl wissen, daß er hier war!
In diesem Gefühl von Unbehaglichkeit und Angst dachte er jetzt nur noch daran, so schnell wie möglich aus diesem Durchgang herauszukommen und strebte dem anderen Ausgang zu, der sich ihm schon zeigte. Aber so schnell kam er nicht vorwärts in dem Gewühl.
Endlich war er erreicht und die Straßen öffneten sich wieder vor ihm. Er stand still, nahm seinen neuen Hut ab und trocknete sich mit seinem schmutzigen Taschentuch die Stirn. Hier war er nun wohl sicher.
Aber nein: wie er aufsah, fühlte er wieder einen Blick auf seinem Gesicht, den Blick eines noch jungen Menschen, der dicht vor ihm stand und ihn ansah, nicht böse, nicht zudringlich, auch nicht lächelnd oder fragend, aber so unverhohlenerregt, so, als wolle er ihn im nächsten Augenblick ansprechen, daß ihn von Neuem die Angst ergriff und er, Hut und Tuch noch in der Hand, zu laufen anfing. Er lief über die Straße, zwischen den Autos durch, auf den Eingang der gegenüberliegenden Untergrundbahn zu, an diesem vorbei wieder über den Damm, die Straße drüben hinunter, weiter und weiter, ohne auf- oder sich umzusehen, als würde er verfolgt; lief durch eine Nebenstraße und immer noch so weiter, bis er endlich auf einem großen Platze landete, vor einem hohen Gebäude und neben einer niedrigen, freistehenden Kirche.
Da machte er endlich Halt und sah sich um. Aber Niemand schien ihm zu folgen. Bänke standen herum. Aber er setzte sich nicht. Er ging weiter und weiter, immer neue Straßen hinunter, bis er sich in einer ganz stillen und fast menschenleeren befand. Wieder sah er sich um. Nein, kein Mensch ging ihm nach. Er war ganz allein hier.
Langsamer und nun beruhigt schritt er weiter. Er kam wieder über einen großen Platz, über eine Brücke, in immer neue Straßen, aber engere und ärmlichere, und fühlte plötzlich Hunger. In ein Lokal zu gehen, traute er sich nicht. Sie sahen alle so unheimlich aus, und durch die offenen Türen sah er, wie überall an den Schanktischen bei den Eingängen lärmende und trinkende Männer herumstanden. Nur in dem nächsten Bäckerladen kaufte er sich ein paar Brötchen und kaute sie im Weiterbummeln auf.
Nun sollte er doch wohl Max aufsuchen. – – Aber dafür war es heute fast schon zu spät geworden. Und wie sollte er die Straße finden, wo er wohnte? – Sie lag gewiß weit weg, ein paar Stunden weit weg. Das konnte er heute nicht mehr schaffen mit seinen müden Füßen.
Geschlafen hätte er jetzt gern. Zum Bahnhof zurück? – Dort lagen Hotels, wie er gesehen. Aber es mußte doch auch noch in anderen Gegenden von Berlin solche geben.
Er fing an, auf die Schilder der Häuser zu achten. Nicht lange und er las über der Tür eines alten und schmalen: Gasthaus. In ihr stand ein Mann mit einer Schürze und in Hemdsärmeln. Zögernd trat der Junge näher.
Ob er wohl hier schlafen könne? –
Schlafen? – Warum denn nich? – »Haste denn Geld, Kleener?«
Ja, er hätte Geld.
»Wieviel denn?«
Dann, als keine Antwort kam, mit einem lauernden Seitenblick: »Kannste fünf Märker zahlen?«
Ein Erschrecken erst: Fünf Mark! – Aber dann ein bejahendes Nicken.
»Na, dann komm’ mal mit ...«
Er wurde zwei Treppen höher in ein kleines Loch geführt, wo außer einem wackligen Bett und einem ebensolchen Stuhl nur noch eine Art Waschtisch aus Blech stand, gab einen Fünfmarkschein in eine rote, schmutzige Faust und war allein.
Todmüde nun von dem langen und aufregenden Tage, streifte er Jacket, Hose und Stiefel ab und war in dem unsauberen Bett eingeschlafen, bevor er noch Zeit gefunden, sich über die unverschämte Nepperei dieses Viehs von einem Wirt recht klar zu werden.
2
An demselben Tage, und – wie der Zufall es so wollte – fast um dieselbe Stunde, traf auf einem anderen großen Bahnhof Berlins, dem Potsdamer, weit aus dem Süden Deutschlands kommend, ein anderer Reisender ein: ein junger Mann von vielleicht zwei–, dreiundzwanzig Jahren. Auch er kam zum ersten Mal hierher, fand sich aber – aus Büchern und Plänen im Voraus mit den hauptsächlichsten Verkehrsadern und Plätzen der Hauptstadt vertraut – schnell und sicher zurecht. Fast Alles kam ihm, nachdem er sich im Fürstenhof, wo er ein kleines Zimmer im obersten Stock genommen, gewaschen und umgekleidet – fast Alles kam ihm, wie er nun langsam dahinging, bekannt, ja vertraut vor: der belebte Platz, der einzigartige Bau des Warenhauses in der Leipziger Straße, vor dem er lange stand, der Tiergarten und natürlich auch das herrliche Tor mit der Flucht der Bäume und Häuser – den Linden ...
Er beeilte sich nicht, sie zu betreten. Lange erst saß er, kaum ermüdet, denn die Reise war zwar lang, aber angenehm gewesen, auf einem der Stühle an dem nahen See und genoß die Nachmittagsstunde dieses schon so warmen Frühlingstages. Das erste, zarte Grün der Bäume, die milde Süßigkeit der Luft und das beglückende Gefühl, nun endlich in der großen Stadt zu sein, nach der er sich heimlich schon so lange gesehnt – ohne daß er zu sagen gewußt hätte, warum eigentlich – alles dies erfüllte ihn mit einer inneren Heiterkeit, die seinem ernsten Wesen sonst fast fremd war.
Nach einer Stunde erhob er sich, durchschritt das Tor und ließ seinen Blick die breite Straße hinuntergleiten. Die Linden lagen vor ihm in ihrer ganzen Länge. Sie waren anmutig in dem neuen, frischen Gewand ihrer Bäume, wenn er sie sich auch, ebenso wie die Häuser, größer, majestätischer gedacht hatte. Froh, wie immer beim Anblick von Schönem, schritt er sie hinab.
Der Menschen- und Wagenverkehr war lebhaft, aber ebenfalls nicht überwältigend. Herrlich aber ein Blumenladen in seiner ganzen, verschwenderischen Pracht; und durchaus bester Geschmack ein ganz kleiner dicht neben ihm, für eine einzige Sorte von Parfüm.
Er stand vor ihnen, hielt sich dann aber doch lieber in der Mitte, wo die Ellbogenfreiheit größer war und man die schöne Straße nach ihren beiden Seiten und an ihr weites Ende besser übersehen konnte.
Nach einer Wanderung, die ihm nur ein paar Schritte dünkte, sah er die lange und enge Straße, die die Breite der Linden hier schnitt, und wußte sofort, daß er nun die Friedrichstraße erreicht hatte. Er verspürte nicht geringste Lust, sich in ihren, hier nun wirklich dichten und lauten Verkehr zu stürzen, sondern setzte sich, etwas abseits, auf einen der vermietbaren Klappstühle und ließ ihn so an sich vorübertreiben.
Er wäre wohl noch länger sitzen geblieben, wenn ihn nicht das Gebahren der neben ihm Sitzenden aufgescheucht hätte: junge Burschen und Mädchen, laut lachend und kreischend, als seien sie hier allein. Ihre Worte und Gesten waren von solcher unverhüllten Gemeinheit, daß er sich bald wieder angewidert erhob.
Sein Blick fiel dabei in den Durchbruch des Hauses ihm gegenüber und es bedurfte für ihn kaum einer Bestätigung, als er sich sagte, daß dies die ›Passage‹ sein mußte.
Auch von ihr hatte er gelesen. In anderen Büchern. Es war die berüchtigte Passage, der Sammelpunkt eines gewissen Teils der Berliner Bevölkerung zu allen Tag- und Nachtzeiten. Nicht neugierig, denn er wußte, daß er dort nicht finden würde, was er suchte – (und suchen wollte, bis er es fand) –, aber doch etwas gespannt, ging er hinüber; war durchaus nicht erstaunt, den Eingang von jungen Burschen im Alter von siebzehn bis zwanzig Jahren bevölkert zu finden; streifte ihre Gesichter, die ihm teils abgelebt und gierig, teils roh und gemein erschienen mit einem flüchtigen Blick; sah, wie dieser Blick von Einzelnen sofort verständnisinnig und antwortend erwidert wurde; und schritt, ohne sich weiter um die Herausforderungen zu kümmern, umwogt von dem Menschengedränge, in die Halle hinein.
Sie erschien ihm zwar hoch, aber weder schön noch hell. Die Auslagen der Läden waren meist dürftig, verglichen mit den eben gesehenen, voll billigen Kleinkrams und unelegant. Unelegant auch das Publikum hier.
Vor einem der Läden schoben und drängten sich die Massen.
Über ihre Schultern warf er einen Blick in die hellerleuchteten Fenster, schauderte sofort zurück und hätte dann am Liebsten laut aufgelacht. Denn was er da gesehen, das waren Bilder: ›Gemälde‹ von solcher berückenden Farbenpracht und berauschenden Schönheit, daß das Auge erstarrte. Dieser junge, überirdisch schöne Offizier, an dessen Brust sich die schluchzende Braut im Weh des Abschieds schmiegte, indem sie ihm Veilchen an die ohnehin schon so blaue Uniform nestelte; dieser edle Greis in Schlapphut und Vollbart mit den noch feurigen Augen in dem dämlichen Schafsgesicht; und dann dort im Hintergrunde diese Germania – das hehre Weib mit Schwert und Schild – es war überwältigend! – Und die Menschen wichen und wankten nicht! –
Alle Wetter! – dachte er im Weitergehen – und sein sonst so ernstes Gesicht überflog ein belustigtes Lächeln – wenn das der Geschmack der Berliner ist! ...
Er hatte bereits genug von dieser berühmten Passage und was er noch sah, ließ ihn nur noch schneller gehen. Überall an den Seiten standen Gestalten, verdächtige und wenig sympathische, Bummler und Nichtstuer offenbar, entweder heruntergekommen oder schäbig-elegant, die hier ihre Zeit totschlugen oder ihren gewiß recht unsauberen Geschäften nachgingen. Und wieder überall merkwürdig viele junge Gesichter, lauernd und wie wartend und sich dabei doch in die Ecken und vor die Läden drückend, als wollten sie nicht gesehen werden.
Er wollte hinaus und drängte sich schneller durch den Menschenstrom.
– Und da geschah es:
Vor ihm her ging – hastig, wie er selbst – und offenbar von demselben Wunsche getrieben, möglichst schnell den Ausgang an der anderen Seite zu gewinnen, ein Knabe von fünfzehn oder sechzehn Jahren. Seine Kleidung: der schlechtsitzende, grobe Anzug und die schweren Stiefel paßten nicht zu dem leichten Gang und der ganzen, zarten und noch unentwickelten Gestalt. Auf den schmalen Schultern erhob sich ein dünner Hals mit braunen Haaren im Nacken – gegen seinen Willen seltsam angezogen und plötzlich wie willenlos vermochte der junge Mann dicht hinter ihm keinen Blick mehr von diesem Halse zu wenden und in dem Wunsche, ihn nicht aus den Augen zu verlieren: das Gesicht zu sehen, das diese Schultern trugen, schob er sich hastiger durch das Gewühl.
Sie verschwanden, die Schultern, tauchten unter. Er ging noch schneller, sah sie wieder vor sich – der Ausgang öffnete sich.
Er sah, wie der Junge unschlüssig stehen blieb, den ganz neuen Strohhut abnahm und sich mit einem aus der Tasche gezogenen, zu einem schmutzigen Klumpen geballten Taschentuch die heiße Stirn trocknete.
Er mußte, er mußte dies Gesicht sehen! – Drei Schritte weiter und er stand nun dicht vor ihm.
Der Junge sah auf. Ein Ausdruck gequälten Erschreckens ging über seine Züge. Dann: jäh, mit einer heftigen Bewegung, wandte er sich um, lief mehr, als er ging, hinaus, über den Bürgersteig, über die Straße und verschwand, immer laufend und laufend, wie verfolgt, drüben in dem Schwarm der Passanten.
Der junge Mann stand wie erstarrt. Die Stelle, wo der Knabe eben gestanden, war leer. Andere Menschen um ihn herum stießen und drängten, schoben ihn fort.
Ein anderes Gesicht tauchte dicht vor ihm auf: ein freches, junges mit aufdringlichem Grinsen, herausfordernd und dreist fragend in das seine starrend. Einer der Bengels vom Eingang, der ihm bis hierher nachgegangen war? ...
Widerlich! – widerlich! – dachte er und scheuchte es mit unwilliger Gebärde fort.
Sein erstes Gefühl war gewesen: dem fremden Jungen nachzugehen, ebenfalls über die Straße hinüber. Sein zweites: unmöglich! –
Nun war er fort. Verschwunden dort drüben! ...
Es blieb Nichts übrig, als weiterzugehen.
Noch immer zögernd bog er nach rechts in die stillere Straße ein und schritt sie langsam hinunter.
Sein Herz schlug. Er fühlte ein Erzittern in sich, wie nach einem jähen Schreck. Aber warum und wovor? Was war denn geschehen? – Doch Nichts.
Er sah ganz deutlich das kleine und blasse Gesicht vor sich, das eben für den Bruchteil einer Minute, für eine Sekunde nur, vor ihm aufgetaucht war.
Er sah es mit vollkommener Deutlichkeit: die graublauen Augen, die zu ihm emporgesehen mit einem Ausdruck – ja, mit welchem Ausdruck doch nur? – Der Angst? – Nein, nicht grade der Angst, aber mit ganz ersichtlichem Erschrecken, einer offenbaren Furcht; er sah die roten, vollen Lippen, von denen die obere so seltsam aufgezuckt hatte; und blondes, fast mehr braunes, wirres Haar über einer heißen Stirn – ein kleines, schüchternes, durch irgend Etwas verängstigtes Gesicht! ...
Er blieb stehen und legte die Hand über die Augen, als vermöge er so, es sich noch deutlicher zurückzurufen. Umsonst. An mehr, als das, konnte er sich nicht erinnern. Zu flüchtig war die Sekunde gewesen. Er ließ die Hand wieder fallen.
Da aber, noch immer auf demselben Fleck, verspürte er einen jähen Schmerz. In der Stirn? – In der Brust? – Er war schon wieder vorbei, wie er weiterging.
Aber seine Gedanken arbeiteten weiter und wie immer, wenn er in ihnen gefangen war, hielt er den Kopf gesenkt beim Weiterschreiten, die Straße hinab.
Was war das gewesen – warum war er so plötzlich fortgelaufen? – Warum war er vor ihm fortgelaufen? –
Und was war – er kam nicht los davon – das für ein Ausdruck gewesen, mit dem er zu ihm aufgesehen? – Des Schreckens – zweifellos. Aber noch ein Anderes hatte in ihm gelegen. Etwas Kläglich-Bittendes. Etwas, als wolle er sagen: aber so laßt mich doch in Frieden! – Was habe ich Euch denn getan, daß ihr mich nicht in Ruhe laßt! – Was wollt Ihr denn nur von mir? – –
Er wurde nicht klug daraus. Aus dem Ganzen. Nur das Eine stand fest: es war ganz offensichtlich ein anständiger Junge gewesen. Ein fremder Junge, der sich in die Passage verirrt, dann gemerkt hatte, wo er war und nun so schnell, wie nur möglich, wieder von ihr fortwollte! – Es war ganz klar. So und nicht anders war es gewesen! –
Aber vor ihm, gerade vor ihm, hätte er nicht fortzulaufen brauchen. Ganz gewiß nicht. Er lächelte bitter. Er hätte ihm Nichts getan. Und wieder fühlte er für einen Augenblick diesen leisen Schmerz, von dem er nicht wußte, woher er kam und wo er saß.
Er ging weiter. Er wußte nicht, wo er war und wie spät es war.
Er fand sich zum Potsdamer Platz und seinem Hotel zurück, aß irgendwo in der Nähe schlecht zu Abend und ging früh schlafen.
Aber immer wieder sah er das kleine, blasse Gesicht vor sich: wie es zu ihm aufgesehen. Und kein Gedanke: Was geht dich dieser fremde Junge an, den Du nie wiedersehen wirst! – vermochte es zu verscheuchen.
Er sah es beim Entkleiden. Noch in seine Träume dieser ersten Nacht in dieser fremden, großen Stadt nahm er es hinüber.
Warum war er von ihm fortgelaufen? ...
3
Als der Junge, der am vorigen Tage in Berlin angekommen war, gegen Mittag durch ein grobes Pochen und eine rohe Stimme, die durch die Tür brüllte, ob er denn nicht endlich aufstehen wolle, geweckt wurde, starrte er erst schlaftrunken in die ihm fremde Umgebung. Dann griff er mit einer ersten Bewegung unter das Kopfkissen wohin er sein Geld gestern Abend beim Einschlafen gelegt. Es war noch da.
Er wusch sich notdürftig und zog sich an.
Etwas später stand er auf der Straße, ohne eine Ahnung zu haben, in welcher Gegend er sich befand.
Aber sein erstes Gefühl war das eines mörderischen Hungers. Er hatte seit der Bahnfahrt gestern nur ein paar Schrippen gegessen. Nachdem er ein paar Straßen durchbummelt, wagte er sich in eine noch gästeleere Destille.
Dann dachte er nach.
Die Hauptsache war nun: Max zu finden.
Er holte wieder die beschmutzte und verbogene Visitenkarte hervor und las zum hundertsten Male, was er auswendig wußte: Skalitzer Straße 37 bei Hampel.
Aber wo war die Skalitzer Straße? – Beim Bezahlen fragte er den Wirt. In der Nähe des Schlesischen Bahnhofs. Er solle die 48 nehmen und dann einen Grünen fragen.
Er wußte weder, was die Zahl 48 bedeutete, noch was das war: ein Grüner.
Am Besten war’s wohl, sich hinzufragen.
Das tat er, erst zögernd und furchtsam, dann immer mutiger, wurde richtig und falsch gewiesen oder einfach stehen gelassen, und langte endlich nach einer Wanderung von fast zwei Stunden nicht in der Nähe des Bahnhofs – von wo, wie ihm gesagt war, es »nicht mehr weit sein sollte« –, sondern auf einem großen Platz mit einer braunen Kirche und einem durch einen Kanal gebildeten Wasserbecken an und so auch endlich in ihr, der Skalitzer Straße.
Eine ganze Weile stand er noch vor dem Hause mit der Nummer 37. Vielleicht kam Max grade heraus. Das wäre fein gewesen. Aber Max kam nicht und so entschloß er sich endlich, über den Hof und das Hinterhaus hinauf zu gehen. Eine alte Frau wies ihn zurecht: vier Treppen rechts. Oben stand wirklich der Name Hampel auf einem Blechschild. Er hatte auch kaum schüchtern geklingelt, als die Tür aufgerissen wurde und ein schlampiges, zerzaustes Weib mit einem Säugling an der halbnackten Brust erschien.
Zu wem er wolle? – Zu Max Friedrichsen? – Und eine Flut von Schimpfworten ergoß sich über den ganz Verdutzten, aus denen er nur so viel verstand, daß der Gesuchte hier gewohnt habe, mit Schulden auf und davon sei, daß er zuletzt die ›Kerle‹ sogar hier mit herauf geschleppt hatte und daß, wenn er, ja er, nicht gleich mache, daß er fortkomme, sie die Polizei holen lassen würde, um ihn festzustellen, denn er sei doch auch gewiß nur so einer ›von die warmen Brider‹ und sähe auch ganz so aus.
Dann ertönte aus dem Hintergrund das Geschrei anderer Kinder, die Tür wurde zugeschlagen und der Junge war froh, sich die Treppe wieder hinunterstehlen zu können. Das war ja ein furchtbares Weib. Gegen die waren ja die Bauernweiber, die in dem Laden eingekauft und bei jedem Pfennig, um den sie sich übervorteilt glaubten, gezetert hatten wie die Wilden, noch die reinen Engel!
Er zitterte ordentlich. Dann aber wurde er, bei dem Gedanken, daß er nun nicht wußte, wo er Max suchen und finden sollte, ganz mutlos. Fast kamen ihm die Tränen hoch. Was sollte er hier anfangen – ohne ihn!
Das Beste war, er fuhr gleich nach Hause zurück und ließ dort Alles über sich ergehen! – Dazu mußte er nun zunächst wieder zu dem Bahnhof zurück, an dem er gestern angekommen, und mit müden Füßen machte er sich wieder auf den Weg. Im Fragen nach dem Weg hatte er nun schon eine gewisse Übung und er sah sich jetzt auch die Leute erst an, die er fragte. Daß er fahren könne, kam ihm noch immer nicht in den Sinn.
Todmüde kam er am späten Nachmittag – Straßen, Straßen und immer neue Straßen hinauf – endlich am Stettiner Bahnhof an. Schon wollte er die Treppen hinauf, als ihm der Gedanke kam, sich erst einmal ordentlich satt zu essen. Er hatte ja Geld. Genug Geld noch dazu.
Diesmal fand er ein ordentliches Lokal und einen Platz in einer Ecke, wo sich kein Mensch um ihn kümmerte. Nach einigen belegten Stullen und einem Glas Bier schien die Lage nicht mehr ganz so verzweifelt. Beim Bezahlen sah er, daß er noch eine ganze Menge Geld hatte, noch weit über zwanzig Mark. Er ließ sich gleich noch ein Glas Bier geben und blieb sitzen.
Er überlegte. Das langte noch gut für ein paar Tage. Wenn er denn schon wieder nach Hause mußte, dann wollte er wenigstens noch Etwas von Berlin sehen. Und vielleicht fand er doch noch Max. Berlin war groß, aber so groß konnte es doch nicht sein, daß man in ein paar Tagen in ihm nicht einen Menschen finden sollte, den man suchte.
Für heute aber mußte er wieder schlafen. Müde wie er war, von dem langen Gange und mehr noch von dem ungewohnten Bier.
Er stieg also zum Bahnhof hinauf, holte sich seine Schachtel und suchte dann in den Nebenstraßen nach einem Hotel. Eines lag neben dem anderen. Er brauchte bloß zu wählen.
Er fand denn auch ein Zimmer, ein ganz kleines und schmales, in dem auch nicht viel mehr als ein Bett stand, aber es kostete nur eine Mark fünfzig für die Nacht, die ihm ein alter Kellner in schwarzem, fettigen Frack gleich abnahm.
Und wieder sank der Junge sofort in den tiefen und traumlosen Schlaf seiner gesunden Jugend.
– Wie er nach Berlin gekommen war aus seinem Dorfe? – Denn auf einem Dorfe war er zur Welt gekommen: als das Kind einer Mutter, die sich schon bald nach seiner Geburt aus dem Staube gemacht und sich in der Welt herumtrieb (wenn sie noch lebte); und eines Vaters, der – einer der vielen Gäste auf dem benachbarten Gutshof, wo sie bedienstet war – sie genommen und fortgeworfen hatte (sonst aber sollte es ein vornehmer Herr gewesen sein).
Seine Großeltern mußten ihn wohl oder übel behalten und aufziehen. Er wuchs auf, besuchte die Dorfschule, kam in die Lehre zu einem Kaufmann, wo er den ganzen Tag herumgehetzt wurde, Säcke leeren, Tüten füllen, abwiegen und verkaufen mußte, voraussichtlich vier Jahre und auch dann noch sein ganzes Leben lang.
Herausgekommen aus dem Nest war er nie und so war sein Leben völlig ereignislos verlaufen bis zu dem Tage, an dem Max – Max Friederichsen (mit dem er auf derselben Schulbank gesessen, mit dem zusammen er dann eingesegnet war und der dann eines Tages so urplötzlich aus dem Dorfe verschwunden war) – bis zu dem Tage, an welchem dieser selbe Max um Weihnachten herum ebenso unverhofft wieder auf der Bildfläche erschienen war und die gesamte Dorfjugend gleichen Alters durch sein Auftreten in Erstaunen, Bewunderung und ein taumelndes Entzücken versetzt hatte.
Denn der Max, der wiederkam, war ein ganz anderer als der vor einem Jahre durchgebrannte. Ein ganz anderer Max – in ganz neuer Kluft, mit einem Jacket auf Taille gearbeitet, mit umgeschlagenen Hosen, in gelben Handschuhen, Ring am Finger, Armbanduhr und einem Spazierstock in den jetzt immerhin gewaschenen Händen. Und der Geld hatte – so viel Geld, daß er sie alle zum Sonntagnachmittag in das Nachbardorf einlud, um sie dort sämtlich, die einen mehr, die anderen weniger, betrunken zu machen – mit Bier und Schnäpsen und Grog, betrunken vor Allem auch mit seinen Erzählungen von Berlin.
Von diesem Berlin mit seinen Theatern und Dielen; seinen Kinos, in denen immer nicht weniger als fünftausend Menschen Platz hatten; seinem Zirkus, der alle Tage (nicht nur Sonntags) spielte; seinen Cafés und seinen feinen Restaurants ohne Zahl – diesem Berlin, wo das Geld so auf der Straße lag, daß man es nur aufzuheben brauchte.
Da saßen sie um ihn herum, mit aufgesperrten Ohren und Mäulern, die Arme aufgestemmt und hörten zu, und wenn einer fragen oder erwidern wollte, schnitt er Alles mit einer großartigen Handbewegung ab: »Ihr habt ja alle keine Ahnung nicht!« (Ihr Bauernlümmel! – bei sich.)
Am Abend aber, als sie nach Hause torkelten, Max und er Arm in Arm, und er ihn fragte, ob denn auch alles wahr sei, was er erzählt, und ob man wirklich da so viel Geld verdienen könne und wie, war Max stehen geblieben, hatte ihn von oben bis unten angesehen und gesagt:
»So ein hübscher Junge, wie Du! – Wenn Du’s nicht glaubst, komm’ doch hin!« – hatte dann in die Tasche gelangt und seine Brieftasche – eine wirkliche Brieftasche mit Monogramm und silberbeschlagenen Ecken – hervorgeholt und aus ihr eine Visitenkarte, auf der mit gedruckten Buchstaben sein Name stand. Darunter mit Blei seine genaue Adresse.
»Komm doch hin! – Wirst schon sehen ...«
Er hatte ihm die Karte in die Hand gedrückt, wie ein Versprechen: »Werde Dir schon helfen ...«
Am nächsten Tage war der so unversehens Aufgetauchte allerdings wieder verschwunden, weil ihm der Boden zu heiß geworden war, aber die Karte hatte er behalten und verwahrte sie wie ein heiliges Gut.
Sie brannte auf seiner Brust. Er war wie verwandelt. Immer wieder wiederholte er sich heimlich die Worte, die er gehört, und jedesmal wurde der Entschluß reifer in ihm: Auch er mußte nach Berlin! ... Nach Berlin und zu Max! ...
Das war natürlich nicht so einfach. Freiwillig hätte man ihn nie gehen lassen, weder die Großeltern noch sein Vormund. So mußte er denn ebenfalls durchbrennen.
– Und als der Frühling gekommen war, der holde und leichtsinnige Frühling, der so viele Wünsche entstehen und vergehen und einige auch Wirklichkeit werden läßt, da hielt es ihn nicht länger.
Eines Abends, als Alles schlief, zog er seinen Sonntagsanzug an, packte etwas Wäsche und was er so sein eigen nannte, in eine Schachtel, leerte seine Sparkasse und schlich sich aus dem niedrigen Hause.
Auf einen Zettel hatte er noch geschrieben, daß sie sich keine Sorge um ihn machen sollten: er würde schreiben, wenn er Arbeit gefunden habe und wiederkommen, wenn es ihm gut ginge.
Er ging die halbe Nacht durch bis zu einer anderen Bahnstation als der seines Dorfes, löste sich dort eine Fahrkarte nach einer nächsten, um auch da noch nicht zu verraten, wohin er wollte, und dann erst weiter nach Berlin.
Es ging Alles gut. Keiner sprach oder hielt ihn an. Die Reise dauerte das Ende der Nacht durch und bis in den Nachmittag hinein.
Nun war er schon den zweiten Tag an dem Ziele seiner Sehnsucht.
Als er am dritten erwachte, nicht so spät wie am vorigen Tage, dachte er noch weit weniger als am Vorabend an eine Rückkehr. So lange sein Geld reichte, blieb er auf alle Fälle hier. Er zählte es nochmals sorgfältig, stellte fest, daß es mindestens noch zwei bis drei Tage reichen würde und beschloß, für diese nächsten zwei Nächte das Zimmer im Voraus zu bezahlen, worüber der alte Kellner mit den gleichgültigen Worten: »Also bis Donnerstag früh ist bezahlt!« quittierte.
– Die Tage vergingen im Fluge.
Zwar war es langweilig, so den ganzen Tag mit sich allein zu sein und Keinen zu haben, mit dem man ein Wort reden konnte. Aber was gab es nicht Alles zu sehen!
Die Häuser und Straßen zwar begannen ihn bald zu langweilen: die einen waren enger, länger und breiter, die anderen höher und größer, und aufhören taten sie beide nie. Aber die Läden in ihnen! – Was es da zu sehen und zu kaufen gab! – Er konnte sich nicht satt sehen an ihnen und Alles hätte er haben mögen: diesen schicken Anzug und diese bunten Krawatten; diese Armbanduhr und dies Zigarettenetui aus Silber – nein, lieber noch dies andere da, das flache, goldene. Und dies hier! – Und das da! –
So stierte und staunte er und konnte eine Stunde lang vor demselben Schaufenster stehen bleiben, ohne sich zu rühren.
Er war auch lange nicht mehr so schüchtern wie am ersten Tage. Wenn er Hunger und Durst verspürte, ging er in die erste, beste Bierhalle und bestellte. Er dachte bei Allem: Du hast ja noch Geld.
Auch den Teil der Stadt, in dem er sich gewöhnlich herumtrieb, lernte er jetzt allmählich näher kennen. Die lange Straße, die hier oben anfing, um nie zu enden, das war die Friedrichstraße; und die breite, mit den Bäumen und den Bänken in der Mitte, und einem Tor am Anfang – oder am Ende? – das waren die Linden.
Selbst mit der Straßenbahn fuhr er und mit dem Omnibus, oben auf dem Verdeck. Einmal rein zum Vergnügen durch den Tiergarten; und ein anderes Mal hinunter zum Kreuzberg und wieder zurück.
Wurde es aber gar zu langweilig, so allein, blieb immer noch das Kino. Das war noch viel schöner, noch viel bunter und geheimnisvoller in seinem Dunkel, als das helle Leben dort draußen. Es gab welche, die machten schon am frühen Nachmittag auf. Da konnte er stundenlang sitzen und auf die flimmernde Wand blicken, meist, ohne zu begreifen, was dort vorging, aber immer in dem zitternden und ewig wechselnden Bann der Bilder.
– Eines Tages, er wußte selbst nicht mehr, welcher es war, zählte er beim Erwachen sein Geld, zählte es dann nochmals und sah, daß es nicht einmal mehr zur Rückreise langte. Er erschrak erst furchtbar, besonders, als er nachrechnete und sich darüber klar wurde, daß es der Donnerstag war, der Tag, bis zu dem er sein Zimmer bezahlt hatte.
Heim mußte er nun. Was sollte er hier anfangen ohne Geld? Er wäre tausendmal lieber hier geblieben. Aber er mußte heim.
Er dachte nach. Die Sachen dort in der Schachtel waren, soviel begriff er, Nichts wert. Aber er hatte noch seine Uhr. Seine Einsegnungsuhr.
Er schlich sich aus dem Hotel, glücklicherweise, ohne gesehen zu werden. Irgendwo, in der Nähe des Bahnhofs, erinnerte er sich, das Schild einer Pfandleihe gesehen haben. Er fand es wieder.
Silber? – Ach was, Nickel. Eine Mark wolle man darauf geben. Eine Mark! – Nein, dann lieber nicht. Aber schließlich nahm er die Mark doch.
Nun hatte er im Ganzen noch zwei Mark und siebzig Pfennig.
Was sollte er nun anfangen? – Essen mußte er doch; und den Tag hinbringen auch.
So trank er denn eine Tasse Kaffee und aß ein paar trokkene Schrippen, um dann fast den ganzen Tag in einem Tageskino mit atemraubender Luft in einer Ecke hungrig zu sitzen, aus ihr endlich aufgestöbert zu werden, nachzahlen zu müssen und sein Geld auf etwas über eine Mark zusammenschmelzen zu sehen.
An Essen war für heute nicht zu denken. Wovon sollte er sonst morgen leben? –
Er schlich um sein Hotel herum, in einem unbewachten Augenblick hinein und gelangte unangefochten in sein Zimmer. Er schlief unruhig ein.
Ganz früh am nächsten Morgen stand der alte Kellner in seinem ewigen Frack am Bett.
Was denn das sei? – Das Zimmer für die Nacht sei ja noch nicht bezahlt? –
Er mußte gestehen.
Aber da war es aus.
Das wäre ja noch schöner! – Schlafen und nicht bezahlen? –
Was, die alte Schachtel mit den Lumpen als Pfand hierlassen? – Natürlich blieb sie hier. Wiederkriegen würde er sie erst, wenn er Geld brachte. Und nun solle er schleunigst machen, daß er fortkäme ...
Er bat: »Nur noch ein paar Tage ... Er werde dann auch ganz gewiß bezahlen.«
»Nischt zu machen! Da könnte Jeder kommen ...«
Der Alte blieb neben ihm stehen, bis er fertig war mit Anziehen.
Wenn er Geld habe, dürfe er wiederkommen und seine Sachen holen. Nicht eher, verstanden?
Da stand er nun auf der Straße. Er hätte heulen mögen. Vor Wut. Hätte der Olle ihn nicht wenigstens diese Nacht noch dortbehalten können, wo er doch schon ganze vier dort geschlafen und sie pünktlich bezahlt hatte, sogar im Voraus! –
Was nun? –
Wenn er nur Arbeit finden könnte! – Aber wo und wie? – Er hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. (Daß er seinem Freund Max noch irgendwo begegnen würde, diese Hoffnung hatte er nun doch aufgegeben.)
Hingebracht aber mußte der Tag werden und etwas essen mußte er heute doch auch, umsomehr, als er gestern hungrig zu Bett gegangen war. So kaufte er sich denn mit Anreißung seiner letzten Mark ein paar Brötchen und dazu ein paar Knobländer und aß sie in einer Ecke des Bahnhofs.
Den Vormittag trieb er sich in der Nähe des Friedrichstraßenbahnhofs herum, bis er von den Dienstmännern (die mit Schrecklichem drohten) fortgewiesen wurde und verbrachte den Nachmittag auf den Bänken des Tiergartens, von einer zur anderen gehend, auf jeder eine Weile sitzend, um endlich am Abend auf einer von ihnen in einem wenig belebten Teil des Parkes einzuschlafen.
In der Nacht erwachte er und fühlte etwas Feuchtes und Warmes an seiner Hand. Er sprang auf, hörte das Fluchen eines Wachmanns und lief davon, so schnell ihn seine Füße trugen. Der Wärter, mit dem Stock in der Hand und seinem Hund an der Leine, noch eine Weile hinter ihm her, aber ohne ihn zu erreichen.
Am Reichstagsgebäude kauerte er sich in eine dunkle Nische und dröselte in der lauen Frühlingsnacht langsam wieder ein.
Sein erstes Gefühl beim Erwachen am frühen Morgen war wieder das eines quälenden Hungers. Er hatte grade noch zwanzig Pfennige. Die langten zu vier Schrippen und ein paar Zigaretten. Wenn er rauchte, das hatte er schon gestern bemerkt, spürte er den Hunger für eine Weile weniger. Rauchen mußte er.
Wieder trieb er sich den Vormittag auf den Bänken des Parkes herum. Von Zeit zu Zeit nickte er ein und raffte sich wieder auf, wenn er die Blicke der Vorübergehenden auf sich fühlte.
Einmal, als er aufsah, saß dicht neben ihm ein kleiner, ganz gut gekleideter, aber häßlicher Mensch, der ihn durch seinen Kneifer aufmerksam und, wie es ihm schien, nicht böse, aber doch so merkwürdig ansah, daß er aufstand. Was wollte er von ihm? – Helfen gewiß nicht.
Auf der nächsten Bank fuhr er beim Gelächter von zwei Burschen in die Höhe, die plötzlich vor ihm standen und ihn fragten, wieviel Uhr es sei. Er habe doch eine? Als sie sein dummes Gesicht sahen, gingen sie brüllend weiter.
Und auf einer dritten hörte er, wie ihm ein Rollkutscher von seinem Bocke aus Etwas zurief, das er nicht verstand, das sicherlich aber keine Schmeichelei war.
Er war zu müde, um sich zu ärgern; zu stumpf, um noch zu erschrecken; und viel zu hungrig, um darüber nachzudenken, was alle diese Menschen von ihm wollten.
Auf einer ganz abgelegenen Bank saß er dann länger und nun unbelästigt. Es war jetzt Mittag. Eine grenzenlose Wut, wie sie ihn als kleines Kind schon zuweilen gepackt, stieg in ihm auf. Auf diesen Max; auf den alten Kellner in dem Hotel; auf die ganze Welt. Er zertrat die Erde mit den Absätzen seiner Schuhe und zerbiß einen Grashalm in kleine Fetzen.
Seine Wut verging, und nun heulte er los. Ein großes Mitleid mit sich selber, seinem Elend und seiner Verlassenheit, überkam ihn. Was sollte er tun? – Was sollte er nur tun? – Er wußte es nicht.
Er wollte den ersten, besten Vorübergehenden ansprechen und ihm Alles erzählen. Aber hier kam kaum Einer vorbei und er sah auch selbst ein, daß es doch Nichts nützen würde. In Berlin, so viel hatte er schon gesehen, mußte man Geld haben oder vor die Hunde gehen.
Als er sich ausgeweint und seine Tränen langsamer flossen, packte ihn ein böser Trotz. Wütend stand er auf und verkroch sich in das nächste, dichte Gebüsch. Dort warf er sich lang hin und war bald eingeschlafen.
Nach Stunden eines tiefen Schlafes erwachte er. Er fühlte sich nicht mehr müde und auch der Hunger quälte ihn nicht mehr so.
Er wusch sich an dem nächsten Brunnen notdürftig Gesicht und Hände.
Dann ging er langsam der Stadt, den Linden, zu. Es war Nachmittag geworden.
Immer wieder, wie seit gestern, dachte er an Das, was Max ihm gesagt hatte. Er suchte sich jedes Wort zu vergegenwärtigen, um endlich hinter seinen Sinn zu kommen.
Was hatte er gesagt? – Daß man in Berlin Geld, viel Geld verdienen könne. Aber womit? – Mit welcher Arbeit? – Und wo fand man die? – Und warum fanden grade hübsche Jungens (wie er doch einer sein sollte) eher Arbeit als andere?
Er verstand es nicht. Nein, er verstand es nicht.
Und wieder fiel ihm ein, daß sein ehemaliger Freund (jetzt war er es nicht mehr, auch wenn er ihn wiedersehen sollte!), daß der immer von der Friedrichstraße und später an jenem Nachmittag, als sie allein waren, auch von der Passage gesprochen hatte.
Die Passage, das war doch der große Durchgang, in dem er am ersten Nachmittag gleich nach seiner Ankunft gewesen war; wo die Menschen ihn so merkwürdig angesehen, daß er ordentlich Angst bekommen hatte und fortgelaufen war? – Solche Angst, daß er in all diesen Tagen immer einen weiten Bogen um sie gemacht hatte.
Junge Bengels hatten dort auch herumgestanden, aber hübsch waren sie ihm nicht erschienen, eher häßlich und gemein. Ob die dort etwa Arbeit suchten und sich deshalb dort aufstellten?
Er wollte doch noch einmal hingehen und sich die Sache näher ansehen. Vielleicht auch einen direkt fragen. Mehr als ihn davonjagen oder auslachen konnten sie doch nicht.
Aber plötzlich faßte ihn das Gefühl des Hungers wieder mit solcher Gewalt und zugleich schmerzten ihn die schweren Stiefel, die er nun seit gestern nicht mehr von den Füßen bekommen hatte, so, daß er nicht mehr weiter konnte. Er mußte sich auf die nächste Bank unter den Linden setzen und die Hände auf den Magen pressen. Er konnte auch nicht mehr denken. In seinem heißen Kopf ging Alles hin und her.