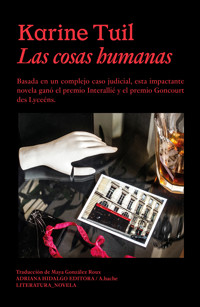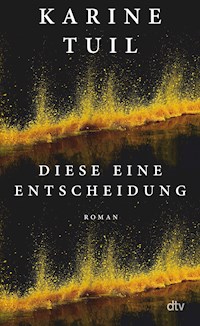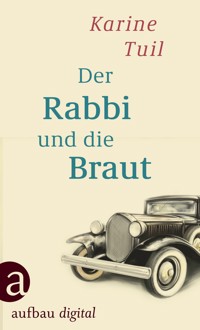
10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Saul Weissmann ist Jude. Wenigstens hat er das sein Leben lang geglaubt, denn schließlich mußte er den gelben Stern tragen und überlebte als einziger aus seiner Familie Auschwitz.
Als eine sehr viel jüngere und reiche, dafür aber ausgesprochen häßliche Jüdin ihn trotz seiner siebzig Jahre heiraten möchte, erklärt ihm der zuständige Rabbi kurz vor der Trauung, daß er nach jüdischem Gesetz gar kein Jude sei.
Daraufhin ist es aus und vorbei mit der Hochzeit, denn für die Braut kommt ein Goi als Ehemann nicht in Frage. Und so verliert Saul nicht nur die Frau, die ihm einen sorglosen Lebensabend versprach, sondern auch seine Identität. Von nun an liefern sich der Jude und der Nichtjude in ihm erbitterte Kämpfe. Was bedeutet es, wenn man seiner religiösen Identität beraubt wird?
Mit scharfzüngigem Witz läßt Karine Tuil ihren Saul mit dieser Frage auf Gottesdiener, Psychologen und Exorzisten los. Bis er die Antwort ganz überraschend in sich selbst findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Saul Weissmann ist Jude. Wenigstens hat er das sein Leben lang geglaubt, denn schließlich mußte er den gelben Stern tragen und überlebte als einziger aus seiner Familie Auschwitz.Als eine sehr viel jüngere und reiche, dafür aber ausgesprochen häßliche Jüdin ihn trotz seiner siebzig Jahre heiraten möchte, erklärt ihm der zuständige Rabbi kurz vor der Trauung, daß er nach jüdischem Gesetz gar kein Jude sei.Daraufhin ist es aus und vorbei mit der Hochzeit, denn für die Braut kommt ein Goi als Ehemann nicht in Frage. Und so verliert Saul nicht nur die Frau, die ihm einen sorglosen Lebensabend versprach, sondern auch seine Identität. Von nun an liefern sich der Jude und der Nichtjude in ihm erbitterte Kämpfe. Was bedeutet es, wenn man seiner religiösen Identität beraubt wird? Mit scharfzüngigem Witz läßt Karine Tuil ihren Saul mit dieser Frage auf Gottesdiener, Psychologen und Exorzisten los. Bis er die Antwort ganz überraschend in sich selbst findet.
Über Karine Tuil
Karine Tuil, geboren 1972, studierte Jura in Paris und beschäftigte sich in ihrer Doktorarbeit mit gesetzlichen Bestimmungen zu Wahlkampfkampagnen in den Medien. Sie ist Autorin mehrerer gefeierter Romane und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Paris.
Ralf Pannowitsch, geboren 1965 in Greifswald, studierte Germanistik und Romanistik. Er lebt in Leipzig als Lehrer, Gärtner und Übersetzer aus dem Englischen und Französischen. Beinahe alle Bücher der Autoren Chrstophe André und François Lelord wurden von ihm ins Deutsche übertragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Karine Tuil
Der Rabbi und die Braut
Roman
Aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch
Übersicht
Titelinformationen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Impressum
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Zum Andenken an Joseph Séror und Edmond Tuil
Für meine Eltern
Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam …
Franz Kafka, Tagebücher (1914)
Die Toten werden dich, Herr, nicht loben.
Psalm 115, 17
Ich heiße Saul Weissmann, aber trauen Sie meinem Namen nicht, denn auch wenn er den Anschein erweckt, er ist nicht jüdisch. Siebzig Jahre lang habe ich den anderen und mir selbst etwas vorgemacht.
Gestern noch war ich Jude. Ich lebte friedlich in meinem Appartement in der Rue des Rosiers, umgeben von meinen Fetischen: den Büchern, einem alten Schaukelstuhl aus Leder, den ich auf dem Flohmarkt von Saint-Ouen ergattert habe, einem Brigitte-Bardot-Foto mit Widmung, einem siebenarmigen Leuchter und meiner Sammlung von Marionetten. Da ahnte ich noch nicht, daß ich einen Tag später kein Jude mehr sein würde. Ich bin nicht exkommuniziert worden oder zu einem anderen Glauben konvertiert – ich habe überhaupt nichts dafür getan, kein Jude mehr zu sein.
Nach meiner Geburt wurde ich beschnitten wie jeder neugeborene jüdische Junge. Im Krieg setzte man mich als Juden auf die Liste und deportierte mich nach Auschwitz. Und trotzdem erfuhr ich aus dem Munde eines Rabbiners, daß ich kein Jude sei. Als er es mir verkündete, dachte ich zunächst, mein weltliches Aussehen habe ihn zu diesem Urteil kommen lassen – ich trage keinen Bart und habe kein Käppchen auf dem Kopf. Ich rechtfertigte mich also mit meinem Widerwillen gegen allzu auffällige Erkennungszeichen. Schließlich hätten sie mir einst den gelben Stern auf die Jacke genäht, und wohin mich das geführt habe, sei ja allseits bekannt. Aber der Rabbi suchte die Schuld bei meiner Mutter (Gott sei ihrer Seele gnädig!). Er behauptete, sie sei keine Jüdin gewesen, woraus folge, daß ich ebensowenig einer sei. Sie können sich meine Bestürzung und meinen Schmerz vorstellen; innerhalb weniger Minuten hatte dieser Rabbiner mein Leben in die betrüblichste Banalität gestürzt: Ich gehörte nicht mehr zu den Auserwählten Gottes.
Ich sehe ihn noch vor mir mit seinem traurigen Lächeln, das er immer am Ende eines Gebets auflegt, seinem müden Blick, das Gesicht verschlossen wie eine Faust! Ein langer und dichter roter Bart wuchs ihm über die untere Gesichtshälfte, verhüllte Lippen und Nasenlöcher. Weiche Härchen überwucherten seine Wangen, keine Pore, die nicht abgedichtet gewesen wäre. Selbst aus den Ohren sprossen ihm büschelweise kupferne Haare wie Unkraut. Die obere Hälfte seines Gesichts hingegen war ganz und gar unbehaart. Ein unfruchtbarer Boden. Nicht eine Wimper wippte am Rand seiner Augenlider, und an den Brauen schienen die Haare eins nach dem andern mit der Pinzette ausgezupft oder mit Wachs ausgerissen worden zu sein. Nicht ein Haar wurzelte auf seinem Schädel, der so glatt und fahl wie ein Knochen war. Am meisten aber verwirrten mich seine Augen: lebhafte, nachtblaue Glupschaugen, die nur so vor Glauben und Zuversicht strahlten, während sich in meinen eigenen lauter Zweifel spiegeln. Was konnten unsere Augen schon gemeinsam haben, als sich ihre Blicke trafen? Er sah in mir nur einen alten Mann mit zerknittertem Gesicht. Dabei stelle ich, wenn ich vorm Spiegel stehe, immer noch mit freudiger Genugtuung fest, daß meine Wangenknochen nach wie vor markant hervorspringen. Mein Haar hat nichts von seiner Kraft verloren. Nur ein paar silberne Sprenkel verraten mein Alter. Zwei Grübchen in den Mundwinkeln beweisen, daß ich immer noch gern lache. Meine Lippen sind nicht schmal geworden, meine Zunge ist wie die eines Säuglings: immer auf der Lauer nach neuen Geschmacksreizen. Allein meine Zähne – die dritte Garnitur – zeugen davon, daß der Alterungsprozeß still und heimlich eingesetzt hat. Ja, ich bin alt – warum dieses Wort vermeiden, das jenen so angst macht, denen es nicht wie eine Schmähung ins Gesicht geschrieben steht.
Ich spürte den Blick des Rabbis auf meinem müden Körper. Er trat näher an mich heran (ich war drei Kopf größer als er) und streckte mir eine feuchte Hand entgegen, wobei er sich seltsam verdrehte, um dem Blick der Frau auszuweichen, die zu diesem Zeitpunkt noch bloß meine Lebensgefährtin war. Sie heißt Simone Dubuisson, und sie ist Jüdin – der Name trügt. Ich hatte sie drei Monate zuvor auf einem Ausflug kennengelernt, den die Jüdischen Wanderfreunde Frankreichs organisiert hatten. Wir waren um die zwanzig Leute gewesen (siebzehn Frauen und drei Männer), lauter ehrenwerte Juden, ledig und jenseits der Vierzig, allesamt auf der Suche nach der jüdischen Schwesterseele. In dichtgedrängten Reihen, von unserem Herdentrieb geleitet, hatten wir den Wald von Fontainebleau durchfurcht und waren froh gewesen, aus gänzlich freien Stücken beisammen zu sein. Die ganze Zeit über war ich an Simones Seite geblieben. Ich hatte sie sofort bemerkt: Sie war die Jüngste der Gruppe, gerade mal dreiundvierzig, ziemlich klein (stämmige hundertfünfzig Zentimeter), mit braunem Deckhaar und weißem Schopf darunter, verwaschenen Augen und einem umwerfenden Lächeln, bei dem Zahnlücken zum Vorschein kamen, die, so weiß der Volksmund, großes Kinderglück verheißen. Das Prägnanteste war jedoch ihre Hakennase: Simone schien als einzige jener Schönheitsdiktatur entkommen zu sein, in der plastische Chirurgen mit Skalpellschnitten ihren Beitrag zur jüdischen Revolution leisteten. Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage lassen sich die Juden ihre Seele vom Psychoanalytiker richten und ihre Nase vom Chirurgen.
Simone gehört nicht zu den Frauen, die Männern gefallen, sie hat nicht das passende Profil. Trotzdem, kaum hatte ich sie erblickt, wußte ich: Sie ist die Richtige. Nicht die Frau meines Lebens, denn da war nicht mehr viel zu machen, aber in jedem Fall die, die mich bis zum Tod begleiten würde. Mit Siebzig muß man die Liebe als Ensemble von Palliativmaßnahmen betrachten. Simone hatte mir ihr Leben erzählt und ihre Ambitionen preisgegeben, die sich mit einem Wort auf den Punkt bringen ließen: heiraten. Ihre Offenherzigkeit entzückte mich. Die sechzehn übrigen Teilnehmerinnen suchten nach eßbaren Pilzen, in der Hoffnung, dabei einen Mann zu finden. Simone hatte mich gefragt, ob ich Jude sei, und als ich ganz spontan mit »ja« antwortete (wie hätte ich damals daran zweifeln können?), lächelte sie mit großer Erleichterung und preßte ihre Lippen auf meine Stirn, so wie man einem Tier den Stempel »Aus kontrollierter Herkunft« aufdrückt. Derart beruhigt, wich Simone nicht mehr von meiner Seite. Ein paar Wochen später arrangierte sie einen Termin bei einem Pariser Rabbiner, um über unsere Hochzeit zu sprechen. Warum hätte ich mich dagegenstemmen sollen? Sie trug ihre dreiundvierzig Jahre ohne versteckte Falten oder Laster – im Gegenteil, sie bot ihre Makel nur allzu sichtbar dar, was wenig Raum ließ für nachträgliche Reklamationen –, und vor allem besaß sie die Fürsorglichkeit einer Krankenschwester: »Hast du deine Temperatur gemessen und die Medikamente gegen Diabetes und Bluthochdruck genommen? Warst du dein Geschäft erledigen? Iß deine Suppe! Deck dich zu, sonst erkältest du dich! Halt dich am Geländer fest, wenn du runtergehst!« Das war höchst wichtig, denn wollte ich den Statistiken Glauben schenken, war das Risiko eines Oberschenkelhalsbruchs für mich größer als die Wahrscheinlichkeit, Simone ein Kind zu machen.
Aber ich schweife vom Thema ab … Wenn ich von Simone rede, verliere ich immer ein bißchen den Kopf. Sie war es, die auf einer religiösen Trauung bestanden hatte. Ich hatte mich zunächst gesträubt: Gott war nicht nach Auschwitz gekommen, weshalb sollte er bei meiner Hochzeit zugegen sein? Simone aber versteifte sich darauf. Sie stellte sich vor, wie sie im weißen Kleide, das mit Perlen und Straß besetzt war, am Arm ihres Vaters schreiten würde. Das Gesicht mit einem Tüllschleier bedeckt, würde sie unter den erleichterten Blicken Gottes und der Seinigen langsam dem Altar entgegenwandeln. Oh, Simone hatte große Träume! Von einer schönen Zeremonie mit den Segnungen des Rabbiners. Einem großen Fest mit Cateringfirma und Orchester … Eigentlich war es unanständig, zu essen, zu trinken, zu tanzen und zu lachen, während Millionen Tote uns dabei beobachteten. Simone war das schnurz. Simone wollte leben. »Du stehst ja schon mit einem Fuß im Grab«, sagte sie mit beißendem Unterton, als ich ihr meine Bedenken offenbarte. Und ich wußte, sie hatte recht; seit fünfzig Jahren stand ich mit einem Fuß im Grab. Wenn Simone mich heiratete, würde sie einen Toten und einen Lebenden ehren müssen, würde es ihr obliegen, mich mitsamt meiner Erinnerung zu achten, für mein Leben zu beten und dafür, daß meine Seele in Frieden ruhen möge. Jeden Monat spreche ich das Kaddisch für den Teil von mir, der in Auschwitz gestorben ist. Simone hört mir aus Respekt für das Gedenken an die Toten zu. Sie ist eine Expertin in Sachen Begräbnisriten, ihr Vater besitzt ein Bestattungsinstitut; sie ist wundervoll, ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Und sie hat ihre Jungfräulichkeit für mich aufgespart, sie wußte sie zu bewahren – oh, ohne große Mühe: Simone ist häßlich, ich sage das ohne jede Bitterkeit. Ihr Leib ist ein mit Zellulitis überzogener Fetthaufen. Ihre Haut, so rauh wie ein Baumstubben, verströmt den Geruch eines Zimmers, das seit Wochen nicht gelüftet wurde. Lange Krampfadern schlängeln sich an ihren Beinen entlang wie wimmelndes Gewürm. Ihre Brüste, die kein Busenhalter mehr tragen kann, klatschen auf Höhe des Bauchnabels aneinander. Weiter oben dörrt ihr verblühtes Gesicht, auf welches sich mein Blick voll Schrecken richtet. Ihr Mund ähnelt mit seinen scharfen Konturen und seinem metallenen Aussehen einem Briefkastenschlitz; mehr als einmal hat sich meine Zunge an ihm verletzt; ihre Augen – zwei saftige Oliven – triefen von einer Mischung aus Begierde und Schamhaftigkeit; ihre Nase schließlich, ein unförmiger Vorsprung, hat nie den berauschenden Duft von Körpern erfahren, sondern war immer nur dazu verdammt, den Geruch von zubereitetem Essen einzusaugen.
Kein Mann wollte Simone. Simone hätte jeden Mann akzeptiert. Vorausgesetzt, er war Jude. Und ich, wenn ich dem Rabbi Glauben schenken sollte, ich war keiner. Dabei hatte ich alles getan, was in meiner Macht lag. Ich hatte extra noch einmal meinen Bühnenanzug hervorgekramt (der mich in den siebziger Jahren das nette Sümmchen von achtzig Dollar gekostet hatte) und mir eine schwarze Baskenmütze aufgesetzt, die ich am Tag zuvor für ganze fünfzehn Francs auf dem Flohmarkt von Montreuil erstanden hatte. Simone war in ein purpurnes Seidenkleid gehüllt, das weder Arme noch Beine sichtbar werden ließ. Ihre langen Kraushaare hatte sie geflochten und ein schwarzes Tuch darübergeknotet, das die Strenge ihrer Gesichtszüge noch betonte. Aber der Rabbi hatte es eilig: Vielleicht war eine Hochzeit zu feiern oder eine Bar-Mizwa, eine Scheidung auszusprechen, ein Gottesdienst vorzubereiten – Gott und die Menschen ließen ihm keine Atempause. Ohne das Wort an uns zu richten, wies er uns in sein Büro, ein winziges, fensterloses Zimmerchen, dessen Mobiliar sich auf einen Holztisch, drei billige Plastikstühle und eine Halogenlampe beschränkte. Was wußte er vom Gesang der Vögel, vom Licht des Tages, vom Lachen der Kinder, eingemauert, wie er war, in diesen überheizten und nüchternen Raum? Die Farbe blätterte in kleinen Plättchen von den Wänden, die von Feuchtigkeit durchzogen waren und an die man Porträts von verschiedenen Rabbinern gehängt hatte. Simone wirkte eingeschüchtert. Sie wagte sich nicht zu rühren, ja nicht einmal, den Blick zu heben. Zusammengesunken saß sie da, in einer unterwürfigen Haltung, die mich sprachlos machte: Die Schultern hatte sie eingezogen, den Rücken gekrümmt, die Arme vor dem Körper verschränkt. Derart in sich selbst verkrochen, ähnelte sie einer Molluske, die der Fuß einer übelwollenden Person in Kürze zerquetschen wird. Ob sie schon eine Vorahnung hatte, wie sich die Dinge entwickeln würden? Argwöhnte sie bereits, daß der Rabbiner ihr die schreckliche Nachricht überbringen würde, die ihren Körper in ewige Trauer stürzen sollte? Simone befürchtete das Schlimmste, denn wie sonst sollte ich mir das Zittern ihrer Hände erklären und die krampfhaft zuckenden Mundwinkel, die ihr das Gesicht verzerrten? Und ihr Geschlecht – ach, ihr kleines Geschlecht, in das vor mir kein Mann eingedrungen war und das sie in einen voluminösen Schlüpfer gezwängt hatte, dessen Nähte ich durch das verhüllende Gewebe ihrer buntscheckigen Unterröcke erahnen konnte! –, wußte ihr kleines Geschlecht, daß es zum Verdursten verurteilt war? Ich nahm Simones Hände in die meinen und streichelte mit der Kuppe meines Mittelfingers darüber. Aber kaum hatte ich ihre dürstende Haut gestreift, als der Rabbi mir auch schon einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. Offene Bekundungen von Zärtlichkeit waren in den Mauern der Synagoge nicht gestattet. Die Männer links, die Frauen rechts, und einer schaut den andern nicht an, das ist ein Befehl! Trennen soll man sie. So lasset uns beten! Laßt uns beten! Und die Frauen, schweigen sollen sie! Und die Männer den Rücken beugen! Daß der Blick sich senke! Und die Lust, sie krepiere. Wenn ich Simone berührte, war es, als ob ich von einer verbotenen Speise kostete. Ich ließ ihre Hand los; Simone muckste nicht, sie schrumpfte noch mehr zusammen. Der Rabbi wandte sich mit gezierter und süßlicher Stimme an mich, ganz so, wie man alten Leuten böse Dinge sagt. Er sprach mit Nachdruck von den Pflichten eines jeden Ehepartners und befragte mich ausgiebig, wie ernst es mir damit sei, Simone zu meiner Frau zu machen (war sie wirklich derart häßlich, daß er mich so plagen mußte?). Dann bot er mir verschiedene Ratgeber für Frischvermählte an. Er fragte mich auch, was mein Beruf gewesen sei. Ich antwortete »Anwalt«, ohne zu präzisieren, daß ich nie jemand anderen verteidigt hatte als mich selbst. Daß ich auch Marionettenspieler war, wagte ich nicht zu erwähnen, man kennt ja die Vorurteile. Er kniff die Augen zusammen und knirschte mit den Zähnen. Unter seinen wimperlosen Lidern konnte ich die Pupillen kaum erkennen. Mit einer brüsken Drehung des Beckens wandte er sich Simone zu.
»Ich nehme an, Sie sind nicht berufstätig …«
»Nein«, stimmte sie zu, »die Suche nach einem Mann ist eine Vollzeitbeschäftigung.« Ehe sie mich getroffen hatte, war Simone neununddreißig Stunden pro Woche dieser Tätigkeit nachgegangen, Wochenenden und Feiertage nicht mitgezählt. Und wenn es einen Tag in der