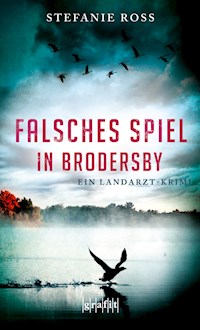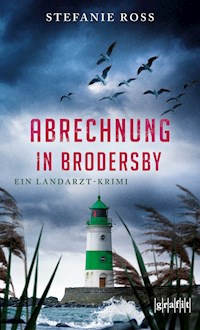9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Reiz des Bösen – für Serientäter ist er wie eine Droge, für Kommissar Marcus Lauer die größte Herausforderung. Als eine Reihe von Verbrechen verübt werden, die nicht zwingend zum Tod der Opfer führen, aber ihr Leben zerstören, steht er vor seinem kniffligsten Fall. Erst als er sich mit der durchtriebenen Lokalreporterin, der brillanten Analytikerin und dem stadtbekannten Obdachlosen zusammentut, kann das ungewöhnliche Ermittlerteam einen Zusammenhang zwischen den Handlungen herstellen. Doch der Täter hat seinen Racheplan minutiös vorbereitet. Können sie ihn noch aufhalten oder ist es schon zu spät?
»Marcus Lauer steckt voller Überraschungen, hadert jedoch damit, dass seine Kugel einst einen Unschuldigen getroffen hat. Dieser Fall bringt ihn an seine Grenzen … aber lesen Sie am besten selbst.« Stefanie Ross
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Reiz des Bösen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Lisa Wolf
Covergestaltung: bürosüd, München
Covermotiv: mauritius images / Ingo Boelter
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
In Hamburg sagt man Tschüss und Danke …
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Sie konnte sich nicht bewegen, war gefesselt, mit elastischen Binden an der Innenseite des Garagentores fixiert. Der Knebel in ihrem Mund ließ keinen Hilferuf zu.
Heftig rang sie durch die Nase nach Luft, als sich der Geländewagen langsam in Bewegung setzte und rückwärts auf sie zurollte. Das konnte er doch nicht tun! Das tonnenschwere Fahrzeug würde sie zerquetschen. Einen Sekundenbruchteil vor dem Aufprall begriff sie, dass genau das seine Absicht war. Wenn er schon so gnadenlos mit ihr umging, was würde er dann ihren Freundinnen antun? Sie hörte ein widerliches Knirschen. Ehe sie verstand, dass es ihre eigenen Knochen waren, die zermalmt wurden, senkte sich eine gnädige Dunkelheit über sie.
***
Zufrieden betrachtete er das Haus. Er musste zugeben, dass sie alles erreicht hatte, was sie damals angekündigt hatte. Doch dafür hatte sie einen hohen Preis bezahlt und auf eine Familie oder Partnerschaft verzichtet, es dafür zu Reichtum, einem großen Haus und einem protzigen Wagen gebracht. Und was hatte es ihr genützt? Nichts. Am Ende seiner kleinen, aber sorgsam einstudierten Rede hatte er ihr angesehen, dass sie begriffen hatte, worum es ihm ging. Neben der Angst hatte er in ihrer Miene Reue erkannt – und auch die Einsicht, dass all die schönen Dinge, die sie in ihrem Leben angehäuft hatte, ihr nun nichts nutzen würden. Wie gewonnen, so zerronnen.
Natürlich hatte er dafür gesorgt, dass das Ganze nach einem tragischen Unfall aussah. Er holte sein Smartphone aus der Jackentasche und rief die App auf, mit der er sein Vorhaben verwaltete. Erstes Teilprojekt abgeschlossen.
In wenigen Stunden würde er den zweiten grünen Haken setzen können. Danach würde es schwieriger werden. Doch er hatte Geduld.
Kapitel 1
Halb fünf Uhr nachmittags. Endlich war es Zeit, den gemütlichen Teil des Tages einzuläuten. Nach exakt acht Stunden im Büro war Marcus Lauer wieder zu Hause und ließ die Tür seines Reihenhauses hinter sich ins Schloss fallen. Als Kriminaloberkommissar beim Hamburger Landeskriminalamt kannte er sich mit den Vorschriften des Waffengesetzes aus, dennoch verstaute er seine Dienstwaffe in der Flurkommode. Da er alleine lebte, hatte er den Tresor seit Monaten nicht mehr benutzt. Eigentlich gab es nicht einmal einen vernünftige Grund, warum er die Walther überhaupt noch jeden Tag trug. Vermutlich eine alte Gewohnheit. Sein Job bestand heute, im Gegensatz zu früher, im Wälzen von Akten, da bestand höchstens die Gefahr, dass er sich am Papier schnitt.
Mit einer Flasche Bier setzte Marcus sich auf die Terrasse. In der Sonne war es warm genug, um im T-Shirt draußen zu sitzen. Er überflog auf seinem Smartphone die Schlagzeilen eines Nachrichtenmagazins und überlegte wieder einmal, das monatliche Abo zu kündigen. Es gab nicht einen Artikel, der ihn interessierte. Er war jedoch zu bequem, sich seinen E-Book-Reader aus dem Haus zu holen, und klickte sich gelangweilt durch verschiedene Webseiten. Er wollte schon weiterscrollen, als ihm eine Überschrift auffiel. Wintereinbruch auf den Kanaren. Wenn das keine Ironie war. Er saß Anfang März in Hamburg bei über zwanzig Grad auf seiner geschützten Terrasse, während bei seiner Ex-Frau und seiner Tochter am Vortag Temperaturen um den Gefrierpunkt geherrscht hatten. Mehr als einen Anflug von Schadenfreude verschwendete er jedoch nicht an seine ehemalige Familie, dafür waren ihm Frau und Tochter in all den Jahren einfach zu fremd geworden.
Marcus studierte gerade die Neuankündigungen auf Netflix, als es zweimal energisch an der Haustür klingelte. Wenn er nicht ein neues Bier gebraucht hätte, wäre die Versuchung groß gewesen, die Störung zu ignorieren. Er erwartete keinen Besuch, und auf Paketzusteller, die ihm eine Sendung für irgendeinen Nachbarn zur Aufbewahrung andrehen wollten, konnte er verzichten.
Auf dem Weg zum Kühlschrank warf er einen flüchtigen Blick aus dem Küchenfenster und vergaß im nächsten Moment, was er eigentlich vorgehabt hatte.
Ein Mädchen, eher eine junge Frau, stand einige Meter vor dem Haus und betrachtete es neugierig. Die langen blonden Haare waren zu einem lockeren Zopf zusammengebunden, sie war braun gebrannt und trug eine Jacke, dir ihr viel zu groß zu sein schien. Neben ihr lag ein Rucksack im Militärlook auf dem Boden, der Platz genug bot, um damit auf Weltreise zu gehen.
Marcus blinzelte. Tatsächlich. Das war Valerie. Seine Tochter litt nicht auf Teneriffa unter den kalten Temperaturen, sondern stand in Hamburg vor seinem Haus. Er konnte froh sein, dass er sie überhaupt erkannte. Sie hatten sich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Früher hatte sie sich telefonisch an ihrem Geburtstag und zu Weihnachten für seine Geldgeschenke bedankt. Seit einigen Jahren schickte sie ihm nur noch eine WhatsApp. Wenn seine Ex-Frau ihm nicht pflichtschuldig einmal im Monat ein Foto über den gleichen Messengerdienst schicken würde, dann … Valerie trat vor und trommelte energisch gegen die Tür.
Eilig öffnete er. »Na, das ist mal eine Überraschung.«
Valerie musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Papa?«
Die Frage fuhr ihm direkt ins Herz. Natürlich. Ihr hatte niemand Fotos von ihm geschickt. Er nickte stumm, weil er seiner Stimme nicht traute.
Sie wuchtete den Rucksack hoch. »Na, dann happy Familienzusammenführung. Mom meinte, das Haus sei groß genug, dass ich hier wohnen kann. Lässt du mich rein, oder …«
Obwohl sie ihn beinahe trotzig ansah, bemerkte er, dass ihr Blick unsicher umherhuschte.
»Komm«, sagte er lediglich und wich zurück.
Sie ließ ihr Gepäckstück im Flur auf den Boden fallen.
»Ich … Ich wollte mir gerade ein Bier holen. Willst du auch eins?« Er rechnete rasch nach. Sechzehn. Sie war alt genug. »Auf der Terrasse kann man noch in der Sonne sitzen. Und es ist wärmer als bei dir zu Hause.«
»Okay.«
Sie zog die Jacke nicht aus, kramte aber in einem Fach ihres Rucksacks herum, bis sie einen zerknitterten Umschlag in der Hand hielt. Er sah sie neugierig an. Als sie keine Anstalten machte, ihm etwas zu sagen, geschweige denn zu erklären, drehte er sich um. »Küche ist hier rechts. Man kommt da auf die Terrasse und auch durchs Wohnzimmer.«
Während Marcus zwei Flaschen Jever öffnete, dämmerte ihm langsam, was gerade geschehen war. Seine Tochter war hier, und, wie es aussah, würde sie auch nicht so schnell wieder gehen. Doch wie sollte das funktionieren? Mit sechzehn musste man doch noch zur Schule gehen, oder nicht? Wein und Bier kaufen und trinken durfte man in dem Alter allerdings schon, das wusste er.
Unsicher sah er sich um. Sie saß bereits draußen. Auf seinem Stuhl. Na, das konnte ja lustig werden.
Nachdem Marcus die Flaschen auf dem klapprigen Tisch abgestellt und sich ein zweites Stuhlkissen zurechtgelegt hatte, schob sie ihm den Umschlag hin.
»Moms Einverständniserklärung, dass ich bei dir wohnen kann. Offiziell teilt ihr euch ja das Sorgerecht, und es dürfte keine Probleme geben, aber man weiß ja nie. Ab Montag gehe ich dann hier aufs Gymnasium. Den Unterhalt für mich musst du ihr nicht mehr überweisen, weil ich jetzt ja hier wohne.«
Und er wurde überhaupt nicht gefragt? Gut, er machte sich in seinem Job nicht gerade kaputt, aber er schätzte seine Ruhe und sein gewohntes Leben.
»Und auf die Idee, mich zu fragen oder vorzuwarnen, seid ihr nicht gekommen?«
Sie sah an ihm vorbei zu einer Amsel, die in einem Lebensbaum verschwand. »Dann hättest du vielleicht Nein gesagt, und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Mom kenne ich, dich nicht. Das will ich jetzt ändern. Außerdem habe ich mit einem Abi von einer deutschen Schule bessere Aussichten auf einen Studienplatz.«
Vermutlich wäre das der passende Zeitpunkt, um sie nach ihren Zukunftsplänen zu fragen, er tat es aber nicht. Ihre Worte wirkten einstudiert, dazu noch das leise Zittern ihrer Unterlippe. Noch vor wenigen Minuten hätte er es nicht für möglich gehalten, aber irgendwo tief in ihm verborgen empfand er noch väterliche Gefühle für dieses Mädchen, obwohl sie ihm völlig fremd war.
Er griff nach seinem Smartphone, rief eine App auf und schob ihr das Gerät zu. »Da. Das WLAN-Passwort.«
Valerie sprang auf. »Ich muss kurz auf die Toilette.«
Sie war schnell, aber nicht schnell genug. Er hatte noch die Tränen in ihren Augenwinkeln gesehen.
Wenig später kehrte seine Tochter zurück, nahm sich ihre Flasche Bier und prostete ihm zu. »Auf uns.«
Er erwiderte den Gruß, wusste aber immer noch nicht, was er eigentlich mit ihr anfangen sollte.
Am besten, er plante einen Schritt nach dem anderen. Sie brauchte Bettwäsche, Handtücher, Platz im Badezimmer. Er musste seinen Krempel aus dem Gästezimmer rausholen und im Keller verstauen. Essen. Was mochte sie? Ernährten sich die jungen Leute heutzutage nicht alle vegan?
»Isst du Salamipizza?«, fragte er, während sie die Daten seines Routers in ihr Handy eingab.
»Ja, sicher. Wieso denn nicht?«
»Weil es doch gerade in ist, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren.«
Sie pustete sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Ich hasse Massentierhaltung. Zu Hause … Ich meine, auf der Insel, wissen wir noch, wo das Fleisch herkommt. Pizza und McDonald’s gehen mal in Ordnung, nur nicht so oft. Damit unterstützen wir die Falschen, und es ist ungesund. Besser ist es, sich nachhaltig zu ernähren. Also ja, ich esse viel vegetarisch, aber nicht nur.«
»Dann kannst du kochen?«
»Ja. Du nicht?«
»Nur, wenn du es kochen nennst, die Pizza aus der Verpackung zu nehmen und in den Ofen zu schieben. Ich esse mittags in der Kantine. Da reicht abends eine Scheibe Brot und am Wochenende eben was Schnelles aus dem Ofen oder vom Imbiss.«
Normalerweise war Haus des Geldes seine Lieblingsserie, heute schaltete Marcus sie nach wenigen Minuten aus. Die Pläne des Professors konnten ihn nicht fesseln. Es war still im Haus. So, als wäre seine Tochter gar nicht hier. Aber sie war es, und deswegen störte ihn die Stille.
Sie hatten eine Salami- und eine Mozzarellapizza gerecht geteilt und über Belanglosigkeiten geredet. Seine Versuche, sie auszuhorchen, waren kläglich gescheitert. Er wusste immer noch nicht, warum Valerie beschlossen hatte, die Insel zu verlassen.
Mit ihren Bluetooth-Ohrsteckern hatte sie sich ins Gästezimmer zurückgezogen, aus dem sie zuvor gemeinsam eine Unmenge Krempel geschleppt hatten. Er war eindeutig zu bequem geworden und hatte sich vorgenommen, die aussortierten Bücher, Klamotten und leeren Kartons in den nächsten Tagen endgültig zu entsorgen, ehe sie monatelang im Keller herumlagen.
Ihr einziges Gesprächsthema waren Bücher und Serien gewesen, bei denen sie keinen einzigen gemeinsamen Nenner gefunden hatten. Er kannte die Namen, die sie nannte, nicht einmal. Eine gute Voraussetzung für das künftige Zusammenleben war das nicht gerade.
Unschlüssig betrachtete er das Handy. Sollte er seine Ex-Frau darüber informieren, dass Valerie heil angekommen war? Das hatte seine Tochter doch bestimmt selbst erledigt.
Er nahm das Smartphone in die Hand und rief WhatsApp auf. Auch wenn er die App nicht oft nutzte, fiel ihm sofort auf, dass seine Ex-Frau ein neues Profilbild hatte. Neugierig sah er es sich an. Ein Sonnenaufgang mit den Worten »Endlich frei«.
Er legte das Handy zurück auf den Tisch.
Kapitel 2
Er war ein Meister der Täuschung. Nichts erinnerte mehr an den Jungen von früher. Das teure Seidenhemd, dazu die graue Anzughose und die protzige Uhr an seinem Handgelenk – alles an ihm schrie Geld und Macht. Es fiel ihm überraschend leicht, immer wieder in eine neue Rolle zu schlüpfen. Er konnte sein, wer er wollte.
Als erfolgreicher Geschäftsmann hatte er in den letzten Wochen regelmäßig den Sex-Club besucht. Anfangs hatte er befürchtet, in dieser Welt nicht überzeugend auftreten zu können. Doch letztlich hatte er sogar Gefallen daran gefunden, den dominanten Liebhaber zu spielen. Statt einige Stunden dort aus Pflichtgefühl zu verbringen, um sein nächstes Opfer in Sicherheit zu wiegen, hatte er ein gewisses Vergnügen empfunden und geduldig gewartet, bis er seinem Ziel näher kam. Zuerst hatte er sie bewusst ignoriert, um ihr Interesse zu wecken, doch heute war sie endlich an der Reihe.
»Komm mit«, befahl er.
Gehorsam rutschte sie von ihrem Barhocker. Nichts erinnerte in diesem Moment an die Frau, die es gewohnt war, Anweisungen zu geben.
Stumm deutete er auf eines der Separees. Den Blick bereits auf den Boden gerichtet, wie es sich für eine unterwürfige Sub gehörte, ging sie dorthin. Beinahe hätte er bei dem Anblick verächtlich geschnaubt.
Er wartete exakt zwei Minuten, ehe er ihr mit seinem kleinen schwarzen Lederrucksack in der Hand folgte. In diesem Etablissement war es völlig normal, dass die Männer ihr eigenes Spielzeug mitbrachten.
Kaum hatte er den kleinen Raum betreten, dimmte er das Licht, bis alles beinahe in völliger Dunkelheit lag. Er wollte nicht riskieren, dass sie ihn so kurz vor dem Ziel noch erkannte, obwohl das natürlich nahezu ausgeschlossen war.
»Shibari?«, fragte er knapp.
Ihr Einatmen klang wie ein Seufzen, während sie eifrig nickte. In einem Gespräch, das sie vor einigen Tagen mit einer anderen Besucherin geführt und er mitangehört hatte, war der Name der traditionellen japanischen Fesselungstechnik gefallen. Ihr war nicht aufgefallen, dass er jedes Wort verfolgt hatte, obwohl er scheinbar mit einer Blondine im roten Kleid geflirtet hatte. Jetzt hatte er sie. Wenn sie misstrauisch wurde, war es zu spät.
»Bitte, tu mir nicht weh«, bat sie.
O nein, das würde er nicht, das würde sie schon selbst erledigen. Er schlug ihr sanft mit der flachen Hand auf die Wange. »Wie heißt es?«
»Bitte, tu mir nicht weh, Herr.«
»Ich werde dich lehren, dass Schmerzen Lust sind und in Demut Leidenschaft liegt.« Blablabla. Zur Vorbereitung hatte er die gängige Literatur gelesen, die es mittlerweile in jedem Bahnhofsladen gab. »Wenn du dich unwohl fühlst, so sage ›Hamburg‹.«
»Ja, Herr.«
»Ausziehen. Langsam. Leg dich auf den Bauch, Hände auf den Rücken.«
Sofort ließ sie sich auf das Doppelbett sinken und bot ihm eine ganz ansehnliche Stripshow. Es war beinahe eine Schande, diesen Körper zu vernichten. Aber vielleicht kam es ja nicht so weit. Sie hatte es selbst in der Hand. Sein Körper reagierte bereits, aber der würde heute Abend auf sein Vergnügen verzichten müssen. Nach diesem Abend war der Club für ihn tabu.
»Du wirst nicht ohne meine Erlaubnis kommen. Hast du das verstanden?«
»Ja, Herr.«
»Braves Mädchen.«
Er holte das dünne Seil aus seinem Rucksack und begann, damit ihre Hände zu fesseln. Als er sicher war, dass sie sich nicht mehr selbst befreien konnte, setzte er seine Arbeit an den Fußgelenken fort. Nun wurde es komplizierter.
»Ich werde testen, wie bereit du bist.«
Ein wohliges Seufzen war die einzige Antwort. Sanft legte er ihr die Schlinge um den Hals und führte das Seilende den Rücken entlang zu den Füßen. Er drehte sie auf die Seite und bog ihre Beine zurück, bis sie in einem gespannten Halbkreis vor ihm lag. In seiner Hose pochte es bereits schmerzhaft, doch er konnte sich keine Ablenkung erlauben. Darum musste er sich später kümmern.
Mit zusammengebissenen Zähnen rief er sich den Verlauf des Seils ins Gedächtnis. Falsch ausgeführt oder bei zu später Befreiung führte es erst zu höchster Erregung und dann zum Tod.
Sein Opfer keuchte schon leise. Das mit der Erregung klappte hervorragend, nicht nur bei ihr, auch bei ihm. Er ballte die Hand zur Faust, um sich zu fokussieren. Mit einem Ruck zog er das Seil straffer. Nun musste sie sich zusammenkrümmen, um den Druck auf ihrer Kehle zu mildern. Noch wuchs ihre Erregung durch die Drosselung, aber lange würde sie die Beine nicht so weit zurückbiegen können. Sie war zwar schlank, aber nicht besonders sportlich. Sobald ihre Beine nachgaben, würde sie ersticken, aber sie hatte eine Wahl. Sie musste nicht sterben.
Er nahm sein Smartphone aus der Jackentasche und schoss zwei Fotos, auf denen ihr Gesicht und ihr gefesselter Körper gut zu erkennen waren. Das Blitzlicht irritierte sie. Protest löste die Erregung ab.
Etwas Spaß würde er sich noch gönnen. Sanft streichelte er sie, bis sie alles um sich herum wieder vergaß. Die Berührungen und der zunehmende Sauerstoffmangel sorgten dafür, dass es für sie nur noch Lust gab. Die Landung würde verdammt hart sein.
Er näherte sich mit seinem Mund ihrem Ohr. »Du hast die Wahl. Entweder du stirbst, oder du schreist, und es wird jemand kommen, um dir zu helfen, Frau Senatorin. Ich lasse die Tür offen. Aber dann werden die Fotos innerhalb kürzester Zeit viral gehen. Ich schicke Kopien an die Bild und an die Morgenpost.«
Sie erstarrte, dann folgte die Erkenntnis und der vergebliche Kampf gegen die Fesseln. Typisch Politikerin, sie hatte wirklich nicht besonders viel Verstand. Statt ihre Kraft zu schonen, zog sie durch ihre hektischen Bewegungen die Schlinge um den Hals noch enger. Der Knoten war natürlich so gebunden, dass er nicht wieder nachgab.
Er trat auf den Flur hinaus und entfernte sich ohne auffällige Eile. Ehe er den Barbereich erreicht hatte, hörte er ihren gequälten Schrei. Jedem würde klar sein, dass es sich dabei nicht um einen Lustschrei handelte. Einer der Männer, die den Bereich im Auge behielten, lief bereits eilig in das Zimmer.
Sie hatte ihre Wahl getroffen, also schickte er die Fotos los. Sein Ziel war erreicht.
»Das hier kann nicht einmal deine Familie vertuschen«, sagte er zu sich selbst.
Als er in seinem Wagen saß, betrachtete er die Fotos. Perfekt. Dank seiner technischen Kenntnisse war er absolut sicher, dass niemand den Absender der Nachrichten identifizieren konnte. Er setzte einen weiteren Haken in seiner App, um das Teilprojekt abzuschließen. Die Liste war lang. Er bedauerte, dass er bei den nächsten Fällen nur Zuschauer sein würde, doch sehr bald würde es wieder Gelegenheiten geben, bei denen er nach ausreichender Vorbereitung selbst tätig werden konnte.
Kapitel 3
Es gab einen lauten Knall, die Scheibe ging zu Bruch, und im nächsten Moment befand sich Sabrina von Wesenberg mitten in der Hölle. Gerade noch hatte sie mit ihrer Freundin gelacht. Dann hatte Conny nach ihrem Weinglas gegriffen, war aber niemals dazu gekommen, einen Schluck des spanischen Rotweins zu trinken. Ihre Hand war plötzlich blutüberströmt. Das Glas schien sich in Luft aufgelöst zu haben, und Conny hatte klaffende Wunden an Wange und Schläfe. Blut floss ihr übers Gesicht. Es hatte fast die gleiche Farbe wie der Tempranillo, den ihre Freundin so liebte. Für ein paar kostbare Sekunden weigerte sich Sabrinas Verstand, zu begreifen, was geschehen war, dann brach die Realität über sie herein.
Sie nahm alles auf einmal wahr. Die Schreie, den Geruch nach Blut und verschüttetem Wein, das Geräusch von zersplittertem Glas und immer wieder dieses leise, harmlos klingende »Plopp«,gefolgt von einem Klirren oder Krachen. Männer mit schwarzen Skimasken und Waffen, die Sabrina nur aus Filmen kannte, schossen wild um sich, während sie sich durch die Tischreihen bewegten.
Ihre Freundin Conny war kreidebleich, sie starrte auf ihre blutende Hand und schien nichts anderes mehr zu sehen. Sabrina sprang so schnell auf, dass sie ihren Stuhl umstieß. Sie schob den Tisch zur Seite, packte die unverletzte Hand ihrer Freundin und zog sie von der Sitzbank herunter.
Wie eine willenlose Puppe ließ Conny es geschehen. Als sie auf dem Boden lag, verzerrte sich ihre Miene. Sie öffnete den Mund und stieß einen gellenden Schrei aus, der einfach nicht endete. Es klirrte in Sabrinas Ohren. Sie wollte sehen, was geschah, was die Männer vorhatten, doch alles, was sie wahrnahm, war dieser unheimliche Schrei, der ihr einen Schauer über den Rücken jagte.
Einer der Angreifer kam auf sie zu. Er richtete die Waffe auf Connys Kopf, aber der Typ neben ihm hielt ihn zurück. Ohne nachzudenken, schob sich Sabrina zwischen das Gewehr und ihre Freundin, die weiter schrie.
Die Mündung zielte nun auf sie. Für einige Sekunden starrte der Mann Sabrina aus blassen blauen Augen durchdringend an. Dann blickte er auf Conny, und sein Mund verzog sich. Zu was? Zu einer Grimasse? Zu einem Grinsen? Die Maske verbarg zu viel. »Sorg dafür, dass sie ruhig ist«, brüllte er sie an.
Sabrina brachte eine Bewegung zustande, die wohl als Nicken durchging. Der Kerl lief weiter. Groß, schlank, bewegte sich sportlich, eine blonde Strähne sah unter der Maske hervor, registrierte sie automatisch.
»Conny, hör auf. Sei still.«
Es war vergeblich. Sie drang nicht zu ihrer Freundin durch. Soweit Sabrina erkennen konnte, war Connys Hand verletzt, und dazu kamen noch die Schnittwunden im Gesicht. Sie musste etwas tun. Der Kerl sah wieder zu ihr rüber und hob bedeutungsvoll sein Gewehr höher. Oder war es eine Maschinenpistole? Egal. Das gab es doch eigentlich alles gar nicht. Sie lebten in Hamburg und nicht im Wilden Westen. Vor Kurzem hatte sie zwar gelesen, dass ein anderes Restaurant überfallen und Gäste verletzt worden waren, aber das nicht weiterverfolgt. Und jetzt war sie mittendrin in einem solchen Überfall.
Sabrina schüttelte den Kopf, um klar denken zu können. Dann riss sie sich ihr Halstuch herunter und stopfte es Conny in den Mund. Ihre Freundin verbiss sich in dem Stoff, wie es früher Sabrinas Hund mit seinen Bällen getan hatte. Endlich verstummte der Schrei. Andere Geräusche drangen in Sabrinas Bewusstsein. Das leise Weinen eines Kindes. Das Krachen, als ein Tisch umgestoßen wurde. Conny krallte sich mit der unverletzten Hand in Sabrinas Arm. Ihre Augen bewegten sich unkontrolliert hin und her. Sie sog heftig Luft durch die Nase ein.
Sabrina umarmte sie fest. »Es wird alles gut. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Du wirst ganz bestimmt wieder gesund.«
Conny verdrehte die Augen und sackte zusammen. Vielleicht war die Bewusstlosigkeit das Beste, was ihrer Freundin in diesem Moment passieren konnte. Rasch entfernte Sabrina das Tuch. Irgendwann würden sie vielleicht zusammen über die Sache mit dem Halstuch lachen können. Schließlich handelte es sich um ein Geschenk von Conny, und ihre Freundin hatte Sabrinas Hund auch geliebt. O Gott, was gingen ihr nur für absurde Gedanken durch den Kopf? Völlig verrückt. Erst einmal mussten sie hier lebend rauskommen.
Vergeblich versuchte sie, sich zu erinnern, was sie vor Ewigkeiten im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hatte. War die stabile Seitenlage wichtig? Conny atmete regelmäßig, aber das viele Blut … Ein weiteres Mal kam das Tuch zum Einsatz. Sabrina wickelte es fest um Connys Hand und kämpfte dabei gegen einen heftigen Würgereiz an. Sogar als absoluter Medizinlaie sah sie, dass die Verletzung schwer war. Das Weiße waren wohl Knochensplitter und … Sabrina presste die Lippen zusammen und wischte sich die blutige Hand an ihrer schwarzen Jeans ab. Wie viel Zeit mochte vergangen sein? Wo blieb die Polizei? Was wollten diese Kerle eigentlich? Angst und Schrecken verbreiten? Das war ihnen gelungen.
Vorsichtig schob Sabrina sich einige Zentimeter vorwärts. Es kostete sie einiges an Überwindung, aber sie hob den Kopf so weit, dass sie Einzelheiten erkennen konnte.
Fünf Männer, zwei von ihnen schlugen Guido, den Besitzer des Restaurants, zusammen, die anderen beobachteten die Gäste. Wieder stieg Übelkeit in Sabrina auf, die sie kaum noch in den Griff bekam. Sie mochte den Gastwirt. Er war immer gut gelaunt und hatte Conny und ihr nach dem Essen meistens noch einen Cappuccino spendiert. Sein Kopf flog hin und her, während die Schläge auf ihn einprasselten. Sabrina begann zu zittern. Sie würden ihn umbringen, wenn keiner was tat. Sie musste … Ein heftiger Ruck an ihrem Arm, und sie fand sich am Boden wieder. Fassungslos starrte sie den Mann an, der jetzt direkt neben ihr lag. Der hatte vorher am Nachbartisch gesessen, zusammen mit einer Frau und zwei Mädchen, die sich so ähnlich sahen, dass es wohl Zwillinge waren.
Sie hatte nicht einmal gemerkt, dass sie dabei gewesen war, aufzustehen. Sie wusste nicht, ob sie ihn wütend anbrüllen oder dankbar sein sollte.
»Das hat keinen Zweck. Die drei anderen behalten jede Bewegung im Auge, und sie haben Maschinenpistolen. Was wollen Sie dagegen ausrichten?«
Er hatte recht. Die drei Männer hatte sie völlig ausgeblendet. Der, der vorher Conny bedroht hatte, sah zu ihr rüber. Ihr Zittern wurde heftiger. Schon als Kind hatte sie Ungerechtigkeit gehasst und sich etliche Male deswegen mit Lehrern oder größeren Kindern angelegt. Aber das hier war sogar schlimmer als damals der Streit mit … Ihre Erinnerungen machten eine Art Vollbremsung, als ihr bewusst wurde, wie abstrus diese Gedanken waren. Der brutale Überfall hatte nichts mit einem Streit auf dem Schulhof gemeinsam. Nur hilflos zusehen zu können, wie sie den Mann umbrachten, war schlimmer als alles, was sie bisher erlebt hatte. Ihr fiel ein, dass auf dem Tisch ihr Smartphone liegen musste. Die Polizei zu alarmieren, war zwar nicht viel, aber besser als nichts. Sie drehte sich um, bis sie den Tisch sehen konnte. Aufstehen und das Telefon nehmen schied aus. Aber vielleicht konnte sie an der Tischdecke ziehen, bis … Na sicher, das wäre ja sehr unauffällig, wenn sämtliche Teller und Gläser zusammen mit ihrem Telefon auf den Boden krachten.
Der Vater der Mädchen beobachtete sie. »Was haben Sie jetzt schon wieder vor?«
»Telefonieren.«
»Sie hätten eine Kugel im Kopf, ehe Sie die Nummer gewählt haben. Falls Sie an den Notruf denken, das hat meine Frau schon erledigt. Aber viel kann die Polizei nicht tun. Die wird warten, bis die Täter draußen sind. Alles andere wäre zu gefährlich.«
Sabrina sah zu den Zwillingen hinüber, die sich an die Mutter klammerten.
Ihre Fantasie spielte verrückt. Als ob das aktuelle Bild nicht erschreckend genug wäre, malte sie sich jetzt aus, wie das Steakhouse von Polizisten umstellt wurde, während sie Stunden oder sogar Tage als Geiseln dort ausharren mussten. Der Albtraum wurde immer schrecklicher.
»Das geht nicht. Ich meine, dass die Polizei den Laden umstellt. Meine Freundin braucht dringend einen Arzt. Sie blutet so stark. Und ihr Gesicht …«
»Guido ist auch verletzt! Die Polizei weiß schon, was sie zu tun hat.«
»Und woher wollen Sie das wissen?«, fuhr Sabrina ihn leise an.
»Weil ich … Sie hauen ab.«
Ehe Sabrina begriff, was er gesagt hatte, rannten die bewaffneten Männer an ihr vorbei ins Freie. Die Mutter der Kinder stand plötzlich neben ihr. »Bleib bei deiner Freundin und pass bitte kurz auf die Kinder auf. Wir sehen nach, ob wir Guido helfen können.«
Ehe die Bitte richtig bei Sabrina angekommen war, standen die zwei Mädchen vor ihr. Die Kinder schienen jetzt eher neugierig als verängstigt zu sein und waren gegenüber Sabrina damit klar im Vorteil. Also, der Reihe nach. Die Verbrecher waren verschwunden. Conny … Was war mit Conny? Sabrinas Kopf flog herum. Alles klar, sie lag immer noch reglos dort und atmete. Das konnte Sabrina erkennen, aber sie hatte keine Ahnung, was sie jetzt tun sollte.
Männer in roten Anzügen und in dunkelblauen Uniformen stürmten in das Lokal. Polizisten und Sanitäter. Einer von den Roten stand im nächsten Moment direkt vor ihr. Der war doch noch keine zwanzig. Verdammt, ihr Gehirn schien immer wieder merkwürdige Sondertouren zu unternehmen. Das Alter war doch nicht wichtig. Der Sanitäter schob sie und die Mädchen einfach zur Seite und hockte sich neben Conny hin. Sie erkannte nicht, was genau er tat, aber dann sprach er kurz in ein Gerät, das wie ein klobiges Handy aussah.
Natürlich, ihre Freundin musste sofort in ein Krankenhaus. Aber nicht alleine. Sie würde mitfahren. Aber was sollte sie mit den Mädchen tun? Nicht, dass sie bisher viel für sie getan hatte. Im nächsten Moment stand schon wieder die Mutter der Kinder vor ihr.
»Danke.«
»Ich habe doch gar nichts getan. Was ist mit Guido?«
»Das sah schlimmer aus, als es ist. Er wird es überleben.«
Obwohl das eine gute Nachricht war, wurden plötzlich ihre Knie weich, und sie lehnte sich gegen den Tisch. Ihr Blick fiel auf das Rumpsteak, auf das sie sich vor einer gefühlten Ewigkeit so gefreut hatte. Sie sah auf die Uhr. Das ganze Drama hatte keine zehn Minuten gedauert.
Ein leises Gespräch lenkte sie ab, als sie die Stimme des Vaters der Mädchen erkannte, hörte sie genauer hin:
»Übernimmst du die Leitung?«, fragte ein Unbekannter.
»Nein, ich war gar nicht hier. Es sei denn, Tannhäuser beschließt etwas anderes.«
»Na, wenn ich dich so anschaue, wäre es wohl auch besser, wenn ein anderes Team die Ermittlungen übernimmt.«
»Was meinst du?«
»Du siehst aus, als ob du die Täter in der Luft zerreißen willst.«
»Damit liegst du verdammt richtig.«
Sabrina fuhr herum und hätte beinahe das Gleichgewicht verloren. Der Vater war also auch Polizist, das erklärte einiges, und er hatte einen Namen erwähnt, den sie sehr gut kannte. Tannhäuser, das war nicht nur der Hamburger Polizeipräsident, sondern auch ihr Patenonkel. Ihr Entschluss stand fest. Sie würde dafür sorgen, dass die Verbrecher zur Verantwortung gezogen wurden. Sabrina wusste noch nicht, wie sie das anstellen sollte, aber sie hatte bisher alles geschafft, was sie sich vorgenommen hatte. Na ja, fast. Ihr ursprüngliches Berufsziel war Astronautin gewesen, stattdessen war sie Reporterin geworden. Normalerweise gehörten nette Stadtteilgeschichten oder andere Themen, bei denen es um das Zwischenmenschliche ging, zu ihren Aufgaben, aber dieses Mal würde sie eine andere Geschichte schreiben. Die Täter würden dafür bezahlen, was sie Conny und Guido angetan hatten.
Kapitel 4
Nicht schießen! Er wusste, dass es ein Traum war und dass er nicht abdrücken durfte. Doch er würde es tun. Und er kannte die Folgen nur zu gut: der blutüberströmte Kopf des Kindes, der gellende Schrei der Mutter.
Schweißgebadet fuhr Marcus Lauer hoch. Wieder einmal war es so weit. Die Grenzen zwischen Wachen und Träumen verschwammen, und er durchlebte die schrecklichsten Minuten seines Lebens erneut, immer und immer wieder. Jedes Mal hatte er die verzweifelte Hoffnung, dass er den verhängnisvollen Schuss nicht abgeben würde, durch den nicht der Verbrecher, sondern das unschuldige Kind sterben würde.
Er riss sich das verschwitzte T-Shirt herunter und griff nach dem Sweatshirt und den Shorts, die schon neben dem Bett lagen. Im Flur warteten seine Laufschuhe und eine gefüllte Trinkflasche auf ihn. Fast hätte er die Tür hinter sich ins Schloss geworfen, gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass er nicht mehr alleine in dem kleinen Reihenhaus lebte. Seine Tochter hatte vor über einem Monat mit einem gigantischen Rucksack vor der Tür gestanden, und er hatte keine Ahnung, was er mit ihr anfangen sollte. Sechzehnjährige Teenager waren ihm fremd. Wenigstens war ihm klar, dass sie es ihm nicht danken würde, wenn er sie weit vor vier Uhr morgens aus dem Schlaf reißen würde.
Läufern wurde empfohlen, das Tempo langsam zu steigern. Das mochte im sportmedizinischen Sinne vernünftig sein, aber es half nicht, das Denken abzuschalten und die Bilder aus seinem Kopf zu vertreiben. Marcus sprintete die ersten Meter zu den hämmernden Klängen von Helloween. Der ziehende Schmerz in seinen Muskeln war wie ein alter Freund. Nur langsam nahm er das Tempo zurück, lag damit aber immer noch deutlich über seiner üblichen Geschwindigkeit. Die Temperatur war mit gerade mal sechs Grad für Anfang Mai verhältnismäßig kühl, eigentlich war es zu kalt, um in Shorts zu laufen. Doch das war Marcus egal. Mehr noch: Jede Unannehmlichkeit bedeutete Ablenkung. Eine Psychologin hatte versucht, ihm zu erklären, dass seine Joggingrunden eine Form der Selbstgeißelung waren. Na, sicher doch. Es ging darum, den Kopf wieder freizubekommen, und die Erinnerung, die wie eine angriffslustige Bestie im Hintergrund lauerte, zurück in den Käfig zu drängen.
Die ersten Kilometer lief er an der Außenalster entlang. Tagsüber waren die Wege hier überfüllt, um diese Zeit menschenleer. Nach knapp sechs Kilometern lag die Elbe vor ihm. Der Fluss schlief nie. Schiffe waren dunkle Schatten, die nur anhand ihrer roten und grünen Positionslichter zu erkennen waren und sich langsam Richtung Nordsee bewegten. Am anderen Ufer war der Containerhafen hell erleuchtet. Einige wenige Passanten gingen mit ihren Hunden spazieren. Ansonsten war Marcus alleine. Das genoss und brauchte er in diesen Momenten. Er bog Richtung Landungsbrücken ab. Sein Ziel war die HafenCity, erst dort würde er umkehren. Insgesamt betrug seine Laufstrecke etwas über sechzehn Kilometer, für die er mittlerweile deutlich unter zwei Stunden brauchte.
Das Wasser der Elbe roch immer leicht brackig und vermischte sich mit dem Gestank nach Schiffsdiesel. Marcus mochte die Mischung. Mein Hamburg lieb ich sehr … Die Hymne der Hamburger Fußballfans, die ihm in den Sinn kam, passte zwar nicht so ganz zu den Heavy-Metal-Klängen aus seinen Kopfhörern, traf es aber. Hier war er zu Hause. Früher hatte er von einer Wohnung mit Blick auf die Elbe geträumt, heute wollte er einfach nur seine Ruhe haben. Meistens gelang ihm das. Aber es gab Ausnahmen. Dann wünschte er sich verzweifelt, die Vergangenheit ändern zu können. Sich unerfüllbare Dinge zu wünschen, brachte ihn jedoch nicht weiter. Das hatte ihm sein Großvater immer wieder gepredigt.
Seine Füße bewegten sich in einem steten Rhythmus. Meter für Meter legte er zurück. Endlich lag die Brücke vor ihm, über die er die HafenCity erreichte. Er blieb stehen und trank durstig. Wie oft hatte er schon hier auf der Brücke gestanden und seine Trinkflasche geleert? Wieder musste er an seinen Großvater denken. Unzählige Male hatte an diesem Ort seine Hand auf dem Knauf seiner Dienstpistole gelegen. Viel zu oft hatte er sich die Mündung gegen die Schläfe gepresst. Es wäre so einfach. Dann läge alles hinter ihm. Die Bilder. Die Vorwürfe. Die schlaflosen Nächte. Aber er war nie ein Feigling gewesen, und er würde mit den Folgen seines Fehlers weiterleben. Es war überflüssig, dass sein Großvater ihm das Versprechen abgerungen hatte, »keinen Blödsinn zu machen«. Das hätte der Mann, bei dem er aufgewachsen war, eigentlich wissen müssen.
Seitdem seine Tochter bei ihm wohnte, ließ Marcus seine Dienstwaffe zu Hause. Allerdings war er seit ihrem Auftauchen fast jede Nacht gelaufen. Ihre Rückkehr hatte ihm gezeigt, was er verloren hatte. Jetzt war Valerie wieder bei ihm, und er wusste nicht, was er mit ihr anfangen sollte. Zehn Jahre hatten aus seiner sechsjährigen Tochter einen Menschen gemacht, der noch nicht erwachsen, aber auch kein Kind mehr war. Er kam nicht einmal mit seinem eigenen Leben zurecht. Wie sollte er da auf einen Teenager aufpassen?
Er lief weiter. Für den Rückweg wählte er die Straße, die nur durch einen Kanal von der Speicherstadt getrennt war. Die Fassaden der alten Häuser ließen längst vergangene Zeiten plötzlich zum Greifen nah erscheinen. Marcus quetschte einen Fluch zwischen seinen zusammengebissenen Zähnen hervor, als er sah, was sich im Windfang eines Nobelrestaurants abspielte. Drei Jugendliche hatten sich vor dem Obdachlosen aufgebaut, der von allen nur Astra gerufen wurde und sich eigentlich eher in der Gegend rund um Marcus’ Haus aufhielt. Der Mann war mit seinem Einkaufswagen in Hoheluft und Eppendorf ein vertrauter Anblick. Den Namen verdankte er seiner Entschlossenheit, nur Astra-Bier zu trinken. Wie eine friedliche Zusammenkunft wirkte das Ganze hier allerdings nicht. Marcus biss die Zähne noch fester zusammen. Nicht heute, am besten niemals! Er wollte sich nicht einmischen. Aber er brachte es auch nicht fertig, einfach weiterzulaufen. Bei der nächsten Straße links abbiegen und die Polizei rufen. Das war eine akzeptable Lösung. Doch da war die leise Stimme in seinem Hinterkopf, die ihm sagte, dass seine Kollegen erst dann eintreffen würden, wenn Astra bereits krankenhausreif geprügelt worden war – oder Schlimmeres.
Er hatte auf die harte Tour gelernt, dass es nichts brachte, den Helden zu spielen, und dennoch beschleunigte er sein Tempo und sprintete auf die Jugendlichen zu. Verdammt, die sahen aus wie sechzehn und waren vermutlich höchstens vierzehn. Warum lagen die Jungs um die Zeit nicht im Bett und schliefen? Warum mussten sie ausgerechnet dann versuchen, Astra sein kümmerliches Pfandgeld zu stehlen, wenn er vorbeikam? Und warum war der alte Penner überhaupt hier? Das Leben war kein Ponyhof, aber musste es ständig der größtmögliche Hundehaufen für ihn sein? Anscheinend ja. Bei dem Alter der Teenager brachte er es nicht fertig, seine Waffe zu ziehen. Das Letzte, was Marcus gebrauchen konnte, war ein weiteres Gesicht, das ihn bis in seine Träume verfolgte. Eins reichte. Erst dann fiel ihm ein, dass seine Waffe zu Hause im Safe lag. Es wurde immer besser.
»Hey, was macht ihr da?«
Die drei Jungs erschraken kurz und hielten sich dann wieder für cool und unbezwingbar. Astra, blass, mit blutender Nase, sah ihn erleichtert an. Fuck! Wie weit war es mit der Gesellschaft gekommen, wenn Kids Penner ausraubten und kaputte Typen wie er für Gerechtigkeit sorgen mussten? Die drei hielten Klappmesser in den Händen. Ein Wunder, dass sie sich damit noch nicht selbst einen Finger abgeschnitten hatten. Anders als im Film traten sie nicht brav einer nach dem anderen gegen ihn an, sondern stürmten wie auf ein geheimes Zeichen gemeinsam auf ihn zu. Marcus handelte so, wie er es vor Ewigkeiten gelernt hatte. Den Kräftigsten von ihnen schickte er mit einem Tritt in den Solarplexus zu Boden, wo der Junge die nächsten Minuten damit beschäftigt war, nach Atem zu ringen. Marcus duckte sich weg, um dem ungelenken Messerangriff des Zweiten auszuweichen, und trat ihm seitlich gegen das Knie. Das Knacken der Kniescheibe klang widerlich. Blieb der Dritte. Er schien zwischen Flucht und Angriff zu schwanken. Marcus verkürzte den Entscheidungsprozess mit einem Ellbogenschlag gegen die Schläfe. Mit verdrehten Augen sackte der Junge bewusstlos zusammen. Seine Kumpels waren noch damit beschäftigt, zu heulen. Von ihrer Kampfbereitschaft war nichts mehr übrig. Fehlte nur noch, dass sie nach ihrer Mami riefen. Überrascht stellte er fest, dass seine alten Reflexe offenbar noch nicht komplett eingerostet waren. Er hatte die drei Jungs lehrbuchmäßig abgefertigt und dabei ein Minimum an Gewalt angewendet, auch wenn seine Opfer dies vermutlich anders sahen.
Astra hatte sich hochgerappelt und sah nun auf die Teenager herab. »Das sind doch noch Kinder. Was sind denn das für Eltern? Vermutlich die, die tagsüber mit gerümpfter Nase an mir vorbeistolzieren. Ich danke dir, Running Man.«
Running Man? Mit dem Spitznamen konnte Marcus leben. »Brauchst du einen Arzt?«
»Nein, die Nase blutet kaum noch. Aber ich glaube, die Kinder könnten einen gebrauchen.«
»Dann rufe ich die Polizei an, die kann die Kids einsammeln.«
Astra nickte. »Mach das. Ich habe für heute genug geschlafen und ziehe weiter.«
Eigentlich müsste Marcus ihn aufhalten und dafür sorgen, dass Astra den Überfall zu Protokoll gab. Und dann? Ein endlos langer Ermittlungsprozess, an dessen Ende zwei Wochenenden Jugendarbeit standen. Das war es nicht wert. Er nickte. »Einverstanden, dann warte ich, bis du unterwegs bist, und telefoniere dann.«
»Danke.« Astra warf ihm etwas zu. Instinktiv fing Marcus den Gegenstand auf. Zum ersten Mal seit Wochen musste er lachen. Es war eine Flasche Bier, natürlich Astra. »Vielen Dank, ich hoffe, du bist nicht beleidigt, wenn ich es später trinke?«
Astra schüttelte den Kopf. »Aber nein. Und wann immer du etwas brauchst, wird der alte Astra dir helfen. Ein Wort von dir genügt.«
»Ich werde daran denken.« Marcus half ihm, seine Sachen in den Einkaufswagen zu verfrachten. Erst, als Astra abmarschbereit war, rief er den Notruf an.
Astra hatte aufmerksam zugehört und hielt den Kopf etwas schief. »Bist du selbst ein Bulle? Ich kenne niemanden, der RTW sagt, wenn er Krankenwagen meint.«
Tja, war er noch einer? Offiziell schon, aber sicher war sich Marcus da nicht. Da er sich selbst die Frage nicht beantworten konnte, wechselte er einfach das Thema. »Wo willst du hin?«
»Richtung Bundesbank, da gibt es ein nettes Plätzchen am Fleet.«
»Ich bringe dich hin.«
Astra widersprach nicht. Gemeinsam liefen sie durch die nächtlichen Straßen, während in der Ferne schon die Martinshörner erklangen. Als Astra schließlich stehen blieb und seine Plastikplane auf dem Boden ausbreitete, pfiff Marcus leise durch die Zähne. Der Platz war mehr als nett: eine Grasfläche an der Rückseite eines Gebäudes, direkt an einem der Kanäle, die Hamburg wie ein Netz durchzogen. Er blickte erst auf seine Uhr, dann auf die Flasche, die er immer noch in der Hand hielt. Schon halb fünf. Warum eigentlich nicht? »Sag mal, hast du einen Öffner?«
Astra hob auf unnachahmliche Art und Weise eine Augenbraue. »Brauche ich so was?«
Er nahm ihm die Flasche aus der Hand, löste den Kronkorken mit einem gezielten Schlag gegen den Einkaufswagen, und hielt sie ihm wieder hin. »Hier, lass es dir schmecken. Verdient hast du es dir. Die hätten mich ins Krankenhaus oder direkt auf den Friedhof geprügelt. Sie wollten auch etwas anzünden, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie mich oder den Wagen gemeint haben.«
Die Worte klangen in Marcus nach, als er die Flasche nahm. Wann war er zum letzten Mal für etwas gelobt worden, oder viel wichtiger, hatte selbst das Gefühl gehabt, etwas richtig gemacht zu haben? Er konnte sich nicht daran erinnern.
Er prostete Astra zu und trank einen Schluck. Morgens um halb fünf. Was war nur aus seinem Leben geworden? Und war »Leben« überhaupt die korrekte Bezeichnung? Er existierte, das traf es eher. Ein Tag reihte sich an den anderen, und Marcus war froh, wenn wieder einer vorbei war.
Er setzte sich neben Astra und registrierte dankbar, dass von dem Obdachlosen nicht der typische Pennergeruch ausging. Schweigend blickten sie auf den Kanal, der wie ein dunkles Band vor ihnen lag, und tranken ihr Bier. Seltsamerweise empfand Marcus in diesem Moment seit Langem wieder so etwas wie Frieden.
Kapitel 5
Gähnend schlug Marcus die Wagentür seines BMW zu. Der Dienstwagen und der Mitarbeiterparkplatz waren zwei Dinge, die er zu schätzen wusste, auch wenn er nicht so ganz verstand, wieso er überhaupt einen Anspruch darauf hatte. Die Parksituation rund um das Hamburger Polizeipräsidium war katastrophal. Selbst bei Kollegen und Staatsanwälten, die dienstlich in dem sternförmigen Gebäude zu tun hatten, klemmte häufig ein Strafzettel unter den Scheibenwischern. Öffentliche Verkehrsmittel waren für Marcus ein Albtraum. Die Enge, das Gefühl, auf einen festen Fahrplan angewiesen zu sein, die häufigen Verspätungen, dauernd hustete jemand, und dann auch noch die Gerüche – das war nicht sein Ding. Und sollte er doch einmal im Rahmen von Ermittlungen in Hamburg unterwegs sein müssen, wären S-Bahn oder Bus auch keine vernünftige Alternative. Nicht, dass er in den letzten Wochen, oder eher Monaten, seinen Schreibtisch aus dienstlichen Gründen verlassen hätte.
Marcus rieb sich über die Stirn und atmete tief durch, aber die Müdigkeit blieb. Wieder einmal würden Unmengen an Kaffee dafür sorgen müssen, dass er wach blieb. Obwohl es darauf bei seiner Arbeit eigentlich kaum ankam.
Langsam ging er auf den Eingang zu. Um diese Zeit war es noch ruhig auf dem Parkplatz, und im Gebäude waren auch nur wenige Büros bereits erleuchtet. Es gab keinen Grund, so früh anzufangen, aber Marcus hatte nach einer langen Dusche nicht gewusst, was er sonst tun sollte. Das Frühstücksfernsehen war jedenfalls kein Anlass für ihn, zu Hause zu bleiben.
Ein Motorradfahrer fiel ihm auf, der gegen jede Vorschrift seine schwarze Maschine direkt neben dem Eingang parkte. Statt abzusteigen, nahm der Fahrer lediglich den Helm ab und blieb sitzen, als ob er auf etwas warten würde. Marcus hatte nur einen kurzen Blick auf den Gesichtsausdruck des Mannes werfen können. An die beinahe schulterlangen schwarzen Haare und die markanten Gesichtszüge hätte er sich erinnert. Er kannte den Mann nicht, und dennoch wirkte etwas in seiner Miene merkwürdig vertraut. Neugierig beschleunigte Marcus seine Schritte und blieb dann abrupt stehen.
Dirk Richter, ein Kollege, den er flüchtig kannte, ging auf den Motorradfahrer zu und pfiff leise. Der Motorradfahrer zuckte zusammen, und seine Hand fuhr automatisch dorthin, wo er vermutlich seine Waffe trug. Im nächsten Moment sah er Dirk und entspannte sich.
Dirk deutete auf das Motorrad. »Wieder die ganze Nacht unterwegs gewesen?«
»Nur ein paar Stunden.«
»Warum schläfst du dich nicht erst einmal zu Hause aus?«
»Weil Tannhäuser Sehnsucht nach Toni und mir hat. Ich hoffe, danach kann ich etwas Schlaf nachholen.« Er fuhr sich mit dem Handschuh übers Gesicht. »Aber nur, wenn die verdammten Bilder endlich aus meinem Kopf verschwinden.«
Marcus hielt unwillkürlich den Atem an. Es war eigentlich unmöglich von ihm, die Kollegen zu beobachten und sogar zu belauschen. Er konnte froh sein, dass sie ihn bisher nicht bemerkt hatten, und dennoch konnte er sich einfach nicht dazu durchringen, weiterzugehen.
In jedem Wort und in jeder Geste des Motorradfahrers erkannte er sich selbst wieder. Dirk legte dem Motorradfahrer, mit dem er offensichtlich gut befreundet war, in einer tröstenden und zugleich herzlichen Geste eine Hand auf die Schulter. »Ganz wirst du sie nie los, aber sie werden weiter verblassen und dich immer längere Zeit in Ruhe lassen. Wenn du willst, ruf mich das nächste Mal an. Ich fahre mit, oder wir reden.«
Der Motorradfahrer stieg mit steifen Bewegungen ab. »Danke, Dirk. Ich hoffe, du hast recht, zumindest heute kann ich den ganzen Mist in meinem Kopf einfach nicht gebrauchen. Komm, ich spendiere dir einen Kaffee bei uns. Wir haben wenigstens einen vernünftigen Automaten.«
Die beiden gingen auf den Eingang zu. Dirks Antwort konnte Marcus nicht verstehen, aber sie brachte seinen Freund zum Lachen. Anscheinend war Marcus nicht der Einzige, der von Dämonen verfolgt wurde. Mit neuem Interesse betrachtete er das schwarze wuchtige Motorrad. Er konnte sich vorstellen, wie gut es sich anfühlte, damit nachts über die Straßen zu jagen. Doch solange er mit der ewigen Müdigkeit zu kämpfen hatte, ließ er besser die Finger davon.
Er widerstand der Versuchung, den Fahrstuhl zu nehmen. Sein Büro lag im vierten Stock. Die Treppen waren durch die langen Lauftouren keine Herausforderung für ihn, eine sinnvolle Tätigkeit zu finden, um die Bürostunden irgendwie zu überstehen, schon. Bis vor Kurzem hatte er es nicht abwarten können, nach Hause zu kommen, um den späten Nachmittag und Abend mit Büchern oder Serien verbringen zu können. Doch die Anwesenheit seiner Tochter verdarb ihm diese Freizeitbeschäftigung ganz gewaltig.
Das Vorzimmer zu seinem Büro war noch leer. Vor acht Uhr war seine Assistentin selten anzutreffen, was ihm nur recht war. Er liebte es, den Arbeitstag um sieben Uhr zu beginnen, um möglichst früh nach Hause fahren zu können. Gegen halb vier lag seine Terrasse im hellen Sonnenschein. Dort konnte er bei entsprechendem Wetter in Ruhe lesen und später dann im Wohnzimmer fernsehen. Er durchquerte den Raum und betrat sein eigenes Büro. Der Schreibtisch war perfekt aufgeräumt, persönliche Gegenstände gab es nicht. Warum auch. Ein gelber Haftzettel, der mitten auf dem Monitor prangte, wirkte wie ein Fremdkörper.
Marcus nahm den Zettel ab und fluchte leise. Zehn Uhr, Tannhäuser. Wichtig.
Die Notiz war nicht unterschrieben, und die Schrift kannte er nicht.
Er schloss den Wandschrank auf und betrachtete unschlüssig den dünnen Papierstapel, der dort zwischen zwei roten Pappdeckeln lag. Ein Ausdruck war mit einer Büroklammer auf dem Ordner befestigt. Marcus wusste, was dort stand. Juliane Meyer, seine Assistentin, hatte einen Ansatzpunkt gefunden, um den Fall an die Kollegen aus dem Drogendezernat mit der Bitte um weitere Ermittlungen zurückzugeben. Sah so vernünftige Polizeiarbeit aus? Sein Job war es, Akten nach übersehenen Hinweisen oder entgangenen Zusammenhängen zu durchforsten und zu prüfen, ob ein Fall neu aufgerollt werden musste. Hatte Tannhäuser, der Polizeipräsident, wirklich dies im Sinn gehabt, als er ihn vor gut drei Jahren eingestellt hatte? Er biss die Zähne so fest zusammen, dass es schmerzte. Was war heute nur los mit ihm? Das war seit seiner Versetzung aus Niedersachsen sein Job. Wieso hatte er ausgerechnet heute dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmte?
Marcus stürmte aus seinem Büro. Früher hatte er sich über die Typen lustig gemacht, die Akten von links nach rechts bewegten und so das Geld der Steuerzahler verschwendeten, heute war er selbst einer. Die Erkenntnis war nicht neu, aber heute schmerzte sie. Er riss die Tür zu dem Waschraum auf. So früh hatte er den Bereich für sich. Mit der Hand schaufelte er sich kaltes Wasser ins Gesicht, aber das half weder gegen das Stechen in seiner Magengegend noch gegen die Gedanken, die durch seinen Kopf jagten.
Die Hände auf das Waschbecken gestemmt, blickte er in den Spiegel. Er war gerade sechsundvierzig Jahre alt geworden, sah aber mindestens zehn Jahre älter aus. Sein Gesicht war zu hager, sein dunkelbraunes Haar müsste mal wieder geschnitten werden und wurde langsam grau. Früher hatte er sich viel im Freien aufgehalten und war sogar im Winter sonnengebräunt gewesen. Heute war seine Gesichtsfarbe eine ungesunde Mischung aus Grau und Weiß. Seine Ex-Frau hatte von seinen strahlenden blauen Augen geschwärmt. Das würde sie heute nicht mehr tun, jeder Glanz war ihnen abhandengekommen. Marcus erschrak über sich selbst. Das war nicht er, sondern ein blasses Abbild seines früheren Ichs. Er musste etwas ändern. Aber was? Wie? Die Antworten kannte er nicht.
Als er in sein Büro zurückkehrte, lag die Akte immer noch auf seinem Schreibtisch. Er musste lediglich Julianes Begründung abzeichnen und die Akte in das Postausgangsfach auf dem Gang legen. Dann würde der Fall beim Drogendezernat landen. Und damit bei Kollegen, die Überstunden ohne Ende schoben und personell unterbesetzt waren, während bei ihm die Gefahr bestand, dass er sich zu Tode langweilte. Er brachte es nicht fertig, den Fall wie gewohnt abzuschieben. Stattdessen öffnete er die Akte und begann zu lesen.
***
Sabrina atmete tief durch und tigerte weiter durch das Vorzimmer des Polizeipräsidenten. Es gab keinen Grund, nervös zu sein. Theoretisch. Egal, wie oft sie sich das sagte, es beruhigte sie nicht. Herbert Tannhäuser war für sie nicht Hamburgs oberster Polizist, sondern ihr Onkel Herbie, den sie heiß und innig liebte. Das sollte sie allerdings ganz schnell vergessen. Heute ging es nicht darum, wie früher als Kind auf seinen Knien geschaukelt zu werden, und auch nicht um die sündhaft teuren Pralinen, die er ihr bei jeder Gelegenheit schenkte. Sie musste ihm gegenüber als kompetente Journalistin auftreten, um ihr Ziel zu erreichen. Heute zählten nur die Fakten. Sie verzog den Mund. Fakten? Wackelige Theorie traf es eher. Gedanklich reihte sie einen Fluch an den anderen.
Ein leises Lachen riss sie aus ihren Grübeleien. »Er wird dich schon nicht umbringen, Schätzchen.«
Luise Walter, die Sekretärin ihres Onkels, die von allen liebevoll Walterchen genannt wurde, kannte Sabrina schon, seit sie ein kleines Kind war. Obwohl Walterchen mittlerweile die fünfzig überschritten hatte und die Haare in ihrem Knoten grau geworden waren, wirkte sie wesentlich jünger, was vielleicht an ihrer Vorliebe für farbenfrohe Kleidung und der ansteckend guten Laune lag. Am liebsten hätte sich Sabrina trotz ihrer sechsunddreißig Jahre in eine tröstende Umarmung geflüchtet. Das hatte damals funktioniert, als sie sich als Kind an der Schreibtischkante gestoßen hatte. Sabrina zwang sich dazu, ihre unruhige Wanderung durch das Büro zu beenden.
»Das weiß ich, aber mir ist es wichtig, dass er mir auch zuhört und glaubt.«
»Und warum zweifelst du daran, dass er das tun wird?« Sabrina konnte die Frage nicht beantworten, sofort legte Walterchen nach. »Kann es sein, dass du an dir selbst zweifelst?«
Nun zögerte Sabrina keine Sekunde. »Nein, das ganz bestimmt nicht.«
»Dann nimm dir einen Keks und hör auf, dir Sorgen zu machen.« Walterchen schob den Teller mit dem Gebäck dichter an den Rand des Schreibtisches und sah auf das Display ihres Telefons. »Das Gespräch muss jeden Moment zu Ende sein, dann gehört er dir.«
Sabrina kaute gerade an ihrem dritten oder vierten Keks, als sich die Tür zum Büro ihres Onkels öffnete.
Er lächelte und umarmte sie herzlich. »Wie schön, dich zu sehen, Sabrina. Am Telefon klang es ja ziemlich dringend.«
»Danke, dass du mich so kurzfristig dazwischenschiebst. Ich wäre sonst aber auch heute Abend bei dir zu Hause vorbeigekommen.«
Ihr Onkel zwinkerte ihr zu. »Ach was, wenn du schon sagst, dass es dringend und ›dienstlich‹ ist, dann erledigen wir das auch hier und so schnell wie möglich. Du darfst aber trotzdem gerne heute noch zum Essen vorbeikommen. Wir würden uns freuen. Deine Tante hat angekündigt, Kohlrouladen zu machen.«
»Das klingt verlockend, aber lass uns erst einmal abwarten, ob du noch mit mir sprichst, wenn du hörst, worum es geht.«
Ihr Onkel wurde schlagartig ernst und deutete einladend auf sein Büro. Sie folgte ihm zu der Besucherecke und ließ sich seufzend in einen der bequemen Sessel fallen. »Ich weiß, dass dir das, was ich dir gleich erzähle, nicht gefallen wird, aber bitte höre mir trotzdem bis zum Ende zu.«
Sabrina glaubte, nun auch bei ihrem Onkel eine gewisse Anspannung festzustellen, aber vor allem wirkte er wachsam, wenn nicht sogar alarmiert. Er hatte eindeutig den Polizistenmodus eingeschaltet, wie seine Frau es immer nannte. »Hast du von dem Überfall auf das Steakhouse gehört? Das war im letzten Monat.«
»Ja, habe ich. Einer meiner Beamten war sogar zufällig dort, als es passiert ist. Aber so schrecklich das auch war, das ist kein Fall fürs LKA.«
Damit hatte ihr Onkel zielsicher das größte Problem beim Namen genannt. Es gab Zuständigkeiten, an denen Sabrina nicht vorbeikam. Allerdings wusste sie auch, dass ihr Onkel häufig eigenwillige Wege ging. Im Gegensatz zu dem Chef des LKA, der seinen Posten der Politik verdankte, war ihr Onkel selbst viele Jahre lang als Polizist aktiv gewesen. In den letzten Jahren hatte bei ihren Treffen oder sogar Familienfeiern ab und zu sein Telefon geklingelt, und Sabrina hatte mitbekommen, dass ihr Onkel einige Posten und auch ganze Teams personell so besetzt hatte, dass er sie für unkonventionelle Ermittlungen nutzen konnte.
»Ich war auch dort.« Als sie sah, wie blass ihr Onkel geworden war, sprach sie schnell weiter. »Mir ist nichts passiert, aber meine Freundin Conny ist ziemlich schwer verletzt worden. Sie liegt immer noch im Krankenhaus. Schnittwunden im Gesicht und eine komplizierte Verletzung an der Hand. Es werden Narben zurückbleiben, und an den psychischen Folgen wird sie auch noch eine ganze Weile zu knabbern haben. Die Verbrecher haben mit irgendwelchen schweren Waffen die Scheiben von außen zerstört, ehe sie das Restaurant gestürmt haben. Und dabei sind Splitter durch die Gegend geflogen, die Conny erwischt haben. Aber eben auch nur sie! Der Arzt meinte, dass ihre Hand wohl sogar von einer großkalibrigen Kugel verletzt wurde. Das alles ist schon schlimm, aber deshalb bin ich nicht hier. Wir haben schon sehr oft dort gegessen, sodass ich Guido, den Besitzer des Steakhouses, ein bisschen kenne. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht und mit ihm geredet. Er würde das zwar offiziell nicht zugeben, aber es ging wohl um Schutzgeld. Er hat von einer Mail gesprochen, die er bekommen hatte. Das könnte doch zu dem Überfall auf dieses Sterne-Restaurant vor Kurzem passen.«
Ihr Onkel nickte. »Davon habe ich gelesen, aber die Täter sind völlig anders vorgegangen. Die waren doch mit Äxten bewaffnet. Deswegen gehen wir auch von einem normalen Überfall aus, der dann Sache der Kriminalpolizei und nicht des LKA ist.«
»Stimmt, aber die Unterschiede gelten nur für die Waffen, es gibt bei der Täterbeschreibung Ähnlichkeiten. Das klingt nach einer Serie, und dafür ist das LKA zuständig.« Hoffentlich biss er an, damit sie zu ihrer eigentlichen Theorie kommen konnte.
Ihr Onkel schwieg so lange, dass Sabrinas Unsicherheit wuchs, dann rieb er sich übers Kinn. »Und was sagt dein Chef dazu, dass du plötzlich zur Polizeireporterin wirst?«
»Ich musste erst mit Kündigung drohen, dann hat er nachgegeben.«
Zum ersten Mal lächelte ihr Onkel wieder. »Na gut, du warst schon als Kind sehr überzeugend. Aber was genau erwartest du jetzt von mir?«
»Ich bin jeden Tag bei Conny im Krankenhaus. Ihr ganzes Leben wurde zerstört! Sie wird, wenn überhaupt, erst in einigen Monaten wieder malen können. Und vielleicht weißt du noch, dass sie sich für die Vermarktung ihrer Bilder auch immer wieder selbst in Szene gesetzt hat. Als Influencerin auf Instagram. Jetzt ist ihr Selbstwertgefühl natürlich zerstört. Ich will helfen, den Kerl, der ihr das angetan hat, zu erwischen, und unseren Fall zu lösen.« Verflixt, nun hatte sie mehr gesagt, als sie vorgehabt hatte.
»Unseren Fall?«, wiederholte ihr Onkel mit mildem Spott.
Sabrina atmete tief durch und setzte sich aufrechter hin. »Ja, unseren Fall. Meine Stärke ist es, Leute zum Reden zu bringen. Keiner, mit dem ich gesprochen habe, würde so offen mit einem Polizisten reden. Ihr braucht mich dabei.«
»Und wobei genau? Was für einen Hintermann siehst du denn da am Werk?«
Natürlich war ihm ihr kleiner Ausrutscher nicht entgangen. Nun hätte sie einen Schluck Prosecco gebrauchen können. Natürlich nur, um ihre Nerven zu beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit war riesig, dass ihr Onkel sie einfach auslachen würde, und dann war sie am Ende. Alleine würde sie nicht weiterkommen. »Bitte höre mir bis zum Ende zu. Versprich mir das!«
Sie konnte die Miene ihres Onkels nicht länger deuten, aber immerhin nickte er.
»Der Überfall auf Guido macht gar keinen Sinn. Sein Restaurant wirft zu wenig ab, und er hätte sogar bezahlt, hatte aber gar keine Gelegenheit dazu. Jemand hat die Männer auf ihn angesetzt. Das eigentliche Ziel war Conny, denn sie hat am meisten abbekommen. Ihr Leben ist zerstört. Fürs Erste zumindest. Es gibt noch weitere solcher Fälle, die perfekt ins Schema passen. Die Senatorin Elena von Woltersleben. Ihre Karriere kann sie nach den Sexfotos vergessen. Es gibt einen Fall in einem Altersheim, dort hat jemand eine Bewohnerin überredet, ihr ganzes Vermögen einer Stiftung zu überschreiben. Ihr Enkel ist nun pleite, und seine Familie verliert das Haus. Die eigentlichen Opfer sind alle im gleichen Alter.«
»Du glaubst also nicht an eine Serie von Überfällen, sondern an einen ganz anderen Serientäter?«
»Ja«, stieß sie hervor.
Er schwieg wieder. »Rede ich hier mit meiner Patentochter oder mit einer Journalistin?«
Erleichtert lehnte sich Sabrina zurück. Eine komplette Ablehnung hätte er anders eingeleitet. »Es geht mir nicht um Schlagzeilen, ich will die Verantwortlichen hinter Gittern bringen. Natürlich hoffe ich, einen Artikel herausbringen zu können, wenn es so weit ist, aber ich könnte auch ohne leben, wenn die Gangster dafür im Gefängnis landen. Und wenn ich ihn schreibe, lasse ich vorher jedes Wort von dir absegnen.«
»Das ist gut. Da ein Mitarbeiter, den ich sehr schätze, bei dem Überfall vor Ort war, habe ich mir die Sache genauer angesehen und mich auch über die Auswahl des Restaurants gewundert. Gehen wir mal als sehr vage und sehr weit hergeholte Arbeitsthese davon aus, dass du eventuell recht haben könntest.«
Mehr Zweifel an ihrer Überlegung konnte er wohl kaum in einem Satz unterbringen. Sabrina biss sich sicherheitshalber auf die Lippe, um nicht zu protestieren.
Ihr Onkel tippte nachdenklich mit den Fingern auf dem Tisch herum. »Na gut. Es gibt da jemanden, mit dem ich nachher über ein anderes Thema reden wollte. Wenn es dir gelingt, ihn zu überzeugen, den Fall zu verfolgen, schulde ich dir sogar etwas.«
Nun verstand Sabrina gar nichts mehr. Ihr Onkel konnte dem Mann doch schließlich einfach eine entsprechende Anweisung geben. Anscheinend interpretierte er ihre ratlose Miene richtig. Sie hatte sich schon oft genug anhören müssen, dass sie ihre Gefühle schlecht verbergen konnte.
»Natürlich könnte ich ihm einfach befehlen, die Sache zu verfolgen, aber ich möchte, dass er sich selbst dazu entscheidet. Das wird nicht einfach, aber so hast du eine faire Chance. Was sagst du?«
»Einverstanden, natürlich, denn jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht. Verrätst du mir, wer er ist und warum du so vorgehst?«
»Er heißt Marcus Lauer. Den Rest musst du schon selbst herausfinden. Ich möchte, dass du unvoreingenommen in das Gespräch gehst.«
»Und wann lerne ich ihn kennen?«
Ihr Onkel sah auf die Uhr. »In zwanzig Minuten. Ich hatte, wie gesagt, eigentlich vor, etwas anderes mit ihm zu besprechen, aber das hier passt ausgezeichnet. Ich stelle euch vor, und dann gehört er ganz dir.«
Einfach würde es bestimmt nicht werden, aber dennoch wuchs in ihr eine gewisse Aufregung. Die erste Hürde hatte sie genommen, und mit diesem merkwürdigen Polizisten würde sie auch fertigwerden.
Kapitel 6
Es war schon nach halb zehn, und noch immer war das Vorzimmer verwaist. Unschlüssig hielt er den roten Pappordner in der Hand. Sollte er wirklich …? Marcus wusste es einfach nicht.