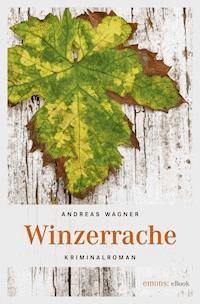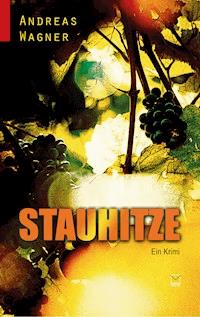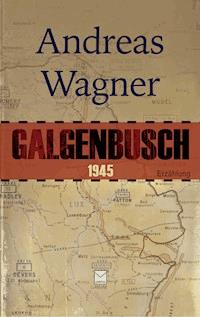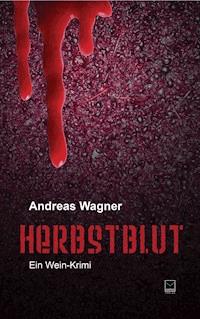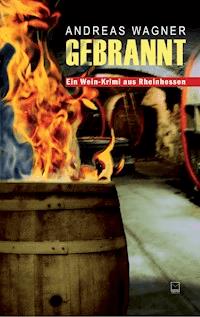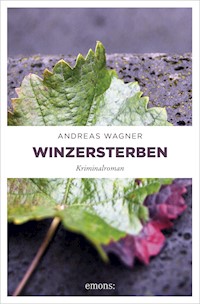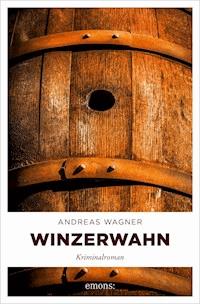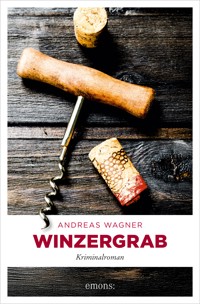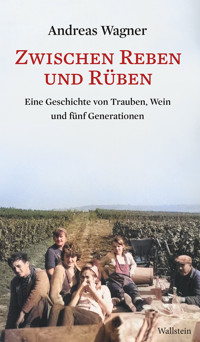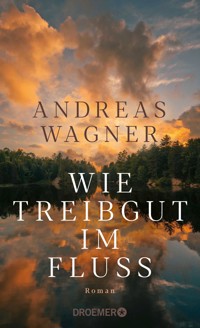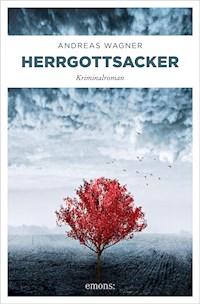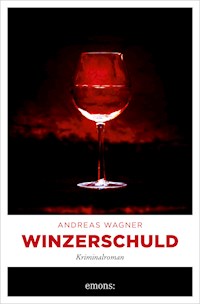Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fesselnde Krimilektüre, die in menschliche Abgründe führt. Als ein Ehepaar ermordet in seinem Haus aufgefunden wird, ist das Team der Kripo Mainz rund um Chefermittler Harro Betz sofort zur Stelle. Die Spurenlage am Tatort ist schwierig zu deuten, ein Raubmord scheint es nicht gewesen zu sein. Doch wer hat die beiden Rentner auf dem Gewissen, und welches Motiv könnte es dafür geben? Auf der Suche nach dem Täter geraten die Kommissare immer tiefer in die Mainzer Drogenszene und zwischen die Fronten zweier rivalisierender Clans – bis es für Betz und seine Kollegen brenzlig wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Wagner ist Winzer, Historiker und Autor. Nach dem Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Bohemistik in Leipzig und an der Karls-Universität in Prag hat er 2003 zusammen mit seinen beiden Brüdern das Familienweingut seiner Vorfahren in der Nähe von Mainz übernommen. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.
www.wagner-wein.de/Krimi
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus arcangel.com/Jackie Robinson, shutterstock.com/elegeyda
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-098-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Was wir wissen, ist ein Tropfen – was wir nicht wissen, ein Ozean.
Isaac Newton
1
Mittwoch, 30. Oktober
Wo war der Rhein? Er versuchte, sich in der Dunkelheit zu orientieren. Die Augen konnten ihm dabei nicht helfen. Nutzlos waren sie, auch wenn sie noch so sehr blinzelten und sich mühten. Gerne hätte er sich aufgesetzt oder zumindest ein wenig zur Seite gedreht. Den Versuch unternahm er erst gar nicht, weil er spürte, dass ihm der Rest seines Körpers nicht gehorchen würde. Die Augen, die das Ende der Finsternis nicht fanden, und sein müder Verstand waren das Einzige, was ihm im Moment zur Verfügung stand. Zu wenig, um sich zurechtzufinden und herauszubekommen, in welcher Richtung der Fluss lag, an dem er doch vorhin noch unterwegs gewesen war. Die Erinnerung stieg dunstig in ihm auf, sie roch nach fauligem Wasser, und sie schmerzte.
Sein Atem ging hektisch. Er arbeitete gegen den Druck auf seiner Brust an, der jeden Zug erschwerte und seinen Puls rasen ließ. Kalter Schweiß stand in seinem Nacken und auf seiner Stirn. Das Rauschen in seinen Ohren beruhigte ihn nicht. Der Klang war eine Lüge, die sein zerstörter Körper schuf. Der Rhein rauschte nicht, jedenfalls nicht hier. Nirgendwo um den Rheinkilometer 497 gab es Stromschnellen, die das Geräusch von Wasser erzeugten, das über mächtige Felsbrocken hinweg in die Tiefe stürzte. Der Fluss gurgelte. Mehr nicht. Die Wellen, die die schweren Lastkähne hinter sich herzogen, platschten rhythmisch gegen die Uferbefestigung. Dazwischen hörte man die tippelnden Schritte zahlloser Ratten, die auf den nassen Steinen nach Fressbarem suchten. Spitzes Fiepen ertönte, wenn eine fündig geworden war und ihre Beute gegen das halbe Dutzend verteidigen musste, das sofort bereitstand, um gierig seinen Anteil einzufordern.
Er glaubte, Geräusche zu hören, Töne, denen er in den unzähligen Nächten am Ufer des Flusses immer gerne gelauscht hatte und die ihm seit Kindheitstagen vertraut waren. Der Rest Verstand, der in seinem Schädel das Regiment zu führen suchte, wollte die beruhigende Wirkung der unablässig strömenden Wasserader auferstehen lassen, um ihn in einer Sicherheit zu wiegen, die nicht mehr existierte. Er lag hilflos da und focht einen aussichtslosen Kampf um jeden weiteren Moment seines kläglichen Daseins.
Mühsam rang er weiter nach Luft. Er zwang sich in einen Rhythmus und zählte in Gedanken mit: Eins, zwei, drei – Atmen! Es war wie das letzte gierige Aufbäumen eines Erstickenden. Ein röchelndes Stöhnen, das so gar nicht wie er selbst klang. Er kannte die eigene Stimme. Sie tönte in seinen Ohren, auch wenn er nicht in der Lage war, auch nur ein einziges Wort über die Lippen zu bekommen. Der Gedanke ließ ihn zittern. Eisige Kälte kroch seinen Nacken hinunter und über seinen Rücken. Eins, zwei, drei – Atmen! Seine Brust vibrierte unter den schnellen und von panischer Angst getriebenen Schlägen seines Herzens.
Der nächste so dringend benötigte Atemzug verfing sich in einem Hindernis, das seine Luftröhre blockierte. Heiser bellend kämpfte er gegen den Widerstand an. Zuerst erfolglos, drückte er dann doch das heraus, was ihm die Luft nahm. Sein Oberkörper krümmte sich unter dem Schmerz zusammen. Brennend heiß schoss die Fontäne aus seinem Mund und den Nasenlöchern. Ein weiterer Krampf ließ sogleich eine zweite, noch heftigere folgen.
Gurgelnd atmete er wieder ein, japste nach Luft und schluckte gierig. Vor seinen Augen blitzten helle Punkte auf. Kleine leuchtende Lichter und Funkenregen, die dem Feuerwerk an Johannis ähnelten, das er über Jahrzehnte nicht versäumt hatte. Seinen Widerschein auf dem dahinfließenden Wasser des Rheins suchte er vergebens. Die nächste Lüge, die sein unterversorgtes Hirn ihm vorgaukelte, obgleich sie wohltat. Die Erinnerungen beruhigten ihn und drängten die Angst für einen winzigen Moment in den Hintergrund.
Er fand in seinen ins Stottern geratenen Rhythmus zurück. Eins, zwei, drei – Atmen! Vielleicht war der Stein, der auf seine Brust drückte, sogar ein wenig leichter geworden. Sein Magen krampfte sich aber bereits wieder zusammen. Es konnte doch kaum noch etwas in ihm sein.
Er wusste ohne jeden Zweifel, dass der Rhein sehr weit weg lag, aber er hatte keine Erklärung dafür, was das bedeutete und ob er ihn jemals wieder zu Gesicht bekommen würde. Heiße Tränen rannen über seine Wangen.
2
Vier Tage zuvor
Ganz vorsichtig, ohne eine weitere Bewegung ihres Körpers, schob Magda Oberländer zwei Finger zwischen die silbergrauen Alulamellen ihrer Jalousie und spähte hinaus über die gelb verfärbten Blätter der beiden Birnbäume. Sie hatte alles vorbereitet, schon vor Stunden, weil sie wusste, dass die Zeit drängte.
Den größten Teil des Laubs hatten die Bäume schon abgeworfen, obwohl es draußen noch warm war. Viel zu warm eigentlich für die Jahreszeit, aber dafür mussten sie noch nicht heizen. Wie es aussah, würde ihnen der milde Oktober auch noch nächste Woche erhalten bleiben.
Ihr Blick wanderte bang durch das lichte Geäst und die menschenleere Straße hinauf. Sie versuchte sich zu beruhigen, indem sie sich seine Worte wieder ins Bewusstsein rief. Sehr entschlossen hatten sie geklungen, aber auch so besorgt, dass dieses Gefühl sie nun fast gänzlich beherrschte. Die Furcht hatte sie durchdrungen und ließ sie auf Zehenspitzen unruhig vom Fenster zur Couch und durch das Wohnzimmer schleichen. Durch ihre dünnen Perlonstrümpfe spürte sie die weiche Wolle des großen roten Perserteppichs, der einen Teil des Wohnzimmerbodens bedeckte. Vor Weihnachten musste er noch mal in die Reinigung, zusammen mit dem Läufer im Flur. Wenn die Kinder kamen, was nur selten geschah, sollte alles blitzsauber sein. Sie sollten sehen, dass sie alles im Griff hatte und trotz der Last auch die kleinen Details nicht aus den Augen verlor.
Sie drückte die Flügeltür des Buffets zu und schloss ab. Kurz hielt sie in der Bewegung inne und überlegte, ob sie den Schlüssel abziehen sollte, um ihn in die kleine Tasche ihres dunklen, dezent karierten Rocks zu stecken. Sie entschied sich dagegen, weil sie das in ihrer Anspannung wahrscheinlich umgehend vergaß und dann hektisch nach dem Schlüssel suchen würde, wenn sie ihn später brauchte.
Gerne hätte sie sich jetzt noch mal ein Gläschen des guten roten Portweins eingeschenkt, den sie in der kleinen Weinhandlung hinter dem Dom einkaufte. Die fast noch volle, aber letzte Flasche stand neben den Spirituosen ihres Mannes und dem benutzten Gläschen in dem beleuchteten und mit Spiegelglas ausgekleideten, großzügigen oberen Fach des Buffets. Sie müsste jetzt nur die Tür aufklappen. Der Jahrgangs-Portwein war unverschämt teuer, aber den geschmacklichen Unterschied zu dem pappsüßen, billigen Zeug aus dem Supermarkt wusste sie zu schätzen. Wenn ihr hier alles zu viel wurde mit Erwin, goss sie sich eines der winzigen verzierten Gläschen randvoll und genoss mit geschlossenen Augen die Fülle der Beerenaromen, die zarte Vanillenote des Holzes und die Süße, die an Rosinen erinnerte. Die Wärme des Alkohols, die sich dann langsam in ihr ausbreitete, ließ vieles, was sie vorher niedergedrückt hatte, leichter erscheinen. Wenn es ganz schlimm war, legte sie zusätzlich eine von Beethovens Klaviersonaten auf. Nicht die abgedroschene Mondscheinsonate, sondern am liebsten die Appassionata, die ihr zusammen mit einem zweiten und zur Not auch dritten Gläschen des guten Ports die innere Ruhe wiedergab, die sie zur Bewältigung ihrer alltäglichen Bürden benötigte.
Sie ließ die Klappe geschlossen. Vielleicht würde sie sich später einen weiteren Schluck gönnen, wenn alles überstanden war. Sie spürte, dass ihre Handinnenflächen sehr feucht waren und sich ihr Puls beschleunigte. Dem Drang, erneut zum großen Wohnzimmerfenster zu gehen und durch die Lamellen zu spähen, widerstand sie. Sie wusste, dass man sie leicht von draußen sehen konnte. Die Sicherheit, die die Jalousie versprach, war trügerisch. Magda Oberländer schnaufte zitternd aus. Warum dauerte das bloß so lange? Mit einer schnellen Bewegung strich sie sich die glatten weißen Haare hinter die Ohren. Sollte sie nicht doch noch einmal nachschauen, ob sie auch wirklich alles beisammenhatte? Ihre Finger berührten schon den Schlüssel, um die Sachen wieder aus dem Buffet herauszuholen. Sie ließ ihn aber sogleich wieder los und schüttelte den Kopf. Sie kam nur wieder ins Grübeln, wenn sie erneut alles auf dem Wohnzimmertisch ausbreitete. Kontrolliert hatte sie die Sachen doch schon unzählige Male. Es barg unkalkulierbare Gefahren, wenn sie jetzt schon wieder damit anfing. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht wahnsinnig zu werden. Hastig strich sie sich mit den Handflächen über den knielangen Rock. Sie blieben trotzdem feucht. Das mochte sie nicht.
Magda seufzte, als sie Erwins unverständlichen Aufschrei hörte. Für einen Moment hatte sie ihn komplett vergessen. Das passierte ihr sonst nie und verdeutlichte ihr noch einmal, wie angespannt sie war. Ihr Mann bekam von alldem zum Glück nichts mit. Es war Samstag, kurz vor vier, er lag im Zimmer gegenüber in seinem Pflegebett und starrte gebannt auf den Fernseher, der an der Wand hing. Seine Haut war wächsern und die Gesichtszüge reglos, wie bei einer Puppe. Die Demenz hatte außer der Hülle nicht mehr viel von ihm übrig gelassen. Ein Organismus, der von ihr versorgt wurde und weiterlief, auch wenn ihm der Sinn längst abhandengekommen war.
Zur Beruhigung strich sie über die raue Oberfläche der Bronzebüste, die auf einem weiß glänzenden Sockel neben der Tür zum Flur stand. Sie hatte den Carl Zuckmayer des Bildhauers Eberhard Linke zuerst gar nicht gemocht. Er war ihrem Mann vor sechs Jahren von der Firmenleitung mit vielen warmen Worten für den »Unersetzbaren« zur Verabschiedung in den Ruhestand überreicht worden. Als promovierter Chemiker hatte Erwin die Entwicklungsabteilung eines großen Mainzer Chemieunternehmens verantwortet, das mit seinen Reinigungsprodukten in jedem deutschen Supermarkt vertreten war. Sie hatte sich damals maßlos geärgert und ihr Missfallen nur schwer verbergen können, als der Vorstandsvorsitzende beim anschließenden Empfang ihre Meinung zum wertvollen Abschiedsgeschenk für ihren Mann hatte hören wollen. Die Bronze sah aus, als ob sie zu lange im Freien gestanden und der Rost die Oberhand gewonnen hätte. Zwar liebte ihr Mann die Bücher und Theaterstücke Zuckmayers, der nicht weit von hier in Nackenheim geboren war, wo sein Vater eine Fabrikation für die Herstellung von Kapseln für Weinflaschen betrieben hatte. Aber musste man ihn und dadurch ja auch sie deswegen mit einer schweren Büste belasten, wenn andere verdiente Mitarbeiter der Leitungsebene beim Eintritt in den Ruhestand mit einer luxuriösen mehrwöchigen Schiffsreise in die Südsee verabschiedet wurden?
Sie strich dem Zuckmayer noch einmal über den Kopf und spürte, dass sie sich dadurch ein wenig beruhigte. Er hatte drei Gesichter. Das hatte sie am meisten verstört an jenem festlichen Nachmittag im Hochsommer mit Blick auf den Rhein. Die Erklärung hatte sie nicht hören wollen und hastig gleich zwei Gläser Rieslingsekt hinuntergespült, um die Fassung nicht gänzlich zu verlieren. Erwin hatte das verstanden und nicht protestiert, als sie zwei Tage später die beiden jungen Männer anwies, das »Ding« in die hinterste Ecke seines Büros zu verfrachten, damit es sie nicht ständig gehässig an die entgangene Südsee-Kreuzfahrt erinnerte.
Erst als sich Erwin immer mehr auflöste, hatte sie den Zuckmayer zu sich ins Wohnzimmer geholt, weil ihr klar geworden war, dass mehr in ihm zu sehen war als der Ärger über eine entgangene Fernreise. Die drei Gesichter der Büste standen für das langsame Verschwinden ihres Mannes. Das erste Gesicht war vollständig ausmodelliert, das zweite daneben deutlich schmaler gearbeitet. Und nur wenn man genau hinsah, konnte man zwischen den beiden, verdeckt, das dritte erkennen. Es ähnelte ihrem Erwin, der jetzt gegenüber im Zimmer lag und auf den Fernseher an der Wand starrte. Sein altes Ich war verschwunden zwischen den beiden Köpfen, die ihn zerdrückten.
Irgendetwas musste soeben passiert sein. Er brachte einen gurgelnden Laut heraus, den sie als Torjubel einordnete. Für welchen Verein das Tor gefallen war, spielte schon längst keine Rolle mehr. Sie wusste nicht, wer da spielte, und glaubte auch nicht, dass er das noch unterscheiden konnte, wo er selbst ihre Kinder und sie nur noch in seltener werdenden, lichten Momenten erkannte. Lediglich die Begeisterung für den Fußball war ihm geblieben. Stundenlang konnte sie ihn damit zufrieden- und ruhigstellen. Wenn es nicht so absurd klänge, ginge sie jede Wette ein, dass eine weitsichtige Frau das Fußballspiel erfunden hatte, um sich selbst und ihresgleichen allwöchentlich ein paar entspannte Stunden zu verschaffen.
Gerne hätte sie jetzt über diesen absonderlichen Gedanken gelacht oder zumindest das Gesicht zu einem Schmunzeln verzogen, hätten ihr pochendes Herz und die schweißnassen Handflächen sie nicht wieder daran erinnert, dass sie in höchster Gefahr schwebte.
Hastig löste sie sich von ihrem Zuckmayer und machte den ersten Schritt in Richtung der Jalousie. Der schrille Ton der Klingel fuhr ihr tief ins Mark und ließ sie erschrocken zusammenzucken. Sie zitterte nun heftiger. Die feinen Härchen auf ihren Unterarmen richteten sich auf. Ihre Angst wuchs mit jedem Schritt, den sie über den verzierten roten Läufer im Flur bis zur Wohnungstür setzte. Als sie sich vorsichtig dem Spion näherte, hielt sie die Luft an. Sie glaubte, dass man das Hämmern ihres Herzens trotzdem durch die Tür hindurch bis in den Hausflur würde hören können, denn ihr ganzer schmächtiger Körper vibrierte unter den Schlägen in ihrem Brustkorb. Sie musste die Augenlider mehrmals auf- und zudrücken, weil sie durch das kleine Loch des Spions nur verschwommen sehen konnte. Mit der linken Hand fing sie sich an der Tür ab, weil sich das Zittern auch auf ihre Knie übertrug. Alles um sie herum schien sich gleichzeitig in Bewegung zu setzen. Sie drohte das Gleichgewicht zu verlieren. Erwin brüllte im Hintergrund.
Sie riss die Tür auf, weil es nicht anders sein konnte – und weil sie wollte, dass es jetzt ein Ende hatte, bevor sie es nicht mehr aushielt und hinter der verschlossenen Wohnungstür das Bewusstsein verlor.
»Endlich!«, wisperte sie erleichtert.
Jetzt würde alles gut werden.
3
Natcha hetzte schnaufend in ihren quietschenden violetten Gummisandalen die Treppenstufen hinauf. Sie war jetzt schon zu spät dran, obwohl es erst ihre dritte Station an diesem Morgen war. Aber nicht ganz so spät wie sonst. Es spielte keine Rolle, weil ihr das niemand vorwarf. Die Kolleginnen wussten, dass sie ihre Arbeit ordentlich machte, und da keine von ihnen für die eine oder manchmal sogar zwei Stunden, die sie länger für die Aufgaben des Tages benötigte, aufkommen musste, scherten sie sich auch nicht darum. Sie grinsten höchstens, weil sie nicht verstehen konnten, wie man auch nur eine Minute länger arbeiten konnte, als man musste und bezahlt wurde.
So schnell wie die Chefin würde sie sowieso nie werden. Egal, wie sehr sie sich bemühte. In den ersten Tagen Anfang des Jahres, als sie noch zur Probe mitgelaufen war, hatte sie oft rennen müssen, um überhaupt hinterherzukommen. Manchmal hatte sie die bereits zufallende Haustür nur noch im letzten Moment erreicht und danach japsend zwei Stufen auf einmal nehmen müssen. Die Chefin rannte nicht. Es war ihr normales Tempo, das sie den ganzen Tag beibehielt. Wie der gleichmäßige Rhythmus einer Nähmaschine, die im genau festgelegten Abstand aufsetzte und sich dabei in einer unglaublichen Geschwindigkeit vorwärtsbewegte. Die Wege schien sie mit geschlossenen Augen zurücklegen zu können, während sie gleichzeitig entweder die Gummihandschuhe wechselte oder eine Notiz für die spätere Abrechnung in ihr Tablet tippte. Nur bei Hindernissen wie einer verschlossenen Haus- oder Wohnungstür musste sie ganz kurz innehalten, bis der passende Schlüssel, den sie im Laufen bereits gezückt hatte, im Schloss und herumgedreht war. Danach ging es in der gleichen Geschwindigkeit weiter.
Auch die anderen Mitarbeiterinnen des privaten Pflegedienstes kamen an die Chefin nicht heran. Elena, die große, hagere Ukrainerin, die seit dem Krieg in ihrer Heimat hier bei ihnen arbeitete, lief fast so schnell. Sie hielt dabei, wie die Chefin auch, den Oberkörper annähernd reglos und gerade. Beide trugen sie aber auch nicht so viel Ballast mit sich herum. Natcha lächelte zufrieden. Ihr konnte man ansehen, dass sie fleißig war und genug verdiente, um ihren Sohn und sich selbst ordentlich zu ernähren. Und wenn am Ende des Monats noch genug Geld übrig blieb, um ihre Familie daheim auf der Khorat-Hochebene, dem ärmsten Teil Thailands, zu unterstützen, dann war doch alles in Ordnung.
Für ein paar Schritte verlangsamte sie intuitiv ihr Tempo, weil sie besonders leise sein wollte. Sie duckte sich sogar ein wenig und rollte ihre Füße über die Seiten ab, weil die neuen Sandalen dann kaum Geräusche von sich gaben. Erst als sie um die Kurve und damit aus dem Blickwinkel des Spions von Isolde Guntermann verschwunden war, beschleunigte sie wieder. Das war eine böse Frau. Sie wollte ihr nicht begegnen. Letzte Woche war sie genau in dem Moment aus der Wohnung gekommen, als sie ihre Tür passiert hatte. Vor Schreck war Natcha wie angewurzelt stehen geblieben und hatte sie entgeistert angestarrt. Die Guntermann hatte sie nicht erkannt. Das zeigte ihr Blick. Aber beschimpft hatte sie sie trotzdem. »Was gaffen Sie mich so blöde an? Man wird doch noch den Müll runterbringen dürfen. Lassen Sie mich in Frieden.«
Bei der Guntermann hatte sie Ende letzten Jahres zwei Monate fast rund um die Uhr gearbeitet und sich den Arm und zwei Rippen gebrochen, weil sie mit der Leiter samt den schweren, nassen Vorhängen umgefallen war. Es war ihr zweiter Arbeitsplatz gewesen, nachdem ihr Mann sie und den Jungen verlassen hatte. Ihre erste Arbeit als Spülhilfe in einem Ausflugslokal am Lennebergwald, das früher mal ein Bordell gewesen und erst kürzlich als Gaststätte wiedereröffnet worden war, hatte sie schon nach zwei Wochen fluchtartig verlassen, weil der verschwitzte Chefkoch sie zum Ende ihrer Schicht in der verwaisten Küche in eine Ecke gedrängt und begrapscht hatte. Sie war froh gewesen, anschließend durch die Vermittlung einer Nachbarin bei Frau Guntermann untergekommen zu sein, die gerade aus der Klinik entlassen worden war und dringend Hilfe benötigte, um von ihren Kindern nicht in ein Pflegeheim abgeschoben zu werden. Sie hätte aber auch nie für möglich gehalten, dass ein alter Mensch so böse sein konnte.
Zuerst schrieb Natcha ihre Launen den Schmerzen zu. Bald merkte sie aber, dass die Guntermann regelrecht nach Kleinigkeiten suchte, um sie anzuschreien und wüst zu beschimpfen. Sie hatte das Telefonat, in dem sie ihrem Sohn in München detailreich erzählte, auf welche Weise »diese Asiatin« sie von morgens bis abends bestehlen würde, selbst mit angehört. Sie hatte noch nie irgendwo etwas mitgenommen. Obwohl sie genau wusste, wo bei der Guntermann der Schmuck lag und das Haushaltsgeld, das sie immer am ersten Montag für den gesamten Monat holte. Schließlich hatte sie einmal die Woche alle Hängeschränke in der Küche ausräumen und sauber wischen müssen. Zuvor hatte sie der Alten aber auf den Hocker zu helfen, damit sie die beiden Suppenterrinen aus weißem Porzellan mit Goldrand ins Wohnzimmer schaffen konnte, bis die Reinigungsprozedur beendet war. »Damit das teure Porzellan meiner Urgroßmutter nicht kaputtgeht!«
Frau Oberländer dagegen, zu der sie jetzt musste, war eine gute Frau. Sie betete jeden Abend für sie, damit sie noch lange lebte und sie weiter zu ihr und ihrem kranken Mann kommen konnte. Frau Oberländer steckte ihr mindestens einmal die Woche fünf oder sogar zehn Euro zu. Meistens am Freitag, mit Nachdruck und einem freundlichen Lächeln, als Dankeschön für die Woche. Am Samstag und Sonntag versorgte sie ihren Mann allein. Das wollte sie so.
Natcha klingelte und schob fast zeitgleich den Schlüssel ins Schloss. Sie wusste, dass Frau Oberländer das so wünschte. Hier war alles immer schon vorbereitet. Der alten Dame war es lieb, wenn sie nicht noch extra zur Tür musste. Sie stand am Bett ihres Mannes bereit und hatte das handwarme Wasser schon eingelassen, damit Natcha die Windeln wechseln und ihn waschen konnte.
»Natcha ist da!« Sie drückte die Tür auf und eilte schnell weiter. »Alles gut?« Der weiche rote Teppich, der sich von der Wohnungstür durch den gesamten Flur zog, verschluckte ihre Schritte.
Der Fernseher lief. Das fiel ihr sofort auf. Eine Stimme, die sich fast überschlug und dann im Jubel und Tosen einer großen Menge unterging. Erschrocken hielt sie in der gewohnten Bewegung inne. Weit aufgerissene Augen starrten sie an. Der Jubel ebbte ab. Die Stimme drang wieder durch. »Hat es so etwas schon einmal gegeben? Sagenhaft! Die Deutsche Mannschaft ist zurück in diesem Halbfinale. Und es bleiben ihr noch ein paar Minuten, um das Spiel zu drehen!«
Sie lag keinen Meter von ihr entfernt. Ihr Oberkörper ragte aus dem Wohnzimmer in den Flur. Der rote Läufer warf kleine, gleichmäßige Wellen, die zur Seite hin gegen die Wand ausliefen. Ihr Kopf ruhte wie auf ein großes, rundes Kissen gebettet in einer braunen, eingetrockneten Blutlache. Ein Schwarm Fliegen stob erschrocken in die Höhe. Natcha wollte schreien. Sie öffnete den Mund, doch kein Ton fand aus ihrem Hals heraus.
Ganz vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Etwas trieb sie weiter, obwohl sie vor dem erschauderte, was sie erwarten würde.
Erwin Oberländer lag in seinem Bett. Als sie ihn sah, konnte sie endlich schreien. Ein spitzer Ton, in dem der Schrecken vibrierte. Sie wollte nie wieder damit aufhören. Es musste heraus, auch wenn sie bald keine Luft mehr hatte und zitternd vor ihm zusammenbrach. Seine geöffneten Augen waren trüb und glanzlos, sein Gesicht seltsam verzerrt. Daraus sprach das Grauen, das er erlebt, sich bis zu seinem letzten Atemzug aber nicht mehr hatte erklären können.
4
»Denn ich hab heute Nacht einen Engel gesehen. Mona Lisa …«
Ravi Bingenheimer verfolgte aus den Augenwinkeln, wie sein Chef mit den Fingern der rechten Hand den Takt auf seinem Oberschenkel mittrommelte, während seine Linke den Lautstärkeregler des Autoradios suchte. Harro schien entweder über das Wochenende taub geworden oder aber der Ansicht zu sein, dass die Flippers für ihr unvergleichliches künstlerisches Schaffen die ungeteilte Aufmerksamkeit von gleich drei Mainzer Kriminalbeamten verdienten.
»Und ich sah ihre Augen, sie war wunderschön. Mona Lisa. So wunderschön …«
Die Körperhaltung von Harro deutete an, dass er jeden unautorisierten Eingriff in die Musikgestaltung entschlossen abwehren würde. Schützend beließ er die linke Hand ganz nahe am Gerät. Es fehlte nur noch, dass er versuchte, sich bei Tobias, der auf dem Mittelsitz der Rückbank saß, unterzuhaken. Das K11 des Mainzer Polizeipräsidiums, zuständig für Tötungsdelikte, auf munterer Ausfahrt zum Einsatzort: Gute Stimmung ist garantiert. Der Polizeipräsident ist in der Ranzengarde, hier herrschen Ausgelassenheit und Teamgeist das ganze Jahr, nicht nur an Fassenacht. Wir schunkeln sogar im Auto.
Ravi fühlte sich wohl nach einem erholsamen Wochenende, das er mit Sandra verbracht hatte. Eine typische Dienstbeziehung: die Streifenpolizistin und der Kriminalkommissar. Sie hatten sich im vergangenen Herbst an einem Tatort kennengelernt. Ein Hobbywinzer war beim Laubschnitt im Weinberg durch herumfliegende Metallsplitter schwer verletzt worden. Erst später stellte sich heraus, dass alles mit dem Knochenfund auf einem Gartengrundstück, dem »Herrgottsacker«, zusammenhing. Diesen Namen trug auch der Prozess, der in den kommenden Wochen beginnen sollte. Ein für sie alle sehr belastender Fall, ohne den er und Sandra sich aber möglicherweise bis heute nicht gefunden hätten. Die erste Frau, die es geschafft hatte, die Vier-Wochen-Beziehungsschallmauer zu durchbrechen. Bald ein Jahr waren sie jetzt zusammen. Er grinste, was Harro sofort auffiel. An den Gesichtszügen des Chefs ließ sich ablesen, dass er diese positive Grundstimmung seinem Wirken als DJ für Schlagermusik zuschrieb. Hoffentlich setzte er jetzt nicht zu einem Monolog über die gesundheitsfördernden Wirkungen deutscher Unterhaltungsmusik an. Den hatten sie sich erst letzten Montag anhören dürfen. Völlig absurde Theorien, die Harro spontan, aber so amüsant entworfen hatte, dass sie sich alle kaum eingekriegt hatten vor Lachen.
Eigentlich hätten Sandra und er am gestrigen Sonntag den Antrittsbesuch bei seiner Mutter absolvieren sollen. Seit er ihr von Sandra erzählt hatte, drängte sie darauf, während er immer neue Ausreden erfand, um das Zusammentreffen zu vermeiden. Seine Mutter, die seit dem Tod des Vaters vor drei Jahren allein in einem viel zu großen Haus in der Nähe von Kaiserslautern lebte, war nicht ganz einfach.
Gestern hatte er einen dienstlichen Notfall vorgeschoben, den es nicht gegeben hatte. Heute würden sie um den Besuch in Otterbach nicht erneut herumkommen. Da er ihr schon klargemacht hatte, dass sie nicht übernachten würden, waren die Aufenthaltsdauer vor Ort und somit das damit verbundene Risiko für Konflikte immerhin zeitlich begrenzt. Einfach würde es trotzdem nicht werden. Das war es noch nie gewesen, auch nicht, als sein Vater noch gelebt hatte. Gisela und Norbert hatten ihn als Säugling direkt nach seiner Geburt im Juni 1988 in Sri Lanka adoptiert. Mit dem sich entwickelnden Bewusstsein für die offensichtlichen Unterschiede zwischen ihm und seinen Eltern, seine dunklere Haut, die schwarzen Haare, war der Graben aufgebrochen. Die Fragen nach seiner Herkunft, die er unbeholfen formulierte und die sie unbeantwortet ließen, hatten ihn noch vergrößert. »Junge, sei doch dankbar, dass wir dich dort rausgeholt und dir ein gutes Leben ermöglicht haben.« Je mehr er wissen wollte, desto unterkühlter wurden sie.
Ravi schaltete zurück. Der Motor heulte auf und bremste den Wagen.
»Ich tippe auf achtzig plus.« Harro drehte den Kopf zur Seite, um sich beim Überholvorgang die Bestätigung für seine Vermutung abzuholen.
Der betagte Verkehrsteilnehmer in seinem dunkelgrünen Stufenheck schien jetzt endlich das Blaulicht auf dem Kombi erkannt zu haben. Er näherte sich der Leitplanke so weit an, dass Ravi an ihm vorbeikam. Dicht am Lenkrad, kerzengerade aufgerichtet, um gerade so darüber hinwegspähen zu können, hatte er seinen Hut tief in die Stirn geschoben und trug zu allem Überfluss noch eine weiße FFP2-Maske, obwohl er allein in seinem Wagen saß. Er wirkte wie aus einer anderen Zeit.
»Bingo!« Harro nickte, erfreut, richtiggelegen zu haben.
»Müssen wir da einschreiten?« Ravi konnte trotz des Lärms das Kichern von Tobias auf der Rückbank vernehmen. »Vermummungsverbot im Straßenverkehr. Dem Tempo nach wirkt es aber nicht so, als ob er sich für den nächsten Blitzer getarnt hätte.«
»Volksbank Guntersblum. Der überfällt sie, während wir nur wenige Kilometer entfernt nach Fingerabdrücken auf Fensterprofilen suchen.« Ravi beschleunigte und blieb auf der Bundesstraße 9, die sie in einem ausladenden Bogen nach links in Sichtweite des Rheins brachte, um dann dem Fluss nach Süden in Richtung Nierstein und Oppenheim zu folgen. So weit mussten sie aber nicht.
Ravi setzte den Blinker für die Ausfahrt genau in dem Moment, als auch SWR4 endlich ein Einsehen mit ihnen hatte. Der eingeschobene Werbeblock war eine Wohltat für seine malträtierten Gehörgänge. Sie mussten nach Laubenheim und kurz vor dem Bahnhof des Mainzer Stadtteils nach links abbiegen. Je nach Verkehrslage brauchten sie noch gut fünf Minuten, bis sie am Ziel waren.
»Du könntest doch nach Dienstschluss am Freitagnachmittag anfangen und bis Montagmorgen sieben Uhr durchgängig diese Musik hören.« Tobias blickte prüfend in Harros Richtung. »Mit dieser Sättigung würdest du die ersten Tage der neuen Woche überstehen, und wir könnten hier drinnen darauf verzichten, uns die Ohrmuscheln mit diesem süßen Schmalz zuzukleistern.«
Ob Tobias wirklich eine Antwort von Harro erwartete, wusste Ravi nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Die Kontrolle über Auswahl und Lautstärke der Musik auf der Fahrt zum Einsatzort beanspruchte der Chef von jeher für sich. Das war ein ungeschriebenes Gesetz, so wie auch jeder von ihnen immer auf derselben Position saß, wenn sie zusammen losfuhren.
Tobias, der mal wieder einen seiner gefürchteten, von seiner Frau Sara selbst gestrickten, heute cremefarbenen Pullunder über dem himmelblauen Hemd trug, richtete den Blick erneut nach vorne. Ravi erkannte im Rückspiegel, dass um den V-Ausschnitt herum zwei unregelmäßige, wulstige Zöpfe verliefen, die den Eindruck vermittelten, mehrere Wiener Würstchen befänden sich im ungelenken Liebesspiel. Tobias’ luftiger Mittelscheitel wippte bei jeder Bodenwelle mit. Er lächelte und wirkte im Gegensatz zum Chef ausgeruht. Er hatte schon ausgiebig von seinem Wochenende berichtet und die Entwicklung seiner beiden kleinen Kinder in aller Ausführlichkeit dargestellt. Lena und Ben waren ihren Altersgenossen in allem immer mindestens einen Schritt voraus und brauchten daher ganz besondere Herausforderungen, die die Schmahl’schen Familienwochenenden wie zwei Wochen komprimiertes Kinder-Ferienkarten-Programm erscheinen ließen. Ravi hatte schon wieder vergessen, wo sie nach der Sonderausstellung im Frankfurter Senckenberg Naturkundemuseum, der ehemaligen Landesgartenschau in Bingen und einem Workshop zum Thema Dunkelheit auf Schloss Freudenberg in Wiesbaden noch überall gewesen waren, um die Entwicklung der beiden sieben- und vierjährigen Sprösslinge optimal zu unterstützen. Und wenn es nicht um die frühkindliche Förderung schlummernder Talente ging, dann trieben Tobias die Sorgen und Ängste um, was den armen Kleinen alles zustoßen könnte. Zwar wurden sie von ihm und seiner Frau Sara so umfassend umsorgt, dass sie außerhalb des Hauses keinen unbeobachteten Schritt mehr tun konnten. Trotzdem wusste er immer wieder davon zu berichten, welchen alltäglichen Gefahren sie ausgesetzt waren. Einmal war es der rücksichtslose Autofahrer, der den Zebrastreifen übersehen hatte, dann die offen gelassene Zisterne auf einem verwilderten Grundstück, die sein Sohn beim Sonntagsspaziergang entdeckt, in die er aber zum Glück nicht hineingestürzt war. Wie sehr ihn diese Sorgen verfolgten, merkte Ravi daran, dass Tobias manche Erlebnisse sogar kopfschüttelnd mehrmals erzählte und dabei völlig vergaß, dass sie das alles schon kannten.
Er fuhr sich durch seine schwarzen, flusigen Locken. Manchmal hatte er das Gefühl, dass Tobias an den zwei Tagen des Wochenendes so mit aller Gewalt das schlechte Gewissen bekämpfte, das ihn die ganze Woche über umtrieb, wenn er meinte, nicht genug Zeit für seine Frau und die beiden Kinder zu haben. Mit dem Bau des eigenen Einfamilienhauses im rheinhessischen Hinterland und den damit verbundenen Wegstrecken, die er jeden Tag im dichten Berufsverkehr auf gewundenen, einspurigen Landstraßen über die Dörfer zurücklegen musste, schien sich dieser Zwang noch verstärkt zu haben. »Jeden Tag verschenke ich fast anderthalb Stunden Zeit, sieben Stunden in der Woche, die ich mit meinen Kindern und meiner Frau verbringen müsste.« Die Verzweiflung war aus diesen Worten deutlich herauszuhören und ebenso sein Vorwurf an sich selbst, die Nähe zur Arbeit für vierhundertfünfzig Quadratmeter in einer Neubausiedlung eingetauscht zu haben, die Saras wiederkehrende Depressionsschübe eher noch verstärkte.
Ravi nutzte die Verkehrsmeldungen im Radio, um über die Steuerung am Lenkrad die Lautstärke zumindest so weit nach unten zu regeln, dass der nächste sinnentleerte Schlagersong sich nicht auch noch in seine Gehörgänge fräste und ihn als Endlosschleife durch den gesamten Vormittag begleitete. Gegen eine wohldosierte Ablenkung als präventive Psychohygiene auf dem Weg zum Einsatz gab es nichts einzuwenden, solange sie keinen nachhaltigen Schaden anrichtete. Auf Harros bevorzugten Sender traf dies jedoch nur bedingt zu.
Der Chef reagierte nicht darauf, er schien anderen Gedanken nachzuhängen. Mit seinen dreiundfünfzig war er fast zwanzig Jahre älter als Ravi. Doch Harros trockener Humor, dem er oft eine gehörige Brise Spott beimischte, tat ihnen allen gut. Jetzt rieb er sich müde mit der Rechten über den kahlen Schädel und die stoppeligen Wangen. Wie an jedem Montag vermittelte er nicht den Eindruck, dass er das Wochenende zur Erholung genutzt hatte. Seine speckige und abgegriffene dunkelbraune Lederjacke verströmte den abgestandenen Geruch der Kneipen, in denen sich das Rauchverbot bis heute nicht hatte durchsetzen wollen. Sein ausgeblichenes schwarzes Poloshirt spannte über dem Bauch. Harro schnaufte und schloss die Augen.
Ravi atmete konzentriert durch die Nase ein und versuchte, aus dem Gewirr der Gerüche diejenigen zu identifizieren, die eine Aussage darüber zuließen, ob sein Chef heute Morgen schon auf Hochprozentiges zurückgegriffen hatte. Zu einem abschließenden Ergebnis kam er jedoch nicht. Mit einer kurzen Handbewegung bedeutete Harro ihm, dass er an der nächsten Ampel links abbiegen musste. Es konnte nicht mehr weit sein. Harro drückte das Radio endgültig aus.
Sie schwiegen. Das tat gut. Eine kurze innere Einkehr, bevor die vielen Eindrücke eines Tatorts über sie hereinbrachen. Die meisten ihrer Einsatzorte wurden von Stille beherrscht. Von konzentrierter Ruhe mit gedämpften Gesprächen und knappen Anweisungen. Dort, wo sie hinkamen, war der Lärm längst vorüber, die Hektik vorbei. Manchmal erinnerten verstreut herumliegende Utensilien des Notarztes und der Rettungssanitäter, hastig aufgerissene Plastikverpackungen, die Kappe einer Spritze, an das Ringen und den erfolglosen Kampf um jede Sekunde Leben. Die vergeblichen Bemühungen standen auch den Rettern ins Gesicht geschrieben, die sie bei der Abfahrt oder einer Zigarette davor am Rettungswagen antrafen.
Was sie vor Ort erwartete, gab keinen Laut mehr von sich, aber es hallte trotzdem in ihnen nach. Die Spuren von Blut an Wand und Böden, ein Projektil, das eine massive Schranktür durchschlagen hatte, oder ein beim Kampf herausgerissenes Stück Stoff, all diese Dinge lösten winzige Geräusche in Ravis Kopf aus. Selbst von dem, was er roch, gingen kleine Laute aus. Es hatte mit dem ersten Tatort angefangen und nie aufgehört. Zuerst hatte er dagegen angekämpft, weil es ihm sonderbar vorgekommen war. Harro hatte ihn auf seine typische Art beruhigt. »Erst wenn die Toten nach dir rufen, sobald du die Augen schließt, solltest du dir Gedanken machen. Alles andere zeigt nur, wie gespitzt deine Sinne in dieser Situation sind. Versuch, sie nicht zu unterdrücken. Solange du da oben«, er hatte mit dem Zeigefinger an Ravis Stirn getippt, »alles wieder ausgeräumt bekommst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.«
Ravi bog auf Harros erneuten Fingerzeig nach rechts ab. Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser wechselten sich ab. Große Laubbäume und bunte Hecken rahmten sie ein oder verbargen sie fast vollständig. Obwohl gut gepflegt, war einigen dennoch anzusehen, dass sie aus den frühen Achtzigern stammten. Von den Fensterrahmen blätterte die Farbe. Am Ende der Straße, die auf offenes Feld mündete, erkannte er den Rettungswagen.
»Magda und Dr. Erwin Oberländer, beide Anfang siebzig. Die Frau vom Pflegedienst hat sie gefunden und die Polizei alarmiert. Sie ist Thailänderin und spricht schwer verständliches Deutsch. Sie steht noch unter Schock, mal sehen, was wir später überhaupt aus ihr herausbekommen. Sie war wohl zuletzt am Freitag da. Und am Wochenende war es fast spätsommerlich warm.« Harro schnaufte vielsagend. In Ravis Ohren klang es wie ein ahnungsvolles Aufstöhnen. »Ich denke, wir kümmern uns zuerst um die Wohnung«, schlug Harro vor. »Dann haben wir es bis zum Mittagessen hinter uns. Zwei Streifenpolizisten sind noch vor Ort, und die Kriminaltechnik müsste auch in ein paar Minuten da sein.«
Ravi spürte die Anspannung, die ihn erfasste. Es bestand Routine in ihren Arbeitsabläufen. Das gab einen gewissen Halt, ein Tau, das ihn sicherte, wenn er abzurutschen drohte. Doch die Situation vor Ort war jedes Mal anders. Unvorhersehbar und nicht kalkulierbar.
Er rollte langsam in die freie Lücke neben dem Krankenwagen. Ein Stoppelfeld, auf dem es wieder grünte, lag vor ihnen. Sie stiegen aus. Er holte seinen Rucksack aus dem Kofferraum. Im Vorbeilaufen sah er an der Seitentür des Rettungswagens eine gedrungene Frau in violetten Gummisandalen. Ihr mintfarbener Pflegekittel spannte um den Bauch. Schwarze Haare umrahmten ein rundes Gesicht, ihr Blick aus verweinten Augen folgte ihnen. Die Frau griff nach einem Becher, den ihr eine Sanitäterin reichte.
Harro eilte voran. Ein kleines Mehrfamilienhaus, drei Etagen mit ausgebautem Dach, erwartete sie. Die Birnbäume links und rechts des Gehwegs trugen nur noch wenige gelbe Blätter. Die dichte Rasenfläche war frisch gemäht, die Kanten sauber nachgearbeitet. Warum achtete er auf solche Dinge? Belanglose Details machten das große Grauen ein wenig erträglicher. Hellbraune Marmorstufen ließen ihre Schritte von den Wänden widerhallen. Der Geruch des sonntäglichen Schmorbratens hing noch im Treppenhaus fest und wurde intensiver. Einheitlich gerahmte, leicht vergilbte Stiche aus den Hochzeiten der Rheinromantik begleiteten sie. Der Mäuseturm, dann verschiedene Burgen, Reichenstein, Rheinstein, die Pfalzgrafenstein bei Kaub, die wie ein steinernes Schiff auf einer Insel im Wasser thronte. Links und rechts zweigte je eine Wohnung ab. An jeder Tür hing ein kleines Gesteck, der saubere Fußabtreter lag akkurat darunter. Keine Schuhe vor der Wohnungstür, kein Tretroller, kein Skateboard, es wirkte nicht so, als ob es Kinder im Haus gäbe. Den Bratenduft ließen sie schon in der ersten Etage hinter sich. In der zweiten hatten sie ihr Ziel erreicht. Die beiden noch jungen Streifenpolizisten standen vor der Tür. Aus ihren großen Augen und geröteten Wangen sprach die Erregung. Sie hielten Abstand zum Wohnungseingang und vermieden es, hineinzusehen. Was sie bisher erblickt hatten, schien ihnen auszureichen.
»Guten Morgen, Kollegen.« Harro nickte den beiden aufmunternd zu. »Was müssen wir wissen?«
Beide reckten sich und schienen sich kurz zu sammeln.
»Wer war alles drinnen?«, fragte Harro weiter, noch bevor ein Wort gesagt worden war. Sein Blick wanderte von einem zum anderen.
»Die Pflegerin ist überall herumgerannt. Wir sind gleichzeitig mit den Sanitätern hier angekommen und zusammen rein.« Er deutete mit einer knappen Kopfbewegung in Richtung der geöffneten Wohnungstür. Ravi merkte, dass er sich bemühte, nicht durch die Nase einzuatmen. »Wir haben uns aber zurückgehalten. Wir waren nur ein paar Schritte im Flur und haben die Pflegerin mit rausgenommen. Es ist ja schließlich ein Tatort.«
Harro nickte und klopfte dem Mann auf die Schulter. »Da habt ihr alles richtig gemacht. Wir übernehmen. Bitte notiert für uns die Namen und Anschriften der Sanitäter und der Pflegerin. Sie soll bleiben. Die Sanitäter können los, wenn sie keine Hilfe mehr braucht.«
Die beiden wirkten erleichtert, endlich wegzukommen von diesem Ort, der großzügig den süßen Geruch des Todes verströmte.
5
Rocco Werner hatte genug gesehen. Surrend startete er den Motor seines schweren SUV. Nebenan fuhr derweil der nächste Wagen der Polizei vor. Genauso unauffällig wie die beiden davor: dunkelblaue Kombis von Volkswagen und Audi. Da vermutlich die gesamte Jahresproduktion in dieser Tarnfarbe an die Polizei ging, schellten bei jedem, den er kannte, sofort die Alarmglocken, wenn er einen solchen Wagen sah. Er schmunzelte und strich sich durch den gepflegten roten Vollbart, den er heute Morgen nach dem Shampoonieren noch zusätzlich mit Wachs bearbeitet hatte. Es fühlte sich gut an, aber der Geruch gefiel ihm nicht. Er atmete hörbar durch die Nase ein. Er roch wie ein überparfümierter Toilettenstein. Wahrscheinlich war das Zeug deswegen im Sonderangebot gewesen. Er hätte besser doch nach der gewohnten Marke gegriffen, die fast geruchlos war. Jetzt konnte er neben der Funktion des Fahrers auch die des Duftbäumchens am Rückspiegel übernehmen. In der Werkstatt musste er sich das Gesicht waschen. Das war nicht auszuhalten.
Er wartete noch einen Moment, bis die beiden Beamten in Zivil mit ihren Koffern im Haus verschwunden waren. Der gute Bekannte seines Chefs war schon mit dem ersten Schwung ziviler Polizisten angereist. Danach manövrierte er den BMW vorsichtig aus der Parklücke und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Es hatte keinen Sinn, weiter das Haus anzustarren. Am Ende wurden sie noch auf ihn aufmerksam und stellten Fragen, für die er nur schwer unverdächtige Antworten fand. Das bedeutete nur zusätzlichen Ärger, den er in dieser ohnehin nicht einfachen Situation tunlichst vermeiden sollte. Als ob es nicht schon genug Probleme gäbe, und jetzt das. Er schlug mit der geballten Faust auf das Sportlenkrad aus poliertem Holz.
Noch bevor das Ortsschild in Sicht kam, trat er das Gaspedal durch und genoss es, dass ihn der Schub in den Sitz drückte. Sein X6 Competition in der Tuningversion hatte gut sechshundert PS, die die mehr als zweieinhalb Tonnen in knapp vier Sekunden auf einhundert Stundenkilometer brachten. Da war ein Passat gerade angefahren. Er vermied es, sich zufrieden durch den Bart zu fahren, weil er befürchtete, dadurch die nächste Dunstwolke freizusetzen. Ließ er die Haare in Ruhe, müffelten sie nur schwach und einigermaßen erträglich vor sich hin. Stattdessen rieb er sich über den massiven, großflächig tätowierten Oberarm und spannte den gut ausgebildeten Bizeps an.
Vollständig sortiert bekam er das, was er da eben gesehen hatte, bisher noch nicht. Eine sehr vorsichtige Formulierung dafür, dass er eigentlich keinen blassen Schimmer hatte, wie alles zusammenhing und ob es sie wirklich betraf. Um das beurteilen zu können, würden sie Details von drinnen brauchen. Darum musste sich der Chef nachher kümmern. Seine eigenen Kontakte reichten nicht aus.
Von Bruno, den Rocco vor zehn Jahren angeworben hatte, stammte der Hinweis, dass die Polizei hier gerade mit fast allem anrückte, was sie zu bieten hatte. Er wohnte zwei Straßen weiter, hatte den Auflauf zufällig mitbekommen und sofort Bescheid gegeben. Rettungswagen, Streife, Kripo, das ganz große Aufgebot. Genug, um Rocco zu bewegen, sich selbst ein Bild zu machen. Die Entwicklungen der letzten Monate und Beobachtungen im Umfeld hatten ihn hergelockt.
Im letzten Winter hatten sie die Bulgaren von der anderen Rheinseite in die Schranken gewiesen. Die verstanden nun, dass die alten Grenzen Bestand hatten. Wilderte man im fremden Revier, lief man Gefahr, beim Überqueren der Theodor-Heuss-Brücke unglücklich in den Rhein zu stürzen. Die Bulgaren waren nicht dumm, es hatte nur einer springen müssen, bis der Groschen gefallen war. Jetzt drängten stattdessen die Türken vom Findik-Clan aus Frankfurt und Offenbach zu ihnen herein. Wobei, Türken waren sie eigentlich nicht. Sie stammten aus dem Libanon, der sie aber auch nicht mehr zurückwollte. Und Findik hießen sie auch nicht. Eigentlich stimmte gar nichts an denen. Angeblich nannten sie sich so, weil der Erste von ihnen, der noch vor dem Zweiten Weltkrieg die Türkei verlassen hatte, mit Haselnüssen, türkisch Findik, gehandelt hatte.
Mit den Bulgaren waren sie leicht fertiggeworden. Die tickten ähnlich wie sie. Die Findiks waren ein anderes Kaliber, kaum zu greifen bis jetzt, und sie wurden immer mehr. Das wollte der Alte nicht wahrhaben. Die Jungs auf der Straße, die ihre Drogen verkauften, wurden aber bereits nervös. Sie spürten jede Veränderung zuerst und redeten davon, dass ständig neue dazukamen. Die meisten von denen waren zwischen vierzehn und fünfundzwanzig, also im besten Alter. Alle aus der großen Familie und untereinander so oft direkt verwandt, dass sie gerne Witze über die Qualität des eingeschränkten Genpools machten. Das hielt sie aber nicht auf und machte sie nur noch gefährlicher.
Sie fluteten herüber, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Drei Familien saßen bereits in der Neustadt, eine in Mombach. Und das waren nur die, von denen sie wussten. Er glaubte fest, dass es schon viel mehr waren. Sein Informant in der Stadtverwaltung hatte berichtet, dass Anfang des Monats einer von denen mit einem knappen Dutzend Geburtsurkunden aufgetaucht war und den Mitarbeiter im Sozialamt unter Druck gesetzt hatte. Das Kindergeld hatte er auf diese Weise anscheinend schon klargemacht. Und gäbe es in der Stadt nur ein paar wenige von ihnen, träten sie nicht so selbstsicher auf. Zwei ihrer Dealer waren erst letzte Woche am Hauptbahnhof von denen bedrängt worden. »Kommt zu uns, was wollt ihr noch bei dem alten Mann?«
Zwar hielten die Findiks die Füße ansonsten weitgehend still. Er war sich aber ganz sicher, dass es so nicht bleiben würde. Sie sammelten sich. Eine trügerische Ruhe, von der sie sich nicht einlullen lassen durften, umgab sie, weil ihre Geschäfte jetzt sogar besser liefen als vor dem Geplänkel mit den Bulgaren. Die Drogen und das Schutzgeld sowie das Glücksspiel in zwei Kellern in der Nähe des Südbahnhofs, der Handel mit den Autos und den Antiquitäten, die dem Alten so am Herzen lagen, weil sich darüber ein Teil des Geldes waschen ließ, sorgten für steigende Einnahmen. So war auch zu verschmerzen, dass der warme Geldregen aus dem guten Dutzend Corona-Testcentern mittlerweile versiegt war. Doch das vernebelte ihnen nicht den Blick auf die dunklen Gewitterwolken, die am Horizont aufgezogen waren.
Die Findiks vermaßen das Terrain, sondierten ihre Chancen und Risiken und verteilten sich still und leise über die gesamte Stadt. Das kannten auch die Bulgaren, weil es bei denen drüben ebenso angefangen hatte. Kein einziger nennenswerter Zwischenfall, dann kam auf einmal der große Knall, und man wunderte sich, dass innerhalb weniger Minuten vier Dutzend Brüder und Cousins da waren, die nicht lange fackelten.
Ob der Chef, der die sechzig inzwischen überschritten hatte und den sie wegen seiner auch privaten Vorliebe für feine alte Möbel den »Starinski«, die Antiquität, nannten, noch für einen großen Kampf taugte? Seine beiden ältesten Kinder hatten frühzeitig das Weite gesucht und würden nicht zurückkommen. Rajko, der Jüngste, studierte noch im Rheingau an einer Privatuni und schwirrte in letzter Zeit immer öfter um den Vater herum. Mit verworrenen Ideen, die er umsetzen wollte und für die er den Alten um Geld anging. Auf Rocco machte es eher den Eindruck, als ob er nur auf den richtigen Zeitpunkt wartete, um sich mit vollen Taschen ebenfalls aus dem Staub zu machen.
Egal, wie sich das entwickelte, sie gingen äußerst schwierigen Zeiten entgegen, von denen er nicht mehr mit letzter Überzeugung behaupten würde, dass sie am Ende als Sieger dastünden. Daher war es wichtig, die Augen und Ohren offen zu halten, um rechtzeitig reagieren zu können. Er hielt zum Alten, dem er viel verdankte, aber das sinkende Schiff verließ er bestimmt nicht als Letzter.