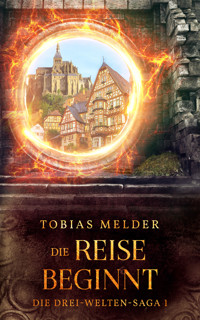3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Reise geht weiter: Gemeinsam machen sich unsere Gefährten auf den Weg in den eisigen Norden, um nach der Druidenältesten zu suchen. Doch schon bald müssen sie sich tödlichen Gefahren stellen. Blutrünstige Banditen und brandschatzende Plünderer sind dabei nur die geringsten ihrer Probleme. Als ihnen dann auch noch uralte, magische Wesen nach dem Leben trachten, droht ihre Reise endgültig zu scheitern. Werden sie ihr Ziel trotz aller Widrigkeiten erreichen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tobias Melder
Die Drei-Welten-Saga 2:
Der Ruf der Elderbäume
Über die Illustratorin:
Natalina Macri wurde 1980 in Schwabmünchen geboren und lebt seit vielen Jahren im Ostallgäu. Sie schreibt gern Bücher über Katzen, insbesondere über ihren schwarzen Kater Zampano. Er erlebt in den Geschichten »Zampano und die besonderen Tiere« und »Zampano wild unterwegs«, zwei mitreißende Abenteuer. Neben vielen schönen Bildern und Zeichnungen, mit denen die Autorin ihre Bücher selbst illustriert hat, erwartet die Lesenden ein spielerischer Lerneffekt.
Impressum:
1. Auflage Oktober 2022
Illustrationen: Natalina Macri
Cover und Umschlaggestaltung: Jennifer Schattmaier
Lektorat: Anke Unger
Karte gestaltet mit Inkarnate pro
© Copyright by Tobias Melder
Veilchenweg 2, 87749 Hawangen
www.tobias-Melder.de
Prolog
Sarah hatte in ihrem Leben noch nie zuvor etwas so Gewaltiges gesehen wie den alten Wächter. Ein Baum, dessen Wurzeln allein so gigantisch waren, dass sie einen Tunnel formen konnten, der groß genug war, dass zwei Fuhrwerke ohne Probleme aneinander vorbeikamen.
Der Tunnel markierte den Eingang zum Wolfswald und war der einzige passierbare Weg für alle, die weiter nach Norden wollten. So auch für Sarah und ihre Familie.
Fasziniert von den unzähligen Facetten, welche die Dunkelheit hier annahm, beobachtete sie die unheimlichen Schatten, welche das Wurzelwerk im unsteten Schein der Laternen warf. Je länger sie die sich immerwährend verändernden Schattengestalten betrachtete, desto mehr hatte sie das Gefühl, als wären sie lebendig. Es war ihr, als würden sie Sarah und ihre Familie misstrauisch beäugen und nur auf den passenden Moment warten, um sich auf sie zu stürzen.
Das Schnauben ihrer Stute riss ihren Blick von den Wänden. Ihr Pferd wurde unruhig, und es kostete sie einiges an Mühe, es wieder zu beruhigen. Die anderen hatten angehalten, weshalb Sarah ihr Reittier ebenfalls zum Stehen brachte. Unsicher sah sie sich um. Ihr Vater war ein Stück vorausgeritten und spornte sein Pferd an, langsam weiter vorwärts zu traben. Nur widerwillig gehorchte es ihm.
Neben Sarah saß ihre Mutter Ethel im Sattel auf ihrer rostbraunen Stute. Sie versuchte ihre Tochter mit einem aufgesetzten Lächeln zu beruhigen, allerdings erkannte Sarah die Angst hinter ihrer Fassade.
Den Übrigen erging es nicht anders. Die Pferde ihres Onkels und ihrer Tante tänzelten unruhig auf der Stelle, fast so, als würde sich die Anspannung ihrer Reiter auf sie übertragen. Ihr kleiner Bruder Egon wimmerte leise auf dem Kutschbock, während ihr Großvater ihn in den Arm nahm und versuchte, ihn sanft zu beruhigen.
Auf dem knarzenden Karren befand sich alles, was sie noch besaßen. Ein paar Kisten Kartoffeln, einige Sack Getreide eine Kiste mit einfachem Geschirr sowie ihre verschlissenen Werkzeuge. In einem Käfig pickten drei Hühner auf dem Holzboden nach den wenigen Körnern, die sie noch erübrigen konnten. Das war alles gewesen, was sie hatten retten können. Alles andere war ihnen in jener Nacht genommen worden. Ein Schauder überkam Sarah, als sie sich daran erinnerte, was vor einer Woche geschehen war.
Es war mitten in der Nacht gewesen, als ein lautes Krachen Sarah geweckt hatte. Sie eilte aus ihrem Zimmer und wollte vom Treppengeländer nach unten sehen, was passiert war, aber ihre Mutter schickte sie wieder zurück. »Nimm deinen kleinen Bruder, geh in dein Zimmer und schließ deine Tür ab!«, rief sie ihrer Tochter verängstigt entgegen, während sie die Treppenstufen hinuntereilte. Sarah nahm pflichtbewusst ihren kleinen Bruder bei der Hand und zog ihn mit sich in ihr Zimmer. Hinter der Tür blieb sie stehen und lauschte.
»Was wollt ihr hier?«, hörte sie ihren älteren Bruder rufen.
»Nach was sieht es wohl aus?«, antwortete eine dunkle Stimme.
»Wir haben nicht viel, aber wir können gerne mit euch teilen«, hörte Sarah ihre Mutter flehentlich sagen.
»Wir sind nicht gekommen, um zu teilen«, erwiderte die dunkle Stimme erbarmungslos.
»Bitte, es muss nicht so enden!« Die zitternde Stimme ihrer Mutter ließ Sarah innerlich erbeben.
»Verlasst sofort unser Haus!«, schrie Olaf, ihr anderer Bruder, ihnen mutig entgegen.
»Oh, das werden wir«, entgegnete der Fremde. »Aber nicht, bevor wir uns das geholt haben, wofür wir gekommen sind.« Ein kehliges Lachen drang zu Sarah herauf, dann hörte sie den Lärm eines kurzen Kampfes.
»Nein!« Der verzweifelte Schrei ihrer Mutter hallte durch das Haus. Sarah vernahm einen dumpfen Schlag, dann war es plötzlich unheimlich still.
»Durchsucht das Haus und nehmt alles mit, was ihr finden könnt.« Die befehlsgewohnte Stimme des Mannes durchbrach die Stille.
Schritte ertönten und verteilten sich überall im Haus. Einige der Eindringlinge eilten die Stufen hinauf. Sarah überkam Panik. Sie sah sich in ihrem Zimmer um, schnappte sich ihren kleinen Bruder und wies ihn an, sich in der Kiste hinter dem Bett zu verstecken.
»Warum denn?«, fragte er verängstigt.
»Tu einfach, was ich sage!«, zischte sie ihn an, während sie ihn vor sich herschob. »Und egal, was du hörst, du gibst keinen Ton von dir!« Jemand rüttelte an ihrer Tür. »Hast du mich verstanden?«
»Ja«, schluchzte ihr Bruder, als Sarah den Deckel über ihm schloss. Etwas schlug mit furchtbarer Gewalt gegen die Tür und riss sie aus den Angeln. Zwei breitschultrige Männer in abgetragenen Uniformen starrten sie lüstern an.
»Was für eine angenehme Überraschung«, säuselte einer von ihnen Sarah zu, während er auf sie zuging. Sie wich zurück und drängte sich in die hinterste Ecke ihres Zimmers.
»Keine Angst, Kleine, wir werden uns gut um dich kümmern«, war das Letzte, das er zu ihr sagte, als er sie packte und auf das Bett schleuderte.
Alles, was danach geschehen war, war für Sarah wie in eine dunkle Wolke gehüllt. Weit weg und nicht mehr greifbar. Ab und an kamen ein paar der Bilder zum Vorschein, nur um gleich wieder hinter den dichten Wolken zu verschwinden. Bilder von Männern, die sich über sie beugten, sie auszogen, sie berührten. Anfangs hoffte sie noch, dass jemand kommen und sie retten würde, dann hoffte sie nur noch, dass es bald aufhörte, dann, dass ihre Peiniger ihrem Leid einfach ein Ende setzen und sie töten würden. Zum Schluss fühlte sie gar nichts mehr. Irgendwann war es ihr egal, wie oft die Männer sich noch an ihr vergingen. Sie war innerlich bereits gestorben, als die Männer schlussendlich die Lust an ihr verloren hatten und sie in der Ecke kauernd zurückließen.
Sarah wusste nicht mehr, wie sie aus dem brennenden Haus entkommen war. Unbewusst fuhren ihre Finger über die sichelförmige Narbe auf ihrer linken Wange. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie sie sich diese zugezogen hatte. Dennoch blieb ihr die Narbe als eine immerwährende Erinnerung.
Alles, was sich ihre Familie aufgebaut hatte, verglühte in dieser einen Nacht, zusammen mit ihren älteren Brüdern und ihren Cousins, zu Asche. In Sarah blieb nichts weiter zurück als Finsternis, in die seitdem kein Licht mehr vordringen konnte.
Nun waren sie auf dem Weg zu entfernten Verwandten im Norden, in der Hoffnung, dort ein neues Leben aufbauen zu können. Diese besaßen eine große Metbrennerei, und ihre Eltern hofften, dass sie ihnen beim Neuanfang behilflich sein würden. Der Weg dorthin war jedoch gefährlich. Der Krieg hatte viele Menschen dazu gebracht, ein Leben als Gesetzlose zu führen, und die Straßen waren nicht mehr sicher. Wegelagerer plünderten überall im Land Reisende und fahrende Händler aus. Sie waren auf ihrem Weg an vielen herrenlosen Wagen oder geplünderten Rastplätzen all derer vorbeigekommen, die ihnen zum Opfer gefallen waren. Bislang hatten sie Glück gehabt und waren verschont geblieben, dennoch wuchs ihre Anspannung von Tag zu Tag.
Sarah blickte wieder zu ihrem Vater, der reglos an einer Biegung verharrte und ins Dunkel starrte. Langsam drehte er seinen Kopf zu ihnen. Sie sah in seinen Augen, dass auch von ihm eine tiefe Dunkelheit Besitz ergriffen hatte. Er hatte sich nie verziehen, an diesem Abend in der Stadt übernachtet zu haben.
»Alles gut, wir können …«, hörte sie ihn noch sagen, als er plötzlich mitten im Satz abbrach. Ein Bolzen hatte sich durch seine Kehle gebohrt, und ein grausames Röcheln hallte durch die Tunnelwände. Ungläubig versuchte ihr Vater noch, seine Hände auf die Wunde zu pressen, ehe er wie ein nasser Sack von seinem Pferd herunterglitt und dumpf auf dem Boden aufschlug. Die Lampe, die er gehalten hatte, zerbrach und das restliche Öl fing Feuer. Schon bald griffen die Flammen auf seinen Körper über. Sarah starrte in das lodernde Inferno. Erinnerungen an die Nacht der Vergewaltigung schwappten ein weiteres Mal in ihr hoch.
Sie hörte ihre Mutter schreien und ihren kleinen Bruder laut weinen. Doch sie selbst fühlte nichts. Es war ihr Vater, der gerade vor ihren Augen zu Asche verbrannte, und doch spürte sie dabei nichts. Sie fragte sich nur, ob das Feuer vielleicht imstande wäre, die Kälte in ihr zu vertreiben.
Mit martialischem Gebrüll näherten sich ihnen Wegelagerer. Sie kamen nicht nur von vorne auf Sarah und ihre Familie zugestürmt, sondern auch von hinten. Sie mussten ihnen gefolgt sein, nachdem sie den Tunnel betreten hatten. Sie waren in eine Falle getappt. Sarah zog das Messer aus ihrer Satteltasche, welches sie dort heimlich versteckt hatte. Nicht, um sich gegen die Angreifer zu wehren, sondern um ihrem Leben notfalls ein Ende zu bereiten. Sie setzte das Messer an ihre Pulsader und betrachtete den glänzenden Stahl der Klinge. Die matten und gebrochenen, dunkelgrünen Augen, die sich dort spiegelten, erkannte Sarah nicht mehr wider. Trotzig sah sie, wie das Messer die oberste Hautschicht anritzte und einige Tropfen Blut aus der Wunde rannen. Sie würde es diesen Männern nicht erlauben, ihr ein weiteres Mal solch grausame Dinge anzutun wie in jener Nacht.
Plötzlich ertönte ein fürchterliches Getöse, als das gesamte Wurzelwerk um sie herum zu beben begann. Ihr Pferd bäumte sich vor Schreck auf, sodass Sarah sich tief ins Fleisch schnitt, ehe ihr das Messer aus der Hand fiel. Warmes Blut begann aus der Wunde zu sickern. Verwirrt blickte Sarah zu den Angreifern, von denen einige nun nicht mehr auf sie zu rannten, sondern panisch schreiend versuchten, zu fliehen.
Die Wurzeln waren zum Leben erwacht und stürzten sich auf die Angreifer. Mit einer unbändigen Brutalität jagten sie jeden einzelnen der Wegelagerer. Sie durchbohrten, zerschmetterten oder erdrosselten sie ohne Gnade. Bei diesem Anblick lächelte Sarah kurz. Das erste Mal seit dem Überfall.
Das ganze Schauspiel dauerte nur wenige Augenblicke, dann war alles still. Behutsam zerrten die Wurzeln die Leichen an die Tunnelwände, und die Körper verschmolzen mit dem Holz, so dass bald nichts mehr von ihnen übrigblieb, als verzerrte Silhouetten am Wegesrand. Einzig ein paar Waffen und einige Beutel voller Münzen am Boden zeugten noch von dem, was gerade eben passiert war, dann wurde Sarah schwarz vor Augen und sie fiel aus ihrem Sattel.
Kapitel 1 – Die Elderbäume
Toms Blick blieb an einer ungewöhnlichen Form im Wurzelwerk hängen, die einem menschlichen Körper erschreckend ähnlich sah. Es war nicht das erste Mal, dass ihn hier solch eine Gestalt aus toten, hölzernen Augen anstarrte.
»Wahrlich ein Ableger des Weltenbaumes«, hörte er die Elfe Aeria hinter sich ehrfürchtig sagen. Sie war gerade in ein Gespräch mit Fiadorgas, ihrem gelehrten Reisebegleiter, vertieft. Tom kam es immer noch absurd vor, dass er erst vor ein paar Tagen zusammen mit seinen Freunden Ben und Lucy, der Elfe, dem Gelehrten, dessen wortkargen Begleiter Beolar und einem Zwerg zu dieser Reise aufgebrochen war. Auf der Suche nach einer Druidin, die ihnen helfen sollte, ein mächtiges Artefakt, das Herz des Phönix, zu beschaffen.
»Dieser Frieden und diese Lebendigkeit«, fuhr Aeria fort. »Er besitzt genau die gleiche Schwingung wie der Elderbaum in meiner Heimat. Wie viele es wohl noch gibt?«
»Ich weiß von zwölf dieser Bäume«, beantwortete Fiadorgas die Frage der Elfe. »Sechs davon habe ich mit eigenen Augen gesehen. Den hier und den in deiner Heimat eingeschlossen. Dazu habe ich den Elderbaum auf den Sumpfinseln weit im Westen und den in den Orklanden im Osten bereist. Auch den heiligen Baum der Minotauren, sowie jenen in der Kaiserstadt Sarkrit durfte ich bereits bewundern. Ich hoffe, dass ich auf unserer Reise noch ein paar mehr zu Gesicht bekommen kann. Faszinierende Bäume sind das, für wahr.«
»Hast du eine Ahnung, wie sie entstanden sind?«, wollte Aeria wissen. »In den Jahrtausenden, in denen wir Elfen den Weltenbaum beschützen, ist noch kein Samenkorn auch nur annähernd so weit gereift, dass wir es hätten in die Erde pflanzen können.«
»Es gibt verschiedene Theorien dazu«, erwiderte Fiadorgas. »Einige gehen davon aus, dass alle Elderbäume eigentlich ein und derselbe Baum sind. Dass sie letztlich alle aus dem Weltenbaum entstanden sind. Die Wurzeln dieses Baumes sollen ein gigantisches unterirdisches Geflecht bilden, welches sie alle miteinander verbindet. Einige Gelehrte behaupten sogar, dass aus diesem Geflecht jeder Wald entstanden ist.
Eine andere Theorie besagt, dass jeder der Zwölfgötter einen Baum als Zeichen seiner Macht und seiner Weisheit gepflanzt hat. So soll dieser hier von Bromos, dem Weltenschmied, gepflanzt worden sein und für dessen Kraft stehen.
Wieder andere behaupten, dass früher einmal der ganze Kontinent von Elderbäumen bedeckt war, allerdings fielen sie mit der Zeit immer mehr dem Raubbau von uralten Zivilisationen zum Opfer, bis nur noch ein paar wenige übrig blieben. Mir persönlich gefällt die erste Theorie am besten.«
Tom kam nicht umhin, die Besonderheit dieses Baumes zu spüren. Es lag nicht nur an dessen unglaublicher Größe. Nein. Die Energie zwischen den Wurzeln war einzigartig. So voller Leben, und doch strahlte er gleichzeitig eine unendliche Ruhe aus. Aber da war noch etwas anderes. Er konnte es nicht genau einordnen. Es war fast, als wollte er mit ihm kommunizieren. Tom verstand jedoch nicht, was der Elderbaum von ihm wollte, doch dieses Gefühl wuchs mit jedem Hufschlag seines Pferdes weiter an. Schließlich wurde es so allgegenwärtig, dass er sein Reittier an die Tunnelwand führte und es dort zum Stehen brachte. Er legte seine Hand auf das Wurzelwerk, schloss seine Augen und lauschte erwartungsvoll, dem knarzen des Holzes, doch es geschah nichts.
Er wollte seine Hand gerade wieder wegziehen, als er urplötzlich aus dem Sattel gerissen und in ein schier endloses, schwarzes Loch hinabgesaugt wurde.
Es dauerte, doch bald schon passten sich seine Augen an die Dunkelheit an, so dass er schemenhafte Formen um ihn herum erkennen konnte. Diese rasten in ungeheurer Geschwindigkeit an ihm vorbei, so dass ihm schwindelig wurde.
Allmählich wurde Tom klar, dass er es war, der sich in diesem wahnwitzigen Tempo fortbewegte. Etwas in ihm schien zu wissen, was hier gerade vor sich ging. Er reiste durch die Wurzeln des Elderbaumes.
Langsam verringerte sich die Geschwindigkeit, in der die Wurzeln ihn mitzogen. Nach und nach nahm er die schemenhaften Umrisse um sich herum deutlicher wahr.
Er befand sich in einem wundervollen Wald voller alter, starker Bäume. Viele davon waren hell erleuchtet. Sind das Gebäude?, fragte Tom sich, bevor er auf einmal abrupt in die Höhe stieg. Gut einhundert Meter über dem Boden kam er zum Stehen. Sein Blick schweifte über eine Stadt aus majestätisch geformten Holzbauten, oder vielmehr über eine Stadt, die allem Anschein nach aus den Bäumen gewachsen war.
»Tom, was siehst du?«, hörte er Fiadorgas Stimme dumpf zu ihm hallen. Er brauchte eine Weile, um die Worte zu verstehen, es fühlte sich so an, als wäre er mit seinen Gedanken unendlich weit weg, doch irgendwann beschrieb Tom dem Gelehrten die Szenerie.
»Das ist Nie’riennah!«, rief Aeria erstaunt aus. Auch ihre Stimme klang, als würde sie durch dichten Nebel zu ihm dringen.
»Sehr interessant«, fuhr Fiadorgas fort. »Allem Anschein nach hast du eine Verbindung zu den Elderbäumen aufgebaut. Wie bist du dorthin gekommen?«, fragte er Tom jetzt.
»Ich … wurde in die Tiefe gezogen. Und dann... Es fühlte sich so an, als würde ich durch die Wurzeln reisen«, versuchte Tom ihm zu erklären.
»Ha, ich wusste es«, rief Fiadorgas freudig aus. »Die Bäume sind tatsächlich alle miteinander verbunden. Kannst du deine Position verändern?«
Tom strengte sich an, um sich irgendwie zu bewegen. Es geschah jedoch nichts. »Nein, das kann ich nicht«, antwortete er.
»Dann kannst du vermutlich nur das sehen, was die Bäume dir zeigen wollen«, sinnierte Fiadorgas. In diesem Moment bewegte sich Tom wieder. Erneut wurde er in die Tiefe gerissen und raste durch das beinahe unendliche Wurzelwerk, bis er ein weiteres Mal in die Höhe stieg. Er schwebte über den goldenen Dächern einer gewaltigen Stadt, in deren verwinkelten Gassen reges Treiben herrschte. Umringt wurde diese von einer Sandwüste, soweit das Auge reichte. Tom berichtete seinen Gefährten, was er sah.
»Das muss Erboros sein.« Diesmal war es Bens Stimme, die Tom leise vernahm. »Fahir hat mir davon erzählt. Eine riesige Oase mitten in der Wüste und der größte Handelsposten seines Landes.«
»Es ist heiß hier«, sagte Tom. Schweißtropfen perlten an seinem Körper hinab.
»Das ist wirklich faszinierend«, drang Fiadorgas` Stimme aufgeregt zu ihm. »Allem Anschein nach ist nicht nur dein Geist dort, auch deine Empfindungen sind mitgereist. Hast du eine Ahnung, was der Elderbaum dir sagen will?«
Tom versuchte, mit der Pflanze zu kommunizieren, konnte sie aber nicht verstehen. »Nein, habe ich nicht«, antwortete er schließlich. »Ich weiß nicht, wieso …« Ein weiteres Mal ging es für Tom ohne Vorwarnung tief hinab, so dass er vor Schreck den Atem anhielt. Er raste wieder durch das Wurzelwerk noch schneller und länger als zuvor.
Allmählich gewöhnte Tom sich an diese Art der Fortbewegung, so dass das Schwindelgefühl nachließ und er mit der Zeit immer mehr seiner Umgebung wahrnehmen konnte.
Da war eine gigantische, natürliche Brücke, die zwei Landmassen miteinander verband, welche durch einen tosenden Fluss voneinander getrennt waren. Die Brücke war über und über mit Schnee bedeckt, und in der Mitte ragte eine Mauer aus grauem Stein empor, die den Weg versperrte. Wenn Tom sich konzentrierte, konnte er sogar Menschen sehen, die, eingepackt in dicke Pelzmäntel, darauf patrouillierten.
Die Wurzeln zogen ihn weiter unter der Mauer hindurch in ein karges Land aus Felsen und Schnee, bis er zu einem weiteren der Elderbäume kam. Dieser ragte aus einer großen Siedlung, bestehend aus einfachen Holzbauten empor. Ein eisiger Lufthauch wehte um seinen Körper und Tom begann am ganzen Leib zu zittern.
Fjellheim sein«, schlussfolgerte Fiadorgas, nachdem Tom seine
»Folge dem Pfad nach Norden«, hörte Tom plötzlich die Stimme einer jungen Frau hinter ihm sagen. Irgendetwas an ihr faszinierte ihn und ließ ihm gleichzeitig die Nackenhaare zu Berge stehen. Er wollte sich umdrehen, um zu sehen, von wem sie stammte, aber er konnte sich nach wie vor nicht bewegen. »Folge dem Ruf der Elderbäume, sie werden dir den richtigen Weg weisen«, ertönte die Stimme der Frau ein weiteres Mal. Daraufhin wurde er ein letztes Mal in die Tiefe gerissen.
Erschrocken schlug Tom seine Augen auf. Was war das denn?, fragte er sich halblaut. Er saß wieder im Sattel seines Pferdes, als wäre nichts gewesen.
»Wie mir scheint, haben wir einen neuen Verbündeten auf unserer Suche nach dem Artefakt«, schlussfolgerte Fiadorgas begeistert.
»Das ist wirklich erstaunlich«, hörte Tom Aeria sagen. Noch immer klangen die Stimmen für ihn, als kämen sie aus einiger Entfernung, obwohl seine Gefährten direkt neben ihn geritten waren. »Nicht einmal unsere obersten Priesterinnen können sich in diesem Maße mit dem Weltenbaum verbinden, und sie bringen sich bereits seit Hunderten von Jahren mit ihm in Einklang. Wie hast du das angestellt?«, wollte sie wissen.
»Ich habe gar nichts angestellt«, erwiderte Tom schroff und erschöpft. Er fühlte sich mit einem Mal müde und ausgezehrt. »Ich habe nur meine Hand auf die Wurzeln gelegt, der Rest ist einfach passiert.«
»Du scheinst eine natürliche Verbindung zu den Elderbäumen zu besitzen«, kam jetzt von Fiadorgas. »Wirklich erstaunlich. Ich kenne Geschichten aus alten Zeiten, die von Menschen berichten, die durch die Bäume sehen und hören konnten, jedoch habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der dieses Talent tatsächlich besitzt. Nichtsdestotrotz sollten wir jetzt weiter. Es wird bald dunkel und wir müssen einen geeigneten Lagerplatz finden, bevor die Nacht hereinbricht.«
Kapitel 2 – Die Jagd
Lucy kam sich wie der größte Trampel vor, als sie versuchte, hinter Aeria durch das dichte Unterholz zu schleichen. Hätte sie es nicht besser gewusst, hätte sie die Elfe für einen Geist gehalten, so leise wie diese durch das Gewirr aus Blättern und Ästen huschte. Selbst Beolar, der Lucy folgte, verursachte hin und wieder einmal Geräusche, wenn auch bei weitem nicht so viele wie sie. Dazu kam, dass Aeria darauf bestanden hatte, dass sie einen Jagdbogen mit sich führen sollte, welcher ihr zusätzlich das Leben schwermachte. Sie fragte sich, wozu das gut sein sollte, denn ihre Schießkünste waren ohnehin alles andere als gut. Das Einzige, was der Bogen bewirkte, war, dass Lucy sich mit ihm noch schneller in Ästen oder Sträuchern verhedderte.
Auch wenn sie mittlerweile zumindest das Gefühl hatte, ein wenig geschickter geworden zu sein, schreckte sie trotzdem noch immer ihre Beute auf, die sie für die Gruppe jagen wollten. Schon dreimal war ein Hirsch geflohen, weil Lucy ungeschickt auf einen Ast getreten oder sich im Gestrüpp verfangen hatte. Im Anschluss gab es jedes Mal eine Standpauke von Aeria. Beolar war zumindest etwas geduldiger und gab ihr hin und wieder Ratschläge.
Lucy ärgerte sich gerade darüber, dass ihr Umhang schon wieder in einem Dornengestrüpp festhing, als Aeria vor ihr stehen blieb und ihre rechte Hand hob. Das Zeichen, stillzustehen. Ihre Beute musste in der Nähe sein. Lucy spähte durch das dichte Geäst und versuchte etwas zu erkennen, sah jedoch nichts außer Bäume, Sträucher und die wunderschönen violetten Blumen, die den Waldboden säumten und ein gigantisches Blütenmeer bildeten.
Vorsichtig nahm Aeria ihren Bogen in die Hand und legte einen Pfeil auf. Beolar zeigte mit seiner Hand auf eine kleine Anhöhe inmitten des Blütenmeeres. Erst jetzt erspähte Lucy das Reh, welches umringt von den Wogen der violetten Blütenpracht friedlich graste. Die Elfe atmete einmal tief ein, spannte den Bogen und hielt kurz die Luft an. Mit dem Ausatmen ließ sie die Sehne wieder los. All das dauerte nur einen Augenblick, dennoch lag so viel Anmut und Eleganz in den Bewegungen der Elfe, dass Lucy nicht anders konnte, als sie ehrfürchtig zu beobachten.
Der Pfeil pfiff durch das Unterholz und schlug mit einem dumpfen Laut ein. Das Knacken von Holz war zu hören, als ihre Beute versuchte zu fliehen.
»Kommt!«, rief Aeria ihren Begleitern zu, während sie dem verletzten Reh hinterherrannte. Lucy und Beolar folgten ihr.
Kurze Zeit später hatten sie das Tier eingeholt. Die Elfe stand über ihm gebeugt. Sie hatte es in den Hinterleib getroffen, und nach einigen hundert Metern war ihm die Kraft ausgegangen. Das Reh lag auf dem Boden und versuchte verzweifelt, sich aufzurichten, allerdings ohne Erfolg.
»Hier, du solltest sie von ihrem Leid erlösen.« Aeria holte ein Messer hervor und reichte es Lucy.
»Ich?«, fragte diese entsetzt. »Aber ich kann das nicht!«
»Dann lernst du es!«, erwiderte Aeria kühl. »Ansonsten wirst du in der Wildnis nicht lange überleben.«
»Ich … das arme Tier«, schluchzte Lucy, als sie das Messer zitternd entgegennahm.
»Willst du essen oder nicht?«, fuhr Aeria Lucy barsch an, ehe die Elfe sie unsanft an den Schultern packte und ihr tief in die Augen blickte. Dann sprach sie einfühlsam weiter: »Sie gibt ihr Leben für unseres. Du solltest ihr dankbar sein. Sie wird in dir weiterleben. Und jetzt solltest du sie endlich von ihren Qualen erlösen, sie hat schon zu lange gelitten.« Aeria nahm ihre Hand und führte sie zu dem sich immer noch am Boden windenden Reh. Lucy kniete sich vor ihm nieder und blickte tief in dessen kastanienbraune Augen. In diesem Moment hörte das Reh auf zu zappeln und blieb reglos liegen. Mit einem Mal fühlte Lucy eine tiefe Verbundenheit mit ihm. Dankbarkeit und Trauer überfluteten ihr Herz in gleichem Maße. Sie spürte den schwächer werdenden Herzschlag des Tieres, und es war fast so, als spräche das Reh mit ihr. Als bäte es Lucy, es endlich zu erlösen. Mit zittrigen Händen folgte sie dem Ruf. Aeria nahm sanft ihre Hand und half ihr, das Messer tief in den Hals des Rehs zu treiben, und sie durchtrennten gemeinsam die Schlagader des Tieres. Im letzten Moment meinte Lucy, ein »Dankeschön« von ihrer Beute zu vernehmen, ehe das Blut aus der klaffenden Wunde strömte. Ein letztes Mal bäumte das Tier sich auf, bevor seine Bewegungen endgültig erstarben.
»Gut gemacht«, sagte Aeria aufbauend zu Lucy. »Jetzt sollten wir einen Moment still sein und Mutter Natur für ihre Großzügigkeit danken.« Aeria und auch Beolar schlossen ihre Augen. Lucy tat es ihnen gleich. Noch einmal schossen ihr die Bilder, wie sie dem winselnden Reh die Kehle durchtrenne, durch den Kopf. Ein Schaudern durchfuhr sie. Dennoch fühlte ein Teil von ihr eine nie gekannte Seligkeit. Dieses kurze Gefühl der Verbundenheit mit dem Tier hatte sich tief in ihrem Herzen verankert.
»Wir sollten einen Teil als Tribut an die Wölfe hierlassen«, hörte sie Beolar sagen. »Wir sind hier in ihrem Wald und sollten uns mit ihnen gutstellen, wenn wir eine ungefährdete Reise erleben wollen.«
»Eine gute Idee«, pflichtete Aeria bei. »Und jetzt lernst du, wie man ein Tier ausnimmt.« Schon führte sie wieder Lucys Hand, um ihr zu zeigen, wie man das Reh fachmännisch zerlegt.
Kapitel 3 – Die Wölfe
Lucy saß am Ufer des kleinen Sees und versuchte mit dem erfrischenden Wasser den widerlichen Geschmack aus ihrem Mund zu bekommen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, woher er stammte, jedoch hatte sie noch nie in ihrem Leben etwas derart Ekelhaftes geschmeckt. Sie beugte sich über den Rand des Sees und erschrak, als nicht ihre eigenen tiefblauen, sondern ein Paar stechend gelb leuchtende Augen zurückblickte. Ihre lange Zunge schnellte in das Wasser und die daraufhin entstehenden Wellen verzerrten den Umriss des Wolfes, welcher sich darin spiegelte. Lucy verstand nicht, wie es möglich war, aber sie blickte durch die Augen des Wolfes und sie teilte dessen Empfindungen.
Als der Geschmack endlich endgültig aus ihrem Mund verschwunden war, drehte sie sich um und besah sich den riesigen Kadaver, der neben ihr lag. Noch nie zuvor hatte sie solch eine große Spinne gesehen. Ihre acht Beine waren armlang und zeigten angewinkelt gen Himmel. Der schwarze, von stacheligen Haaren übersäte Körper war beinahe so groß wie die Wildschweine, die am Rande des Waldes lebten. Sie blickte in die vier pechschwarzen, toten Augen im Gesicht des Ungeheuers und begutachtete die beiden kräftigen, übergroßen Zangen. Gedankenfetzen des Kampfes mit der Spinne schwirrten nun durch ihren Geist. Nur mit Mühe hatte sie es geschafft, das Monstrum zu besiegen. Dabei war diese alleine gewesen. Mittlerweile wimmelte es im Wald nur so von diesen Biestern.
Sie beschnupperte den Kadaver. Er roch nach Tod und Fäulnis, obwohl sie ihn erst vor kurzem getötet hatte. Schon bald würde der ganze Wald danach stinken, wenn sie nichts dagegen unternahm.
Es war an ihr, Nirthalak, Anführerin des größten Rudels im gesamten Wolfswald, etwas gegen diese neue Gefahr zu unternehmen, doch dazu brauchte sie die Hilfe ihrer Artgenossen. All ihrer Artgenossen. Sie legte ihren Kopf in den Nacken, stieß ein lautes Heulen in die Nacht hinaus und lauschte. Ich hoffe, sie kommen alle, betete sie.
Ihr Heulen wurde erwidert. Ein einzelner Ruf aus dem Süden des Waldes signalisierte ihr Unterstützung. Es folgte eine weitere Antwort und dann noch eine. Schon bald schallte Wolfsgeheul aus allen Richtungen zu ihr. Sehr gut. Sie kommen wirklich alle, stellte sie erleichtert fest. Mit kräftigen Schritten trugen ihre Pfoten sie zum Treffpunkt, bereit für den Kampf, der nun bevorstand.
˜˜˜
Nirthalak stand auf der Waldlichtung und starrte in Hunderte schwarzer, im Mondlicht glänzende Augenpaare. Vor ihr hatten sich ihre Widersacher unter den Bäumen auf einer Anhöhe versammelt. Neben den schweinegroßen Spinnen wimmelte es hier auch noch von vielen weiteren Arten. Die meisten von diesen Biestern waren schwarz wie die Nacht, es gab aber auch welche, die mit braunem oder ockerfarbenem Fell bedeckt waren. Auf einigen Leibern erspähte Nirthalak auffällige, feuerrote Linien. Selbst die Größe der Tiere variierte sehr stark. Nur wenige der Spinnen waren so groß wie die, die sie noch vor wenigen Stunden selbst getötet hatte, dennoch glaubte sie nicht daran, dass die anderen Ungeheuer weniger gefährlich waren. Auch zwischen dem Laub der Bäume glitzerten etliche der Spinnenaugen im Mondlicht auf.
Sie fletschte die Zähne und ging langsam auf die unheimlichen Eindringlinge zu, die sich seit ein paar Wochen in ihrem Revier wie Unkraut ausbreiteten und sie sogar aus ihren Jagdgründen vertrieben hatten. An ihrer Seite waren fast alle ihrer Artgenossen aus ihrem eigenen Rudel, die ebenfalls angriffslustig ihre Zähne fletschten. Nur wenige hatte sie bei ihren Jungtieren zurückgelassen.
Nirthalak sog die kühle Waldluft ein. Der Geruch der anderen Wölfe, die sich im Schatten der Bäume an die Eindringlinge anschlichen, lag in der Luft. Sie hoffte, dass die Spinnen sie nicht witterten, damit sie ihre Feinde einkesseln und von allen Seiten gleichzeitig attackieren konnten. Es waren tatsächlich alle Rudel ihrer Aufforderung gefolgt. Selbst Themessia, ihre schärfste Rivalin, war gekommen. Sie alle wussten um die Gefahr, die von diesen Spinnen ausging. Wenn sie nicht zusammenarbeiteten, dann wäre das ihr sicheres Ende. Zu schnell hatten sich diese Biester vermehrt, sich in ihrem Wald ausgebreitet und ihre Jagdgründe übernommen. Es musste enden, und zwar so rasch wie möglich, sonst war ihre Heimat endgültig verloren, und mit ihr auch ihre Zukunft.
Nirthalak machte ein paar weitere bedachte Schritte, dann blieb sie stehen und wartete auf den richtigen Zeitpunkt. Zum Sprung bereit, blickte sie nach oben in die Bäume. Die dortigen Augenpaare schauten unheilvoll auf sie herab. In ihrer Position waren die Spinnen klar im Vorteil. Ihre einzige Hoffnung war es, dass ihre Artgenossen unentdeckt blieben.
Noch einmal sog sie die kühle Abendluft ein. Es ist so weit. Die anderen waren alle in Position. Sie legte ihren Kopf in den Nacken und stieß ein markerschütterndes Heulen aus, um dann ansatzlos mit einem gewaltigen Satz die größte Spinne anzuspringen, die in Reichweite war. Noch im Sprung hörte sie, wie der Wald vom Geheul der anderen Wölfe durchdrungen wurde. Der Kampf um ihre Heimat hatte begonnen.
Nirthalaks Krallen bohrten sich tief in das Auge der Spinne, die sie angefallen hatte. Das Ungetüm versuchte, zurückzuweichen, war jedoch zu langsam. Das Tier krümmte sich vor Schmerzen und stach unkontrolliert mit ihren langen, kräftigen Beinen nach ihr. Geschickt wich die Wölfin ihnen aus, setzte erneut zum Sprung an und landete auf dem Rücken des Monsters. Mit einem kräftigen Biss durchbrach sie den Panzer am Nacken des Tieres und riss ihr das Fleisch heraus. Der Schmerzensschrei war so schrill, dass ihr Trommelfell kurz davor war, zu platzen. Die Spinne wand sich für kurze Zeit, dann brach sie zuckend zusammen. Erneut hatte Nirthalak diesen widerlichen Geschmack im Maul, allerdings musste sie das jetzt ertragen. Sie musste noch viel mehr davon ertragen, ihn sogar lieben lernen, denn heute war dies der Geschmack des Sieges.
Zwei der monströsen Geschöpfe versuchten sie anzuspringen, jedoch konnte sie sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe ihre Artgenossen die Spinnen zerfleischten. Sofort suchte sie sich ihr nächstes Opfer, fand es und riss das braunhaarige Ungetüm in Stücke.
Nirthalak wütete erbarmungslos unter ihren Gegnern, wie sie es noch nie zuvor getan hatte. Ihre Pranken und ihr Gebiss brachten Dutzenden Tieren binnen kürzester Zeit den Tod. Schon bald vermieden es die Spinnen, sie anzugreifen und fielen lieber über ihre kleineren Gefährten her. Das machte Nirthalak allerdings nur noch wütender, und sie stürzte sich mit noch größerem Eifer auf ihre Feinde.
Die Bestien fielen reihenweise unter den Klauen und Zähnen der Wölfe, allerdings zeugte das schmerzerfüllte Jaulen, das aus allen Richtungen zu ihr drang, davon, dass auch viele ihrer Gefährten verletzt oder bereits gefallen waren.
Es war ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod. Keine der Seiten schenkte sich etwas, aber mit der Zeit schafften es die Wölfe, immer mehr die Oberhand zu gewinnen. Schon bald flohen die ersten Spinnen vom Schlachtfeld. Triumphierend hob Nirthalak erneut den Kopf und setzte zum Heulen an, als sie einen Stich im Hinterleib spürte, der sie in ihrer Bewegung innehalten ließ. Schmerzen, so stark, dass sie gegen die drohende Ohnmacht ankämpfen musste, durchfluteten ihren gesamten Körper. Benebelt drehte sie ihren Kopf. Eine kleine, rotgoldene Spinne hatte sich an ihrer Flanke festgebissen. Sie war nicht viel größer als ihre Pranke, und doch erfüllte ihre Attacke die Wölfin mit weit mehr Qualen, als sie jemals zuvor erlitten hatte. Verzweifelt versuchte sie, die Spinne abzuschütteln, jedoch ohne Erfolg. Weder mit ihren Klauen noch mit ihren Zähnen konnte sie sie erreichen. Erst als ein anderer Wolf nach der Spinne schnappte und sie von ihrem Leib zerrte, ließ der stechende Schmerz ein wenig nach. Dafür brannte jetzt ihr gesamter Körper, als stünde er in Flammen. Sie fühlte sich unendlich müde, aber sie wusste, dass sie es sich nicht anmerken lassen durfte. Sie musste standhaft bleiben, musste ihren Artgenossen und ihren Feinden Stärke demonstrieren. Dieser Kampf war jetzt endgültig entschieden. Die restlichen Krabbeltiere verschwanden in der Dunkelheit, sofern sie nicht von den Wölfen auf der Flucht getötet wurden.
Als alle Feinde vertrieben worden waren, versammelten sich die überlebenden Tiere um Nirthalak. Es waren weniger als die Hälfte, die in den Kampf gezogen waren. Wir haben gesiegt, allerdings zu welchem Preis?, fragte sie sich erschöpft. So viele waren gefallen. Trotz dieses teuer erkauften Sieges würde der Krieg noch weiter andauern und die Trauer würde warten müssen, bis sie die Brutstätte dieser Bestien vernichtet hatten. Sie hoffte nur, dass sie noch genug waren, um den Kampf am Ende gewinnen zu können, sodass ihre Freunde heute nicht umsonst gestorben waren. Erneut setzte sie zu einem Triumphgeheul an. Dieses Mal unterbrach sie niemand mehr. Die verbliebenen Wölfe stimmten mit ein, und ihr vereinter Schrei hallte durch den Nachthimmel.
Lucy schreckte auf. Von irgendwoher drang lautes Wolfsgeheul aus dem Wald.
»Die Wölfe sind unruhig«, hörte sie Aeria leise am Lagerfeuer sagen. »Sie verhalten sich merkwürdig, und sie haben Angst.«
»Ja, etwas Unnatürliches macht sich in diesem Wald breit, ich kann es spüren«, kam Fiadorgas´ geflüsterte Antwort. »Ich frage mich, wovor die Wölfe solche Angst haben.«
»Vor den Spinnen«, keuchte Lucy außer Atem.
Kapitel 4 – Wolfshain
Langsam näherten sich die Gefährten der Holzpalisade, die ein Zwei in einfache, wollene Umhänge gehüllte und mit Jagdbögen bewaffnete Männer musterten die Ankömmlinge misstrauisch von ihrem Wachtturm aus. Eine der Wachen sprach mit jemandem, der unten hinter dem Tor stand. Kurze Zeit später öffneten sich die Flügel knarzend und gaben den Blick auf den Hauptweg des Dorfes preis, der sich quer durch den Ortskern zog. Dieser war voll. Zu voll für eine solche Siedlung. Neben den Menschen drängelten sich noch unzählige Tiere durch die wenigen Straßen und suchten nach einem Ort, an dem zumindest noch etwas Platz war.
Ein korpulenter Mann trat den Reisenden, mit vier bewaffneten Männern an seiner Seite, entgegen. »Willkommen in Wolfshain«, begrüßte er sie. »Mein Name ist Fex und ich bin das Oberhaupt dieser Siedlung. Verzeiht bitte das Chaos, aber derzeit sind einfach zu viele Menschen hier, die nach einer Zuflucht suchen, und ich muss in alldem hier für Ordnung sorgen. Falls ihr gehofft habt, einen Platz zum Übernachten in unserem Gasthaus zu ergattern, muss ich euch leider enttäuschen. Es ist derzeit jedes verfügbare Bett belegt. Wenn ihr Glück habt, dann findet ihr irgendwo eine halbwegs freie Ecke, um eure Zelte aufzuschlagen. Allerdings muss ich euch bitten, nur eine Nacht hier zu verweilen. Wenn ich euch einen Rat geben darf: Kehrt wieder um. Die Straßen jenseits unseres Dorfes sind nicht mehr sicher.«
»Seid gegrüßt, Fex«, erwiderte Fiadorgas freundlich. »Ich versichere Euch, dass wir in guter Absicht kommen. Wir sind lediglich auf der Durchreise und wollen schon morgen weiterziehen. Habt Dank für Eure Warnung, allerdings werden wir unseren Weg dennoch fortsetzen. Wir haben noch eine lange Reise vor uns und können uns ein Umkehren nicht erlauben. Sagt, warum suchen all diese Menschen hier Zuflucht?«
»Es liegt an den Wölfen«, antwortete Fex unruhig. »Seit einer Woche verhalten sie sich seltsam. Sie kommen immer näher an unsere Siedlungen heran. Sie reißen unser Vieh, und mittlerweile sind selbst die Reisenden auf der Straße nicht mehr vor ihnen sicher. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Seit Wolfshain gegründet wurde, leben wir mit dem Wald und den Wölfen im Einklang. Die Späher, die der Sache auf den Grund gehen sollten, sind bisher noch nicht zurückgekehrt. Keiner, bis auf Ferdnir. Allerdings konnte er uns nichts Brauchbares berichten. Er phantasiert nur im Fieberwahn, und ich fürchte, er wird diesen Tag nicht überleben.«
»Wo versorgt ihr ihn denn?«, wollte Lucy wissen. »Vielleicht können wir helfen.«
»Dafür wären wir Euch sehr dankbar.«, antwortete Fex. »Unser Heiler tut, was er kann, allerdings hat er so etwas noch nie zuvor gesehen und er befürchtet das Schlimmste. Folgt mir. Ich bringe Euch zu ihm.«
Als sie Wolfshain betraten, war die angespannte Stimmung regelrecht zum Greifen. Ängstlich betrachteten die Bewohner die Neuankömmlinge. Lediglich ein paar Kinder rannten sorglos um einen Baum im Ortskern, wobei eines versuchte, den anderen zu entkommen. Dabei sangen sie einen einfachen Kinderreim:
Stock und Stein, nie allein
Geh in den Wald hinein
Sie heulen bei Nacht
Gib gut acht! Gib gut acht!
Sonst holen dich bald
Die Wölfe im Wald
Denn er gehört ihnen
Gib, was sie verdienen
Betritt nie ihr Revier
Sonst heult dieses Tier
Die Wölfe im Wald
Dann holen dich bald
Die Gruppe beschloss, sich zu trennen. Während Fiadorgas zusammen mit Lucy zur Hütte des Heilers ging, suchten die restlichen Gefährten nach einem geeigneten Platz zum Rasten.
Fex führte Lucy und Fiadorgas zu einer einfachen Holzhütte, deren Tür weit offenstand. Das Oberhaupt klopfte an den Türrahmen, ehe er eintrat. »Ich bin es, Tervus. Ich bringe Reisende mit, die vielleicht helfen könnten.«
Hinter einem Vorhang, der einen Teil des Raumes vom Rest des Zimmers abtrennte, kam der Kopf eines kleinen, kahlköpfigen alten Mannes zum Vorschein.
»Ist dem so?«, fragte Tervus mit einer hohen, brüchigen Stimme und beäugte die Fremden misstrauisch.
»Wie geht es Ferdnir?«, fragte Fex, während er um das Tuch herumging. Dort lag der Späher mit geschlossenen Augen in einem einfachen Bett. Er war leichenblass und atmete schwer.
»Nicht gut«, erwiderte der Heiler resignierend. »Sein Zustand verschlechtert sich von Stunde zu Stunde. Meine Medizin wirkt nicht und das Fieber steigt trotz der Wickel, die ich ihm laufend neu anlege. Vor ein paar Minuten ist er ohnmächtig geworden. Ich befürchte, er hält nicht mehr lange durch. Die arme Liara. Ob sie alleine mit ihren vier Kindern zurechtkommen wird?« Der Heiler setzte sich erschöpft auf einen kleinen Hocker, der neben dem Bett stand.
»Hat er noch etwas gesagt, bevor er sein Bewusstsein verloren hat?«, wollte Fex wissen.
»Nein, er hat nur weiter vor sich hin phantasiert«, antwortete Tervus. »Irgendetwas von wolfsgroßen Spinnen. Aber so etwas gibt es nicht, und das Gift, das er in sich trägt, passt auch nicht zu einem Spinnenbiss.«
»Ich befürchte, es waren keine Fieberträume«, mischte sich Fiadorgas in das Gespräch ein. »Wie es aussieht, haben sich hier Spinnen eingenistet, die den Wölfen ihren Wald streitig machen. Deswegen sind diese so aggressiv und kommen immer näher an eure Siedlungen heran.«
»Aber wie sollte so etwas möglich sein?«, fragte Tervus. »Ich habe noch nie von derartigen Spinnen gehört. Schon gar nicht in unserem Wald.«
»Ich befürchte, dass hier dunkle Magie im Spiel ist«, antwortete Fiadorgas. »Ich habe etwas Derartiges bereits einmal erlebt. Es ist schon eine Weile her, als ich auf einer kleinen Insel namens Heliconos weit im Westen auf Entdeckungsreise war. Allerdings gab es dort nicht mehr viel zu entdecken.
Als ich dort ankam, war die gesamte Insel von einem dichten Netz aus Spinnweben überzogen. Die Spinnen hatten alles überrannt und jegliches Leben dort vernichtet. Und als es keine Beute mehr gab, haben sie sich am Ende gegenseitig gefressen. Ich kam zu spät, als dass ich noch etwas hätte ausrichten können. Ich konnte lediglich noch den Ursprung Gilgarath, ein mächtiger, von dunkler Magie durchtränkter Gegenstand. Er hat dafür gesorgt, dass die heimischen Spinnen binnen kürzester Zeit mutierten und alles Leben auslöschten. Ich war eigentlich der Überzeugung, dass das Ei an einem sicheren Ort aufbewahrt wird. Entweder habe ich mich geirrt, oder aber diese Spinnenplage rührt von einer anderen Quelle her. Dennoch ist sie zweifellos magischen Ursprungs.«
»Mit einem Sud aus Langkraut und Binswurz. Auf die Wunden habe ich eine Salbe aus Bielkraut gestrichen«, antwortete der Heiler.
»Eine gute Behandlung, das hat ihn vermutlich bislang am Leben gehalten. Allerdings wird das nicht genügen, um ihn endgültig vor dem Tode zu bewahren. Lucy, was hast du an Kräutern aus Elderan mitbekommen?«, wandte sich Fiadorgas an sie.
»Ich habe Drachenwurz, Kaisergarbe und Dornenkraut dabei, wobei Dornenkraut in diesem Fall zu schwach ist. Ich würde einen Sud aus Drachenwurz herstellen, um der Vergiftung entgegenzuwirken«, sagte Lucy.
»Mach das«, erwiderte Fiadorgas. »Ich habe noch etwas Föllkraut irgendwo in meiner Tasche. Das kannst du beimischen. Es verstärkt die Wirkung eines jeden Gegengiftes und wirkt auch gegen Gifte, die auf unnatürliche Weise entstanden sind. Seit meiner Entdeckung auf Heliconos habe ich immer etwas davon vorrätig. Der Sud sollte in der Lage sein, ihn zu heilen, zusammen mit dem hier.« Fiadorgas holte ein Kraut aus seinem Rucksack und zerkaute es. Anschließend drückte er die Masse in die entzündeten Wunden. »Philomonaskraut. Äußerst effektiv gegen Wundbrand, und es senkt darüber hinaus auch Fieber. Nur zerkauen und auf die Wunden geben. Es entfaltet seine Wirkung sehr schnell. Ein Geschenk der Eingeborenen von Takilastas, einem Stamm, der weit im Süden jenseits der roten Wüste lebt.«
»Ihr seid wahrlich schon weit gereist«, entgegnete Tervus schmatzend, während er den Rest des Krautes an sich nahm, darauf herumkaute und es in die Bisswunden presste. »Ich hoffe, dass Euer Heilmittel hält, was Ihr versprecht.«
»Das hoffe ich auch«, antwortete Fiadorgas. »Sein Zustand ist kritisch. Die nächsten Stunden werden es zeigen.«
Während Lucy sich daran machte, den Sud mit Hilfe von Tervus zuzubereiten, wandte sich Fex an Fiadorgas: »Diese Spinnen. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu vernichten?«
»Der Gegenstand, welcher für ihre Verwandlung verantwortlich ist, muss unschädlich gemacht werden«, antwortete der Gelehrte. »Habt Ihr eine Ahnung, wo er sich befinden könnte?«
»Ich kann nur spekulieren«, erwiderte Fex. »Nachdem die Wölfe von ihren ursprünglichen Jagdgebieten vertrieben wurden, muss er sich vermutlich irgendwo dort befinden, allerdings ist das Gebiet viel zu groß, als dass wir es ganz absuchen könnten. Mal davon abgesehen, dass sowohl die Wölfe als auch diese Spinnen dort draußen ihr Unwesen treiben. Könntet Ihr den Gegenstand denn zerstören, wenn wir ihn finden?«
Fiadorgas überlegte einen Moment. »Zerstören sicher nicht, dafür ist seine Macht zu stark. Ich könnte jedoch den Zauber unschädlich machen, der darauf gewirkt wurde. So habe ich es damals auch getan, allerdings kann ich nicht zu einhundert Prozent sagen, ob es heute wieder funktioniert. Das Ei hatte damals bereits einen Großteil seiner Kraft verbraucht, und ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich hier tatsächlich um den gleichen Zauber handelt.«
»Aber wenn dem so wäre, würdet Ihr uns denn helfen?«, fragte Fex.
»Da müsste ich mich zunächst mit meinen Gefährten beratschlagen. Wir haben eine wichtige Aufgabe zu erledigen und noch einen weiten Weg vor uns, und ich befürchte, dass uns die Zeit davonläuft«, antwortete Fiadorgas.
»Bitte, ich flehe Euch an«, wandte sich Fex an ihn. »Wenn das, was Ihr erzählt habt, tatsächlich wahr ist, dann werden diese Spinnen uns ansonsten mitsamt dem Wald verspeisen.«
»Wie gesagt, ich muss mich erst besprechen«, erwiderte Fiadorgas. »Ich werde aber umgehend die Akademie in Elderan unterrichten. Sie werden auf jeden Fall sofort Hilfe schicken.«
˜˜˜
»Und was würde das für unsere Aufgabe bedeuten?«, fragte Tom. »Aren sagte, die Beschaffung des Artefaktes sei entscheidend für die Rettung des ganzen Landes. Können wir es uns leisten, wertvolle Zeit zu verlieren?«
»Das ist die große Frage«, entgegnete Fiadorgas. »Welchen Pfad hat das Schicksal für uns vorgesehen? Wenn ich eines gelernt habe in den vielen Jahren meines Lebens, dann, dass es immer einen Grund gibt, wieso wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sind. Es ist kein Zufall, dass wir gerade hier stehen. Wir müssen jetzt darüber entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen. Brechen wir sofort auf und setzen unseren Weg nach Norden fort, um unserer ursprünglichen Aufgabe zu folgen, ehe die Spinnen den gesamten Weg blockieren? Oder stellen wir uns der Gefahr, in der Hoffnung, dass wir die Dorfbewohner und diesen Wald retten können, und riskieren, dabei wertvolle Zeit oder Schlimmeres zu verlieren?«
»Du glaubst, wir können die Spinnen besiegen?«, fragte Ben.
»Das wird sich zeigen«, antwortete Fiadorgas. »Aber im Moment sind wir die Einzigen, die etwas gegen diese Plage unternehmen können. Sie ist magischen Ursprungs, und als solche kann sie auch nur mit Magie besiegt werden.«
»Also ist die Frage, ob wir es riskieren, hier blind nach diesem Artefakt zu suchen, während wir von wilden Wölfen und gigantischen Spinnen angegriffen werden.« Es war Aeria, die jetzt sprach. »Dabei laufen wir Gefahr, bei unserer eigentlichen Aufgabe zu scheitern und damit die ganze Welt zu verdammen. Oder aber wir ziehen einfach weiter, ignorieren das hier, und am Ende bleibt vielleicht keine Welt mehr übrig, die es zu retten lohnt.« Auf ihre Ausführung folgte bedrücktes Schweigen.
˜˜˜
Tom ging am Rande des Dorfes spazieren, um seine Gedanken neu zu sortieren. In ihm hallten immer noch Arens eindringliche Worte wider, der ihm eingebläut hatte, wie wichtig ihre Aufgabe war. Aber konnte er deswegen die Menschen hier im Stich lassen? Was, wenn es ihnen tatsächlich gelänge, das Dorf jetzt zu retten? Würde er sie letzten Endes nicht trotzdem zum Tode verdammen, falls sie deswegen an ihrer eigentlichen Aufgabe scheiterten?
Er kam an einer, aus dem Holz eines Baumstammes geschnitzten, Statue vorbei. Vor ihr waren unzählige Gaben dargebracht worden. Kerzen brannten an deren Sockel und Essen war auf einfachen Tellern angerichtet worden.