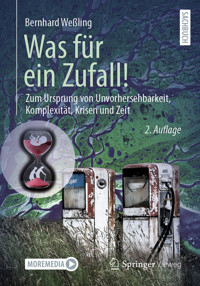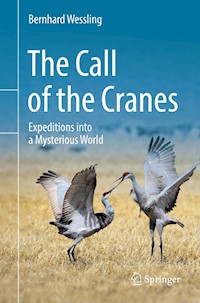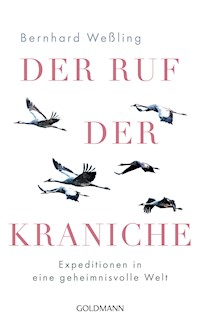
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Kraniche sind rätselhafte Vögel. Nur wenige wissen etwas über diese grazilen Tänzer der Lüfte. Der renommierte Naturforscher Bernhard Weßling nimmt uns mit auf spannende Expeditionen in ihre verborgene Welt und geht den Mythen um die Vögel des Glücks auf den Grund. Mithilfe einer eigens entwickelten Methode hat der Kranichexperte ihr Verhalten erforscht und Teile ihrer Sprache entschlüsselt. Eindrucksvoll bebildert und ganz nah an der Natur erzählt, legt er seine Erkenntnisse über ihre Anpassungs- und Problemlösungsfähigkeit, ihr Einfühlungsvermögen und ihren manchmal eigenwilligen Charakter dar. Seine Beobachtungen lassen uns tief in die Lebensweise und das Bewusstsein der Kraniche eintauchen und zeigen uns die erstaunlichen Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier. Ein verblüffendes Werk über Entdeckergeist, Demut und Achtung vor der Natur im Sinne eines Alexander von Humboldt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Kraniche sind rätselhafte Vögel. Nur wenige wissen etwas über diese grazilen Tänzer der Lüfte. Der renommierte Naturforscher Bernhard Weßling nimmt uns mit auf spannende Expeditionen in ihre verborgene Welt und geht den Mythen um die Vögel des Glücks auf den Grund. Mithilfe einer eigens entwickelten Methode hat der Kranichexperte ihr Verhalten erforscht und Teile ihrer Sprache entschlüsselt. Eindrucksvoll bebildert und ganz nah an der Natur erzählt, legt er seine Erkenntnisse über ihre Anpassungs- und Problemlösungsfähigkeit, ihr Einfühlungsvermögen und ihren manchmal eigenwilligen Charakter dar. Seine Beobachtungen lassen uns tief in die Lebensweise und das Bewusstsein der Kraniche eintauchen und zeigen uns die erstaunlichen Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier.
Ein verblüffendes Werk über Entdeckergeist, Demut und Achtung vor der Natur im Sinne eines Alexander von Humboldt.
Autor
BERNHARD WESSLING, Jahrgang 1951, ist promovierter Chemiker und erfolgreicher Unternehmer. Schon als Jugendlicher fühlte er sich von der Natur angezogen. Vor über 30 Jahren begann er im Duvenstedter und Hansdorfer Brook am Nordrand von Hamburg mit der Beobachtung von Kranichen und organisierte dort mehrere Jahre den Kranichschutz. Durch seine Forschungen gilt er längst als international gefragter Kranichexperte und war am bisher größten und komplexesten Auswilderungsprojekt der extrem bedrohten Schreikraniche in Nordamerika beteiligt.
Bernhard Weßling
DER RUF DER KRANICHE
Expeditionen in eine geheimnisvolle Welt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe März 2020
Copyright © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © Bernhard Weßling
Lektorat: Judith Mark
MP | Herstellung: KW
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-24914-4V002
www.goldmann-verlag.de
Für George, ohne den dieses Buch nicht einmal halb so interessant wäre;für meine Enkel, deren Nachfragen mich anregten, es zu schreiben;für meine Lebensgefährtin, die mich so sehr unterstützt.
Inhalt
Vorwort
KAPITEL 1: Wie alles anfing
KAPITEL 2: Kranichwissen kompakt: die Mythen und die Fakten
KAPITEL 3: Problemlösungen, Ballett-Balz und Fuchsalarm: Wie kommunizieren Kraniche miteinander?
KAPITEL 4: Ankunft im Brook nach Rückflug aus dem Winterquartier: Allein oder in Gruppen?
KAPITEL 5: Brutsaison: eine tragische Liebesgeschichte
KAPITEL 6: Kampfläufer, Seeadler und andere Brookbesucher: Was Kranichbewacher so alles erleben können
KAPITEL 7: In der Schule des Lebens
KAPITEL 8: Der Sprache der Kraniche auf der Spur: Sie rufen und erzählen so von ihrem Leben
KAPITEL 9: Aufbruch in die weite Welt: Asiatische und amerikanische Kranicharten rufen mich
KAPITEL 10: Forschungs-Abenteuer: Mandschurenkraniche belauschen bei minus 25 Grad und bewacht von Grenzsoldaten
KAPITEL 11: Das Abenteuer geht weiter: bei den wilden Schreikranichen
KAPITEL 12: Wir fliegen los: der schwere Weg zur Migrations-Flugschule
KAPITEL 13: Was können wir über Intelligenz, Zugverhalten, Kulturbildung, Werkzeuggebrauch und Selbstbewusstsein bei Kranichen lernen?
KAPITEL 14: Können Kraniche strategisch denken? Weitere erstaunliche Beobachtungen
KAPITEL 15: Kraniche sind Subjekte. Plädoyer für mehr Bescheidenheit und Respekt vor der Natur.
Anhang
Dank
Bildteil
Bildnachweis
Anmerkungen
Vorwort
Es war ein langer Weg aus dem engen und verschmutzten Ruhrgebiet, in dem ich aufwuchs und studierte, bis in den Duvenstedter Brook bei Hamburg, wo ich erstmals Kraniche sah. Noch länger und beschwerlicher war meine Expedition in die verborgene, rätselhafte Welt der Kraniche, ihr Leben und Denken.
Schon sehr früh kam ich mit den Themen Umweltverschmutzung und Bedrohung der Natur in Berührung. Als Kind erlebte ich oft, wie die saubere Wäsche der achtköpfigen Familie draußen im Garten hing und sich plötzlich eine Rußwolke aus den Schloten der nahe gelegenen Kokerei in Herne erhob und hässliche schwarze Flecken auf der Wäsche hinterließ. Als Jugendlicher liebte ich die späten Herbstabende, in denen der dichte Nebel die damals noch wenigen Autos zum Schritttempo zwang, während ich mit meinem Rad und zusätzlich angebrachten starken Lampen kräftige Lichtkegel in den Nebel zauberte, der in Wirklichkeit Smog war.
Als Chemiestudent im dritten Semester meldete ich mich 1971 auf einen Aushang, in dem Chemiker zur Analyse von illegal abgelagerten Fässern1 gesucht wurden. Diese enthielten zum großen Teil Cyanidverbindungen, zum kleineren Teil andere Stoffe, in einigen befand sich Schwefelsäure. Die Fässer waren in ein eigens ausgehobenes Loch gekippt worden, das sich nach und nach mit Wasser gefüllt hatte. Die Schwefelsäurefässer verrotteten zuerst, sodass dieser Tümpel inzwischen stark sauer war, was im Kontakt mit Cyanidsalzen zur Freisetzung von Blausäuregas führte. Um den Tümpel herum lagen und auf dem Wasser schwammen tote Tiere. Es war ein »Doomsday«-Szenario. Als Student ohne finanzielle Mittel benötigte ich dringend Geld für meinen Lebensunterhalt. Der schwere und gefährliche Job wurde gut bezahlt. So fand ich mich in den Semesterferien bei brütender Hitze in Vollatemschutzkleidung wieder. Ich analysierte wochenlang täglich, oftmals in hochgiftige Staubwolken eingehüllt, sechs bis acht Stunden lang verrottende Fässer darauf hin, ob sie Cyanide (»nach links auf den großen Fassberg«) oder andere, weniger giftige Abfallsalze enthielten (»nach rechts zu dem anderen Giftmüll«).
Es war drückend heiß. Aus allen Richtungen zogen bedrohliche Staubwolken über uns hinweg. Die notwendige Vollschutzkleidung und Gasmasken waren eigentlich unerträglich. Das verführte einige Arbeiter dazu, ohne Atemschutz zu arbeiten. Einer davon saß vor mir oben auf seinem Bagger. Ich sollte die Fässer, die er ausgrub, untersuchen. Seine Schaufel erfasste ein Fass mit Pulver, das verrottete Fass zerbrach, eine Staubwolke umhüllte mich und den Bagger, der Baggerfahrer brach vor meinen Augen oben auf dem Fahrersitz sofort tot zusammen. Ich alarmierte den Notarzt, der Arbeiter wurde schnellstens in die auf dem Gelände installierte mobile Notfallklinik gebracht, bekam innerhalb von Sekunden ein Gegenmittel gespritzt, wurde dadurch wiederbelebt und zusätzlich beatmet. Am nächsten Tag saß er wieder auf dem Bagger, nun aber mit Gasmaske und Vollschutzkleidung. Keiner der Arbeiter verweigerte von nun an die notwendigen Schutzmaßnahmen. Der wochenlange Studentenjob hat meine Haltung zum Umwelt- und später Naturschutz geprägt. Ein Jahr später, 1972, erschien der erste Bericht des Club of Rome Die Grenzen des Wachstums, der unter uns Chemiestudenten heiß diskutiert wurde. Für mich wurde immer klarer: Wir müssen diesen Planeten und seine Ökosysteme mit viel mehr Respekt behandeln. Als Chemiker wollte ich durch Forschung meinen Beitrag dazu leisten.
Schon als etwa 14-jähriger Junge hatte ich mich intensiv mit Naturwissenschaften befasst, unter anderem mit Astronomie. Wenn ich durch mein mühsam erspartes Teleskop in den Weltraum schaute, empfand ich neben unstillbarer Neugierde und grenzenloser Ehrfurcht auch eine tiefsitzende Furcht vor der Unendlichkeit des Universums. Mich befiel daraufhin eine schwere Depression: Wir sind mit unserer Erde allein im lebensfeindlichen Weltraum, so empfand ich es, und ich selbst fühlte mich einsam, hatte in der Familie wenig Rückhalt und war ein Einzelgänger.
Als ich wieder einmal ziellos durch einen kleinen Wald in Herne stromerte, fand ich eine winzige, bläulich schimmernde Feder. Ich fand heraus, dass es eine Eichelhäherfeder war, und legte sie in ein kleines Kästchen. Bei weiteren Ausflügen sammelte ich immer mehr Federn, unter anderem sogar eine Adlerfeder. Ich befestigte sie auf einer weißen Pappe, die ich in meinem Zimmer an die Wand hängte; ich therapierte mich durch die Beschäftigung mit Vogelfedern und bei Aufenthalten in der Natur selbst und fand aus meinen Ängsten und meiner tiefen Niedergeschlagenheit heraus. Wald und Feld waren für mich Rückzugsorte geworden, in denen ich mich entspannen, über mich selbst und die Welt nachdenken konnte. Die Natur – als von Menschen geformte Landschaft gleichermaßen wie wilde, raue, schwer zugängliche und einsame Gegenden – ist seitdem regelmäßig Quelle der Entspannung und der Linderung von beruflichem und privatem Stress gewesen. (Um diesen Effekt festzustellen, scheint man heute aufwändige Forschung zu benötigen, aber immerhin bestätigen die neuesten Studien aus den USA und Japan meine Erfahrungen aus den letzten über fünf Jahrzehnten.)
Als junger Familienvater brachte ich meine Kinder von Anfang an mit der Natur in Kontakt. Insbesondere beobachteten wir Vögel und entdeckten dabei die Kraniche für uns. Zusammen mit meinen heranwachsenden Söhnen erkannte ich ihre Verletzlichkeit, und mir wurde bewusst, wie schwierig es ist, ihren Lebensraum zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen, und dass Natur- und Artenschutz immer Hand in Hand mit Umweltschutz gehen muss. Ich beschloss, am Kranichschutzprogramm teilzunehmen, das ich später etwa fünf Jahre lang leiten sollte.
Bei meiner intensiven Beobachtung der Kraniche stellte ich fest, dass über das Leben und Verhalten dieser eindrucksvollen Vögel erschütternd wenig bekannt war. Mit ihrem rätselhaften Wesen weckten sie meine naturwissenschaftlich geschulte Neugierde und regten mich zum Forschen außerhalb meines angestammten Berufs an.
Es wird kaum einen anderen Ort auf der Welt geben, an dem freie und wilde Kraniche in so enger Nachbarschaft mit Menschen leben und brüten, wie den Duvenstedter und den Hansdorfer Brook. Beide befinden sich am Nordrand der Millionenstadt Hamburg, von deren Einwohnern jährlich Zehntausende das Naturschutzgebiet besuchen, wandern, sich erholen und die Natur beobachten. (Leider störte eine nicht zu vernachlässigende Minderheit der Besucher durch Picknicks, Ostereiersuchen und Fotografieren abseits der Wege, einige Male sogar mit Wilderei und Eierdiebstahl, das Naturschutzgebiet empfindlich. Das hat sich inzwischen aufgrund unserer beharrlichen Arbeit stark verbessert.)
Vielleicht waren Kranichbeobachter nirgendwo sonst so intensiv mit »ihren« Kranichen verbunden wie wir. Die Aufgabe der »Kranichbewacher«, wie wir uns selbst nannten und von den Besuchern genannt wurden, war es, Störungen zu verhindern. So »bewachten« wir eigentlich nicht die Kraniche, sondern die Besucher, zumindest diejenigen, die bewusst oder unbewusst zu Störern wurden.
Während der Brutzeit waren zumeist zwei Kranichbewacher jeweils für eine Woche täglich ganztägig im Brook. Viele von uns übernachteten dort sogar. Wir standen in aller Herrgottsfrühe auf und gingen erst nach dem »Waldschnepfenstrich« schlafen (so nennt man das Verhalten der Waldschnepfen, die in der Dämmerung am Waldrand oder über die Wiesen in ihrem Revier hinweg »streichen«).
Von Mitte Februar bis Mitte November sind die Kraniche »bei uns«. Bis Ende der 1990er Jahre waren es vier bis sechs Kranich-Brutpaare und jedes Jahr einige »Junggesellen«, die sich in unserem Gebiet herumtrieben. Anfang der 2000er-Jahre und um 2016 herum besetzten etwa ein Dutzend Kranichpaare je ein Revier. Im Jahre 2019 hielten sich neben einem Dutzend Revierpaaren und weiteren Reviere suchenden Paaren zeitweilig über 20 Jungkraniche, zum Teil als eine große Gruppe, im Brook auf. An einem Tag im Mai sah ich auf einer Wiese im Kern des Brooks 65 Kraniche. Die Reviere im engeren Sinn sind übrigens nicht größer als ca. einen halben Quadratkilometer und an manchen Stellen gut einzusehen (zum Vorteil der Kraniche aber größtenteils sehr unübersichtlich). Die Revierpaare verteidigen allerdings gegen andere Kraniche ein weit größeres Gebiet, die Reviere umfassen also eine Kernzone mit Brutplatz und Nahrungsaufnahmegebiet sowie eine Pufferzone.
So waren mir über Jahre hinweg – vielleicht einzigartig auf der Welt – nur wenige Minuten von meiner Wohnung und meinem Arbeitsplatz entfernt sehr viele Kranich-Beobachtungen unter Freilandbedingungen möglich. Im Sinne unserer Schutzaufgabe beobachteten wir die Tiere von weitem, von außerhalb der Fluchtdistanz, sodass die Beobachtung selbst nicht störend wirkte.
Ich führte keine Verhaltens-Experimente mit Kranichen durch, sondern beobachtete sie nur. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich »von Menschen unbeeinflusste Kraniche« beobachten und beschreiben kann. Die Menschen schränken durch Wanderwege, Straßen oder landwirtschaftliche Nutzflächen die Brut- und Nahrungsräume und die Beweglichkeit der Tiere ein. Diese haben ihr Verhalten angepasst, und so beobachtet man immer auch die Reaktionen der Vögel auf menschliche Einflüsse. Das Verhalten der Tiere in einer Kulturlandschaft wie dem Brook ist sicher nicht dasselbe wie in der Wildnis, in der weitgehend ungestörten sibirischen Tundra, der mittelschwedischen Wald- oder der finnischen Seenlandschaft, wenngleich inzwischen in unserem Naturschutzgebiet einige kleinere Stellen wieder ihrer natürlichen Entwicklung überlassen bleiben.
Genau dieser Umstand machte die Beobachtungen besonders reizvoll: Wie gehen Kraniche mit ihnen unbekannten Situationen um? Wie verhalten sie sich, wenn andere Tiere, vor allem aber Menschen ihr Brutgeschäft oder die Nahrungsaufnahme stören? Wer wie ich von Jugend an Spaß an der Naturbeobachtung hat, egal auf welchem Gebiet, wird früher oder später auf Merkwürdigkeiten stoßen. Mir fiel auf, dass »meine« Kraniche sich anders verhielten, als ich es erwartet hatte, nachdem ich meine Kenntnisse in Verhaltensforschung aufgefrischt oder mir neuere Artikel und Bücher über Kraniche besorgt hatte. Sie verhielten sich nicht stereotyp, nicht so, wie man es sich gemäß eines vererbten Verhaltensschemas vorstellt, sondern wie Persönlichkeiten mit eigenen Plänen und individuellen Charakterzügen.
Das hat mich nicht vollkommen überrascht. Immer wieder hatte ich darüber nachgedacht, wie eigentlich »Denken« vor sich geht, was die materielle Grundlage des Gedächtnisses ist, wie das Bewusstsein entsteht. Dabei fragte ich mich gelegentlich, ob Tiere wirklich so ganz anders denken als wir, und es würde mir völlig normal vorkommen, wenn man eines Tages feststellte, dass Tiere auf prinzipiell ähnliche Weise wie Menschen denken, lediglich – je nach Art – graduell verschieden von uns und voneinander. So lese ich immer wieder begierig Artikel oder Bücher, die über Forschungsergebnisse zur Denk-, Intelligenz- und Bewusstseinsleistung von Tieren berichten.
Ich hatte nicht erwartet, dass ich als Freizeit-Naturschützer jemals in die Lage kommen würde, zu dieser Thematik eigene systematische Beobachtungen beizutragen. Als ich dann aber anlässlich der Europäischen Kranichkonferenz (European Crane Conference) 1996 in Stralsund einige besonders bemerkenswerte Beobachtungen meiner ersten Jahre vortrug, befand sich George Archibald im Raum, der unter Kranichexperten in aller Welt berühmte Gründer der International Crane Foundation (ICF) und ihr Motor. Er motivierte mich, meine Studien zu vertiefen und zusätzlich international zu betreiben, mit anderen Kranicharten als dem bei uns beheimateten Grauen Kranich. So kam es, dass ich im Laufe der Zeit an zahlreichen internationalen Projekten aktiv teilnahm, neben meinem Beruf und dem Aufbau meines Unternehmens Kranichforschung betrieb und die Ergebnisse meiner Arbeit auf Konferenzen und in Fachpublikationen veröffentlichte.
Seit Mitte Mai 2018 kann es geschehen, dass meine Lebensgefährtin und ich morgens nach dem Aufwachen Kranichrufe hören. Wenn ich in meinem Arbeitszimmer unter dem Dach am Schreibtisch sitze, schaue ich während der Denkpausen in die Landschaft. Wir leben nun in unmittelbarer Nähe des Hansdorfer Brooks am Rande von Hamburg. Immer wieder fliegen Kraniche in nur 50 oder 150 Metern Entfernung vorbei. Noch öfter höre ich sie rufen. Kurz nachdem wir in das Haus an der Grenze des Brooks eingezogen waren, erzählte ich meinem damals neunjährigen Enkel die Geschichte von »Romeo und Julia«, dem Kranichpaar, das die Leser dieses Buches später noch näher kennenlernen werden. Ihr letzter Nistplatz liegt nur etwa 300 Meter Luftlinie von unserem Haus entfernt. Damals fasste ich den Entschluss, das vorliegende Buch zu schreiben.
Hier zeichne ich meine Expeditionen in die geheimnisvolle Welt der Kraniche nach. Ich schildere Erlebnisse und Beobachtungen, die es mir erlaubten, einige der Rätsel zu lösen, die diese schönen Vögel uns Menschen seit Jahrtausenden präsentieren. Dies führt uns zu Fragen über uns selbst und unser Bewusstsein: Wie rational, wie bewusst handeln wir Menschen, und wie verschieden ist dies vom Handeln und Denken der Tiere, hier speziell der Kraniche?
Von der Erkenntnis, dass diese Vögel anders sind, als bisher in den Lehrbüchern beschrieben, ist es kein weiter Weg, um zu sehen, dass wir viel umfassender über Naturschutz nachdenken, dass wir ganzheitlicher handeln müssen – basierend auf einem tiefen Respekt vor der Natur.
KAPITEL 1 Wie alles anfing
Seltsame trompetende Rufe erschallten von irgendwo aus dem direkt vor uns liegenden Moor heraus. Wir hatten so etwas noch nie gehört und keine Vorstellung davon, was das sein könnte, aber es interessierte uns brennend. Ihre Verursacher – es mussten wohl Vögel sein, aber was für welche? – konnten wir allerdings nicht ausfindig machen, denn sie waren hinter Büschen, Bäumen und Schilf verborgen. Meine damalige Frau und ich waren mit unseren beiden noch sehr kleinen Söhnen im Frühling 1982 wieder dabei, die neue Umgebung zu erkunden, denn wir waren erst wenige Monate zuvor nach Bargteheide gezogen. Das Naturschutzgebiet »Duvenstedter Brook« lag nicht weit von unserer neuen Wohnung entfernt im Norden von Hamburg, wir hatten es schon einige Male im Winter besucht, an diesem Tag aber erstmals im Frühjahr.
Wir fanden bald heraus, dass diese klaren und kräftigen, weit tragenden Rufe von Kranichen stammten, dem seit unwahrscheinlich langer Zeit ersten Paar, das gerade ein Jahr zuvor sein Revier im Duvenstedter Brook bezogen hatte. Mit hochgereckten Hälsen und aufgerichteten Schnäbeln trompeteten sie im Duett »oooo – i, i, i« mehrmals hintereinander, immer wieder – faszinierend.2 Atemberaubend schön war es, die Kraniche bei unseren immer zahlreicher werdenden Besuchen im Duvenstedter Brook zu beobachten: Sie tanzten umeinander herum, schwangen ihre Flügel, sprangen elegant und federnd hoch3, landeten ebenso tänzerisch und ließen bei ihrem Tanz kurze Laute hören. Manchmal beendeten sie einen Tanz mit einem Duettruf. Schon wenn sie nur über die Wiesen oder durch das Buschland schritten, so gemessen, selbstbewusst, ruhig hier und dort nach Futter suchend, aber auch in Vorbereitung oder anstelle eines Tanzes, konnten sie grazil umeinander herum schreiten, sich dabei anschauend, oder nebeneinander mit erhobenen Köpfen hergehen, sich einander präsentierend. Einfach wunderschön.
Wir waren bei weitem nicht die Einzigen, die sich von diesen Bildern gefangen nehmen ließen. Und nahezu jeder Mensch, der im Herbst oder Frühjahr schon ziehende Kraniche gesehen hat, ihre Flugrufe hören konnte – über Frankfurt, über dem Bergischen Land oder Kassel –, merkt auf und ruft: »Schau mal, da ziehen wieder die Kraniche!« Inzwischen reisen immer mehr Menschen im Herbst in die Vorpommersche Boddenlandschaft, um dort ein großartiges Naturereignis zu erleben: Zehntausende von Kranichen aus Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Polen und der Ukraine rasten hier für ein paar Tage oder Wochen, fliegen frühmorgens von den Schlafplätzen in den Uferzonen der Bodden auf die umliegenden Felder und Wiesen, um Futter zu suchen. Am späten Nachmittag oder frühen Abend kommen die Heerscharen zurück, fliegen, begleitet vom Rauschen ihrer Flügel und ihrer lauten Unterhaltung, zurück in die riesigen Schilflandschaften, um dort zu schlafen.
All dies konnte ich als Jugendlicher im Ruhrgebiet und als junger Mann nach meiner Promotion, als ich zuerst in Düsseldorf arbeitete, nicht erleben, denn dort gab es keine Kraniche. Sie flogen nicht über das Ruhrgebiet oder das Rheinland hinweg, und die Boddenlandschaft war nicht zugänglich, selbst wenn ich davon gewusst hätte, denn sie lag damals noch auf dem Gebiet der DDR.
Ein wichtiger Schritt auf meinem Weg zu den Kranichen war eine Entscheidung, die meine damalige Frau und ich trafen, als unser erster Sohn Bengt 1978 geboren war. Wir wollten mehr über die Natur wissen. Wir wollten, wenn wir später mit unseren Kindern spazieren gehen und wandern würden, von Anfang an nicht »Vogel« (geschweige denn »Piepmatz«), sondern »Schwarzdrossel«, »Kohlmeise« oder »Turmfalke« sagen, wenn wir etwas entdecken und den Kindern zeigen würden. So kauften wir ein Vogelbestimmungsbuch und studierten es.
Ebenso entscheidend war, dass ich 1981 eine neue Arbeitsstelle annahm und wir von Düsseldorf nach Bargteheide, einer Kleinstadt nordöstlich von Hamburg, zogen. Inzwischen war unser zweiter Sohn Børge geboren, und wir spazierten mit den Kindern im Buggy und auf den Schultern an fast jedem Wochenende in das nahe gelegene Naturschutzgebiet, den Duvenstedter Brook. Die Liebe zur Natur und zur Naturwissenschaft wollte ich unseren Kindern durch gemeinsames Beobachten und Erleben von Anfang an vermitteln.
Kurz nachdem wir die ersten Kraniche gehört und dann beobachtet hatten, lernten wir einige der Kranichschützer kennen. Der Deutsche Bund für Vogelschutz (DBV, heute: Naturschutzbund Deutschland, NABU) und der World Wide Fund For Nature (WWF) hatten ab 1982 den Kranichschutz in Hamburg aufgenommen. Es wurden Wege gesperrt, Besucher informiert und zur Rücksichtnahme bewegt, um die Brut jedenfalls nicht durch Menschen stören zu lassen. Das Konzept war schon nach kurzer Zeit erfolgreich.
Damals konnte ich nicht ahnen, dass ich selbst wenige Jahre später das Schutzprogramm leiten würde. Mein Vorgänger führte mich ab Mitte der 80er Jahre an die Feinheiten der Kranich-Beobachtung heran und übergab mir schließlich, als er sich den Kranichen im Osten Deutschlands zuwandte und nach Mecklenburg zog, dieses Projekt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits reichlich Erfahrung gesammelt, kannte das Gebiet und die dort brütenden Kraniche bestens.
Erste Grübeleien über das Verhalten der Kraniche verursachte mir ein Paar, das 1994 sehr nahe an einem Wanderweg brütete. Dort lag ein schönes Wasserloch, das früher wohl ein Teich für die Fischzucht, nun aber versumpft war. Drumherum boten Büsche und Bäume eine schöne Tarnung. Und im Jahr zuvor schon hatte sich dieses Paar dort niedergelassen, Eier gelegt und bebrütet – bis sie von einem Eierdieb gestohlen wurden. Für uns ein Schock! Wie konnte dieser so gut versteckte, so schwer einsehbare und nahezu unzugängliche Brutplatz entdeckt und ausgeraubt werden?
In Deutschland (und sicher ebenso anderen Ländern) gibt es immer wieder illegale Entnahmen von Kranicheiern aus Gelegen. Während meiner Zeit als Kranichschutzverantwortlicher zählten wir drei solcher Fälle – trotz Kranichbewachung. Das Gelände ist unübersichtlich, nachts und in der Morgen- oder Abenddämmerung kann man sich gut verbergen.
Im Jahre 1997 wurde am Amtsgericht Kiel ein Vogelzüchter (der sein Geschäft mit staatlicher Genehmigung betrieb) unter anderem angeklagt, seine Zucht mit illegal beschafften Eiern zu betreiben. Er hielt 60 Kraniche, darunter drei ausländische Arten. Aufgefallen war er dadurch, dass seine Aufzuchtergebnisse bei Kranichen deutlich besser als die des Vogelparks Walsrode waren. Eine Genanalyse wies nach, dass die »Nachkommen« mit ihren »Eltern« nicht verwandt waren, was die Anklagebehörde zu dem Schluss kommen ließ, er habe die Eier aus wilden Gelegen erhalten. Während der Ermittlungen flog in Mecklenburg ein Schmugglerring auf, der Eier aus Kranichgelegen stahl und meist in die Benelux-Staaten verschickte. Bei einem einzigen dieser Transporte wurden über 40 Eier sichergestellt. In der Adresskartei des Schmugglerringes wurde auch der schleswig-holsteinische Züchter gefunden. All dies hat leider den Richter nicht überzeugt, der immer wieder fragte, ob ein Zeuge beim Eierdiebstahl oder bei der Übergabe der Eier an den Angeklagten dabei gewesen sei, was – natürlich – nicht der Fall war. Der Züchter wurde also nicht verurteilt, jedenfalls nicht wegen der Eier. Ohne Frage aber gibt es in Deutschland und Benelux Zuchtbetriebe, legale und möglicherweise illegale, die Kraniche aus wilden Gelegen züchten und verkaufen.
Es gibt auch nicht-kommerzielle Motive für den Diebstahl von Eiern aus den Gelegen wild lebender Vögel. 1999 flog ein Ring von Eiersammlern auf, dessen Mitglieder Eier tauschten wie andere Leute Briefmarken. Was diese Leute an Eiern zusammengetragen hatten, treibt Naturschützern Tränen in die Augen. Es wurden über 100 000 ausgeblasene Eier sichergestellt, darunter zahlreiche Kranicheier, sogar einige Eier des Schneekranichs, von dem es in der westlichen Population damals gerade noch zwölf Exemplare gab, heute nur noch eines.
Verhaftet wurden ganz seriöse Menschen (nicht wie beim Handel mit zu bebrütenden Eiern einige von Züchtern angeheuerte Arbeits- und Obdachlose aus Mecklenburg). Dem Hobby des Sammelns, Ausblasens und Tauschens von Eiern aller Vogelarten der Welt gingen angeblich ehrbare Zollbeamte, kaufmännische Angestellte und Erdkundelehrer nach. Der aufgeflogene Ring wird nur die Spitze des Ei(s)berges gewesen sein.
Zurück zu dem unvorsichtigen Kranichpaar. 1993 waren alle Versuche, sein Nest zu bewachen, erfolglos geblieben. Und ein Jahr später brütete das Paar an derselben Stelle erneut. Wir beratschlagten und verstärkten die Bewachung, suchten uns Plätze, von denen aus wir – ohne von Besuchern gesehen zu werden – das Brutgebiet überschauen konnten. Natürlich konnte es keine wirkliche Sicherheit geben. Der Dieb (falls er noch mehr Eier wollte) hätte sich die Zeiten für weitere Raubzüge aussuchen können. Wäre es besser, wenn wir die Eier selbst entnähmen und so das Paar vergrämten und hoffentlich zu einer Nachbrut an einem geeigneteren Platz bewegten?
Ich war strikt gegen ein solches Vorgehen. Die Kraniche hatten sich nun einmal in diesem Gebiet niedergelassen und mussten wohl oder übel mit den Menschen klarkommen. Wenn sie das hier – unter unserer Bewachung – nicht schafften, konnten wir auch nicht helfen. Es konnte nicht unsere Aufgabe sein, ständig einzugreifen, wenn ein Gelege ungünstig angelegt oder gefährdet war. Wir ließen die Kraniche also brüten. Wenigstens sollten es aber diesmal die Eierdiebe schwerer haben, schworen wir uns, und beobachteten die Umgebung dieses Nistplatzes besonders intensiv. Mein damals 16-jähriger älterer Sohn Bengt und ich nahmen uns vor, in der Dämmerung die Zugänge zum näheren Revierumfeld zu kontrollieren.
Wegen der nahe gelegenen Großstadt hat man bei bewölktem Himmel im Brook auch nachts eine gute Sicht. Einigermaßen dunkel ist nur eine wolkenlose Nacht bei Neumond, und in einer solchen Nacht bewachten mein Sohn und ich damals das Kranichnest.
Es war schon spät, eigentlich wollten wir gehen. Wir froren, es war still geworden. Bengt war von seinem Standort zu mir herübergekommen. Wir standen im Dunklen und lauschten. Das Erste, was wir mitbekamen, war kein Geräusch, sondern eine schemenhafte Bewegung über dem freien Acker am Rande des Brooks, der aber schon zum Naturschutzgebiet gehörte. »Da ist jemand!« Wir schlichen vorwärts und aus der Deckung des Knicks heraus, um die Gestalt sehen zu können, wenn sie aus der nächsten Senke herauskommen würde – wenn es denn eine war. Vielleicht war es ja auch nur ein großer Hund, und die Aufregung war umsonst?
Nein, es war kein großer Hund, es war eine komplett schwarz gekleidete Gestalt, die sich sogar das Gesicht vermummt hatte. Wir überlegten fieberhaft: Was machen wir? Warten, bis er zum Nest geht? Nein, womöglich würden wir ihn im Gestrüpp nicht mehr erkennen oder gar verlieren. Außerdem wollten wir keine Störung am Nest riskieren. Auch wenn dieser Vermummte kein Eierdieb war, war es in Ordnung, wenn wir ihn ansprachen, denn das Verlassen der Wege ist in diesem Gelände verboten, auch nachts.
Also entschieden wir uns dafür, der Gestalt entgegenzulaufen – Bengt außen, ich innen –, um ihr den Weg abzuschneiden. Nun sah der Vermummte uns, verschwand im Knick, versteckte einen Rucksack, wie wir schemenhaft zu erkennen meinten – und schon stand er auf dem Weg. »Halt, was machen Sie hier?«, rief ich ihn an. Wie ich jetzt sehen konnte, handelte es sich um einen etwa 15-jährigen Jungen. Er behauptete, sein eigenes Geländespiel zu spielen, wusste auch, dass er verbotswidrig vom Weg abgewichen war. Von einem Rucksack wollte er nichts wissen, er behauptete, keinen gehabt zu haben. Leider konnten wir in der Dunkelheit später nichts finden.
Ich blieb bei dem Jungen, während Bengt zur nächstgelegenen Telefonzelle lief – Mobiltelefone gab es noch nicht –, um die Polizei zu holen. Die allerdings kam nicht, und so holten wir schließlich den Flurwart. Ihm war es sichtlich unangenehm, er kannte den Jungen wohl. Das Ganze ging aus wie das Hornberger Schießen. Ob der Junge wirklich Eier stehlen wollte oder was sonst hinter seinem Verhalten steckte, haben wir nie herausbekommen. Jedenfalls wurden in jenem Jahr die Eier nicht gestohlen.
Das aber enthob mich keineswegs meiner Sorge um dieses Kranichpaar, denn Kraniche benötigen für eine erfolgreiche Brut drei Voraussetzungen: erstens eine ständig feuchte Stelle mit etwa knietiefem Wasser. Zweitens absolute Ungestörtheit, da sie bei jeder Störung das Nest oder die Jungen verlassen, sodass dann alle möglichen Räuber leichtes Spiel haben, vom Raben über das Wildschwein und den Fuchs bis zum Marder. Ohne Störungen durch Menschen kommen die Kraniche mit diesen räuberischen Nahrungssuchenden ganz gut klar. Drittens brauchen Kraniche für ihre Brut in der Nähe des Nestes eine übersichtliche Wiese oder Lichtung, auf der sie nach der Schlupf4 die Jungen ausführen und füttern können, bis diese flügge sind (was etwa drei Monate dauert). Bei diesem Kranichpaar sah es diesbezüglich nicht gut aus: Wasser war vorhanden. Für die Ungestörtheit sorgten wir, so gut wir konnten. Nur – wo war die Wiese oder die Lichtung? Hinter dem Brutplatz befand sich zwar eine ehemalige Weide, aber die war viel zu klein und viel zu nahe am Hauptweg, auf dem sich an sonnigen Sonntagen die Menschen zu Hunderten entlangschlängelten. Kein normaler Kranich würde dies aushalten.
Der Tag der Schlupf war gekommen. Ich hatte eine Stelle gefunden, von der aus wir mit guten Ferngläsern oder Fernrohr fast direkt in das Nest sehen konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Niemals vorher oder nachher hatten wir die Möglichkeit, die beiden Küken so früh zu sehen. Wie klein sie waren, kuschelig eingehüllt in ihr hellbraunes »Fell« und schon ziemlich aufmerksam!
Normalerweise verlassen Kranicheltern mit ihren Jungen nach wenigen Tagen den Nestbereich und gehen auf die Nahrungswiese. Dabei werden die Ausflüge immer länger. Nachts gehen sie entweder wieder zum Nistplatz zurück oder suchen eine andere (wiederum ca. knietief feuchte) Stelle zum Übernachten. Beim Schlafen stehen sie im Wasser. Doch unsere Kraniche hier bewegten sich kaum vom Fleck. Sie blieben in ihrem kleinen Sumpf, oft weniger als 20 oder 30 Meter vom Nest entfernt, oder versteckten sich im angrenzenden Gebüsch. Das alles machte keinen guten Eindruck auf mich, und ich hatte nicht die geringste Vorstellung, wie die Kraniche es anstellen würden, ihre Jungen groß (und flügge!) zu bekommen. Dann wurden die Jungen größer, und ich beobachtete, dass der Ort als Nahrungsquelle sehr gut gewählt war. Zwar bot er wenig Auslauf, aber reichlich proteinhaltige Nahrung: Die Alten fingen viele Fluginsekten und verfütterten diese an ihre Jungen.
Nur, wie sollte die Aufzucht weitergehen, wenn die Jungen den engeren Nistbereich verlassen würden? Wie wollten die Eltern ihnen zeigen, was gut und was weniger schmackhaft war, so ganz ohne offene Fütterungsfläche? Während im Süden der Brutplatz durch dichtes Buschwerk, eine Abbruchkante (der Brutplatz lag etwa zwei Meter tiefer) und eine schmale Wiese vom Haupteinfallsweg der Hamburger in den Duvenstedter Brook her uneinsehbar und unzugänglich war, erstreckten sich nach Osten, Norden und Westen nahezu undurchdringliche Waldstücke mit viel Unterholz, Büschen unter den Birken und Nadelbäumen. Wie traurig, dass Kraniche so sehr an den einmal genutzten Brutplatz gebunden und so gar nicht flexibel sind! So dachte ich damals, als ich die Kranichjungen langsam größer werden sah, weil die Alten wirklich geschickt die großen Insekten fingen. Aber wie sollten sich die Jungen weiterentwickeln, wenn sie wachsen und normalerweise immer größere Gebiete erwandern und kennenlernen?
Damals konnte ich noch nicht wissen, dass die Kranicheltern einen Plan hatten – dazu später mehr. Erst einmal treten wir einen Schritt zurück und schauen uns an, was wir Kranichbewacher, aber auch generell die Kranichexperten und Biologen seinerzeit über Kraniche wussten. Und wir blicken einige Jahrhunderte und Jahrtausende zurück, um uns anzusehen, was die Kraniche den Menschen früher bedeuteten.
KAPITEL 2 Kranichwissen kompakt: die Mythen und die Fakten
Als ich damals sorgenvoll das anscheinend rein mechanisch von seinen Instinkten gesteuerte Kranichpaar beobachtete, wusste ich über das Verhalten der Vögel kaum mehr als ein paar grundlegende Fakten.
Kraniche und Rallen (wie die bekannten Blässhühner, die an vielen unterschiedlichen Gewässern leben, einschließlich Parkteichen in Städten) sind miteinander verwandt, ebenso wie die Trappen (die in Deutschland fast ausgerottet sind). Diese drei Familien (und ein paar weitere) gehören zu den »Gruiformes« oder »kranichähnlichen Vögeln«. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind die Kraniche nicht mit den Graureihern (»Fischreiher«) oder Störchen verwandt. Zwar sehen sie ein wenig ähnlich aus (lange Beine, langer Hals, langer Schnabel), aber das ist auch schon alles.
Seit 60 Millionen Jahren leben Kraniche auf der Erde. Damit sind sie 20- bis 30-mal früher aufgetaucht als die unmittelbaren Vorfahren der Menschen, früher sogar als die frühesten Säugetiere. Kraniche gibt es mutmaßlich, seit die Dinosaurier von der Erde verschwanden. Natürlich haben sie sich in dieser langen Zeit stark verändert, aber sie sind eine der erfolgreichsten Artenfamilien der Evolutionsgeschichte. Es gibt immer mehr Hinweise dafür, dass Kraniche und alle anderen Vögel letztlich von Dinosauriern abstammen – sie sind eigentlich moderne Dinos. Nicht nur zeichnet sich immer klarer die Entwicklung des Federkleids in der Evolution der Dinosaurier ab. Auch die Färbung der Eier deutet auf ihre direkte Abstammung von den Dinos hin: Alle Vogeleier weisen unabhängig von ihrem konkreten Aussehen nur zwei Farbpigmente auf. Diejenigen Dinosaurier, die mit den Vögeln eng verwandt sind (die Maniraptora) legten ebenfalls gefärbte Eier, deren Färbung auf den gleichen Pigmenten beruhte.5 Besonders der Kanadakranich scheint eng verwandt zu sein mit den Vorfahren, die vor etwa 60 Millionen Jahren gelebt haben.
Wie verbreitet und alltäglich Kraniche in Europa in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden waren, zeigt eine Untersuchung des Iren Lorcan O’Toole.6 Bei archäologischen Ausgrabungen wurden in Irland oftmals Kranichknochen gefunden – in einem Land, in dem es seit Hunderten von Jahren keine Kraniche mehr gibt. Viele irische Ortsnamen sind wohl von früheren Kranichrevieren abgeleitet. O’Toole vermutet darüber hinaus, dass Ortsnamen gälischen Ursprungs auf dem europäischen Festland, die mit »Cor« oder »Kor« beginnen – es sind Hunderte –, aus der Bronzezeit stammen und ebenfalls mit Kranichplätzen zu tun haben. Im modernen Gälischen gibt es eine Reihe von Begriffen, die aus früheren, übertragenen Bedeutungen herrühren könnten, wie »Corr duine« (»Kranich-Person«) für »Einzelgänger« oder »Corrluach« (»Kranich-Portion«), was »übrig gebliebenes Korn« bedeutet.
Ein irisches Diptychon (ein zweiteiliges Relief oder Gemälde mit Scharnieren zum Aufklappen) von 1399 zeigt die Geburt von Richard II.: Alle umstehenden Engel haben Kranichflügel! Auf uralten Grabsteinen und Stelen sind Menschenfiguren mit Kranichköpfen zu sehen.
Während in Irland wie in England die Kraniche unter anderem durch intensive Jagd ausgerottet wurden, ist die Jagd auf sie in Spanien, Schweden und anderen europäischen Ländern seit Langem verboten. Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, dass sich der Bestand an Grauen Kranichen in einigen Ländern Europas seit etwa 1980 erholt hat. Andere maßgebliche Gründe sind der jahrzehntelang erfolgreiche Schutz der Kraniche in der DDR, was zu einer »Überbevölkerung« führte, zusätzliche Naturschutzverordnungen, wiedervernässte Feuchtgebiete und die Verschiebung der Kranichzugwege westwärts. Dass es heute wieder mehr Kraniche gibt, kann aber auch eine Folge der Lernfähigkeit der Vögel sein, denn Kraniche nehmen zunehmend Brutplätze an, die sie früher gemieden hätten.
Vor der Wiedervereinigung waren Kraniche in der Bundesrepublik Deutschland nahezu ausgestorben, in Dänemark und Norwegen komplett verschwunden. Erst intensive Naturschutzmaßnahmen bewirkten einen Umschwung. In Deutschland konnte der Kranich inzwischen von der Roten Liste gefährdeter Arten gestrichen werden. Bevor nun aber Euphorie ausbricht, sei daran erinnert, dass Kraniche früher überall in Deutschland und Mitteleuropa bis hin nach Großbritannien und mit nennenswerter Verbreitung in Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Österreich, Schweiz, Rumänien und Ungarn vorkamen – Länder, in denen heute keine Kraniche mehr brüten. In Deutschland gibt es beispielsweise in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Bayern nach wie vor kaum Brutpaare.
Der Graue Kranich kommt heute wieder in nennenswerten Zahlen in Schweden und Finnland (zusammen über 30 000 Brutpaare beziehungsweise 100 000 Individuen) sowie in Russland (rund 20 000 Paare) vor. Nachdem es lange Jahre nur wenige Kraniche in Norwegen gab, ist die Population inzwischen wieder auf fast 5000 Paare angestiegen. Im kleinen und dicht besiedelten Dänemark sind es inzwischen fast 500 Paare. In Deutschland hat sich die Kranichpopulation deutlich erholt, man schätzt etwa 7500 Brutpaare, von denen die allermeisten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern leben. In Russland unterscheidet man zwei Rassen, wobei die östliche Rasse etwas heller gefärbt und kleiner ist. Kleinere Vorkommen sind in Polen, den baltischen Staaten und den übrigen östlichen Nachfolgestaaten der UdSSR zu finden. In der Mongolei, Kasachstan und China leben jeweils ebenfalls einige hundert Paare. Außerdem gibt es noch an die 300 Brutpaare in der Türkei.
In Großbritannien trafen 1979 überraschenderweise drei Kraniche in Norfolk ein; ein erster Brutversuch begann 1982, nur ein Jahr später als im Hamburger Duvenstedter Brook. Die Wiederansiedlung von Kranichen in England wurde später durch Eier aus Wildgelegen in Brandenburg unterstützt. Diese wurden dann künstlich bebrütet, und die Kraniche in einer Gruppe von bereits wildlebenden Artgenossen ausgesetzt. Ein anderes Kranichpaar brütete zwei- oder dreimal in der Normandie, hielt sich dort aber nicht. Seit jüngstem gibt es eine Handvoll Paare in Lothringen. Die Schätzungen für Eurasien (Europa, Sibirien, Mongolei, Nordost-China mit Überwinterung zum Beispiel in Indien) insgesamt liegen bei etwa 450 000, vielleicht sogar 500 000 Individuen. Einige Forscher gehen davon aus, dass die Grauen Kraniche östlich des Urals eine Unterart bilden (Grus grus lilfordi), die sich mit der westlich des Urals verbreiteten Art nicht mischt (genetische Untersuchungen gibt es hierzu bisher nicht). Möglicherweise gibt es zwei weitere Unterarten in Transkaukasien und Tibet, doch das ist alles sehr spekulativ.
Schweden, wo wirklich genügend Raum für Menschen wie für Kraniche ist, erlaubt den Bauern, Kraniche abzuschießen, wenn sie sich zu oft auf den Feldern aufhalten. Unsere schwedischen Kranichschutzfreunde haben sich auf der Europäischen Kranichkonferenz in Stralsund dafür entschuldigt. Besonders in den Rast- und Überwinterungsgebieten sind die Konflikte zwischen Kranich und Bauer, zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, wenngleich lokal sehr begrenzt, nicht zu übersehen.
Ein Kranichweibchen (eine Henne) wiegt trotz seiner imposanten Größe (Kraniche werden 1,10 bis 1,30 Meter groß bei einer Flügelspannweite von 2,20 bis 2,40 Metern) bescheidene 4,5 bis 5,8 Kilogramm. Die Männchen (Hähne) wiegen 5,1 bis 6,1 Kilogramm. Zum Vergleich: Die viel kleinere Graugans wiegt um 3,5 Kilogramm, ein Höckerschwan bis zu 12 Kilogramm. Zur Aufrechterhaltung seines Körpergewichtes braucht der Kranich erstaunlich wenig Nahrung. In seinem Magen finden sich normalerweise etwa 100 Gramm, wovon allein 30 Gramm kleine Steinchen sind. Doch wenn Tausende von Kranichen auf einem Acker Futter suchen, kommt trotz der geringen Nahrungsmenge pro Individuum einiges zusammen, zumal eine Gruppe von Kranichen im Frühjahr auf einem Acker mit z. B. frisch gekeimten Ackerbohnen diesen vollständig ruinieren kann, wenn sie nicht vergrämt werden, weil sie die Pflanzen ausreißen. Auch der Kranichschutz muss sich, wie Natur- und Artenschutz generell, den Interessenkonflikten u. a. mit der Landwirtschaft stellen und diese kreativ lösen helfen.
Kraniche fressen Wurzeln, Knollen und Zwiebeln verschiedener Pflanzen, Kartoffeln, Samen, Mais- und Getreidekörner. An tierischem Eiweiß fressen sie größere Insekten und ihre Larven (Grillen, Schmetterlinge, Libellen, Käfer), Regenwürmer und gelegentlich Eidechsen, Frösche oder Mäuse. Allerdings sind sie im Gegensatz zu Reihern oder Störchen keine guten Jäger. Dennoch habe ich einmal zufällig beobachten können, wie ein Kranich einen kleinen vorbeifliegenden Vogel erwischte und sofort verschlang. Im Allgemeinen sagt man, dass Kraniche sich nicht räuberisch ernähren. Diese Ansicht scheint sich derzeit jedoch nach und nach aufgrund gelegentlicher – alles andere als einfach zu machender – Beobachtungen zu wandeln. Eine Geschichte hierzu finden Sie im Anhang unter der Überschrift »Friedfertige Kraniche?«.
Ein Kranich nimmt am Tag durchschnittlich etwa 130 Gramm, im Winterquartier etwa 180 Gramm Nahrung auf. Es ist daher erstaunlich, dass Kraniche so ausdauernde Flieger sind. Auf dem Weg in ihr Winterquartier können sie offenbar 24 Stunden an einem Stück (vielleicht unterbrochen durch kurze Pausen) fliegen, im Durchschnitt sind es aber eher nur 50 bis 200 Kilometer am Tag. Während des Zuges verbringen Kraniche etwa drei Viertel der Zeit in Rastgebieten. Die Gesamtflugleistung beträgt – je nach Brutgebiet und Lage des Winterquartiers – bis zu 4000 oder sogar 5000 Kilometer. Die Flugleistungen sind deshalb erstaunlich, weil Kraniche sogenannte Ruderflieger sind, sich also im Gegensatz zu Störchen nicht überwiegend im Segelflug tragen lassen. Daher ist ihre Geschwindigkeit nicht besonders aufregend: Je nach Windrichtung werden im Mittel um die 45 Stundenkilometer erreicht.
In der Regel fliegen Kraniche nicht höher als 1000 Meter, sind aber von Piloten auch schon in 4300 Metern Höhe angetroffen worden. In Tibet beziehungsweise im Tibet-Hochland in West-China lebende Schwarzhalskraniche sind auf dem Weg ins Winterquartier südlich des Himalayas sogar in Höhen von über 8000 Metern beobachtet worden. Die Schwarmgrößen variieren beim Zug: Beim Abflug sind die Gruppen um 100 Vögel stark, nehmen zur Mitte des Fluges auf 60 bis 70 ab, dann gegen Ende der Strecke auf 25, bis schließlich nur noch um die zehn Individuen einen Schwarm bilden. Kurzzeitig können 400 bis 500 Kraniche beim gemeinsamen Flug angetroffen werden, dies ist jedoch sehr selten.
Unüberhörbar sind die trompetenartigen Rufe der Kraniche am Boden, zumeist paarweise im Duett. Sie sind manchmal kilometerweit zu hören. Diese Lautstärke ist möglich aufgrund der bis zu 1,30 Meter langen Luftröhre.
Kraniche hören gut, riechen vermutlich nicht besonders gut, können aber exzellent sehen. Sie erkennen jede verdächtige Bewegung, selbst von Weitem. Wenn man sich einem Kranich nähern will (was man unbedingt vermeiden sollte, denn wir wollen wildlebende Tiere nicht stören, aber Fotografen und Forscher müssen dies gelegentlich versuchen), wird man meist feststellen, dass er einen schon längst hat kommen sehen, während man den Vogel selbst noch gar nicht gesehen hat. Früher sagten die Menschen: »Kraniche haben auf den Schwanzfedern hundert Augen«, weil die Vögel uns Menschen sogar dann erkennen und sich verdrücken, wenn sie uns scheinbar nur den Rücken zugekehrt haben.
Das Gedächtnis und die Differenzierung von Bildern scheinen bei Kranichen ebenfalls sehr ausgeprägt zu sein. Sie können uns Menschen auseinanderhalten, während wir uns schwer damit tun, das »Gesicht« des einen Kranichs von dem eines anderen zu unterscheiden. Eigentlich sehen sie für uns alle gleich aus – wir offenbar für sie nicht; darüber können Sie im Anhang unter »USA: menschliche Freunde und Feinde« lesen.
Kraniche sind etwa ab dem vierten Lebensjahr geschlechtsreif. Sie können rund 25 Jahre (im Durchschnitt angeblich 13 Jahre), im Zoo über 40 Jahre alt werden; von Schnee- und Mandschurenkranichen wird berichtet, dass (in Gefangenschaft) sogar 80 Jahre möglich seien.
Die wissenschaftliche Literatur über Kraniche7 ist nicht mit der zum Beispiel über Menschenaffen zu vergleichen, weder in Umfang noch Inhalt – über Primaten und andere Säugetiere wird unvergleichlich viel mehr geforscht und veröffentlicht. Die Kranich-Literatur aus aller Welt umfasst einige tausend Quellen und wird dominiert von Arbeiten über die Verbreitung der Kraniche: wann wie viele wo zu finden sind, Veränderungen der Brut-, Zug- und Überwinterungszahlen, Forschung über die Zugwege. Die nächstgrößere Gruppe besteht aus Arbeiten über die Art und Qualität der Brut- und Nahrungs- und Überwinterungsgebiete sowie die Nahrung selbst.
Wenn man nach Literatur zum Verhalten der Kraniche sucht, findet sich kaum noch etwas. Die wenigen Arbeiten, die es gibt, bestehen aus rein systematischen (zum Teil sogar statistischen) Auswertungen von beobachteten Bewegungen einzelner Kraniche am Nest oder bei der Nahrungsaufnahme (»fliegt auf, steht, putzt sich, pickt, sichert …«). Balz und Tanz, Revierverteidigung, Brut und Aufzucht werden ausführlich beschrieben. Bemerkenswert ist, dass man sich dabei gerne zu einer mechanisch anmutenden Beschreibung verleiten lässt und die beobachteten Verhaltenselemente »Funktionskreisen« zuordnet. Darunter versteht man »Körperhaltung«, »Schlafen/Ruhen«, »Aufmerken, Wachen«, »Körperpflege und Komfortverhalten«, »Lokomotion« (also »Bewegung von einem Ort zum andern«), »Nahrungssuche und -aufnahme«, »antagonistisches Verhalten« (also Verhalten anderen Kranichen gegenüber) und »Fortpflanzung, Balz«.
Die Aufzählung von 132 verschiedenen Körperhaltungen (wie zum Beispiel für den japanischen Mandschurenkranich) oder von ca. 50 Körperhaltungen in den acht »Funktionskreisen« erweckt den Eindruck, als würde das »Verhaltensinventar« maschinenähnlicher Tiere beschrieben.
Alle diese Arbeiten sind wichtig, sachdienlich und hilfreich, gehen aber nicht in die Tiefe. Denn was weiß man wirklich über Kraniche, wenn man ihre »Funktionskreise« kennt? Ich meine, Begriffe wie »Funktionskreis« und »Verhaltensinventar« verleiten uns dazu, eine wichtige Kompetenz zu übersehen: die Fähigkeit zu flexiblem, situations- und umgebungs-angepasstem Verhalten. Mir ist keine einzige Veröffentlichung bekannt, die sich mit dem eigentlichen Verhalten der Kraniche befasst, also ihrem Sozialverhalten, ihren Reaktionen auf die Umgebung, ihrer Intelligenz und Lernfähigkeit, vor allem nicht im Freiland. So, wie über viele Tierarten (vor allem Primaten und andere Säugetiere, seltener über Vögel wie zum Beispiel Raben) in aufwändigen Freilandbeobachtungen gearbeitet wurde, wurde noch nie über Kraniche geforscht.
Verhaltensstudien an Vögeln werden in aller Regel in Gefangenschaft gemacht. Hier sind Graugänse, Tauben, Papageien oder Rabenvögel beliebte Studienobjekte. Doch obwohl in zwei Einrichtungen in den USA zahlreiche Kraniche, darunter viele Kanadakraniche, gehalten werden, gab und gibt es nicht einmal hier Verhaltensforschung. Wir sind also in Bezug auf das Verhalten und die kognitiven Fähigkeiten der Kraniche nicht viel weiter als die Menschen früherer Jahrhunderte und Jahrtausende.
Tatsächlich existieren rund um den Kranich zahlreiche Mythen. Besonders in Asien (vor allem in China und Japan) weit verbreitet ist der Aberglaube, dass Kraniche sehr lange leben, vielleicht sogar unsterblich sind. Das rührt daher, dass dort, wo Menschen Kranichreviere kennen, sie über Generationen hinweg beobachtet haben, dass »jedes Jahr die gleichen Kraniche« dort brüteten. Bis vor gar nicht so vielen Jahren gab es ja keinerlei Möglichkeiten festzustellen, um welche Kranichindividuen es sich handelte, die dort in diesem, dann im nächsten und schließlich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten brüteten.
In der chinesischen Sprache gibt es das Wort (gesprochen »hè nián«, wobei die Akzente die korrekte Betonung der Silbe andeuten), wörtlich Silbe für Silbe übersetzt »Kranich-Jahr(e)«, es bedeutet »langes Leben«, und manche Eltern nennen ihr Kind so in der Hoffnung, es möge ein langes, erfülltes Leben haben.
In Japan, besonders aber auch in China gibt es zahllose Gemälde und Seidenstickereien, die Kraniche auf dort typischen Kiefern zeigen.8 Ich fragte meine dortigen Freunde oft, ob sie nicht wüssten, dass Kraniche (im Gegensatz zu Reihern) gar nicht auf den Ästen irgendwelcher Bäume landen oder stehen könnten. Ihre Krallen sind einfach nicht dazu geeignet. Aber keiner der Chinesen, die ich kenne (und das sind sehr viele), hatte jemals Kraniche gesehen, von einer Unterscheidung zwischen Kranichen und Reihern ganz zu schweigen. Also hielt ich die künstlerische Darstellung für Unwissen der Maler und für eine Verwechslung mit Reihern, bis ich lernte, dass einerseits diese Kiefernart, andererseits die Kraniche für »langes Leben« stehen, die Kiefern zusätzlich noch für Robustheit – beides zusammen drückt also auf doppelte Weise den Wunsch nach einem langen Leben aus.
Während der Kranich zumindest in Asien hoch geachtet ist, wird er in einer Fabel von Aesop als naiv und dumm, als Loser dargestellt: Der Wolf hat allzu gierig ein Schaf gefressen, ein Knochen steckt in seinem Hals; der Kranich hilft ihm, steckt seinen Kopf in das Wolfsmaul, zieht mit dem Schnabel den Knochen heraus und verlangt anschließend die versprochene Belohnung; der Wolf aber weist dies zurück und meint, es sei Belohnung genug, dass der Kranich seinen Kopf unbeschadet aus seinem Maul herausziehen durfte. Diese Fabel spiegelt vermutlich die damalige Meinung über Kraniche wider, die zwar als elegant und tugendhaft galten, aber eben nicht als »schlau« wie Wölfe und Füchse.
In Japan dagegen steht der Kranich für Autorität. Wenn man sagen will, dass jemandes Wort Gewicht hat und keinen Widerspruch duldet, dann ist dies »ein Wort des Kranichs«.
Schon bei den alten Griechen entwickelte der Kranich sich zum Symbol der Wachsamkeit: Man glaubte, er schlafe mit einem Stein in einer seiner beiden Krallen, die er hochhalte; sobald ihm der Stein herunterfalle, weil er tief eingeschlafen sei, wache er auf. Heute wissen wir, dass Kraniche keineswegs auf einem Bein stehend schlafen, wie zum Beispiel Flamingos dies tun. Das diesbezügliche Unwissen der Antike ist vermutlich darin begründet, dass Kraniche im Unterschied zu Flamingos nur sehr selten an ihren Schlafplätzen beobachtet werden können. Nichtsdestoweniger findet man auf alten Häusern Zeichnungen und Figuren, die auf diesen uralten Glauben hindeuten – übrigens auch in Deutschland. Hierzulande nutzt die Mendelssohn-Gesellschaft den wachsamen Kranich mit dem Stein in der Kralle als ihr Logo, zusammen mit dem Motto »Ich wach«. Wilhelm Busch hat darüber das liebenswerte Gedicht »Zu guter Letzt, der kluge Kranich« geschrieben.
Unwissenheit und reine Phantasie sind auch der Hintergrund der merkwürdigen Interpretation des Kranichzugs in den Süden, wie sie in der Ilias von Homer zu finden ist: Demnach fliegen menschenfressende Kraniche in den Süden, um dort in Afrika mit den Pygmäen zu kämpfen. Der Zug der Kraniche spielt auch in Schillers Ballade »Die Kraniche des Ibykus« eine Rolle, denn diese sind die einzigen Zeugen eines Mordes; als der Mörder wieder einmal ziehende Kraniche sieht, entlarvt er sich selbst.
Im Chinesischen ist der Kranich oft Akteur einer Geschichte, einer Fabel, die einem der vielen tausend wunderschönen und lebensklugen chinesischen Sprichwörter zugrunde liegt. In einer dieser Erzählungen lädt der Fuchs einen Kranich zum Essen ein, allerdings serviert er die Suppe auf einem flachen Teller, sodass der Kranich diese gar nicht verspeisen kann. Der Fuchs schlabbert sie mit der Zunge ganz einfach weg. Der Kranich lässt ihm bald darauf eine Gegeneinladung zukommen, allerdings ist das Mahl am Boden eines Kruges zu finden, der einen langen, schmalen Hals aufweist, einen Flaschenhals. Nun muss der Fuchs einsehen, dass seine Trickserei dazu führte, dass er selbst im Gegenzug ausgetrickst wurde, denn er kommt nicht an den Boden des Kruges heran. Diese Geschichte existiert in vielen Varianten; in Europa ist sie seit altersher als Fabel von Aesop bekannt, teils mit wechselnden Akteuren, zum Beispiel dem Storch anstelle des Kranichs. Sie scheint aber ihren Ursprung in China zu haben.
In einer anderen jahrtausendealten chinesischen Geschichte wird einem General gehuldigt, der bei einer Invasion seines Königreichs trotz enormer Verluste bei seinem König bleibt, ihn beschützt und das Land rettet. Die Menschen sagten daraufhin, er sei so herausragend »wie ein Kranich, der unter Hühnern steht«. Die Chinesen haben aus dieser wie aus Tausenden anderer Geschichten Sprichwörter gemacht, indem sie die Geschichte auf genau vier oder acht Schriftzeichen kondensierten, und jeder einigermaßen Gebildete versteht den Hintergrund. In diesem Fall heißt das entsprechende »Cheng Yu« (so nennt man diese Art Sprichworte) » hè lì jī qún«, wörtlich übersetzt »Kranich steht (in) Hühnerschar«. »Einen Kranich nach YangZhou reiten« bedeutet, dass jemand eine höhere, attraktivere Position erreicht hat. » fēng shēng hè lì«, »Geräusch des Windes (und) des Kranichrufs«, kennzeichnet besonders furchtsame Menschen (ursprünglich Soldaten), die bei jedem unerwarteten Geräusch gleich in Panik geraten.
In allen Ländern der Erde, in denen es Kraniche gibt, gelten diese als Glücksbringer und Frühlingsboten, weil sie im Frühjahr zurückkommen und dann so wunderschön tanzen. »Frühlingsbote«, dagegen ist aus rein fachlicher Sicht nichts einzuwenden: Ziehen die Kraniche im Februar, wenn wir nachts ihre Flugrufe hören, nach Norden zurück, wird es in absehbarer Zeit Frühling. »Glücksbringer« – nun, das ist jedem selbst überlassen und entzieht sich der wissenschaftlichen Analyse. Mir haben Kraniche sehr viel Glück gebracht: Wann immer ich sie sah und heute noch sehe, huscht ein Lächeln über mein Gesicht, und meine Stimmung hebt sich.
Nach einem der ältesten und hartnäckigsten Mythen sind Kranichpaare sich lebenslang treu; ein Kranich habe in seinem Leben nur einen einzigen Partner. Diese Auffassung ist wiederum in China und Japan besonders populär (obwohl die allermeisten Menschen dort noch nie einen Kranich gesehen haben). In Japan sind Kraniche deshalb äußerst beliebt als Abbildung auf dem Hochzeitskleid. Diese Vorstellung ist ja auch allzu schön und so wohlig-romantisch. Diesem Glauben, der auch unter Kranichfreunden, -experten und -forschern nach wie vor weit verbreitet ist, werde ich mich an späterer Stelle zuwenden. Im nächsten Kapitel möchte ich mich erneut dem Kranichpaar widmen, das hartnäckig genug war, um erneut an einem Ort zu brüten, der doch eigentlich ungeeignet war.
KAPITEL 3 Problemlösungen, Ballett-Balz und Fuchsalarm: Wie kommunizieren Kraniche miteinander?
Das Kranichpaar, das wieder dort nistete, wo ihm im Vorjahr die Eier geraubt worden waren, wo es nebenan gar keine Wiese zum Führen und Ernähren der Jungen gab, machte mir immer mehr Sorgen.
Eines sonnigen Sonntagmorgens konnte ich die Kranicheltern mit den Jungen wieder auf dem Sumpf in der Nähe des Nestes beobachten. Zu dieser Zeit hatte ich mich schon fast an den Gedanken gewöhnt, dass sie wohl nie aus ihrem selbstgewählten Sumpfloch herauskommen würden, und damit wäre die Brut erfolglos gewesen. Inzwischen, zwei Wochen nach der Schlupf, waren die Jungen schon hühner- beziehungsweise putengroß.9 Wir hatten bisher nie beobachtet, dass sich eine Kranichfamilie so lange in direkter Umgebung ihres Nestes aufhielt.
Am Nachmittag desselben Tages fuhr ich nochmals in den Brook. Die Kranichfamilie war verschwunden. Nun hatte ich sie schon zuvor manchmal nicht oder nur schwer entdecken können, wenn sie sich – aus welchem Grund auch immer – besonders gut versteckt hatten. Aber dieses Mal waren die Vögel wirklich nicht zu sehen. Ich war beunruhigt.
Aus reiner Routine hielt ich auf dem Weg nach Hause hier und da an, suchte noch einige andere Stellen mit dem Fernglas ab, und irgendwann konnte ich aufatmen: Die gesuchte Familie befand sich auf einer Wiese, die 500 Meter vom Brutplatz entfernt und durch einen ziemlich wilden, verbuschten und unwegsamen Wald davon abgetrennt lag. Es war eindeutig: Die Kraniche mussten gegen Mittag (ich hatte sie zuletzt gegen zwölf Uhr gesehen) losmarschiert sein und waren spätestens um 17 Uhr auf der neuen Wiese angekommen (das war der Zeitpunkt, an dem ich sie dort entdeckte), wahrscheinlich schon deutlich eher.
Ich war sprachlos. Wochenlang hatte ich mir Gedanken gemacht, was die Kranicheltern wohl unternehmen würden, um ihr Problem zu lösen, und es war so einfach: Sie warteten, bis ihre Jungen groß und stark genug waren, um gemeinsam mit ihnen den Weg zur Wiese zurückzulegen und dabei über Äste und umgefallene Bäume zu steigen.
Im Frühjahr hatte ich auf eben dieser Wiese ein Kranichpaar bei der Balz beobachtet – nun nahm ich an, dass es sich um die jungen Eltern handelte, die ich hier wiederum vor mir hatte. Dies war »ihre« Wiese, sie gehörte ihrer Ansicht nach zu ihrem Revier, und offenbar war dem Paar von vornherein »klar« gewesen, wie es die Jungen aufziehen würde, wann es den Platz wechseln würde usw. Die Altvögel hatten wohl nie »in Erwägung gezogen«, die unmittelbar an das Brutrevier angrenzende Wiese direkt am Hauptwanderweg zu nutzen. Wie viele Menschen sich dort zeitweilig aufhielten, war ihnen sicher nicht entgangen.
Ich war beeindruckt. Ich hatte mir Sorgen gemacht und war auf das Nächstliegende doch nicht gekommen. Für mich stand nun fest, dass dieses Paar seit seiner Ankunft im Revier einen Plan entwickelt hatte, wie es seine Jungen mit Nahrung versorgen würde. Einen auf der Wiese gelegenen Schlafplatz (wiederum eine ausreichend feuchte Stelle), der als Nistplatz ungeeignet war, hatten sie ebenfalls vorher bereits ausgesucht – denn diesen strebten sie nunmehr allabendlich an.
Mein Erlebnis gab mir zu denken: Ich hatte die Kraniche für nicht besonders intelligent gehalten, jedenfalls für dümmer, als sie sich mir hier präsentiert hatten. Ganz sicher hatte ich schon in den Jahren zuvor mancherlei Hinweise übersehen, wie intelligent Kraniche sind, wie flexibel sie sich ihrer Umgebung und Umwelt anpassen und es schaffen, Probleme zu lösen und sich selbst unter widrigen Umständen zu behaupten.
Beschämt musste ich mir eingestehen, dass ich der menschlichen Selbstüberschätzung erlegen war: Wir glauben immer, dass unsere außerordentliche Intelligenzleistung darin besteht, dass wir es schaffen, uns über die Widrigkeiten der Natur hinwegzusetzen. Wir bauen uns Werkzeuge, Häuser und Autos und umgehen damit unsere natürlichen Beschränkungen.
Die Fähigkeiten der Tiere, in ihrer natürlichen (oder in der von uns Menschen veränderten) Umwelt zu überleben, mehr noch: ein ihnen gemäßes erfülltes und schönes Leben zu leben (und nicht einfach nur täglich um das Überleben zu kämpfen, wie es oft so schön gruselig heißt), nennen wir dann »vererbt«. Das, so meinen wir, können die Tiere quasi »automatisch«, weil ihre Instinkte sie so und nicht anders programmiert haben. Wir übersehen dabei geflissentlich, wie viel Intelligenz und Erfindungsgabe hinter dem Verhalten der Tiere und ihren Anpassungsleistungen steckt, wie viele ihrer erfolgreichen Verhaltensweisen sie auch erst mühsam, aber pfiffig erlernen mussten.
Für mich war dieses Ereignis ein Schlüsselerlebnis. Ich nahm mir vor, noch intensiver, vor allem aber anders zu beobachten. Unvoreingenommener. Seither hat mich das ruhige Betrachten, Hören, Riechen und Fühlen der Vorgänge in der Natur unzählige Male regelrecht glücklich gemacht. Immer wieder hatte und habe ich Gelegenheit, über die erstaunlichen Leistungen der Evolution nachzudenken – unsere eigenen und diejenigen anderer Lebewesen. Das hat mich im Verlauf meines Lebens immer bescheidener gemacht – bescheidener, was meine Rolle als Mensch in der Welt und was die Rolle der Menschen insgesamt in der Natur anbetrifft.
Ich habe mir seit diesem Erlebnis mehr Zeit genommen, an verschiedenen Stellen des Brooks Kraniche (und nicht nur diese!) zu beobachten, zu allen Tages- und Jahreszeiten und bei allen Wetterlagen. Da ich mit der Familie oder allein häufig dort spazieren ging (oder mit dem Rad fuhr), empfand ich es nicht einmal als zusätzlichen Zeitaufwand, sondern als willkommene sportliche Betätigung und Ablenkung von meinem sehr anstrengenden, aber ebenso interessanten Beruf als forschender Chemiker und Unternehmer. Und ich las Bücher und Artikel, sprach mit Menschen, die Kraniche schon besser kannten als ich.
Im Frühjahr ist es besonders spannend. Wenn die Kraniche ihr »Zuhause« im eigenen Revier und Brutgebiet gefunden haben, werden die Partner aktiver. Sie balzen, rufen im Duett, stolzieren, tanzen. Die längeren Tage des Frühlings bewirken im Zusammenspiel mit der Balz selbst, dass sich Eier und Spermien entwickeln, bis schließlich beide reif sind und bei der Kopulation vereinigt werden können. Es ist charakteristisch für Kraniche, dass es einer (ziemlich umständlichen) wochenlangen Einstimmung bedarf, um eine fruchtbare Begattung zu erreichen – anderenfalls träfen Spermien auf unvollständig entwickelte Eier, oder wenn die Henne ihre Eier legte, wären sie nicht befruchtet.
Als langjähriger Kranichbetreuer hat man – vorausgesetzt, man scheut die frühe Stunde vor der Dämmerung und das meist lange Warten nicht – oft die Gelegenheit, Balztänze und Kopulationen zu beobachten. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich gesehen habe, doch ich konnte sicherlich jedes »unserer« Paare mehrfach beobachten.
In vielen Fällen, aber nicht immer, wird die Begattung durch einen Balztanz eingeleitet. Die beiden Kraniche umschreiten sich langsam, »gemessen«, manchmal erscheint das Weibchen desinteressiert, und das Männchen versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Beim Tanz springen die Vögel einen viertel bis halben Meter hoch (oder sogar einen ganzen!), dann zur Seite und nach vorne. Dabei schlagen sie kräftig, aber nicht hektisch mit den Flügeln, ducken sich ruckartig, erheben wieder den Hals. Eine feststehende Choreographie, ein erblich fixiertes Ritual gibt es nicht. Jedes Paar tanzt jedes Mal anders.
Vor der Eiablage kopulieren die Kraniche häufig, zumeist morgens, nicht lange nach dem Wachwerden. Das ist aufgrund der frühen Stunde das Unangenehme für denjenigen, der sie dabei beobachten möchte. Bislang gewinnt man durch die Umstellung auf Sommerzeit etwas Zeit, und so muss man etwa Mitte April »erst« um drei Uhr nachts aufstehen, wenn man mit etwas Frühstück im Magen mindestens eine Stunde vor den Kranichen da sein und noch Käuze, Tüpfelralle, Bekassinen und Waldschnepfen hören oder vielleicht einen mächtigen Wildschwein-Keiler sehen oder zumindest in der unmittelbaren Nähe hören oder gar riechen will.
Manchmal direkt nach dem ersten Ruf, manchmal eine Stunde danach, mitunter auch ohne vorherigen Duettruf erscheint das Kranichpaar auf der bevorzugten Tanzfläche (bis auf Ausnahmen scheinen sie immer auf der gleichen, meist besonders schwer einsehbaren Fläche zu balzen). Die beiden Partner schreiten umeinander herum, tanzen. Das kann sich lange hinziehen oder auch nur ein paar Minuten dauern. Schließlich springt das Männchen von hinten auf das Weibchen, sitzt rittlings auf seiner Partnerin, hält sich irgendwie mit den Krallen an den Flügelansätzen des Weibchens fest und begattet es innerhalb weniger Sekunden unter Flügelschlagen (um nicht herunterzufallen).10 Dabei kann man Laute hören, die wie ein Ächzen oder Stöhnen klingen – dies aber nur, wenn man wie ich die Möglichkeit hatte, rechtzeitig vor den Kranichen vor Ort zu sein und nah am Balzplatz geduldig zu warten. Nach der Kopulation springt der Hahn über den Kopf der Henne ab. Oft ist danach sofort Schluss, das Weibchen ordnet sein Gefieder, und beide Partner gehen umher und suchen Futter. Manchmal lassen sie noch einen schmetternden Duettruf erschallen.
Eines Morgens während meiner einwöchigen Schicht als Kranichbewacher erlebte ich die schönste Balz meiner »Laufbahn«. Ich war in tiefer Dunkelheit zu einem Revier geradelt und von dort weiter ins Gebiet gegangen, hatte mitten im Kranichrevier einen kleinen Hochsitz erklommen, von wo aus ich feststellen wollte, ob ein Kranichpaar, das ich »Die Schlitzohren« nannte (warum, verrate ich später), seine Brut vorbereitete und balzte, oder ob ein zehn Tage zuvor abgebrochener Brutversuch diese Saison zu einem Fehlschlag für das Paar machen würde.
Es war Regen vorhergesagt, aber als ich vom Forstbetriebshof (wo wir mitten im Brook übernachteten) mit dem Fahrrad losfuhr, tröpfelte es nur. Als ich meinen Hochsitz erreichte, war es windig und noch dunkel. Ich hörte eine Tüpfelralle rufen und zwei Bekassinen ihre Revierflüge machen, bei denen sie mit den Schwanzfedern charakteristische Laute erzeugen; man könnte meinen, die Bekassinen »rufen«, aber nein: ihre Schwanzfedern vibrieren und erzeugen diese Töne.