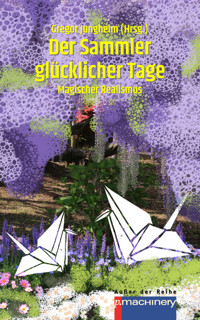
Der Sammler glücklicher Tage E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wollten Sie nicht schon immer Geschichten lesen, die das Beste aus zwei Welten vereinen? Erzählungen, die sich den Problemen unserer Zeit widmen, wie Belletristik es tut. Und Storys, die uns über die engen Grenzen der Realität hinaustragen. So wie es Fantasy vermag. Seit Mitte der 2010er-Jahre sind etliche Romane und Novellen erschienen, denen beides gelungen ist und die eine zweite Welle des Magischen Realismus' ausgelöst haben. In der kurzen Form gab es dagegen bislang kaum Beiträge. Deshalb freuen wir uns, die erste deutschsprachige Anthologie mit vierundzwanzig magisch-realistischen Erzählungen zu präsentieren. Es erwarten Sie Geschichten über imaginäre Freunde, Mobbing, Migration, Chauvinismus, Kapitalismuskritik, Pazifismus, Angststörungen, Demenz, Trauer, die unkontrollierte Macht von Influencern, christlichen Fundamentalismus und vieles mehr. Immer unterlegt mit einer feinen Prise Fantastik, die es ermöglicht, über all dies mit großer Leichtigkeit zu erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gregor Jungheim (Hrsg.)
Der Sammler glücklicher Tage
Magischer Realismus
Außer der Reihe 105
Gregor Jungheim (Hrsg.)
DER SAMMLER GLÜCKLICHER TAGE
Magischer Realismus
Außer der Reihe 105
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2025
p.machinery Michael Haitel
Die Urheberrechtsinhaber behalten sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
Titelbild: Gabriele Behrend
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 475 5
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 682 7
Gregor Jungheim: Das Beste aus beiden Welten
Sieht die Buchhandlung an Ihrem Wohnort auch so aus? Auf der einen Seite ein Regal mit Buchrücken in gedeckten Farben und konventionellen Schriftarten, wo die Belletristik zu finden ist. Und auf der anderen Seite des Raums dann ein oft deutlich kleineres Regal, wo die Buchrücken kunterbunte Farben haben und die Schrift viele Verzierungen und das die Bezeichnung »Fantasy« trägt. Wie schön wäre es doch, wenn die Geschichten aus beiden Buchregalen nachts nach Geschäftsschluss die Nähe der anderen Seite suchen würden, einen Reigen eingingen, einander befruchteten und das Beste aus zwei Welten vereinten.
In der Literaturgeschichte ist so etwas schon einmal geschehen. Lateinamerikanische Autoren wie Arturo Uslar Pietri, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier und natürlich Gabriel García Márquez brachten ab Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts Werke hervor, in denen sich die Mythen aus vorkolonialer Zeit ganz selbstverständlich mit Ereignissen aus der jüngeren Geschichte ihres Landes vermischten. Magischer Realismus nannte man dieses Genre, zu dem später auch der Weltbestseller Das Geisterhaus von Isabel Allende gezählt wurde.
Gegenwärtig scheint sich dies zu wiederholen: Ab Mitte der 2010er-Jahre sind auffallend viele Bücher erschienen, die sich über weite Strecken wie Gegenwartsliteratur lesen, aber auch einen Hauch von Fantastik enthalten. Und die Menschen dahinter stammen tatsächlich aus beiden Welten.
Da gibt es einerseits Belletristik-Autorinnen wie Fatma Aydemir, Mariana Leky oder Melanie Raabe, die ihre Romane mit kleinen fantastischen Elementen anreichern. Andererseits haben Fantasy-Autoren wie Jay Kay oder Kai Meyer die fantastischen Elemente in einigen ihrer Bücher einfach mal stark heruntergefahren.
Die Ergebnisse dieser zweiten Welle des Magischen Realismus sind sich erstaunlich ähnlich und – gerade weil wir solche Werke noch nicht in Massenproduktion vorfinden – meist von erlesener Qualität. Ratlos sind nur viele Verlage, die nicht wissen, welcher Zielgruppe sie diese Bücher anbieten sollen und im Klappentext oft ganz auf die Erwähnung der fantastischen Elemente verzichten.
Klingt toll, gab es aber bislang hauptsächlich in Form von Romanen und Novellen. Wer speziell nach magisch-realistischen Kurzgeschichten in deutscher Sprache Ausschau hielt, musste sich mit einer Handvoll Veröffentlichungen begnügen.
Die Ausschreibung für diese Anthologie im Oktober 2023 war deshalb auch der Versuch, das Angebot an derartigem Lesestoff deutlich zu erhöhen. Die Resonanz war überwältigend. Insgesamt hundertfünfundfünfzig Einsendungen erreichten uns aus ganz Mitteleuropa. Es schien, als hätten viele Literaturschaffende schon länger auf die Gelegenheit gewartet, endlich einmal Erzählungen mit nur minimalen fantastischen Elementen veröffentlichen zu können. Und auch diesmal fanden Menschen aus Belletristik und Fantastik bei einem gemeinsamen Projekt zueinander.
Die Qualität der Texte ist auf einem so hohen Niveau, dass selbst eine strenge Auswahl der besten Erzählungen eine Veröffentlichung in zwei Bänden erforderlich macht. So können wir zumindest vierzig Einreichungen aus diesem Projekt ein Forum bieten.
In dem hier vorliegenden ersten Band sind jene Geschichten versammelt, denen es auf vortreffliche Weise gelungen ist, Themen unserer Zeit zu bearbeiten und/oder die erzählerischen Möglichkeiten des Genres auszuschöpfen. Der Folgeband wird im Jahr 2026 mit etwas anderer Schwerpunktsetzung erscheinen.
Alle Texte dieses Buches zeichnet eine Tugend aus, die ich in vielen Veröffentlichungen aus der zeitgenössischen Fantastik schmerzlich vermisse: Sie haben Mut. Den Mut, für ihre Ideen ungewöhnlichen Darstellungsformen zu wählen. Und den Mut, heiße Eisen anzupacken. So finden sich in den vierundzwanzig Geschichten Auseinandersetzungen mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Kindererziehung, Mobbing, Migration, Chauvinismus, Kapitalismuskritik, Pazifismus, Angststörungen, Demenz, Trauer, die unkontrollierte Macht von Influencern, christlichem Fundamentalismus und vielem mehr. Die fantastischen Elemente machen es wiederum möglich, hierüber mit großer Leichtigkeit zu erzählen.
Auch zeigen die ausgewählten Texte, welche große Bandbreite an erzählerischen Möglichkeiten die zweite Welle des Magischen Realismus zu bieten hat. Einige Teilnehmende verleihen ihren Geschichten ein einzelnes fantastisches Element und setzen dieses konsequent ein (z. B. »Schlüsselkind« und »Lehm unter den Nägeln«). Andere belassen es bei winzigen, wie mit dem Rasiermesser gezogenen Rissen in der Realität (z. B. »Fortfahren« und »Wer bin ich?«). Wieder andere entführen uns in surrealistische Szenarien (z. B. »Der Architekt« und »Leben mit Harrods«) oder präsentieren Welten, die der unseren sehr ähnlich sind und alle ihre Probleme teilen (z. B. »Das Dienstsiegel« und »Dazwischen reden andere«). Einige Geschichten lassen es auch ganz offen, ob sie nun ein fantastisches Element enthalten oder nicht (z. B. »Der magische Kugelschreiber« und »Bin ich von allen bösen Spindeln gestochen?«). Manche Erzählungen ziehen sogar ihre Spannung daraus, wann das fantastische Element auftaucht (z. B. »Das Fass« und »Elusive as Magic«). Und dann ist da noch Juan Tramontinas auf Kuba angesiedelte Geschichte »Die alte Ceiba«, die eine Brücke zu den alten Meistern des Magischen Realismus spannt.
Ebenfalls freut es mich, Ihnen mit diesem Band auch einen Eindruck zu verschaffen, welche neuen Talente in der Fantastik-Szene heranwachsen. So sind mit Lukas Beckmann, Clara Dobbelstein und Ella Dombrowski drei Personen aus der Generation Z vertreten. Emmy Herzig, die jüngste Autorin dieser Sammlung, war bei Einreichung ihres Textes sogar erst siebzehn Jahre alt und beeindruckte uns mit einer der besten Geschichten der Anthologie.
Ich hoffe, dass Sie nach dieser wortgewaltigen Anmoderation nun voller Spannung umblättern werden, um endlich zu den vierundzwanzig Erzählungen zu gelangen. Falls Sie nicht wissen, wo Sie starten sollen, beginnen Sie mit Rebecca Bauers »Ein bisschen Magie«. Die Geschichte ist ein wunderbarer Opener, vermittelt sehr gut, was den Reiz des Magischem Realismus ausmacht und stimmt Sie auf die nachfolgenden Erzählungen ein. Anschließend haben Sie die freie Auswahl. Ich versichere Ihnen: Jeder dieser Beiträge ist lesenswert – sonst wäre er angesichts der starken Konkurrenz durchs Raster gefallen.
Im Namen aller Teilnehmenden
Gregor Jungheim
im Oktober 2025
Rebecca Bauer: Ein bisschen Magie
»Flicken Sie auch Teppiche?«
Die Frau sprach so schleppend und undeutlich Hindi, dass Benisha ohne hochzuschauen wusste, dass wohl wieder eine Touristin ihre Mittagspause störte.
»Geschlossen.«
Benisha wedelte vom Schatten des Sonnenschirms aus in Richtung ihrer Ladentür, an der die Öffnungszeiten standen. Sie hatte sich erst vor wenigen Minuten in den Plastikstuhl fallen lassen und ihre schmerzenden Beine hochgelegt, um durch das offene Fenster die neueste Folge ihrer Lieblingssoap zu schauen. Blechern schallte die Zusammenfassung nach draußen, wie Anya in der Nacht vor ihrer Hochzeit von ihrer eifersüchtigen Zwillingsschwester angelogen worden war, dass ihr Verlobter Abdel sie mit ihrer besten Freundin Maha, einer Muslima, hinterging.
Natürlich würden Anya und Abdel wieder zueinanderfinden. Und es gäbe einen Tanz. Aber gerade weil Benisha wusste, was passieren würde, wollte sie es sehen. Das hatte sie sich nach fünf Staffeln verdient.
Die Luft stand diesen Sommer schlimmer denn je in Sitamarhi. Klimawandel, sagten all die Nachrichtensprecher und Politiker, und in den Talkshows diskutierten sie über Smog und Energie und Lösungen und die Zukunft und eins Komma fünf oder zwei Grad. Aber das war nicht Benishas Welt. Sie musste einfach mit der Hitze leben. Und das bedeutete, mittags zu ruhen und eine Zigarette unter dem Sonnenschirm zu rauchen und keine weitere Minute zwischen all den Brautkleidern und Saris zu verbringen.
Weiß.
Bald sähen sie alle aus wie die Araber am Roten Meer. Immer weniger ihrer Kundinnen wollten farbige Stoffe, weil man darin im eigenen Schweiß ertrank.
»Wann öffnen Sie denn wieder?«
»Später.«
»Dann warte ich. Die Schneiderinnen auf dem Markt haben mich extra zu Ihnen geschickt, weil Sie Wunder bewirken können mit Ihren Fingern.«
Benisha schaute scharf hoch, während sich Abdel und Anya inmitten von Delhi stritten und die Autos um sie herumfuhren und hupten. Anya war in der vorigen Folge weggerannt, nachdem sie Abdel das Verlobungsgeschenk, die Kette seiner Großmutter, ins Gesicht geworfen hatte.
Vor ihr stand eine Europäerin. Hochgewachsen und hochmütig genug, das gelbe Tuch nur lose um ihren Kopf zu wickeln. Ihr Gesicht war von der Sonne so rot gebrannt wie ihre Haare. Die Europäerin hielt einen eng gerollten Perserteppich unter dem Arm. Er war fast so groß wie sie, sodass ein Ende am Boden schleifte. Benisha nahm einen Zug von ihrer Zigarette und blies ihn in den Himmel. Nur Flugzeuge zerkratzten das strahlend drückende Blau über ihnen.
So viele Menschen, die kommen und gingen, und immer in Eile. Immer schneller und höher und mehr. Dabei drehten sie sich alle doch eh bloß im Kreis.
»Gehen Sie weiter. Sie müssen bettelarm oder nicht richtig im Kopf sein, wenn die Schneiderinnen am Markt Sie abgewiesen haben.«
»Ein bisschen von beidem, werte Dame.«
Werte Dame. Aus welchem Touristenführer die das wieder hatte. So sprach doch keiner mehr heutzutage.
Die Europäerin begann ungefragt, ihren Teppich auf dem kleinen weißen Plastiktisch vor Benisha auszubreiten. Mit einem Fluch rettete sie ihren Aschenbecher, der beinahe abgestürzt wäre.
»Ich bin wirklich nicht an Ihrem Teppich interessiert.« Benisha drehte sich mit dem Aschenbecher in der Hand zum Ladenfenster. Abdel hatte Anya am Handgelenk festgehalten, damit sie nicht wegrannte und für immer aus seinem Leben verschwand. Gleich würde er um ihre Liebe tanzen.
»Ein Blick nur. Bitte.«
»Ich arbeite nicht umsonst«, sagte Benisha, »deshalb habe ich einen Laden und die Weiber am Markt nur einen Stand. Unter sechshundert Rupien hebe ich keinen Finger. Erst Geld, dann der Teppich.«
»Ich bin schon so lange unterwegs, so viel habe ich nicht mehr. Kann ich stattdessen für Sie arbeiten oder …«
»Kommen Sie wieder, wenn Sie das Geld haben.«
Benisha kannte Europäer; als ob jemand wie die nicht genug Rupien besäße, um sich ein Essen bei McDonald’s zu leisten und ein Bier. Wahrscheinlich hatte sie die zehnfache Summe in ihrer Hosentasche.
Im Fernseher drehten sich gerade Abdel und Anya umeinander wie Balletttänzer. Abdel versuchte, Anya an seine Brust zu ziehen, sie stieß ihn aber wieder und wieder von sich. Dann, endlich – sie fielen in eine Umarmung. Seine Worte hatten ihr Herz erreicht.
»Was aber, wenn mein Teppich nicht warten kann, bis ich das Geld zusammenhabe? Bitte! Schauen Sie sich den Riss zumindest an.«
Die Frau erinnerte Benisha an eine nervtötende Fliege, die sie bloß mit der Klatsche erschlagen wollte. Sie schaute vom Fernseher auf, um etwas Bissiges zu erwidern, als …
Ihr Blick blieb an dem Teppich haften.
Einst mochte der Perser Unsummen wert gewesen sein, aber alles, was Benisha nun sah, waren die ausgefransten Enden, wo die Naht aufgebrochen war. Die gewebten Stofffäden brachen auseinander, und der Spalt hatte schon fünf Zentimeter.
Prasseln von Feuerwerk.
Benisha schaute zum Fernseher, wo die zuvor hupenden Autofahrer ausstiegen und mit dem Paar tanzten und feierten. Irgendwer warf Farbbomben wie an Holi in die Luft; und natürlich zog sich ein Feuerwerk über den Himmel, während Abdel vor Anya erneut auf die Knie ging und ihr zum zweiten Mal die Kette seiner Großmutter überreichte.
Benisha wollte das sehen.
Das Leben war einfach zu kurz, um auf Wiederholungen zu warten.
»Ich mache Ihnen ein Sonderangebot. Sechshundert Rupien für einen neuen Teppich, wenn Sie mich das in Ruhe zu Ende schauen lassen.«
»Aber ich brauche diesen hier!«
Benisha hob eine Augenbraue. »Ich habe allein fünf im Lager, die so aussehen wie der.«
Minus den Fransen und dem Riss und den Altersflecken.
»Die würden mich aber noch weniger tragen als der hier.«
Tragen.
»Entschuldigen Sie, Miss. Ich habe Sie nicht recht verstanden.«
»Sie müssen meinen Teppich reparieren.« Die Europäerin ergriff ungefragt Benishas Hand und presste sie zwischen ihre Finger. So beteten die drüben auf dem Kontinent. Das hatte Benisha im Fernsehen gesehen. »Er hat kaum noch die Kraft, um mich zu tragen. Bald wird er mitten in der Luft zerreißen.«
Opferte sie wirklich ihre Lieblingsserie für diesen Müll? Zumindest war die Europäerin eine gute Schauspielerin. Beinahe hätte sie ihr abgekauft, eine echte Kundin zu sein.
»Ach, das hätten Sie gleich sagen sollen. Ich spreche einfach meinen Zauberspruch für fliegende Teppiche, und morgen ist er wieder so gut wie neu.«
Benisha widmete sich wieder Abdel und Anya, die von einem Taxifahrer zu ihren wartenden Hochzeitsgästen gefahren wurden.
»Sie glauben nicht an Magie.« Die Europäerin klang enttäuscht. Sie rollte den Teppich wieder zusammen.
Natürlich nicht. Dafür hatte Benisha zu viele Regierungen kommen und gehen sehen. Zu viel Hunger und weiße Krankenwagen und Feuer, wenn mal wieder ein Hochhaus mit Schneiderinnen brannte. Leute schossen und stachen und ließen andere links am Straßenrand liegen. Die Welt drehte sich und sie alle mit ihr.
Magie war doch bloß der Wunsch, dass eine einzelne Person tatsächlich etwas bewirken könnte, was acht Milliarden Menschen zusammen nicht schafften.
»Ich glaube an die Gesetze der Natur und an Luftwiderstand und Auftrieb. Da drin«, Benisha nickte zum Teppich, »steckt keine Technologie der Amerikaner. An fliegende Untertassen, an die glaube ich. Aber nicht an fliegende Teppiche. Toller Witz, aber. Erzählen Sie Ihren Freunden in Europa davon, wie Sie es mir und meinen Leuten gezeigt haben. Wir sind ja so zurückgeblieben.«
»Das ist das Problem, wissen Sie. Weil selbst in den hintersten Winkeln der Erde die Leute nur noch an das glauben, was sie sehen können, stirbt alle Magie aus, bis mein Teppich irgendwann wirklich nur noch ein Teppich ist.«
Die meinte das ernst.
Langsam dämmerte es Benisha, dass sie nicht auf den Arm genommen wurde. »Schauen Sie sich«, forderte sie forsch mit einem Handwedeln zum Himmel über ihnen. »Wir haben Handys und Fernseher und Flugzeuge. Keine fliegenden Teppiche.«
»Bitte.« Die Europäerin umklammerte ihren Teppich. »Ich bin schon so lange unterwegs, um die Magie wieder in der Welt zu säen. Um den Leuten den Glauben zurückzugeben. Sie müssen ihn reparieren. Bitte!«
Die Europäerin hatte den Teppich zwar zusammengerollt, aber noch immer nicht von Benishas weißem Plastiktisch genommen.
»Bisschen spät, Miss.«
»Für den Teppich?« Die Frau klang den Tränen nahe.
»Für sie.«
Das Einzige, woran die Menschen noch glaubten, waren steigende Aktienkurse. Alles andere ließ sich beweisen. Anfassen und zur Not mit dem Mikroskop sehen wie ein Bakterium und hörbar machen wie der schaurig-traurige Gesang der Wale. In den Leerräumen zwischen den Atomen, die Benisha atmete und aus denen sie bestand und in die sie wieder zerfallen würde, da war trotzdem nicht genug Raum für Magie.
»Dann … ist meine Reise vorbei?«
Die Europäerin schien nicht mit Benisha zu sprechen, so wie sie verloren vor ihrem Laden stand.
Vielleicht war es nur richtig, dass auch die Europäerin ihren Glauben verlor. Aufklärung und Wissenschaft und Fortschritt. Nur das brachte sie als Menschheit voran.
Aber dann waren da trotzdem Hunger und Krieg und Klima.
Vielleicht steckte die Menschheit auch fest in ihrer Gegenwart, eben weil sie nicht mehr glaubte.
Nicht mehr vertraute.
Aber auch das überstieg Benishas Welt. Solche Gedanken verkauften keine Sari, und ohne verkaufte Sari gab es keinen Reis und keine Zigaretten. Und keinen Strom für ihre Lieblingsserie …
Sie hatte den Schluss verpasst.
Ein Nachrichtensprecher ratterte Infos über ein Zugunglück am anderen Ende der Welt hinunter. Ein großes Pharmaunternehmen aus der Hauptstadt hatte Insolvenz angemeldet. Ein Raketentest in Nordkorea.
Nichts Neues zwischen Himmel und Erde, zwischen West und Ost und Nord und Süd. Da war nichts, was sie nicht schon einmal gesehen hatte.
In dem Punkt hatte die Europäerin recht.
Da war kein Funken Magie mehr in dieser Welt.
Vielleicht, weil man heutzutage zu viel sah. Oder vielleicht sah man auch zu wenig bei all den Bildschirmen, auf die man schaute.
Ein bisschen wollte sie daran glauben.
Daran, dass da mehr war.
Benisha legte ihre knochige Hand auf den zusammengerollten Teppich. »Lassen Sie ihn die Nacht über da. Ich schaue, was sich machen lässt.«
Es war nicht ihre beste Arbeit. Selbst auf dem körnigen Bildschirm konnte Benisha die Nahtstellen sehen, wo sie die Fransen des Teppichs zusammengezwungen hatte. Der Dokumentarfilmsprecher hatte etwas ungemein Einschläferndes, so wie er über die Bergsteiger am Everest berichtete. Dann wurde einer der Sherpas interviewt, der sein Brot damit verdiente, Touristen hoch und im besten Falle wieder hinunterzubringen. Irgendwelche amerikanische Tech-Tycoons, die mehr Geld hatten, als sie zum Leben brauchten. Dann würden sie Fotos machen und diese im Internet mit ihren Bekannten teilen. Als Beweis, dass sie dort gewesen waren.
Benisha sprach den nepalesischen Dialekt nur wenig. Sie verstand noch weniger, weil all ihre Aufmerksamkeit auf der jungen Europäerin lag, die sich mit einem Teppich auf den Rücken geschnallt hinter dem Kamerateam den Berg hochkämpfte.
Also trug die Europäerin noch immer ihre Magie in die Welt.
Benisha griff sich die Fernbedienung, und mit einem Zappen wurde der Bildschirm dunkel.
Wie weit die Europäerin wohl schon gekommen war, seitdem sie den Everest bestiegen hatte? Welche Höhen und Tiefen der Welt sie wohl durchschritt, um ihre Magie zu säen?
Benisha würde Ausschau nach ihr halten.
Nach ihrer Magie.
Denn vielleicht … vielleicht war da ja wirklich mehr unter der Sonne, als sie begreifen konnte.
Vielleicht.
Bernd Maile: Ein Satz
Das warme Licht der Straßenlaternen ergoss sich in die schmalen Gassen von Forcalquier.
Er hatte wie jeden Abend noch einmal die Zitadelle besucht, die über der Altstadt thronte. Jetzt schlenderte er die engen Wege hinunter, ohne auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, in welches der verwinkelten Gässchen er gerade einbog.
Wie eine Murmel in einer Kugelbahn suchte er sich instinktiv den Weg hinab zum Haus. Bog, ohne nachzudenken, einmal in die eine Gasse ein, dann wieder in die andere. Alle führten sie bergab, und letztendlich endeten seine Spaziergänge immer auf dem Marktplatz, dem Zentrum des kleinen Städtchens. Dort hatte er sich ein kleines Zimmer genommen, wo er Ruhe und Muse finden wollte, um seinen neuen Roman zu beginnen.
Zu Hause war es ihm nicht möglich gewesen. Die Großstadt mit ihrem Trubel, ihren Vergnügungen und seinen Freunden hatte ihn zu sehr im Griff und lenkte ihn ständig ab.
Hier, in der Region Provence Alpes Côte d’Azur, zwischen dem Montagne de Lure und dem Luberon, schien die Zeit stillzustehen. Und so verlangsamte sich Tag für Tag sein Leben, entspannten sich seine Gedanken, beruhigten sich seine Nerven und verringerte sich der Druck, den er sich allzu oft selbst auferlegte.
Auf dem Weg hinunter zum Marktplatz war nichts zu hören, außer dem Knirschen vereinzelter Steinchen unter seinen Sandalen. Er kramte in seiner Hosentasche nach seinen Zigaretten. Fischte eine aus der Packung heraus und steckte sie an. Rauchend lehnte er sich an eine Hauswand und blickte die Gasse hinunter.
Ein unangenehmer Gedanke drängte sich ihm wieder auf. Wie eine Luftblase, die beim Marmeladekochen langsam nach oben steigt, bahnte sich der Gedanke zäh, aber stetig seinen Weg nach oben.
Er versuchte, ihn zu verdrängen, aber es gelang ihm nicht. In der ganzen Zeit in Forcalquier hatte er noch keine einzige Zeile für seinen Roman geschrieben. Obwohl er wusste, worüber er schreiben wollte, erreichte ihn keine Idee aus den Wäldern zwischen seinen Schläfen, die es wert gewesen wäre, niedergeschrieben zu werden. Keinen einzigen Satz hatte er in seinem Kopf geboren, der es verdient hätte, festgehalten zu werden.
Sein Leben und seine Ansichten hatten sich hier von Tag zu Tag weiter von ihm entfernt. Ähnelten verblichenen Fotografien in einem Fotoalbum, die man mit Befremden ansah und sich zu erinnern suchte.
Ausgeraucht angelte er sich eine neue Zigarette aus der Hosentasche und knickte sie dabei.
»Verdammte Scheiße!«
Nervös fingerte er sie aus der Tasche, um zu sehen, ob sie noch zu retten war. Er brach sie an der eingerissenen Stelle ab und warf das kürzere Stück mit Filter weg. Nachdem er sie angezündet hatte, entspannten sich seine Gedanken wieder.
Besser gestimmt begann er die Gasse nach unten zu marschieren, als sein Blick auf ein stark verstaubtes Schaufenster eines kleinen Ladens fiel. Den hatte er bisher wohl übersehen. Drinnen brannte schwaches Licht. Um diese Zeit noch offen? Das konnte nicht sein. Als er eine Bewegung wahrnahm, war seine Neugier geweckt. Instinktiv schnippte er die Zigarette fort und betrat den Laden, ohne zu wissen, was er anbot, geschweige denn, was er selbst wollte. Sein Eintreten löste ein sanftes, freundliches Bimmeln der Türglocke aus.
»Bonsoir, Monsieur.«
Die alte Dame stand freundlich lächelnd hinter einem uralten, langen und schweren Holztresen. Hinter ihr mäanderte ein wuchtiger Apothekerschrank mit unzähligen Schubladen die Wand bis zur Decke entlang.
»Bonsoir, Madame.«
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Eine gute Frage, er wusste ja nicht mal, in was für einer Art Laden er stand, geschweige denn, was er hier wollte.
Ganz entgegen seiner Art war er eingetreten, ohne zu wissen, was ihn erwartete.
Eigentlich mied er gerne Situationen, die er nicht einschätzen konnte, die ihn unsicher machten. Normalerweise wäre er morgen tagsüber noch einmal hergekommen, hätte sich vielleicht vorher im Café nach dem Laden erkundigt, sich vorbereitet.
Aber er hatte einfach seine Zigarette weggeworfen, ohne sie aufzurauchen – ein Novum – und war in den Laden gestürmt. Nein, war eher hineingezogen worden.
Der Innenraum war dunkler, als er erwartet hatte.
Es war angenehm kühl, roch leicht modrig und holzig. Während er versuchte, seine Augen an das Dämmerlicht zu gewöhnen, stotterte er ein paar hilflose Worte. Er wusste nicht, was er sagen sollte, wollte aber auf jeden Fall seine Unwissenheit verbergen.
Endlich an das Halbdunkel gewöhnt, sah er, wie Madame ihn wohlwollend anblickte. Eigenartigerweise fühlte er sich nicht unwohl, obwohl er sich in dieser schrägen Situation befand. Madame hatte eine beruhigende Wirkung auf ihn, wie der gesamte Laden. Staubig, aber heimelig. Er fühlte sich angenommen.
Madame musterte ihn eingehend.
»Sie suchen etwas, richtig?«
Er wollte seine Unkenntnis nicht preisgeben, also antwortete er: »Richtig, Madame.«
Warum den Dingen nicht einfach mal ihren Lauf lassen und nicht aktiv eingreifen?
UndMadame fuhr fort.
»Natürlich. Jeder, der hier reinkommt, sucht etwas.«
»Und? Findet er es auch?«
»Oh, fast immer. Mal sehen, was ich für Sie tun kann.«
Sie drehte sich um und begann, kleine, große, schwere und quietschende Schubladen zu öffnen, ohne ihr Reden zu unterbrechen.
»Früher lief das Geschäft prächtig, aber es kommen immer weniger Kunden. Die Zeiten ändern sich. Man legt nicht mehr so viel Wert auf schöne Worte, wissen Sie? Heute muss alles schnell schnell gehen. Viel Blabla. Hektik. Stress. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte das nicht kritisieren, aber Beständigkeit ist keine Tugend mehr. Aha! Vielleicht wäre das was für Sie.«
Sie zog eine kleine Papierrolle samt einer roten Kordel mit Schlaufe heraus und entrollte sie.
»Was ist das. – Was – ist das!«
»Wenn Sie es nicht wissen, ich weiß es auch nicht, Madame.«
Sie las es noch einmal vor:
»Was ist das. – Was – ist das.«
Erst jetzt begriff er, dass es keine Frage war. Der Satz stand auf dem Papier. Und sie las ihn vor.
Was nun? Gespannt sah er sie an.
»Ah, Monsieur versteht nicht«, lächelte sie, »es ist der erste Satz aus den Buddenbrooks von Thomas Mann«.
Was sollte er darauf antworten? Die Situation überforderte ihn gerade maßlos.
»Kennen Sie die Buddenbrooks denn nicht? Die Geschichte vom Niedergang einer Familie? Vielleicht sind Sie ja zu jung? Wie ich schon sagte, die Zeiten ändern sich so schnell, was einmal wichtig war, ist morgen schon vergessen, und man ist auch noch stolz darauf und nennt es Fortschritt.«
»Aber ja, Madame, natürlich kenne ich die Buddenbrooks. Und Sie lagern hier den ersten Satz des Romans?«
»Natürlich, wo sollten all’ die Anfangssätze denn sonst lagern?«
»Natürlich, also ich meine, Moment? Was meinen Sie mit all den Anfangssätzen?«
»Hier liegen sämtliche Anfangssätze der Weltliteratur. Aber auch Weisheiten und Sprüche. Deswegen sind Sie doch hier, oder nicht?«
»Doch, doch, deshalb bin ich hier«, log er, ohne dass es in dem Moment, in dem er es aussprach, noch länger eine Lüge war.
Er wusste nicht, wie ihm geschah, ein Laden voller Sätze?
Total abstrus, aber auch aufregend und fantastisch. Er wollte, ja er musste sich selbst davon überzeugen.
»Darf ich?«
Er hatte die Hand schon an einer Schublade des Tresens und zog daran, entnahm eine Papierrolle, öffnete sie und las laut vor.
»Er war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte, und er war jetzt vierundachtzig Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen.«
»Oh, das ist leicht«, erklärte Madame, »Hemingways ›Der alte Mann und das Meer‹«.
»Das ist ja unfassbar«, er konnte nicht widerstehen und griff nach der nächsten Papierrolle, überwältigt von dem Gedanken, dass in jeder Schublade unzählige Sätze schlummerten, die nur darauf warteten, ausgesprochen zu werden.
Sätze, die einen nicht mehr loslassen, ein Leben lang begleiten, die einem weiterhelfen, die ins Poesiealbum geschrieben werden, die Trost spenden oder Freude bereiten, die der Beginn einer abenteuerlichen Reise sein können, die Revolutionen ausgelöst haben und Weltbilder ins Wanken brachten. Ich habe einen Traum. Und sie dreht sich doch. Warum essen Sie dann keinen Kuchen? Give peace a chance.
Er musste sich am Tresen festhalten, um nicht von der Flut der Sätze mitgerissen zu werden. Aus jeder Schublade schienen unzählige Stimmen Worte zu wispern, und das Flüstern schwoll an und erfüllte den Raum.
Madame bemerkte seine Blässe, und sie versuchte ihn mit einem weiteren Satz abzulenken.
»Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.«
»Kafka!«, riefen beide im Chor und lachten herzlich los.
»Oh, das ist so wunderbar, Madame, ich möchte einen Satz kaufen. Ach, was sag’ ich! Alle! Ich möchte alle kaufen!«
Madame betrachtete ihn milde: »Übertreiben Sie nicht! Zu viel des Guten ist nicht besser. Auf die Dosis kommt es an. Sehen Sie, einer meiner Kunden, Monsieur Rossier, kommt jedes Wochenende in meinen Laden, um seiner geliebten Frau einen Satz zu schenken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jede Woche einen Satz voller Liebe. Er selbst konnte die Sätze nicht formen. Er hatte es mit Blumen versucht, schenkte ihr jede Woche einen großen Blumenstrauß. Oh, glauben Sie mir: Die Sträuße waren wunderschön und sie dufteten herrlich, aber sie konnten nicht die Worte wiedergeben, die er für seine Frau empfand. Von der Sehnsucht getrieben, ihr seine Liebe zu erklären, wie es nicht einmal ein Blumenstrauß vermag, fand Monsieur Rossier den Weg in meinen Laden und entdeckte dort die Macht der Worte, ihre Sinnlichkeit und Präzision. Ein ums andere Mal fand er einen passenden Satz seiner Liebe und schenkte ihn seiner Frau.«
»Das ist eine wundervolle Geschichte, zu schön, um wahr zu sein. Zu schön, um sie aufzuschreiben, Madame, wie kann ich Ihnen dafür danken?«
»Indem Sie sie tatsächlich aufschreiben. Mein Laden wird bald der Vergangenheit angehören, aber ihre Geschichte wird davon erzählen. Schreiben Sie, Monsieur. Ich bitte Sie, schreiben Sie darüber!«
»Gerne, noch heute Abend. Aber welche Zitate und Sätze über die Liebe schenkte Monsieur Rossier seiner geliebten Gattin?«
»Das möchte ich Ihnen nicht verraten. Vor allem kaufte er niemals einen bereits verwendeten Satz. Seine Sätze waren rein und weiß und ungelesen. Nur für seine Frau bestimmt.«
»Sie lagern hier ungeschriebene Sätze? Wer hat sie verfasst? Und warum?«
»Sätze sind wie Schmetterlinge. Sie flattern herum und lassen sich für einen kurzen Augenblick nieder. Dann heißt es handeln. Schon meine Vorgänger haben sie aufgeschrieben und gesammelt, und auch ich entdecke immer wieder Sätze, die es wert waren, festgehalten zu werden.«
Sie öffnet eine weitere Schublade und zog eine Papierrolle heraus.
»Wie dieser hier. Betrachten Sie ihn als Geschenk, vielleicht bringt er Ihnen Glück. Und vergessen Sie nicht, über meinen Laden zu schreiben, Monsieur.«
Sie reichte ihm die kleine Papierrolle und komplimentierte ihn sanft, aber bestimmt aus dem Laden.
Er fand kaum Zeit, sich zu bedanken, so schnell hatte Madame die Ladentür hinter ihm verschlossen; und so flog er seinem Apartment entgegen, voller Enthusiasmus und Vorfreude. Auf keinen Fall wollte er den Satz in einer Gasse stehend lesen. Nein, er wollte ihn ganz vorsichtig auspacken und ihn zelebrieren.
Noch nie hatte ihm jemand einen Satz geschenkt.
Er erhob sich erst wieder von seinem Schreibtisch, als er das erste Kapitel seines Romans beendet hatte. Wie es ihm Madame geheißen, hatte er die Geschichte genauso niedergeschrieben, wie sie ihm widerfahren war. Madames Satz hatte ihm dabei den Weg gewiesen.
»Das warme Licht der Straßenlaternen ergoss sich in die schmalen Gassen von Forcalquier.«
Kai Focke: Schlüsselkind
Sie hörte das Gegröle der Kinder schon von Weitem: Alle lachten – bis auf eines, das wie eine heisere Sirene heulte. Ort des Geschehens war der in die kleine Parkanlage integrierte Spielplatz, welcher sich etwa in der Mitte des Fußwegs zwischen Wohnblock und Bushaltestelle befand. Der Hitze zum Trotz beschleunigte sie ihre Schritte. Kurz darauf war die wohl achtjährige Sirene lokalisiert, umringt von einem halben Dutzend Gleichaltriger. Die Kinderschar befand sich neben einer der mächtigen Rosskastanien, die dem Spielplatz gnädig Schatten spendeten.
Vom Schnalzen ihrer Sandaletten aufgeschreckt, nahmen die Kinder flugs Reißaus und hinterließen der jungen Frau ein schluchzendes Häuflein Elend. Aus ihrer Handtasche kramte sie ein Päckchen Papiertaschentücher hervor und befreite – so gut es ging – das puterrote Gesicht von Rotz und Tränen.
»Du bist doch die kleine Lisa Pohl von gegenüber. Warum weinst du denn? Waren die anderen Kinder gemein zu dir?«
Das Mädchen schaute schniefend zu der großen Frau mit den langen, hellblonden Haaren hinauf.
»Franzi … hat meinen Schlüssel … weggenommen … und hochgeworfen«, kam schließlich stoßweise die Antwort, wobei Lisa auf den untersten Ast der Kastanie zeigte. In etwa drei Metern Höhe ragte aus dem Blätterwerk der Teil eines Schlüsselbands hervor.
Die Frau hielt Umschau.
»Wir sind allein«, stellte sie zufrieden fest. Spitzbübisch zwinkernd entledigte sie sich der Sandaletten, raffte ihr ohnehin knappes Sommerkleid und bestieg – äußerst geschickt, jedoch alles andere als damenhaft – den Baum. Sie hangelte sich am untersten Ast entlang, ergriff das Band und landete Sekunden später federnd auf dem Grasboden. Lisa klatschte kichernd in die Hände, als sie ihr – einer Prinzessin gleich – das Band wie eine kostbare Kette um den Hals legte.
»Danke! Wie heißt du eigentlich?«, fragte Lisa.
Die Frau lächelte. »Von meinen vielen Namen gefällt mir Daracha am besten. Das bedeutet von der Eiche. Meine Freunde nennen mich Dara.«
»Darf ich deine Freundin sein, Dara? Und zeigst du mir, wie man so schnell auf einen Baum klettert?«
»Klar, aber jetzt bringe ich dich erst mal nach Hause.«
Als sie gemeinsam den Park verließen, deutete die junge Frau auf Lisas Schlüssel.
»Lassen dich deine Eltern oft allein?«
»Papa ist bei der Stadt angestellt. Er arbeitet immer bis um fünf. Mama denkt sich Mode für Geschäftsleute aus und macht Karriere. Sie muss viel reisen und kommt nur zwei- oder dreimal im Monat heim.«
»Das ist selten.«
»Mama ruft fast jeden Abend an, und wenn sie am Wochenende da ist, machen wir ganz viel zusammen. Dann gehen wir mit Papa in den Zoo oder zum Eislaufen. Aber ich würd’ lieber weniger machen, wenn sie dafür immer da wäre. Am Donnerstag kommt sie wieder.«
»Also übermorgen – da freust du dich doch, oder?«
Die beiden hatten inzwischen das Ende der Straße erreicht. Vis-a-vis des vierstöckigen Mehrfamilienhauses, dessen Dachwohnung Daracha bezogen hatte, befand sich ein frei stehender Bungalow mit Carport. Vor der Haustür angekommen hüllte sich Lisa noch immer in Schweigen, bis plötzlich erneut die Tränen zu kullern begannen.
»Mama wird wütend auf mich sein. Ich hab’ ihre Lieblingsblume totgemacht. Dabei wollte ich nur, dass sie ganz doll blüht, wenn Mama wieder kommt. Ich hab’ sie jeden Tag gegossen. Papa sagt, ich hab’ sie ersäuft.«
Daracha ging in die Knie, ließ Lisa in ein frisches Taschentuch schnäuzen und streichelte ihr beruhigend über den Kopf.
»Dara, du magst doch Pflanzen und kennst dich mit denen aus. Hilfst du mir?«
»Wieso meinst du, dass ich mich mit Pflanzen auskenne?«
»Ich habe dich im Park gesehen. Du bist allein gewesen und hast mit den Bäumen gesprochen.« Das Mädchen schaute schüchtern zu Boden. »Außerdem wachsen Blätter in deinem Haar.«
Daracha umfasste sanft Lisas Schultern und blickte ihr tief in die Augen.
»Du siehst die Blätter in meinem Haar? Hast du jemandem davon erzählt?«
»Nur Mama. Aber sie hat gesagt, ich spinne und habe zu viel Fantasie.«
Ein warmes Lächeln machte sich im Gesicht der jungen Frau breit. »Fantasie ist eines der wenigen Dinge, von denen man nie zu viel haben kann, kleine Lisa.«
»So wie Geld? Papa sagt immer, dass man nie genug Geld haben kann.«
Unwillkürlich schüttelte Daracha den Kopf. »Nein, Geld gehört nicht dazu. Wo ist denn die Lieblingsblume deiner Mama?«
»Papa hat sie auf den Kompost geworfen.«
Beherzt griff Lisa nach Darachas Hand und zog sie auf dem um das Haus herumführenden schmalen Kiesweg zum rückwärtig gelegenen Garten. Dort befand sich, neben einem etwas windschiefen Gewächshaus, die von zwei Fliederbüschen flankierte Kompostkiste.
»Dendrobium nobile – eine Traubenorchidee«, murmelte Daracha, als sie die unter Kartoffelschalen begrabenen Überreste der Pflanze aus dem Kompost zog.
»Woher weißt du so viel über Blumen?«
»Pflanzen sind mein Beruf. Ich bin Botanikerin – und eine Dryade. Aber das bleibt unser Geheimnis!«
»Versprochen!«, sagte Lisa und unterstrich dies mit einem feierlichen Nicken. Dann überlegte sie einen Moment. »Was ist eine Dryade?«
»Ihr Menschen bezeichnet meinesgleichen in eurer Mythologie, also in Geschichten und Märchen, als Baumgeist. Doch das ist nicht ganz richtig: Ich bin kein Geist, sondern der Avatar einer Eiche.«
»Deshalb wachsen Blätter in deinem Haar?«
»Ja, aber die meisten Menschen können sie nicht sehen. Du bist eine Ausnahme, Lisa.
Wahrscheinlich wirst du in deinem Leben noch mehr außergewöhnliche Dinge wahrnehmen, die anderen verborgen bleiben.«
»Ich hätte dich auch als Geist gemocht, Dara. Nur Mama mag dich nicht. Sie hat sich wegen dir mit Papa gestritten, weil er dir nachguckt. Mama sagt, dass du ein Fietchen bist.« Es folgte eine kurze Pause, bevor Lisa, nun deutlich leiser fragte: »Was ist ein Fietchen? Und warum war Mama so wütend? Hat Papa etwas falsch gemacht?«
»Zuerst versprichst du mir, das Wort nicht mehr zu gebrauchen. Ich werde es dir erklären, wenn du älter bist.« Nach einem zustimmenden Nicken fuhr Daracha fort. »Dein Papa hat nichts falsch gemacht. Es ist normal, dass Männer einer Dryade nachschauen.«
»Und warum tun sie das? Weil du größer bist als andere Frauen?«
»Genau – du bist ein kluges Mädchen.«
Während Lisa vor Stolz strahlte, musste sich Daracha abwenden. Sie wusste nicht warum, doch war es ihr stets unangenehm, Menschenkinder anzulügen. Rasch richtete sie ihren Blick auf die Orchidee und befühlte vorsichtig deren Wurzelwerk. Die Essenz des Lebens war kaum noch spürbar; eine Revitalisierung würde viel Energie kosten. Aktuell besaß sie nur geringe Reserven. Fernab ihrer Bäume gab es für Dryaden nur eine Energiequelle; diejenige, welche ihresgleichen einen mehr als zweifelhaften Ruf beschert hatte: körperliche Verschmelzung mit einem Menschen.
Auf der Durchreise oder in Großstädten bereitete dies keine Probleme. Hier musste sie jedoch deutlich vorsichtiger agieren. Kurioserweise war es Lisas Vater gewesen, der sie auf ein unauffälliges Revier aufmerksam gemacht hatte: den hinter der Siedlung beginnenden Trimm-dich-Pfad, der in einen Ausläufer des Odenwalds mündete. Gerade die städtischen Möchtegern-Jogger – zu erkennen an stylish-überteuerten Laufklamotten, dicken Autos und dünner Kondition – erwiesen sich als leichte Fänge. Nicht weit hinter dem Waldparkplatz zweigte ein unscheinbarer Pfad zu einer zerfallenen Grillhütte ab. Die Abgeschiedenheit des Ortes sowie die Unfähigkeit des menschlichen Geistes, die Vereinigung mit einer Dryade zu verarbeiten und zu erinnern, sorgten für die notwendige Diskretion. Daracha empfand es als die größte Ironie ihrer Existenz, dass gerade der intimste Kontakt zugleich den besten Schutz vor menschlicher Entdeckung gewährte. Obwohl sie nicht wählerisch sein durfte, hatte sie sich stets von Lisas Vater ferngehalten. Zumindest in dieser Beziehung besaß seine Frau die richtige Intuition, denn er wäre nach wie vor ein williges Opfer.
Herr Pohl war ihr zum ersten Mal beim Einzug auf der Straße begegnet. Er hatte sich gleich als »Hermann« vorgestellt und begonnen, sie auszufragen. Daracha erklärte ihm damals, dass sie von der Philipps-Universität Marburg aus für ein Projekt der hessischen Forstbetriebe Erhebungen durchführen sollte. Er gab sich äußerst interessiert, doch brauchte sie nicht allzu lange, um festzustellen, dass es ihm weniger um das Projekt, als um die Fortsetzung des Gesprächs ging: Er wusste genauso viel über Mykologie wie sie über Buchhaltung. Auch entdeckte er auffallend schnell, nachdem er sie in den folgenden Tagen öfters in glänzenden Leggings und einem bauchfreien Jogging-Oberteil angetroffen hatte, seine Leidenschaft für den Laufsport.
Ein Zupfen an ihrem Kleid holte Daracha wieder in das Hier und Jetzt zurück, wo große Augen fragend zu ihr hochschauten. »Kannst du die Blume wieder gesund machen?«
»Ich denke schon. Doch dafür muss ich sie mit zu mir nach Hause nehmen.«
Zum Abschied streichelte Daracha dem Mädchen noch einmal über den Kopf. »Sag deiner Mama einen Gruß. Sie kann die Orchidee am Freitag bei mir abholen. Und denk an unser Geheimnis«, fügte sie verschwörerisch zwinkernd hinzu.
In ihrer Dachwohnung angekommen, wickelte sie die Orchidee in ein feuchtes Tuch ein. Danach duschte sie, zog Sport-Shorts, Laufschuhe sowie ihr Teilnehmer-Shirt vom letzten Halbmarathon an, und verließ das Haus in Richtung Trimm-dich-Pfad.
Beim Überqueren des Waldparkplatzes musste Daracha an den von ihresgleichen mehr als einmal erhaltenen Rat denken, sich nicht in die Belange der Menschen einzumischen: Lebe von ihnen, nicht mit ihnen! Nüchtern betrachtet war es purer Wahnsinn, die Tarnung für das Gefühlsleben eines kleinen Mädchens zu riskieren.
Ein untersetzter Mittvierziger im hautengen Sprintanzug, der gerade aus einem Zweisitzer-Cabriolet ausgestiegen war, musterte sie beim Vorbeilaufen mehr als ausgiebig. Das Opfer setzte sich – ebenso willig wie unwissend – in Bewegung und begann, langsam den Abstand zu ihr zu verringern. Ein Grinsen machte sich im Gesicht der Dryade breit: Dann bin ich wohl wahnsinnig!
Die junge Frau, die soeben die Wohnungstür geöffnete hatte, war schlank, sportlich und auch ungeschminkt äußerst attraktiv. Ihr offenes Haar fiel bis zu den Hüften glatt herab. Viola Pohl schätze sie auf Ende zwanzig und musste – ungeachtet aller Antipathie – gestehen, dass ihr zweifellos eine Karriere als Modell offenstand. Einzig die Größe wäre problematisch: Obwohl barfuß überragte sie ihr nicht gerade kleines Gegenüber um fast einen Kopf. Die freizügige Garderobe der jungen Dame veranlasste die moralisch gefestigte Modedesignerin zu einem tiefen Atemzug: Neben Hotpants trug sie lediglich ein knapp geschnittenes Top ohne BH, was auch die sommerlichen Temperaturen nicht entschuldigen konnten. Selbstzufrieden sah sie sich auf ganzer Linie bestätigt: Hermann zurechtzuweisen war berechtigt gewesen, denn diese Frau personifizierte den Archetyp eines Flittchens.
»Guten Tag, mein Name ist Pohl«, flötete sie mit einem mehr als übertriebenen Lächeln. »Ich bin Lisas Mutter.«
»Damira Wagner. Einen Moment bitte, ich hole die Orchidee.«
Daracha verschwand im Nebenraum und gab damit den Blick auf das kleine Wohnzimmer des Dachgeschoss-Apartments frei. Während der Fußboden mit Umzugskartons zugestellt war, stapelten sich auf den wenigen Möbelstücken – einem Schreibtisch nebst Bürostuhl, einer schmalen Couch sowie einem Sideboard – Bücher, Zettel und Aktenordner; darüber hinaus verbliebene Freiflächen wurden von unterschiedlich hohen Wäschehaufen okkupiert. Eine nähere Untersuchung verbat sich jedoch, denn Daracha kehrte bereits aus dem Nebenraum zurück.
»Sie ziehen um?«, fragte Frau Pohl, auf einen der Kartons deutend. Der Versuch, ihre Freude darüber zu verbergen, scheiterte kläglich, was sich die Angesprochene allerdings nicht anmerken ließ.
»Mein Forschungsprojekt ist hier beendet. Morgen geht es zurück nach Marburg.«
»Ein Forschungsprojekt? Interessant! Lisa hatte erwähnt, dass sie Botanikerin sind. Sicher ein spannender, wenn auch nicht gerade einträglicher Beruf. Nein, das ist wirklich schade! Jetzt, wo Sie dabei waren, sich bei uns so richtig einzuleben. Ach, und meine Kleine hat Sie ja völlig ins Herz geschlossen …«
Ein dezentes Räuspern lenkte Frau Pohls Aufmerksamkeit auf die Orchidee. Der Wortschwall versiegte augenblicklich, denn als sie die Pflanze das letzte Mal auf der heimischen Blumenbank hatte stehen sehen, besaß diese ganze fünf Knospen. Lisas Bewässerungsaktion hatte, so der Bericht ihres Mannes, zu einem Totalausfall geführt. Doch nun reckten sich ihr mindestens drei Dutzend prächtig entwickelte Blüten entgegen. Ihr war nicht klar warum, doch hegte sie keinen Zweifel daran, dass dies tatsächlich ihre Orchidee war.
»Für die Revitalisierung« – Daracha betonte das Wort in einer Strenge, die deutlich machte, dass sie den Vorgang nicht erklären würde – »war es fast zu spät.« Als sie die Pflanze überreichte, trafen sich die Blicke der beiden – und Frau Pohl hatte das Gefühl, in den saphirblauen Augen der Frau wie in einem Bergsee zu versinken.
»Zu viel Wasser ist für eine Orchidee genauso tödlich wie zu wenig«, erklang ihre Stimme, wie von einem weit entfernten Ort. »Die Bedürfnisse eines Lebewesens müssen beständig gestillt werden: Eine Überdosis gleicht fehlende regelmäßige Fürsorge nicht aus. Das betrifft auch die Wochenenden mit den anderen Orchideen in Ihrem Leben. Für die zwei ist es noch nicht zu spät. Sie verstehen, was ich meine?«
Es dauerte eine Weile, bis Frau Pohl sich vom Blick der Dryade lösen konnte. Mit der Pflanze in den Händen und ohne ein weiteres Wort – denn mehr als ein verlegenes Nicken war ihr nicht möglich gewesen – verließ sie das Apartment. Auf dem Weg zum Bungalow kreisten ihre Gedanken um Tochter und Ehemann.
Sie hatte verstanden.
Emanuel Memminger: Königin für ein Jahr
Sophia schließt die Augen. In einer fließenden Bewegung hebt sie ihre Hände über den schweren steinernen Krug. In diesem Moment höchster Konzentration erfüllt sie ein eigenartiges Gefühl der Ruhe. Farbe, Duft, Textur und Geschmack bauen sich vor ihrem inneren Auge auf und fügen sich zu einem größeren Ganzen zusammen, das für einen Moment nur in ihrem Kopf existiert. Dann nimmt die Idee Gestalt an, das Werk ist vollbracht. Erschöpft lässt Anna ihre Hände sinken und murmelt, mehr um der Form Genüge zu tun, ein kurzes Dankgebet.
Seit bald fünf Jahrhunderten ist das, was allgemein die Gabe genannt wird, nur noch bei jungen Frauen aufgetreten. Unter den Männern ist die Fähigkeit, welche doch einst einer der ihren in die Welt gebracht hat, langsam aber stetig versiegt. Von da an mussten sie im Schweiße ihres Angesichts mühsam erarbeiten, was Sophia und ihren Schwestern im Geiste noch immer auf geheimnisvolle Weise geschenkt wurde.
Doch längst hatten die selbst ernannten Herren der Schöpfung einen Weg gefunden, sich das verlorene Terrain zurückzuerobern: Nur was du mit deiner Hände Arbeit geschaffen hast, nur das Vergnügen, dem der Schmerz und das Leiden vorausgegangen ist, erfüllt die wahre Bestimmung des Menschseins. So wird es seither mit lauter Stimme von den Kanzeln und Kathedern des Landes verkündet, auch wenn längst gewaltige Maschinen und chemische Substanzen den Anbau so stark verändert haben, dass er mit der schweißtreibenden Arbeit ihrer Vorfahren kaum mehr etwas zu tun hat.
Die Schöpfung mithilfe der Gabe jedoch, die Kunst der Frauen, die noch immer blüht, ist längst zur reinen Folklore degradiert worden. Ihre Kreationen werden nur noch an wenigen Hochfesten von der Männerwelt rituell bewertet und verkostet, während eine staunende Menge das Ereignis begafft. Im Alltag jedoch gelten sie als minderwertige Produkte, die weder zum Konsum noch zum ernsthaften Wettbewerb zugelassen sind. Die Männer wissen bei all dem sehr genau, dass das, was durch die Gabe entsteht, ihre Erzeugnisse bei Weitem in den Schatten stellt. Doch sie haben es über die Jahrhunderte geschafft, die Gabe zu domestizieren, zum rein religiösen Vollzug zu erklären und so aus der Welt des Alltäglichen auszuschließen.
Sophia öffnet die schweren Fensterläden und lässt die Sonne durch die kleine Luke in den kühlen Kellerraum ein. Bedächtig nimmt sie ein Glas aus dem Regal neben ihr, taucht es in den Steinkrug und hält den Inhalt prüfend ins einfallende Sonnenlicht. Mit Genugtuung betrachtet sie die helle, ziegelrote Farbe, während sie die Flüssigkeit sanft im Glas schwenkt, um eine optimale Sauerstoffdurchmischung zu erhalten. Daraufhin hebt sie das Glas an ihre Nase und zieht den Duft genüsslich ein. Sie riecht reife Kirschen und einen Hauch von Brombeeren. Mit einem zufriedenen Seufzen lässt sie den Kopf nach hinten in den Nacken fallen, sodass die einfallenden Sonnenstrahlen ihre Stirn wohlig erwärmen.
Was sie mit ihren Gedanken geformt hat, ist nun in den Krug gebannt. Die Aufgabe, die sie sich gestellt hat, ist mehr als heikel, doch es scheint, als hätte sie ihr Ziel erreicht. Sie hebt das Glas an den Mund, nimmt einen tiefen Zug und lässt den Wein über ihre Zunge rinnen. Zu den fruchtigen Aromen mischen sich nun holzige Noten und ein Hauch von Zimt. Das soll mir mal einer nachmachen. Zufrieden lässt sie den Wein ihre Kehle hinunterrinnen. Doch im nächsten Augenblick schleudert sie das Glas wutentbrannt an die Kellerwand, wo es in tausend Stücke zerspringt und einen hässlichen, roten Fleck zurücklässt. Das Schandmal ihres Versagens.
»Der Abgang ist immer der schwerste Teil der Wandlung. Es hätte ja auch nicht gleich Spätburgunder sein müssen.« Die gut gemeinten Worte sind mit einem tröstenden Emoji garniert. Sophia starrt auf das Display ihres Smartphones und kocht vor Wut. Stephanie hat leicht reden, ihre Gabe ist seit zwei Jahren versiegt. Sie muss sich nicht mehr dem Konkurrenzkampf stellen, der jedes Jahr von Neuem unter den Frauen der Weinstraße ausbricht. Und überhaupt, was hatte sie schon erreicht? Den Einzug ins Finale hatte Stephanie jedenfalls nie geschafft.
Irgendwoher weiß Sophia ganz genau, dass ihre Vorwürfe unfair sind. Ihre Schwester meint es nur gut. Doch Sophia ahnt, dass sie nur eine Chance im diesjährigen Wettbewerb hat, wenn sie sich an diese schwierige, geradezu mimosenhafte Traubensorte heranwagt. Auch die Männer scheitern immer wieder bei der Kelterung dieser heiklen Sorte. »Der Spätburgunder verzeiht dir nichts, egal ob du die Gabe hast, oder nicht.« Doch die tröstenden Worte, die ihr die Schwester aus der Ferne zusendet, verfehlen ihre Wirkung nicht völlig. Erst jetzt bemerkt Sophia, wie kalt es hier im Keller ist. Wir Schwestern dürfen uns durch diesen Wettbewerb nicht auseinanderbringen lassen, durchfährt es sie. Die Krone für ein Jahr ist das Einzige, was uns Frauen noch geblieben ist. Sollten sie sich dieser etwa verweigern? Dann hätten sie gar nichts mehr. Oder würden sie nicht vielmehr alles gewinnen? Schnell schiebt Sophia den ketzerischen Gedanken beiseite.
Die Tage ziehen ins Land. Fehlversuche reihen sich an halbwegs zufriedenstellende Ergebnisse. Bei der lokalen Vorausscheidung lässt Sophia ihre Gegnerinnen weit hinter sich. Doch wirkliche Freude will sich angesichts ihrer deutlichen Siege nicht einstellen. Erschöpft und zugleich verunsichert blickt sie dem Tag der Entscheidung entgegen, dem alljährlichen Erntefest, an dem aus den vielen Prinzessinnen die eine Königin der Weinstraße erkoren wird, welche darauf für ein Jahr als Repräsentantin des ganzen Anbaugebietes walten darf. Das Tal der magischen Königinnen – unter diesem Namen ist die Gegend weltweit bekannt, und zum alljährlichen Weinfest fällt jeweils ein Heer von sensationshungrigen Touristen in das beschauliche Tal ein, um die großen Wunder zu sehen und zu schmecken, die sich hier noch immer wie zu biblischen Zeiten ereignen.
Die wogende Masse der Schaulustigen beginnt zu brodeln, als die Jungwinzer schnaufend und stöhnend unter dem Gedröhne der vereinigten Blaskapellen die schweren Steinkrüge auf die mit üppiger Blumendekoration bekränzte Bühne schleppen. Die Sonne brennt selbst an diesem Herbsttag erbarmungslos auf den Platz, dessen wenige schattige Ecken bereits vor Sonnenaufgang durch erfahrene Festbesucher okkupiert wurden.
Sophia, die sich zusammen mit den anderen Prinzessinnen am hinteren Bühnenrand aufgestellt hat, bemerkt angewidert, wie ihr Schweißperlen über das Gesicht und das üppig zu Schau gestellte Dekolleté rinnen. Wie alle anderen Prinzessinnen hat sie sich frühmorgens in die eng geschnürte Tracht ihres jeweiligen Dorfes gezwängt und muss nun auf diese Weise ihre sogenannte blühende Jugend der Menge zur Schau stellen. Manche ihrer Konkurrentinnen scheinen die Blicke der männlichen Zuschauer, die sich an ihren Körperrundungen weiden, geradewegs zu genießen. Als sei ihnen auf diese Weise eine Form von Macht über die hormongesteuerten jungen Herren des Tals gegeben, welche am heutigen Tag zu reinen Zuschauern degradiert werden. Doch für Sophia stellt dieser Kleiderzwang nur eine weitere Demütigung dar, die den begabten Frauen bei der Ausübung ihrer Kunst aufgezwungen wurde.
Der Vorsitzende der Winzergenossenschaft betritt nun die Bühne und hebt beschwichtigend die Hände. Nur widerwillig beginnt sich die Masse zu beruhigen und schweigt erst, als der Redner den Abbruch der Zeremonie androht, sollte sie nicht in absoluter Stille durchgeführt werden können. Nach ein paar nichtssagenden, einführenden Worten überlässt er das Rednerpult dem Pfarrer der Marktgemeinde. Mit gravitätischer Würde öffnet dieser seine Bibel und liest mit fester Stimme die Worte aus dem Johannesevangelium, welche das Wunder, dass die versammelte Masse nun herbeisehnt, begründen sollen.
»Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.« Vertraute Worte, die Sophia zugleich fremd bleiben, ja sie geradezu anwidern. »Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?«, blafft Jesus in der Geschichte seine Mutter an. Wer ist dieser Mann, dass er so mit seiner Mutter umgeht? Selbst im Heiligen Buch scheinen die Frauen ein weiteres Mal Ziel von männlicher – göttlicher? – Demütigungen zu sein.
Doch die Worte Mariens verhallen trotz der verletzenden Widerworte des Sohnes nicht ungehört und das Wunder ereignet sich. Das Wunder, das sich seither durch die Jahrhunderte wiederholt und nun auch durch Sophias Hände geschehen soll. Das Wunder, das nun allein in der Hand der Frauen liegt, den Männern auf unbestimmte Zeit entzogen wurde. Aus dem Gottessohn sind Gottestöchter geworden. Doch sie erhalten bis heute nicht die Verehrung, die ihnen zusteht.
Sophia zuckt zusammen, als der Pfarrer seinen Blick über die säuberlich aufgereihten Prinzessinnen gleiten lässt. Es ist ihr, als habe er ihre ketzerischen Gedanken gewittert. Mit ernster Miene fährt er fort mit der Lesung. »Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.«
Bei den Worten des Speisemeisterns beginnt die Menge, zu johlen. Der Pfarrer duldet diese choreografierte Form der Unruhe. Erst als ein paar junge Winzer aus den hinteren Reihen anzügliche Sprüche in Richtung der Prinzessinnen zu rufen beginnen, bringt er die Menge mit einer einzigen, selbstsicheren Handbewegung erneut zum Schweigen. »Ihr habt gehört, was der Gottessohn damals zu Kana getan hat.« Herausfordernd blickt er in die Gesichter der versammelten Menschen. »Seine Gabe jedoch hat er seither in die Herzen und Hände seiner Jünger gelegt, auf dass sie mit ihrer Wunderkraft einladen zum großen himmlischen Festmahl.«
Töchter, nicht Jünger, durchfährt es Sophia, und diesmal ist sie es, die den Pfarrer mit ihrem maßregelnden Blick geradezu durchbohrt. Und als hätte dieser ihre wortlose Ermahnung gehört, fährt er nun fort. »Doch heute sind es unsere Töchter, die durch die göttliche Geistkraft begabt, die Vorfreude auf das kommende Gottesreich in die Welt hinaustragen. Die größte unter ihnen soll heute erkoren werden. So lasst uns im Geiste der Geschwisterlichkeit den jesuanischen Wettkampf beginnen.«
Die Masse nimmt dankbar zur Kenntnis, dass der Geistliche sie nicht mit einer langatmigen Predigt auf die Folter spannen will, sondern genau weiß, warum sie alle sich hier versammelt haben. Nicht, um frommen Worten zu lauschen, sondern um Zeuge zu werden, wie sich noch heute mitten unter ihnen ein Wunder ereignet.
Nun werden die steinernen Krüge mit Wasser befüllt. Die Königinnen der vergangenen Jahre schöpfen das Wasser mit Tonkrügen aus dem Marktbrunnen und lassen es von ihren Schultern herab mit glitzerndem Schwall in die Steingefäße rauschen. Schließlich betritt der Vorsitzende erneut die Bühne und platziert vor jedem Krug eine kleine Tontafel. Darauf zu lesen ist die jeweilige Weinsorte, welche die entsprechende Prinzessin nun mithilfe der in ihr wohnenden Gabe erschaffen wird.
Ein wissendes Lächeln umspielt für einen Moment Sophias Züge, als sie den Blick ihrer Schwester in der Menge sucht. Siehst du, niemand außer mir hat sich an den Spätburgunder gewagt. Schwere, üppige Rotweine und fruchtige weiße Rebsorten haben einmal mehr unter den Prinzessinnen das Rennen gemacht. Mit ihrer mutigen Wahl steht Sophia alleine da, und dies sollte ihr die Sympathie der Preisrichter sichern, sofern ihr die Wandlung wie geplant gelingt.
Unter schmetterndem Hörnerklang wird nun auf einem samtenen Kissen die Krone der Königin herbeigetragen. Ein weiteres Mal erschallt die Stimme des Pfarrers: »Ehret die göttliche Gabe! Lasst die Wandlung beginnen!« Unter tosendem Applaus und den wachenden Augen unzähliger Kameras schreiten die Prinzessinnen zu ihren zugewiesenen Krügen.
Sophia macht das Atmen Mühe, die Hitze ist in der schweren Tracht kaum zu ertragen. Die starrenden Augen der Menschenmenge, die Ausdünstungen ihres eigenen Körpers und die ihrer Konkurrentinnen sowie die erneut einsetzenden Fanfarenklänge mischen sich zu einem klebrigen Brei, der Sophia zu verschlingen droht. Nur mit Mühe gelingt es ihr, sich aufrecht hinter ihrem Krug aufzustellen.
»Silentium! Seid eingedenk unseres Herrn und den Gaben, die er euch gegeben hat.« Der Pfarrer weiß ganz offensichtlich, wie er diese Worte publikumswirksam auszusprechen hat. Aber glaubt er wirklich daran, oder sind es bloß die immer gleichen, hohlen Phrasen, die er Jahr für Jahr pflichtschuldig aufsagt? Die Gabe war real, daran gab es keine Zweifel. Doch wer war der Geber und mit welcher Absicht?
Eine bleierne Stille legt sich nun über den Platz. Sophia blickt in ein Heer von gezückten Smartphones. Verzweifelte Versuche, den Moment des Wunders ins Bild zu bannen. Doch die Geistkraft wird sich auch dieses Mal nicht sehen lassen. Sie gehört allein den Prinzessinnen und ihrer Gabe. Ein letzter Fanfarenstoß, nun kann die Wandlung beginnen.
Gehorsam heben die Schwestern der Gabe nun ihre Hände über die Steinkrüge, lassen die Kraft, die ihnen innewohnt, in das Wasser strömen. Dies ist der Moment, der ihnen ganz allein gehört. Keine Kamera der Welt kann einfangen, was nun geschieht. Erst die Probe der Richter wird später zeigen, was sich in diesem Moment ereignet hat.
Doch nun geschieht das Unvorstellbare. Erst ist es nur ein leises, kaum zu ortendes Raunen, das den heiligen Moment stört. Aber bald schwillt es an, erfüllt den ganzen Platz. Die Blicke der Menge werden wie durch ein Brennglas auf einen einzigen Punkt gebündelt. Gebannt starren sie auf den Krug, über den sich keine Hände gehoben haben. Die Prinzessin hat sich einfach umgedreht, nestelt kurz an der Verschnürung ihrer Tracht, um das Mieder zu lockern. Ruhig und gemessenen Schrittes verlässt Sophia die Bühne. Königin für ein Jahr, nein das wird sie nicht sein.
Wann der Entscheid gefallen ist, kann sie selber nicht sagen. Sie wird heute nicht nur diesem Platz, sondern auch ihrem Tal für immer den Rücken kehren. Ob ihr die Gabe bleiben wird, spielt jetzt, da ein neues Leben vor ihr liegt, keine Rolle mehr. Hier jedoch hält sie nichts mehr. Zurück bleibt einzig ein Krug, gefüllt mit Wasser, dem gestattet wurde, zu bleiben, was es ist.
Die Bibelstelle (Auszüge aus Johannes 2, 1-12) ist zitiert nach: Lutherbibel revidiert 2017, Stuttgart 2016
Werner Hermann: Der magische Kugelschreiber
Auf gut Glück streifte ich wie fast jeden Abend durch einen mir noch unbekannten Bezirk der Stadt. Ich war wie immer auf der Suche nach einem Ort der Inspiration, brauchte ich doch wie jeder Künstler meine Musen. Diese bestanden üblicherweise – das muss ich jetzt ganz deutlich eingestehen – im Alkohol und zweifelhaften Zufallsbekanntschaften in mehr oder weniger dubiosen Espressos1 an den Haupt- und Nebenstraßen der etwas heruntergekommenen Viertel außerhalb des innerstädtischen Ringes.
Als ein unbekannter Autor, der hie und da in verschiedenen Anthologien seine mehr oder minder gelungenen Kurzgeschichten veröffentlichte, war mir bisher der große Durchbruch verwehrt geblieben, obwohl ich schon einige Novellen und längere Romane an etliche Verlage geschickt hatte. Alle diese Einsendungen waren allerdings abgelehnt worden. Die Gründe dafür lasen sich in der Korrespondenz der Lektoren wie gehabt: Von diplomatisch eleganten Absagen wie »ohne über die Qualität ihres Werkes urteilen zu wollen, müssen wir jedoch von einer Veröffentlichung Abstand nehmen, da dieses Genre nicht in unser Verlagsprogramm passt«, bis zu sehr direkten, um nicht zu sagen unverschämten wie »die Handlungen, welche Sie in Ihren Geschichten beschreiben, sind für ein breites Publikum nicht geeignet; Sie verletzen nicht nur die allgemeinen Anstandsregeln jeglicher Gesellschaft inklusive der Subkulturen; Sie bewegen sich auch eindeutig an einem Grenzpunkt des guten Geschmacks und der literarischen Etikette, die Sie sogar des Öfteren überschreiten und gefährlich nahe an die rote Linie der gültigen Strafgesetze unseres Staates gelangen«, war alles drin. Na ja, dachte ich, bin halt ein verkanntes Genie und meiner Zeit weit voraus – viel zu weit! Tief in mir drinnen wusste ich jedoch: Als mittelmäßiger Schriftsteller mangelte es mir mehr an Talent, als an Verkennung bei den renommierten Verlagen. Das war und blieb leider nun mal so.
Als ich an diesem Abend wieder einmal eine üble Spelunke im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk betrat, um mich mit Bier und Wodka volllaufen zu lassen, hatte ich wie immer meinen Schreibblock und meinen Kugelschreiber dabei, um im Falle einer plötzlichen geistigen Eingabe den gedanklichen Erguss auf Papier festhalten zu können. Tatsächlich rebellierte mein Verstand nach etlichen hochprozentigen Getränken, und ich holte meine Schreibutensilien hervor, um mir die ersehnten Notizen zu machen. Im selben Augenblick gesellte sich ein Mann zu mir an die Bar und sprach mich ob meiner Tätigkeit an.
»Na Kollega, was schreibst denn da in deinen Notizblock? Magst einen Drink? Bin heute spendabel«, sagte er und nahm am Barhocker neben mir Platz. Ich unterbrach mein Gekritzel und musterte ihn neugierig. Es war eine typische Gestalt, welche man in den Cafés wie diesen anzutreffen gewohnt war. Ein Kerl um die Mittvierziger, Dreitagebart und fettiges, nach hinten gekämmtes schwarzes Haar, bekleidet mit einer braunen Lederjacke, Jeanshosen und Turnschuhen, das helle Hemd von oben drei Knöpfe weit offen, einen Tschick2 in der einen, ein Krügerl in der anderen Hand.
»Na, wenn’s denn sein muss, einen Bourbon könnt’ ich noch vertragen«, bejahte ich, wohlwissend, dass ein Whiskey um einiges teurer war als meine Wodkas aus den Diskontern. »Bin ein Schriftsteller und versuche gerade einen Bestseller zu schreiben, aber es will mir partout nicht gelingen. Und du, was machst du so?«
»Bin ein Magier, ein Meister in okkulten Dingen des Lebens. Ob du mir das nun glaubst oder nicht«, antwortete der Typ und winkte den Barkeeper heran, um die Bestellung meines Getränkes in Auftrag zu geben.
Wir plauderten tatsächlich einige Zeit lang, da mich interessierte, was dieser Mann mir erzählte: Als Quelle der Inspiration waren seine seltsamen Aussagen bei meinen fantastischen Geschichten willkommen, obwohl ich weder an Magier, Zauberer noch sonst so einen Quatsch glaubte. Aber was macht man nicht alles für eine gute Story.
Die Konversation gestaltete sich lebhaft und leidenschaftlich, und als ich meinen Bourbon ausgetrunken hatte, ging die nächste Runde naturgemäß an mich, nur das ich schon gewaltig mehr intus hatte als mein Gesprächspartner. Kein Wunder, saß ich doch schon gute zwei Stunden länger in dem Lokal als er. Mein Alkoholpegel war dermaßen hoch, dass ich einwilligte, auch die dritte und die vierte Runde zu zahlen. Ich war nicht mehr in der Lage gewesen, zu eruieren, was sich mein Sitznachbar eigentlich bestellt hatte.
Dann schließlich motivierte er mich für die allerletzte Bestellung, dessen Bezahlung ebenfalls auf mich gehen sollte. Er zog einen Kugelschreiber aus seiner Westentasche. Er sah aus wie ein ganz normaler Schreibstift, weder edel noch exklusiv noch teuer: aus billigem, durchsichtigem Plastik mit einer vollgefüllten Einwegmine in seinem Inneren.
»Ich habe da was ganz Spezielles, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Passt aber genau für dich, mein Freund. Zahlst mir eine Flasche Brandy, Kollega, und dieser magische Schreiberling gehört dir. Ich habe dir aufmerksam zugehört, und ich weiß jetzt, dass es dein größter Wunsch ist, ein anerkannter Autor zu sein. Doch dir fehlt das gewisse Etwas dazu. Ich habe es: Es ist dieser magische Kugelschreiber! Glaub’ mir – mit diesem Schreibinstrument wirst du über Nacht berühmt werden. Er hat zauberhafte Fähigkeiten. Das garantiere ich dir. Schließlich bin ich ein Magier. Ich sehe und weiß Dinge, die der Rest der Welt nicht einmal erahnen würde.« Er hielt mir den besagten Stift vor die Nase.
Was sollte ich anderes tun? Nicht, dass ich an so einen Firlefanz glaubte, aber in Anbetracht meines Alkoholspiegels, meines sehnlichsten Wunsches und … hilft’s nix, so schad’s nix. Ich willigte ein. Sichtlich von meinen vorher konsumierten Getränken beeinträchtigt, griff ich gierig nach dem Kugelschreiber und winkte den Kellner herbei. Mehr Erinnerungen an diesen Abend kann ich leider nicht mehr hervorrufen, so sehr ich mich auch anstrenge.
Am nächsten Morgen hatte ich einen riesigen Kater. Mein Schreibblock mit meinen gedanklichen Ergüssen hatte ich natürlich am Vorabend irgendwann und irgendwo verloren. Ich erinnerte mich nicht einmal daran, wie ich eigentlich wieder nach Hause gekommen war. Doch das war jetzt nebensächlich.





























