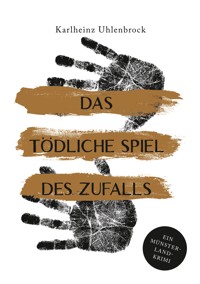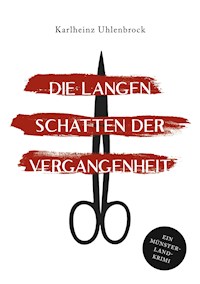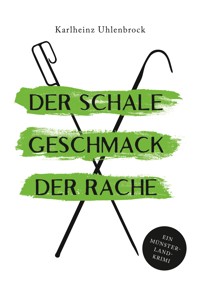
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Rumphorst-Mey-Reihe
- Sprache: Deutsch
Auf ihrer Fahrt zum rock'n'popmuseum nach Gronau entdeckt eine Radlergruppe an einem Bahnübergang in Rheine die Leiche eines jungen Mannes. Zunächst scheint seine klaffende Kopfwunde auf einen bedauerlichen Unfall hinzudeuten. Doch dann liefert die Obduktion Indizien für einen bizarren Mord. Kriminaloberkommissar Luke Rumphorst und sein Team ermitteln und sehen sich bald mehr offenen Fragen gegenüber, als ihnen lieb ist: Hängt der Tod des Mannes mit seinem Engagement in der Ökoaktivistengruppe Green Time Warriors zusammen? Oder wurde er das Opfer einer Beziehungstat? Und warum postet jemand am Tag nach dem Mord das Bild einer Apostelfigur aus der Rheiner St.-Dionysius-Kirche vom verschwundenen Handy des Toten? Die Ermittlungen kommen nur mühsam voran und die Zeit drängt, denn der Mörder hat sein grausiges Werk noch nicht vollendet ... Ein brandaktuelles Thema, ein verzwickter Fall, ein furioses Ende und ganz viel Lokalkolorit - ein Muss für alle Regionalkrimi-Fans!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für
Agnes und Paul & Ingrid und Rolf
–
Die Familie ist die Heimat des Herzens.
(Giuseppe Mazzini, 1805 – 1872, italienischer Philosoph und Politiker)
Rache ist süß, aber vollzogen bitter.
(Deutsches Sprichwort)
Im Rausch der Rache wird auch ein guter Mensch zur Bestie.
(Sprichwort der mexikanischen Indios)
RHEINE AN DER EMS
1
Geburtshaus des Schriftstellers Josef Winckler
2
Gärtnerei Fröschel
3
Bahnübergang Stoverner Straße
4
Villa der Familie Mey
5
Wohnung von Rainer Lindhausen
6
Einmündung der Butterstraße in die Gasse
An der Stadtkirche
7
Restaurant
Roter Hirsch
8
Haus in der Friedenstraße
9
Mathias-Spital
10
Wohnung von Andreas Joon
11
Wertstoffhof Rheine
12
Restaurant
GETS
am Flugplatz Rheine-Eschendorf
Inhaltsverzeichnis
DIE HANDELNDEN PERSONEN
PROLOG
ERSTER TEIL
PEDALEROS 98
CESSNA F172P SKYHAWK
WER IST DENN HEUTZUTAGE OHNE HANDY UNTERWEGS?
EIN PAAR BIS ZUM 1. MAI
ZWEITER TEIL
DAS BILD IM WHATSAPP - CHAT
CRASH 2030
EIN BESUCH AUF DEM WOCHENMARKT
IN DER STADTKIRCHE
DRITTER TEIL
DU SOLLTEST MAL MIT REINHOLD LINDHAUSEN SPRECHEN
DOKTOR NOT TENDORF
EIN SEE AUS SCHOKOLADE
KUNST
DIE REKONSTRUKTION DES FREITAGMORGENS
WAS VERSTEHEN SIE UNTER ›FIES‹?
AUF EINER HARTEN HOLZPRITSCHE
POLIZEI! KEINE BEWEGUNG!
ZU VIEL SCHWUNG
DAS ÖFFNEN EINER WUNDERTÜTE
EIN GRUND ZUM KOPFZERBRECHEN
EINE BULLDOGGE BEI DER ARBEIT
RATLOS
VIERTER TEIL
WIE ES SICH UNTER ZIVILISIERTEN MITTELEUROPÄERN GEHÖRT
DER LUZIFER - EFFEKT
ÜBERRASCHENDE ERKENNTNISSE
COVIDS LANGER SCHATTEN
DIE GREEN TIME WARRIORS
VERDAMMT VIELE FRAGEN
IN DER AGRESTIS - BANK
TELEFONAT UND SAUZAHN
HYPOTHESEN
FÜNFTER TEIL
NICHTSDESTOTROTZ EIN DATE
WAS HABEN SIE DENN MIT MEINER GARAGE?
NACH EINER BESCHISSENEN NACHT
DIE ZWEITE STATUE
TOUCHÉ, WÜRDE ICH SAGEN
HELLE AUFREGUNG IM HAUSE MEY
DER DURCHBRUCH
VERLASSEN, STUMM UND TOT
EINE ENTSCHEIDUNG WIRD GETROFFEN
DER ZERBERUSBAUM
ALSO LOS JETZT!
ATTENTAT AUF DEN TOWER
GESTÄNDNISSE
DER KELCH MIT DER SCHLANGE
BIRNEN-SALSA UND KOHLRABISCHNITZEL
DANK AN ...
FAKTEN UND FIKTION
QUELLENVERZEICHNIS
ÜBER DEN AUTOR
DIE HANDELNDEN PERSONEN
MORITZ MEY
Zeigt, dass man auch als studierter Historiker ein perfekter Hausmann sein kann. Sorgt zudem als freier Mitarbeiter der Rheiner Allgemeinen Zeitung für Niveau im Lokalteil. Selbst in brenzligen Situationen nie um eine rettende Idee verlegen.
ANNA MEY
Lehrerin für Biologie und Mathematik am Rosalind-Franklin-Gymnasium in Rheine. Erstellt Klausuraufgaben, die sich überraschenderweise als Lösungshinweis für einen Kriminalfall entpuppen.
LUKE RUMPHORST
Kriminaloberkommissar und ein Ermittler alter Schule. Ruhig und entschlossen – inzwischen auch beim Umgang mit dem weiblichen Geschlecht.
JAKOB BÄR
Unfreiwillig Single. Begeisterter Krimi-Leser. Nicht gerade die Pünktlichkeit selbst. Doch alles in allem ein Kriminalkommissar, auf den man sich in kritischen Situationen verlassen kann.
EDGAR FALTERMEYER
Kriminalermittler mit einem Faible für Obduktionen. Allerdings lässt ihn das Coronavirus auch Monate nach der Infektion nicht los.
LEON BOCKSTEDT
Auf den ersten Blick mollig rund und wohlgenährt, auf den zweiten ein Polizeiobermeister, wie er im Buche steht – sorgfältig und beharrlich, mit dem Blick fürs Detail.
AZRA CEYLAN
Attraktive Polizeibeamtin mit türkischen Wurzeln. Im entscheidenden Moment reagiert sie bedauerlicherweise zu schnell.
MARIE VAN DENGGELEN
Langes blondes Haar, Stupsnase und in Enschede geboren. Als Dolmetscherin für Niederländisch eine Idealbesetzung.
DR. PAUL NOTTENDORF
Wortkarger, Pfeife rauchender Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Münster mit einem ambivalenten Verhältnis zu Geburtstagen.
SIMONE & ANSGAR ALBRICHT / CHRISTIANE & DIETER CORNRADE / STEFFIE & MICHAEL LORENZ / VERONIKA & JÖRG VALK
Zusammen sind sie die Green Time Warriors und seit den 80er-Jahren im kreativen Einsatz für den Umweltschutz.
JOHANNA BRANDNER
Servierkraft im Restaurant GETS am Flughafen in Eschendorf. In ihrer Freizeit aktiv im Kampf gegen den Klimawandel.
MANFRED BREUGER
Begeisterter Pedelec-Fahrer mit einem überraschenden Nebenverdienst.
PETRONELLA CASTELLANO
Küsterin in der Rheiner Stadtkirche und sprudelnde Quelle kirchenhistorischen Wissens.
TOMMY DORNIER
Fluglehrer im Luftsportverein Eschendorf. Behält auch in kritischen Situationen die Ruhe.
LEA FRÖSCHEL
Modebewusster Fan der Gruppe Coldplay. Ihre jüngste Romanze hat in ihr tiefe Spuren hinterlassen.
LUISE FRÖSCHEL
Mitinhaberin der Gärtnerei Fröschel. Ein Schicksalsschlag verdunkelte ihr Leben.
MAXIMILIAN FRÖSCHEL
Versierter Landschaftsgärtner und Inhaber der Gärtnerei Fröschel, bedauerlicherweise ohne Hoffnung auf einen Nachfolger.
NICO FRÖSCHEL
Sensibler Gärtnerlehrling im Familienbetrieb Fröschel, dem sein Engagement im Kampf gegen den Klimawandel zum Verhängnis wurde.
GIACOMO GALLDETTI
Unterstützt als Fotovoltaik-Spezialist die Klimawende, wenngleich nicht immer mit integren Mitteln.
ANDREAS JOON
Ein grimmiger Klimaaktivist, entschlossen und kreativ. Sein Auftritt im Roman ist ein kurzer, und doch ist er im Grunde stets präsent.
REINHOLD LINDHAUSEN
Dem Tabakkonsum ergebener Kenner der Werke Josef Wincklers. Vor seiner Pensionierung Kunstlehrer und ein bei den Pennälern beliebter Betreuer schulischer Facharbeiten.
JOSEF MANDELSTEIN
Oldschool, was das Biken angeht, doch mit dem Auge für das Wesentliche.
ALOIS NICKEL
Chefredakteur der Rheiner Allgemeinen Zeitung und gewichtiger Liebhaber von Kaffee und süßen Versuchungen.
TIMOTHEUS PLUSCH
Ein erfahrener Pilot, den kaum etwas aus der Ruhe zu bringen vermag. Na dann: Holm- und Rippenbruch.
SARA SONNENBERG
Eine Frau mit einem ausgefallenen Beruf und Haaren auf den Zähnen.
PROLOG
Rabenvögel erhoben sich schwarz in die Lüfte. Ihre Schreie klangen wie das Kreischen stählerner Räder beim Passieren einer rostigen Weiche. Oder waren es gar nicht die Vögel, die schrien?
Was mochte in den Pillen gewesen sein? Drogen? Kokain? Ecstasy? Jedenfalls gaben sie jene Leichtigkeit, die ihm zuvor immer gefehlt hatte. Ihm war, als könne er fliegen, sich mit den Vögeln in den Himmel erheben. Die Kälte spürte er nicht mehr. Mutig war er, unendlich mutig! Er, der sonst so Vorsichtige, Abwägende, der Zaudrer. Ja, heute würde er es schaffen, das, wovor er bisher zurückgeschreckt war. Das, wovor er so viel Angst gehabt hatte. Angst, die die Kehle zuschnürte, die Hände zittern ließ und die Beine lähmte. Heute gab es keine Angst, nur grenzenlosen Mut!
Er stapfte über die Gleise. Das fahle Licht des Mondes ließ die Konturen verschwimmen. Dennoch war es seltsam, dass die stählernen Bänder nicht gerade waren, sich krümmten und wanden wie mattgraue Schlangen auf dunklem Schlamm. Ihm schien es, als veränderten sie beständig ihre Form, als wichen sie vor ihm zurück, entzögen sich seinem Tritt, wenn er sich ihnen näherte. Umsonst, ihr eisernen Gleise, umsonst! Heute entkommt ihr mir nicht.
Da war es wieder, dieses Kreischen. Kehrten die Raben zurück? Vielleicht, um ihn zu holen, ihn mit sich zu nehmen in die grenzenlose Weite des Himmels. Zur Sonne? Von der es, obgleich es doch Nacht war, derer drei zu geben schien. Drei Sonnen, so hell, als wollten sie das Dunkel für immer vertreiben. Drei Sonnen, die auf ihn zukamen, blendend und rasend schnell. Im nächsten Augenblick schon waren sie beängstigend nah, so wie das infernalische Kreischen, das laut, immer lauter wurde. Er wollte sich die Finger in die Ohren stopfen.
Und plötzlich war sie wieder da, die Angst, die den Verstand lähmte und das Denken zum Erliegen brachte. Die Angst, die seine Beine paralysierte, sie daran hinderte vorwärts zu stolpern. So stand er nur da, den Kopf wie lauschend erhoben, regungslos im Schotterbett zwischen den Schienen, unfähig auch nur einen Schritt zu tun.
Beim Aufprall des Zuges erstarb sein stummer Schrei.
ERSTER TEIL
Rheine, Freitag, 24. Juni 2022
PEDALEROS 98
Was bitte spricht denn gegen ein Pedelec?«
Josef Mandelstein verdrehte die Augen. Wie oft hatte er diese Diskussion mit den Radlerinnen und Radlern vom Isernhagener Radsportverein Pedaleros 1998 – kurz Pedaleros 98 – schon geführt! Heute war es Rudi Krawuschke, der versuchte, ihn von den Vorteilen elektrounterstützten Radelns zu überzeugen. Dabei waren seine Argumente die gleichen wie die der anderen Pedaleure: Mit Elektrounterstützung radelt man schneller – weiter – entspannter. Was natürlich alles stimmte, aber eben nicht Mandelsteins Radfahr-Philosophie entsprach, in der Begriffe wie »schneller« und »weiter« eher hintere Plätze einnahmen. Bei ihm stand das Fahrerlebnis im Vordergrund, der Spaß an der Bewegung, das bewusste Wahrnehmen der Landschaft.
Natürlich gab es daneben auch ganz handfeste Gründe, die Mandelstein bis dato vom Kauf eines Pedelecs abgehalten hatten. Seine klammen Finanzen zum Beispiel, auch wenn er dies den Mitradlern gegenüber nie zugeben würde. Aber für einen Angestellten des Ordnungsamtes der Gemeinde Isernhagen wuchsen die Bäume nun wahrlich nicht in den Himmel. Zumindest in finanzieller Hinsicht. Seine übrigen Argumente hatte er dagegen bereits so häufig vorgebracht, dass er sie im Schlaf hätte herunterbeten können: Pedelecs waren reparaturanfälliger; der Akku musste immer wieder neu geladen werden – besonders umweltschonend war das gerade nicht; zudem war ein Pedelec deutlich schwerer als sein geliebtes Alu-Trekkingrad und last but not least verbrauchte man beim elektrounterstützten Radeln deutlich weniger Kalorien als beim Strampeln auf einem normalen Drahtesel – rund die Hälfte weniger, um genau zu sein. Angesichts seines nicht zu übersehenden Wohlstandsbauches ein durchaus gewichtiges Argument, wie er fand, das allerdings seine Mitradlerinnen und Mitradler ebenso wenig überzeugte wie all die anderen Gründe, die Josef Mandelstein in der mit unschöner Regelmäßigkeit immer wieder einmal aufflammenden Diskussion vorbrachte.
»Mensch, Josef, immer hängste hintenan und wir müssen auf dich warten«, nölte Rudi Krawuschke. »Abends biste so fertig mit ’de Welt, dat ’de dat Bierglas kaum heben kannst. Und alles nur, weil ’de dich nich dazu durchringst, dir endlich auch ’nen Pedelec zuzulegen. Der Manni, der hätte da ’nen prima Angebot für di ch.»
Der Manni, alias Manfred Breuger, genoss seit drei Jahren die Freuden des Rentnerdaseins, freilich mit gebremstem Schaum, wie er nach dem zweiten Bier gerne betonte. Denn mit einer Rente von gerade einmal 1.400 Euro ließen sich keine großen Sprünge machen. Zur Aufbesserung seiner Altersversorgung hatte er daher seit dem vergangenen Herbst einen Handel mit gebrauchten Rädern aufgezogen, der sich angesichts der Knappheit des Angebotes auf dem Fahrradmarkt als durchaus lukrativ erwies. Rudi Krawuschkes dezenter Werbehinweis hätte den Manni gefreut, war ihm aber offenbar entgangen. Zumindest zeigte er keine Reaktion. Mit geübten Handgriffen setzte er seinen Fahrradhelm auf und zog den Riemen unter dem Kinn fest. Ein Blick in die Runde. Alle Mitglieder der Radlergruppe waren mit letzten Startvorbereitungen beschäftigt. Breuger drückte verschiedene Tasten seines Fahrradradios. Der am Lenker des Bikes montierte Lautsprecher knackte. Im Display leuchtete WDR 2 auf. Unvermutet ertönte das Intro von Hinterm Horizont geht’s weiter. Udo Lindenberg, das passte! Denn das Ziel ihrer heutigen Etappe war das rock’n’popmuseum in Gronau, für dessen Gründung der gebürtige Gronauer Lindenberg einst die Idee geliefert hatte. Breuger drehte den Lautstärkeregler bis zum Anschlag auf.
Es dauerte nur Sekunden, bis Gudrun Neiße »Zu laut!« rief. Mit 72 war sie die Seniorin der Gruppe.
»Mach’ leiser, Manni!«, unterstütze sie ihre Freundin Hermine Mulch. »Da kriegen ja die Amseln einen Hörsturz!«
Die Musik erstarb.
»Geht doch«, knurrte Mandelstein und verstaute Wäsche- und Kulturbeutel in den Satteltaschen. Wenn er etwas nicht mochte, dann war es, mit Musikgedudel durch die Gegend zu radeln.
»Los, Leute, auf geht’s! Wir haben noch ’ne ganz schöne Strecke vor der Brust. Also nicht trödeln und ab die Post!«
»Wohin geht’s denn heute als Erstes?«
»Zum Offlumer See bei Neuenkirchen. In der Ewigen Liebe gibt’s Pause Number One.«
»Soll ’ne ganz nette Lokalität sein.«
»Hoffentlich haben die ein gutes Bier.«
»Los, Leute, der Tag wird nicht jünger.«
»Wir auch nicht!«
Lachend schwangen sich drei Frauen und vier Männer auf ihre Pedelecs. Ein einzelner Mann stieg bedächtig auf sein Trekkingrad. Wenig später hatte sich in der Gruppe die altbekannte Reihenfolge der Fahrer eingestellt. Manni Breuger radelte vorneweg. Sein Fahrradradio hatte er wieder in Betrieb genommen, leiser zwar, aber doch bis zum Ende der Kolonne hörbar. Breuger folgten sechs munter miteinander schwatzende Damen und Herren und am Ende der Gruppe trat, schon ein wenig abgehängt, Josef Mandelstein in die Pedale. Lautlos fluchte der über das wieder einmal extrem hohe Anfangstempo.
»Russische Truppen stürmten das schwer umkämpfte Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine …« Im WDR liefen die Nachrichten. Keiner der Biker beachtete sie. Dabei war es irgendwie surreal, hier durch das friedliche grüne Münsterland zu radeln, während im Osten Europas ein von Putin und seiner Clique entfesselter Angriffskrieg tobte, in dem auch in diesem Augenblick Menschen starben, gefoltert wurden oder ihre Heimat verloren.
Eine gute Stunde später erreichten die Radler die Saline Gottesgabe in Bentlage.
»Ein kleiner Umweg, aber einer, der sich lohnt«, hatte Breuger, der für das Austüfteln der Fahrtroute verantwortlich war, vollmundig versprochen und damit nicht übertrieben. Man stellte die Räder in den Schatten des Gradierwerkes, sicherte sich einen Sitzplatz auf den zünftigen Holzbänken und schnaufte durch.
Allein Manni Breuger blieb stehen. Schaute man in sein Gesicht, konnte man bereits ahnen, was nun kommen würde. Er räusperte sich. Mit weit ausholenden Gesten begann er seine Erläuterungen. Seine umfangreichen Erläuterungen, um genau zu sein. So wie zuvor bereits an den anderen Standorten ihrer Fahrradtour, akribisch vorbereitet im heimischen Wohnzimmer. Breuger war Perfektionist. Bis zu seiner Verrentung hatte er als Verkäufer in einem renommierten Bekleidungsgeschäft in Hannover gearbeitet. Zugleich galt »der Manni«, wie man ihn in Isernhagen liebevoll nannte, als Stimmungskanone und seine Auftritte auf den Festveranstaltungen des Isernhagener Karnevalsvereins Dat Narrenschiffwaren legendär. Seine Büttenreden sprühten vor nicht immer jugendfreiem Witz. Jeder Kalauer saß und brachte den Saal zum Kochen. Was man, nach Mandelsteins Meinung, von seinen Vorträgen auf ihrer aktuellen Radpartie eher nicht behaupten konnte. Er hörte nur mit halbem Ohr zu.
»Schon im Mittelalter wurde hier in Bentlage Salz gewonnen. Nach Gründung des Klosters Bentlage durch Brüder des Ordens vom Heiligen Kreuz setzten diese die Salzgewinnung für den Eigenbedarf fort. Im 18. Jahrhundert dann gründete Fürstbischof Clemens August eine Salinen-Sozietät und ab 1743 erfolgte eine grundlegende Modernisierung …«
Mandelstein waren dies zu viele Daten und Namen. Die konnte man zu Hause im Reiseführer nachlesen, sofern einem danach gelüstete. Das Salinenensemble in Bentlage war doch viel zu schön, um es auf eine trockene Abfolge von Jahreszahlen zu reduzieren. Man musste es begehen, mit allen Sinnen genießen. Mit einem entschuldigenden Blick in Breugers Richtung, den der Vortragende allerdings nicht bemerkte, erhob sich Mandelstein und schlenderte in Richtung eines nahe gelegenen Fachwerkhauses. Niemand achtete auf ihn. In seinem Rücken hörte er noch einige Zeit den tiefen Bass des selbst ernannten Tourguides: »… eine damals hochmoderne Salinenanlage … das ursprünglich fast 300 Meter lange Gradierwerk … die erste derartige Anlage in Westfalen …« Je weiter er sich entfernte, desto leiser wurde der Bass. Der Kopfsteinpflasterweg führte links am lang gestreckten Fachwerkbau vorbei, den Mandelstein nach einem Blick durch die mit Glas verschlossene ehemalige Türöffnung als historisches Siedehaus und Salzlager identifizierte. Hier wurde offenbar in früherer Zeit durch Aufkochen der in den Gradierwerken angereicherten Sole Salz gewonnen, jener Stoff, den man seinem damaligen Wert nach als »weißes Gold« bezeichnete. Mandelstein fuhr sich nachdenklich mit der Zunge über die Zähne. Zwei der Backenzähne waren goldüberkront. Kommende Woche stand der routinemäßige Kontrollbesuch beim Zahnarzt an. Hinter seinem Rücken ging schnellen Schrittes ein Paar vorbei.
»… und glücklich werden«, hörte Mandelstein den Mann sagen.
»Wie auch immer, wir haben unsere Pflicht getan. Uns kann man nichts vorwerfen«, stellte die Frau mit zittriger Stimme fest.
»Da hast du recht«, beruhigte sie der Mann. »Uns kann man nichts vorwerfen. Aber man wird …«
Die Stimmen verebbten. Vorsichtig wandte sich Mandelstein um. Das Paar hatte bereits die Spitze des Gradierwerkes erreicht. Einen Moment lang war er versucht, den beiden leisen Schrittes zu folgen. Zu gerne hätte er gewusst, wie das Gespräch weiterging. Solch kryptische Gesprächsfetzen, zufällig im Vorübergehen aufgeschnappt, reizten einfach dazu, Annahmen über den Rest der Unterhaltung anzustellen. Natürlich ließen sich solche Spekulationen recht einfach beenden. Man müsste den Personen lediglich folgen, ihnen auf die Schulter tippen und die Frage stellen: »Entschuldigen Sie, worüber bitte haben Sie gerade gesprochen?« Ein Vorgehen, das dem Fragenden im günstigsten Fall die gewünschte Information, im ungünstigsten Fall allerdings eine Ohrfeige eintragen könnte. Als aufmerksamer, wenn auch unfreiwilliger Lauscher hätte er sich in jedem Fall geoutet. Mandelstein biss sich auf die Lippen. Natürlich würde er einen solchen Plan niemals in die Tat umsetzen. So blieb die Ergänzung der aufgefangenen Gesprächsbruchstücke wieder einmal seiner Fantasie überlassen. Er wandte sich um und schlenderte weiter.
Wenig später stand er vor dem eingeschossigen Westteil des Gebäudes. Hier hatte sich früher die Wohnung des Salineninspektors befunden und hier wurde, wie eine Tafel neben dem letzten Fenster verkündete, am 7. Juli 1881 ein gewisser Josef Winckler geboren.
»Josef Winckler? Nie von dem gehört«, murmelte Mandelstein.
»Was sehr bedauerlich ist«, tönte es leise neben ihm.
Erstaunt blickte er zur Seite. Ein älterer Mann, dessen Kommen er überhört hatte, lächelte ihm freundlich zu. Seine vollen Lippen umrahmte ein gepflegter grauer Bart.
»Ich … bin nur ein Tourist«, entschuldigte sich Mandelstein verlegen.
»Und ich bin der beste Josef-Winckler-Kenner in Rheine.« An Selbstbewusstsein schien es dem Mann nicht zu mangeln. »Reinhold Lindhausen«, stellte er sich vor. »Kommen Sie, wir setzen uns auf die Bank.« Unter Ächzen nahm er auf der Holzbank vor dem Josef-Winckler-Haus Platz. »Es stört Sie doch nicht, wenn ich rauche?« Eine rein rhetorische Frage, denn im gleichen Moment zündete sich Reinhold Lindhausen bereits eine Zigarette an, inhalierte tief und stieß den Rauch durch die Nase wieder aus. Die Zigarette zwischen Ring- und Mittelfinger haltend, fuhr er fort: »Sie fragen sich sicherlich, warum ich es als bedauerlich ansehe, dass Sie unseren prominenten Heimatdichter nicht kennen.«
Zwar fragte sich Mandelstein dies nicht wirklich, doch aus Höflichkeit nickte er.
»Weil Ihnen damit der Zugang zu einem wesentlichen Element der westfälischen Mentalität fehlt: dem westfälischen Humor«, beantwortete Lindhausen seine selbst gestellte Frage.
Mandelstein konnte sich nicht erinnern, je etwas von ›westfälischem Humor‹ gehört zu haben. Im Gegenteil. Ihm kam die Behauptung in den Sinn, der Westfale gehe zum Lachen in den Keller. Sollte dies nichts als üble Nachrede sein?
»Nehmen wir einmal den von Winckler verfassten Roman ›Der tolle Bomberg‹, das Paradebeispiel eines westfälischen Schelmenromans. Der Titel sagt Ihnen doch sicherlich etwas.« An Mandelsteins verständnislosem Gesichtsausdruck war abzulesen, dass dem nicht so war. »Aber den Film aus dem Jahre ’57 werden Sie vielleicht kennen. In der Hauptrolle Hans Albers. Daneben spielte die Crème de la Crème des deutschen Films der 50er-Jahre mit: Marion Michael, Harald Juhnke, Gert Fröbe, um nur einige zu nennen.« Lindhausen nahm erneut einen tiefen Zug von seiner Zigarette.
»Es tut mir leid, aber meine Filmkenntnisse beschränken sich weitgehend auf die letzten drei Jahrzehnte.« Hilfe suchend schaute Mandelstein sich um. Jetzt hätte er gerne Manni Breuger winken sehen. Das hätte ihm einen willkommenen Anlass geboten, sich mit einer gemurmelten Entschuldigung aus dem Gespräch zu verabschieden. Doch der stand noch immer deklamierend vor dem Gradierwerk.
Lindhausen schnaubte, was man durchaus als Missbilligung eines solch limitierten Filmkonsums deuten konnte. »Dabei könnte der Baron von Bomberg auch heute noch als Vorbild für kreative Bürgerbeteiligung und humorvollen Widerstand gegen jede Art obrigkeitlicher Bevormundung dienen.« Er kicherte. Schon der Gedanke an Wincklers subversiven Humor schien ihm Vergnügen zu bereiten.
»Ich müsste jetzt … also, meine Radfahrergruppe wartet dort drüben …«
Der ältere Herr in der grauen Strickjacke überhörte diesen Einwand geflissentlich. »Darf ich Ihnen ein Beispiel geben?« Hastig zog er an seiner Zigarette. Seine Augen sprühten vor Begeisterung. Ohne auf Mandelsteins Antwort zu warten, fuhr er fort: »Ende des 19. Jahrhunderts hielt die Eisenbahn nur in den größeren Städten wie etwa hier in Rheine. Haltestationen in den ländlichen Regionen gab es nur sehr wenige. So war natürlich auch das kleine Buldern, in dem das Bomberg’sche Schloss stand, obgleich an der wichtigen Bahnstrecke von Münster ins Ruhrgebiet gelegen, ohne eine solche Haltestelle. Den Baron ärgerte das und er beschloss, dem Missstand auf die ihm eigene Art ein Ende zu setzen. Weilte er in Münster, so benutzte er für den Rückweg die Bahn und zog jedes Mal, wenn diese Buldern passierte, die Notbremse. Dem Schaffner zahlte er klaglos die für diese Ordnungswidrigkeit festgesetzte Strafe von 30 Mark und stolzierte dann querfeldein zu seinem Schloss. Die Mitreisenden amüsierten oder echauffierten sich, je nach Temperament. Die Presse reagierte empört. Die Eisenbahndirektion sah sich aller Bemühungen zum Trotz nicht in der Lage, den Spuk abzustellen. Manch pfiffiger Bulderner nutzte im Windschatten des Barons die regelmäßigen außerplanmäßigen Fahrtunterbrechungen dazu, den Zug so wie er heimatnah zu verlassen. Als Bomberg selbst den von Hannover kommenden Expresszug mit dem Herzog von Cumberland nebst Gattin an Bord per Notbremsung stoppte, war das Maß voll. Die Bahnverwaltung beschloss, in Buldern eine eigene Bahnstation zu eröffnen, die kleinste Bahnstation des Münsterlandes.«
Lindhausen beendete seine fließend und mit angenehmer Stimme vorgetragene Rede mit einem leichten Hüsteln. Ohne Frage hielt er diesen Vortrag nicht zum ersten Mal.
Mandelstein schwieg.
»Subversiv, aber genial, finden Sie nicht?«, fragte Lindhausen und zwinkerte ihm zu. »Sie sollten den Bomberg im Original lesen. Ein köstlicher Genuss, sag’ ich Ihnen.« Er zog eine leere Blechschachtel aus der Tasche und drückte die bis auf den Filter heruntergerauchte Zigarette darin aus. Dann stand er auf und strich sich behutsam über die Hose, so als wollte er Aschereste entfernen, die es dort jedoch gar nicht gab. »Ich müsste dann mal wieder. Es war schön, mit Ihnen zu plaudern. Na denn, guët gaon!« Mit einem freundlichen Kopfnicken verabschiedete sich der ältere Herr und entschwand in Richtung Salinenstraße.
Versonnen starrte Mandelstein auf das Grün der Tanzlinde, die dem Geburtshaus Wincklers gegenüberstand. So offen und gesprächig hatte er sich die Münsterländer gar nicht vorgestellt. Und so humorvoll erst recht nicht. Wie viele Vorurteile man doch mit sich herumtrug! Mandelstein seufzte. Eben wollte er aufstehen, als sich eine schwere Hand auf seine linke Schulter legte.
»Hier steckst du also!«, schnarrte Manni Breuger ungehalten. »Mensch, wir haben dich überall gesucht. Wir wollen weiter.«
Mandelstein spürte die bösen Blicke der Mitradler, als er am Gradierwerk kommentarlos sein Rad bestieg. »Nächster Halt ist am Offlumer See in Neuenkirchen«, verkündete Breuger. »Bis dahin sind es nur gut zehn Kilometer. Wenn wir jetzt losfahren, achtet mal auf die Storchennester. Im NaturZoo und im Salinenpark gibt es die größte Weißstorch-Kolonie in Nordrhein-Westfalen.« Das Navi im Blick, radelte Breuger vorneweg. Sein Fahrradradio hatte er ausgeschaltet, möglicherweise, um das Klappern der Störche nicht zu übertönen. Ihm folgte munter schwatzend der Rest der Gruppe. Als die Radler nach dem Kreisverkehr in die Stoverner Straße einbogen, schallte jedoch erneut laute Musik aus dem für seine geringe Größe erstaunlich leistungsstarken Lautsprecher. Für Manni Breuger schien Stille beim Radeln eine Todsünde zu sein.
Die Gruppe passierte den Bahnübergang Stoverner Straße, als Letzter Josef Mandelstein. Die oberhalb der wuchtigen Andreaskreuze angebrachten Warnlampen begannen gelb zu leuchten. Die Durchfahrt eines Zuges kündigte sich an. Mandelstein beeilte sich, die Gleise zu überqueren. Aus Gewohnheit warf er einen Blick nach links, dann einen zweiten nach rechts. Er stutzte, schaute erneut nach links. Zwischen den Schienen des linken Gleises lag etwas, das dort nicht hingehörte. Ein grünes, längliches Etwas, dessen Proportionen an einen schlafenden Menschen erinnerten. In dieser Sekunde sprang das Licht der Signalanlage auf Rot.
»Halt!« Mandelsteins Schrei gellte so unvermittelt über die Straße, dass die gesamte Biker-Gruppe scharf bremste. Die Räder zweier Frauen kollidierten. Ein Mann landete auf der Grasnarbe des Seitenstreifens. Ein heilloses Durcheinander. Es wurde geflucht und geschimpft.
»Kannst du nicht aufpassen, wohin du lenkst?«
»Verdammt, was soll das?«
»Mein Rad! Das gibt todsicher ’ne Acht!«
»Josef, bist du verrückt geworden, uns so zu erschrecken?«
»Hier liegt jemand auf den Gleisen!«, brüllte Mandelstein, während er sein Rad hastig gegen das Andreaskreuz lehnte. Lautlos begannen die Halbschranken sich zu senken. Ohne über sein Tun nachzudenken, stakste er in fliegender Hast über den Schotter des Gleisbettes auf das menschliche Bündel zu. Sekunden später bemühte er sich verzweifelt, den steifen Körper von den Schienen zu zerren. »Leute, helft mir doch!«, keuchte er. Durch die Schienen ging ein Vibrieren. Lauschend hob Mandelstein den Kopf und seine Stimme bekam einen beschwörenden Klang. »Schnell, Mensch, schnell! Da kommt ein Zug!«
Manni Breuger reagierte als Erster. Ohne zu zögern, warf er sein Rad ins Gras und hastete über die Gleise.
»Fass mit an!«, keuchte Mandelstein. »Hier, nimm die Beine! Ja, genau so.«
Gemeinsam packten sie den leblosen Körper und zerrten ihn ins Gras neben dem Gleisbett. Sekunden später rauschte ein Intercity mit jaulendem Pfeifen an ihnen vorbei. Der Windzug ließ die Grashalme flattern. Stöhnend richtete sich Mandelstein auf. »Danke, Manni«, japste er. »Das war knapp, aber gerade noch rechtzeitig!«
Mit einer mechanischen Handbewegung zog Breuger ein rot-weiß kariertes Taschentuch aus der Hosentasche und wollte sich damit über die schweißnasse Stirn fahren. Abrupt hielt er in der Bewegung inne. Seine Augen weiteten sich. »Rechtzeitig kann man das wohl nicht mehr nennen«, sagte er langsam. »Der da ist tot.« Das karierte Taschentuch in der Faust, deutete er auf die klaffende Wunde am Kopf des jungen Mannes, der regungslos vor ihnen im Gras lag.
So, als sei nichts geschehen, hoben sich in diesem Moment am Bahnübergang Stoverner Straße die Schranken und die Warnlichter erloschen.
CESSNA F172P SKYHAWK
Timotheus Plusch«, so hatte er sich vorgestellt, als sie sich auf der Terrasse des Restaurants GETS am Flugplatz Rheine-Eschendorf die Hand gaben. »Ich bin Ihr Pilot.« Der Händedruck des Mannes war kräftig, sein eigener feucht. Er war aufgeregt. Den Rundflug hatte ihm seine Frau Helga zum Fünfzigsten geschenkt. Gut 15 Minuten sollte das Erlebnis dauern, genügend Zeit, um seine Heimatstadt Rheine aus der Luft zu erkunden. Selbstverständlich hatte ihm Helga den Preis für das Event nicht verraten und ebenso selbstverständlich hatte er ihn auf der Homepage des Luftsportvereins Eschendorf nachgesehen. 50 Euro kostete der Spaß – äußerst passend zum Anlass für das Geschenk, wie er im Stillen dachte.
Seine Spiegelreflexkamera über der Schulter, folgte er dem Piloten zur startbereiten Cessna F172P Skyhawk, »Ihrem Flugzeug für die nächste halbe Stunde«, wie Timotheus Plusch augenzwinkernd anmerkte. Ein wenig mulmig war ihm schon. Denn anders als die großen Passagierjets, die er von seinen Urlaubsflügen nach Mallorca und Teneriffa her kannte, machte die kleine einmotorige Maschine mit der Kennung D-EOJC auf dem Rumpf einen eher filigranen Eindruck. ›Ein Sicherheitsversprechen sieht anders aus‹, dachte er.
Plusch schien seine Bedenken zu ahnen. Vielleicht hatte er auch sein banges Schweigen richtig gedeutet. Jedenfalls versicherte er ihm: »Die Maschine wird regelmäßig von einem erfahrenen Mechaniker gewartet und ich fliege seit gut zehn Jahren. Unfallfrei. Sie können sich also ganz entspannt auf Ihren Flug freuen.«
›So weit, so gut‹, dachte er. ›Wahrscheinlich gehört die Fähigkeit, aufgeregte Kunden zu beruhigen, zum Anforderungsprofil eines Rundflugpiloten. Also denn: auf zum Boarding.‹ Sie kletterten in die Cessna, Plusch links, er rechts. Es folgten eindringliche Anweisungen zu all den Schaltern und Knöpfen, von denen er als Fluggast besser die Finger lassen sollte. Gurte schließen. Kopfhörer aufsetzen. Die Maschine rumpelte zum Start. Es roch nach Sprit und Abgasen. Im Kopfhörer ein Knistern, dann eine Mickey-Maus-Stimme, die die Startinformationen durchgab. »Okay«, bestätigte Plusch. Mit einer fließenden Handbewegung schob er den Gashebel ganz hinein. Vollgas! Der Motor röhrte auf. Immer schneller rollte die Cessna über die Grasnarbe. Endlich lösten sich die Räder vom Boden.
Einen Wimpernschlag später schlug sein Unbehagen in pure Begeisterung um. Boah! Sie flogen! Die Welt unter ihnen wurde kleiner und kleiner. Binnen einer Minute schrumpften Wiesen und Äcker zu Feldern in Schachbrettgröße. Dunkelgrün die Hecken zwischen ihnen und dunkelgrün auch die Waldstreifen entlang der Ems. Die berühmte Münsterländer Parklandschaft. Herrlich! Die Autos auf dem grauen Band der Straße schienen zu kriechen. Reinhard Mey kam ihm in den Sinn: »Über den Wolken …« Momentan konnte er dem Barden nur zustimmen, dass die Freiheit dort grenzenlos sein musste. Dann Rheine selbst, die Basilika, St. Dionysius, der Marktplatz, das Rathaus, die dichte Bebauung mit doch erstaunlich viel Grün. Er fotografierte, als gäbe es kein Morgen. In einer weiten Kurve flogen sie über die Stadt in Richtung Salzbergen. Unter ihnen ein doppelter Reißverschluss. Auf seine Frage hin bestätigte ihm Plusch, dass es sich dabei um die Bahnlinie nach Amsterdam handelte.
»Und was ist das da vorne?«, krächzte er in das Mikro und wies mit einer weit ausholenden Handbewegung auf eine auffällige Ansammlung von Fahrzeugen. Offenbar ein Rettungs- und ein Notarztwagen, ein ziviles Fahrzeug und ein Streifenwagen, der Rettungswagen mit einem rotierenden Blaulicht auf dem Dach, das selbst von hier oben gut zu erkennen war.
Plusch kippte die Cessna nach rechts und zog sie in eine enge Kurve. So hatte sein Fluggast einen guten Blick auf das Objekt seines Interesses.
»Das müsste der Bahnübergang Stoverner Straße sein«, hörte er im Kopfhörer. »Vielleicht hat es da einen Unfall gegeben.«
Der Verschluss der Spiegelreflex klickte in hektischem Stakkato.
»Geht das noch ein wenig niedriger?«
Plusch brummte Undefinierbares und flog eine letzte Schleife, dieses Mal gefühlt nur knapp über den Wipfeln der Bäume. »Wir müssen zum Flugplatz zurück«, erklärte er dann und richtete die Nase der Cessna gen Osten.
Ein letztes Foto. Erschöpft ließ sein Passagier die schwere Kamera sinken. Beim Grillen heute Abend würde er den Freunden einiges zu erzählen haben.
WER IST DENN HEUTZUTAGE OHNE HANDY UNTERWEGS?
Jetzt reisen die Gaffer auch schon per Flugzeug an. Das ist doch wohl der Gipfel«, knurrte Kriminaloberkommissar Luke Rumphorst. »Ein richtiger Fluch, dieser Katastrophentourismus!« Er schickte der abdrehenden Cessna einen bösen Blick hinterher. Vor gut einer Dreiviertelstunde hatte ein Radfahrer den Fund einer Leiche auf den Gleisen der Eisenbahnstrecke Rheine–Amsterdam gemeldet. Als das Team der Kripo Greven den Fundort an der Stoverner Straße erreichte, war dieser erfreulicherweise bereits von zwei uniformierten Kolleginnen aus Rheine abgesperrt worden. Zudem waren auch schon Notärztin und Rettungssanitäter vor Ort, was nicht verwunderte, war doch der Anfahrtsweg von der Rettungswache Rheine links der Ems deutlich kürzer als vom Kriminalkommissariat 11 in Greven. Mit einer routinierten Bewegung streifte sich Rumphorst Einmalhandschuhe über. »Übernimmst du die Zeugenbefragung, Jakob?«, wandte er sich an den Kollegen Bär. »Ich kümmere mich um den Toten.«
»Geht in Ordnung«. Bär nickte müde und unterdrückte ein Stöhnen. Der Rücken! Sicher wieder mal die Bandscheibe. »36 Jahre alt und schon Dauerpatient beim Orthopäden«, grollte er leise. »Danke, Marlies!« Er knirschte mit den Zähnen. Bei der ersten Behandlung hatte ihn der Orthopäde durch seine Eingangsfrage »Na, wer hat Sie denn geärgert?« mit der Nase darauf gestoßen, dass es einen Zusammenhang zwischen Stress und Bandscheibenproblemen gab. Sein nun schon zweiter Bandscheibenvorfall konnte also durchaus eine Spätfolge der nervenaufreibenden Trennung von seiner Frau sein. Jetzt stöhnte Bär doch. Morgen stand der Umzug in seine neue Singlewohnung an. Wie sollte er den nur überstehen, wenn sein Rücken selbst ohne körperliche Belastung heftige Schmerzsignale aussandte? Er reckte sich und glaubte im gleichen Moment, ein Knacken zu hören. Vorsichtig reckte er sich ein weiteres Mal. Die Schmerzen ließen nach. Gut so. Damit bestand Hoffnung für morgen.
Rumphorst hatte den Dienstwagen hinter dem Notarztwagen auf dem Seitenstreifen der Stoverner Straße geparkt. Weiß Gott keine der Hauptverkehrsadern Rheines, was schon daran zu erkennen war, dass der Straße eine Mittelstreifenmarkierung fehlte. Der Kommissar ging die wenigen Schritte bis zum Bahnübergang und blieb dann stehen. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, am Fundort einer Leiche zunächst einen Augenblick still zu verharren, die Umgebung unvoreingenommen und ungefiltert auf sich wirken zu lassen, quasi, den Geist des Ortes in sich aufzunehmen. Manches Mal schon hatte ihm dieser erste intuitive Eindruck des Fundortes an späterer Stelle im Aufklärungsprozess geholfen. Sein Blick folgte den schnurgerade in Richtung Rheine führenden Bahngleisen. In der Ferne war eine Brücke zu erkennen. Die musste zur B70 gehören. Wie ein Klangteppich lag das Rauschen und Dröhnen der die Brücke passierenden Fahrzeuge über der Landschaft. Schaute man nach rechts, reichte das Doppelband der Gleise bis zum Horizont. Rostig braune Stahlschienen, den Kopf blank gerieben von den Radreifen unzähliger Triebwagen, Lokomotiven und Waggons. Darunter hell leuchtende Betonschwellen, verlegt in immer gleichem Abstand, Querschwelle um Querschwelle, wie das bleiche Gerippe zweier endlos langer Schlangen, eingebettet in steingrauem Schotter. Saftig grüne Bäume und Sträucher zu beiden Seiten. Der Bahnübergang, auf dem er stand, mit seinen Halbschranken, Signalanlagen und Andreaskreuzen unterbrach das Gleichmaß der Schienenstränge. Oberleitungen, die Strecke nach Amsterdam war natürlich elektrifiziert, schwebten an filigranen Trägermasten wie Spinnweben über der Bahntrasse. Eine menschliche Behausung in Sichtweite gab es nicht. Der Bahnübergang Stoverner Straße war ein Ort der Durchreise, des Transits. Kein Platz zum Verweilen. Und doch war er für einen Menschen zur Endstation geworden.
Man hatte den Toten auf die Betonplatten gelegt, unter denen sich die zur Signalanlage des Bahnübergangs führenden elektrischen Leitungen verbargen. Der junge Mann war mit einer dunkelgrünen Latzhose bekleidet, auf die schwarze Knietaschen aufgenäht waren. Schob man Kniekissen in diese hinein, ließ es sich im Knien gelenkschonend und schmerzarm arbeiten. Eine typische Hose wie sie Landwirte oder Gärtner bei der Arbeit trugen. Der Kopf des Mannes war zur Seite geneigt. Es sah fast so aus, als schliefe er.
Die Notärztin, deren aufreibender Berufsalltag deutliche Spuren in ihrem zerfurchten Gesicht hinterlassen hatte, erwiderte Rumphorsts Gruß mit einer müden Geste. »Ein Mann aus der Radfahrergruppe hat den Toten dort zwischen den Schienen gefunden«, sagte sie und wies mit der Rechten auf die stadtauswärts führende Bahnlinie. »Zu zweit haben sie ihn dann von den Gleisen gezerrt, weil ein Zug kam, und ihn schließlich hier abgelegt.«
Rumphorst nickte. Das deckte sich mit der Meldung, die bei der Polizei eingegangen war.
»Wir haben den Toten so belassen, wie wir ihn vorgefunden haben«, fuhr die Ärztin fort, »und auch den von den Radlern angegebenen Fundort nur grob inspiziert und fotodokumentiert.«
»Können Sie etwas zur Todesursache sagen?« Rumphorst kratzte sich am Kinn. Der Körper des Mannes wirkte unversehrt. Von einem Zug war er offenbar nicht erfasst worden. Wortlos kniete sich die Ärztin ins Gras. Vorsichtig drehte er den Kopf des Toten. Eine lange, klaffende Wunde wurde sichtbar, die sich auf der rechten Seite des Schädels von der Wange bis zum Scheitel hinzog. Im oberen Bereich der Wunde schimmerte in der Tiefe weiße Gehirnmasse. Das dichte braune Haar beidseits der Wundränder war blutverklebt. Nach Rumphorsts langjähriger Erfahrung konnte eine solche Verwundung nur tödlich sein.
Die Erklärung, zu der die Ärztin nun ansetzte, bestätigte diese Einschätzung: »Der Tod ist durch ein schweres Schädel-Hirn-Trauma verursacht worden, das der Mann wahrscheinlich bei einem Sturz auf die Gleiskante erlitten hat.«
»Kann ein Sturz solch eine Verletzung verursachen?« Zweifelnd schaute Rumphorst auf die klaffende Kopfwunde.
»Möglich ist das schon, wenn der Mann wie ein nasser Sack umgefallen und ohne sich abzufangen mit Wucht auf die Schiene geprallt ist.«
Rumphorst blieb skeptisch. »Aber warum sollte ein junger Mann einfach umfallen?«
»Möglicherweise hatte er einen Herzinfarkt oder einen apoplektischen Insult«, erklärte die Notärztin. »Einen Hirnschlag«, ergänzte sie, als sie den ratlosen Blick des Kommissars sah.
»Hm«, brummte Rumphorst. Er besah sich die Hände des Toten. Schwielen – offenbar war der Mann Handarbeiter gewesen –, aber keine frischen Wunden, wie man sie erwarten würde, wenn sich jemand beim Sturz auf Schotter mit den Händen abfängt. Rumphorsts Zweifel an der Unfalltheorie verstärkten sich. »Kennen wir die Identität des Toten?«
Die Ärztin zuckte die Achseln. »Da uns die baldige Ankunft der Kripo angekündigt wurde«, ein feines Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, »haben wir seine Taschen bisher noch nicht nach Ausweisdokumenten durchsucht.«
Rumphorst nickte und kniete sich nun ebenfalls neben die Leiche. Seine behandschuhten Hände tasteten die Taschen der Latzhose ab. In der linken Oberschenkeltasche wurde er fündig. Das Portemonnaie, das er zutage förderte, enthielt Personalausweis, Führerschein sowie eine EC- und diverse Kundenkarten. Alle waren ausgestellt auf Andreas Joon, geboren am 11. Oktober 2000.
»Ist nicht mal 22 Jahre alt geworden«, murmelte die Notärztin, als Rumphorst ihr den Ausweis zur Aufnahme der Personalien in den Einsatzbericht und den Totenschein reichte.
Im Geldscheinfach des Portemonnaies steckten zwei Zwanziger-Banknoten und ein Foto. Das Foto zeigte eine außergewöhnliche junge Frau. Langes, welliges Haar, rotblond, von einer angenehm warmen Farbe, ein Haar, das man im Plattdeutschen treffend mit dem Begriff»se häw raude Pannen up’t Dak« beschrieb. Helle Haut mit einigen neckischen Sommersprossen rund um die leicht knollige Nase. Ein großer Mund, in dem eine lückenlose Reihe strahlend weißer Zähne leuchtete und der zu einem fröhlichen, ansteckenden Lachen geöffnet schien. Möglicherweise die Freundin des Toten oder dessen Schwester. Der Kommissar steckte das Foto wie auch die Banknoten zurück in die Geldbörse und tastete sodann die übrigen Taschen der Arbeitshose ab. In der rechten Oberschenkeltasche entdeckte er ein Multifunktionstaschenmesser. Die Gesäßtaschen waren leer. Auf dem Brustlatz prangte neben einer aufgestickten Sonnenblume der Schriftzug Gärtnerei Fröschel. Die Brustlatztasche enthielt einen Beutel Fisherman’s friends spearmint, zuckerfrei und eine Packung Papiertaschentücher. Rumphorst fotografierte das Portemonnaie des Toten wie auch die übrigen Tascheninhalte mit seinem Handy und versenkte sie anschließend in zwei papierene Asservatenbeutel.
»Die Gärtnerei Fröschel liegt ganz in der Nähe«, meldete sich die Notärztin zu Wort, als ihr Blick auf die Stickereien fiel. »Nur einige Hundert Meter von hier im Dreieck Salzbergener Straße – Sandkuhle – Kreuzherrenweg.«
»Er könnte also auf dem Weg von oder zu seiner Arbeitsstelle gewesen sein, als er seinen … hm, Unfall hatte.«
»Jedenfalls wohnt er in einer ganz anderen Ecke von Rheine«, erklärte die Ärztin, als sie Rumphorst den Personalausweis des Toten zurückgab. »Felsenstraße 11. Das ist das Hochhaus, das am Ortseingang rechts von der Neuenkirchener Straße liegt. Der Bau ist Ihnen bestimmt schon mal aufgefallen, wenn Sie von Neuenkirchen aus nach Rheine reingefahren sind.«
»Stimmt, wenn man das Kalkwerk passiert hat … ja, da sind mir die mehrstöckigen Häuser rechts voraus schon aufgefallen.« Im Stillen musste Rumphorst zugeben, dass er keine Ahnung hatte, welches Haus die Ärztin meinte. »Es hat schon Vorteile, wenn man ortskundig ist«, schloss er unverbindlich.
Die Notärztin schenkte ihm ein freudloses Lächeln. »Was glauben Sie, wo ich in den letzten fünf Jahren in Rheine schon überall Notfalleinsätze gefahren bin? Da kommt die Ortskunde von ganz alleine, ob man will oder nicht.«
Rumphorst nickte. Das Phänomen kannte er. Nur waren seine Ortskenntnisse bedeutend grobmaschiger, bezogen sich dafür aber auf das gesamte Kreisgebiet. »Ich schaue mir den Fundort mal näher an.«
»Der Tote lag gleich da vorne. Blutspuren sind noch zu sehen, auch wenn nach dem Unfall etliche Züge über die Stelle hinweggedonnert sind. Außer auf dem Schienenkopf.«
Wie sich schnell herausstellte, lag die Ärztin mit ihrer Einschätzung richtig. Die vierte Betonschwelle in Richtung Rheine wies deutliche Blutspuren auf. Desgleichen der schwellennahe Schotter. Auch am rostigen Stahl der Schiene selbst entdeckte Rumphorst Blutspritzer, während der Schienenkopf blank gerieben war. Die Befunde passten zur Wunde am Kopf des Toten. Dieser musste, Rheine im Rücken, zwischen den Schienen des rechten Gleises gestanden haben, war dann offenbar hart und ungebremst mit der rechten Schädelseite auf den Schienenkopf geschlagen und so zu Tode gekommen. Aber warum hatte er die Gleise überhaupt betreten? Wenn Andreas Joon, wie seine Kleidung nahelegte, als Gärtner oder Landwirt arbeitete, was suchte er dann im Schotter des Gleisbettes? Akribisch musterte Rumphorst die Umgebung, machte mit dem Smartphone Fotos der Blutspuren und des Gleisbettes in der Nähe des Leichenfundortes. Auffälligkeiten entdeckte er keine. Warum der junge Mann die Straße verlassen und sich zwischen die Schienen einer sicherlich viel befahrenen Bahnlinie gestellt hatte, blieb ein Rätsel. Und erst recht, warum er hier so massiv gestürzt war. Denn ein Hindernis, an dem sich sein Fuß dermaßen verhakt haben könnte, dass er zu Fall gekommen wäre, entdeckte Rumphorst nicht. »Allenfalls hätte er an einer der Schwellen hängen bleiben können«, überlegte der Kommissar laut und stapfte nachdenklich zurück zum Leichnam.
Die Notärztin, mit dieser Hypothese konfrontiert, winkte ab. »Bei dem in diesem Fall zu erwartenden Stolperer wäre der Sturz dank des Patellarsehnenreflexes sicherlich nicht ungebremst und mit der für die Entstehung einer solch tiefen Wunde notwendigen Wucht erfolgt.«
Rumphorst stöhnte entnervt. Wieder löste sich eine seiner Vermutungen in Luft auf. Wie er es auch drehte und wendete, er fand keine plausible Erklärung für den tödlichen Sturz Joons. Die Unfalltheorie zu akzeptieren, bereitete ihm allerdings zunehmend Bauchschmerzen.
»Herr Oberkommissar, ich müsste jetzt zurück in die Rettungswache!«, drängte die Ärztin. »Eine vorläufige Todesbescheinigung habe ich ausgestellt. Aber ich denke, angesichts der Fundumstände des Toten sollte ein Kollege in der Rechtsmedizin eine vollständige Leichenschau vornehmen.«
Rumphorst nickte. »Da gehe ich mit Ihnen vollkommen d’accord.« Der Leichnam würde also in die Rechtsmedizin nach Münster überführt werden.
»Dann empfehle ich mich.« Ein flüchtiges Lächeln, ein kurzes Heben der Hand und die Ärztin war verschwunden.
Wenig später hatte Rumphorst zwei Telefonate geführt und stand nun in Gedanken versunken neben der Leiche. Mit geräuschvollen Schritten stakste Kommissar Bär heran und gesellte sich zu ihm.
»Na, war die Befragung der Radfahrer ergiebig?«
»Eher ermüdend.« Bär gähnte theatralisch. »Ein gewisser Herr …«, er schaute kurz in sein Notizbuch, »Manfred Breuger hatte schrecklich viel zu erzählen. Ich bin jetzt absolut im Bilde, was die Unterschiede zwischen Pedelecs und E-Bikes angeht. Dazu kann ich dir zehn Vorteile des Pedelecs gegenüber dem Normalrad erläutern, Minimum. Und die Fahrtroute der Gruppe kenne ich auch in- und auswendig.«
»Relevante Aussagen, die unseren Toten hier betreffen, gab es die auch?«
»Die gab es tatsächlich. Die Radfahrergruppe kam von der Saline und wollte weiter in Richtung Neuenkirchen. Beim Überqueren des Bahnübergangs Stoverner Straße fiel dem am Ende der Gruppe fahrenden«, Bär schaute erneut in sein Notizbuch, »Josef Mandelstein ein dunkles Bündel auf den Gleisen auf, das sich bei näherem Hinsehen als ein zwischen den Schienen liegender Mensch entpuppte. Da die Schranken sich bereits schlossen, hat Mandelstein offenbar relativ hektisch versucht, den leblosen Körper aus dem Gleisbett zu zerren. Auf seinen Zuruf hin ist ihm der Leiter der Radlergruppe, besagter Manfred Breuger, zur Hilfe geeilt. Gemeinsam haben sie den Mann zur Seite geschafft und im Gras abgelegt. Kurz darauf hat dann ein Zug in schneller Fahrt den Bahnübergang passiert. Ich hab’ mich eben telefonisch beim Fahrdienstleiter in Rheine erkundigt: Das muss der IC 240 nach Amsterdam gewesen sein, der hier gegen 10.23 Uhr durchgekommen sein dürfte. Der vorausgehende Zug auf dieser Strecke war die Regionalbahn nach Bad Bentheim, die den Bahnübergang um etwa 9.52 Uhr passiert hat. Der Tote muss also zwischen 9.52 Uhr und, sagen wir, 10.20 Uhr auf die Gleise gelangt sein.«
»Ist den Radfahrern auf ihrem Weg hierher ein Fahrzeug begegnet? Oder haben sie jemanden in der Nähe des Bahnübergangs gesehen?«
»Beide Male nein. Alle Radler waren sich einig, dass ihnen, nachdem sie von der Salzbergener in die Stoverner Straße eingebogen sind, weder ein Fahrzeug noch ein fremder Radfahrer begegnet ist. Am Bahnübergang waren sie, gleichfalls nach übereinstimmenden Aussagen aller, die einzigen anwesenden Personen.«
Die Kommissare schwiegen einen Moment.
»Und, wie sehen deine Ergebnisse aus?«, brummte Bär schließlich.
Mit knappen Worten setzte Rumphorst den Kollegen ins Bild.
Aufmerksam schaute sich Bär die klaffende Kopfwunde des Mannes an. »Tatsächlich kaum glaubhaft, dass er sich die allein durch einen Sturz zugezogen hat.«
»Wie dem auch sei, am Montag wird uns Nottendorf dazu sicher mehr sagen können. Ich habe eben mit der Staatsanwaltschaft telefoniert. Der Leichnam geht zu ihm in die Rechtsmedizin nach Münster.«
Ein dunkler Kombi mit den klassischen weißen Gardinentafeln in den hinteren Fenstern und der Aufschrift Bestattungsinstitut Rheinbeck auf der Fahrertür näherte sich von der Salzbergener Straße her.
»Ah, da ist ja schon der Leichenwagen.«
Das Fahrzeug bremste sanft und hielt. Zwei schwarz gekleidete Männer stiegen aus. Der Ältere öffnete die Heckklappe und gab den Blick auf einen grauen Zinksarg frei. Mit routinierten Griffen zogen die Männer den Sarg aus dem Wagen, grüßten die Kommissare mit einem knappen Nicken und begannen nach einer einladenden Handbewegung Rumphorsts damit, den Leichnam in das geöffnete Behältnis zu betten. Als sie wenig später den Bahnübergang verließen, hatten sie kaum mehr als zwei Sätze mit den beiden Kripobeamten gewechselt. Der tagtägliche Kontakt mit dem Tod schien sie stumm gemacht zu haben.
»Das war’s dann wohl für uns«, stellte Bär fest. »Die Radfahrer kommen übrigens am Montag auf dem Rückweg von Gronau wieder in Rheine vorbei und Josef Mandelstein, der Mann, der die Leiche entdeckt und geborgen hat, hat zugesagt, seine Aussage in der Polizeistation zu Protokoll zu geben.«
Am Bahnübergang begannen die Streifenpolizistinnen die rot-weißen Flatterbänder einzurollen, mit denen sie den Fundort abgesperrt hatten. »Die Presse ist auch vor Ort«, stellte Rumphorst mit einem feinen Lächeln fest. Bär folgte dem Blick des Oberkommissars und entdeckte eine massige Gestalt, die sich, ein schwarzes Notizbuch in der Hand, gerade angeregt mit den beiden uniformierten Kolleginnen unterhielt. »Der gewichtige Herr dort drüben ist Alois Nickel, der Chefredakteur der Rheiner Allgemeinen Zeitung. Im Zusammenhang mit dem Mord im Falkenhof hatte ich mit ihm zu tun. Muss fast zwei Jahre her sein. Der brennt sicher darauf, Genaueres über unseren Toten hier zu erfahren.«
»Dann soll er gefälligst auf die Pressemitteilung warten«, knurrte Bär. »Hoffentlich hält sich auch die Schutzpolizei mit Informationen zurück.«
Rumphorst zuckte die Schultern. »Mit den Radfahrern wird Nickel sicherlich schon gesprochen haben. Mehr als die könnten ihm derzeit weder wir noch die beiden uniformieren Kolleginnen verraten.«
»Stimmt auch wieder. Na, der geschwätzige Herr Breuger wird dem Chefredakteur sicher gerne seine Story in die Feder diktieren, solange er nur darin vorkommt«, brummte Bär. »In der Hauptrolle, versteht sich.«
»Lass uns kurz zusammenfassen, was wir bisher haben«, lenkte Rumphorst den Blick zurück auf den Leichenfund. »Also: Ein junger Mann zieht sich auf den Gleisen nahe dem Bahnübergang Stoverner Straße eine tiefe Kopfwunde zu, an der er verstirbt.«
»Wahrscheinlich durch einen Sturz.«
»Möglicherweise durch einen Sturz.« In Rumphorsts Stimme schwang Skepsis mit. »Bereits an dieser Stelle ergeben sich für mich eine Reihe von Fragen: Warum stürzt ein offenbar gesunder junger Mensch so schwer auf die Schienen, dass er an den dabei im Kopfbereich erlittenen Verletzungen verstirbt? Und das, ohne sich Prellungen und Abschürfungen an den Händen zuzuziehen, mit denen man sich normalerweise bei einem Sturz abstützen würde. Warum ist der junge Mann, seiner Kleidung nach ein Gärtner, überhaupt auf die Gleise gegangen? Was wollte er dort?«
»Warum war er eigentlich auf der Stoverner Straße unterwegs und hatte kein Arbeitsgerät dabei?«, ergänzte Bär die Liste der offenen Fragen.
»Und das zu Fuß, ohne fahrbaren Untersatz.«
»Stimmt! Welcher junge Mensch geht heute noch längere Strecken zu Fuß, wenn er fahren kann. Er nimmt doch eher einen Wagen oder, wenn der nicht verfügbar ist, das Fahrrad oder einen dieser modernen E-Scooter, die überall als Verkehrshindernis rumstehen. Eine wahre Landplage!«
Zustimmend senkte Rumphorst den Kopf, auch wenn er die E-Scooter ein wenig positiver bewertete als der Kollege Bär. »Eine Menge offener Fragen. Bevor die nicht geklärt sind, steht die Unfalltheorie auf ziemlich wackeligen Beinen.«
»Vielleicht bringt die Obduktion neue Erkenntnisse. Doktor Nottendorf ist doch immer für eine Überraschung gut.« Bär grinste.
»Ich denke, wir sollten es dieses Mal selber übernehmen, die Angehörigen des Toten zu informieren.«
»Die uniformierten Kolleginnen werden dankbar sein.«
»Aber zuvor statten wir der Gärtnerei Fröschel, dem Betrieb, in dem der junge Mann arbeitet, einen Besuch ab«, entschied Rumphorst. »Nach Auskunft der Notärztin liegt die gleich um die Ecke.«
»Wenn die Gärtnerei denn tatsächlich die Arbeitsstätte des Toten ist. Möglicherweise trägt er seine Latzhose ja nur, weil die so bequem ist.«
»Das werden wir dann ja sehen«, sagte Rumphorst. »Also: Auf geht’s!«
Am Steuer des Dienstwagens kam den Oberkommissar ein Gedanke: »Weißt du, was komisch ist, Jakob? Ich habe bei der Leiche kein Smartphone gefunden. Auch im Gleisbett lag keins. Wer ist denn heutzutage noch ohne Handy unterwegs?«
»Stimmt. Man fühlt sich richtig nackt ohne das Ding.«
»Besaß der Mann etwa kein Handy?«, überlegte Rumphorst weiter. »Oder hat man es ihm vor oder nach seinem Tod abgenommen?«
»Zwei weitere Fragen auf unserer Liste«, räumte Bär ein.
»Eine Liste, die für meinen Geschmack inzwischen deutlich zu lang ist«, knurrte Rumphorst und startete den Wagen.
EIN PAAR BIS ZUM 1. MAI
Der Weg zur Gärtnerei Fröschel