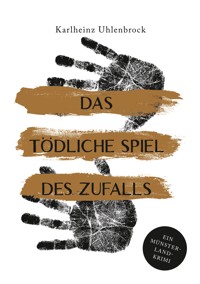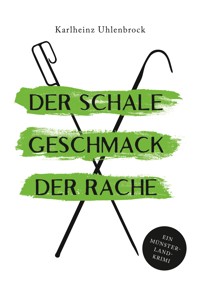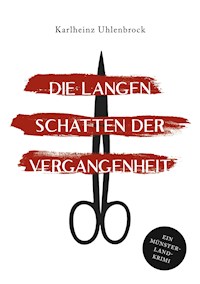
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rheine im August 2020. Das Corona-Virus hält die Stadt im Griff. Konzerte und Theatervorstellungen fallen aus, Olympia und Fußball-EM sind auf das nächste Jahr verschoben. Die Rheiner Allgemeine Zeitung hat Mühe, ihre Seiten zu füllen. Da kommt die Eröffnung der Ausstellung "Bürgersinn und Seelenheil" im Falkenhof-Museum gerade recht. Von seinem Chefredakteur erhält Reporter Moritz Mey den Auftrag, über das dort präsentierte ebenso pracht- wie geheimnisvolle Dionysius-Evangeliar zu berichten. So bekommen er und seine Frau Anna die Gelegenheit, sich die Ausstellung vorab anzusehen. Doch bei der Führung durch Ausstellungsleiter Andreas Brockmann wartet auf sie das Grauen: Zu Füßen des Dionysius-Evangeliars liegt ein Toter in seinem Blut, brutal erstochen mit einer eigentümlichen Schere. Während Kriminaloberkommissar Luke Rumphorst und sein Team bei Motiv und Täter im Dunkeln tappen, recherchieren die Meys auf eigene Faust. Die Spur führt dabei weit in die Vergangenheit ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Eva, die zu treffen das größte Glück meines Lebens war.
Es gibt kein Heute ohne das Gestern.
Discipulus est prioris posterior dies. Der heutige Tag ist des gestrigen Schüler. Publilius Syrus (um 90–40 v. Chr.), Römischer Moralist und Possenschreiber
Inhaltsverzeichnis
RHEINE AN DER EMS INNENSTADT
DIE HANDELNDEN PERSONEN
IN RHEINE
IN AACHEN
PROLOG
ERSTER TEIL
MEY, ÜBERNEHMEN SIE
SPAGHETTI UND EINE GUTE IDEE
EIN OPFER DER PANDEMIE
VERGANGEN UND VERGESSEN
ZU EINER ANDEREN ZEIT, AN EINEM ANDEREN ORT
ZWEITER TEIL
DIE NACHT IST NICHT ALLEIN ZUM SCHLAFEN DA
GESPENSTER DER VERGANGENHEIT
DESSOUS UND EIN SCHARFER BLICK
»BÜRGERSINN UND SEELENHEIL«
TRAUMA - VERARBEITUNG
ERMITTLUNGSBEGINN
PLANEN BEI BAGUETTE UND SALAT
EINE ERSTE BEFRAGUNG
EIN AUFTRAG FÜR DEN HAUSMANN
RECHERCHEN
EINE ENTDECKUNG
DOKTOR NOTTENDORFS FUND
WOHNUNGSDURCHSUCHUNG
EIN HAUSMANN AUF ABWEGEN
RÜGE VOM CHEFREDAKTEUR
MULTICOLOURED
EIN LETZTER SCHRECK DES TAGES
EINE FOLGENSCHWERE ENTSCHEIDUNG
DRITTER TEIL
JOGGINGTOUR
MORGENDLICHER DISPUT
MORDKOMMISSION »FALKENHOF«
MOTORENGERÄUSCH
… UND EINE ERSTE SPUR
OBDUKTION
EINE NEUE KOLLEGIN?
ARCHIVARBEIT
FOTOSCHAU IM GARTEN
GESTÄNDNIS
COCKTAILS UND EIN MITTAGSSNACK
DER TEUFEL IM DETAIL
DER SCHWARZE KOFFER
IN DER SACKGASSE
NOTRUF
UM JEDE SEKUNDE!
AM ABGRUND
ZUR FALSCHEN ZEIT AM FALSCHEN ORT
ZU EINER ANDEREN ZEIT, AN EINEM ANDEREN ORT
VIERTER TEIL
ERINNERUNGEN KEHREN ZURÜCK
IM INNEREN DES EVANGELIARS
NACHBETRACHTUNG
ZU EINER ANDEREN ZEIT, AN EINEM ANDEREN ORT
DANKSAGUNG
FAKTEN UND FIKTION
RHEINE AN DER EMS – INNENSTADT –
Falkenhof-Museum
Ehemaliger Getreidespeicher
Restaurant Veracruz
Stadtkirche St. Dionysius
Pfarrbüro St. Dionysius
Marktplatz
Stadtarchiv
RAZ (Rheiner Allgemeine Zeitung)
Villa von Anna und Moritz Mey (außerhalb des Kartenausschnitts)
DIE HANDELNDEN PERSONEN
IN RHEINE
MORITZ MEY
Von der Ausbildung her Historiker, von Beruf jedoch Hausmann und freier Mitarbeiter der Rheiner Allgemeinen Zeitung. Akribisch und hartnäckig in der Recherche.
ANNA MEY
Lehrerin für Biologie und Mathematik am Rosalind-Franklin-Gymnasium in Rheine. Kann geduldig zuhören, aber auch rasch handeln.
ALOIS NICKEL
Chefredakteur der Rheiner Allgemeinen Zeitung und gewichtiger Liebhaber von Kaffee und süßen Versuchungen.
MARGARETE (MAGGIE) UPPKAMPP
Aktuell arbeitslos – ihr Nagelstudio fiel dem ersten Corona-Lockdown zum Opfer.Träumt von einer Chance auf das große Glück.
MERLE RUBIN
Kriminalhauptkommissarin und Leiterin einer Mordkommission. Ihr eilt der Ruf voraus, eine brillante Analytikerin zu sein, die ihr Team bis an seine Grenzen fordert.
LUKE RUMPHORST
Kriminaloberkommissar und ein Ermittler alter Schule. Ruhig, energisch und entschlossen – außer beim Umgang mit dem weiblichen Geschlecht. Daher auch mit 36 Jahren noch Junggeselle.
JAKOB BÄR
Macht seinem Namen alle Ehre: bärbeißiger, notorisch schlecht gelaunter Kriminalkommissar mit einem Hang zu verschrobenen Theorien.
EDGAR FALTERMEYER
Kriminalkommissar; spielt als Kriminalermittler die zweite Geige und leistet die Fußarbeit, so wie es dem Assistenten in einer Mordkommission eben zukommt.
AZRA CEYLAN
Polizeibeamtin in Rheine, mit dem Blick auf höhere Weihen. Attraktiv und doch single – und letzteres durchaus mit guten Gründen.
DOKTOR PAUL NOTTENDORF
Wortkarger, Pfeife rauchender Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Münster, dessen pedantische Arbeit nicht bei allen Kriminalbeamten Anerkennung findet.
ANDREAS BROCKMANN
Leiter der Ausstellung »Bürgersinn und Seelenheil« im Falkenhof-Museum in Rheine. Sympathisch, kompetent und dennoch nicht vor Fehlern gefeit.
ADAMA DIABATÉ
Gründlich und zuverlässig arbeitende Reinigungskraft im Falkenhof-Museum in Rheine. Stammt ursprünglich aus Mali, was seinen Namen wie auch seine dunkle Hautfarbe erklärt.
MARKUS KLEIN
Tattoo-geschmückte, zweite Reinigungskraft im Falkenhof-Museum. Nicht der Hellste, genießt jedoch das Leben.
AGNETHA LÖCHTE
Kassiert beruflich im Falkenhof-Museum den Eintritt und verkauft die Souvenirs. In ihrer Freizeit eine passionierte Joggerin. Greift beherzt zu, als ihr das Schicksal die Chance zum großen Geldgewinn bietet – aber Hand aufs Herz: Wer würde das nicht tun?
PETER KÖRNER
Hochherziger Stifter eines wertvollen Buches und, obgleich schon lange verstorben, der Stein, der die Ereignisse ins Rollen bringt.
JULIA KAMPEL
Gelernte Archivarin und aktuell Studentin der Geschichte. Archiviert im Ferienjob alte Ausgaben der Rheiner Allgemeinen Zeitung .Ein Glücksfall für die Zeitung und für jeden, der im Archiv nach Spuren der Vergangenheit sucht.
FRITZ MOHN
Ein Elektriker mit kurz geschorenem Haar, Tattoos auf den Armen und Springerstiefeln an den Füßen, der auf Feldwegen zu einem einsamen Bauernhof fährt – noch Fragen?
IN AACHEN
WILHELM UPPKAMPP
Ein Goldschmied mit hochgepriesener fachlicher Kompetenz. Zugleich ein Mensch mit manchem Laster. Doch würzen nicht gerade diese den faden Alltag eines Junggesellen?
CÄCILIA CORNRADE
Eine junge Witwe, die ihre magere Pension durch die Untervermietung eines Zimmers ihrer Wohnung aufbessert.
PAUL GROTHUES / LAMBERT QUIRIN / HEINRICH KOELGES / EGIDIUS ERKENS
Eine honorige Runde gesetzter Herren, welche alle einem gemeinsamen, wenngleich bedauerlicherweise illegalen Hobby frönen.
JOHANNES OPRÉE
Weilte in Berlin bereits als Gast am Kaiserhof und bringt damit ein wenig hauptstädtisches Flair in die rheinische Provinz.
PROLOG
Das Fenster im Obergeschoss des Turmes war lange Zeit nicht geöffnet worden. Erst nach heftigem Zerren schwangen die hölzernen Fenster mit einem widerwilligen Knarren nach innen auf. Der Ausblick, der sich bot, war atemberaubend. Die ganze Stadt lag einem zu Füßen, ein Meer von schwarzen und roten Dächern. Am Horizont war das Grün der Felder zu erahnen. Zur Linken entdeckte man ein blaues Band. Der Fluss, dessen Wasser wie schon seit Jahrtausenden der Nordsee zuströmte. Vom nahen Marktplatz klangen die Gespräche der Café-Besucher herauf, nur unverständliche Worte, natürlich, ein gleichmäßiges, lebenslustiges Murmeln. Der warme Wind zerzauste einem das Haar und fast hatte es den Anschein, als müsste man nur die Arme ausbreiten und die Brise würde einen forttragen, wohin auch immer man wolle.
Normalerweise wäre dies ein Augenblick zum Genießen.
Doch im Hier und Jetzt war nichts normal. Und es gab auch nichts zu genießen.
Das Gefühl, auf dem Wind reiten zu können, war reine Illusion. Ein Schritt aus dem Fenster und man wäre zurück auf dem harten Boden der Realität. Der Sturz würde nur wenige Sekunden dauern. Mit rasender Geschwindigkeit käme das Kopfsteinpflaster auf einen zu. Menschen, die jetzt noch unbeschwert in den Cafés und Restaurants rund um den Marktplatz saßen, würden aufspringen, kreischen, schreien vor Entsetzen. Es würde gerade noch Zeit für einen Atemzug bleiben – den definitiv letzten. Mit dem Aufschlag wäre dann alles gnädig ausgelöscht: die Ausweglosigkeit, die Verzweiflung, die Angst.
Aber eines bliebe: die Schuld. Die würde man mitnehmen, wohin auch immer man dann ginge. Die schwarze, blutbeladene Schuld. Sie würde einen begleiten auf dem Weg in die Hölle, so es denn eine gab. Die Schuld ließe sich nicht auslöschen mit einem Sprung in die Tiefe. Sie würde auf immer bleiben, ein unauslöschlicher Teil seiner selbst, eingebrannt in die Flügel der Seele.
Ein Gedanke, der die Gestalt am Turmfenster trotz der sommerlichen Hitze erschaudern ließ, sie in ihrem Innern mit eisigem Entsetzen erfüllte. Ein Gedanke, der sie zögern ließ, den letzten Schritt zu tun.
Noch …
Im Treppenaufgang waren hastige Schritte zu hören.
Sie kamen.
Kamen, sie zu holen!
Sie musste sich entscheiden. Jetzt!
ERSTER TEIL
Rheine, Montag, 3. August, bis Mittwoch, 5. August 2020
MEY, ÜBERNEHMEN SIE
Ihre Bluse war eine Augenweide. Der luftige Stoff fiel in feinen Falten. Das zarte, rosafarbene Muster harmonierte auf angenehme Weise mit dem Sommerblumenstrauß neben der Computertastatur. Der oberste Blusenknopf spannte, was seine Gedanken auf ihre üppige Oberweite lenkte.
Seit gut zehn Minuten saß Moritz Mey im Vorzimmer von Alois Nickel, seines Zeichens Chefredakteur der RAZ, der Rheiner Allgemeinen Zeitung. Nickel hatte ihn zu einem Gespräch gebeten. Genauer gesagt: Es war Nickels Sekretärin Lisa Leuring gewesen, die ihn telefonisch kontaktiert und einen Gesprächstermin für den heutigen Montag, zehn Uhr vereinbart hatte.
»Und seien Sie pünktlich. Sie wissen ja: Herr Nickel wartet nicht gerne.«
Moritz Mey war pünktlich, der Chefredakteur war es nicht. So saß Mey seit einer Viertelstunde wartend im Redaktionssekretariat und hatte Zeit und Muße, seine Blicke und seine Gedanken schweifen zu lassen.
Es kam nicht oft vor, dass man ihn als freien Mitarbeiter zu einem Gespräch in die heiligen Hallen der Redaktion bat. In der Regel erhielt er seine Arbeitsaufträge per Mail oder Telefonanruf. Auch die fertigen Artikel schickte er auf elektronischem Wege. In die Redaktion kam er eigentlich nur zum alljährlichen Betriebsfest im Januar, zu dem jeder Mitarbeiter angehalten war, einen kulinarischen Baustein zum Buffet beizusteuern, das alle Jahre wieder fleischlastig und überladen war. Üblicherweise entschied sich Moritz in letzter Minute dafür, seinen legendären griechischen Hirtensalat mitzubringen, eine Spezialität mit reichlich Zwiebeln und Knoblauch, die ihm in der Redaktion den Spitznamen »Sirtaki« eingebracht hatte.
Die Tür zum Büro des Chefredakteurs war noch immer geschlossen. Frau Leuring tippte mit bewunderungswürdiger Geschwindigkeit. Dabei schien sie so gut wie nie Korrekturen vornehmen zu müssen. Beneidenswert. Der oberste Knopf ihrer Bluse hatte dem Druck bisher standgehalten. Vielleicht waren ja Haken und Öse als Sicherung in die Knopfleiste eingenäht worden.
Moritz Mey kannte sich damit aus. Eigentlich kannte er sich mit allem aus, was mit Kleidung, Haushalt und Kochen zu tun hatte. Denn Moritz Mey war Hausmann. Eine Profession, die er nicht ganz freiwillig gewählt hatte.
Ursprünglich hatte er Gymnasiallehrer werden wollen. Deutsch und Geschichte hatten schon in der Schule zu seinen Lieblingsfächern gezählt. Was lag näher, als diese Passion im Studium fortzusetzen und gerne auch später im Beruf? Doch die Lehrerschwemme der frühen 80er-Jahre machte ihm einen Strich durch diese Rechnung. Nicht einmal für eine Vertretungsstelle hatte sein Zweier-Examen gereicht. Pech oder Schicksal – wer konnte das sagen? Das Studium hatte in jedem Fall Spaß gemacht und auf der Examensparty hatte er dann Anna kennengelernt, eine zielstrebige Studentin der Naturwissenschaften. Langes blondes Haar, schlank und mit einem unwiderstehlichen Lachen, seine Traumfrau. Nach drei Monaten zogen sie zusammen. Ihre Hochzeit in einem Hausboot auf der Ems wurde ein rauschendes Fest. Neun Monate später kam Sohn Malte zur Welt. Und dann ergab sich alles fast zwangsläufig. Nach dem Referendariat bekam Moritz keine Stellenangebote, seine Frau schon. Mathematiklehrerinnen waren eben gesucht. Die Geburt der Zwillinge Lotta und Luise zementierte dann endgültig seinen Weg zum Hausmann, ein Beruf, der ihm inzwischen durchaus Spaß machte, ihn aber in den 90er-Jahren unter seinen Freunden und Bekannten zum Exoten hatte werden lassen.
Heute waren die drei Kinder längst aus dem Haus. Der Älteste arbeitete als IT-Spezialist in Münster, die Zwillinge studierten in Aachen. Und er hatte seinen Job als freier Mitarbeiter bei der RAZ. Ein Mitarbeiter, der noch immer auf seinen Termin beim Chefredakteur wartete.
Zum gefühlt hundertsten Mal ließ Mey seinen Blick durch das Sekretariat schweifen. Sehr viel Neues zu entdecken gab es hier nicht mehr. Frau Leurings Finger glitten noch immer wieselflink über die Computertastatur. Neben ihr lag auf einem weißen Porzellanteller das Markenzeichen des Corona-Zeitalters: eine rosafarbene Alltagsmaske. Zu tragen an allen Orten, an denen sich Menschen nahekommen konnten. Aktuell gerade außer Dienst, weil ihre potenzielle Trägerin konsequent auf ausreichend Abstand zur einzigen weiteren Person im Raum achtete – und dies nicht nur räumlich. Sie siezte ihn auch nach zehn Jahren gemeinsamer Tätigkeit bei der RAZ noch immer.
›Doch Chapeau‹, dachte Mey. ›Maske und Bluse harmonieren perfekt. So wird das ungeliebte Utensil zum modischen Accessoire.‹ Was seiner Meinung nach den Tragekomfort allerdings kaum erhöhen dürfte. ›Eigentlich‹, überlegte er, ›bietet solch eine Gesichtsmaske noch eine Fülle weiterer Möglichkeiten. Man könnte sie zum Beispiel als Werbeträger nutzen, so wie die Trikots im Sport, als Reklamefläche für Zahncreme, Lippenstift oder Elektrorasierer. Oder als Kommunikationsmittel. Sprüche wie Mies gelaunt oder Könnte heute tanzen würden dem Gegenüber im Büro direkt vermitteln, wie es um die Laune des Maskenträgers bestellt ist.‹ Er grinste. ›Sofern man denn morgens die richtige Maske aufsetzt.‹
»Herr Mey!«, riss ihn die sonore Stimme der Sekretärin aus seinen Gedanken.
»Ja?«
»Herr Nickel hat jetzt Zeit für Sie.«
Mey brauchte einen Moment, um in die Wirklichkeit zurückzufinden.
»Ähm, danke.« Er erhob sich.
»Aber Herr Mey!« Die Sekretärin klang entrüstet.
Mey schaute irritiert.
»Sie wissen schon, die Maske.«
»Ach, natürlich. Die Maske.« Vermummt wie ein Chirurg im Operationssaal betrat er das Büro des Chefredakteurs.
»Moin, Moritz. Nimm doch Platz. Die Maske kannst du abnehmen. Wir halten Abstand.«
Erleichtert verstaute Mey den Mund-Nasen-Schutz in der Brusttasche seines Sommerhemdes. Die Seitenteile schauten oben heraus. ›Ein Pendant zum klassischen Einstecktuch‹, ging es ihm durch den Kopf. ›Womit wir eine weitere Möglichkeit hätten, die Maske zu nutzen, wenn auch eine eher bizarre.‹ Mey grinste. Vorsichtig setzte er sich auf den Besucherstuhl, der einen wenig vertrauenerweckenden Eindruck machte und beim Hinsetzen knarrte. Sein schwarzes Notizbuch, das er zu allen Zeitungsterminen mitnahm, legte er auf den Rand des ausladenden Kiefernschreibtisches, auf dem Stöße ordentlich geschichteten Papiers die Skyline einer nordamerikanischen Downtown nachzubilden schienen. Alois Nickel war und blieb eben ein Pedant.
»Einen Kaffee?«
Mey stellte seine Ohren auf. Innerlich. Denn wenn der Chefredakteur bei einer Besprechung Kaffee anbot, dann hatte er ein Anliegen oder eine unangenehme Mitteilung an den Mann zu bringen. Oder beides.
»Gerne.«
Nickel betätigte einen der vielen Schalter des auf dem Sideboard platzierten, chromglänzenden Kaffeeautomaten. Mit einem brummenden Geräusch begann das Mahlwerk der Maschine zu arbeiten. Wenig später standen zwei Tassen frisch aufgebrühten Kaffees vor ihnen. Im Redaktionsbüro breitete sich ein köstlicher, aromatischer Duft aus.
»Dazu vielleicht einen Dominostein?«
Mit einer fließenden Bewegung zauberte Nickel einen Teller mit einem handverlesenen Sortiment an weißen, hellbraunen und schwarzen Dominosteinen aus den Tiefen seiner Schreibtischschublade. Die Lebkuchenspezialität war die erklärte Lieblingssüßigkeit des Redaktionsleiters der RAZ. Dass er einen Großteil seines nicht eben geringen Bauchumfanges dieser Liebe verdankte, galt als offenes Geheimnis.
»Greif zu. Sie sind gekühlt.«
Nickels Büro verfügte über einen kleinen Kühlschrank, in dem neben Wasserflaschen stets auch einige Packungen Dominosteine lagerten. In der Redaktion munkelte man, dass er sie von einem speziellen Lieferanten aus Aachen bezog.
»Danke, Alois, vielleicht später.« Bei den aktuellen hochsommerlichen Temperaturen stand Mey zwar durchaus der Sinn nach etwas Kühlem, doch bestimmt nicht nach gekühltem Weihnachtsgebäck.
»Wie du willst.« Nickel schien enttäuscht. »Ich nehme schon mal einen mit … weißer Schokolade.« Genussvoll ließ er den Dominostein zwischen seinen Zähnen verschwinden.
Vorsichtig nahm Mey einen ersten Schluck Kaffee. Heiß und gut!
Alois Nickel räusperte sich. »Wie du weißt, feiert unsere Stadtkirche St. Dionysius in diesem Jahr den 500. Jahrestag ihrer Fertigstellung.«
Mey nickte. Das 500-Jahr-Jubiläum der Dionysius-Kirche war seit mehr als zwei Jahren ein großes Thema in Rheine. Begonnen hatte man mit dem Kirchenbau nach neueren Erkenntnissen um etwa 1440. Chronischer Geldmangel in der mit knapp 2000 Seelen damals noch recht kleinen Pfarrei, aber auch kriegerische Auseinandersetzungen hatten den Baufortschritt verzögert. So konnte die Errichtung der spätgotischen Hallenkirche erst anno 1520 mit der Vollendung des Turmes und der Weihe der Glocken abgeschlossen werden.
»Über mehrere Generationen haben die Rheiner Bürger an ihrer Kirche gebaut, ihren Schweiß und ihr Geld in den Bau eingebracht, Pfennig für Pfennig. Sie haben den Bau praktisch ihrem Alltag abgerungen. Einem verdammt harten Alltag, geprägt von beschwerlicher Arbeit und oftmals auch von Hunger, Krieg und frühem Tod.«
Mey nickte. Als Historiker konnte er diesem Statement nur zustimmen.
»Zur Feier des Jubiläums sind von der Kirchengemeinde eine Vielzahl von Veranstaltungen geplant und akribisch vorbereitet worden. Orgelkonzerte in der Dionysius-Kirche, eine Dombauhütte, ein Jahrmarkt, um nur einige zu nennen. Selbstverständlich hatte unsere Zeitung geplant, diesen Veranstaltungsreigen journalistisch zu begleiten. Vorgesehen waren neben einem bunten Potpourri verschiedener Artikel auch vier mehrseitige Beilagen. Letztere natürlich mit reichlich Platz für Anzeigenkunden.«
Der Chefredakteur legte eine theatralische Pause ein.
»Durch den Corona-Lockdown und die anschließenden Vorgaben für alle Arten von öffentlichen Veranstaltungen sind die meisten Veranstaltungen zum Kirchenjubiläum ausgefallen – und damit haben sich auch unsere Sonderbeilagen und alle mit ihnen verbundenen Einnahmen aus dem Anzeigengeschäft in nichts aufgelöst. Einnahmen, die wir in der momentan schwierigen Zeit mehr als gut hätten gebrauchen können.«
Nickel holte Luft.
›Aha, jetzt kommt er zum Kern‹, dachte Mey.
»Eine Sonderbeilage haben wir retten können. Sie wird Anfang September erscheinen, passend zur Eröffnung der Ausstellung ›Bürgersinn und Seelenheil‹ im Falkenhof-Museum am 30. August.«
»Die Ausstellung findet statt?«, fragte Mey.
Nickel nickte. »Mit vielen coronabedingten Auflagen, doch ja, sie findet statt und ist damit eines der wenigen Projekte aus dem Jubiläumsjahr, das die Kirchengemeinde und die Stadt Rheine tatsächlich gemeinsam umsetzen.«
Mit spitzen Fingern nahm der Chefredakteur einen Dominostein mit dunkler Schokolade vom Teller und ließ ihn in seinem Mund verschwinden. »Greif zu, sie werden sonst warm.«
Mey ignorierte diese Aufforderung.
»Die Ausstellung scheint gut konzipiert, soweit es die vorab veröffentlichten Details erkennen lassen.« Nickel schlug die vor ihm liegende Mappe auf und entnahm ihr einige Papiere. »Die Presseinformationen verheißen«, der Chefredakteur rückte seine Brille zurecht und zitierte aus dem Flyer, den er in der Hand hielt, »eine spezielle Inszenierung, die die Objekte aus dem Kirchenschatz von St. Dionysius in einem ganz neuen Licht erstrahlen lassen. Das klingt interessant und ist es sicherlich auch. Aber spektakulär geht anders.«
Nickel nahm einen Schluck Kaffee. Er wirkte gedankenverloren. Sein Blick ging ins Leere. Auch als er Mey anschaute, blieb sein Blick starr, und es schien, als sähe er durch ihn hindurch.
»Corona hat uns Anzeigenkunden und Abonnenten gekostet.Unsere wirtschaftliche Situation ist, nun ja … angespannt. Die Sonderbeilage bietet eine der seltenen Chancen, Anzeigenkunden zurückzugewinnen.Je mehr, desto besser. Was in der aktuell angespannten wirtschaftlichen Situation, in der sich viele Geschäfte und Firmen befinden, nicht eben einfach sein wird. Daher brauchen wir etwas Attraktives, einen besonderen Glanzpunkt, einen Clou. Etwas, das die Konkurrenz von der Münsterländischen Volkszeitung definitiv nicht hat. Etwas Exklusives.«
Pause.
»Ich habe einen solchen Clou gefunden: das Dionysius-Evangeliar!« In einer theatralischen Geste hob der Chefredakteur die Arme. Seine Augen leuchteten.
»Das Dionysius-Evangeliar?« Meys Gesicht war ein einziges Fragezeichen. »Davon habe ich noch nie gehört.«
»Was nicht weiter verwunderlich ist, mein Lieber«, räumte Nickel jovial ein. »Kaum ein Rheinenser wird schon davon gehört haben. Das ist doch gerade der Clou!«
Meys Schweigen signalisierte Skepsis. So schob der Chefredakteur eine Erklärung nach.
»Das Buch ist zwar Teil des Kirchenschatzes von St. Dionysius, wurde aber bisher noch nie in Gottesdiensten benutzt oder in einem Museum ausgestellt. Es muss kurz vor dem Ersten Weltkrieg in der berühmten Witte-Werkstatt in Aachen entstanden sein. Eine Eintragung auf der Innenseite des Buchdeckels legt nahe, dass die prachtvolle Außenhülle von einem Goldschmied namens Wilhelm Uppkampp geschaffen wurde. Uppkampp mit vier ›P‹ – zwei vor dem ›Kam‹ und zwei dahinter.«
Nickel lachte meckernd, als er sich am Kalauer aus dem Rühmann-Film Die Feuerzangenbowle versuchte. Mey blieb ernst, notierte aber den Namen in sein Notizbuch.
»Über ihn ist nichts bekannt, außer, dass er gebürtig aus Rheine stammte.«
Mey notierte auch dieses Faktum.
»Das Buch selber ist durchaus wertvoll. Seine Außenhülle besteht auf der Vorderseite aus Goldblech, besetzt mit Edelsteinen und Elfenbein.Die Pergamentseiten mit den Texten der vier Evangelien sind aufwendig gestaltet.«
»Warum ist ein solches Kleinod denn bisher gänzlich unbeachtet geblieben?«
»Das genau ist die Frage. Angeblich hat man es erst im Zuge der Aufarbeitung des Kirchenschatzes von St. Dionysius für das Jubiläumsjahr wiederentdeckt.«
»Was nicht die Frage beantwortet, warum es in Vergessenheit geraten ist.«
»Exakt. Und wo wir schon bei ungeklärten Fragen sind: Das wertvolle Buch wurde der Kirchengemeinde in den letzten Jahren des Kaiserreichs geschenkt. Doch von wem und warum?« Nickel zuckte die Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Bisher konnte ich noch nichts Näheres über den Stifter und seine Motive in Erfahrung bringen.«
In Meys Notizbuch füllte sich die Seite mit der doppelt unterstrichenen Überschrift »Dionysius-Evangeliar« zunehmend. Wobei der Großteil der Eintragungen allerdings aus Fragen bestand.
Auf Nickels Gesicht erschien ein triumphierendes Grinsen. »Damit ist das Dionysius-Evangeliar genau das Zugpferd, das wir für unsere Sonderbeilage benötigen. Es hat etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles, vielleicht sogar eine Spur Dunkles und Obskures. Das kommt an. Das wollen unsere Leser lesen. Und wenn etwas unsere Leser fasziniert, dann kann man damit auch die Anzeigenkunden locken.«
»Das Evangeliar soll also im Mittelpunkt der Sonderbeilage zur Ausstellung ›Bürgersinn und Seelenheil‹ stehen?«
»Nicht nur im Mittelpunkt der Sonderbeilage! Im Fokus unserer gesamten Berichterstattung zur Ausstellung! Wir ziehen das ganz groß auf. Ich denke da an eine Serie von drei vorbereitenden Artikeln. Artikeln, die Fragen aufwerfen, neugierig machen, die Spannung anheizen.«
›… und die Anzeigenkunden anlocken‹, ergänzte Mey im Geiste.
»In der Sonderbeilage gibt es dann die finalen Antworten.« Nickel grinste und schaute sein Gegenüber an, als habe er soeben ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Langsam begann Mey zu ahnen, worum es bei diesem Gespräch ging.
Die nächsten Sätze des Redaktionsleiters bestätigten seine Vermutung: »An dieser Stelle kommst du ins Spiel. Für die Artikelserie und die entsprechenden Seiten in der Sonderbeilage brauche ich jemanden, der intensiv recherchiert, jemanden mit fundierten Geschichtskenntnissen, am besten einen Historiker. Da habe ich an dich gedacht.«
Gespannt schaute ihn der Chefredakteur an.
»Außerdem hast du einen flotten Schreibstil und, wenn ich mich recht erinnere, persönliche Kontakte nach Aachen«, ergänzte er.
Mey überlegte. Die Tätigkeit als freier Mitarbeiter bei der RAZ war weder ein Zuckerschlecken noch eine Goldgrube. Meist erhielt er Aufträge zu eher alltäglichen Themen: Berichte über Unterausschusssitzungen des Stadtrates, Reportagen zu goldenen Hochzeiten, eine Befragung zur Neugestaltung des Marktplatzes oder zur bevorzugten Freizeitbeschäftigung in diesem Corona-Sommer. Alles interessant, doch wenig herausfordernd. Zudem lagen seine monatlichen Einnahmen aus dem Artikel-Geschäft selten oberhalb der 500-Euro-Marke, in den vergangenen Monaten coronabedingt sogar deutlich darunter. Brutto versteht sich.
Hier nun bot sich die Chance, beides zu ändern. Endlich einmal ergab sich die Gelegenheit, zu einem wirklich spannenden Thema zu recherchieren, und dazu noch die Möglichkeit, ein ordentliches Salär einzustreichen. Doch letzteres verlangte vorsichtiges Taktieren.
»Stimmt. Meine beiden Töchter studieren in Aachen«, räumte Mey daher ein. »Doch die würde ich ungern mit der Sache behelligen. Beide arbeiten derzeit an ihrer Masterarbeit.« Nachdenklich strich er sich über das Kinn.
Nickel, der Meys Zögern bemerkte, rückte seine inzwischen leere Kaffeetasse zurecht. »Was dein Honorar anbelangt: Wir würden dir für das Gesamtpaket eine Pauschale zahlen. Ich habe dabei an 600 Euro für die drei Artikel zum Evangeliar und seiner Geschichte sowie für die zwei Seiten in der Sonderbeilage gedacht. Vielleicht erleichtert dir das ja deine Zusage.«
Mey überlegte einen Moment. »Gut, Alois, ich mach’s.«
»Das freut mich, freut mich ehrlich.« Aus der obersten Schublade seines Schreibtisches zog Nickel eine Visitenkarte hervor und schob sie zu Mey herüber. »Hier sind die Kontaktdaten von Doktor Andreas Brockmann. Er koordiniert die Ausstellung und hat beste Kontakte zur Pfarrei St. Dionysius. Ihm verdanken wir es im Wesentlichen, dass das Evangeliar endlich einmal in Rheine ausgestellt wird.«
Mey steckte die Karte vorne in sein Notizbuch.
»Die Artikel sollten in jedem Fall vor Beginn der Ausstellung am 30. August erscheinen. Du kennst das Prozedere. Also schau mal, wie es bei dir zeitlich passt. Deine Seiten für die Sonderbeilage müssen am 21. August auf meinem Schreibtisch liegen. Spätestens. Und jetzt: Vergiss deinen Kaffee nicht.«
Doch der war inzwischen kalt geworden.
SPAGHETTI UND EINE GUTE IDEE
Drei Esslöffel Olivenöl, zwei Esslöffel Balsamicoessig, einen halben Teelöffel Senf, eine Knoblauchzehe, ein Viertel Zwiebel und schließlich drei gehäufte Teelöffel mediterraner Kräuter, fein gehackt. Mit routinierten Handgriffen mixte Moritz die Vinaigrette für den Salat. Lollo rosso, Lollo bionda, dazu in Scheiben geschnittene Gurken und gestückelte Tomaten. Fertig.
Auf dem Herd köchelte eine Bolognese-Soße. Original italienische Spaghetti warteten in einer schwarzen Vorratsdose mit der silbernen Aufschrift »Pasta« darauf, ins kochende Wasser geworfen zu werden.
Von der Haustür her war das Geräusch eines sich im Schloss drehenden Schlüssels zu vernehmen. Für Moritz das Signal, den Topf mit dem Pasta-Wasser aufzustellen.
»Hallo Schatz, das duftet ja herrlich.« Anna betrat die Küche und ihr erster Blick galt dem Inhalt der Kochtöpfe. Moritz und sie aßen beide leidenschaftlich gerne, eine der vielen Leidenschaften, die sie verbanden.
»Finger weg!«
Anna hatte sich ein Salatblatt genommen und kostete von der Vinaigrette.
»Zu spät«, lachte sie.
»Das Essen ist gleich fertig.«
»In Ordnung, ich mache mich nur kurz frisch.« Sie warf Moritz eine Kusshand zu und verschwand in Richtung Bad.
Kurze Zeit später saßen sie auf der schattigen Terrasse. Anna hatte sich eine Jacke übergezogen. Am Himmel bauschten sich mächtige Wolken, hinter denen die Sonne immer wieder verschwand. Der Sommer legte offenbar eine Pause ein.
»Erzähl. Wie war dein Morgen?« Bedächtig drehte Moritz seine Spaghetti ein.
Anna nahm einen Schluck Rotwein. »Wir sind noch sehr unsicher, wie der Schulstart nächste Woche laufen soll. Heute Morgen gab es erste Details aus dem Ministerium. Unterricht mit Maske wird wohl der neue Standard werden. Zunächst einmal bis Ende August.«
»Das klingt nach großer Vorsicht.«
»Und nach unbequemem Unterrichten. Schon in der Vor-Corona-Zeit hatte ich oft das Gefühl, dass mich meine Schüler nicht richtig verstehen. Mit Mund-Nasen-Schutz dürfte das kaum besser werden«, flüchtete sich Anna in Ironie.
»Dass dich deine Schüler nicht verstehen, liegt wohl eher an den komplizierten Inhalten und weniger an deiner unklaren Aussprache«, witzelte Moritz und zwinkerte ihr zu. Anna unterrichtete Mathematik und Biologie am Rosalind-Franklin-Gymnasium in Rheine, zwei Fächer, die bei Schülern nicht eben in dem Ruf standen, leichte Kost zu sein.
»Wie dem auch sei, das Hygiene-Konzept unserer Schule steht. Ob es funktioniert, wissen wir dann nächste Woche, wenn wieder 900 Schüler in den Klassen sitzen oder kreuz und quer über den Pausenhof jagen. Doch zu dir. Was wollte Nickel heute Morgen eigentlich?«
Moritz berichtete von seinem Termin beim Chefredakteur und dem ebenso interessanten wie lukrativen Schreibauftrag, den er erhalten hatte. »Ich habe schon mit Andreas Brockmann, dem Leiter der Ausstellung im Falkenhof, telefoniert. Wir sind für Donnerstagmorgen um zehn Uhr verabredet. Dann zeigt er mir das Dionysius-Evangeliar und versorgt mich hoffentlich mit jeder Menge Insiderinformationen.«
»Das Evangeliar befindet sich schon im Museum?«
»Seit gut einer Woche. Eigentlich sollte die Ausstellung am 7. Juni eröffnet werden, ohne das Evangeliar, warum auch immer. Dann kam die Verschiebung durch den Corona-Lockdown und man hat sich vonseiten der Organisatoren plötzlich entschieden, das Buch doch in die Ausstellung aufzunehmen. Ich habe keinen Schimmer, warum. Mal schauen, was das Gespräch am Donnerstag bringt.«
»Der Einband des Buches wurde von einem Goldschmied aus Rheine gestaltet?«
»Genau, von einem gewissen Wilhelm Uppkampp. Uppkampp mit vier ›P‹, zwei vorne und zwei am Ende. Seine Ausbildung hat er angeblich bei einem Goldschmied am Marktplatz absolviert. Das müsste so um 1880 gewesen sein. Genaueres weiß ich noch nicht. Es dürfte auch ziemlich schwierig sein, Details zu seinem Lebenslauf zu recherchieren. Zumindest hat mein erster Blick ins Internet nichts Brauchbares zutage gefördert.«
»Uppkampp … hm, ich hatte mal eine Schülerin mit diesem Nachnamen … Margarete Uppkampp hieß sie, wenn ich mich recht erinnere. Das muss vor sechs oder sieben Jahren gewesen sein. Vielleicht habe ich sogar noch ihre Adresse. Ich kann gerne mal meine alten Klassenlisten durchsehen.«
»Fantastisch!« Moritz zeigte sich ehrlich begeistert. »Ein Interview mit der Enkelin des Goldschmieds, der das Evangeliar angefertigt hat, das wäre was.«
»Ururenkelin dürfte es eher treffen«, kicherte Anna. »Aber vielleicht ist meine Margarete Uppkampp ja auch gar nicht mit deinem Goldschmied verwandt. Wer weiß.«
»Immerhin, Uppkampps mit vier ›P‹ dürfte es in Rheine nicht ganz so viele geben. Der Name in dieser Schreibweise ist doch recht ausgefallen«, überlegte Moritz.
»Ich schaue auf jeden Fall in meinen alten Unterlagen nach. Und du kannst dir ja parallel das Telefonbuch vornehmen.«
»Wer von den jungen Leuten lässt sich denn bitte schön heute noch im Telefonbuch eintragen?«
EIN OPFER DER PANDEMIE
Die Leuchtziffern des Radioweckers zeigten neun Uhr. Durch die Ritzen der Rollläden sickerte spärliches Tageslicht. Der Raum war stickig und heiß. Mühsam öffnete sie ihre Augen. Deren dunkle Ränder sprachen Bände. Aufstöhnend hielt sie sich eine Hand vors Gesicht. Selbst das dämmrige Licht im Zimmer schmerzte. Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Gestern Abend war es spät geworden. Spät und feucht. Doch der Wein, den Markus spendiert hatte, war zu süffig gewesen, um einen Rest in der Flasche zu belassen. In der dritten Flasche wohlgemerkt, die sie beide geköpft hatten.
Ach was soll’s? Früh aufstehen musste Margarete Uppkampp ja nicht mehr. »Corona sei Dank«, wie sie sarkastisch und voller Bitternis anzumerken pflegt.
Noch vor wenigen Wochen hatte der Name »Maggie Uppkampp« in großen roten Buchstaben über dem Eingang des Nagelstudios »Nails Beauty« auf der Emsstraße, der angesagten Einkaufsmeile von Rheine, geprangt. »Maggie« klang in ihren Ohren jung und beschwingt, ganz anders als »Margarete«, der Vorname, der in ihrem Pass vermerkt war.
Das »Nails Beauty« war gut gelaufen. Zwei Angestellte, eine satte Auslastung. Doch dann kam im Frühjahr der mehrwöchige Corona-Lockdown.Ihre Rücklagen schmolzen wie Schnee im August und am Beginn des Sommers war klar: Ihr Studiokonzept hatte den Lockdown nicht überstanden. Allen staatlichen Hilfen zum Trotz. Doch um ehrlich zu sein: Deren Umfang war auch eher gering gewesen. Im weiten Meer der vom Lockdown betroffenen Unternehmen war ihr Nagelstudio nur ein kleiner Fisch. Die Maschen des aufgespannten staatlichen Rettungsnetzes waren für solch kleine Fische zu weit.
So lebte Maggie Uppkampp seit Juli von Grundsicherung und fragte sich jeden Morgen aufs Neue, wie es weitergehen sollte. Für Kosmetikerinnen und Nageldesignerinnen waren die Berufsaussichten in Corona-Zeiten nicht gerade rosig. Doch ein Gutes hatte ihre aktuelle Misere immerhin: Das frühe Aufstehen gehörte der Vergangenheit an.
Ihr Freund Markus Klein arbeitete als Reinigungskraft in den Museen der Stadt Rheine und hatte seine Einsätze ebenfalls meist in den Abend- und Nachtstunden, sodass momentan für sie beide das lange Ausschlafen und ein ausgedehntes gemeinsames Frühstück zu den Höhepunkten des Tages zählten.
Schwerfällig richtete sich Maggie Uppkampp auf und schob ihre Beine über die Bettkante. Heute hatte sie allein geschlafen. Markus putzte bereits im Falkenhof-Museum, eine Sonderschicht. In gut drei Wochen sollte dort die Ausstellung »Bürgersinn und Seelenheil« eröffnet werden. Gestern hatte es einen ersten Testdurchgang für das inzwischen verbindlich vorgeschriebene Hygiene-Konzept gegeben. Zwanzig Freiwillige sollten das Verhalten einer größeren Besuchergruppe unter Corona-Bedingungen simulieren. Für kommenden Mittwoch war ein zweiter Testlauf vorgesehen. Vergeblich hatte Markus versucht, Maggie als Freiwillige für diese Simulationen anzuheuern. Sie hatte eben kein Faible für sakrale Kunst.
Hinter ihren Schläfen pochte es. Sie stöhnte leise. Was sie jetzt brauchte, waren ein, zwei Tassen starken Kaffees. Dann würde die Welt gleich wieder freundlicher aussehen. Maggie stand auf, zog die Rollläden hoch und öffnete das Fenster. Frische Luft strömte ins Zimmer. Das Wetter vermittelte den Eindruck eines Herbsttages – und das im August. Vor der Sonne hingen Dunstschleier und die Luft war angenehm frisch. Es war, als schöpfe der Sommer Atem für das große Finale. Für die zweite Wochenhälfte hatte der Wetterdienst bis zu 15 Sonnenstunden pro Tag und Temperaturen von 35 °C angesagt. Hochsommer.
Seitdem sie ihr Nagelstudio hatte schließen müssen, war Maggies Tagesablauf trister und eintöniger geworden. Meist drehten sich ihre Gedanken bereits vor dem Frühstück darum, wie sie ihrer ökonomischen Misere entkommen und ihrem Leben eine erfolgversprechende neue Richtung geben könnte. Heute jedoch ging ihr unter der Dusche der überraschende Telefonanruf durch den Kopf, den sie gestern Nachmittag erhalten hatte.
Ihre alte Mathematiklehrerin am Rosalind-Franklin-Gymnasium hatte sie kontaktiert. Nicht dass sie besonders gute Erinnerungen an den Mathematikunterricht bei Anna Mey gehabt hätte. Der Umgang mit Zahlen hatte noch nie zu ihren Stärken gehört. Dennoch war es schön gewesen, Meys Stimme zu hören. Das Telefongespräch hatte eine Fülle angenehmer Erinnerungen wachgerufen, die zugegebenermaßen wenig mit Schule und Unterricht zu tun hatten. Erinnerungen an ausgelassene Oberstufenpartys in einer Diskothek im Salzbergen, an das gemeinsame Abschlussessen in der Schule mit den zähesten Brathähnchen, die ihr jemals untergekommen waren, und nicht zuletzt auch an die legendäre Kursfahrt in die Provence, auf der sie ihre Unschuld verloren hatte. Vielleicht war die Schulzeit doch nicht so schlecht gewesen, wie sie damals dachte. Auch wenn sie ihr Abitur nur mit Mühe und Not und einer großen Portion Glück geschafft hatte. Oder war es nur die Erinnerung, die vergoldete?
»Gold« war das Stichwort. Gold hatte auch im gestrigen Telefonat mit Anna Mey eine zentrale Rolle gespielt. Denn es war um Urgroßonkel Wilhelm gegangen, das Enfant terrible ihrer Familie. Über ihn wurde bei Familientreffen nur im Flüsterton gesprochen, wenn man denn überhaupt über ihn sprach. Eigentlich, so musste Maggie zugeben, wusste sie so gut wie nichts über ihn. Nichts Genaueres jedenfalls, außer dass er Goldschmied war und das schwarze Schaf der Familie.
Umso erstaunter war sie gewesen, im Verlauf des Telefonates zu erfahren, dass ebendieser Urgroßonkel Wilhelm ein außergewöhnliches Kunstwerk erschaffen hatte, das zudem in den kommenden Monaten im Falkenhof-Museum in Rheine ausgestellt werden sollte: jenes prachtvolle Dionysius-Evangeliar, mit dem ihr bereits Markus in den Ohren lag, seit er es beim Putzen im Gewölbekeller des Museums in einer der neu aufgestellten Vitrinen entdeckt hatte.
»Das Buch ist Prunk pur«, hatte er gemeint. »Rundherum Gold und Edelsteine vom Feinsten. Unter zehntausend geht das bestimmt nicht über den Ladentisch. So was musst du sehen!«
Das klang in jedem Fall interessant. So hatte Maggie auch nicht lange gezögert, als ihre ehemalige Lehrerin sie um ein Interview bat. Deren Mann arbeitete, wenn sie die Mey richtig verstanden hatte, als Reporter für die RAZ, sollte einen Artikel über die Ausstellung im Falkenhof und das Dionysius-Evangeliar im Besonderen schreiben und war daher brennend an Informationen über dessen Schöpfer interessiert.
Die konnte er gerne haben, sobald sie diese denn selbst hatte. Bislang war ihr nur eine Quelle eingefallen, aus der sich Näheres über Urgroßonkel Wilhelm in Erfahrung bringen ließe: ihre Mutter. Die würde sie anrufen. Aber erst nach dem Frühstück.
VERGANGEN UND VERGESSEN
Der rostrot verklinkerte Giebel des Kötter-Hauses im Kloddenhook trug die Jahreszahl 1848. Als Maggie die schmiedeeiserne Pforte in der hohen Buchenhecke öffnete, war es ihr, als öffne sie eine Tür in die Vergangenheit. Vor ihr lag, sauber in buchsbaumumfasste Beete unterteilt, ein Meer aus blühenden Sommerblumen. Ein frisch geharkter Kiesweg führte auf die dunkel gebeizte zweiflügelige Haustür zu, deren Messingbeschläge blitzten. Neben der Tür rankte an einem Klettergitter ein Rosenstock empor. Ein wenig zögerlich betrat Maggie den Vorgarten. Der helle Kies knirschte unter ihren Füßen. So war es schon gewesen, wenn sie nach einem anstrengenden Schultag zurück nach Hause kam, mit knurrendem Magen und den Kopf voller Ideen für die Abendgestaltung.
Maggie läutete. Im Inneren des Hauses waren schlurfende Schritte zu hören. Ein Schlüssel wurde im Schloss gedreht und die Haustür öffnete sich. Im Türrahmen stand, ein breites Lachen im Gesicht, ihre Mutter Bertha.
»Willkommen to Huus!«
Berthas Stimme besaß nicht mehr die Kraft, die Maggie aus Kindertagen in Erinnerung hatte, doch wirkte die alte Dame alles andere als gebrechlich. Vor fast fünfzig Jahren hatte sie Hubert Uppkampp, Maggies Vater, geheiratet und war auf den Kötter-Hof gezogen. Ihr Mann lag längst auf dem Friedhof am Königsesch. Nach dessen Tode hatte Maggies Mutter zwar alles Land verpachtet, sich aber beharrlich geweigert, das Bauernhaus in Wadelheim gegen eine Wohnung in der Stadt oder ein Zimmer in einem Altenheim einzutauschen. Immerhin war sie inzwischen über siebzig Jahre alt. Doch bei jeder Nachfrage ihrer Kinder betonte sie, sich fit zu fühlen, und stellte dieses dadurch unter Beweis, dass sie Haus und Garten perfekt in Schuss hielt. So wie eh und je.
»Schön, dass du da bist. Das Essen ist auch gleich fertig. Wasch dir noch schnell die Hände!«
Einmal mehr fühlte sich Maggie in ihre Kindertage zurückversetzt. So hatte sie die Mutter begrüßt, wenn sie aus der Schule nach Hause kam. In der Küche wartete dann das Mittagessen, bei dem man nicht nur den Hunger stillen, sondern sich auch alle Sorgen von der Seele reden konnte.
Wenig später saßen Mutter und Tochter am Küchentisch und löffelten eine kalte Rote-Bete-Suppe, genau das Richtige an solch einem heißen Tag, wie Bertha Uppkampp mehrfach betonte.
»Nun erzähl mal, wie sieht es mit deiner Stellensuche aus?«
»Im Moment ist es schwierig, eine Stelle zu finden. Der Lockdown …«
»Ach, papperlapapp. Das sind doch nur Ausreden. Wenn man will, findet man immer Arbeit.«
»Aber ich suche nicht irgendeine Stelle. Ich möchte wieder in meinem Beruf arbeiten, in einem Nagelstudio oder als Kosmetikerin.«
»Das ist natürlich schwer. Wer braucht denn heute spitz gefeilte Nägel mit Glitzersteinen? Du hättest damals auf mich hören und einen vernünftigen Beruf ergreifen sollen. Finanzbeamtin oder Krankenschwester. Dann hättest du einen sicheren Arbeitsplatz gehabt. Aber nein, du wolltest ja unbedingt was Künstlerisches werden.«
Mit einem Mal wusste Maggie wieder, warum sie ihre Mutter so selten besuchte. Moralisierende Vorhaltungen hatte sie schon in der Schulzeit gehasst. Zu ihrem Leidwesen hatte damals jede Mathematik- oder Englischarbeit ihrer Mutter reichlich Gelegenheit dazu geboten.
»Also von Hartz IV kann man doch auf Dauer nicht leben. Du könntest aber bei mir einziehen. Platz hätte ich genug und Arbeit auch. Der Garten …«
»Du bist lieb, Mama. Danke für das Angebot. Aber ich bin erwachsen. Ich habe meine eigene Wohnung und mein eigenes Leben.«
»Ein eigenes Leben muss man auch bezahlen können.« Bertha Uppkampps Stimme klang eindringlich. »Ich weiß doch, dass du Geld brauchst, und habe deshalb mit Onkel Franz gesprochen. Gerade jetzt in der Erntezeit sucht er händeringend Helfer für seinen Gemüsebetrieb. Wo doch viele Arbeiter aus Rumänien in diesem Jahr gar nicht gekommen sind. Franz sagt, du könntest schon morgen anfangen.«
»Lass gut sein, Mama, ich kenne den Knochenjob auf den Gemüsefeldern von meinen Arbeitseinsätzen in den Sommerferien zur Genüge. Dafür soll sich Onkel Franz bitte jemand anderen suchen.«
Demonstrativ stand Maggie auf und räumte das Mittagsgeschirr in die Spülmaschine. Ihre Mutter schaute verkniffen, schwieg aber.
»Eigentlich bin ich ja heute aus einem ganz bestimmten Grund zu dir gekommen.«
»Ach ja? Das hätte ich mir eigentlich denken können«, bemerkte Bertha Uppkampp steif.
Maggie war irritiert, fuhr aber dennoch nach einer kurzen Pause fort: »Gestern hat mich meine ehemalige Mathematiklehrerin angerufen. Sie möchte Informationen zu Urgroßonkel Wilhelm haben. Ihr Mann schreibt an einem Artikel über ein Kunstwerk von Wilhelm, das Dionysius-Evangeliar.«
»Kenne ich nicht«, knurrte Bertha Uppkampp.
»Doch ich weiß eigentlich nichts über ihn«, fuhr Maggie ungerührt fort. »Nur, dass er Goldschmied war.«
»In unserer Familie reden wir nicht über ihn«, brummte ihre Mutter. »Wilhelm war ein Taugenichts, ein Hallodri.«
»Ein Hallodri?« Maggie konnte mit dem Wort nichts anfangen. »War er kriminell?«
»Ach, nein, das nicht«, antwortete Bertha gedehnt. »Zumindest nicht kriminell im Sinne der heutigen Gesetze.« Es entstand eine Pause. »Soweit ich das aus den Familienerzählungen sagen kann.«
»Was dann?«
»Es ging wohl eher ums Moralische. Die Großmutter deines Vaters hat immer die Augen verdreht, wenn die Rede auf ihren Schwager Wilhelm kam.«
Gespannt sah Maggie ihre Mutter an. Doch die erwartete Erklärung blieb aus. »Kannst du mir denn gar nichts Näheres über ihn erzählen? Wann wurde er zum Beispiel geboren?«
»Das müsste ich nachschauen. Wenn ich sein Geburtsdatum überhaupt habe. Ich könnte natürlich Großmutter fragen. Aber deren Gedächtnis …«
»Gibt es vielleicht Aufzeichnungen von ihm oder Fotos?«
»Gesehen habe ich nie welche. Wie gesagt, über deinen Urgroßonkel Wilhelm hat man in der Familie nicht geredet. Aber du kannst natürlich gerne auf dem Speicher nachschauen. Im hinteren Teil müssten noch Dinge aus der Zeit deiner Großeltern und Urgroßeltern liegen. So ganz genau weiß ich das allerdings nicht, ich bin schon einige Jahre nicht mehr oben gewesen.«
Eine halbe Stunde später kletterte Maggie die wackelige Holztreppe zum Speicher hinauf. Hier hatte sich sogar ganz offensichtlich seit vielen Jahren niemand mehr aufgehalten. Spinnweben hingen an den verstaubten Dachbalken. Die beiden Dachfenster waren staubverkrustet. Auf den Dielen türmten sich die Hinterlassenschaften mehrerer Generationen Uppkampps: alte Möbel, Bilder in breiten Holzrahmen, blinde Spiegel, fleckige Kisten, eine aufrecht stehende Teppichrolle und ein Schaukelstuhl mit zerbrochenen Kufen.
Nur langsam gewöhnten sich Maggies Augen an das Halbdunkel. ›Ich hätte eine Taschenlampe mitnehmen sollen‹, dachte sie.
»Die Hinterlassenschaften deiner Groß- und Urgroßeltern stehen ganz hinten, direkt an der Wand«, hatte ihre Mutter gesagt. Also tastete sich Maggie durch die Relikte der vergangenen hundert Jahre in den hinteren Teil des Dachbodens vor. Hier lag auf einem Sideboard, dessen helles Holz von unzähligen Wurmlöchern verunziert wurde, ein alter Koffer. Spinnweben überzogen das schwarze Behältnis wie dünne Gaze. Offensichtlich hatte den Koffer seit Jahren niemand mehr bewegt. Maggie hustete, als sie ihn anhob und dabei eine Staubwolke aufwirbelte. Auf der Seitenwand entdeckte sie einen Aufkleber. Im matten Licht vermochte sie nicht, die verblasste Schrift zu entziffern.
Hilfe suchend sah sie sich um. Unter einem der schmalen Dachfenster stand ein alter Stuhl, den offenbar einmal jemand genutzt hatte, um einen Blick nach draußen werfen zu können. Ächzend schleppte Maggie das Behältnis zum Fenster und wuchtete es auf den Stuhl. Hier waren die Lichtverhältnisse besser.
»Wilhelm Uppkampp, Rheine«, las sie. Ihre Augen leuchteten. »Bingo! Das nenne ich einen Volltreffer!«
Der schwarze Lederkoffer war durch zwei Riemen gesichert. »Ein Königreich für eine Zange und einen Hammer«, stöhnte Maggie, als sie versuchte die Schnallen zu öffnen. Nur unter Flüchen und auf Kosten ihres rechten Daumennagels bekam sie diese schließlich auf. Die Kofferschlösser waren korrodiert. Auch sie leisteten Maggies Öffnungsversuchen erbitterten Widerstand. Erst einige Schläge mit einem abgebrochenen Stuhlbein, das sie im vorderen Teil des Speichers aufgelesen hatte, führten zum gewünschten Ergebnis: Die Schließen sprangen auf. Staub tanzte im Licht, das durch die blinden Dachfenster fiel. Maggie klappte den Kofferdeckel nach oben.
Das Innere war mit hellem Taft ausgeschlagen. Obenauf lag eine zusammengefaltete Zeitung, der Aachener Anzeiger vom 20. April 1912, wie der Kopfteil verriet. Maggie legte sie beiseite. Darunter kam ein Mantel zum Vorschein. Fraglos ein Herrenmantel von mittelgrauer Farbe, heller abgesetzt, elegant in Schnitt und Form. Am Revers und auf der rechten Brustseite wies der Stoff eine Reihe schwarzer Flecken auf. Mit der rechten Hand strich Maggie über die dunklen Stellen.
»Fühlt sich irgendwie fettig an«, murmelte sie. Vorsichtig roch sie an ihren Fingern. »Es riecht nach … nach Schmiere und Ruß.«
Was immer diese Flecken verursacht hatte, auf einen solch eleganten Überzieher gehörten sie sicherlich nicht. Behutsam nahm Maggie den Mantel aus dem Koffer. Dabei fiel ihr ein in die obere Rückenpartie eingenähtes Etikett ins Auge. Neben dem Aufdruck Gebr. Anschel – Rheine – Auf dem Thie 12 war dort mit einem schwarzen Stift handschriftlich W. Uppkampp eingetragen. Der Mantel gehörte also ihrem Urgroßonkel.
›Hatte Urgroßonkel Wilhelm gehört‹, verbesserte sie sich in Gedanken.
Sie legte das Kleidungsstück beiseite und widmete ihre Aufmerksamkeit erneut dem Kofferinhalt. An der rechten Seite entdeckte sie ein eingerolltes Stück braunen Leders. Ein stabiler Verschlussriemen hielt die Rolle zusammen. Maggie löste den Riemen und entrollte das Lederetui. Ein rechts oben eingenähtes Namensschild wies den Besitzer aus: ihren Urgroßonkel. Offensichtlich handelte es sich um eine Werkzeugrolle, wie die zwölf unterschiedlich großen Werkzeugfächer belegten. Nur zwei dieser Fächer waren gefüllt. Maggie zog die beiden Werkzeuge heraus. Sie wirkten zart, fast filigran. So sahen also die Arbeitsgeräte eines Goldschmiedes aus. Sie rollte die Werkzeugtasche wieder ein und platzierte sie neben der Anzugjacke auf dem Boden.
Der verbliebene Inhalt des Koffers machte einen kompakten Eindruck. Es handelte sich um ein Fotoalbum und eine schwarze Kladde mit grauen Längsstreifen. Als sie die erste Seite des Schreibheftes aufschlug, hielt sie unwillkürlich den Atem an. Tagebuch des Wilhelm Uppkampp stand dort mit schwarzer Tinte in seltsam geschwungenen Lettern geschrieben. Vorsichtig blätterte Maggie um. »Aachen, den 14. Mai 1911«, las sie. Heiße Röte stieg ihr ins Gesicht. Dieser Fund übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Nach einem kurzen Rundblick zerrte sie die Teppichrolle unter das Dachfenster, setzte sich darauf und lehnte sich mit dem Rücken an einen der Dachbalken.
Zwei Stunden später hatte Maggie ihre Lektüre beendet. Nun wusste sie, dass sie einen Schatz gefunden hatte. Mühsam stand sie auf. Vom langen Sitzen waren ihre Beine steif geworden. Als sie die Fundstücke zurück in den Koffer legen wollte, fiel ihr Blick auf einen kleinen, bunten Gegenstand, der ihren Nachforschungen bisher entgangen war: eine Pappschachtel, die zu ihrer Überraschung ein Kartenspiel enthielt.
»Ich habe uns einen Apfelkuchen gebacken«, hörte sie die Stimme ihrer Mutter am Fuß der Holzstiege. »Wann kommst du endlich nach unten zum Kaffeetrinken?«
»Gleich, Mama.«
Rasch verstaute Maggie die Habseligkeiten ihres Urgroßonkels wieder im Koffer und ließ die Schließen einrasten. Dann nahm sie das Lederbehältnis mit einem derart festen Griff in die Hand, als würde sie es nie mehr hergeben wollen.
ZU EINER ANDEREN ZEIT, AN EINEM ANDEREN ORT …
AachenTagebuch des Wilhelm Uppkampp
Sonntag, 14. Mai 1911
Seit gut einer Woche bin ich nun in Aachen. Eine Weltstadt, verglichen mit dem verschlafenen Rheine. Hier fahren Trambahnen und Automobile statt Pferdefuhrwerke und Kutschen. Hier trifft man Menschen, die Französisch, Niederländisch und Englisch sprechen. Menschen, die nicht nur anders sprechen, sondern auch anders denken. Offener. Liberaler. Hier atmet man freier. Und an das Oecher Platt werde ich mich schon noch gewöhnen.
Es bleibt zu hoffen, dass die leidige Angelegenheit, um derentwegen ich Rheine verlassen musste, baldigst in Vergessenheit geraten wird. Welch eine Kalamität, dass mit dem Verlustieren auch das Kinderkriegen verbunden ist! Ach, soll die Lene doch sehen.