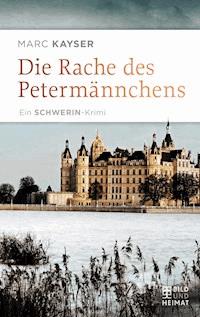Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Jahre nach der spektakulären Jagd auf den Kindermörder Theo Sander holt die Schweriner Kriminalkommissarin Eva Lindenthal dieser aufwühlende Fall erneut ein. Über die Notrufnummer der Schweriner Polizei meldet ein Anrufer den Tod eines jungen Polizisten, der als Mitglied eines Spezialeinsatzkommandos bei der Verfolgung des Täters, der als "Petermännchen-Mörder" in die Schweriner Kriminalgeschichte einging, beteiligt war. Was zunächst nicht unbedingt wie ein vorsätzliches Tötungsdelikt aussieht, entpuppt sich aber schnell als Teil einer Verkettung brutaler Ereignisse. Bei ihren Ermittlungen stößt die Kommissarin auf ein terroristisch agierendes Netzwerk, das weitere Mordanschläge auf Polizisten plant. Lindenthal sieht sich kalt agierenden Menschen gegenüber, die offenbar einen blutigen Rachefeldzug im Schilde führen. Mehr und mehr taucht sie ein in eine unheilvolle Parallelwelt – und macht dabei eine Entdeckung, die für sie als Vertreterin der Exekutive mehr als gefährlich wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Kayser
Der Schatten aus dem
Ramper Moor
Ein Schwerin-Krimi
Bild und Heimat
eISBN 978-3-95958-774-7
1. Auflage
© 2019 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: © picture alliance / Arco Images GmbH
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Alexanderstr. 1
10178 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Der Inhalt dieses Buches ist ein Produkt meiner Phantasie. Jede noch so winzige Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist unbeabsichtigt und wäre rein spekulativ.
Für KKK
Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier.
William Shakespeare (1564–1616), Der Sturm
Teil I
1
Schwerin, eine Privatwohnung
Der junge Mann, der auf seinem imposant breiten Bett in seinem Schlafzimmer im Schneidersitz saß und mit einer Fernbedienung hantierte, war ein Typ Herzensbrecher und das nicht ohne Grund. Er war großgewachsen, hatte einen kahlrasierten Schädel mit einer gesunden Bräune, eine muskulöse, sportliche Figur und war bekleidet mit eng anliegenden, schwarzen Chinos und einem weißen Sporthemd, das einen Blick auf seine durchtrainierten Schultern und Arme freigab. Der stopplige Dreitagebart und seine großen, hellen Augen verliehen seinem markanten Gesicht etwas Draufgängerisches.
An der weiß gekalkten Wand über seinem Bett hing ein unter Glas gerahmtes Plakat mit dem Satz: in dubio pro libido.
Jetzt drückte er auf der Fernbedienung einen Knopf. Das Bild des Videos auf seinem Bildschirm stand still und zeigte eine augenscheinlich männliche Person, die im Wasser des Schweriner Sees wild mit den Beinen strampelte, dabei die Arme hochgerissen hatte, umgeben von vielen Geldscheinen, die in einiger Entfernung von ihr auf dem Wasser wild verstreut dahintrieben. Ein aufgeklappter Koffer schwamm friedlich neben der Person. Die Silhouette der Stadt Schwerin und die ihres Doms waren deutlich zu erkennen. Der Timecode des Bildes zeigte einen Tag im April vor zwei Jahren.
Der Mann ließ das Video rückwärts laufen. Dann stoppte er und drückte erneut den Play-Knopf. Zu sehen war das Steuerhaus eines Fischerboots, in dem ein anderer, sportlich wirkender Mann das Ruder fest umschlossen hielt, über ihm ein Funkgerät, das vom Dach des Steuerhauses dicht vor seinem Mund hing. Neben den Armaturen lagen zwei Polizeiwesten und zwei Polizeipistolen sowie zwei Handys und eine Tafel angebrochene Schokolade. Jetzt hatte sich der Fokus der Kamera auf den Mann gerichtet, der auf dem Bett im Schneidersitz saß. Zu sehen war, wie er selbstgefällig in das Objektiv grinste. Er war gekleidet wie ein Fischer auf Capri: Streifenhemd, wasserdichte Hose, Stiefel. Nun schwenkte die Kamera zurück auf den Steuermann am Ruder, der jetzt nach dem Funkgerät griff und hineinsprach: »Basis, hier Katharsis 1. Wie lautet der genaue Befehl?«
»Rammt ihn mit ›Viktor‹, dann aufnehmen und verhaften. Wir übernehmen ihn in Seehof am Ufer. Dort warten schon zwei Streifenwagen.«
Jetzt fing die Kamera ein kleines Boot mit einer offensichtlich sehr kleingewachsenen Person ein, die versuchte, vom Ufer aus das offene Wasser des Schweriner Sees zu erreichen. Wer nicht genau hinsah, könnte auch meinen, es sei ein Kind.
»Wasserdrohne aussetzen«, sagte der Steuermann.
»Ausgesetzt«, erhielt er zur Antwort.
Der junge Mann streckte sich auf seinem Bett jetzt weit nach vorn. Er zoomte mit einem Knopf auf seiner Fernbedienung die Bilder jetzt näher heran. Die Schaluppe mit der Zielperson kam nur sehr langsam voran. Der Motor hatte nicht annähernd die Kraft der Wasserdrohne, die sich der Person unsichtbar und auf sie als Ziel programmiert näherte. Als ob der Flüchtige ahnte, gleich gerammt zu werden, warf er das Ruder herum. Doch es nutzte ihm nichts mehr. Die Drohne krachte wie ein Torpedo in den Bug des Kahns, der daraufhin schwer zur Seite kränkte. Der Insasse verlor das Gleichgewicht, griff noch geistesgegenwärtig nach dem Geldkoffer, kippte dann aber zur Seite und stürzte in den See.
Der junge Mann auf dem Bett knipste das Video an dieser Stelle aus. Das Zimmer war auf einen Schlag noch dunkler, als es ohnehin schon gewesen war. Die Vorhänge vor den beiden Fenstern schluckten die mäßige Helligkeit dieses verregneten Tages noch um ein Vielfaches. Der angebliche Fischer aus dem Video warf sich der Länge nach auf sein Bett, drehte sich auf seine rechte, der Schlafzimmertür abgewandte Seite, verkrallte eine Hand in sein Kopfkissen und starrte an eine leere Wand. Es schien, als sei der junge, sportliche Mann, der äußerlich der Typ eines smarten Verführers war, ein Depressionskranker ohne den Glauben an den nächsten Tag.
Ganz in sich gekehrt, noch immer versunken in den Einsatz im Ramper Moor, dämmerte er langsam in eine Art Halbschlaf. Er rollte zurück auf den Rücken und begann, leise zu schnarchen.
Er bekam nicht mit, wie sich etwa dreißig Minuten später beinahe unhörbar die Tür zu seiner Wohnung öffnete, zwei Personen so vorsichtig wie Katzen auf Beutezug über den kleinen Flur in sein Schlafzimmer schlichen und für den Bruchteil von Sekunden an jeweils einer der beiden Bettseiten verharrten. Eine der beiden Gestalten hielt eine Art Inhalationsmaske in der Hand, die andere eine Pistole.
Blitzschnell drückte einer der Eindringlinge dem jungen Mann die Maske aufs Gesicht, aus der sofort ein leises zischendes Geräusch entwich. Der andere hatte dem Schlafenden währenddessen den Pistolenlauf gegen die Halsschlagader gepresst. Ihr Opfer erwachte und zuckte zusammen, aber lag auf dem Bett wie gelähmt bei dem Gedanken an das scheinbar Unmögliche.
»Ganz ruhig!«, flüsterte der Mann mit der Pistole zu ihm fast so freundlich wie zu einem unruhigen Kind, »denn sonst erschieße ich dich.«
2
Schwerin, Polizeiinspektion, Notrufzentrale
»Es gibt einen Toten«, sagte eine Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie klang fest, ihre Lautfarbe ließ eher auf einen Mann als auf eine Frau schließen.
»Kommando Theo Sander! Verfolgen Sie die Spur des Löwen!«, rasselte die Stimme in die Leitung, dann brach die Verbindung ab. Das Programm auf dem Monitor der diensthabenden Polizistin der Notrufzentrale 110 öffnete ein Fenster von der Größe einer Streichholzschachtel. Ein Kartenausschnitt mit einem Pfeil und ein schmales Textfeld wurden sichtbar. Gebannt starrte die Beamtin auf die Nachricht: »Übertragung Datenleitung. Verifizierung Stadtmitte, Johannes-Brahms-Straße, verschlüsselter Privatanschluss, keine Kennung möglich.« Mit der Maus dirigierte sie die Sprachaufzeichnung auf Anfang. Sie hörte genau hin. Sie dachte angestrengt nach, kam aber zu keinem Ergebnis.
»Verdammt«, fluchte die Polizistin, wuchtete sich von ihrem Stuhl hoch und eilte aus dem Raum. Ein Toter und Spuren von Löwen? Und wer, bitte sehr, war ein Kommando Theo Sander? Das klang in ihren Ohren nach einem unheimlichen Vorgang, den sie dringend melden und mit ihrem Vorgesetzten besprechen musste. Ihre Tür schlug laut und vernehmlich zu.
3
Die Nachricht eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens erreichte Eva Lindenthal nur wenige Minuten später. Die Kommissarin der Abteilung für Gewaltverbrechen der Schweriner Polizeiinspektion war soeben von einer Bootsfahrt auf dem Schweriner See mit ihrem Lebenspartner Paul zurückgekehrt. Eva Lindenthal war eher zierlich; ihr Gesicht hatte etwas Mädchenhaftes, mit klaren blauen Augen, Sommersprossen auf der Nase, einem energisch wirkenden Kinn und gleichmäßig geschwungenen Lippen. Es wurde von schwarzem, lockigem Haar umrahmt, durch das sich erste silbrige Fäden zogen, und zeigte zugleich auch etwas Verwegenes mit harten Zügen.
Sie fröstelte und zog ihren Schal noch fester um den Hals. Auf ihrem Mantel saßen die Wassertropfen wie angeklebt, und an den Spitzen ihrer derben, braunen Lederschuhe pappte Schmutz der Straße. In der Luft des noch so jungen Maitags lag der Geruch vermoderter Blüten. Die grellen Laternen tauchten den nassen Abend in ein diffuses Licht.
Die aus Betonplatten zusammengesetzten Wohnblöcke entlang der Straße mit dem wohlklingenden Namen erschienen ihr vertraut. Sie war als Kind oft bei ihren Großeltern zu Gast, die in ebenso einem Plattenbau wohnten, und sie hatte es genossen, mit lautem Singen durch das Treppenhaus zu gehen, weil es so schön hallte. Wenn sich jemand am Gesang der kleinen Eva störte, dann die Frau aus dem dritten Stock, Tür links. Sie erwartete das kleine Mädchen schon mit in die Hüften gestemmten Fäusten, wütend blitzenden Augen und vor Ärger verzerrtem Mund. Doch Eva beeindruckte die Furie aus Stockwerk drei wenig: Sie flötete fröhlich: »Tag auch!«, schlüpfte an der Alten vorbei und verschwand schnell in der Wohnung ihrer Großeltern in der vierten Etage.
Auf ihrem Weg bewegten sich ihre Gedanken über ihren romantischen Ausflug mit Paul wie flackernde Funken eines Holzfeuers. Ihr standen die letzten Stunden vor Augen, als würde alles noch einmal passieren:
»Wirf mir das Tau rüber, Eva.«
Etwas steif von der Kühle, machte die Kommissarin einen ungeschickten Schritt. Erschrocken schrie sie auf.
»Vorsichtig«, warnte er. »Nicht, dass ich dich noch aus dem Wasser fischen muss.«
»Der Fischer aus der Bibel hieß Johannes, nicht Paul«, lachte sie.
Er drohte ihr schelmisch mit dem Finger. »Heiraten wir?«, fragte er sie unvermittelt.
Der Musiker und die Kommissarin waren zwar seit mehr als drei Jahren ein Paar; aber immer wieder sorgten langwierige und schwierige Fälle dafür, dass sie sich nur in unregelmäßigen Abständen trafen und sich deshalb nur sehr zurückhaltend aufeinander einließen, was sie nicht benennen konnten und vielleicht auch nicht wollten. Ihr Freund Paul lebte nach einem anderen Rhythmus. Als Violinist im Orchester des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin hatte er seinen festen Platz. Proben wechselten mit Auftritten, Notenarbeit mit Recherchen nach neuer Musik.
Sie hielt kurz inne, blickte auf sein blondes, feuchtes Haar, sein mit schon einigen Fältchen durchzogenes Gesicht, seinen buntgemusterten Schal. Sie beschloss, ihm eine ehrliche Antwort zu geben. »Ich kann mir mit dir alles vorstellen. Allein mein Job …« Doch trotz dieser Einschränkung strahlte er sie an.
Paul legte seinen Arm um ihre Schultern. Er roch ihr Parfüm. Ihre Lippen berührten sich leicht. Seine Augen glänzten. »Nach Hause?«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Zeit für Wein und danach …«
Sie griff nach seiner Hand und zog ihn sanft hinter sich her vom Steg.
Ihr Handy vibrierte. Schlagartig nahm ihr Gesicht einen anderen Ausdruck an. Pauls Mundwinkel machten einen Satz in Richtung Kinn.
»Polizeimeisterin Rohde«, hallte ihr eine energische Frauenstimme entgegen. »Ein Notruf auf der 110. Jemand hat einen Toten gemeldet. Wir haben den Quadranten, aber nicht die genaue Adresse.«
»Das soll die Feiertagsschicht übernehmen«, sprach sie etwas unsicher ins Telefon.
»Sie sollen die Adresse finden und dann sofort dorthin. Anweisung von ganz oben«, sagte die Polizeimeisterin jetzt strenger.
»Wie bitte?«, fragte die Kommissarin gereizt.
»Schwerin-Mitte ist verifiziert. Johannes-Brahms-Straße. Viel Erfolg.« Die Dame legte auf.
»Wir haben einen Toten«, sagte sie zu ihrem Freund. »Ich muss in die Inspektion.«
Bevor Paul etwas sagen konnte, legte sie ihre rechte Hand über seinen Mund und blickte ihm tief in die Augen. »Wir schaffen das«, sagte sie. »Du und ich. Wir müssen geduldig sein.«
Die Kommissarin bog mit schnellen Schritten von der Lessingstraße in die Johannes-Brahms-Straße ein. Noch war sie mit ihren Gedanken bei Paul, doch aus der Ferne sah Eva Lindenthal die flackernden Blaulichter eines Polizeiwagens, der einen kleinen Teil der Straße und einen Hauseingang abschirmte. Gäbe es ein Gedankenschafott, dachte sie, dann war es jetzt mit einem scharfen Messer heruntergerast und hatte sie von der Erinnerung des Tages vorerst abgetrennt. Etwas atemlos trat sie an den ersten Beamten, der hinter der Polizeiabsperrung stand, heran, grüßte knapp, zeigte ihren Dienstausweis, schob sich an ihm vorbei und stieg die Treppen in den zweiten Stock hinauf.
Der junge Mann, der scheinbar so friedlich auf dem Bett lag, als schliefe er, war so kalt wie Schnee. Seine Gesichtshaut hatte eine bläuliche Farbe, er war vollständig bekleidet bis auf seine Füße, die seltsam verquer zueinander lagen. Auffällig war sein kahlrasierter Schädel, wie man ihn gelegentlich bei Hooligans oder Skinheads sieht.
»Hi, Bernhard, ist das unser Notruf-Toter?«, fragte sie den anwesenden Gerichtsmediziner, ein dünner, kleiner Mann mit einem vorspringenden Kinn, Hakennase und vielen kleinen Fältchen auf der Stirn. »Scheint so, Eva«, sagte er. »Seit mindestens acht Stunden tot. Erst einmal keine äußeren Einwirkungen von Gewalt.«
Er gähnte. »Verdammt spät für einen Einsatz«, sagte er etwas grantig. Ihr war klar, dass es sein Job war, Tag und Nacht einsatzbereit zu sein. Aber auch Chefpathologen hatten einen Sinn für Feierabend.
Der Gerichtsmediziner schob das Sporthemd des Toten vorsichtig bis zum Hals hinauf. Dann öffnete er dessen Hose und zog sie ihm bis auf die Knöchel nach unten.
»Keine Würgemale, keine Schlagblessuren. Sehen wir in den Mund …« Er zog die Lippen des Toten auseinander, griff ihm beherzt zwischen die Zähne und beförderte die Zunge zutage. Es waren deutlich hellrote Schleimhautblutungen zu sehen.
»Ich tippe auf einen akuten Sauerstoffschock. Möglicherweise ein schnell wirkendes Gift, das die Sauerstoffbindung an den roten Blutfarbstoff, ans Hämoglobin, abrupt blockiert und somit den Sauerstofftransport. Vielleicht Kaliumcyanid«, sagte der Pathologe mit einem hörbar lauten Atmen. »Im Wasser schnell löslich, im Alkohol eher träge.«
»Tippen Sie auf Mord?«, fragte Eva Lindenthal.
»Vielleicht auch selbst herbeigeführt. Eine Vergiftung dieser Güte kann leicht auch durch Einatmen mittels Inhalator erfolgen. Blausäure braucht nur fünfundzwanzig Grad Umgebungstemperatur, verdampft und diffundiert sehr leicht durch Zellmembrane.«
»Ist das eine sichere Anamnese?«, fragte die Kommissarin.
»Sicher bin ich nach Untersuchung von Gewebeproben, seines Urins und des Mageninhalts.«
Der Gerichtsmediziner wandte sich an die Männer der Spurensicherung, die ebenfalls weiße Wegwerfanzüge aus Vliesfasern trugen, um keine Spuren zu zerstören.
»Sie sollten mal nach Stäubchen weißer Kristalle, nach einem Inhalator oder einem Wasserglas mit Giftresten suchen«, wies der Pathologe sie an, klappte seinen Instrumentenkoffer auf und nahm ein Skalpell heraus. Vorsichtig entnahm er aus den Fingerkuppen des Toten mehrere Proben. Er stach mit einer Kanüle in den Bauchraum der Leiche und zog eine gelbliche Flüssigkeit heraus.
»Die Nieren untersuche ich in der Pathologie«, sagte er. Dann zog er ein kleines Notizbuch aus dem Innern seiner Schutzkleidung und kritzelte etwas hinein. Als er die Proben sicher verpackt hatte, strich er der Kommissarin sacht über die Schulter.
»Da scheint uns ein alter Fall wieder einzuholen«, bemerkte er leise.
»Verdammt, ja, wenn der Anrufer kein Trittbrettfahrer war.«
»Und was ist Ihr wahres Gefühl, Eva?« Der Pathologe gab ihre Schulter wieder frei.
Eva Lindenthal suchte seine Augen. »Ein miserables«, antwortete sie ehrlich.
»Wir sehen uns«, sagte er, lächelte aufmunternd und verließ dann schnell die Wohnung.
Die Kommissarin fröstelte beim Anblick des toten Mannes, der so friedlich vor ihr lag, als schliefe er nur einen Rausch aus. Sie schätzte sein Alter auf Mitte zwanzig. Sie musterte konzentriert den Raum, vermaß ihn geradezu mit den Augen. Sie entdeckte eine Fernbedienung, wandte sich dem Bildschirm zu und berührte ihn. »Kalt«, murmelte sie.
Ein Spurensicherer trat an sie heran und wies auf den Monitor. »Nehme ich gleich mit«, sagte er. »Vielleicht hat er Videos oder andere Daten von seinem Handy darauf gespiegelt. Ich sehe keinen DVD-Schacht.«
»Guter Hinweis. Und haben Sie Ausweispapiere oder Kreditkarten gefunden?«, fragte sie ihn.
»Noch nicht«, erhielt sie zur Antwort. »Wir suchen noch.«
»Alle Kommunikationsmittel einpacken, die Sie finden. Diesen Bildschirm hier, die Fernbedienung, Computer, soweit vorhanden, Laptop, Handy, Videos … und durchsuchen Sie alle Schubladen nach verwertbarem Material. Ich will auch, dass Sie nach persönlichen Briefen suchen. Räumen Sie seine Badapotheke aus. Drehen Sie alles auf den Kopf, was uns hilft, einen Selbstmord von einem Mord zu unterscheiden.«
Sie fingerte ihr Handy aus der Innentasche ihres luftigen Mantels und drückte auf einen Knopf. Sie lauschte.
»Ach, Mensch! Paul, mein Liebling, unser Abendessen wackelt etwas. Ich habe hier eine Leiche voller Gift. Kann ich dich später nochmals erreichen?« Sie hörte kurz zu.
»Das schätze ich so an dir. Danke. Ich liebe dich.« Sie trennte die Verbindung. Inzwischen schienen die Spurensicherer etwas entdeckt zu haben.
»Wir haben einen Dienstausweis des Landeskriminalamts.«
Eva Lindenthal zuckte zusammen. »Verdammt!«, zischte sie und fragte: »Wer ist er, welcher Einsatzort?«
»Leon Schacht. Siebenundzwanzig, seit drei Jahren im Dienst«, erhielt sie zur Antwort. »Gehört zur mobilen Sondereinsatztruppe in Rampe. Müsste sich eigentlich wehren können.«
»Müsste, sollte, könnte …«, knurrte sie. »Erkennen Sie Gift, wenn es vor Ihnen steht?«
Der Beamte zuckte leicht zusammen. »Ich meine nur …« Weiter kam er nicht.
»Finden Sie etwas Verwertbares, das übliche Programm. Und denken Sie an die Wünsche des Pathologen. Ich fahre zurück in die Inspektion. Halten Sie mich auf dem neuesten Stand. Ich organisiere seinen Abtransport in die Pathologie.«
Eva Lindenthal winkte lahm mit einer Hand und rauschte aus der Wohnung des Mannes, der noch immer so aussah, als warte er auf ein Morgen.
Unten, vor dem Hauseingang, telefonierte sie erneut.
»Kommissarin Lindenthal am Apparat. Ich möchte noch heute einen Termin bei Alexander Klink.« Sie lauschte, dann reagierte sie auf die Ausführungen der anderen Seite mit harscher Stimme. »Nein, nicht erst morgen vierzehn Uhr, sondern heute, und zwar in der nächsten Stunde! Sie haben einen Mann verloren. Das dürfte Sie doch interessieren, oder?«
Auf der Straße durchfuhren sie mehrere kalte Schauer. Der kühle Maiabend kroch ihr nun doch unangenehm unter den Mantel, und die Erfahrungen der letzten Minuten waren ohnehin kalt und abstoßend gewesen.
4
Rampe bei Schwerin, am nächsten Tag
Die Ansiedlung Rampe war ein eher unspektakuläres Örtchen mit einer hübschen Seelage, einer Handvoll Häusern, einer Straßenkreuzung und einer gut ausgebauten Straße nach Schwerin. Eine unscheinbare Umgehungsstraße führte direkt vor die Tore des Landeskriminalamts, eines Handwerksbetriebs und des Diakoniewerks mit Behausungen für sozial gestrauchelte und andere hilfsbedürftige Menschen. Warf man einen scharfen Blick durch den Waldgürtel am Rande des Geländes, konnte man das Wasser des Schweriner Sees in der Sonne funkeln sehen.
Soeben rollte der Audi A6 der Kommissarin auf die Sicherheitsschranken vor den LKA-Gebäuden zu. Sie zeigte ihren Ausweis und durfte passieren. Ihr Termin war nicht nur wegen des Todes eines Polizeibeamten prekär, er war auch vorhersehbar kompliziert, weil Gegenwind aus der Behörde zu erwarten war. Immerhin war ein Mitarbeiter der Abteilung 2, in der die Mobilen - und Sondereinsatzkommandos gebündelt waren, möglicherweise von fremder Hand gestorben. Schließlich herrschte unter den Spezialkommandos noch immer der Kodex, dass man an Informationen nur das Nötigste herauszugeben pflegte. Egal ob eine befreundete Polizeibehörde wie die Schweriner Inspektion oder ein Kommissar-Kollege ermittelte oder nicht. Lindenthals Vorgesetzter Timmermann, Chef der Abteilung Gewaltkriminalität, ein aalglatter Typ und Freund des Landesinnenministers, hatte sie telefonisch dann auch vorgewarnt.
»Wir arbeiten zwar bei der Aufklärung von Gewaltverbrechen zusammen«, hatte er gesagt, »aber diese Geschichte könnte für Sie als Polizeikommissarin eine Nummer zu groß sein. Zumal hier ein alter Fall erneut eine Rolle zu spielen scheint. Wissen wir denn schon, ob es Mord war?« Eva Lindenthal hatte reagiert wie immer. Sie hatte ihn ausreden lassen und dann nüchtern entgegnet: »Wissen wir nicht – und: War’s das?«
Timmermann hatte daraufhin grimmig wiederholt, was er schon oft zu ihr gesagt hatte: »Denken Sie daran, dass Sie mich mal ablösen wollen. Auf dem Weg nach oben gibt es eine Menge Stolpersteine.« Lindenthal hatte erwidert: »Ja, das Leben besteht aus vielen kleinen Druckpunkten, Uli« – und hatte aufgelegt.
Ja, sie wäre unaufrichtig, würde sie nicht zugeben, dass sie gern einen Schritt weiterkommen würde in ihrem Job. Andererseits genoss sie die Freiheit, die sie hatte. Das Büro in der Inspektion sah sie selten von innen. Sie war eine Frau, die Straßen liebte, keine Korridore. Und seit sie mit Paul zusammen war, hatte sie schon genug damit zu tun, ihm auszureden, mit ihr für immer zusammenzuziehen. Eva Lindenthal bestärkte ihn eher darin, seine Karriere als Violinist im Orchester des Staatstheaters in Schwerin weiterzuverfolgen, während sie Gewaltverbrecher überführte.
Doch so einfach war die Sache nicht. Paul war nicht nur etwas jünger als die Kommissarin, er war auch sehr viel romantischer veranlagt, zumindest was die Liebe anbelangte. Auf ihrer Fahrt nach Rampe hatte sie sich an ein Abendessen vor einigen Monaten im Restaurant des Rudervereins am Südufer des Schweriner Sees erinnert. Sie hatte gerade mit den Ermittlungen zu einem Kindsmord begonnen, ein gemeinsamer Norwegen-Urlaub stand allerdings vor der Tür, und Paul kam nach einem Glas Wein mal wieder auf die Idee, gemeinsam eine Wohnung zu suchen und ein trautes Leben zu zweit zu führen.
»Paul«, sie hatte viel Schmelz in ihre Stimme gelegt, »wir kennen uns jetzt seit mehr als einem Jahr. Ich finde, es läuft gut so, wie wir es uns organisiert haben. Wir sehen uns ein-, zweimal die Woche, oft am Wochenende, wir haben wirklich guten Sex, wir können gut miteinander reden, die Chemie stimmt. Warum also eine gemeinsame Wohnung? Offen gesagt …«, sie hatte eine kurze Pause gemacht, »… offen gesagt, würde ich mich vor dir genieren, wenn du von meinen Kämpfen und Zweifeln, die mein Job mit sich bringt, zu viel mitbekommst. Ich fürchte mich tatsächlich davor, dass du es unattraktiv findest, wenn ich abgekämpft, müde und lustlos ins Bett falle, während du vielleicht auf Zärtlichkeiten hoffst.« Der Kellner hatte eine neue Flasche Wein gebracht. Sie hatten sich schweigend zugeprostet und jeweils nur einen kleinen Schluck getrunken. Paul hatte an ihr vorbei auf den See geblickt, während Möwen um ein Stück Brot stritten, das ein Vogel soeben von einem weiter hinten platzierten Tisch ergattert hatte.
»Warum vertraust du mir nicht?«, hatte er sie gefragt. »Glaubst du, ich würde dich zu sehr einengen?«
Die Kommissarin hatte mit ihren Händen unter dem Tisch eine Raute gebaut. Ihre Fingerspitzen hatten dabei immer wieder gegeneinander getrommelt. Sie liebte Paul, sie liebte seine Nähe, und sie liebte den Sex mit ihm. Doch sie liebte ihren Beruf, auch wenn der sie derart einnahm, dass für ein Privatleben kaum noch Raum war. Streng hatte sie zu ihm gesagt: »Mit Vertrauen hat das nichts zu tun. Eher damit, dass ich bereit bin, dich zu lieben, aber nicht in der Lage bin, meinen Alltag mit dir zu teilen. Dafür bin ich vielleicht auch nicht geschaffen. Oder besser: noch nicht geschaffen. Auch ich entwickle mich weiter und möchte die Zeit haben, mich auch weiterentwickeln zu können.«
Während sich die Kommissarin ihren Gedanken hingab, trommelte sie immer wieder mit ihren Fingerspitzen auf das Lenkrad ihres Audis. Jetzt blitzte ihr durch den Kopf, wie Paul und sie nach ihrer Ansage an ihn hastig ihre Gläser geleert und vor sich hin gestarrt hatten. Ein merkwürdiges Knistern hatte in der Luft gelegen, wie kurz vor einem Gewitter, wenn die Natur plötzlich angespannt still wird. Doch Paul war klug genug gewesen, sich emotional nicht zu entladen. Er hatte lediglich ihr Glas nachgefüllt, ihr zugeprostet und gesagt: »Ich liebe dich.«
Heute war vieles anders. Paul wohnte, wie momentan auch, unregelmäßig, aber dafür eine längere Zeit mit ihr unter einem Dach. Er hatte ein Konzert vorzubereiten, las sich in die Noten ein, übte.
Die Kommissarin verließen ihre Gedanken an Paul ebenso schnell, wie sie gekommen waren. Sie parkte ihr Auto vor dem Zugang zum Hauptgebäude der Behörde. Ihr Handy klingelte. Die Gerichtsmedizin. Das dünne Männchen mit dem vorspringenden Kinn und der Hakennase war in der Leitung. Eva Lindenthal kannte den Pathologen seit Jahren. Er war stets loyal gewesen und hatte sie schneller mit Informationen versorgt, als er eigentlich müsste. Und: Sie teilten beide ihre Abneigung gegen Ulrich Timmermann, Lindenthals Chef, den sie nur den »Lackaffen« nannten.
»Ich habe Cyanwasserstoffreste gefunden. In seiner Mundschleimhaut. In seiner Blase werde ich von dem Zeug noch mehr finden. Entweder war es Zyankali in kristalliner Form, das er durch den Magen aufgenommen hat, oder er hat giftige Blausäuredämpfe mittels Inhalator durch den Mund eingeatmet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es sich selbst eingeflößt hat.«
»Warum nicht?«, fragte Eva Lindenthal. Sie wusste zwar, dass es ihr Job war, herauszufinden, ob es Selbstmord, Mord oder nur ein tragisches Versehen war, dennoch: Der Pathologe war gewieft, sie verließ sich gern auf sein Urteil.
»Weil es ein ekelhafter Tod ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein so junger Mann mit Blausäure ins Jenseits befördert. Es sei denn, er hat erfahren, dass er todkrank ist.«
»Oder er ist zur Einnahme des Gifts gezwungen worden, oder es hat ihm jemand ins Getränk gemischt, wollte ihn also töten.«
»So würde ich das eher sehen«, sagte der Pathologe.
»Wie wirkt Zyankali?«, wollte die Kommissarin wissen. »Ich mache gleich meinen Ritt auf dem Besen zu den LKA-Typen, die sind sicher ganz scharf darauf, zu hören, was eine Frau ihnen zu sagen hat.«
Sie erntete ein Lachen als Antwort, und dann: »Hier die Kommissarin einer Polizeiinspektion, dort Beamte eines Landeskriminalamts … ich verstehe genau, was Sie meinen, Frau Kollegin …« Er machte eine kurze Pause, als sammelte er sich.
Eva Lindenthal lächelte fein. Sie mochte den Pathologen. Sie kramte einen kleinen Notizblock samt Schreibgerät aus der Tasche, denn sie wusste, dass Wissen sich nur dann nicht verflüchtigte, wenn man es schwarz auf weiß nach Hause trug.
Er sagte: »Das Perfide an Zyankali ist die Blausäure, die bei der oralen Einnahme unter Wirkung der Magensäure freigesetzt wird. Besagte Blausäure bindet sich – ähnlich dem Kohlenmonoxid, nur eben viel stärker – an das Hämoglobin, den Sauerstoff übertragenden roten Blutfarbstoff. Kurzum: Der Tod durch Zyankali ist ein inneres Ersticken. Das kann sehr schnell gehen – muss aber nicht. Der Tod durch Gift kommt quasi wie ein leises Tier und schnappt schnell und erbarmungslos zu.« Er machte wieder eine kurze Pause. Die Kommissarin ließ ihren Stift derweil ruhen.
»Aber der Reihe nach«, setzte er fort.. »Zunächst einmal wird die Blausäure im Magen freigesetzt. Sekunden nach der Einnahme der Lösung hört die Zellatmung auf, was letztlich zu einer inneren Erstickung führt. Dann aber wieder gibt es Fälle, in denen die Blausäure sich Zeit lässt. Im Klartext: Bis die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abgeschnitten ist, vergehen zehn, wenn Sie Pech haben, zwanzig, dreißig Minuten, und in Ausnahmefällen bis zu einer Stunde. All diese Zeit verbringt das Opfer bei vollem Bewusstsein. Die Krämpfe, die durch die Wirkung der Blausäure einsetzen, sind zudem alles andere als schmerzlos. Mehr noch: Eine höhere Dosierung als die sowieso schon tödliche von 0,25 Gramm gestaltet das Sterben nicht angenehmer, sondern oft noch entsetzlicher, da Zyankali ätzt und den Magen zerfrisst. Ich glaube nicht …«, er legte wieder eine kurze Pause ein, »dass sich jemand selbst auf diese Weise vergiftet. Es sei denn, unser Mann hatte extreme persönliche Probleme. So was wie eine Depression oder eben eine tödliche Krankheit, wie Krebs …«
»Das werde ich hoffentlich gleich bei dessen Kollegen herausfinden«, sagte Eva Lindenthal.
»Haben Sie schon eine Spur oder einen Hinweis auf dieses ominöse Kommando?«
»Nein, noch nicht«, antwortete sie mit leicht zitternder Stimme. »Ist ja alles noch sehr frisch. Ich frage mich …«, nachdenklich pausierte sie kurz, »… ob wir damals irgendetwas übersehen haben.«
»Wenn ich mich noch richtig erinnere, verfolgte der Mörder ja eine perfide Strategie«, erwiderte der Pathologe. »Aber das ist ja nun auch schon zwei Jahre her.«
»Keine Strategie ohne eine Exit-Strategie«, sinnierte die Kommissarin. »Was wäre denn, wenn unser Täter von damals nur ein Werkzeug war, das lediglich benutzt wurde? Oder anders ausgedrückt: es in Schwerin nicht nur einen dieser Art Täter gibt?«
»Das klingt gewagt«, sagte der Pathologe schnaufend ins Telefon. »Das würde ja bedeuten …«
»… dass wir es möglicherweise mit einer gefährlichen Lage zu tun haben?«, fragte sie.
»Ja«, sagte er. »Gefährlich auch, aber vor allem: undurchsichtig, ungewöhnlich, neu. Schwerin ist ja keine Millionenstadt, in der sich ein Haufen Irrer versammeln kann, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommt.«
»Ich muss leider enden«, sagte sie aufrichtig bedauernd. »Ich habe meinen LKA-Termin.«
»Gut«, sagte der Gerichtsmediziner verständnisvoll und legte auf.
Eva Lindenthal sammelte sich kurz und verließ dann ihr Auto. Vor ihr lag weithin sichtbar ein kasernenartiges Gebäude, in welchem ein Teil der Ermittlungsabteilungen untergebracht war. Ihm schloss sich ein zweigeschossiger, leicht wirkender Baukörper an, dessen breite, farbig eingefassten Fensterfronten wie die Zinken eines Kammes nebeneinander angeordnet waren. Sie wusste, dass hier die kriminaltechnischen Labore eingerichtet worden waren, und sie hätte gern einmal einen Blick hinein riskiert. Doch in die Alchimistenküche der Kriminalen kam man so einfach nicht hinein. Nicht einmal, wenn man Kriminaloberkommissarin einer Polizeiinspektion war. Nach den üblichen Ausweiskontrollen sah sie sich in einem der unzähligen Büros der Kaserne einem Mann gegenüber, der äußerlich nicht den Eindruck machte, als müsste man ihn nur von der Leine lassen, damit aus ihm ein polizeilicher Raufbold in Kampfmontur wurde. Er war ein drahtiger Typ mit gegerbtem Gesicht, lebendigen grauen Augen und dichten, kurzen Haaren. Sein Oberhemd trug er leger über seiner Jeans, dazu moderne Sneakers mit drei Streifen.
»Nehmen Sie Platz. Kaffee?« Kommandeur Klink lächelte sie freundlich an. Dann reichte er ihr die Hand, die sie auch annahm.
»Wir kennen uns ja bereits vom Einsatz gegen Theo Sander. Aber noch mal förmlich: Ich bin Alexander Klink, Leiter der Einsatzunterstützung. Mobile Einsatzkommandos, Sie wissen schon. Ich bin der, der dafür sorgt, dass jeder unserer Mitarbeiter gut vorbereitet seinen Job macht und möglichst heil wieder nach Hause kommt.« Er blickte sie bei seinen Worten sehr ernst an.
»Und ich bin Kriminaloberkommissarin Lindenthal, Abteilung Gewaltverbrechen in Schwerin. Und nein, ich nehme Tee. Kräutertee, wenn Sie haben.«
»Haben wir.« Er drückte auf eine Taste seines Telefons. Eine Frauenstimme meldete sich, der er Lindenthals Wunsch mit einer so öligen Stimme vortrug, als sei er der Besitzer einer Rotlichtbar.
Die Kommissarin schätzte sein Alter auf Anfang fünfzig, das seines Oberhemds auf nur wenige Tage. Das Gel in seinen Haarspitzen war vermutlich sogar nur wenige Minuten alt.
»Heil bleiben … soso …«, sagte sie. »War Leon Schacht immer gut vorbereitet, und kam er immer wieder heil nach Hause, wie Sie es gerade ausdrückten?«
»Wollen wir uns nicht setzen?«, drängte Klink sie und wies auf eine lederne, beigefarbene Sitzgruppe, die mindestens so ausladend wie ein Garagentor und auch mindestens so schwer war.
Nein, sie wolle lieber stehen, sagte sie ihm, das sei nicht gegen seine fabelhaften Sessel gerichtet, aber eine Eigenart von ihr. Sie sagte ihm nicht, dass es Methode war, um physisch die gleiche Augenhöhe mit einem Gegenüber zu halten, mit dem sie weder befreundet war noch befreundet sein wollte. Er hatte sie dabei erstaunt angesehen und etwas schief gegrinst.
»Gehen Sie auch noch selbst an die Front?«, fragte sie und bemerkte selbst wie martialisch das klang.
Statt eine Antwort zu geben, schritt er zu einem in die Wand eingelassenen Schrank, öffnete ihn und präsentierte ihr sein gesamtes Arsenal: Kevlar-Weste, Combat-Stiefel, Helm, Handschuhe, Waffe, Schlagstock, Verteidigungssprays und technische Kommunikationsmittel.
»Meine Ausrüstung«, bemerkte er nicht ohne Stolz.
»Ich bin beeindruckt«, sagte sie mit einem ironischen Unterton.
»Ich komme sofort, wenn Sie mich mal brauchen sollten«, beteuerte er ganz ernsthaft. »Ich haue Sie allein oder mit meinen Männern aus jeder Situation heraus.«
»Ich habe es notiert«, antwortete sie etwas spitz, dachte aber sogleich, dass es immer gut wäre, einen bewaffneten Verbündeten für den Ernstfall zu haben. Sie selbst trug keine Waffe, obwohl sie eine ganz passable Schützin war. Beim Einsatz gegen Theo Sander waren die mobilen Einsatzkräfte des LKA von Nutzen gewesen, auch wenn sie am Ende in ihren Augen versagt und Theo Sander im Schweriner See haben ertrinken lassen. Und seit ihr Kollege Toni Kielmann nicht mehr im Sold der Polizei stand und damit prahlen konnte, dass er, wie er es beinahe enervierend oft ausgedrückt hatte, »schneller schießen als der Gegner furzen« konnte, war sie an der Verteidigungsflanke reichlich ungedeckt.
Der Tee wurde gebracht von einer schlanken Blondine, die mit ihrem eng geschnürten, mit bunten Blumen bedruckten Oberteil und einer weißen, weit fallenden Hose auch als vielgebuchte Animateurin eines Robinson Clubs hätte durchgehen können. Sie strahlte Eva Lindenthal mit dem Ausdruck einer zufriedenen Frau an. »Heute bringe ich den Tee, morgen fange ich einen Räuber«, scherzte sie und zeigte zwei beeindruckende Reihen fabelhaft weißer Zähne. Sie stellte die Tasse auf einem Beistelltischchen ab.
»Das ist Maria Baumann und immer zu Scherzen aufgelegt«, sagte der sportliche Kommandeur. »Sie ist soeben für meine Sekretärin eingesprungen, die in der Poststelle zu tun hat.«
»Kriminaloberkommissarin Lindenthal«, stellte sich die Kommissarin vor und schenkte der Frau ein Lächeln. »Ich danke für den Tee! Was genau tun Sie hier?«
»Ich koordiniere die Einsätze. Unsere Männer müssen ja wissen, wann sie wohin müssen.«
Baumann und Klink blickten jetzt auf die Kommissarin weder freundlich noch unfreundlich, eher wie Menschen, die lieber unter sich mit ihrem Wissen blieben.
»Kannten Sie Leon Schacht auch gut?« Eva Lindenthal beobachtete bei ihrer Frage das Gesicht der LKA-Beamtin sehr genau. Ihr schien es, als sei die Frau für einen kurzen Moment blass geworden. Die Beamtin blickte ängstlich auf ihren Vorgesetzten.
»Nur zu gut«, sagte sie schließlich.
»Wie soll ich das verstehen?«, fragte die Kommissarin.
»Ja, und ich erst?«, krakeelte Klink hintendrein.
Die Beamtin rang mit den Händen. Sie lehnte steif an der Wand neben der Sitzgruppe.
»Wir haben hier zusammen angefangen. Er war erst Tauchlehrer, später Fahrlehrer für Sportboote. Wir lernten uns auf der Polizeischule kennen. Er war ein guter Polizist, ein fabelhafter Kenner maritimer Details und ein ausgezeichneter Steuermann. Immer gut drauf, ein derber Spaßmacher, stabil, soweit ich die psychologischen Gutachten richtig interpretiere.«