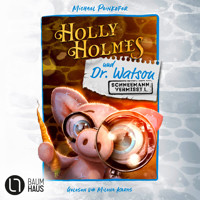8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sarah Kincaid ermittelt
- Sprache: Deutsch
London im ausgehenden 19. Jahrhundert: In einem verruchten Viertel der Stadt wird eine Prostituierte grausam ermordet. Die königliche Familie bittet die junge Adlige Sarah Kincaid um Hilfe: Ein Neffe der Königin steht unter Verdacht, hinter der Mordserie im Stadtteil White Chapel zu stecken. Sarah willigt nur widerstrebend ein. Wie sich herausstellt, sind die Privaträume des Mannes angefüllt mit ägyptischen Relikten, und es zeigt sich, dass er der Vorsitzende einer Gesellschaft von Gentlemen ist, die sich der Erforschung altägyptischer Geheimnisse gewidmet haben. Der königliche Neffe scheint unter Wahnvorstellungen zu leiden und spricht fortwährend von einer ägyptischen Gottheit, die zurückkehren wird - aber ist er wirklich ein kaltblütiger Mörder?
Die Spur führt Sarah bis nach Ägypten, wo ein uraltes Geheimnis auf sie wartet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
London im ausgehenden 19. Jahrhundert: In einem der verruchtesten Viertel der Stadt wird eine Prostituierte grausam ermordet. Die königliche Familie bittet die junge Adlige Sarah Kincaid um Hilfe: Ein Neffe der Königin steht unter Verdacht, hinter der Mordserie im Stadtteil White Chapel zu stecken. Sarah willigt nur widerstrebend ein. Wie sich herausstellt, sind die Privaträume des Mannes angefüllt mit ägyptischen Relikten, und es zeigt sich, dass er der Vorsitzende einer Gesellschaft von Gentlemen ist, die sich der Erforschung altägyptischer Geheimnisse gewidmet haben. Der königliche Neffe scheint unter Wahnvorstellungen zu leiden und spricht fortwährend von einer ägyptischen Gottheit, die zurückkehren wird - aber ist er ein kaltblütiger Mörder?
Die Spur führt Sarah bis nach Ägypten, wo ein uraltes Geheimnis auf sie wartet ...
Über Michael Peinkofer
Michael Peinkofer studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen«. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Peinkofer
Der Schatten von Thot
Nach den Aufzeichnungen von Lady Kincaid - Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
PROLOG
I. BUCH — LONDON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II. BUCH — ÄGYPTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III. BUCH — THOTS SCHATTEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EPILOG
DANKSAGUNG
Anmerkungen
Impressum
MEINEN ELTERN GEWIDMET
FÜR IHRE LIEBE UND DAFÜR,
DASS SIE STETS AN MICH GEGLAUBT HABEN.
PROLOG
ALTE STERNWARTE, KAIRO
SEPTEMBER 1883
Ein Firmament funkelnder Sterne spannte sich über den Häusern und Gassen der Stadt, die sich von den Ufern des Nils bis hinauf zu den Hängen des Djebel Mokattam erstreckten. Blaues Licht erhellte die Kuppeln der Moscheen und die Minarette der Stadt, beschien die trutzigen Mauern der Festung und ließ das breite Band des Flusses leuchten.
Auf der alten Sternwarte, die einst von den Kalifen errichtet worden war, um die Vorgänge am Himmel zu beobachten und zu deuten, stand Ammon el-Hakim, und obgleich seine Augen hinaufstarrten zum glitzernden Himmel, sahen sie den Glanz der Sterne nicht mehr.
Den Weisen von Mokattam, so pflegten sie jenen Alten zu nennen, der die Sternwarte zu seinem Domizil erkoren hatte; hier lebte und arbeitete er, und in den unzähligen Winkeln und Kammern des baufälligen Turmes häufte sich das Wissen vergangener Tage. Bücher und Schriftrollen, alte Pergamente und mancher Gegenstand, dem magische Bedeutung beigemessen wurde, hatten sich hier angesammelt. Sein ganzes Leben hatte el-Hakim der Erforschung der letzten Geheimnisse gewidmet, der letzten Rätsel, die es noch zu erforschen gab in einer Zeit, in der der Mensch die letzten Grenzen überschritt.
Die Fremden aus dem Norden …
Der Weise von Mokattam verachtete sie.
Ohne Demut und Respekt betraten sie das geweihte Land, besaßen keine Ehrfurcht vor dem jahrtausendealten Vermächtnis. Die Pyramiden, die Tempel, die Grabmäler und der Sphinx – für sie waren es leblose Bauwerke, Ansammlungen von Stein, begraben von Sand und dem Staub der Zeit.
Die Römer waren die Ersten gewesen, die den Ruhm Ägyptens mit Füßen getreten hatten.
Dann die Griechen.
Die Türken.
Die Franzosen.
Und nun die Engländer.
Nur wenige waren unter ihnen, die Verstand genug besaßen, um zu begreifen, dass Ägypten mehr als tote Vergangenheit war, dass der Sand der Wüste den Schlüssel zur Zukunft bergen mochte. Und diejenigen, die es begriffen, waren längst nicht alle Diener des Lichts.
Ammon el-Hakim lebte in Finsternis, und das nicht nur, weil sein Augenlicht verloschen war. Dunkelheit hatte sich über das Gemüt des Weisen gebreitet, eine Dunkelheit, die finsterer war als jede Nacht und undurchdringlicher als jeder Sandsturm. Als seine Augen das Licht der Sterne noch erblickten, hatte el-Hakim es ein letztes Mal gedeutet. Und was er gesehen hatte, hatte ihn mit Grauen und Furcht erfüllt.
Eine alte Macht war aus den Untiefen der Geschichte wieder aufgetaucht und griff nach Geheimnissen, die nicht für sie bestimmt waren. Dinge, die verborgen bleiben sollten, wurden den Schatten der Zeit entrissen. Die Welt geriet aus dem Gleichgewicht, Chaos und Zerstörung würden die Folge sein.
Leise sprach der Weise von Mokattam die Worte, die in eine steinerne Tafel gemeißelt waren. Das Original lag tief unter dem Sand von Memphis vergraben, eine Abschrift jedoch befand sich im Besitz der Sterndeuter von Mokattam, seit Generationen gehütet von den Weisen.
Ägypten, o Ägypten!
Eine Zeit wird kommen, in der die Götter die Erde verlassen. Von deiner Religion werden nur ferne Legenden bleiben und Worte in Stein gehauen, denen die Nachwelt keinen Glauben schenken wird. Die Frommen werden verstummen und die Finsternis dem Licht vorgezogen werden, und keines Menschen Blick wird sich zum Himmel heben. Die Reinen werden als Narren verlacht, die Unreinen als Weise verehrt. Der Rasende wird für mutig gehalten und der Verruchte für rechtschaffen, das Wissen um die unsterbliche Seele wird man leugnen.
Aus diesem Grund habe ich, Thot, die Geheimnisse der Götter aufgeschrieben und sie an einem geheimen Ort bewahrt. Bis die Menschen reif für unser Wissen sind. Den Pfad der Nacht beschreite, wer des Mondes Geheimnis sucht. Doch hüte sich, der nach Wissen trachtet, vor dem, was in Dunkelheit lauert …
I. BUCH
LONDON
1
LONDON, EAST END
14. OKTOBER 1883
Mitternacht.
Der Glockenturm von Westminster, der das Parlamentsgebäude und die Westminster Bridge weit überragte, meldete das Ende des alten und den Beginn des neuen Tages. Aber der Klang der großen Glocke, der die Einwohner Londons den Namen »Big Ben« gegeben hatten und die einer ganzen Nation als Symbol der Größe und Überlegenheit galt, drang nicht in die verwinkelten Straßen des Londoner East End.
Zu eng waren die mit Unrat und Schmutz übersäten Gassen, zu hoch die tristen Backsteinmauern der Mietskasernen und Hinterhöfe, zu laut der Lärm, der auch um diese späte Stunde noch aus den Spelunken drang. Zum schrägen Klimpern verstimmter Klaviere gesellte sich der scheppernde Klang einer Ziehharmonika, begleitet vom geistlosen Gegröle der Betrunkenen und vom kreischenden Gelächter der Huren.
Das schmutzig gelbe Licht, das durch die Fenster der Bars und Tavernen fiel, schimmerte matt und verschwommen im dichten Nebel, der zäh und klamm durch die Gassen kroch, vermischt mit dem beißenden Rauch aus Kaminfeuern und Kohleöfen.
Nur vereinzelt riss der flackernde Schein der Gaslaternen Löcher in die Dunkelheit und warf spärliches Licht auf die zerlumpten, verzweifelten Gestalten, die sich in Nischen und Hauseingängen drängten. Waisen zumeist, die nicht wussten wohin, aber auch Bettler und Betrunkene, von denen es in Whitechapel mehr gab als in jedem anderen Bezirk der Stadt. Verzweiflung und Hunger waren allgegenwärtig, und um mit ihren Familien nicht in einem der berüchtigten staatlichen Arbeitshäuser zu enden, wandten sich nicht wenige Männer der anderen Seite des Gesetzes zu. Skrupellose Verbrecherbanden trieben im East End ihr Unwesen, und in den engen, finsteren Gassen, in denen es nach Fäulnis und Exkrementen stank, tummelten sich nicht nur vierbeinige Ratten, sondern auch solche, die bereit waren, für ein paar Shillings oder ein Stück Brot zu morden.
Unter den Frauen waren die Arbeitshäuser nicht minder gefürchtet als unter den Männern, und auch sie unternahmen alles, um nicht dorthin verfrachtet zu werden – selbst wenn es bedeutete, im Kampf um das tägliche Überleben den eigenen Körper zu Markte tragen zu müssen. Wer von Natur aus mit einem attraktiven Aussehen gesegnet war und sich ein hübsches Kleid leisten konnte, ging am Covent Garden und im Theaterdistrikt auf Kundenfang, wo die Aussicht bestand, dass ein Gentleman für eine Nacht einen Florin oder gar mehr bezahlte. Die Prostituierten von Whitechapel, häufig krank und entstellt an Körper und Seele, verrichteten für einige Pence ihre Dienste, und das oft genug in dunklen Hinterhöfen und auf schmutzigem Pflaster.
Grace Brown verfluchte den Tag, an dem sie in die große Stadt gekommen war. Drei Jahre lag dies nun zurück. Bevor ihr Ehemann beim Diebstahl dreier Orangen erwischt und in die Tretmühle geschickt worden war; bevor sie als Frau eines Zuchthäuslers ihre Stellung in der Fabrik verloren hatte; bevor sie auf die Straße gejagt worden war, weil sie die Miete für das schäbige Zimmer nicht mehr hatte bezahlen können; bevor sie aus Furcht vor dem Arbeitshaus damit begonnen hatte, ihren Körper zu Markte zu tragen; und bevor der Messerschnitt eines zahlungsunwilligen Kunden ihre linke Gesichtshälfte mit einer Narbe verunstaltet hatte. Nur eines hatte Grace Brown ihrer Konkurrenz voraus, die rings um die Fournier Street die Straßen säumte und die Röcke hochzog, um keinen Zweifel an der Natur des angebotenen Dienstes aufkommen zu lassen: Sie hatte rotes Haar, das wie ein Leuchtsignal aus der grauen Ödnis stach und die Aufmerksamkeit der Freier auf sich zog. In anderen Nächten hatte diese Laune der Natur Grace davor bewahrt, in der Gosse nächtigen zu müssen – in dieser Nacht wurde sie ihr zum Verhängnis …
Das regennasse Pflaster der Hopetown Street schimmerte im Licht der Laternen. Nur hin und wieder kam eine Kutsche oder ein Fuhrwerk die Brick Lane herab – meist waren es nur schäbige Karren, die von abgemagerten Eseln gezogen wurden und deren Besitzer hohlwangige Männer mit bleichen, ausgemergelten Gesichtern waren; Marktschreier, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Obst und Gemüse auf den Märkten von Covent Garden oder Billingsgate zu kaufen und andernorts einige Pence teurer feilzubieten; Kohlehändler und ihre schmutzigen Cousins, die Staubmänner, die die Aschebehälter der Stadthäuser leerten; und schließlich die Rattenfänger, für die es in allen Teilen der Stadt mehr als genug zu tun gab.
Grace Brown sprach diesen und jenen an, erntete jedoch nichts als Spott und derbes Gelächter. Niemand wollte sich mit ihr einlassen, und ihre Verzweiflung wurde immer größer – als sich plötzlich, zugleich schön und unheimlich anzusehen, die Formen einer großen, vornehmen Kutsche aus Rauch und Nebel schälten.
Es war ein Vierspänner, wie nur noble Herrschaften ihn sich leisten konnten, gezogen von vier schwarzen Rossen, das Geschirr silberbeschlagen. Zu Grace Browns maßloser Verblüffung verlangsamten die Tiere ihren Tritt, gerade als die Kutsche sie passierte, und das vornehme Gefährt hielt an.
»He, du.«
Der Kutscher, ein breitschultriger Mann, der ein wollenes Cape trug und den Hut tief ins Gesicht gezogen hatte, um sich vor der klammen Kälte der Nacht zu schützen, zog die Bremse an.
»Sprichst du mit mir?« Erstaunt blickte Grace sich um – aber außer ihr war niemand da.
»Mit wem denn sonst?« Der Kutscher beugte sich zu ihr herab. »Bist du auf der Suche nach Arbeit?«
»J-ja.«
»Mein Herr dort«, er deutete über die Schulter zur Kutsche, in deren dunklem Fensterglas sich Straße und Häuser spiegelten, »ist auf der Suche nach etwas Zerstreuung. Und ich denke, dass du genau das bist, wonach er sucht.«
»Meinst du?« Grace zupfte verlegen ihr Haar und den schäbigen Schal zurecht, den sie trug, während sie in Gedanken schon auszurechnen begann, wie viel der hohe Herr wohl springen lassen würde. Zehn Pence vielleicht oder gar einen Shilling …
»Ganz sicher.« Die Augen des Kutschers waren im Schatten der Hutkrempe nicht zu sehen, aber der Mund und das bärtige Kinn verzogen sich zu einem ermunternden Grinsen. »Bist du mit einem Florin als Bezahlung einverstanden?«
»E-ein Florin?«, stammelte Grace – das war mehr, als sie je von einem Freier bekommen hatte. »Natürlich bin ich einverstanden.«
»Dann geh nur hinein. Mein Herr erwartet dich schon.«
»Hab tausend Dank«, hauchte Grace, die sich nicht erklären konnte, woher diese günstige Wendung des Schicksals kam, und den Kutscher am liebsten umarmt hätte. Mit pochendem Herzen trat sie auf die Kutsche zu, deren Inneres in undurchdringlicher Schwärze lag und in deren dunklen Fenstern sie sich selbst sehen konnte. Kaum hatte sie sich dem Gefährt genähert, öffnete sich die Tür und schwang mit leisem Knarren auf. Die Schwärze im Inneren jedoch blieb, als weigerte sich der spärliche Laternenschein, hineinzudringen.
»Sir?«, fragte Grace zaghaft, während sie sich vorsichtig näherte und einen Blick in die Kutsche warf.
Für einen Augenblick schlug ihr eine eisige Kälte entgegen, und die Gewissheit, dass jemand dort in der Kutsche saß und sie mit durchdringendem Blick anstarrte, erfüllte sie. Der jähe Drang, sich abzuwenden und rasch die Flucht zu ergreifen, überkam sie, aber der Gedanke an den Florin, der für die nächsten Tage einen vollen Magen und ein Dach über dem Kopf versprach, hielt sie an Ort und Stelle.
»Soll ich reinkommen, Sir?«, fragte sie flüsternd, doch wie zuvor drang aus dem Dunkel keine Antwort. Dafür schien sich in der Kutsche etwas zu regen. Das leise Rascheln von Stoff war zu hören und ein heller, metallischer Klang, fast wie das Läuten eines Glöckchens. Aber es war kein Glöckchen – es war der Klang rasiermesserscharfen Stahls.
Grace Brown blieb keine Zeit, entsetzt zu sein, als die blitzend weiße Klinge aus der Dunkelheit stach und ihr mit einem einzigen Streich die Kehle durchtrennte.
Ein Schwall von Blut ertränkte ihre Träume und Ängste, ihre Hoffnungen und Befürchtungen, noch ehe im fernen Westminster der Glockenschlag von Big Ben ganz verklungen war.
2
PERSÖNLICHER TAGEBUCHEINTRAG SARAH KINCAID
Ich hatte ihn wieder, diesen seltsamen Traum, von dem ich gerne annehmen möchte, dass er nicht mehr ist als ein wüster Nachtmahr, der mich von Zeit zu Zeit verfolgt. Aber die Bilder, die ich darin sehe, jene Schatten und Eindrücke, sind zu wirklich, als dass ich sie als bloße Folge eines schwer verdaulichen Nachtmahls sehen könnte. Sie sind mir auf eine Weise vertraut, die mir fast Angst macht, und dennoch kann ich mich nicht entsinnen, dergleichen je erlebt zu haben.
Warum?
Ist der Traum eine Folge dessen, was mir widerfahren ist? Oder entstammt er jenen im Dunkel der Vergangenheit verborgenen Tagen, die mein Vater als ›tempora atra‹, als ›Dunkelzeit‹ zu bezeichnen pflegte? Beides ängstigt mich mehr, als mir lieb sein kann, denn nach allem, was geschehen ist, will ich die Vergangenheit endlich hinter mir lassen. Selbst nach all den Monaten, die verstrichen sind, stehen mir die Geschehnisse von Alexandrien noch deutlich vor Augen, und noch immer quält mich die Frage, ob ich meinen Vater hätte retten können. Und je mehr ich darüber nachsinne, desto deutlicher fühle ich, dass der Tag kommen wird, an dem mich die Vergangenheit einholt …
KINCAID MANOR, YORKSHIRE
1. NOVEMBER 1883
Die Sonne war hinter dem Horizont versunken und tauchte die Wolken in blassroten Schein, als die Kutsche der königlich wissenschaftlichen Gesellschaft vor dem Haupthaus des Gehöfts vorfuhr. Das raue, hügelige Marschland war in ein sanftes Licht getaucht, das der Landschaft einen geradezu unwirklichen Anstrich verlieh.
Schnaubend kamen die Pferde, die der Kutscher unnachgiebig zur Eile angetrieben hatte, zum Stehen, und zwei Stallknechte eilten heran, deren Bewegungen deutlich erkennen ließen, dass sie dem derben, ein wenig unbeholfenen Menschenschlag angehörten, den das Marschland von Yorkshire hervorgebracht hatte.
Dr. Mortimer Laydon hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Leidenschaft seines alten Freundes Kincaid für das Landleben nie geteilt hatte; er hatte nie verstanden, was Gardiner daran gefunden hatte, im fernen Yorkshire zu leben, fernab von allen Segnungen der Technik und der Zivilisation, von Annehmlichkeiten wie einer täglichen Zeitung und regelmäßigen Besuchen im Club ganz zu schweigen. Aber Gardiner Kincaid hatte sich hier nach Jahren ausgedehnter Reisen im Auftrag der Wissenschaft ein Heim eingerichtet, ein »Domizil«, wie er es zu nennen pflegte, in dem er ungestört seinen Studien nachgehen konnte. Als Romantiker, der er nun einmal gewesen war, hatte er seine Gedanken stets mehr auf die Vergangenheit gerichtet als auf die Gegenwart. Nicht von ungefähr hatte er den Landsitz, mit dem die Königin ihn aus Dank für seine Verdienste um die Archäologie bedacht hatte, »Kincaid Manor« genannt, gemäß den Ländereien, mit denen die normannischen Ritter einst von ihren Herren belehnt worden waren. Und diese Liebe zur Vergangenheit hatte den alten Gardiner Kincaid am Ende das Leben gekostet.
Längst war das Anwesen, das aus einem zweiflügeligen Gebäude und einer angrenzenden Stallung bestand, kein Farmhaus mehr; zwar verpachtete die Familie Kincaid ihren Landbesitz an die Bauern, von denen es in dieser öden, nur zur Schafzucht geeigneten Gegend ohnehin recht wenige gab. Der wahre Reichtum von Kincaid Manor lag jedoch nicht im Besitz von Grund und Boden, sondern in dem Wissen, das hier gesammelt wurde. Kein unbedarfter Besucher, der sich durch das Moor und die felsigen Hügel näherte, hätte vermutet, dass die ehrwürdigen Mauern des Anwesens nicht nur eine ansehnliche Bibliothek bargen, sondern auch eine höchst außergewöhnliche Sammlung antiker Artefakte.
Gardiner Kincaid hatte sein Leben der Erforschung vergangener Mysterien gewidmet; er hatte Expeditionen in die entlegensten Winkel des Empire angeführt, und er war dafür von Ihrer Majestät geadelt worden. Und obwohl sein alter Freund tot war, was Mortimer Laydon mit Trauer erfüllte, war Kincaid Manor auch jetzt noch ein Hort des Wissens und profunder Kenntnis. Denn Gardiner Kincaid hatte eine gelehrige Schülerin gehabt …
Da es weit und breit keine Siedlung gab, geschweige denn eine brauchbare Gaststätte, in der man hätte nächtigen können, hatte der Doktor Gepäck für die Nacht mitgebracht, das von den Bediensteten jetzt ins Haus getragen wurde. Vor zwei Tagen hatte er seinen Besuch durch einen Kurier angekündigt, wie die Formen gepflegten Umgangs es erforderten. Laydon wusste zwar, dass man es hier im Norden mit der Etikette nicht so genau nahm und dass Gardiners Tochter die Abneigung ihres Vaters gegen gesellschaftliche Zwänge teilte, aber er wollte dennoch nicht so unzivilisiert erscheinen, sein Kommen erst anzukündigen, indem er lautstark an die Tür des Hauses klopfte.
Die Pforte wurde ihm vom Diener des Hauses geöffnet, der ihn mit gravitätischer Miene begrüßte. Seine Livrierung war nicht nach der neuesten Londoner Mode geschnitten, sondern so altertümlich wie alles in diesem Haus. Im Licht der Kerzenleuchter, die die Eingangshalle säumten (die Versorgung mit Gas war noch nicht bis Kincaid Manor vorgedrungen), sah Laydon alte Statuen und Gemälde, dazu Waffen aus verschiedenen Epochen, schartige Schwerter und rostige Helme, Hinterlassenschaften aus weit weniger zivilisierten Tagen.
»Sir«, sagte der Diener mit deutlichem Yorkshire-Akzent, nachdem er dem Besucher Hut und Mantel abgenommen hatte. »Wenn Sie gestatten, werde ich Sie zum Kaminzimmer geleiten. Lady Kincaid erwartet Sie bereits.«
»Ich bitte darum«, erwiderte Laydon.
In einem von vergoldeten Schnitzereien gesäumten Spiegel prüfte der kleinwüchsige Mann mit dem schlohweißen Haar und dem Backenbart sein Äußeres. Was er sah, erfüllte ihn nur sehr bedingt mit Zufriedenheit. In guten Londoner Kreisen wäre sein von der langen Fahrt zerknitterter Gehrock wohl kaum mehr dazu angetan gewesen, einer Dame die Aufwartung zu machen; hier im Norden jedoch, wo es weniger auf Formalitäten ankam, mochte es durchaus noch genügen. Zudem war Laydon mit einer dringlichen Mission betraut, die weder Aufschub noch Eitelkeiten zuließ.
Gemessenen Schrittes führte der Hausdiener ihn durch die Eingangshalle in den Gang, der sich daran anschloss. Warmer, flackernder Feuerschein drang vom Ende des Korridors herauf und hieß den Besucher willkommen. Kurz darauf stand Mortimer Laydon im Kaminzimmer. Die niedrige Decke war mit dunklem Holz getäfelt, die Balken dazwischen mit reichen Schnitzereien verziert. Soweit Laydon wusste, stammten sie aus einer alten Abtei, die von den Mönchen aufgegeben und dem Verfall preisgegeben worden war; Gardiner hatte sie aufgekauft und mühevoll restauriert. Die Wände des niedrigen Raumes wurden von Regalen eingenommen, die bis hinauf zur Decke mit Büchern gefüllt waren. Diese stellten jedoch nur einen Bruchteil der Wissensschätze dar, die Kincaid Manor barg. Der weitaus größere Teil davon befand sich in der Bibliothek, die im Ostflügel des Gebäudes untergebracht war und die der alte Gardiner wie seinen Augapfel gehütet hatte.
Vor dem Kamin, auf dessen Rost ein züngelndes Feuer wohlige Wärme verbreitete, stand ein großer, mit dunklem Leder beschlagener Sessel, dessen Rückseite Laydon zugewandt war.
»Ihr Besuch, Madam«, sagte der Diener, und aus dem Sessel erhob sich eine junge Frau, deren Schönheit geradezu überwältigend war – und das, obwohl sie sich in mancherlei Hinsicht von den Damen des vornehmen London unterschied.
Die ebenmäßigen Gesichtszüge hatte sie von ihrem Vater geerbt. Auch die Augen, deren tiefes Blau ein keltisches Erbe erkennen ließ, schrieb Dr. Laydon der Blutlinie des alten Gardiner zu, ebenso wie den schmalen Mund und das entschlossen wirkende Kinn. Zu behaupten, dass Lady Kincaid deshalb streng und unnahbar aussah, wäre allerdings falsch gewesen, denn die Grübchen um ihre Mundwinkel und die kleine, keck hervorspringende Nase ließen ein gewitztes, schalkhaftes Wesen erahnen.
Ihr Teint war dunkler, als es bei einer Dame ihres Standes üblich war, und um die Nase und über den Wangen waren leichte Sommersprossen zu erkennen, was auf lange Aufenthalte unter heißer Sonne schließen ließ. Das schwarze Haar fiel ihr in ungezähmten Locken auf die Schultern herab, nur mühsam im Zaum gehalten von einem samtenen Band. Das schlichte Kleid, das sie trug und das die Damen in London wohl als hoffnungslos altmodisch bezeichnet hätten, verzichtete auf die bauschenden Formen einer Krinoline und fiel glatt und sanft an ihr herab. Der blaue Samt glänzte im flackernden Licht des Feuers. Sarah Kincaid trug weder Federn noch Schmuck – die Abneigung gegen jede Form von künstlichem Putz war eine weitere Eigenschaft, die sie mit ihrem verstorbenen Vater teilte.
»Onkel Mortimer! Welch eine Freude!«
Ohne darauf zu warten, dass ihr Pate ihr seine Aufwartung machte, kam Sarah hinter ihrem Sessel hervor, und noch ehe Laydon auch nur dazu kam, sich zu verbeugen, hatte sie ihn schon herzlich umarmt. Im fernen London wäre jeder Besucher von solch bäuerlicher Vertraulichkeit peinlich berührt gewesen – in der Einsamkeit des rauen Nordens entbehrte sie nicht eines gewissen Charmes.
»Sarah, mein Kind.« Laydon wartete, bis sie sich von ihm gelöst hatte, dann bedachte er sie mit einem milden Lächeln. »Wie lange ist es her? Wie lange haben wir uns nicht gesehen?«
»Seit Vaters Beerdigung«, erwiderte sie, und die Wiedersehensfreude in ihren Zügen verschwand hinter einem dunklen Schatten.
»Wie ist es dir seither ergangen? Verzeih, Sarah, dass ich nicht eher dazu kam, dich zu besuchen, aber meine Anwesenheit in London und am königlichen Hof war dringend erforderlich.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Sarah lächelte wieder, nicht ohne Stolz. »Schließlich will Ihre Majestät die Königin nicht auf ihren besten Leibarzt verzichten.«
»Sarah.« Laydon errötete. »Es schmeichelt mir, dass du so von mir denkst. Aber zum einen hat die königliche Familie viele Leibärzte, und zum anderen maße ich mir nicht an, der beste zu sein.«
»Bescheiden wie immer. Du hast dich nicht verändert, Onkel.«
»Du ebenso wenig, wie es den Anschein hat.« Der Doktor machte eine ausgreifende Handbewegung. »Und Kincaid Manor hat sich offenbar ebenfalls nicht verändert.«
»Der Eindruck täuscht«, entgegnete Sarah. »Es ist nicht mehr dasselbe seit Vaters Tod. Sein Wissensdurst und sein unermüdlicher Forscherdrang haben dieses Haus mit Leben erfüllt. Ich versuche, seine Arbeit fortzusetzen, so gut ich kann, aber …«
»Ich bin sicher, du gibst dein Bestes. Und ich bin ebenso sicher, dass dein Vater sehr stolz auf dich wäre, Sarah.«
»Glaubst du?«
»Ich bin überzeugt davon. Man kann viel über den alten Gardiner Kincaid behaupten, aber nicht, dass er aus seinem Herzen eine Mördergrube gemacht hätte. Abgesehen von seiner Arbeit, warst du der Mittelpunkt seines Lebens, Sarah – und es hätte ihn sehr gefreut zu sehen, dass du seine Forschungen weiterführst.«
»Ich versuche es«, erwiderte sie und zwang sich zu einem Lächeln, um dann rasch das Thema zu wechseln. »Wie lange wirst du bleiben, Onkel Mortimer? Es gibt so viel zu erzählen …«
»In der Tat.« Laydon nickte. »Es gibt dringliche Angelegenheiten zu besprechen, deshalb bin ich hier.«
»Dringliche Angelegenheiten?« Sarahs Miene verfinsterte sich erneut. »Von was für Angelegenheiten sprichst du? Ich dachte, du wärst gekommen, um mich zu besuchen …«
»Das bin ich«, versicherte er. »Aber das ändert nichts daran, dass ich wichtige Nachrichten im Gepäck habe, Sarah.«
»Nachrichten? Was für Nachrichten?«
»Gute Nachrichten. Nachrichten vom königlichen Hof.«
»Das sollte mich wundern«, entgegnete sie sarkastisch. »Vom königlichen Hof sind noch selten gute Nachrichten gekommen, zumal, wenn sie meine Familie betreffen. Ich erinnere mich noch gut an die Depesche, die Alexandrien betraf …«
»Alexandrien hat damit nichts zu tun«, stellte Laydon klar. »Du tätest gut daran, die Vergangenheit ruhen zu lassen, Sarah.«
»Ich soll die Vergangenheit ruhen lassen?« Sie lächelte dünn. »Du vergisst, dass ich Archäologin bin, Onkel. Es ist meine Profession, im Boden zu graben und ihm die Geheimnisse der Vergangenheit zu entreißen.«
»Vielleicht«, gab der Doktor zu. »Aber sicher ist es nicht deine Berufung, dich selbst zu vergraben und in der Vergangenheit zu leben. Das hätte dein Vater nicht gewollt. Bitte, Sarah. Hör dir zumindest an, was ich zu berichten habe.«
Lady Kincaid schaute lange und prüfend in die von weißem Haar umrahmten, aber noch straff und jugendlich wirkenden Züge ihres Paten. Die letzten Monate hatte sie damit zugebracht, über Büchern und alten Folianten zu brüten, und dabei mehr über ihre eigene Vergangenheit nachgedacht als über die versunkener Völker und Kulturen. Möglicherweise hatte ihr Onkel Recht. In den vergangenen Monaten hatte Sarah gehofft, vergessen zu können, was in Ägypten geschehen war, und es war ihr nicht gelungen. Vielleicht konnte ihr väterlicher Freund und Pate ihr dabei helfen. Schließlich hatte er schon ihrem Vater stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
»Einverstanden, Onkel Mortimer«, erklärte sie sich deshalb vorsichtig bereit. »Unter einer Bedingung.«
»Nämlich?«
»Da du deinen Besuch rechtzeitig angekündigt hast, habe ich die Küche angewiesen, ein spätes Dinner zu bereiten. Wenn es dir recht ist, werden wir zunächst zu Abend essen und danach bei einem guten Glas Claret über alles reden.«
»Bei einem guten Glas Claret?« Laydon schürzte anerkennend die Lippen. »Warum hast du das nicht gleich gesagt? Es freut mich zu hören, dass die Segnungen der Zivilisation nicht völlig spurlos an Kincaid Manor vorbeigegangen sind.«
»Also abgemacht?«, fragte Sarah.
Laydon nickte.
»Abgemacht.«
Die Köchin von Kincaid Manor – eine betagte Frau aus den Midlands, die schon für Sarahs Vater gearbeitet und für ihn gekocht hatte, als dieser noch in Oxford weilte – hatte ein Mahl aufgetragen, das selbst dem verwöhnten Gaumen Mortimer Laydons Anerkennung abverlangte. Auf eine delikate Hühnersuppe folgten zwei Gänge mit Lammkoteletts und Truthahn, zu denen Gemüse und Salat sowie französischer und englischer Senf gereicht wurden. Den Abschluss des Mahls bildeten Schokoladencreme und Walnüsse.
»Vorzüglich, mein Kind«, lobte der Doktor und verabschiedete den bittersüßen Geschmack der Schokolade mit einem Schluck Wein. »Wer hätte gedacht, dass man im fernen Yorkshire solche Genüsse kennt? Auf Gardiner Kincaid, den besten Freund, den sich ein Mann wünschen kann – und den besten aller Väter. Möge er in Frieden ruhen.«
»Auf Vater«, stimmte Sarah zu, und beide tranken.
»Ein guter Tropfen«, stellte Laydon mit Blick auf den rubinroten Inhalt seines Glases fest. »Mild und würzig zugleich. Das erklärt, weshalb dieser Franzose zu den bevorzugten Weinen der guten Londoner Gesellschaft gehört.«
»Tut er das?«, fragte Sarah.
»Allerdings. Und dass du etwas davon in deinem Weinkeller hast, beweist mir, dass du den Genüssen des Lebens weniger abgeneigt bist als dein Vater – und darüber bin ich sehr erfreut, Sarah.«
»Täusche dich nicht, Onkel«, erwiderte sie. »Ich bin der Vergangenheit ebenso verfallen, wie mein Vater es war, und ich würde das hier« – sie deutete auf den Dekantierer, in dessen breitem Bauch der Claret geheimnisvoll schimmerte – »jederzeit gegen das Privileg eintauschen, eines der Rätsel der Menschheitsgeschichte zu lösen.«
»Du sprichst tatsächlich wie dein Vater.« Laydon lächelte.
»Warum auch nicht? Er war mein Lehrer, und es ist seine Arbeit, die ich fortsetze. Seine Studien.«
»Ich verstehe. Dann hat die Akademie der Wissenschaften dir also einen Forschungsauftrag erteilt und dich mit Geldern und Mitteln ausgestattet?«
»Natürlich nicht.« Sarah schüttelte den Kopf über diese seltsame Frage. »Du weißt genau, dass die Mitgliedschaft in der Akademie ausschließlich Männern vorbehalten ist. Diese selbstgefälligen Idioten würden sich lieber sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen verschließen, als eine Frau in ihre Mitte aufzunehmen.«
»Auch dann, wenn sie so brillant wäre wie du?«
Wieder verzog Sarah das Gesicht. »Ich danke dir für das Kompliment, Onkel, aber ich fürchte, deine Geschlechtsgenossen sind noch um einiges bornierter, als du es dir vorzustellen vermagst.«
»Schwer vorstellbar, in der Tat.« Laydon nahm noch einen Schluck. »Wir leben in modernen Zeiten, Sarah. Es spielt keine Rolle, welches Geschlecht jemand hat, wenn er nur …«
»Glaubst du das wirklich, Onkel?«
»Allerdings.«
»Dann hebe ich als Gastgeberin und Herrin von Kincaid Manor die Tafel hiermit auf und gestatte dir zu rauchen. Wirst du es tun?«
»Natürlich nicht.«
»Weshalb nicht?«
»Nun – weil es einem Gentleman aufrechter Gesinnung niemals in den Sinn kommen würde, in Gegenwart einer Lady zu rau …« Der Doktor unterbrach sich, als er merkte, dass Sarah ihn überlistet hatte, und blickte schuldbewusst in sein Weinglas.
»Die Wahrheit, Onkel«, erklärte Sarah nicht ohne Bitterkeit, »ist, dass Frauen in dieser Gesellschaft nicht wirklich respektiert werden. Auch mein Vater hat das gewusst, dennoch hat er mir sowohl Kincaid Manor als auch seine Bibliothek und seine Sammlung vermacht.«
»Weil er wusste, dass du nicht aufgeben würdest«, meinte Laydon voller Überzeugung. »Dass du dich mit gesellschaftlichen Beschränkungen nicht einfach abfinden würdest.«
»Dann hat er sich geirrt«, erwiderte Sarah. »Ich bin keine Revolutionärin, Onkel Mortimer. Alles, was ich möchte, ist in Ruhe die Studien meines Vaters fortsetzen. Eingebildete Hohlköpfe aus Oxford oder Cambridge brauche ich dazu nicht.«
»Vielleicht nicht. Aber du wirst die Ergebnisse deiner Forschungen auch niemals veröffentlichen können. Wirst niemals die Früchte deiner Arbeit ernten.«
»Und?« Sarah zuckte mit den Schultern. »Mein Vater hat die Früchte seiner Arbeit geerntet. Er war ein anerkannter Wissenschaftler und wurde für seine herausragenden Leistungen geadelt. Und was hat es ihm am Ende gebracht? Er starb fern von seiner Heimat in einem fremden Land.«
»Dein Vater ist für seine Überzeugung gestorben«, verbesserte Laydon, »für das, was ihm wichtig war. Ich erinnere mich, dass er nie darüber hinweggekommen ist, dass dieser Deutsche vor ihm Troja entdeckt hat. Gardiner wollte stets der Erste sein, wollte die Geheimnisse der Vergangenheit ans Licht bringen, bevor es ein anderer tat, und dafür war er auch bereit, sein Leben zu geben. Und du, Sarah, hast dieselbe Leidenschaft in dir.«
»Keineswegs.«
»Willst du mir das wirklich erzählen? Schon als junges Mädchen hast du ferne Länder bereist und den Odem des Abenteuers geatmet. Du kennst nichts anderes als das, Sarah, und willst mir dennoch weismachen, dass du damit zufrieden bist, in der Abgeschiedenheit eines alten Gemäuers zu sitzen und in alten Büchern zu stöbern?«
»Du vergisst, dass ich auch eine gute englische Erziehung genossen habe, Onkel Mortimer. Irgendwann beschloss mein Vater, dass ich genug Abenteuer erlebt hätte, und schickte mich zurück nach London, auf Kingsleys Schule für höhere Töchter.«
»Du bist nicht lange dort geblieben«, wandte Laydon ein.
»Lange genug, um zu wissen, wo mein Platz in dieser Gesellschaft ist«, gab Sarah bissig zurück. »Das letzte Mal, als ich diesen Platz verließ, hat mein Vater dafür mit dem Leben bezahlt.«
»Jetzt verstehe ich«, stellte der Doktor mit einigem Unglauben fest. »Du machst dir Vorwürfe. Du gibst dir die Schuld an dem, was in Alexandrien geschehen ist.«
»Ich habe viel darüber nachgedacht«, gab Sarah zu. »Und ich frage mich, ob ich es nicht hätte verhindern können …«
»Nein, Sarah. Es war ein feiges Komplott, und das weißt du. Es lag nicht in deiner Macht, es zu verhindern.«
»Wie auch immer – seit Vater in meinen Armen starb, habe ich nach Antworten gesucht. All das muss einen Sinn haben. Es darf nicht sein, dass Vater nur deshalb sein Leben ließ, weil eine Laune des Schicksals es so wollte. Es muss einen tieferen Grund dafür geben, eine Verbindung zur Vergangenheit. Verstehst du, was ich meine? In der Geschichtswissenschaft gibt es immer eine Verbindung zur Vergangenheit, nichts geschieht aus purem Zufall …«
»Vielleicht doch«, warf Laydon ein. »Manchmal geschehen Dinge, ohne dass sie einen Sinn ergeben, Sarah.«
»Nicht solche Dinge.« Sie schüttelte den Kopf.
»Was macht dich so sicher?«
Sie griff erneut nach dem Weinglas und leerte es, mit weit größeren Schlucken, als es sich für eine Dame geziemte. Eine Antwort blieb sie schuldig, aber Laydon gab nicht auf.
»Was macht dich so sicher, Sarah?«, fragte er noch einmal. »Du scheinst etwas zu wissen, das außer dir niemand weiß. Was ist es, Sarah? Willst du es mir nicht verraten?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich bin dein Pate«, erinnerte Laydon sie. »Wenn du dich mir nicht anvertrauen willst, wem dann? Nach dem Tod deines Vaters bin ich wohl derjenige, dem du am meisten vertrauen kannst.«
Sarah besann sich. Es stimmte – Mortimer Laydon war der beste Freund ihres Vaters gewesen und hatte fast zur Familie gehört. Und obendrein war er Arzt – vielleicht konnte er ihr tatsächlich helfen.
Entschlossen stellte sie ihr Glas beiseite und erhob sich. Unter Missachtung jeder Etikette nahm sie ihren Stuhl und umrundete damit die Tafel, um sich direkt neben den Doktor zu setzen.
»Ich habe einen Traum«, eröffnete sie ihm kurzerhand.
»Einen Traum?«
Sie nickte. »Einen Traum, der immer wiederkehrt. Es sind stets dieselben Bilder, die ich sehe, aber ich weiß nicht, was sie zu bedeuten haben.«
»Interessant«, sagte Laydon und reckte wissbegierig das Kinn vor. »Und seit wann hast du diesen Traum?«
»Seit Vaters Tod.«
»Ich verstehe.« Der Doktor nickte verständnisvoll, und ein undeutbarer Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Und was sind das für Bilder, die du siehst?«, fragte er vorsichtig.
»Ich weiß es nicht. Es sind keine konkreten Bilder, sondern nur verschwommene Eindrücke. Farben und Geräusche. Und manchmal auch Gerüche.«
»Aber du kannst sie nicht einordnen, oder?«
»Nein.« Erneut schüttelte sie den Kopf. »Dennoch ängstigen sie mich, denn sie haben mit der Vergangenheit zu tun.«
»Sarah.« Der Doktor schürzte die Lippen. »Nicht alles, was wir träumen, hat zwangsläufig mit der Vergangenheit zu tun. Vieles hat seinen Ursprung in uns selbst, und ich weiß nicht, ob …«
»Mit meiner Vergangenheit«, schränkte Sarah ein, und plötzlich wusste Laydon, worauf sie anspielte.
»Tempora atra«, flüsterte er. »Die Dunkelzeit.«
Sarah nickte. »So nannte mein Vater das Phänomen. Aber auch er konnte sich nicht erklären, was es damit auf sich hat.«
»Und du glaubst, dass die verlorenen Jahre deiner Kindheit mit diesen Träumen in Verbindung stehen?«
»Es wäre möglich, oder nicht?«
»Natürlich.« Laydon rieb sich nachdenklich die Schläfe. »Ich nehme an, dass ein so furchtbares Erlebnis wie der Tod des Vaters durchaus dazu angetan sein könnte, verschüttete Erinnerungen wieder zutage zu befördern. Andererseits sagst du selbst, dass die Bilder, die du siehst, undeutlich und verschwommen sind, also könnten sie alles Mögliche bedeuten, nicht wahr?«
»Das stimmt.« Sarah nickte, und am feuchten Glanz ihrer Augen konnte der Doktor erkennen, dass die Angelegenheit sie weit mehr mitnahm, als sie zugeben wollte. »Aber ein Gefühl sagt mir, dass es einen Zusammenhang zwischen meinen Träumen und Vaters Tod gibt. Du magst an Zufälle dieser Art glauben, Onkel Mortimer – ich tue es nicht. Ich glaube an das Schicksal und bin davon überzeugt, dass nichts auf dieser Welt aus purem Zufall geschieht. Deshalb werde ich weiter nach Antworten suchen.«
»In deinen Büchern?«
»Warum nicht? Kennst du einen besseren Ort?«
»Vielleicht ja«, bestätigte der Arzt und legte eine Kunstpause ein, in der er nach seinem Taschentuch griff und es Sarah reichte, damit sie ihre Tränen trocknen konnte. »Was, wenn es für dich eine Möglichkeit gäbe, weiter an den Fragen zu forschen, die dich beschäftigen? Mehr Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen, ohne dass deine Arbeit verlacht oder missachtet würde?«
»Das wäre schön«, gestand Sarah, »aber das wird nicht geschehen.«
»Vielleicht doch«, widersprach Laydon mit triumphierendem Lächeln. »Denn du musst wissen, mein Kind, dass ich gekommen bin, um dir genau dies anzubieten – und noch ungleich mehr.«
»Du beliebst zu scherzen, Onkel.«
»Durchaus nicht. Denn nur aus diesem Grund bin ich hier. Ich soll dich auf oberstes Geheiß nach London bringen, wo deine Kenntnisse und deine Fähigkeiten dringend gebraucht werden.«
»Meine Kenntnisse?« Sarah hob ihre schmalen Brauen. »Meine Fähigkeiten? Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, dass die Geschehnisse in Ägypten nicht verborgen geblieben sind. Die Königin kennt deinen Namen und weiß, was das Empire dir verdankt – und sie hat mich gebeten, dich in ihrem Namen um Hilfe zu bitten.«
»Um Hilfe? Wobei?«
»Das werde ich dir erst verraten, wenn du zugesagt hast, mich nach London zu begleiten.«
»London.« Sarah kaute den Namen der Hauptstadt wie alten Wein, während ein wahrer Wust an Erinnerungen in ihr Bewusstsein flutete, gerade so, als wäre ein Schleusentor geöffnet worden. Und nicht jede dieser Erinnerungen war angenehm …
»Ich bedaure, Onkel Mortimer«, entgegnete sie deshalb. »Aber ich fürchte, ich kann dein großzügiges Angebot nicht annehmen.«
»Weshalb nicht?«
»Weil ich Kincaid Manor nicht den Rücken kehren werde, weder für London noch für sonst einen Ort auf der Welt.«
»Und warum nicht?«
»Weil ich es Vater schuldig bin, deshalb.«
»Unsinn, Sarah«, widersprach Laydon entschieden und lauter, als es einem Gentleman zukam – mochte es nun am Alkohol liegen oder daran, dass die bäuerischen Sitten Yorkshires bereits auf ihn übergegriffen hatten. »Du schuldest deinem Vater nicht das Geringste.«
»Nein?«, fragte sie trotzig. »Verzeih, Onkel Mortimer, aber ich denke nicht, dass du darüber urteilen solltest. Die letzten Worte, die mein Vater auf dieser Welt sprach, galten mir. Er bat mich, seine Mission fortzuführen und nach der Wahrheit zu suchen.«
»Dann verstehe ich erst recht nicht, weshalb du Kincaid Manor nicht verlassen willst. Gardiners Sammlung in allen Ehren, aber in London sind die Voraussetzungen für ernsthafte wissenschaftliche Arbeit ungleich besser – ich möchte nur an die königliche Bibliothek und das Britische Museum erinnern. Aber in Wirklichkeit geht es nicht darum, oder?«
»Was meinst du?«
»In Wirklichkeit«, fuhr Laydon fort, »willst du Kincaid Manor nur aus einem einzigen Grund nicht verlassen – weil du dich fürchtest. Du fürchtest dich vor der Welt da draußen, die dir den Menschen genommen hat, den du mehr geliebt hast als jeden anderen, und du hast dich hier in diese einsame Gegend verkrochen, um zu trauern. Eine Zeit lang mag dies angebracht gewesen sein, aber die Zeit der Trauer und des Versteckspielens ist zu Ende. Du musst dich dem Leben wieder stellen, Kind. Auch dein Vater hätte es so gewollt.«
»Was du nicht sagst«, konterte Sarah wenig diplomatisch. »Und das alles fällt dir ein, nachdem ich dir über Monate hinweg völlig gleichgültig gewesen bin? Bei Gott, Onkel Mortimer, ich hätte in all der Zeit einen Freund sehr gut gebrauchen können.«
Laydon hielt ihrem empörten Blick stand. »Das glaube ich dir gerne, mein Kind«, sagte er mit ruhiger Stimme, »und ich kann verstehen, dass du wütend auf mich bist. Es stimmt, ich war in den dunklen Tagen, die hinter dir liegen, nicht bei dir, und dafür bitte ich dich um Verzeihung. Könnte ich ungeschehen machen, was geschehen ist, so glaube mir, ich würde es tun. Und könnte ich meinen alten Freund ins Leben zurückholen, indem ich meines dafür gebe, so würde ich auch das ohne Zögern tun. Willst du mir das glauben?«
Sarah ließ sich mit der Antwort Zeit. Laydon hatte nicht Unrecht. Sie fürchtete sich tatsächlich davor, Kincaid Manor zu verlassen, befürchtete, dass die Geschichte sich wiederholen könnte.
Aber das Wort, das ihren Seelenzustand mit Abstand am treffendsten kennzeichnete, war nicht Furcht oder Trauer. Es war Wut.
Blanke, hilflose Wut, die sich auf niemand Bestimmten richtete, sondern auf alles und jeden. Auf Mortimer Laydon, der ungebeten in ihr Leben platzte und es auf den Kopf stellen wollte; auf jene Traumbilder, die sie seit dem Tod ihres Vaters verfolgten und ihr Geheimnis nicht preisgeben wollten; auf ihre eigene Feigheit und Tatenlosigkeit; und schließlich auch auf ihren Vater, weil er seinen Forschungen den Vorzug gegeben und seine Tochter auf dieser Welt allein gelassen hatte …
Sarahs Brust bebte vor Zorn. Ihre Fäuste ballten sich, dass die Knöchel weiß hervortraten – aber schließlich nickte sie.
»Gardiner war mein Freund, Sarah, der beste, den ich je hatte«, fuhr Mortimer Laydon tröstend fort. »Aber er war auch ein Mensch, und Menschen machen Fehler. Gardiner hat sein Leben damit zugebracht, die Vergangenheit zu erforschen, und dabei oft die Gegenwart vergessen. Als dein Pate und väterlicher Freund bitte ich dich, nicht denselben Fehler zu begehen. Die dunklen Tage liegen hinter dir, Sarah. Du musst jetzt nach vorn blicken, ungeachtet aller Dämonen, die dich verfolgen. Und das gelingt dir am besten, indem du Kincaid Manor verlässt. Ihre Majestät die Königin persönlich wünscht deine Anwesenheit in London – muss ich dich erst daran erinnern, dass dein Vater stets ein treuer Gefolgsmann der Krone gewesen ist?«
»Nein«, erwiderte Sarah nachdenklich und schüttelte den Kopf. »Das musst du nicht, Onkel.«
»Dann wirst du mich nach London begleiten? Königin Victoria selbst wird dafür sorgen, dass es dir an nichts mangelt und dir jede erdenkliche Unterstützung zuteil wird.«
»Warum?«, fragte Sarah. »Was steckt hinter alldem?«
Der Doktor blickte sich argwöhnisch um, als fürchte er, belauscht zu werden. Erst als er sich vergewissert hatte, dass keiner der Diener im Speisesaal weilte, begann er leise zu flüstern.
»Ich kann und darf dir nicht mehr darüber sagen, Sarah – aber Ihre Majestät braucht deine Hilfe. Das britische Königshaus, so fürchte ich, wird bedroht von einer Affäre, die den Fortbestand des gesamten Empire gefährden könnte.«
»Eine Affäre? Was für eine Affäre? Du sprichst in Rätseln.«
»Aus gutem Grund.«
»Und weshalb werden dabei Kenntnisse auf dem Gebiet antiker Geschichte benötigt?«
»Warte es ab«, erwiderte Laydon geheimnisvoll und brachte Sarahs Blut damit nur noch mehr in Wallung.
Mit manchem hatte sie gerechnet, aber sicher nicht damit, dass das Gespräch mit ihrem Paten eine solche Wendung nehmen würde – und obwohl Sarah sich geschworen hatte, dem Abenteuer den Rücken zu kehren und sich künftig mit theoretischen Studien zu beschäftigen, spürte sie, wie ihre angeborene Neugier sich regte. Natürlich schmeichelte es ihr, dass die Königin nach ihr persönlich verlangte. Noch stärker jedoch war der Forscherdrang, der in ihr erwachte. Er hatte so lange Zeit geschlafen – seit jenem Tag, an dem sie ihren Vater zur letzten Ruhe gebettet hatte …
»Also?«, fragte Laydon herausfordernd. »Wirst du mich nach London begleiten und Ihrer Majestät helfen?«
»Vielleicht«, erwiderte Sarah ausweichend. »Verrate mir nur noch eines.«
»Nun?«
»Warum ausgerechnet ich?«, wollte Sarah wissen. »In London gibt es viele Kapazitäten auf dem Gebiet der alten Geschichte, die sich sicher um die Ehre schlagen würden, der Königin zu Diensten zu sein.«
»Weil du all diesen Kapazitäten etwas voraushast, mein Kind – etwas, das die Königin sehr zu schätzen weiß.«
»Und was sollte das sein?«
»Sehr einfach«, antwortete Laydon mit weisem Lächeln. »Du bist eine Frau …«
In einem fensterlosen Raum im Herzen Londons, dessen Wände mit Holz getäfelt und dessen Tür gepolstert und mit Leder beschlagen war, sodass kein Laut aus dem Inneren nach außen drang, öffneten bebende Hände ein Kuvert.
Nervöse Augen überflogen im Licht der Gaslampe den Wortlaut der telegraphischen Nachricht, die soeben aus Manchester eingetroffen war. Die Stille im Raum war dumpf und schwer. Nur das Ticken der großen Standuhr, das unbarmherzig darauf hinwies, wie die Zeit zerrann, war zu hören – und schließlich ein erleichtertes Aufatmen.
Das Zittern der Hände, die das Telegramm hielten, legte sich, und die Gestalt, die zuvor ruhelos im Raum auf und ab geschritten war, nahm auf einem der zahlreichen Stühle Platz. Die Mission war erfolgreich gewesen. Sarah Kincaid war auf dem Weg nach London.
3
REISETAGEBUCH SARAH KINCAID
NACHTRAG
Es fiel mir nicht leicht, Kincaid Manor zu verlassen, das mir während der letzten Monate nicht nur zum Heim, sondern auch zur Zuflucht geworden war. Dennoch spürte ich, als die Kutsche die Hauptstraße erreichte und die vertrauten Gebäude hinter den Hügeln des Hochmoors verschwanden, tief in meinem Inneren eine Freiheit, die ich lange nicht mehr empfunden hatte.
Die Kutsche der Royal Science Academy brachte uns nach Manchester, wo wir den Zug nach London bestiegen. Die Tatsache, dass Mortimer Laydon bereits ein Abteil hatte reservieren lassen, machte mir klar, dass er zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt hatte, dass ich einwilligen und ihn nach London begleiten würde. In mancher Hinsicht scheint mein väterlicher Freund mich besser zu kennen als ich.
Zwei Tage dauerte die Fahrt, und je weiter wir nach Süden kamen, desto unruhiger wurde ich. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich mir geschworen, nie mehr nach London zurückzukehren, in diese Steinwüste an der Themse, diesen Moloch, der seine eigenen Kinder verschlingt. Ich habe jedoch mit meinem Vorsatz gebrochen, und nun harre ich ungeduldig auf das, was mich in London erwarten mag …
LONDON
5. NOVEMBER 1883
Es war noch früh am Morgen, als ein Hansom Cab Sarah Kincaid und Mortimer Laydon vom Bahnhof King’s Cross nach Westminster fuhr. Ihr Gepäck hatten sie am Bahnhof zurückgelassen und einen Gepäckdienst damit beauftragt, es zu Laydons Haus im noblen Stadtteil Mayfair zu transportieren. Im Verkehrsgewühl, das bereits am frühen Morgen auf den Einfallstraßen herrschte, bot der leichte Hansom wesentlich bessere Aussichten, rasch voranzukommen, als ein Mehrspänner.
Geschickt lenkte der Kutscher das schnittige Gefährt an Karren und Fuhrwerken vorbei, die auf der Gray’s Inn Lane stadteinwärts rollten. Die despektierlichen Häuserzeilen von St. Pancras und Clerkenwell huschten an der offenen Kabine vorbei, und Sarah bedachte Dr. Laydon mit einem vieldeutigen Blick.
»Wie es scheint, hat sich in London nicht sehr viel verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Die Armen sind noch immer arm und die Reichen noch immer reich.«
»Nun – es wäre auch äußerst verwunderlich, wenn sich dies so rasch geändert hätte, nicht wahr, mein Kind?« Der Doktor lächelte wohlwollend. »Wenn du dich so sehr um das Wohl der Bedürftigen sorgst, solltest du dich vielleicht William Booth vorstellen – ich vermute, er wäre ein Mann nach deinem Herzen.«
»Booth? Wer ist das?«
»Er nennt sich selbst ›General‹ und hat eine Armee von Predigern gegründet, die in Whitechapel und anderen Vierteln Betrunkenen und Taugenichtsen die frohe Botschaft verkünden.«
»Ein Mann mit Idealen«, stellte Sarah anerkennend fest.
»Ein Phantast«, korrigierte Laydon kopfschüttelnd. »Das einzige Evangelium, das diese Leute verstehen, wird in den Arbeitshäusern gepredigt. Sie allein sind dazu angetan, das Elend in den Straßen des East Ends zu beseitigen.«
»Arbeitshäuser«, stieß Sarah hervor. »Es gibt sie also noch?«
»Natürlich.« Laydon lächelte erneut. »Es sollte mich wundern, wenn diese der Gesellschaft so nützliche Einrichtungen verschwinden würden.«
»Nützlich sind die Arbeitshäuser allenfalls denen, die sie unterhalten«, widersprach Sarah. »Schon der Name ist blanker Hohn – in Wahrheit handelt es sich um Gefängnisse, in denen Menschen, die nichts anderes verbrochen haben, als arm zu sein, unter den unwürdigsten Bedingungen hausen müssen. Familien werden ohne Rücksicht auseinander gerissen, und es gibt gerade genügend Nahrung, um niemanden sterben zu lassen – satt ist dort noch niemand geworden.«
»Du hast zu viel Dockins gelesen, mein Kind, diesen elenden Weltverbesserer, der den lieben langen Tag nichts anderes zu tun hatte, als an unserer stolzen Nation herumzumäkeln«, konterte der Doktor säuerlich.
»Er hieß Dickens, Onkel«, verbesserte Sarah. »Und ich denke nicht, dass es sich bei ihm um einen elenden Weltverbesserer gehandelt hat. Vielmehr um einen Mann mit weiser Voraussicht.«
»Wie auch immer. Sieh dich nur einmal um! Dies ist London, die Metropole der Welt und strahlender Mittelpunkt eines Reiches, das selbst die römischen Cäsaren vor Neid hätte erblassen lassen.«
»Strahlend, in der Tat«, gab Sarah widerstrebend zu. »Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten …«
Das Hansom Cab hatte inzwischen Charing Cross erreicht, den pulsierenden Mittelpunkt Londons. Mit dem Glockenschlag von St. Martin in the Fields war die Stadt vollends zu morgendlichem Leben erwacht, und aus den noblen Vierteln im Westen drängten die vornehmen Kutschen, die wohlhabende Gentlemen in ihre Clubs entlang der Pall Mall brachten, ins Regierungsviertel oder zum Temple Bar, wo die Anwälte ihre Kanzleien unterhielten. Prunkvolle Stadthäuser, mit den düsteren Backsteinbauten Clerkenwells nicht zu vergleichen, umrahmten den Trafalgar Square; gewichtig aussehende Männer waren auf dem Weg zum Royal Stock Exchange, und allenthalben tauchten fliegende Händler mit ihren Karren auf – Schuhputzer, Staubmänner und Kuchenverkäufer –, die darauf warteten, dass auch für sie etwas vom Reichtum der pulsierenden Stadt abfiel.
London schien ein perfekt organisierter Mechanismus zu sein, eine geölte Maschinerie, innerhalb derer nichts verloren geht. Was die einen wegwarfen, das diente den anderen zum Überleben, und plötzlich wusste Sarah wieder, weshalb sie diese Stadt mit ihrem tief verwurzelten Pragmatismus so hasste. Auch ihr Vater hatte London nicht gemocht und sich nicht von ungefähr in die Einsamkeit Yorkshires zurückgezogen. Für einen Augenblick wünschte sich Sarah, den Bitten ihres Paten nicht nachgegeben zu haben. Die große Stadt erschlug sie mit ihrem Treiben und ihrem Lärm, mit den verschiedensten Gerüchen und mit dem Rauch, der aus unzähligen Kaminen quoll. Warum nur hatte sie ihrer Neugier nachgegeben? Was, in aller Welt, hatte sie hier verloren?
Es war zu spät, um sich noch anders zu besinnen – soeben bog das Cab in die Whitehall ein und passierte das Gebäude der Admiralität. Am Whitehall Place No. 4 verlangsamte die Kutsche ihre Fahrt. Sie fuhr durch ein hohes Tor auf den Hof eines schmalen Backsteingebäudes, dessen hohe Giebel und weiß gestrichene Fenster Autorität ausstrahlten. Noch nie zuvor war Sarah Kincaid hier gewesen, aber natürlich kannte sie die Adresse.
Dies war der Sitz von Scotland Yard.
»Überrascht?«, erkundigte sich Laydon, als die Kutsche endlich zum Stehen kam.
»Ein wenig«, gab Sarah zu, während der Kutscher ihr beim Aussteigen half. »Ich hatte angenommen, dass die Fahrt in die St. James Street führen würde, wo die Königin ihre Gäste zu empfangen pflegt.«
»Ihre Majestät ist mit wichtigen Aufgaben befasst, mein Kind. Sie wird keine Zeit haben, dich zu empfangen.«
»Nein? Aber sagtest du nicht, sie hätte um meine Hilfe ersucht?«
»Allerdings – durch ihren persönlichen Q. C.1 Sir Jeffrey Hull. Er erwartet uns in diesem Gebäude.«
»Wir werden bereits erwartet?«
»Allerdings, mein Kind. Das sollte dir Aufschluss darüber geben, wie dringlich die Mission ist, auf der du dich befindest.«
»Welche Mission denn?« Sarah lachte freudlos. »Du beliebst zu scherzen, Onkel – ich weiß ja noch nicht einmal, weshalb ich eigentlich hier bin.«
»Nur noch einen Augenblick Geduld, du wirst es gleich erfahren.« Erneut setzte der Doktor sein freundliches, aber undeutbares Lächeln auf.
Ein Polizist in dunkelblauem Uniformmantel trat ihnen entgegen, als sie sich dem Eingang näherten, und nachdem Laydon in seinen Gehrock gegriffen und dem Constable ein Schreiben ausgehändigt hatte, deutete dieser eine Verbeugung an und bat sie, ihm ins Gebäude zu folgen.
Durch eine weite Galerie und eine Anzahl endlos scheinender Korridore, in denen der strenge Geruch von frischem Bohnerwachs hing und deren dunkle Eichentüren allesamt verschlossen waren, führte der Polizist Sarah und Laydon in eine der oberen Etagen des Gebäudes. Vor einer Tür, die sich in nichts von den anderen unterschied, machte er Halt und klopfte an. Für einen kurzen Moment verschwand er im Inneren, um dann sofort wieder zurückzukehren.
»Die Herren lassen bitten«, murmelte er wie ein beflissener Hausdiener und zog sich dann zurück, während die Besucher den Raum betraten. Es war ein nüchtern eingerichtetes Büro, dessen einziges Fenster auf jenen Hof blickte, der dem Gebäude seinen Namen gegeben hatte. Auf dem großen Eichenholzschreibtisch davor stapelten sich Aktenmappen, Unterlagen und Photographien. Die Wände des Zimmers waren in stumpfem Grün gehalten; auf der einen Seite des Raumes stand eine Vitrine mit Büchern und allerlei Gegenständen darin. An der Wand gegenüber hing ein großer Stadtplan.
Im rückwärtigen Teil des Zimmers hielten sich zwei Männer auf, die auf die Besucher gewartet zu haben schienen. Der eine mochte in Laydons Alter sein – wie der Doktor trug auch er einen schwarzen Gehrock, der ihm bis zu den Knien reichte, sein Haar war grau und spärlich. Der Blick seiner Augen jedoch war wach und aufmerksam und von einer gewissen Jugendlichkeit, wie Sarah bemerkte. Der andere Mann war ungleich jünger, dabei von untersetzter Statur. Sein Rock war kurz geschnitten, ebenso wie sein schwarzes Haar, das vor Pomade glänzte. Schmale Augen, eine hervorspringende Nase und der streng gestutzte Oberlippenbart verliehen ihm eine soldatische Strenge, die Sarah auf den ersten Blick missfiel.
»Endlich sind Sie hier, Dr. Laydon«, begrüßte der ältere die beiden Besucher mit offenkundiger Erleichterung. »Seit wir das Telegramm erhalten haben, das Sie von Manchester aus geschickt haben, erwarten wir mit Ungeduld Ihre Ankunft. Seien Sie uns herzlich willkommen.«
»Ich danke Ihnen, Sir Jeffrey«, entgegnete Laydon beflissen. »Darf ich vorstellen? Dies ist Lady Kincaid, die Tochter unseres geschätzten Freundes Gardiner. Sarah – dies ist Sir Jeffrey Hull, seines Zeichens Berater der Königin, und er trägt diese Bezeichnung nicht nur als Ehrentitel, wie ich hinzufügen darf.«
»Es ist mir eine Ehre, Lady Kincaid«, sagte der ältliche Mann mit dem jugendlichen Blick und verbeugte sich.
»Auch mir ist es eine Ehre, Sir Jeffrey.« Sarah nickte, wie die Etikette es für eine Dame ihres Standes vorsah. »Sie kannten meinen Vater, wie ich höre?«
»Das will ich meinen – der gute Gardiner, Dr. Laydon und ich haben zusammen in Oxford studiert und dort einige wilde Jahre verbracht, wenn Sie mir diese Indiskretion gestatten.«
»Ich gestatte sie durchaus«, erwiderte Sarah und lächelte. »Mir ist bekannt, dass mein Vater verborgene Seiten hatte.«
»Vielleicht. Aber er war auch ein guter Freund und ein herausragender Wissenschaftler. Sein Tod ist ein unersetzbarer Verlust für das Empire.«
»Nicht nur für das Empire«, sagte Sarah leise.
»Gestatte, dass ich dir auch noch den zweiten Gentlemen vorstelle«, schaltete sich Dr. Laydon ein, ehe das Gespräch einen unvorteilhaften Verlauf nehmen konnte. »Dies ist Inspector Desmond Quayle vom Scotland Yard.«
»Inspector.« Sarah nickte auch dem Polizisten zu, von dem allerdings keine Antwort kam. Mit einer Mischung aus Unglauben und Entrüstung starrte er die Besucherin an. Seine Gesichtszüge hatten sich dunkel verfärbt, seine Oberlippe bebte.
»Doktor«, wandte er sich an Mortimer Laydon, die Tatsache, dass Sarah im Raum war, schlechterdings ignorierend. »Kann ich Sie für einen Augenblick sprechen?«
»Natürlich, Inspector«, erwiderte der Arzt und trat auf den Polizisten zu. »Was kann ich für Sie tun?«
Vermutlich gab sich Quayle alle Mühe, möglichst leise und diskret zu antworten. Aber zum einen sprachen seine Blicke in Sarahs Richtung Bände, zum anderen tat er sich in seiner Erregung schwer, die Stimme zu dämpfen.
»Hören Sie, Doktor, was soll das?«, hörte man ihn zischen. »Als verantwortlichem Leiter der Ermittlungen wird mir ein hochkarätiger Spezialist versprochen, und was bringen Sie mir? Eine Frau! Seit fünfzehn Jahren arbeite ich nun für den Yard, aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Das kann unmöglich die Kapazität sein, die mir zur Unterstützung in Aussicht gestellt wurde – und ich arbeite nicht mit Amateuren zusammen, wie Sie sehr wohl wissen!«
»Lassen Sie sich von meinem Äußeren nicht täuschen, werter Inspector«, sagte Sarah laut, noch ehe ihr Pate diplomatisch antworten konnte. »Ich mag wie eine Frau aussehen, aber in erster Linie gehöre ich der menschlichen Rasse an. Und was meine Qualifikation angeht, so darf ich Ihnen versichern, dass auch ich gemeinhin nicht mit Amateuren arbeite, jedoch bereit bin, in Ihrem Fall eine Ausnahme zu machen. Es wäre also in höchstem Maße erfreulich, wenn Sie denselben Willen zur Kooperation an den Tag legen würden.«
Ihren Worten ließ sie ein entwaffnendes Lächeln folgen, das dafür sorgte, dass der Inspector keinen ganzen Satz mehr über die Lippen brachte. Unzusammenhängende Worte stammelnd, blickte er zuerst Laydon, dann Sir Jeffrey Hilfe suchend an, aber die beiden Gentlemen verweigerten ihm nicht nur die Sekundantschaft, sondern konnten sich noch dazu ein Grinsen nicht verkneifen.
»Nachdem dies geklärt wäre, können wir nun vielleicht zum eigentlichen Grund unseres Treffens kommen«, sagte Sir Jeffrey schließlich. »Ich wäre Ihnen also sehr verbunden, Inspector, wenn Sie Lady Kincaid mit dem Fall vertraut machen würden.«
»Nun – gut«, erwiderte Quayle pikiert und straffte sich, bemüht, einen letzten Rest von Würde zu bewahren. »Was Sie hier sehen können«, erklärte er überflüssigerweise und wandte sich zu dem Stadtplan um, der an der getäfelten Wand angebracht war, »ist eine Karte des Londoner East Ends mit den Stadtteilen Spitalfields, Whitechapel und Bethnal Green.«
»Das Armenhaus der Stadt«, stellte Sarah fest. »Die Anzahl der Obdachlosen, Straffälligen, Waisen, Alkoholverfallenen und Prostituierten ist dort höher als in jedem anderen Viertel, nicht wahr?«
Quayle und auch Sir Jeffrey schauten zuerst Sarah, dann Mortimer Laydon fragend an, der nur die Schultern zuckte.
»Es gibt keine Prostitution in London«, erklärte der Inspector schließlich kategorisch. »Alles andere mag wohl zutreffen – ja. Whitechapel und Spitalfields sind in der Tat die Problemzonen dieser Stadt, was allerdings nicht den Autoritäten anzulasten ist.«
»Kaum.« Sarah schüttelte den Kopf. »Denn jeder tut ja nur seine Pflicht für Königin und Vaterland. Richtig, Inspector?«
»Richtig«, stimmte Quayle zu. Wenn er den Sarkasmus in ihren Worten bemerkt hatte, so zeigte er es nicht, sondern wandte sich erneut der Karte zu, auf der zwei Stellen mit roter Farbe markiert waren. »Bedauerlicherweise sind Trunkenbolde und Bettler nicht die einzigen, die Whitechapel zu einer wenig erbaulichen Gegend machen – seit einigen Wochen treibt dort auch ein sehr gerissener Mörder sein Unwesen.«
»Ein Mörder?« Sarah hob die Brauen.
»Allerdings. Am 14. Oktober schlug er zum ersten Mal zu, hier in der Davenant Street, östlich des Spitalfields Market. Bereits sechs Tage später suchte er sich ein neues Opfer, nur wenige Straßenzüge entfernt in der Hopetown Street. Die Opfer waren in beiden Fällen Frauen, die einer – wie soll ich es nennen? – verbotenen Tätigkeit nachgingen.«
»Natürlich.« Sarah nickte. »Wie gut, dass es in London keine Prostituierten gibt, nicht wahr, Inspector?«
Quayle erwiderte nichts darauf – er schien für sich zu dem Schluss gekommen zu sein, dass es im Augenblick am besten war, peinliche Situationen mit unbewegt stoischer Miene durchzustehen. »Die Art der Morde«, fuhr er stattdessen mit betont sachlicher Stimme fort, »lässt keinen Zweifel daran, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter gehandelt hat. Leider ist es uns jedoch trotz aller Bemühungen bislang nicht gelungen, ihn zu fassen.«
»Ich verstehe«, erwiderte Sarah, »und das alles ist wirklich sehr bedauerlich. Nur verstehe ich nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Wie Dr. Laydon Ihnen sicher gesagt hat, bin ich Archäologin und in der Kriminalistik in keiner Weise bewandert.«
Quayle schnaubte und sandte den beiden älteren Männern einen Blick, der wohl bedeuten sollte, dass er sich in seinen Einwänden bestätigt sah. Sir Jeffrey jedoch ließ sich nicht beeindrucken.
»Zeigen Sie ihr das Bild, Inspector«, verlangte er.
Ein wenig widerwillig zog Quayle eine der Schubladen seines Schreibtischs auf und beförderte eine Mappe zutage, der er eine Photographie entnahm. »Diese Aufnahme«, sagte er, während er Sarah das Bild aushändigte, »wurde am Tatort des ersten Opfers gemacht.«
Sarah nahm die Photographie entgegen. Es war die reichlich verschwommene Aufnahme eines Zeichens, das mit ungelenker Hand an eine Backsteinmauer geschmiert worden war und mit etwas Phantasie einen stilisierten Vogel mit gekrümmtem Hals erkennen ließ. Die verwendete Farbe war dünnflüssig gewesen, sodass sie an vielen Stellen zerlaufen war. Dennoch war deutlich zu erkennen, was der Urheber der Abbildung hatte darstellen wollen.
»Dies ist eine ägyptische Hieroglyphe, das Ibis-Zeichen«, stellte Sarah verwundert fest. »Das Zeichen für die altägyptische Gottheit Thot.«
»Dieses Zeichen«, erwiderte Sir Jeffrey, »wurde vom Täter selbst an die Wand geschmiert. Verstehen Sie jetzt, weshalb wir Ihre Hilfe brauchen, Lady Kincaid?«
»Nun – offensichtlich haben Sie einen Mörder in der Stadt, der in altägyptischer Schriftkunst bewandert ist. Das ist zumindest sehr bemerkenswert – ob es allerdings den Einsatz einer Archäologin rechtfertigt, möchte ich bezweifeln. Außerdem sagte Dr. Laydon, es ginge bei dieser Sache um ungleich mehr, um den Fortbestand des britischen Empire, wenn ich ihn recht verstanden habe …«
Quayle stöhnte erneut, aber auch Hull schien in diesem Fall nicht sehr erbaut darüber zu sein, dass derart delikate Dinge so offen ausgesprochen wurden. Er sandte Laydon einen strafenden Blick, behielt jedoch die Fassung. »Das stimmt«, sagte er dazu. »Doktor Laydon hat nicht übertrieben.«
»Inwiefern?«, wollte Sarah wissen, und ihr entging nicht, dass Quayle sich neben ihr verkrampfte und warnende Blicke verschickte – der königliche Berater jedoch schien entschlossen, das Geheimnis zu offenbaren.
»Dieses Zeichen«, erklärte er, auf die Photographie deutend, die Sarah noch immer in der Hand hielt, »wurde nicht nur am ersten, sondern auch am zweiten Tatort gefunden, was den Verdacht erhärtet, dass es sich um denselben Täter handelt. Und lassen Sie sich von der schwarzen Farbe auf der Photographie nicht täuschen – in Wirklichkeit prangte das Symbol in schmutzigem Rot an der Wand, denn der Täter hatte dazu das Blut seiner Opfer benutzt.«
»Blut«, wiederholte Sarah leise und betrachtete die Aufnahme mit ungleich größerem Unbehagen als zuvor.



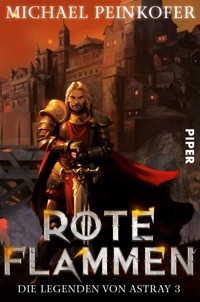
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)