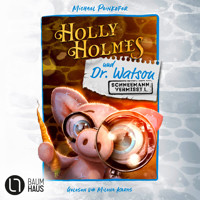6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Karibik im späten 17. Jahrhundert: Obwohl das Weltreich der Spanier im Niedergang begriffen ist, ächzen die Kolonien unter der Knute der spanischen Herren, deren Galeonen die Schätze der Neuen Welt nach Europa tragen. Vor diesem Hintergrund erfährt der junge Nick Flanagan, der im Sklavencamp von Maracaibo ein elendes Dasein fristet, vom Geheimnis seiner Herkunft. Auf der Suche nach seiner Bestimmung ergreift Nick die Flucht und wird zum Bukanier - nicht ahnend, dass eine ungeheure Bedrohung die karibische Sonne verfinstert. Ein unheilvoller Plan, ein tragisches Schicksal und der geheimnisvolle Zauber des Voodoo reißen den jungen Flanagan in ein aufregendes Abenteuer um Rache, Sühne und die Liebe seines Lebens ...
Ein farbenprächtiges Historiengemälde und romantisches Epos von Bestsellerautor Michael Peinkofer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Dramatis Personae
Prolog
Akt I - Maracaibo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Akt II - Tortuga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Akt III - Jamaica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Bekannt wurde er durch den Bestseller DIE BRUDERSCHAFT DER RUNEN (Bd. Nr. 15249). Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
MICHAEL PEINKOFER
DIE ERBEN DER SCHWARZENFLAGGE
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2006 by Michael Peinkofer und
Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG, Köln
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der
Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln
Lektorat: Angela Küpper/Stefan Bauer
Kartenzeichnung: Daniel Ernle
Umschlaggestaltung: Bianca Sebastian
Titelbild: Fukuhara, Inc./Corbis
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0334-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
In Liebe und Dankbarkeit meiner kleinen Tochter Holly gewidmet, dem größten aller Abenteuer
Dramatis Personae
Nick Flanagan
ein junger Sklave, später Bukanier
Angus Flanagan
sein Ziehvater, ein Sklave
Lord Clifford Graydon
sein leiblicher Vater
Lady Jamilla Graydon
seine Mutter
Conde Carlos de Navarro
ein spanischer Graf
Doña Elena de Navarro
seine Tochter
Commodore Bricassart
ein berüchtigter Seeräuber
Damian Bricassart
sein Sohn
Capitán Cuzo Offizier
der spanischen Armada
Cutlass Joe
Kapitän der Bukaniere
Pater O’Rorke
ein Mönch unter Seeräubern
Nobody Jim
ein Negersklave
Unquatl
ein Indianer
Admiral Gordon Lancaster
britischer Kommandant auf Cigateo
Captain Vincent Scarborough
Offizier der britischen Marine
San Guijuela
Sklavenaufseher in Maracaibo
McCabe
}
Bukaniere
Demetrios
Der Chinese
Prolog
Die Karibische See
Im Jahr des Herrn 1673
Die Seeleute nannten sie die Windward-Passage – jenen Abschnitt der Karibischen See, der sich zwischen Kuba und Hispaniola erstreckte und nicht nur wegen seiner Strömungen berüchtigt war. Ungleich traurigere Berühmtheit hatte die Windward-Passage durch die Piraten erlangt, die sich in diesen Gewässern herumtrieben und Jagd auf wehrlose Schiffe machten.
Von ihren Verstecken aus, von denen es entlang der zerklüfteten und von üppigem Dschungel bewachsenen Küsten unzählige gab, brachen die Seeräuber zu ihren Raubzügen auf. Aus dem Nichts heraus griffen sie an, lauerten in Lagunen und Nebelbänken, tauchten beim ersten Licht des Tages auf oder kurz vor Einbruch der Nacht. Ein Schiff, das ihnen in die Hände fiel, war dem Untergang geweiht, die Besatzung hatte keine Gnade zu erwarten. Denn die Männer, die an Bord der Piratenschiffe segelten, waren Ausgestoßene, verdammte Seelen, die nichts zu verlieren hatten und nicht einmal den Teufel fürchteten. Sie achteten weder Moral noch Gesetz, nur das Recht des Stärkeren und den Kodex, den sie selbst aufgestellt hatten – verbrecherische Gesetze für verbrecherische Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Plündern, Rauben und Morden verdienten.
Lord Clifford Graydon wusste all das. Dennoch hatte er befohlen, die Gewässer der Windward-Passage anzusteuern – ein Umweg um Kuba herum hätte drei Wochen Verzögerung bedeutet, die Umseglung von Hispaniola zu tief in spanische Gewässer geführt. Obwohl der Konflikt zwischen England und Spanien offiziell beendet war, waren die Gefilde der Karibik längst nicht sicher, und die britische Krone trug zu einem Gutteil Schuld daran. Während des Krieges war es gängige Praxis gewesen, Kaperbriefe auszustellen und Freibeuter aller Couleur dazu zu ermuntern, Jagd auf spanische Galeonen zu machen. Auf diese Weise waren Halsabschneider und Glücksritter mit dem Versprechen des raschen Goldes sowohl aus der Alten als auch aus der Neuen Welt in die Karibik gelockt worden, und nicht wenige spanische Schiffe, die beladen mit den Schätzen der Kolonien in die Heimat unterwegs gewesen waren, waren als Wracks auf dem Grund des Meeres geendet.
Der Jahrzehnte währende Krieg mochte ein Ende gefunden haben – die Freibeuter jedoch waren noch da. Der Ruf des Goldes hatte sie in Massen herbeigelockt und aus Häfen wie Tortuga und New Providence Pfuhle der Sünde und des Lasters gemacht, in denen sich gottloses Volk versteckte – Mörder, Diebe und anderes Gesindel. Natürlich hatte die britische Krone die Kaperbriefe für erloschen erklärt, aber die Seeräuber scherten sich nicht darum. Getrieben von der Gier nach Blut und Beute und trunken von Hitze und Rum, brachen sie zu immer neuen Raubzügen auf, und längst waren es nicht mehr allein die Galeonen der Spanier, auf die sie es abgesehen hatten. Auch englische Fregatten hatten es den Räubern der Meere angetan. Und was man in den Tavernen von Bristol bis Portsmouth zu hören bekam, war schaurig genug.
Von schrecklichen Bluttaten war die Rede. Von einhändigen Piraten, die gefangenen Seeleuten mit ihrer Hakenhand die Gedärme zerfetzten, von teuflischen Kapitänen, die gefangenen Frauen die Haare anzündeten, ehe sie sie über die Planke schickten, und von einäugigen Maaten, deren liebste Beschäftigung es war, kleine Kinder zu quälen.
Mit Beklemmung musste Graydon gerade jetzt an diese schaurigen Geschichten denken, während sein Blick Lady Jamilla streifte, die an der Reling des Achterdecks stand und nach Westen blickte, wo die im Dunst liegende Küste Kubas das kalte Blau von See und Himmel teilte. In ihrem rüschenbesetzten Seidenkleid, das über den Reifrock fiel, mit ihrer Haube und dem kleinen Schirm, der ihre blasse Haut vor der zudringlichen Sonne der Karibik schützen sollte, bot die zierliche junge Frau einen eigenartigen Gegensatz zur robusten Umgebung des Schiffes, und einmal mehr schalt sich Lord Clifford einen Narren dafür, dass er sich hatte überreden lassen, sie und den kleinen Nicolas in die Kolonien mitzunehmen.
Gewiss, die Planken, auf denen sie standen, waren solide und aus bester englischer Eiche. Die Valiant war eine Fregatte der älteren Bauart, mit 14 Kanonen an Bord und 75 Seelen – Seeleute und Soldaten der königlich britischen Marine, die den Auftrag hatten, Graydon und seine Familie unter Einsatz ihres Lebens zu beschützen. Aber würde das genügen, wenn sich die schwarze Flagge am Horizont zeigte?
Graydon sah, dass Jamilla zitterte. Das Klima konnte es freilich nicht sein, das sie frösteln ließ – schon viel eher das Wissen um die von Piraten verseuchten Gewässer, die sie gegenwärtig durchsegelten. Denn wenngleich Lord Clifford es unterlassen hatte, seiner Gattin und seinem kleinen Sohn von den Schrecken der Karibik zu erzählen, so waren beide hinlänglich darüber unterrichtet worden. Denn der beherzte Pater O’Rorke war ungleich weniger zurückhaltend.
»Seht Euch vor, junger Herr«, sagte er zum kleinen Nicolas, den er auf dem Arm trug, damit dieser über die Achterreling blicken konnte. »Dieser Teil der Welt mag wie das Paradies aussehen, aber in Wahrheit ist er von Gott verlassen. Abel ist nicht mehr; es sind Kains Erben, die hier zu Hause sind – gottlose Menschen, die das Gesetz des Herrn nicht achten und ihresgleichen ohne Rücksicht meucheln. Ich habe Dinge über diese Piraten gehört, junger Herr, die Euch zu Tode ängstigen würden. Von braven Händlern, die den Haien zum Fraß vorgeworfen wurden, von Seeleuten, die nur noch ein Auge besitzen, weil das andere ihnen mit glühenden Zangen herausgerissen wurde.« Mit Daumen und Zeigefinger formte O’Rorke eine Zange und schnappte damit nach Nicolas’ Gesicht, worauf der Junge einen entsetzten Schrei ausstieß.
Nicolas Graydon war erst zwei Jahre alt, aber für sein Alter ungewöhnlich groß und kräftig. Er hatte die milden Gesichtszüge und das dunkle Haar seiner Mutter und die stahlblauen Augen und das markante Kinn des Vaters geerbt. Die Entscheidung, Frau und Kind auf diese Reise mitzunehmen, war Lord Clifford nicht leicht gefallen. Obwohl es ihm das Herz gebrochen hätte, wäre er lieber von ihnen getrennt gewesen, als sie bewusst einer Gefahr auszusetzen. Aber Lady Jamilla, die eine ebenso eigensinnige wie mutige Frau war, hatte darauf bestanden, dass sie und der kleine Nicolas ihn begleiteten. Und nach anfänglichem Widerstand hatte der Lord schließlich eingewilligt – mit einem nagenden Gefühl der Reue im Herzen …
»Muss das sein, Pater?«, wandte er sich an den Mönch, der seine Miene derart verkniffen hatte, dass es jedem Piraten zur Unehre gereicht hätte: Unheilvoll zusammengezogene Augenbrauen und nach unten gewölbte Mundwinkel vermittelten den Eindruck, das Jüngste Gericht stünde unmittelbar bevor.
»Was meint Ihr, Euer Lordschaft?«
»Müsst Ihr dem Jungen solche Schauergeschichten erzählen?«, wurde Lord Clifford deutlicher. Es genügte schon, dass die Seeleute der Valiant hinter vorgehaltener Hand tuschelten und hanebüchener Aberglaube die Runde machte, dass von dunklen Vorzeichen und drohendem Verderben gemunkelt wurde. Die Stimmung an Bord war ohnehin angespannt genug, sodass nicht auch noch ein katholischer Priester ins selbe Horn stoßen musste.
O’Rorkes gerötetes, mit Sommersprossen besetztes Gesicht hellte sich daraufhin ein wenig auf, der unheilvolle Schatten über seinen Augen jedoch blieb. »Verzeiht, Euer Lordschaft«, sagte er. »Es war nicht meine Absicht, den jungen Herrn zu ängstigen.«
»Sind diese Piraten denn wirklich so gefährlich?«, fragte Lady Jamilla. In ihrem Salon zu Hause in England war ihr die Entscheidung, in ferne Gestade zu reisen, leicht gefallen, und auch die Aussicht auf blutrünstige Piraten hatte sie nicht ängstigen können. Nun jedoch, als die Valiant eben jene Gewässer durchkreuzte, die schon unzähligen Schiffen zum Verhängnis geworden waren, stellte sich die Reise ein wenig anders dar.
»Sie sind gefährlich, meine Liebe«, sagte Lord Clifford rasch, »dennoch brauchst du dich nicht zu fürchten. Die Valiant ist ein gutes Schiff, und bei Captain Garrison und seinen Offizieren sind wir in den besten Händen. Nicht wahr, Garrison?«
Kenneth Garrison war ein Veteran zur See – ein erfahrener Kapitän der königlichen Marine, der im Krieg gegen die Spanier gekämpft hatte und schon unzählige Male hinter dem Mast gefahren war. Ein wettergegerbtes Gesicht lugte unter der gepuderten Perücke und dem Dreispitz hervor, und aus den Augen blitzte ein Schalk, der schon manchen Feind das Leben gekostet hatte.
»Ganz recht, Euer Lordschaft«, bestätigte der Kapitän, der mit im Rücken verschränkten Armen beim Steuermann stand und wachsam auf das Vordeck blickte. »Die Valiant ist ein stolzes Schiff, das mir in vielen Schlachten treu gedient und manche Galeone auf den Meeresgrund geschickt hat. Ihr Kiel schneidet wie ein Schwert durch die Dünung, und ihre Vierpfünder werden diese Halunken Mores lehren, sollten sie sich erdreisten, sich zu zeigen. Jeder weiß, dass mit einer Fregatte der königlich britischen Marine nicht zu spaßen ist.«
»Freilich, werter Herr Kapitän«, meinte Pater O’Rorke, »die Frage ist nur, ob die Piraten es ebenfalls wissen.«
»Seid unbesorgt, mein guter Pater«, erwiderte Garrison mit gönnerhaftem Lächeln. »Lasst mich nur meine Arbeit tun.«
»Das werde ich«, antwortete der Mönch nicht weniger lächelnd, »so wie ich die meine tun werde. So wie ich es sehe, kann ein Gebet an einem Ort wie diesem nicht schaden.«
Und er setzte den kleinen Nicolas ab und faltete die Hände, während er den Blick andächtig zum wolkenlosen Himmel richtete.
Auch Lord Clifford senkte unmerklich das Haupt. Einerseits durfte er nicht zeigen, dass auch er sich sorgte, und musste ein Vorbild sein für seine Familie wie auch für seine Untergebenen. Andererseits wusste er, dass O’Rorke nur zu Recht hatte. Wenn es tatsächlich hart auf hart käme, würden weder Kanonen noch blanke Säbel die Valiant retten können, sondern einzig und allein die Gnade des Herrn.
Das Gebet des Paters endete, und Lord Clifford setzte ein leises »Amen« hinzu, als der Ruf des Ausgucks die drückende Stille über der See zerriss: »Schiff an Steuerbord!«
Lady Jamilla sandte Lord Clifford einen furchtsamen Blick, während Kapitän Garrison nach dem Fernrohr griff und an die Reling trat. Tatsächlich waren jetzt vor der dunklen Küste Kubas helle Flecke auszumachen – Segel, die sich rasch näherten.
»Sie haben die Beisegel aufgezogen und segeln hoch am Wind«, stellte Garrison fest.
»Piraten?«, fragte Lord Clifford mit belegter Stimme.
»Das Schiff trägt keine Beflaggung. Aber ich werde nicht warten, bis mir der Jolly Roger1 um die Nase weht. Schiff klar zum Gefecht!«
»Klar zum Gefecht!«, gab Tolen, der Erste Offizier, den Befehl weiter – und schon im nächsten Augenblick verwandelte sich die beschauliche Trägheit, die eben noch auf Deck geherrscht hatte, in hektische Betriebsamkeit: Eilig liefen die Seeleute umher, sicherten das Schiff und bezogen ihre Posten. Die Waffenkammern wurden geöffnet, Pistolen und Säbel ausgegeben. Die Soldaten griffen nach ihren Musketen und bezogen auf dem Oberdeck Stellung, während die Stückmannschaften unter der Führung der Unteroffiziere und Maate an die Geschütze gingen.
»Stückpforten!«, erscholl der Befehl des Wachoffiziers, und entlang der Steuerbordseite der Valiant platzten die viereckigen Öffnungen auf, und die eisernen Rohre der Vierpfünder erschienen.
»Wollen sehen, ob das nicht ein wenig Eindruck macht«, knurrte Garrison und schlug den grauen Uniformrock zurück, um Glocke und Griff des Säbels sichtbar werden zu lassen, die glatt poliert waren vom häufigen Ziehen.
Die Antwort fiel anders aus als erwartet.
Eben noch war der Großmasttopp der fremden Pinasse verwaist gewesen – doch im nächsten Augenblick trug es jenes Zeichen, das braven Seeleuten in aller Welt das Blut in den Adern gefrieren ließ: die schwarze Flagge.
»Hölle«, knurrte Garrison, der wieder durch das Fernrohr blickte. »Es ist der Franzose.«
»Ein Pirat?«, fragte Lord Clifford.
»In der Tat – und zwar der blutrünstigste von allen. Offenbar hat das Beten nicht geholfen.«
Lord Clifford spürte, wie lähmende Furcht ihn befiel – nicht um seiner selbst, sondern um seiner Familie willen. Rasch wandte er sich zu Jamilla um, die den kleinen Nicolas bereits auf den Arm genommen hatte. Pater O’Rorke war bei ihnen, das Gesicht jetzt noch düsterer als zuvor.
»Habt keine Angst«, sagte Lord Clifford, an seine Frau und an den Jungen gewandt, »Pater O’Rorke wird euch unter Deck bringen, dort werdet ihr sicher sein. Es wird alles gut werden.«
»Oh, Clifford«, sagte Jamilla nur und schien mit einem Mal ihre eigene Unbekümmertheit zu bereuen.
»Hab keine Angst«, sagte er noch einmal, und obwohl es weder seinem Stand noch der Lage gemäß war, zog er sie an sich heran und küsste sie hart und innig.
»Ich liebe dich«, sagte er leise, dann küsste er den kleinen Nicolas auf die Stirn. Für weitere Worte des Abschieds blieb keine Zeit.
Sowohl Jamilla als auch der Junge klammerten sich an ihn, wollten ihn nicht loslassen, als könnten sie so das Unglück verhindern, das im Begriff war, über das Schiff und seine Besatzung hereinzubrechen. Aber Lord Clifford gab Pater O’Rorke ein Zeichen, worauf er sich der Lady und des Jungen annahm und sie unter Deck schaffte, in die Kajüte, die sie gemeinsam bewohnten. Ein letztes Mal trafen sich ihre Blicke, dann verdrängte der harsche Ton des drohenden Kampfes jede zarte Empfindung.
Die Trommeln wurden gerührt, während die Musketiere aufenterten und in den Wanten Posten bezogen. Gleichzeitig eilten die Seeleute, jetzt mit Pistolen und Säbeln bewaffnet, auf die Steuerbordseite des Schiffes, wo sie sich hinter das Schanzkleid kauerten. Der Smutje und die Schiffsjungen streuten unterdessen Sand auf die Planken – der Grund dafür war Lord Clifford nur zu klar. Wenn die Valiant geentert wurde und es an Bord zum Kampf kam, würde das Deck im Nu von Spritzwasser und Blut übersät sein. Der Sand sollte verhindern, dass die Männer ausglitten.
Einer der Diener aus Lord Cliffords Gefolge brachte eilig dessen Klinge sowie seinen Waffengurt und die beiden silberbeschlagenen Pistolen. Graydon legte den Gurt um und schob die Pistolen hinein, die der Diener bereits geladen hatte. Dann griff er nach der Klinge – ein Breitschwert schottischer Fertigung, wie viele englische Herren es trugen. In Griff und Knauf eingearbeitet war der sich windende Drache, das Wappentier der Graydons von alters her.
Lord Clifford wog die Klinge in seiner Hand und gesellte sich dann zu Kapitän Garrison, der an der Reling Aufstellung bezogen hatte, den blanken Säbel in der Hand. Das Fernrohr brauchte Garrison nicht mehr, um die Pinasse zu sehen – mit atemberaubender Geschwindigkeit hatte das Piratenschiff aufgeholt, es flog so schnell heran, als berühre sein Kiel kaum das Wasser. Die Segel blähten sich, als wollten sie bersten, und am Großmast wehte die schwarze Flagge, die, wie Graydon jetzt erkannte, einen Totenkopf und ein Stundenglas zeigte – ein Zeichen dafür, dass für die Besatzung der Valiant die Zeit auf Erden abgelaufen war, wenn es nach den Piraten ging.
In spitzem Winkel hielt die Pinasse auf die Valiant zu. Bald schon würde sie ihren Kurs kreuzen. Den Piraten mit einem geschickten Manöver zu entkommen, war nicht möglich, dazu war ihr Schiff zu schnell. Und mit einigem Entsetzen erkannte Lord Clifford, dass der Dreimaster schwer bewaffnet war. Stückpforten öffneten sich, und die bedrohlich dunklen Mündungen von einem Dutzend Sechspfündern starrten der Valiant feindselig entgegen.
»Verdammt noch mal«, wetterte Garrison gegen den Trommelschlag und das Geschrei auf Deck, »der Kerl greift mit dem Wind an. Wo immer er sein Handwerk gelernt hat, er scheint es zu beherrschen. Der Luvvorteil verlängert die Reichweite seiner Kanonen …«
Der Kapitän hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als das erste Geschütz an Bord der Dreimastbark donnernd Feuer gab.
Eine grelle Flammenzunge stach aus der Stückpforte oberhalb des Bugs, gefolgt von einer Wolke weißen Pulverdampfs.
»In Deckung, Euer Lordschaft!«, hörte Lord Clifford Garrison brüllen. Er erhaschte einen kurzen Blick auf etwas, das dicht über der glitzernden Fläche der See heranwischte, und warf sich hinter der Achterschanzung zu Boden.
Einen Atemzug später hörte er einen dumpfen Einschlag, gefolgt von Splittern und Krachen und lautem Geschrei. Lord Clifford hob den Blick und spähte zum Vordeck, wo sich ein schrecklicher Anblick bot. Die Kanonenkugel hatte die Back der Valiant durchschlagen und eine blutige Schneise in die Reihen der Männer gerissen, die dort mit blanken Waffen auf den Feind gewartet hatten. Verstümmelte Körper übersäten das Deck, Blut besudelte die Planken.
Und die Piraten gaben weiter Feuer.
Nacheinander wurden die Sechspfünder gezündet, schlugen Flammen und Rauch aus den Mündungen der Kanonen – und todbringende Geschosse, die an Bord der Valiant einschlugen und das Schiff erzittern ließen.
Die Kugeln waren gut gezielt.
Nur eine von ihnen durchbrach das Schanzkleid und fegte über das Oberdeck, wiederum eine blutige Bresche schlagend. Die übrigen drangen ein Deck tiefer in die Wandung der Valiant – dort, wo die Stückmannschaften an den Geschützen kauerten.
Dicht aufeinander schlugen die Geschosse ein, mit infernalischem Getöse und furchtbarer Wucht. Massives Eichenholz splitterte wie Glas, und die Männer brüllten heiser vor Schmerz, als die Kugeln ein entsetzliches Blutbad unter ihnen anrichteten.
»Sechs schwere Treffer unter Deck, Sir«, meldete der Erste Offizier. »Bug- und Achterstücke sind ausgefallen.«
»Dieser Hundesohn«, wetterte Garrison ganz entgegen der Etikette, die ihm als königlich britischem Seeoffizier zukam. »Und wir können uns noch nicht einmal revanchieren, weil er noch außer Reichweite unserer Vierpfünder ist. Stückpforten räumen und neu bemannen! Wir müssen …«
Der Rest der Worte ging im Geschrei seiner Leute unter – denn die Pinasse veränderte abermals den Winkel, in dem sie auf die Valiant zuhielt, und nahm jetzt direkten Kurs, um ihr den Weg abzuschneiden und sie zu entern.
»Feuer!«, befahl Garrison mit Donnerstimme, als das Piratenschiff in Reichweite der wenigen Geschütze kam, die der Valiant zu ihrer Verteidigung verblieben waren.
Ganze drei Kanonen gaben von unter Deck Feuer. Infernalischer Donner hallte in Lord Cliffords Ohren, beißender Pulverdampf stieg zum Achterdeck auf. Eine der Kugeln verfehlte ihr Ziel. Die beiden übrigen schlugen achtern ein und stanzten Löcher in die Galerie – was die Piratenpinasse nicht davon abhielt, im nächsten Augenblick längsseits zu gehen und die Valiant zum Beidrehen zu zwingen.
»Jetzt gilt es!«, rief Kapitän Garrison. »Wir werden unsere Haut teuer verkaufen! Feuern nach Belieben, Mr. Tolen – wer von diesen Halunken es wagt, seinen Fuß an Bord dieses Schiffes zu setzen, der ist des Todes!«
»Aye, Sir«, scholl es zurück.
Dann überstürzten sich die Ereignisse.
Im Nu war die Pinasse heran, getragen vom Wind in ihrem Rücken. Die Piraten verzichteten darauf, eine weitere Breitseite gegen die Valiant abzufeuern – schließlich wollten sie ihre Beute weitgehend unbeschädigt wissen. Stattdessen flogen Entertaue durch die Luft, deren Haken sich im Schanzkleid und in den Wanten der Valiant verfingen. Auf diese Weise zogen die Piraten das Schiff an sich heran und verringerten den Abstand zwischen den Decks, bis sie unter wildem Geschrei von der Pinasse auf die Valiant übersetzten.
Selbst in den übelsten Vierteln Londons konnte es keine abgerisseneren, verwerflicheren Gestalten geben: Männer aller Hautfarben und unterschiedlichster Herkunft, einige verstümmelt, die meisten mit hässlichen Narben in den bärtigen, sonnenverbrannten Gesichtern. Ihre Kleidung war derb und bestand aus wenig mehr als bunt gestreiften Fetzen – weite Seemannshosen, in denen sehnige Beine steckten, dazu löchrige Hemden und Westen über braun gebrannter, mit lästerlichen Tätowierungen versehener Haut. Bewaffnet waren sie mit Entermessern und Piken, mit Äxten und Pistolen – und ihnen allen gemein war der Blutdurst in den Augen.
Unter wildem Geschrei setzten sie herüber – und wurden von den Musketieren empfangen, die ihnen ein feuriges Willkommen bereiteten. Einige Piraten wurden getroffen und kippten von der Reling, verschwanden in der schmalen Kluft zwischen den Schiffen. Aber der Masse der Seeräuber, die von der Pinasse nachdrängten, hatten die britischen Musketiere nichts entgegenzusetzen, zumal sie in den Wanten den Kugeln des Feindes selbst schutzlos ausgeliefert waren.
Mann um Mann wurde von Blei ereilt und aus den Seilen gepflückt, und schon im nächsten Augenblick hatten die ersten Seeräuber das Oberdeck der Valiant erklommen. Dort trafen sie auf Garrisons Leute, die sie mit blanker Klinge erwarteten. Ein fürchterliches Handgemenge entbrannte. Auch zum Achterdeck schwangen einige Piraten herüber – grobschlächtige Kerle, die bunte Tücher um die Köpfe trugen und krumme, schartige Säbel schwangen. Und einen Herzschlag später waren auch Lord Clifford und die Offiziere in einen blutigen Kampf Mann gegen Mann verstrickt.
Die Pistole in der einen, das Breitschwert in der anderen Hand, stellte sich der Lord den Angreifern entgegen. Eine Pistolenkugel beendete ein schändliches Piratendasein, aber schon war ein weiterer Seeräuber heran und drang mit blutigem Entermesser auf Graydon ein. Der parierte den Hieb und ging dann zum Gegenangriff über. Kunstvolle Finten und ausgefeilte Paraden waren in diesem Kampf nicht gefragt – es war ein grausames Hauen und Stechen, bei dem einzig zählte, wer am Ende noch auf den Beinen stand.
Lord Clifford begriff die Regeln des Kampfes schnell. Mit einem Fußtritt stieß er den Angreifer zurück und brachte ihn ins Taumeln, und noch ehe der Seeräuber begriff, was geschah, hatte die Klinge des Lords ihm eine klaffende Wunde beigebracht.
Der Lord fuhr herum und blickte sich nach seinem nächsten Gegner um – nur um Zeuge zu werden, wie der beherzte Kapitän Garrison von der Pike eines Piraten durchbohrt wurde. Zu Tode verwundet, kämpfte der Offizier weiter, schwang seinen Säbel und schickte den Angreifer in die Verdammnis. Dann sank er nieder, inmitten des Getümmels, das auf dem Achterdeck herrschte.
Tolen, dem Ersten Offizier, erging es nicht besser. Gegen vier Piraten gleichzeitig musste er sich wehren, als ein Säbelhieb tief in seine Schulter drang. In einem Sturzbach von Blut sank Garrisons Stellvertreter auf die Planken – das Schiff war ohne Führung. Bestürzt sah Lord Clifford immer mehr brave britische Seeleute unter den Angriffen der Piraten fallen. Allerorten wurde gemeuchelt und gemordet, die Wölfe der Meere kannten keine Gnade.
Und dann erschien auf der Reling der Pinasse ein weiteres Schreckbild, das sich unauslöschlich in das Gedächtnis des Lords einbrannte.
Die Gestalt war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, mit Pluderhosen und einem weit geschnittenen Hemd aus Seide, dazu einem breitkrempigen schwarzen Hut mit ebenso schwarzer Feder. Das bleiche Gesicht darunter war von einer Narbe entstellt, und eine Klappe aus Leder bedeckte das rechte Auge. Das verbliebene Auge starrte lustvoll auf das blutige Treiben. Am schrecklichsten jedoch war der breite lederne Gürtel des Fremden anzusehen – nicht nur wegen der Furcht erregenden, in Form eines Totenkopfs gearbeiteten Schnalle und der Pistolen, die darin steckten. Sondern vor allem wegen der schaurigen Staffage, mit der sich der Seeräuber schmückte. Denn in langen Strähnen hing Menschenhaar vom Gürtel des Frevlers, das mitsamt der Kopfhaut vom Haupt seiner unglücklichen Besitzer getrennt worden war; außerdem zwei Köpfe, die einst auf den Schultern unschuldiger Opfer gesessen hatten und zu unansehnlichen Talismanen geschrumpft worden waren. Lord Clifford hatte davon gehört, dass es in den Weiten des Indischen Ozeans primitive Völker gab, die derlei grässliche Künste betrieben. Dieser Pirat hatte sie sich wohl zu Eigen gemacht.
Der Lord zweifelte nicht daran, dass er den Kapitän der Pinasse vor sich hatte, den »Franzosen«, wie Garrison ihn genannt hatte. Und ebenso fest stand für ihn, dass es als Mann von Ehre seine Aufgabe war, den Schurken zum Duell auf Leben und Tod zu fordern.
»Ihr da!«, rief er mit lauter Stimme, die im Kampflärm jedoch unterging. Trommelschläge und Pistolenschüsse, Kampfgebrüll und das Klirren von Säbeln, dazu das durchdringende Geschrei der Verwundeten und das Brausen des Feuers, das unter Deck ausgebrochen war, verhinderten, dass der verruchte Kapitän Lord Cliffords Worte vernahm. Stattdessen schwang er sich an einem langen Seil auf das Oberdeck, fuhr mit gezücktem Säbel wie ein tödlicher Blitz unter die Reihen der verbliebenen Seeleute – und schickte sich zu Lord Cliffords Entsetzen an, unter Deck zu gehen.
»Nein!«, brüllte der Lord aus Leibeskräften und wollte vom Achterdeck eilen, um den Schurken daran zu hindern, zu Jamilla und Nicolas zu gelangen. Aber zwei Piraten stellten sich ihm in den Weg, mit erhobenen Waffen und in gebückter Haltung, wie der eines Raubtiers kurz vor dem Sprung.
Schon setzte der eine vor, hieb mit der Axt nach Graydons Arm. Lord Clifford konterte, aber seine Parade war zu schwach, als dass sie die ganze Wucht des Hiebes hätte aufhalten können. Das Blatt der Axt traf seinen Oberarm und brachte ihm eine blutende Wunde bei, aber der Lord war zu sehr um seine Gemahlin und seinen Sohn besorgt, als dass er weiter darauf geachtet hätte. Mit einer Verwünschung auf den Lippen stieß er den Seeräuber zurück, und ein furchtbarer Schwerthieb setzte dem Leben des Piraten ein Ende. Der andere Seeräuber sprang zur Seite, um sich außer Reichweite der Klinge zu bringen, und im nächsten Augenblick prallten Entermesser und Breitschwert Funken schlagend aufeinander.
Mit wütenden Hieben trieb Lord Clifford seinen Gegner über das Achterdeck bis zu den Stufen, die hinunter aufs Oberdeck führten. Der Seeräuber, der nicht merkte, wie nahe er der Treppe gekommen war, trat rücklings ins Leere und verlor den Halt. Mit einem zornigen Schrei stürzte er, schlug auf das Deck und durchbrach die Planken, gegen deren Unterseite zerstörerisches Feuer leckte.
Grelle Flammen loderten empor und verhinderten, dass Lord Clifford die Treppe nehmen konnte. Durch den Feuerschleier sah er, wie der Franzose wieder auf Deck erschien – in seinen Armen die bewusstlose Gestalt Lady Jamillas.
»Bastard!«, brüllte Lord Clifford aus Leibeskräften – und mit einem beherzten Sprung setzte er durch die Flammen.
Lodernde Hitze umfing ihn, die von allen Seiten nach ihm biss und ihm Kleidung und Haar versengte. Er landete auf den blutigen Planken und stürzte, raffte sich inmitten lebloser und verstümmelter Körper auf die Beine. Das Schwert in der Hand, wollte er zu dem Piraten eilen, der dabei war, mit seiner wehrlosen Beute zu entschwinden – aber erneut stellten sich ihm wilde, blutbesudelte Gestalten entgegen, deren Augen vor Mordlust funkelten. Mit einem gellenden Kampfschrei stürzte sich der Lord auf sie, um eine Bresche in ihre Reihen zu schlagen. Die Piraten jedoch konterten seine Attacke, es gab kein Durchdringen.
Eine Pistole krachte, und fast gleichzeitig fühlte Lord Clifford stechenden Schmerz in seiner Brust.
Er wollte weiterkämpfen, wollte Jamilla zu Hilfe kommen, um sie aus der Gewalt des Frevlers zu befreien – aber etwas hielt ihn mit eiserner Hand zurück. Er verlor den Halt, und wie vom Donner gerührt ging er zu Boden. Hart schlug er auf die Planken, zu allen Seiten loderte Feuer. Das Gelächter der Seeräuber dröhnte in seinen Ohren, und das Letzte, was er sah, war Lady Jamilla in den Armen des Piraten.
Lord Cliffords Lippen formten lautlose Worte unendlichen Bedauerns.
Dann kam die Dunkelheit.
AKT IMaracaibo
1.
Spanische Besitzung Neugrenada
19 Jahre später
Den Donner der Kanonen noch im Ohr, schlug Nick Flanagan die Augen auf – nur um festzustellen, dass er sich keineswegs auf hoher See inmitten eines verheerenden Gefechts befand. Und der laute Knall, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte, stammte auch nicht von einem Geschütz. Die Wirklichkeit, in der sich der junge Mann wiederfand, war ungleich grausamer.
Der Gestank von Schweiß und Exkrementen, der zäh über dem Lager hing, stieg ihm in die Nase und brachte ihn vollends zu Bewusstsein. Sich die Augen reibend, wälzte sich Nick von seinem kargen Lager, das nur aus zwei Armen voll Stroh bestand, die auf den nackten, feuchten Erdboden geworfen waren. Überall ringsum regte es sich in dem Unterstand, dessen mit Palmenblättern gedecktes Dach längst nicht mehr dicht war. In der Nacht hatte es geregnet; nun tropfte es von der Decke, und auf dem Boden hatten sich schillernde Schlammpfützen gebildet. Ein neuer Tag war für die Sklaven von Maracaibo angebrochen – ein Tag, der wiederum nichts als Strapazen, Schmerzen und Erniedrigung bringen würde. Und vielleicht auch einen jähen und sinnlosen Tod …
»Na, Sohn? Gut geschlafen?«
Nicks Vater, der alte Angus Flanagan, dessen Lager sich direkt neben seinem befand, war erwacht und schenkte ihm ein schiefes Grinsen. Mit den mehr als fünfzig Lenzen, die er auf dem Buckel hatte, zählte Angus zu den ältesten Gefangenen im Lager – ein sehniger, wenn auch nicht übermäßig großer Mann, dessen eisenharte Verfassung und angeborene Zähigkeit ihn vor dem traurigen Schicksal bewahrt hatten, das jenen Sklaven drohte, die den Strapazen nicht mehr gewachsen waren – dies und die Tatsache, dass der alte Angus Flanagan zu jenem Menschenschlag gehörte, der auch in ausweglosen Situationen nie den Mut verlor.
Und ausweglos war ihre Lage in der Tat.
Vor zwölf Jahren waren der alte Angus und sein Sohn auf einer Schiffspassage von Jamaica nach den Carolinas von einer spanischen Galeone aufgebracht worden. Nach kurzem Gefecht hatte die Besatzung des britischen Schiffes, auf dem die beiden Flanagans gedient hatten, die Waffen gestreckt, und die gesamte Mannschaft war gefangen genommen worden. Auf diese Weise waren Nick und sein Vater nach Maracaibo gelangt, wo sie in dieses Lager gepfercht worden waren. Zusammen mit anderen Seeleuten, die von den Spaniern versklavt worden waren, aber auch mit Mördern, Dieben, Schmugglern und allem anderen, was die Karibische See an Abschaum zu bieten hatte. Sogar ein paar Piraten befanden sich unter den Sklaven – die pragmatischen Spanier sicherten sich lieber die Arbeitskraft eines gefangenen Seeräubers, als ihn öffentlich hinzurichten, wie die Briten es taten.
Die spanischen Herren, die sich selbst als conquistadores bezeichneten, als Eroberer der Neuen Welt, scherte es nicht, welche Hautfarbe man hatte oder woran man glaubte. Ob Engländer oder Holländer, Schwarze oder Indianer – in ihren Lagern sammelte sich alles, was kräftig genug war, um für sie zu schuften. Und wer sich erst innerhalb der zwei Mann hohen Palisadenmauern befand, der hatte keine Chance, jemals wieder von dort zu entkommen. Erst vor zwei Wochen hatte es einer versucht, ein holländischer Seemann, den die Sehnsucht nach seiner fernen Heimat fast umgebracht hatte. Aus Verzweiflung hatte er schließlich einen Fluchtversuch gewagt – sein Leichnam hing noch immer draußen vor dem Haupttor und verfaulte in der Hitze der karibischen Sonne.
»Ich glaube kaum, dass unser Nick gut geschlafen hat«, sagte jetzt Nobody Jim, ein junger Afrikaner, der in Nicks Alter war und sein bester Freund im Lager. »Man braucht ihn nur anzusehen, um zu wissen, dass er wieder geträumt hat. Oder irre ich mich?«
»Blödsinn«, knurrte Nick, während er sich aufrappelte und versuchte, die nach Schweiß und Schlamm stinkenden Lumpen, die er am Leib trug, ein wenig zu ordnen.
Dabei hatte Jim den Nagel auf den Kopf getroffen.
Nick hatte den Traum tatsächlich wieder gehabt – jenen Traum, der ihn verfolgte, solange er zurückdenken konnte. Schon als Junge hatte er ihn heimgesucht, in heißen karibischen Nächten, in denen die Zeit stillzustehen schien und sich kein Windhauch regte. Mit der Hitze kamen die Träume, und es waren immer dieselben Bilder, die Nick im Schlaf vor Augen hatte: Bilder von einem Kampf auf hoher See, von einem Schiff, das in Flammen stand. Nick konnte dabei keine Einzelheiten erkennen, sah nur verschwommene Gestalten und schemenhafte Eindrücke. Aber er konnte die Schreie der Verwundeten hören und den Donner der Kanonen. Und er konnte den bitteren Atem des Feuers riechen, das alles um ihn herum verzehrte …
Jim entblößte die blendend weißen Zähne in seinem dunklen Gesicht zu einem breiten Grinsen. »Mir kannst du nichts erzählen, Bruder«, feixte er. »Dafür kenne ich dich zu gut und zu lange. Willst du mir wirklich weismachen, du hättest vergangene Nacht nicht von Schiffen und von Feuer geträumt?«
»Blödsinn«, sagte Nick noch einmal und bereute es fast, Jim einst von seinem Traum erzählt zu haben. Es war nichts, worüber er gerne sprach, und auch jetzt in wachem Zustand brauchte er nur an die Traumbilder zu denken, um trotz der dampfigen Hitze, die im morgendlichen Lager herrschte, zu schaudern. Diese Bilder berührten etwas tief in ihm. Etwas, das ihn vor Furcht erbeben ließ und an dem er lieber nicht rühren wollte.
Natürlich hatte er versucht herauszufinden, was es mit jenem Traum auf sich hatte. Er hatte den alten Angus danach gefragt, aber der hatte auch keine Antwort gewusst. Der hünenhafte Indianer Unquatl, der ebenfalls unter den Sklaven weilte und zu Nicks Freunden zählte, hatte angemerkt, dass Träume die Stimme der Seele seien. Wenn das stimmte, dachte Nick, dann wollte seine Seele ihm wohl etwas sagen – das Problem war nur, dass er ihre Sprache nicht verstand.
Zusammen mit den anderen Sklaven verließ er den Unterstand. Draußen standen mehrere Fässer, die sich in der Nacht mit Regenwasser gefüllt hatten und nun der Morgentoilette dienen sollten. Die meisten Gefangenen machten einen großen Bogen darum, Nick tauchte seine Hände hinein und schaufelte sich einige Ladungen des lauwarmen Wassers ins Gesicht. Wie die meisten Gefangenen trug er sein Haar kurz geschoren als Schutz vor den Läusen, die einen sonst bei lebendigem Leib auffraßen. Nick hatte Männer den Verstand verlieren sehen wegen der kleinen Biester, von denen es im Sklavenlager nur so wimmelte, ebenso wie von Kakerlaken, Blutegeln, Ratten und anderem Viehzeug, mit dem niemand gern sein Lager teilte – doch den Spaniern war das reichlich gleichgültig.
Auf dem großen Exerzierplatz, der sich zwischen den Unterständen erstreckte, formten die Sklaven eine Warteschlange. Nicht, dass die karge Mahlzeit, die zweimal am Tag ausgegeben wurde, das Warten wirklich gelohnt hätte, aber etwas anderes gab es nicht, und wer bei Kräften bleiben wollte, der durfte nicht wählerisch sein. Fleisch stand so gut wie nie auf dem Speiseplan der Sklaven, dafür dünner Haferbrei und Schiffszwieback aus ausgemusterten Beständen. Ab und zu auch Fisch, der jedoch häufig Tage alt war und dessen Verzehr einen das Leben kosten konnte. Satt wurden die Gefangenen weniger von den kargen Rationen selbst als von den fetten weißen Maden, die sich im schimmeligen Brot tummelten und nahrhafter waren als alles andere.
»Seht euch das an«, rief Nobody Jim triumphierend und hielt den Zwieback hoch. »Habt ihr schon mal ein so fettes Ding gesehen? Das gibt einen Festschmaus, sage ich euch …«
Tische und Bänke gab es nicht. Wer seine Schale gefüllt bekommen hatte, der setzte sich damit auf den Boden und beeilte sich, den Inhalt zu verzehren, ehe zum Appell gerufen wurde. Sich dann noch mit der Schale in der Hand erwischen zu lassen, war eine ausgesucht schlechte Idee.
Noch war die Sonne nicht aufgegangen, und die orangefarbene Dämmerung, die im Osten über dem Dschungel aufzog, gab die einzige Beleuchtung ab. Der Musketenschuss, mit dem die Sklaven geweckt wurden, erklang stets eine Stunde vor Sonnenaufgang, damit das Licht des neuen Tages die Gefangenen bereits bei der Arbeit sah. Die leeren Säcke über der Schulter, versammelten sich die Sklaven auf dem Exerzierplatz und blickten den Strapazen, die sie erwarteten, gefasst entgegen. Man vermied es, dem anderen ins Gesicht zu sehen. Keiner der Sklaven wusste, ob er an diesem Abend ins Lager zurückkehren würde, und so pflegten die Männer allerhand Aberglauben.
Nick glaubte nicht an solche Dinge. Was ihn aufrecht hielt, war die geheime Hoffnung, die er tief in seinem Herzen hegte. Die Hoffnung, eines Tages kein Gefangener mehr zu sein und wieder unter freiem Himmel zu segeln, zusammen mit dem alten Angus und seinen Freunden fremde Gestade anzusteuern und das Elend des Sklavendaseins hinter sich zu lassen. Dem Stern zu folgen, von dem sein alter Vater sprach, solange Nick zurückdenken konnte, und der sein persönliches Schicksal war.
Dass diese Hoffnung ebenso fern wie trügerisch war, machte der scharfe Knall der Peitschen deutlich, die von den Aufsehern geschwungen wurden – grobschlächtigen, brutalen Kerlen, die früher in der Armada gedient hatten und weder Mitleid noch Gnade kannten. Unter wüsten Beschimpfungen setzten sie den Zug der Sklaven in Gang. In einer endlos scheinenden Kolonne marschierten die Gefangenen zum Haupttor hinaus, begleitet von gleichförmigem Trommelschlag und von den Fußketten, die im Takt dazu klirrten.
Über die schmale Straße aus gestampftem Lehm ging es die Anhöhe hinauf, dem Pfad entgegen, dem die Spanier den Namen el sendero de la plata gegeben hatten – der Pfad des Silbers. Die Sklaven jedoch nannten ihn ungleich treffender el sendero de la muerte – den Pfad des Todes.
Einen Fuß vor den anderen zu setzen, wieder und wieder, darin bestand das Geheimnis des Überlebens.
Einen Fuß vor den anderen – ungeachtet der schweren Last auf dem Rücken und der Riemen, die in die Schultern schnitten. Ungeachtet der schmerzenden Glieder. Ungeachtet der Aufseher und ihres Geschreis, ungeachtet der Peitschenhiebe, die demjenigen drohten, der seine Last verlor oder langsamer wurde. Ungeachtet derer, die zurückblieben, weil sie der Strapaze und der Hitze nicht mehr gewachsen waren und ihre ausgemergelten Körper den Dienst versagten. Ungeachtet der Verzweiflung, die einen in jedem Augenblick übermannen wollte.
Einen Fuß vor den anderen.
An jedem einzelnen Tag, unabhängig davon, ob die Sonne vom Himmel stach oder strömender Regen sich entlud und den Pfad über die Berge gefährlich und fast unpassierbar machte. Wer den Kopf gesenkt hielt und seine Arbeit tat, wer ohne zu murren die Befehle ausführte, die die Aufseher erteilten, der hatte die besten Chancen, den nächsten Tag zu erleben. Und den danach …
Nick hatte aufgehört zu zählen, wie oft er schon einen Fuß vor den anderen gesetzt hatte auf dem unwegsamen Pfad, der sich an den Hängen der Berge emporwand, von den schmalen Straßen Maracaibos hinauf in den dichten Dschungel, dessen üppiges Grün die Hafenstadt zu drei Seiten umgab. Unzählige Male war er dem Pfad des Todes schon gefolgt – mit einem leeren Sack auf dem Rücken, wenn es hinaufging, und mit einem Sack voll Silber den Hang hinab.
Täglich trafen neue Lieferungen aus den Minen ein, die die Spanier in den Tiefen des Urwalds unterhielten, und es war die Aufgabe der Sklaven, sie zum Hafen zu transportieren, wo sie auf Schiffe verladen und in den nächstgelegenen Schatzhafen verbracht wurden. Dort wurde das Silber gesammelt und schließlich nach Spanien gebracht – um den Besitz eines fernen Königs zu mehren, der seinen Fuß noch nie in diesen Teil der Welt gesetzt hatte.
Über den steilen Aufstieg erreichte der Sklavenzug die Passhöhe, von der aus man die Bucht und das von zwei mächtigen Wachtürmen gesäumte Hafenbecken Maracaibos überblicken konnte. Zahlreiche Schiffe lagen darin vor Anker, spanische Kriegsgaleonen, aber auch Handelsschiffe aus neutralen Ländern, die nicht am Krieg zwischen Frankreich und der Allianz beteiligt waren.
Oberhalb des Hafens, auf der steilen Klippe, die die Bucht im Süden überragte, thronte eine trutzige, von steilen Mauern umgebene Festung, aus deren Zinnen Kanonenmündungen starrten und über der die Banner Spaniens und Neugrenadas wehten. Dies war die Festung Maracaibo, ein düsteres Bauwerk, das als uneinnehmbar galt und dessen Kerker von den Schreien der Gefolterten widerhallten. Herr der Festung war Graf Carlos de Navarro, der vom spanischen Vizekönig eingesetzte Verwalter Maracaibos.
Navarros Name war weithin gefürchtet. Mit eiserner Hand verwaltete er seine Stadt; dass es einen Vizekönig gab, der Neugrenada von Cartagena aus regierte, scherte ihn nicht. In Maracaibo, der zweitreichsten Stadt der Kolonie, war er der uneingeschränkte Herrscher, der das Heer seiner Sklaven ruchlos ausbeutete und den Nick in all den Jahren hassen gelernt hatte wie niemanden sonst. Hoch oben im Palast betteten Navarro und die Seinen sich auf seidene Kissen, während Nick und seinesgleichen wie Schweine im Schlamm dahinvegetieren mussten; ließen sich Wildbret und Braten auftischen, während die Sklaven Maden aßen.
An jedem Tag, an dem Nick zur Festung blickte, schwor er sich, dass er nicht immer ein Sklave bleiben würde. Fern am Horizont, wo die See den Himmel berührte, war Freiheit, und die Vorstellung, die Sklavenketten eines Tages abzuschütteln, nährte seine Hoffnung – auch wenn er wusste, dass sie trügerisch war.
Unter den Sklaven von Maracaibo gab es ein geflügeltes Wort, demzufolge der einzige Weg aus der Gefangenschaft mit den Füßen voraus angetreten wurde. Die Hitze setzte den Sklaven zu, von der schweren Arbeit und den elenden Verhältnissen im Lager ganz zu schweigen. Und wen Skorbut und Ruhr nicht dahinrafften, dessen einzige Aussicht bestand darin, wieder und wieder den beschwerlichen Weg über die Berge anzutreten, so lange, bis er eines Tages den Halt verlor und in die Tiefe stürzte oder unter den Peitschenhieben der Aufseher zugrunde ging.
In den vergangenen zwölf Jahren hatte Nick unzählige Kameraden sterben sehen. Wenn Ketten sich um die Fußgelenke wanden und man von Peitschenhieben getrieben wurde, spielte es keine Rolle, ob man Silber auf seinem Rücken trug oder wertloses Blei – es war ein sinnloses Leben und ein noch sinnloserer Tod. Dennoch hatte Nick die Hoffnung nie aufgegeben. Eine Stimme tief in seinem Inneren sagte ihm, dass es nicht sein Schicksal war, als Sklave zu enden. Eine Stimme, die möglicherweise denselben Ursprung hatte wie der Traum, der ihn verfolgte …
»Hast du’s noch immer nicht aufgegeben?«, flüsterte Jim, der in der Kolonne vor Nick marschierte, über die Schulter zurück.
»Was meinst du?«
»Du weißt genau, was ich meine. Dein Blick zum Horizont. Du hast den Traum von der Freiheit noch immer nicht aufgegeben, oder?«
»Nein, und das werde ich auch nicht.«
»Was für ein sturer weißer Mann du bist. Hast du nicht begriffen, dass es von hier kein Entkommen gibt? Dass wir hier festsitzen für den Rest unserer Tage?«
Nick wollte etwas erwidern, als er einen scharfen Knall hörte. Fast gleichzeitig spürte er den brennenden Schmerz an seiner nackten Schulter.
»Du da!«, scholl es von oben herab. »Für wen hältst du dich? Halt gefälligst das Maul und spar dir deine Puste für die Arbeit, hast du verstanden?«
Nick widersprach nicht. Demütig senkte er den Kopf, vermied es, den Aufseher anzublicken, und setzte nur einen Fuß vor den anderen.
Wieder und wieder.
Es war das Gesetz des Überlebens. »Wirst du wohl laufen? Nicht so langsam!«
Erneut riss die plärrende Stimme eines Sklaventreibers Nick aus seinen Gedanken. Inzwischen war es später Nachmittag; die Sklaven hatten ihre Silberladung abgeholt und befanden sich auf dem Rückweg. Und wie an jedem Nachmittag waren die Männer müde, und ihre Beine wollten ihnen kaum noch gehorchen.
»Verdammt, hörst du nicht, was ich sage? Sohn einer Hündin, bewege dich gefälligst!«
Eine Peitsche knallte, und erst jetzt bemerkte Nick, dass der derbe Zuruf und der Peitschenhieb nicht ihm gegolten hatten, sondern seinem Vater, der in der Kolonne hinter ihm marschierte. Der alte Angus war langsamer geworden und hatte den Anschluss verloren – in den Augen der Aufseher ein geradezu todeswürdiges Verbrechen.
»Willst du wohl laufen, elender Hund?« Der Sklaventreiber knurrte wie ein Raubtier. Daraufhin biss der alte Angus die Zähne zusammen und beschleunigte seinen Schritt, um wieder zu Nick aufzuschließen, der sich seinerseits ein wenig zurückfallen ließ, um den Abstand zu verringern. Nobody Jim und Unquatl, die vor ihnen marschierten, taten es ihm gleich – auf diese Weise gewann der ebenso einfältige wie grausame Aufseher den Eindruck, dass sein Gezeter Früchte trug.
»Es ist immer dasselbe mit euch faulen Hunden«, maulte er weiter und schwang drohend die Peitsche, schlug aber kein weiteres Mal zu. Unter Navarros Schergen gehörte er noch zu den gemäßigteren. Am meisten fürchteten Nick und seine Freunde den Anführer der Aufseher, einen grauhäutigen Mann mit dunklen Augen, dessen Namen sie nicht einmal kannten. Die Sklaven nannten ihn nur »San Guijuela«, nicht etwa, weil er ein Heiliger gewesen wäre, sondern weil sanguijuela übersetzt »Blutegel« bedeutete. Und diese Bezeichnung war zutreffend …
»Alles in Ordnung, Vater?«, raunte Nick dem alten Angus zu.
»Alles in Ordnung«, scholl es fast unhörbar zurück. »Mach dir keine Sorgen um mich, mein Junge.«
Es entsprach der Art des alten Angus, die Zähne zusammenzubeißen und jeden Schmerz tapfer zu ertragen. Aber es war Nick nicht verborgen geblieben, dass sein Vater in letzter Zeit an Kraft eingebüßt hatte. Zwölf Jahre Sklavendienst für die Spanier hatten Spuren hinterlassen, und unter wild wucherndem Bart hatten sich tiefe Falten der Entbehrung in die Züge des alten Seemanns eingegraben. Seine Gestalt war knochig und ausgezehrt, und es zeigten sich unleugbar jene Anzeichen bei ihm, die Nick schon zuvor bemerkt hatte – bei Sklaven, die eines Tages nicht mehr ins Lager zurückgekehrt waren.
Der Pfad führte jetzt steil bergab. Da der Boden feucht und schlammig war, hieß es sich vorzusehen, wollte man nicht ausgleiten und vom Abgrund verschlungen werden. Nick hatte viele Männer in die Tiefe stürzen sehen, einige von ihnen aus schierer Verzweiflung. Ihre grässlichen Schreie klangen ihm noch im Ohr.
Die Sklaventreiber scherte das nicht. Von hohen Felsen aus, die ihnen sicheren Tritt und Halt boten, beaufsichtigten sie die Kolonne und ließen immer wieder ihre Peitschen knallen. Den Kopf einzuziehen und zu hoffen, dass das Leder der Aufseher sie nicht ereilte, war alles, was die Sklaven tun konnten. Auch Nick fügte sich in sein Schicksal – aber mit jedem Schritt, den er machte, wuchs sein Widerwille gegen das Dasein, das er fristete.
Nobody Jim, der wiederum vor ihm marschierte, rutschte auf einer Wurzel aus, die quer über den schmalen Pfad wucherte.
»Vorsicht, Jimmy«, ermahnte ihn Nick. »Ein Tritt daneben, und ich kriege deine Abendration.«
»Das fehlte noch«, kam es zurück. »Schimmliges Brot und fette Maden sind zwei gute Gründe, am Leben zu bleiben.«
»Ruhe!«, tönte es barsch von oben herab. »Wollt ihr wohl das Maul halten, verdammtes Gesindel? Oder muss ich es euch erst stopfen?«
Die Freunde verstummten augenblicklich, denn wer diese Worte gerufen hatte, war kein anderer als San Guijuela, der gefürchtete Anführer der Aufseher. Sich ihm zu widersetzen, bedeutete den sicheren Tod. Wer sich San Guijuelas Zorn zuzog, der wurde bis aufs Blut gequält – so lange, bis er entweder den Strapazen erlag oder sich selbst in die Tiefe stürzte, um weiteren Schikanen zu entgehen.
In engen Serpentinen wand sich der Pfad immer weiter hinab, bis er endlich die ersten Ausläufer Maracaibos erreichte und die Straße zur Festung kreuzte. Eine von vier Pferden gezogene Kutsche kam die gestampfte Fahrbahn herab, worauf die Aufseher die Sklaven nötigten, stehen zu bleiben und mit der schweren Last auf dem Rücken niederzuknien. Die Silbersäcke absetzen durften sie nicht, damit der Inhalt nicht schmutzig wurde. Wer es dennoch tat, wurde ausgepeitscht.
»Die Köpfe runter, ihr elenden Hunde!«, wetterte der Blutegel. »Es steht euch nicht zu, den Blick zu heben, wenn die Kutsche von Graf Navarro vorbeifährt.«
Den Namen des Mannes zu hören, um dessentwillen sie all dies ertragen mussten, versetzte Nick einen Stich ins Herz. Schwer atmend und den Blick auf den schlammigen und von faulendem Laub übersäten Boden gerichtet, konnte er hören, wie sich der Vierspänner näherte, vernahm den Hufschlag der Pferde und das Rasseln des Geschirrs. Sein Innerstes bebte vor Zorn, und er konnte nicht anders, als die Fäuste zu ballen. Seine Wut schlug jedoch in Entsetzen um, als er merkte, dass der Hufschlag der Pferde sich verlangsamte.
Die Kutsche hielt an.
Nick riskierte einen vorsichtigen Blick und erkannte das goldene Wappen Navarros auf der sonst schwarzen Kutsche. Im nächsten Augenblick wurde die Tür der Kutsche geöffnet, und ein hagerer Mann erschien, der nicht barfüßig ging und Lumpen trug wie die Sklaven, sondern polierte Schuhe mit goldenen Schnallen und Hosen aus feinstem Zwirn, darüber einen weiten, purpurfarbenen Mantel, der mit goldenen Knöpfen verziert war. Die Züge des Mannes waren blass gepudert und wurden von langem schwarzem Haar umrahmt, das in üppigen Locken auf seine Schultern fiel. Seine Nase war schmal, ebenso wie der mitleidlose Mund und die dunklen, kalt starrenden Augen. Ein spitzer Bart nach spanischer Mode zierte das hervorspringende Kinn.
In den vergangenen zwölf Jahren hatte Nick gelernt, diese Züge zu verabscheuen, denn sie gehörten Carlos de Navarro, dem Conde von Maracaibo, der seine Kutsche hatte anhalten lassen, um sich am Bild der vor ihm knienden Sklaven zu weiden. Aber wie staunte Nick, als Navarro nicht der Einzige blieb, der der Kutsche entstieg! Dem Grafen folgte eine junge Frau, die an Schönheit und Anmut alles übertraf, was Nick in seinem ganzen Leben gesehen hatte.
Sie trug ein rotes Kleid mit weißen Borten, das nach spanischer Art geschneidert war, dazu einen ebenso roten Schirm zum Schutz vor der karibischen Sonne. Ihr Teint war leicht gebräunt und nicht gepudert, ihr von blauschwarzem Haar umrahmtes Gesicht so makellos wie das einer Statue. Eine feine, keck geschwungene Nase erhob sich über einem herzförmigen Mund mit vollen, rosigen Lippen. Die hohen, leicht geröteten Wangen verliehen ihrer Erscheinung etwas Würdevolles, das vom ruhigen Blick ihrer braunen Augen noch unterstrichen wurde.
Nick konnte nicht anders, als hingerissen zu sein von dieser Erscheinung, die ihm inmitten von Elend, Schmutz und Gestank wie ein engelsgleiches Wesen vorkam.
»Nun?«, erkundigte sich Navarro, dessen harte Stimme die Männer trotz der schwülen Nachmittagshitze erschaudern ließ. »Wie gehen die Arbeiten voran?«
»So rasch, wie es nur irgend möglich ist, Exzellenz«, versicherte der Blutegel und verbeugte sich tief. Das unbarmherzige Verhalten, das er den Sklaven gegenüber an den Tag legte, war beflissener Unterwürfigkeit gewichen.
»Das will ich hoffen«, tönte es zurück. »Die San Salvador soll noch vor Einbruch der Dunkelheit auslaufen. Bis dahin muss die gesamte Ladung an Bord gebracht worden sein.«
»Keine Sorge, Exzellenz. Es wird alles zu Eurer Zufriedenheit ausgeführt. Wir werden diesen nichtswürdigen Sklaven schon Beine machen, falls sie …«
Erst als der Aufseher mitten im Satz abbrach, wurde Nick klar, dass er gegen die oberste und wichtigste Regel des Überlebens verstoßen hatte: In seiner Faszination über die Schönheit und Anmut der jungen Frau in Navarros Begleitung hatte er völlig vergessen, den Blick zu senken – und damit Widerstand und Ungehorsam gezeigt.
Noch ehe er seinen Fehler berichtigen konnte, waren bereits der Blutegel und zwei seiner Schergen bei ihm, und während der Oberaufseher ihm den Peitschengriff gegen die Kehle presste, zerrten die beiden anderen ihn grob aus der Reihe.
»Was geht hier vor?«, wollte Navarro wütend wissen.
»Nichts weiter, Hoheit«, beeilte sich San Guijuela zu beteuern. »Nur ein Sklave, der sich ungehorsam gezeigt hat und dafür die gerechte Strafe bekommen wird.«
»Was hat er getan?«, erklang die sanfte Stimme von Navarros junger Begleiterin. Nicks Pulsschlag beschleunigte sich, als ihr Blick sich auf ihn richtete.
»Er hat unerlaubt den Blick erhoben und gegen seine Herren gewandt«, erwiderte der Blutegel mit heuchlerischer Entrüstung.
»Welche Strafe wird er dafür erhalten?«
»Das liegt im Ermessen Seiner Exzellenz«, sagte der Aufseher unterwürfig und brachte es irgendwie zustande, sich gleichzeitig zu verbeugen und Nick mit dem Peitschenstiel zu würgen.
»Wohlan«, sprach der Graf hochmütig, »ich werde die Entscheidung darüber meiner Tochter Doña Elena überlassen, die erst vor wenigen Tagen aus der spanischen Heimat nach Maracaibo gekommen ist, um die Kolonie mit ihrem Liebreiz und ihrer Schönheit zu bereichern.«
Die junge Frau lächelte geschmeichelt, während sich alles in Nick gegen Navarros Worte empörte. Jenes wunderbare Wesen, dessen Anblick ihn so verzaubert hatte, sollte Navarros Tochter sein? Ein Spross des Mannes, den er mehr hasste als jeden anderen? Alles in ihm sträubte sich dagegen, dies zu glauben – andererseits war eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden unübersehbar …
»Wie Ihr wünscht, Hoheit«, erwiderte der Blutegel und wandte sich ergeben an die junge Frau. »Was also soll ich mit ihm tun, Doña Elena? Wollt Ihr, dass ich diesen vorlauten Sklaven, der es gewagt hat, den Blick auf Euch zu richten, auspeitschen lasse? Oder soll ich ihn von der höchsten Klippe ins Meer werfen lassen?«
Navarros Tochter ließ sich mit der Antwort Zeit. Gedankenverloren ihren Schirm drehend, musterte sie Nick, dessen nackte Brust sich sowohl vor Erschöpfung als auch vor Zorn heftig hob und senkte. Er fühlte ihren Blick auf sich ruhen und konnte nicht anders, als ein wenig aufzusehen. Aus dem Augenwinkel sah er das Lächeln um ihre Züge, und für einen winzigen Moment – oder war es nur eine Täuschung, ein flüchtiger Trug? – begegneten sich ihre Blicke.
»Nein«, entschied Navarros Tochter schließlich. Ihre Stimme klang dabei sanft und schön wie das Rauschen der abendlichen Brandung. »Ich wünsche nicht, dass der Sklave ausgepeitscht wird.«
»So soll er von der Klippe gestürzt werden?« San Guijuelas Augen leuchteten vor Tatendrang.
»Keineswegs. Ich will nicht, dass er bestraft wird, nur weil er seinen Blick auf mich gerichtet hat.«
Ein Raunen ging durch die Reihen der Sklaven, und Nick konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Von diesem engelsgleichen Wesen hatte er nichts anderes erwartet, selbst wenn es Navarros Blut in den Adern hatte.
»Wie kannst du so etwas sagen, Tochter?«, fragte der Conde entrüstet. »Begreifst du nicht, wer du bist? Du bist die Tochter eines Grafen, des Herren von Maracaibo. Kein Sklave darf ungefragt seinen Blick auf dich richten. Tut er es dennoch, so ist er des Todes, wenn du es wünschst.«
»Das weiß ich, Vater«, entgegnete sie kühl, »aber ich wünsche es nicht. Wäre er ein freier Mann und hätte ein Verbrechen begangen, so würde ich keinen Augenblick zögern, ihn mit der ganzen Härte des Gesetzes zu bestrafen. Aber er ist ein Sklave und somit Euer Besitz. Was für eine Tochter wäre ich, würde ich den Besitz meines Vaters leichtfertig schmälern? Dieser Bursche ist jung und stark und kann noch viele Säcke tragen. Er nützt uns mehr in unseren Diensten als auf dem Grund des Meeres.«
Für einen Augenblick herrschte Schweigen. Die Sklaven warteten gespannt auf die Antwort des Conde, doch diesem schien es die Sprache verschlagen zu haben ob des Scharfsinns seiner Tochter.
Schließlich brach Navarro in schallendes Gelächter aus. »Gut gesprochen, Tochter«, lobte er. »Ich sehe, dass die Ausbildung, die ich dir in Madrid angedeihen ließ, reiche Früchte trägt. Ich bin sicher, dass du mir hier eine große Hilfe sein wirst.«
»Vielen Dank, Vater«, erwiderte die Schöne und deutete eine Verbeugung an. Noch immer waren ihre Züge makellos und anmutig – aber für Nick hatten sie jeden Reiz verloren, so entrüstet war er über die Worte aus ihrem Mund.
Auch wenn sie ihm das Leben retteten und ihm die Peitsche ersparten, zeigten sie ihm, dass Doña Elena unleugbar ihres Vaters Tochter war. Nick schalt sich einen Narren dafür, dass er jemals etwas anderes in Betracht gezogen hatte. Kurz hatte er geglaubt, Mitgefühl und Menschlichkeit in den Blicken der jungen Frau entdeckt zu haben, aber fraglos hatte er sich geirrt. Trotz ihrer blendenden Schönheit bildete Doña Elena keine Ausnahme, sie war genau wie alle anderen Spanier, die ihre Gefangenen mit Füßen traten. Lieber hätte Nick das Leder der Peitsche auf seinem Rücken gespürt, als diese bittere Wahrheit erkennen zu müssen.
Die Aufseher zerrten ihn in die Kolonne zurück, wo sie dafür sorgten, dass er seine Last wieder aufnahm. Der Graf und seine Tochter, für die die Angelegenheit erledigt war, kehrten in ihre Kutsche zurück, woraufhin das schwarze, goldverzierte Gefährt weiterfuhr.
Der Hufschlag der Pferde war noch nicht verklungen, als man die Sklaven bereits wieder auf die Beine prügelte und zum Marschieren antrieb. Nick hatte weiche Knie – nicht der Strafe wegen, der er mit knapper Not entgangen war, sondern Doña Elenas wegen, deren Bild nicht aus seinem Kopf verschwinden wollte.
»Törichter Junge«, zischte der alte Angus ihm zu. »Was hast du dir dabei gedacht, das Frauenzimmer anzustarren?«
»Ich weiß es nicht, Vater«, flüsterte Nick zurück, »aber es wird nicht wieder vorkommen.«
»Allerdings nicht, Sohn, sonst werde ich dir eigenhändig ein paar Knochen brechen. San Guijuela hätte dich am liebsten von der Klippe gestoßen. Nur der Gnade dieser jungen Frau hast du es zu verdanken, dass du noch lebst.«
»Ihrer Gnade«, schnaubte Nick. »Der einzige Grund, weshalb sie mich begnadigt hat, ist der, dass ich lebend mehr wert bin als tot. Du hast selbst gehört, was sie gesagt hat.«
»Das habe ich. Aber sie hat dir auch das Leben gerettet.«
»Und dafür werde ich ihr jetzt ewig dankbar sein müssen«, versetzte Nick bitter. »Diese verdammten Spanier sind alle gleich. Für sie sind wir noch weniger wert als der Dreck unter ihren Füßen.«
»Das sind wir«, bestätigte der alte Angus, »aber deshalb darfst du deine Träume niemals aufgeben, Sohn. Die Spanier können uns auspeitschen lassen und wie Dreck behandeln, sie können uns erniedrigen und uns umbringen, wenn es ihnen beliebt. Aber sie können uns nicht unsere Träume nehmen.«
»Und wenn schon«, flüsterte Nick. »Träume werden Leute wie Navarro und seine Tochter nicht davon abhalten, uns weiterhin wie Tiere zu behandeln und uns ihrer unersättlichen Gier untertan zu machen.«
»Und dennoch kannst du nicht wissen, welche Überraschungen das Leben für dich noch bereithält, mein Junge. Halte an deinen Hoffnungen fest und setze nicht leichtfertig dein Leben aufs Spiel. Glaube an deine Träume – in einer Welt wie dieser sind sie alles, was dir geblieben ist.« »Nun, Vater? Habe ich die Prüfung bestanden?« Ein wissendes Lächeln breitete sich über Doña Elenas Züge, das der Conde de Navarro nur zu gut kannte.
»Wenn du mich auf diese Weise ansiehst, Tochter«, erwiderte er, »so sehe ich deine Mutter vor mir. Auch sie pflegt diese Miene zur Schau zu stellen, wenn sie glaubt, mich zu durchschauen.«
»Aber Mutter ist nicht hier, Vater. Sie ist zu Hause in Spanien und zieht es vor, den Kolonien fernzubleiben. Ich dagegen bin hier, und bitte versuche nicht, meiner Frage auszuweichen.«
»Du hast nicht nur die Schönheit, sondern auch den Starrsinn deiner Mutter geerbt«, stellte Navarro fest und blickte aus dem Fenster der Kutsche, wo das dichte Grün des Regenwalds vorbeiwischte. Die Hitze, die in dem mit dunkelrotem Samt ausgeschlagenen Gefährt herrschte, war unerträglich, und auch die Fächer, mit denen die beiden Insassen die Schwüle zu vertreiben suchten, konnten daran nichts ändern.
»Und?«, beharrte Elena. »Bist du zufrieden mit mir?«
Navarro lächelte. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«
»Dann will ich es dir sagen, Vater. Diese Angelegenheit mit dem Sklaven soeben war nichts anderes als eine Prüfung. Du wolltest wissen, ob ich einer Situation wie dieser gewachsen bin.«
»Nun«, räumte Navarro ein, »ich gestehe, dass dieser Aspekt eine Rolle gespielt hat …«
»Nein«, beharrte Elena, »er war der einzige Grund, weshalb du mir die Entscheidung über die Bestrafung überlassen hast. Du wolltest sehen, wie ich darauf reagiere. Ich hoffe, meine Reaktion ist zu deiner Zufriedenheit ausgefallen.«
»Allerdings – wenngleich anders, als ich erwartet hatte.«
»Den Sklaven zu bestrafen, war überflüssig«, erklärte die junge Frau mit entwaffnendem Lächeln. »Wir hätten uns dadurch nur selbst geschadet. Also habe ich ihn begnadigt und mich auf diese Weise seiner Loyalität versichert.«
»Du hast dich der Loyalität eines Sklaven versichert?« Navarro blickte missmutig drein. »Du bist meine Tochter und damit die uneingeschränkte Herrscherin über diese Stadt, Elena. Du brauchst dir niemandes Loyalität zu verdienen, am allerwenigsten die eines nichtswürdigen Sklaven.«
»Du hast natürlich Recht, Vater. Aber unter den Sklaven wird sich verbreiten, was heute geschehen ist, und sie werden uns um vieles bereitwilliger dienen.«
»Sklaven, die bereitwillig dienen? Wer hat dir denn diesen Unsinn in den Kopf gesetzt?«
»Jene Lehrer, denen du viel Geld dafür bezahlt hast, dass sie mir eine universelle Bildung zuteil werden lassen. Und im Sinne einer rationalen Einheit, wie Spinoza sie forderte …«
»Rationale Einheit?« Der Conde lachte derb. »Welch ein Unsinn! Wenn es darum geht, diesen verlausten Affen zu zeigen, wer ihr Herr ist, zählt ein einziger Peitschenhieb mehr als alle Vernunft. Diese Sklaven sind wertlos, Elena. Sie sind keine Menschen wie du und ich, sondern einzig dazu da, um zu arbeiten. Sie sind noch weniger wert als Tiere, und genauso solltest du sie behandeln. Andernfalls werden sie es dir übel danken.«
»Das ist deine Ansicht, Vater. Meine Lehrer in Madrid haben mir etwas anderes beigebracht.«
»Teufel auch«, maulte Navarro. »Ich habe meine Tochter an das Konservatorium zur Ausbildung geschickt, auf dass sie das Einmaleins der Politik und der Diplomatie erlerne – und was gibt man mir zurück? Eine moralisierende Philosophin!«
»Keineswegs«, beeilte sich Elena zu versichern, die nur zu genau wusste, wie sie ihren Vater nehmen musste, um ihren Willen durchzusetzen. »Aber wir jungen Leute haben eben unsere


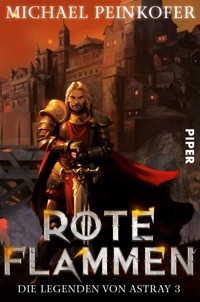
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)