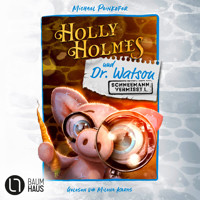6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Töte William Wallace, den Rädelsführer der aufständischen Schotten. Eadrics Auftrag scheint klar. Bevor der junge Angelsachse ihn jedoch ausführen kann, gerät er in die Hände von Wegelagerern. Ausgerechnet ein Trupp Schotten rettet ihm das Leben und nimmt ihn bei sich auf. Bald schon kommen Eadric Zweifel an seiner Mission, so offensichtlich ist die Brutalität, mit der die Engländer in den Highlands vorgehen. Und dann ist da auch noch Ailinor, die Tochter des Clansherren, in die er sich verliebt. Als die Lage sich zuspitzt, steht fest, für wen er kämpfen wird - auch wenn er dafür in die Rolle eben jenes Mannes schlüpfen muss, den zu töten er aufgebrochen ist: William Wallace ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Töte William Wallace, den Rädelsführer der aufständischen Schotten. Eadrics Auftrag scheint klar. Bevor der junge Angelsachse ihn jedoch ausführen kann, gerät er in die Hände von Wegelagerern. Ausgerechnet ein Trupp Schotten rettet ihm das Leben und nimmt ihn bei sich auf. Bald schon kommen Eadric Zweifel an seiner Mission, so offensichtlich ist die Brutalität, mit der die Engländer in den Highlands vorgehen. Und dann ist da auch noch Ailinor, die Tochter des Clansherren, in die er sich verliebt. Als die Lage sich zuspitzt, steht fest, für wen er kämpfen wird – auch wenn er dafür in die Rolle eben jenes Mannes schlüpfen muss, den zu töten er aufgebrochen ist: William Wallace …
ÜBER DEN AUTOR
Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen« und der Abenteuerreihe um Sarah Kincaid, deren abschließender vierter Band mit »Das Licht von Shambala« vorliegt. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.
MICHAELPEINKOFER
Die Runender Freiheit
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren-und Verlagsagentur Peter Molden, Köln
Copyright © 2017 by Michael Peinkofer
Originalausgabe 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer
Kartenzeichnungen: Helmut W. Pesch, Köln
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Einband-/Umschlagmotiv: Johannes Wiebel | punchdesign,unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/Grycaj;shutterstock/David Redondo; shutterstock/Guten Tag Vector;shutterstock/Bajrich
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3955-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
PERSONENVERZEICHNIS
Avelina MacLean
Tochter Malise MacLeans
Aymer de Valence
Earl of Pembroke
Brian de Jay
Großmeister des Templerordens
Catwyg
walisischer Bogenschütze
Cecily
ein Mädchen
Coll
Gefolgsmann des Hauses MacLean
David de Graham
Ritter, Gefolgsmann John »Red« Comyns
Duncan MacDuff
Earl of Five
Dugall MacDuff
schottischer Bogenschütze
Eadric of Kingorn
ein Bastardsohn
Eamma
seine Mutter
Edward »the Longshanks« de Plantagenet
König von England
Edward of Caernarvon
sein Sohn
Geoffrey FitzKane
ein Ritter in königlichem Dienst
Gerard FitzKane
sein Sohn
Gilbert de Umfraville
Earl of Angus
Giles de Clare
ein englischer Ritter
Greeny
junger englischer Bogenschütze
Grizel
eine alte Magd
Iain MacLean
jüngster Sohn Malise MacLeans
Ingram de Umfraville
Bruder des Earl of Angus
Henry de Lacy
Earl of Lincoln
Humphrey de Bohun
Earl of Hereford
James de Douglas
ein junger Schotte
James the Steward
Truchsess von Schottland
John Stewart of Jedburgh
sein Bruder
John Blair
ein Benediktinermönch
John de Menteith
Earl of Menteith
John de Soules
schottischer Ritter
John »Black« Comyn
Earl of Badenoch
John »Red« Comyn
sein Sohn
John de Segrave
englischer Oberbefehlshaber in Schottland
John de Warenne
Earl of Surrey
Malcolm
Earl of Lennox
Malcolm Wallace
Bruder von William Wallace
Malise MacLean
Clansherr und Landlord
Malcolm MacLean
sein ältester Sohn und Erbe
Marmaduke de Thweng
englischer Ritter
Mildred de Warenne
Braut, später Gemahlin Gerard FitzKanes
Patrick of Dunbar
Earl of March
Ralph de Haliburton
schottischer Ritter
Piers Gaveston
Günstling Prinz Edwards
Ralph Ray
schottischer Bauer
Robert of Hastings
Constable von Roxburgh
Robert de Bruce
Earl of Carrick
Robert Wiseheart
Bischof von Glasgow
Roger de Bigod
Earl of Norfolk
Simon Fraser
Ritter, schottischer Bannerführer
Warin Mason
ein Ritter von niederem Stand
William de Beauchamps
Earl of Warwick
William de Lamberton
Bischof von St. Andrews
William Olyphant
Kommandant von Stirling Castle
William Wallace
Anführer des schottischen Aufstands
O weh! Denn der morgige Tag wird ein Tzag des Unglücks sein!Noch vor dem zwölften Glockenschlag wird sich ein mächtiger Windin Schottland erheben, so wie er lange nicht zu vernehmen war.Sein gewaltiger Klang wird die Völker verstummen lassen unddie Welt verändern; er wird erniedrigen, was erhaben ist undhinfortreißen, was lose ist.
Thomas of Erceldoune, genannt »der wahre Thomas«
Am Vorabend des 19. März 1286
PROLOG
Die Nacht war hereingebrochen.
Früher als sonst, so, als hätte sie sich im Schutz der Wolken herangeschlichen, die den Tag über von Osten aufgezogen waren. Nun war ihr dunkler Mantel gefallen, und als wollte der Himmel verkünden, dass dies eine Nacht des Unheils sei, entlud er sich in Strömen von Regen. Dichte Schleier verhüllten die Küste, an deren Klippen sich tosende Wellen brachen, Wind peitschte landwärts und trug salzige Gischt auf den Schwingen – die Reiter jedoch scherten sich nicht darum.
Sie waren zu sechst.
Dunkle Schemen, die sich dicht über ihre Pferde duckten, um der Gewalt des Unwetters zu entgehen. Ihre vom Regen durchnässten Umhänge flatterten im heulenden Wind, der an ihnen riss und zerrte, während sie am steilen Abgrund entlangjagten. Im einen Moment war in der Tiefe noch die schäumende Flut zu erahnen, dann verschwand auch sie in der Schwärze der Nacht, und auch der Pfad, auf dem die Männer ritten, verlor sich mehr und mehr im mondlosen Dunkel.
»Herr!«, rief einer der Reiter, der ein flackerndes Sturmlicht trug. Seine Stimme überschlug sich im Kampf gegen das Tosen von Wellen und Wind »Mein König, ich bitte Euch …«
Der Mann, der vorn an der Spitze ritt, schien nicht gewillt, sein Pferd zu zügeln. Missmutig tat er es dennoch. Sein Tier, ein edler Destrier, bäumte sich wiehernd auf und wandte sich auf der Hinterhand um.
»Was?«, fragte der Reiter nur. Der Wind hatte ihm die Kapuze vom Kopf geweht. Im Schein der Laterne konnte man das angegraute, vom Regen durchnässte Haar sowie die vom Wein geröteten Züge und ein loderndes Augenpaar sehen.
»Mein König«, rief der Knappe, wobei er all seinen Mut zusammennehmen musste. »Ich bitte Euch, haltet ein! Der Sturm nimmt immer mehr zu, und der Wind macht unsere Pferde müde und langsam.«
»Was schlägst du vor?«, fragte der König dagegen. Sein Pferd, das die Unruhe seines Reiters fühlte, tänzelte schnaubend auf den Hufen. »Willst du etwa umkehren?«
Der Junge mit der Laterne sah Hilfe suchend nach den beiden anderen Knappen. »Wi-wir sollten nicht weiterreiten, mein König«, sprang ihm einer von ihnen zögernd bei. »Es wäre klug, in einer Bauernkate Zuflucht zu …«
»Klug?«, unterbrach ihn der König voller Spott. »Und fraglos auch feige«, fügte er bitter hinzu. »Sind das meine Knappen? Die geschworen haben, mir bedingungslos zu folgen?«
»Mein König«, versicherte der erste Knappe, »wenn Ihr es befehlt, so folge ich Euch jederzeit in die Schlacht. Doch in diesem Fall …« Er unterbrach sich selbst und sah beschämt zu Boden – so sah er den Hieb nicht kommen, der ihn mit voller Wucht traf und aus dem Sattel warf.
»Kerl, wie kannst du es wagen? Willst du behaupten, Ihre Majestät die Königin wäre es nicht wert, jederzeit das Leben für sie zu wagen?«
»Nein, mein König«, versicherte der andere, während er sich mühsam vom Boden aufraffte, aus einer Stirnwunde blutend. »Das würde ich niemals wagen. Ich bitte Euch nur, lasst Vernunft walten in Gottes Namen …«
»Ich bin vernünftig gewesen! Vom ersten Licht des Tages an habe ich den Reden meiner Berater gelauscht, ihren Zänken und Ränken, habe mit ihnen bei Speis und Trank gesessen – doch nun verlangt es mich nach anderen Freuden!« Er wandte sich nach den beiden Soldaten um, die er kurzerhand als Führer verpflichtet hatte, weil sie aus der Gegend stammten. »Wie weit noch bis Kingorn?«, wollte er wissen.
»Nicht mehr weit, mein König«, kam es zurück. »Nur noch ein kurzes Stück – die Burg liegt jenseits dieser Bucht.«
»Da hört ihr es.« Ein wölfisches Grinsen erschien auf den Zügen des Monarchen. »Euren König verlangt nicht nach einem hässlichen Bauernweib in einer stinkenden Kate, sondern nach seiner wunderschönen französischen Gemahlin – aber wahrscheinlich seid ihr noch zu jung, um das zu begreifen.«
Er wartete die Antwort seiner Knappen nicht erst ab, sondern drehte sein Pferd abermals herum und trieb es zur Eile an, so sehr, dass auch die beiden Führer nicht mehr mithalten konnten. Ihre Tiere, zäh und ausdauernd, aber keine Destriers, blieben zurück, während der Herrscher selbst in die Dunkelheit enteilte und kurz darauf in ihr verschwand. Und so sehr seine Begleiter auch zu ihm aufzuschließen suchten, es gelang ihnen nicht. Durch sturmgepeitschte Nacht, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, folgten sie dem Pfad nach Kingorn in der Hoffnung, ihren Monarchen doch noch einzuholen – als plötzlich ein Schrei die Nacht durchdrang, so laut und gellend, dass er selbst den Wind übertönte.
Von einer bösen Ahnung ergriffen, zügelten Knappen und Soldaten die Pferde und stiegen ab. Vom steilen Rand der Klippen aus suchten sie die Schwärze mit Blicken zu durchdringen – doch es gelang ihnen nicht, und als ein neuer Windstoß erfolgte, löschte er auch noch das Licht der Laterne und ließ des Königs Mannen in Dunkelheit zurück. Der Knappe ritt dennoch zurück ins Lager, um Hilfe zu holen, doch erst bei Anbruch des neuen Tages war es möglich, über die steilen Klippen hinabzusteigen und nach dem König zu suchen.
Ich war dabei.
Noch heute höre ich den Wind, der über die Klippen streicht, rieche das Salz des Meeres und fühle die Verzweiflung, die uns packte, als wir unseren Herrscher fanden – im Sand am Fuß der Klippe. Neben seinem edlen Ross lag er, wie dieses leblos und mit gebrochenem Genick.
So starb Alexander, der dritte dieses Namens und König von Schottland seit seinem achten Lebensjahr. Sechsunddreißig Winter hatte er über das Land geherrscht, hatte ihm Frieden und Einheit beschert, bis ihm in jener sturmdurchtosten Nacht im Jahr des Herrn 1286 das Verlangen nach seiner jungen Gemahlin zum Verhängnis wurde. Ahnungen von Unheil und düstere Voraussagen, die in den Tagen zuvor gegeben worden waren und die der König allesamt hohnlachend in den Wind geschlagen hatte, hatten sich als wahr erwiesen, und mit dem Tod des Herrschers brach eine Zeit der Dunkelheit über Schottland herein, deren Zeuge wir alle wurden – warum ausgerechnet mir, John Blair, Bruder im Orden des Heiligen Benedikt, die unverdiente Ehre zuteilwurde, die Ereignisse jener Jahre niederzuschreiben und sie so der Nachwelt zu erhalten, weiß nur der Herr allein. Doch in diesem Augenblick, da ich mit vom Alter bebender Hand die Feder führe, sind sie mir wieder höchst gegenwärtig. Ich sehe die grünen Hügel und Täler Schottlands vor meinem geistigen Auge Gestalt annehmen, die Wälder und Burgen und verlassenen Ruinen, die in jenen Jahren zum Schauplatz dramatischer Geschehnisse wurden; und in tiefer Demut gedenke ich derer, denen zu begegnen mir vergönnt war – sowohl jener, die im Licht der Geschichte stehen, als auch jener, deren Namen unbekannt blieben, ihren Taten zum Trotz.
Vieles ist in den Jahren nach dem Tod des Königs geschehen, und der Leser mag mir verzeihen, wenn ich das eine oder andere verkürze oder vereinfache – doch möge der Herr mir die Fähigkeit verleihen, auch nach all den Jahren das Wahre vom Unwahren zu unterscheiden und nur das zu berichten, was damals tatsächlich geschehen ist …
Erstes Buch:
DER SCHATTEN VON STIRLING
1
Kingorn CastleNacht zum 20. März 1286
»Eadric?«
Die Stimme war leise, nur ein Flüstern. Dennoch durchdrang sie den Nebel seiner Träume.
»Eadric! Du musst aufwachen!«
Er schlug die Augen auf.
Finsternis umgab ihn, er brauchte einen Moment, um sich zurechtzufinden. Als ihm schließlich wieder einfiel, wo er sich befand und was geschehen war, hätte er sich am liebsten wieder in das Reich seiner Träume geflüchtet. Doch trotz seiner noch geringen Lebensjahre wusste er, dass das nicht möglich war. Träume waren eine Sache, die Wirklichkeit etwas anderes. Und sie konnte grässlich sein …
»Eadric, du musst kommen. Es ist so weit.«
Er schoss von dem Strohlager hoch, das auf dem kargen Boden ausgebreitet war und ihm wie den anderen Bediensteten, den Burschen, Knechten und Mägden, die in der Burg ihren Dienst versahen, als Schlafstatt diente. Gleichzeitig machte er sich Vorwürfe, weil er eingeschlafen war. Er hätte nicht schlafen dürfen, was war nur über ihn gekommen?
»Beeil dich, Eadric.«
Er stand auf. Während er sich mit der einen Hand noch die Augen rieb, merkte er, wie jemand seine andere Hand fasste und ihn davonzog. Er hatte längst erkannt, wem die Stimme gehörte, die ihn zu nächtlicher Stunde geweckt hatte – es war Grizel, die alte Magd, die in der Burgküche arbeitete. Auf Bitten seiner Mutter hatte sie sich in den vergangenen Wochen Eadrics angenommen, auch wenn dieser überzeugt davon war, dass er niemanden brauchte, der sich um ihn kümmerte. Niemanden außer seine Mutter …
Im flackernden Schein einer Talgkerze stiegen sie über die Schlafenden hinweg. Es war kalt in der Halle der Burg; das Feuer im Kamin war längst erloschen, und von der Glut ging kaum noch Wärme aus. Eadric fror erbärmlich, aber das lag nicht an der Kälte. Es war die Angst, die ihn frösteln ließ, die Furcht vor dem, was vor ihm lag.
Die alte Grizel drückte die Tür der Halle einen Spaltweit auf, und sie schlüpften hinaus, folgten einer schmalen Treppe zu einer Kammer, die der Kommandant der Burg großzügigerweise zur Verfügung gestellt hatte, obschon hoher Besuch nach Kingorn gekommen war. Doch Eadric hatte kein Auge für die Ritter, die seit einigen Tagen auf der Burg weilten, und es scherte ihn auch nicht, dass es hieß, die Königin von Schottland, eine junge Frau von strahlender Schönheit, sei in Kingorn zu Gast. Seine ganze Aufmerksamkeit und Sorge galt der Frau, die auf dem strohgedeckten Lager in der kleinen Kammer lag und die schrecklich blass war und abgemagert bis auf die Knochen.
»Mutter!«
Eadric riss sich von Grizels Hand los und stürzte zu ihr, fiel am Kopfende des Lagers nieder. Der Blick, mit dem seine Mutter ihn bedachte, war seltsam – noch kraftloser als in den letzten Tagen und mit einem trüben Schleier, als blicke ein Teil von ihr bereits in die Ewigkeit.
»Eadric …« Ihre Stimme war kaum noch zu hören, nicht mehr als ein Flüstern. Doch auf ihren bleichen, vom nahen Tod gezeichneten Zügen zeigte sich dennoch ein Lächeln, gütig und nachsichtig wie immer.
»Mama.« Tränen schossen ihm in die Augen. Oft hatte er in den vergangenen Tagen an diesem Platz gekauert, hatte ihr die Hand gehalten und ihr das Haar gekämmt, ihr die Stirn gekühlt, wenn das Fieber sie in den Klauen hielt. Und doch hatte er die ganze Zeit über gewusst, dass dieser Moment kommen würde.
»Eadric.« Obwohl ihre Blicke fliehend waren und es ihr schwerzufallen schien, sah sie ihn aus ihren dunkel geränderten Augen an. »Mein lieber Junge …«
»Du darfst nicht gehen, Mama«, schluchzte er. »Lass mich nicht allein, bitte nicht!«
»Du bist nicht allein«, widersprach sie. »Du hast … noch deinen Vater …«
Eadric widersprach nicht – allerdings nicht aus Überzeugung, sondern nur, weil er nicht ungehorsam sein wollte. Sein Vater – gewiss, der war hier. Er war Kommandant der Burg und Befehlshaber der hier stationierten königlichen Truppen – doch in den vergangenen acht Jahren, die seit Eadrics Geburt verstrichen waren, hatte er sich kaum einen Deut um ihn geschert.
»Geh … zu ihm«, hauchte seine Mutter.
»Ich mag ihn nicht«, gestand Eadric ein. »Er ist so ein strenger Mann. Ganz anders als …«
Er unterbrach sich, als seiner Mutter ein Stöhnen entfuhr. Ihr gepeinigter Körper bäumte sich unter der Decke auf. Das Fieber hatte sie wieder fest im Griff. Und diese Nacht würde es sie nicht wieder freigeben …
»Mama«, flehte Eadric entsetzt und breitete die Arme über sie, als könne er sie auf diese Weise festhalten.
»E-Eadric …« Ihre Stimme war nur noch ein Hauch, ein flüchtiger Schatten. »Wenn ich … gegangen bin … dann zu deinem Vater … musst ihm vertrauen … wird dir … helfen … versprechen.«
»Ich versprech’s«, stieß er tapfer hervor. Obwohl er sich vorgenommen hatte, nicht zu weinen, damit sie nicht noch trauriger wurde, rannen die Tränen jetzt ungehemmt über seine Wangen. Mit dem Handrücken wischte er sich über die Augen, um überhaupt noch etwas sehen zu können.
»Eadric«, flüsterte sie, wobei noch einmal ein Lächeln über ihre ausgezehrten Züge glitt. »bist immer … mein … mein ganzer Stolz gewesen … liebe dich.«
»Und ich liebe dich, Mama.« Eadric kniff die Lippen zusammen. Die Tränen brannten heiß in seinem Gesicht, er hatte das Gefühl, dass der Schmerz ihn zerriss.
»Wirst weggehen«, hauchte sie mit einem Blick, der ihn nicht mehr zu erfassen, sondern geradewegs durch ihn hindurchzugehen schien, in unendliche Ferne, »wirst Kingorn verlassen … weiter Weg vor dir … eine andere …«
Wieder verstummte sie, als eine Welle von Schmerz ihren geschundenen Körper durchlief.
»… andere Welt«, brachte sie den Satz schließlich zu Ende.
Dann lag sie still.
»Mama?«, fragte Eadric leise.
Es kam keine Antwort mehr.
»Mama?« Er fragte noch einmal, lauter und fast ein wenig fordernd, doch auch diesmal erhielt er keine Antwort. Und obwohl sein Herz es nicht wahrhaben wollte, obschon es ihm unwirklich und falsch vorkam, wusste er, dass es geschehen war. Seine Mutter war tot.
»Möge der Herr sich deiner erbarmen, Eamma«, sagte Grizel, die schweigend hinter ihm gestanden hatte, und bekreuzigte sich. Dann beugte sie sich vor, schloss Eadrics Mutter die Augen und faltete ihre Hände wie zum Gebet.
»Tut mir leid, Junge«, sagte sie dann und küsste ihn flüchtig auf den Kopf. Dann zog sie sich zurück, und Eadric war allein mit der sterblichen Hülle der Frau, die ihm das Leben geschenkt und alles für ihn gewesen war, die einzige Familie, die er je gehabt hatte.
Zärtlich strich er über ihre Stirn, die bereits zu erkalten begann, dann warf er sich über sie, und die Trauer, die er bislang tapfer zurückgehalten hatte, flutete in einem Schwall verzweifelter Tränen aus ihm heraus.
Wie lange er so an ihrem Lager gekauert hatte, wusste er später nicht mehr zu sagen. Als der Morgen im Osten heraufdämmerte und fahles Grau durch das hohe Fenster in die Kammer fiel, versiegten seine Tränen, und indem er noch einmal von ihr Abschied nahm, erhob er sich und wandte sich ab.
In ihm war eine Leere, wie er sie nie gekannt hatte. Alles, was in ihm gewesen war und was ihn ausgemacht hatte, alle Erinnerungen, alle Freude und alles Leid, schien mit einem Mal verschwunden. Wie betäubt ging er nach draußen, und trotz seiner jungen Jahre war ihm klar, dass von nun an nichts mehr wie früher sein würde.
Die letzten Worte seiner Mutter fielen ihm wieder ein.
Er hatte ihr versprechen müssen, dass er zu seinem Vater gehen und ihn um Hilfe bitten würde. An sich sträubte sich alles in Eadric dagegen, denn er wusste zu gut, dass er nur ein Bastardsohn war, hervorgegangen aus einer Nacht, die sein Vater mit einer Magd verbracht hatte, vermutlich noch nicht einmal in nüchternem Zustand. Sein Vater hatte sich noch nie um ihn gekümmert, warum in aller Welt sollte er sich also jetzt für ihn verantwortlich fühlen?
Dennoch schlug Eadric den Weg zu der Treppe ein, die hinauf in die oberen Stockwerke des Burgfrieds führte – er hatte es seiner Mutter versprochen, und deshalb wollte er es tun, aus Respekt und Liebe zu ihr … und vielleicht auch, weil er sich tief in seinem Herzen doch ein klein wenig Hoffnung machte.
Schon auf dem Weg wurde ihm klar, dass etwas nicht stimmte. Aus der Großen Halle drang aufgeregtes Geschrei, offenbar war man auch dort schon auf den Beinen. Und Eadric hörte das Klirren von Rüstungen und das Brüllen von Befehlen in französischer Sprache. Noch mehr Besucher schienen in der Burg eingetroffen zu sein, Ritter des Königs.
Noch vor einigen Wochen wäre Eadric erpicht darauf gewesen, sie in ihren prächtigen Rüstungen zu sehen, mit ihren bunten Wappen und Wimpeln und den prächtigen Schabracken über den Rössern. In diesem Augenblick jedoch galt sein Interesse dem Mann, der sein leiblicher Vater und damit sein letzter noch lebender Verwandter war: Geoffrey FitzKane, dem Ritter, der diese stolze, über den Meeresklippen aufragende Burg an des Königs statt befehligte.
Doch Eadric kam nicht weit.
Eine hagere Gestalt stellte sich ihm entgegen, die Arme vor der Brust verschränkt.
»Halt! Wohin willst du?«
Eadric schnaubte. Der Junge war nur ein, zwei Jahre älter als er selbst, dabei aber sehr viel kräftiger, an die anderthalb Köpfe größer und ein Knappe. Seine Züge zeugten von normannischer Härte, sein Haar war dunkelbraun wie das von Eadric; doch während Eadric die blauen Augen seiner Mutter geerbt hatte, blickten ihm aus dem Gesicht des anderen Jungen die stahlgrauen Augen des Burgherrn entgegen. Dies war Gerard FitzKane, Ritter Geoffreys leiblicher Sohn – und damit Eadrics Halbbruder.
Gerard bedachte Eadric mit demselben Ausdruck wie immer. Es war der Blick, mit dem man einen Egel auf seiner Haut entdeckte oder eine Made in seinem Brot. Die Geringschätzung, die daraus sprach, war kaum in Worte zu kleiden.
»Wo du hinwillst, habe ich gefragt!« Wie alle Angehörigen des Adels sprach Gerard nicht Englisch oder Gälisch, die Sprachen des einfachen schottischen Volkes, sondern Französisch; dass sich Eadric auch in jener Zunge zu verständigen vermochte, war ein weiteres der vielen Dinge, die er seiner Mutter zu verdanken hatte. Sie hatte dafür gesorgt, dass ein französischer Söldner namens Galien ihn in der Sprache seiner Heimat unterrichtet hatte.
»Zu unserem Vater«, erwiderte er leise und mit gesenktem Blick. Gerard sollte nicht sehen, dass er geweint hatte.
»Du meinst, zu meinem Vater«, verbesserte der andere ihn mit jener hohen Stimme, die ihm seiner robusten Postur zum Trotz zu eigen war.
Eadric war nicht in der Stimmung, sich zu streiten – ganz abgesehen davon, dass er ohnehin verloren hätte. Gerard wusste nur zu gut, dass sie beide denselben Vater hatten; wenn er es so bewusst leugnete, dann weil er Eadric damit provozieren wollte.
»Meinetwegen auch das«, murmelte er, wobei er den Blick weiter gesenkt hielt. »Aber ich muss ihn dringend sprechen.«
»So?« Gerard machte keine Anstalten, den Weg freizugeben. Im Gegenteil stellte er sich auf die Zehenspitzen, um sich noch ein wenig größer zu machen. »Was, das von Dringlichkeit wäre, hätte eine Ratte wie du meinem Vater wohl zu sagen?«
Eadric ballte die Fäuste. Er mochte klein sein für sein Alter und weniger kräftig als der andere, dennoch hätte er nicht gezögert, sich mit bloßen Fäusten auf Gerard zu stürzen – wären da nicht die letzten Worte seiner Mutter gewesen …
»Bitte«, sagte er deshalb. »Es ist wichtig.«
»Wichtig? Du meinst, es ist wichtig?« Gerard verzog spöttisch das blasse Gesicht. »Dummkopf, weißt du denn nicht, was geschehen ist?«
Eadric hielt es nicht mehr aus. »Meine Mutter ist tot, das ist geschehen!«, blaffte er und schickte seinem Halbbruder einen zornigen Blick. Wenn er jedoch geglaubt hatte, dass Gerard sich dadurch aus der Fassung bringen lassen oder auch nur ein kleines bisschen beschämt sein würde, so hatte er sich geirrt.
»Deine Mutter ist tot?«, fragte sein Halbbruder nach, wobei er mitleidig das Gesicht verzog. »Du armer kleiner Narr, wer schert sich um deine Mutter? Vergangene Nacht ist unser guter König gestorben! Mein Vater und die anderen Edlen müssen nun beraten, was weiter zu geschehen hat – für deine Mutter interessiert er sich ebenso wenig, wie er sich die letzten Jahre für sie interessiert hat.«
Damit wandte er sich ab und ließ Eadric stehen – dem in diesem Moment jäh bewusst wurde, wie allein und verlassen er tatsächlich war.
2
Wald von KingornAugust 1290, vier Jahre später
Er mochte diesen Augenblick.
Den Moment, in dem die Zeit stillzustehen und sich alles auf diesen einen Punkt zu konzentrieren schien, auf die Spitze des Pfeils, der auf der Sehne des Bogens lag.
Eadric genoss die Stille, die ihn erfüllte, wissend, dass sie in dem Augenblick enden würde, in dem der Pfeil von der Sehne schnellte und der Moment der Wahrheit gekommen war. Triumph oder Misserfolg, Treffer oder Fehlschuss – dazwischen gab es nichts.
Eadric erinnerte sich nicht, wann er zum ersten Mal einen Bogen in der Hand gehalten hatte. Er musste fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein und kaum in der Lage, die Sehne zu bewegen. Einer der Soldaten, die in Kingorn stationiert waren, hatte sich daraufhin erbarmt und ihm einen kürzeren Bogen aus weniger starkem Holz gefertigt – fortan waren Eadric und sein Bogen unzertrennlich gewesen.
Das Zielen bereitete ihm keine Mühe. Im Gegenteil hatte Eadric das Gefühl, wann immer er die Sehne zurückzog, die Flugbahn des Pfeils schon im Voraus zu kennen – das Geschoss auf Reisen zu schicken war nur noch eine Sache der Form. Dass Eadric es zu dieser Meisterschaft gebracht hatte, war wohl einerseits einem gewissen Talent zu verdanken, das der Herr ihm gegeben hatte – andererseits aber auch den ungezählten Stunden, die er mit Üben verbracht hatte, allein im Wald, während andere Jungen in seinem Alter ihre Zeit mit Würfelspielen und Raufereien verbrachten. Mit dem Bogen zu schießen war für Eadric mehr, als einfach nur eine Waffe zu bedienen. Er hatte es stets als eine Möglichkeit gesehen, dem Hier und Jetzt zu entfliehen und in seiner eigenen Zeit zu weilen – auch wenn diese in dem Augenblick endete, da er die Sehne losließ.
Eadric zog sie noch ein wenig weiter zurück, bis zu seinem Ohr. Das leise Knarren, das das Eibenholz dabei von sich gab, blieb nicht ungehört. Der Fasan auf der in Sonnenlicht getauchten Lichtung merkte auf. Wachsam hob er das rot gefiederte Haupt.
Eadric stieß eine lautlose Verwünschung aus. Die ganze Zeit über hatte er reglos ausgeharrt. Er wollte seine Beute nicht durch Unachtsamkeit entwischen lassen.
Doch das Tier war gewarnt.
Während der Fasan ein Kreischen von sich gab, breitete er die Flügel aus, bereit zu fliehen. Seine Füße hatten den Boden kaum verlassen, als Eadrics Pfeil von der Sehne schnellte. Blitzschnell zuckte er durch die Luft – und durchbohrte den Fasan im beginnenden Flug.
Wie ein Stein fiel das stolze Tier zu Boden und regte sich nicht mehr. Eadric nickte zufrieden – ein Meisterschuss. Sogar sein gestrenger Sergeant hätte das wohl zugeben müssen.
Triumphierend erhob sich Eadric aus seinem Versteck am Rand der Lichtung, um die Beute zu holen. Das Tier selbst mochte dem König gehören – die schönste und prächtigste Schwanzfeder jedoch gehörte von jeher dem, der den Fasan erlegt hatte, und das war Eadric. Die Feder würde seine Gugel zieren und für jedermann erkennbar machen, was für ein herausragender Schütze er war – und wenn es stimmte, was die anderen Burschen erzählten, dann begeisterten sich auch die Maiden durchaus für Jungs, die ihren Pfeil treffsicher ins Ziel zu lenken wussten.
Er hatte das tote Tier noch nicht erreicht, als er im umgebenden Unterholz plötzlich ein Geräusch vernahm. Er fuhr herum – gerade noch rechtzeitig, um das massige Tier zu sehen, das aus dem Dickicht brach.
Der Hund war so schwarz wie die Nacht und von so riesenhafter Größe, dass Eadric einen entsetzten Schrei ausstieß. Das Haupt des Mastiffs war breit und klobig, ebenso wie seine Schultern und sein gesamter Körperbau. Er hatte die Zähne gefletscht und stieß ein Knurren aus, das aus tiefsten Höllenschlünden zu kommen schien.
»Allmächtiger!«, stieß Eadric hervor. Den erlegten Fasan hatte er vor Schreck völlig vergessen – anders als der Mastiff, der ihn mit dem Maul packte. Doch statt ihn am Stück zu verschlingen, wie es den Anschein gehabt hatte, nahm er ihn lediglich auf und wollte ihn davontragen – als sich das Dickicht abermals teilte. Ein junger Mann trat hervor, dunkelhaarig, mit blassen Gesichtszügen und einem Bogen in den Händen. Und obschon er kräftiger war als Eadric und ihn gut um Haupteslänge überragte, war eine gewisse Ähnlichkeit zwischen beiden nicht zu leugnen.
»Braver Hund«, lobte Gerard FitzKane und nickte dem Mastiff anerkennend zu, der schwanzwedelnd vor ihm stand. Eadrics Anwesenheit übersah er geflissentlich. »Ich dachte schon, das Biest würde uns entkommen.«
»Euch entkommen?« Eadric glaubte, nicht recht zu hören. »Aber es war mein Pfeil, der …«
»Was willst du behaupten?«, fuhr Gerard ihn an. »Dass du es warst, der den Fasan getroffen hat?«
»Allerdings will ich das«, bestätigte Eadric entrüstet. Seine Worte stockten ein wenig, weil er in letzter Zeit wenig Gelegenheit gehabt hatte, Französisch zu sprechen. Die jungen Burschen, in deren Gesellschaft er sich gewöhnlich aufhielt, bedienten sich nicht der Sprache der hohen Herren.
»Aber du irrst dich«, widersprach Gerard schlicht. »Es war mein Pfeil, der das Tier im Flug ereilt und zu Boden geholt hat – und es war mein Jagdhund, der die Beute gefunden und zu mir gebracht hat. Nicht wahr, Angus?« Er zwinkerte dem Köter, der noch jung an Jahren und dennoch groß und einschüchternd war, verschwörerisch zu.
»Du … hast ihm einen schottischen Namen gegeben?«, fragte Eadric.
»Der passende Name für einen Hund«, beschied der andere ihm kaltschnäuzig und mit provozierendem Grinsen.
Eadric war klar, dass er nichts zu gewinnen hatte. Wenn der leibliche Sohn des Herrn von Kingorn behauptete, dass er den Fasan geschossen hatte, dann war es so. Niemand würde Eadric Glauben schenken, noch nicht einmal Geoffrey FitzKane selbst. Gewiss, sein leiblicher Vater hatte ihn in seinen Diensten belassen, hatte ihm nach dem Tod seiner Mutter Arbeit gegeben und ein Dach über dem Kopf – doch damit hatten sich seine Zuwendungen auch schon erschöpft. Zumal sein leiblicher Sohn die Aufmerksamkeit seines Vaters praktisch fortwährend auf sich zog …
»Na schön«, stieß Eadric resignierend hervor. »Du hast gewonnen. Behalte den Vogel, wenn du ihn so unbedingt haben willst. Aber lass mir wenigstens eine Feder.«
»Wozu?« Gerard sah ihn geringschätzig an. »Damit du dich dann mit fremden Federn schmücken kannst? Das würde dir ähnlich sehen, in der Tat.«
»Was willst du damit sagen?«
»Was wohl?« Der andere spuckte aus. »Meinst du, ich merke nicht, wie du um meinen Vater herumschleichst? Wie du fortwährend versuchst, ihn auf dich aufmerksam zu machen?«
»Das ist nicht wahr«, widersprach Eadric.
»Natürlich ist es das – wer wüsste das besser als ich? Seit dem Tag, da deine Mutter ihr jämmerliches Leben aushauchte, hast du nichts unversucht gelassen, um dir die Gunst meines Vaters zu erschleichen.«
»Er ist unser beider Vater«, beharrte Eadric. »Und du solltest nicht so über meine Mutter reden.«
»Ich rede über sie so, wie es mir passt«, gab der andere hochmütig kund. »Wer war sie denn schon? Doch nur eine angelsächsische Hure, deren einziges Verdienst darin bestand, mit ihrem normannischen Herrn das Lager zu teilen, als dieser betrunken war und sich ihrer fragwürdigen Reize nicht erwehren konnte.«
Eadric starrte ihn an.
Ihm war klar, dass Gerard es nur darauf anlegte, ihn zu provozieren, so, wie er es früher oft getan hatte, wenn er mal wieder nach einem Grund gesucht hatte, Eadric eine Tracht Prügel zu verpassen. Doch die Zeiten hatten sich geändert – wenn Eadric jetzt die Hand gegen Geoffrey FitzKanes Sohn erhob, musste er nicht nur damit rechnen, den Kürzeren zu ziehen, sondern auch damit, empfindlich bestraft zu werden. Mit einiger Wahrscheinlichkeit würde man ihn aus Kingorn vertreiben, und vermutlich würde es ihm nicht das Geringste helfen, dass auch er ein Sohn Geoffrey FitzKanes war.
Doch obwohl Eadric all dies wusste, konnte er sich nicht zurückhalten.
Er sah Gerard vor sich stehen, das hämische Grinsen in seinem blassen Gesicht, hörte, wie er all die hässlichen Dinge über seine Mutter sagte – und das Verlangen, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen, war übergroß. Sollte Gerard ihn verachten, sollte er ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit demütigen und ihm auch noch seine Beute stehlen – er hatte einfach nicht das Recht, schlecht von Eadrics Mutter zu sprechen.
»Nimm das zurück«, verlangte Eadric, wobei er den Bogen fallen ließ und die Hände zu Fäusten ballte.
»Was war das?« Gerards Augen verengten sich.
»Du wirst augenblicklich zurücknehmen, was du gerade gesagt hast, und dich dafür entschuldigen«, stieß Eadric hervor, seine Wut nur mühsam beherrschend.
»Oder was?«, fragte Gerard. Er lachte hell und spöttisch.
»Oder du wirst es bereuen«, sagte Eadric mit bebender Stimme voraus, auch wenn ihm insgeheim klar war, dass wohl eher er derjenige sein würde, der es später bereute.
Gerards Mundwinkel fielen spöttisch herab. »Du willst dich schlagen, so wie früher? Hast du schon vergessen, wie oft ich die Scheiße aus dir herausgeprügelt habe?«
»Nein«, erwiderte Eadric wahrheitsgemäß. »Hab ich nicht.«
»Und dennoch stehst du vor mir und bettelst um Schläge«, stellte der andere mitleidig fest. »Zu gerne würde ich dir deinen Wunsch erfüllen – aber es würde einem FitzKane schlecht zu Gesicht stehen, sich mit einem niederen Burschen im Morast zu wälzen. Da überlege ich mir eher, ob ich nicht meinen Hund auf dich hetzen sollte.«
Eadric streifte den Mastiff mit einem Seitenblick. Das Monstrum von einem Jagdhund kauerte jetzt friedfertig im Gras. Den Fasan hatte es vor sich abgelegt und wartete auf neue Anweisungen seines Herrn.
»Aber eigentlich«, fuhr Gerard fort, »ist sogar mein Hund noch zu schade für dich. Er ist nämlich reinen Blutes, musst du wissen, und stammt von edlen Ahnen ab – was sich von dir und deiner Hurenmutter ja wohl nicht behaupten lässt.«
Das war zu viel.
Mit geballten Fäusten sprang Eadric auf seinen verhassten Halbbruder zu, der darauf nur gewartet zu haben schien. Mit einem Sprung setzte er zurück, wobei er in einer fließenden Bewegung seinen Dolch ziehen wollte.
Eadric kam ihm zuvor.
Indem er sich auf seinen Gegner warf, bekam er Gerards Messerhand zu fassen, und obwohl er kleiner und weniger robust gebaut war, riss die Wucht seines Angriffs seinen Halbbruder von den Beinen.
Gerard schrie wütend auf, als sie beide auf dem Boden landeten. Es erfüllte Eadric mit grimmiger Genugtuung, dass der Jagdrock des Hochmütigen dabei mit Dreck besudelt wurde. Allerdings währte sein Triumph nicht lange. Gerard, der kurz davor stand, seine Zeit als Knappe zu beenden, und im Kampf ungleich geübter war, versetzte ihm mit dem Ellbogen einen harten Stoß, der Eadric für einen Moment die Luft nahm. Noch ehe er sich davon wieder erholen konnte, krachte Gerards Faust in sein Gesicht. Eadric hörte es hässlich knacken. Er fühlte heißen Schmerz, Tränen schossen ihm in die Augen, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Gerard lachte höhnisch, aber nicht lange – Eadrics Faust landete in seinem Gesicht und brach auch ihm die Nase, was Geoffrey FitzKanes leiblicher Sohn mit einem gellenden Schrei quittierte.
»Warte«, schrie er außer sich vor Zorn, »dafür büßt du mir!«
Was folgte, war nicht die Auseinandersetzung zweier junger Männer, die kurz vor dem Erwachsenenalter standen, sondern die Keilerei zweier halbwüchsiger Knaben. Sich aneinanderklammernd wälzten sie sich über den Waldboden, wobei jeder dem anderen einen Vorteil abzutrotzen suchte, während der große Mastiff am Rand der Lichtung kauerte und ihnen mit ausdrucksloser Miene zusah.
Doch anders als in früheren Jahren gab Eadric diesmal nicht klein bei. Mit zusammengebissenen Zähnen hielt er dagegen, wenn Gerard ihn niederzuringen suchte, und schaffte es, mit Geschick und Schnelligkeit aufzuwiegen, was ihm an Kraft und Übung fehlte. In einem plötzlichen Ausbruch gelang es ihm, sich herumzuwerfen und seinen Gegner abzuschütteln. Mit einem wilden Kampfschrei stürzte er sich auf Gerard und drückte ihn nieder, hielt seine Schultern auf dem Boden.
»So etwas wirst du nie wieder sagen, verstanden?«, herrschte er ihn an. »Niemals, niemals wieder …!«
Gerard sträubte sich. Die Zähne gefletscht wie ein Raubtier, starrte er Eadric hasserfüllt an, während er sich aus dessen Griff zu winden suchte – vergeblich. Gerards Züge wurden puterrot, während seine Kräfte erlahmten und er einsehen musste, dass er diesmal nicht den Sieg davontragen würde.
»Ver… standen«, stieß er endlich hervor.
»Entschuldige dich!«, verlangte Eadric und drückte ihn weiter zu Boden. »Sag, dass es dir leidtut!«
Gerard zögerte.
»Sag es, verdammt nochmal!«
»Es tut … mir leid«, keuchte es heiser, und Eadric war im Begriff, von seinem Gegner abzulassen – als sie auf der Lichtung plötzlich nicht mehr allein waren.
Ein Reiter setzte aus dem Dickicht. Das Fell seines Pferdes glänzte vor Schweiß, unruhig tänzelte es hin und her.
»Esquire!«, rief er aus, als er Gerard in seiner misslichen Lage erblickte, das Gesicht wutverzerrt und von Blut und Dreck verschmiert. Eadric erkannte den Mann, der wie Gerard lederne Jagdkleidung trug. Es war Warin Mason, ein Ritter von geringem Stand in Geoffrey FitzKanes Diensten.
Das Auftauchen des Gefolgsmanns ließ Eadric jäh zur Besinnung kommen. Schwer atmend ließ er Gerard los und erhob sich, wischte sich mit dem Ärmel das Blut aus dem Gesicht. Dann streckte er seinem Halbbruder die Rechte hin, um ihm aufzuhelfen, doch der wollte nichts davon wissen. Wutschnaubend sprang er auf, sich die gebrochene Nase haltend.
Mason wusste sichtlich nicht, was er davon halten sollte, aber es schien ihn auch nicht weiter zu interessieren. Erst jetzt fiel Eadric auf, dass die Züge des Ritters gerötet und seine Augen geweitet waren – und das offenbar nicht von der anstrengenden Jagd.
»Junger Herr, Ihr müsst sofort kommen! Euer Vater …!«
Gerard erstarrte. »Was ist mit ihm?«
»Ein wilder Keiler«, sagte der andere nur.
3
Was auch immer sie dazu bewogen hatte, aufeinander loszugehen; wie unterschiedlich auch immer sie sein mochten und was auch immer zwischen ihnen stand – plötzlich war es nicht mehr von Bedeutung.
Gerard ritt sofort auf Masons Pferd zur Burg zurück, während Eadric und der Ritter den Umweg über das Lager der Jagdgesellschaft machten. Dort erfuhr Eadric, was sich zugetragen hatte: Der Keiler, dessen Fährte Geoffrey FitzKane und die Seinen gefolgt waren, war unvermittelt aus dem Wald aufgetaucht. FitzKanes Pferd hatte daraufhin gescheut und seinen Reiter abgeworfen, und das Tier war über den Kommandanten von Kingorn Castle hergefallen. Zwar hatten seine Leute den Keiler schließlich töten können, doch FitzKane war schwer verwundet. Auf dem Karren, der die Jagdbeute hatte tragen sollen, hatte man ihn zurück zur Burg gebracht, wohin wenig später auch die übrige Jagdgesellschaft zurückkehrte, einschließlich der Knechte und Bogenschützen, zu denen auch Eadric gehörte.
Die Stimmung der Männer war gedrückt; alles in allem war Geoffrey FitzKane ein guter Dienstherr, der seine Pflichten gegenüber den Untergebenen kannte und sie treu erfüllte. Wenn er starb, so würde eine unsichere Zeit für die Burg und ihre Besatzung anbrechen, deren Kommandant vom König bestimmt und eingesetzt wurde. Doch Schottland hatte keinen Herrscher, seit König Alexander vor nunmehr vier Jahren auf dem Weg nach Kingorn Castle den Tod gefunden hatte, und so war auch die Zukunft der Burg und ihrer Besatzung höchst ungewiss.
Was Eadrics persönliche Empfindungen betraf, war er sich selbst nicht sicher. Gewiss, Geoffrey FitzKane war sein Vater, jedoch hatte dieser in den vergangenen Jahren nur herzlich wenig unternommen, um dieser Bezeichnung gerecht zu werden; die Hoffnung von Eadrics Mutter, der Herr von Kingorn werde sich nach ihrem Tod Eadrics annehmen, hatte sich nicht erfüllt. Zwar hatte FitzKane ihn in sein Haus aufgenommen und ihm Schutz gewährt, doch hatte er davon abgesehen, ihm eine ritterliche Ausbildung angedeihen zu lassen, wie es anderen Bastardsöhnen widerfuhr. Dass Eadric kein einfacher Stallbursche geblieben war, sondern auf dem besten Weg dazu, in die Reihen der königlichen Bogenschützen aufgenommen zu werden, hatte er weniger seinem Vater als vielmehr seinem Talent im Umgang mit Pfeil und Bogen zu verdanken.
Einen persönlichen Grund, um das Leben des Mannes zu bangen, der ihn gezeugt hatte, hatte Eadric folglich kaum. Dennoch fühlte er eine tiefe Unruhe, als er nach Kingorn zurückkehrte. Eine eigenartige Melancholie erfüllte ihn – vielleicht deshalb, weil FitzKanes Tod auch bedeuten würde, dass Eadrics Hoffnung auf Anerkennung endgültig verloren war. Und in dem Moment, als er ins Quartier der Bogenschützen zurückkehrte und sich das Gesicht mit kaltem Wasser wusch, wurde ihm klar, wie sehr zumindest ein Teil von ihm sich in all den Jahren genau danach gesehnt hatte.
»Habt ihr es schon gehört?«, fragte einer der anderen Bogenschützen, die an dem schäbigen Tisch zwischen den strohgefüllten Lagern hockten. »Es soll ihn noch schlimmer erwischt haben, als sie zugeben wollen. Angeblich hat ihm das Biest fast den Kopf von den Schultern gerissen.«
Catwyg, ein betagter Waliser, der schon für viele Herren gekämpft hatte, bedachte ihn mit einem finsteren Blick. »Halt den Rand«, wies er ihn mit hartem walisischen Akzent zurecht. »Der Junge fühlt sich auch ohne dein Geschwätz schon elend genug!«
So dankbar Eadric für diese Worte war, so sehr beschämten sie ihn auch, denn nun sahen alle verstohlen zu ihm herüber. Jedermann auf der Burg wusste, wessen Sohn er war und dass – zumindest zur Hälfte – adeliges Blut in seinen Adern floss. Im täglichen Umgang spielte es keine Rolle, doch dies war eine besondere Situation. Und weder Eadric selbst noch seine Kameraden wussten, wie sie damit umgehen sollten. Er hängte den Köcher mit den Pfeilen an den Haken neben seinem Lager und löste die Bogensehne. Seine Hände zitterten dabei, so heftig war der Aufruhr von Gefühlen, der in ihm herrschte.
Seine Wut auf Gerard war verflogen, dafür fragte er sich jetzt, welche Folgen sein unüberlegtes Handeln haben würde. Er schalt sich einen Narren dafür, dass er die Beherrschung verloren hatte, denn sie waren beide keine Knaben mehr, und ein Angriff auf den Sohn seines Dienstherrn war ein ernstes Vergehen – auch dann, wenn es sich um den Halbbruder handelte. Geoffrey FitzKane mochte nie etwas für Eadric getan haben, aber er hatte auch nie etwas gegen ihn unternommen, wenn Gerard sich wieder einmal lauthals über ihn beschwert hatte. Vielleicht deshalb, weil Geoffrey seinen leiblichen Sohn nur zu gut kannte, seine Launen, seinen Ehrgeiz und seine Eifersucht. Doch all das konnte sich schlagartig ändern, wenn …
»Eadric!«
Einer der Waffenknechte stürzte in die Unterkunft und sah sich suchend um.
»Hier«, meldete Eadric sich leise. Offenbar hatte die raue Wirklichkeit ihn schon eingeholt. »Was gibt es?«
»Sir Geoffrey wünscht dich in seinem Quartier zu sehen! Unverzüglich!«
Eadric wusste nicht, ob er erleichtert oder bestürzt sein sollte. Nicht Gerard verlangte ihn zu sehen, sondern sein Vater. Und das, obschon er schwer verwundet lag! War die Begegnung mit dem Keiler am Ende glimpflicher verlaufen, als die Gerüchte es vermuten ließen? Oder empörte sich der Herr von Kingorn derart über das Verhalten seines Bastards, dass er ihn aller Pein zum Trotz bestrafen wollte?
»Ich komme«, erklärte er und folgte dem Soldaten hinaus. Von der Unterkunft der Bogenschützen – einem einfachen, strohgedeckten Bau aus Fachwerk, der sich an die Außenmauer der Festung duckte, – ging es zum Donjon, der neben der Halle des Burgherrn auch dessen Quartier barg. Am Eingang wartete Sir Warin, der trotz seines vergleichsweise geringen Standes zu FitzKanes engsten Vertrauten zählte, und nahm Eadric in Empfang. Mit pochendem Herzen folgte Eadric ihm die Stufen hinauf, die sich im steinernen Halbdunkel in die Höhe wanden. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, sodass der spärliche Schein einiger Talgkerzen in den Mauernischen die einzige Beleuchtung war.
Zu einem klaren Gedanken war Eadric nicht fähig. Zu seinem eigenen Befremden musste er immerzu an seine Mutter denken, während er Mason nach oben folgte. Vielleicht, weil es derselbe Turm gewesen war, dieselben Stufen … Vielleicht aber auch, weil eine düstere Vorahnung ihn streifte.
Die schwere Eichentür vor ihm öffnete sich, und er betrat einen Raum, der im Halbdunkel lag. Das Bett, das darin stand, war sehr viel bequemer als alles, worauf Eadric je geschlafen hatte, jedoch entbehrte es jeder Verzierung – die wirklich vornehmen Unterkünfte innerhalb der Burg waren nach wie vor dem König und seiner Gemahlin vorbehalten, auch wenn es seit vier Wintern keinen König mehr in Schottland gab. Sir Geoffrey war der Kommandant der königlichen Garnison, entsprechend nüchtern und zweckdienlich war seine Unterkunft eingerichtet.
Die Männer, die um das Bett versammelt waren, kannte Eadric alle. Genau wie Mason waren auch sie Ritter, die in königlichen Diensten standen und dem Befehl FitzKanes unterstellt waren. Die meisten trugen noch ihre Jagdkleidung; Sorge war in ihren bärtigen Mienen zu lesen.
Auch Gerard war da. Er kniete am Kopfende des Bettes und wandte Eadric den Rücken zu. Ein Weib hatte Sir Geoffrey nicht mehr. Seine Gemahlin war kurz nach Gerards Geburt gestorben, was womöglich einer der Gründe gewesen war, weshalb Geoffrey Trost in den Armen einer Stallmagd gesucht hatte. Gerard gegenüber, auf der anderen Seite des Lagers, stand Pater Magnus, ein Benediktinermönch, der als Kaplan der Burg fungierte. Als Eadric den Raum betrat, spendete Magnus den Segen. Die Anwesenden bekreuzigten sich – und Eadric wurde klar, dass der Priester soeben die Sterbesakramente erteilt hatte.
Er bekreuzigte sich ebenfalls und senkte respektvoll das Haupt, als Pater Magnus an ihm vorbei die Kammer verließ. Zögernd trat Eadric näher, und im Schein der Kerzen konnte er endlich einen Blick auf den Mann erheischen, der dort lag.
Geoffrey FitzKane sah fürchterlich aus.
Was man in den Unterkünften tuschelte, so musste Eadric nun erkennen, entsprach der Wahrheit. Der Keiler hatte FitzKane grässlich zugerichtet. Nicht nur, dass sein Gesicht blutig war und er offenbar ein Auge verloren hatte; viel schlimmer war die Verletzung an seinem Hals, die sich bis hinab zur linken Schulter zog – das Gewaff des Tieres hatte ihn förmlich aufgeschlitzt. Zwar hatte der Wundarzt einen Verband angelegt, jedoch war dieser dunkel durchfärbt, was darauf schließen ließ, dass noch immer Blut in großer Menge austrat. Der Rest seines blutigen, zerschundenen Körpers war von einem weißen Laken bedeckt, das sich ebenfalls an einigen Stellen dunkelrot gefärbt hatte.
Eadric fühlte den Kloß, der sich in seinem Hals bildete. Es war eine seltsam fremde Vorstellung, dass dieser Mann, der dort im Sterben lag, sein Vater war. Dennoch machte ihn der Anblick betroffen. Nie zuvor in seinem Leben hatte er so viel Blut gesehen …
»Was willst du hier?«
Gerard hatte sich umgewandt. Unverhohlene Ablehnung sprach aus seinen Zügen. Auf seinen noch immer blutverschmierten Wangen glänzten Tränen.
»Habe … rufen lassen«, drang es leise, aber noch deutlich vernehmbar aus Sir Geoffreys Mund. Seine Stimme bebte vor mühsam beherrschtem Schmerz, er musste entsetzliche Qualen leiden. »Wollte ihn sehen.«
Gerard erhob sich. Die Hand seines Vaters, die er bis dahin gehalten hatte, ließ er los.
»Komm … Sohn.«
Eadric stand wie vom Donner gerührt.
Er konnte sich nicht entsinnen, dass FitzKane ihn je so genannt hatte. Aller Augen richteten sich auf ihn, und in denen von Gerard stand unverhohlener Zorn, selbst jetzt, da sein Vater im Sterben lag.
Zögernd trat Eadric näher, als würde er sich auf unsicherem Boden bewegen. Er wusste nicht, was er tun oder sagen sollte, und dies umso mehr in Anbetracht der Blicke, die auf ihm lasteten.
Aus der Nähe sahen FitzKanes Wunden noch schlimmer aus. Die Hauer des Tieres hatten einen Teil der Kopfhaut von seinem Haupt gerissen, und von seinem linken Auge war nichts geblieben als eine leere Höhle, über der sich ein blutdurchtränkter Verband spannte.
»Edwin«, flüsterte er, als Eadric an sein Lager trat, Gerard gegenüber. »Mein Edwin …«
Eadric biss sich auf die Lippen. Kannte der Mann, der ihn gezeugt hatte, noch nicht einmal seinen Namen? Oder umfing ihn der nahe Tod bereits so sehr, dass er seinen Verstand trübte?
»Edwin«, wiederholte Sir Geoffrey unbeirrt, wobei er den fliehenden Blick seines verbliebenen Auges auf Eadric zu richten suchte. »Das wäre dein Name gewesen, wenn du mein … mein …« Er unterbrach sich und biss die Zähne zusammen, als der Schmerz ihn für einen Moment zu überwältigen schien. »Wenn du mein legitimer Sohn gewesen wärst«, fuhr er schließlich fort.
Edwin.
Eadric wusste nicht, was er denken sollte. Warum sagte FitzKane ihm das? Was spielte es noch für eine Rolle? Er war kein legitimer Spross, das hatte er in der Vergangenheit oft genug zu spüren bekommen.
»Habe in meinem Leben … manches getan«, hauchte Sir Geoffrey. Die Kräfte verließen ihn nun spürbar. »Nicht viel, das bereue … stets versucht, ein guter Diener zu sein … meinem Gott und meinem … König.«
»Das wart Ihr, Herr«, versicherte Mason. Auch die anderen Ritter nickten beifällig.
»Nur eines«, fuhr der Sterbende fort, wobei er ruhelos auf Eadric starrte. »Eines, das ich mehr bereue als alles andere …«
Eadric senkte den Blick.
Selbst jetzt noch, sagte er sich. Sogar im Angesicht des nahen Todes empfand Sir Geoffrey nichts als Scham für ihn, bereute es zutiefst, der Vater eines einfachen Stallburschen zu sein, dessen einfacher Name auf Schritt und Tritt an seine niedere Herkunft erinnerte.
»Da hörst du es«, zischte Gerard von der anderen Seite des Bettes. »Mein Vater schämt sich für dich! Geh ihm und mir aus den Augen, ehe ich dich …«
»Nein!«, widersprach FitzKane energischer, als noch von ihm zu erwarten war. »Nicht das … Bereue, Sohn zu haben und ihn niemals zu sehen … nicht Vater zu sein, der ich hätte sein können …«
»Herr«, entfuhr es Eadric.
Mit manchem hatte er gerechnet – damit nicht.
Geoffrey FitzKane schluckte, um seine Kehle von Blut zu klären, dann sprach er leise weiter: »Wenn Tag zu Ende … manches in anderem Licht … will nicht … vor Schöpfer treten … ohne diese Sünde … bekannt zu haben … bitte verzeih … Sohn …«
Er war kaum noch zu verstehen. Erneut verkrampfte sich sein gepeinigter Körper vor Schmerzen, dennoch brachte er es fertig, die blutige Rechte zu heben und sie Eadric hinzuhalten. »Verzeih einem … alten Narren.«
Eadric konnte nicht anders, als Sir Geoffreys Hand zu ergreifen, zum ersten Mal in seinem Leben.
Als Junge hatte er Geoffrey FitzKane für dessen Kraft und Stärke bewundert und ihn bisweilen auch gefürchtet – nun war seine Hand kraftlos und glitschig vom Blut. Und dennoch hatte Eadric für einen kurzen, winzigen Moment das Gefühl, als würde ihn etwas von dem Licht streifen, das er sein Leben lang vergeblich gesucht hatte.
»Gerard«, hauchte Sir Geoffrey mit einer Stimme, die nur noch ein Schatten war.
»Ja, Vater?«
»Deine … Hand«, verlangte der Sterbende, und obwohl das Spiel in Gerards blasser Miene verriet, wie sehr es ihm widerstrebte, streckte er seine Rechte hin, die Geoffrey prompt nahm und mit Eadrics zusammenführte.
»Dein Bruder«, krächzte er, wobei er von einem zum anderen blickte. »Haltet gemeinsam bei mir Wache … seid stets … stets …«
Es war Sir Geoffrey nicht vergönnt, den Satz zu beenden. Er verstummte jäh, und seine Augen weiteten sich, während sein Körper sich noch einmal aufbäumte, als wollte er sich dem Unausweichlichen verwehren. Dann fiel der Herr von Kingorn Castle leblos in sich zusammen.
Einen Augenblick lang standen alle schweigend.
Fassungslos starrte Eadric auf den leblosen Körper. Geoffrey FitzKane mochte der Mann gewesen sein, der ihn gezeugt hatte. Jedoch erst in den letzten Atemzügen seines Lebens war er zu seinem Vater geworden.
Eadric empfand keine Trauer, dazu hatte er FitzKane zu wenig gekannt und zu sehr unter seinem leiblichen Sohn gelitten. Aber eine eigenartige Wehmut überkam ihn, ein tiefes Bedauern, und er ertappte sich dabei, dass sich seine Augen mit Tränen füllten.
Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sein Halbbruder und er sich noch immer die Hand reichten. Auch Gerard schien es in diesem Moment klar zu werden. Noch ehe Eadric etwas sagen konnte, zog er seine Rechte zurück. Aus seinen Zügen sprach weniger Trauer um den verlorenen Vater als vielmehr Zorn auf Eadric. Die Anwesenden bekreuzigten sich angesichts der Seele, die ihre sterbliche Hülle verließ. Gerard tat es ihnen gleich, sein Blick blieb dabei jedoch auf Eadric haften, der in diesem Moment begriff, dass die letzten Worte Sir Geoffreys nicht mehr als der Wunsch eines Mannes gewesen waren, der im Sterben lag und im Hinblick auf das Jenseits seine Versäumnisse bereute – an den Verhältnissen im Hier und Jetzt würden sie nicht das Geringste ändern.
Gerard schloss seinem Vater die Augen, dabei hielt er die seinen selbst geschlossen, um die Tränen zurückzuhalten.
»Geht«, verlangte er dann halblaut, über FitzKanes Leichnam gebeugt »Geht alle! Ich will allein sein!«
»Aber Esquire«, wandte einer der Ritter ein, »die Totenwache! Euer Vater sagte …«
»Ich weiß, was mein Vater sagte, ich bin nicht taub«, beschied Gerard ihn barsch, wobei er die Augen noch immer geschlossen hielt, als weigere er sich anzuerkennen, was geschehen war. »Und jetzt lasst mich allein! Alle!«
Eadric widerstand dem Drang, sich auf dem Absatz umzudrehen und das Quartier zu verlassen.
Er konnte den Widerwillen der Männer beinahe spüren, die sich nicht nur gegen den barschen Tonfall des jungen FitzKane empörten, sondern auch dagegen, dass er sich dem letzten Willen seines Vaters widersetzte, demzufolge die beiden Halbbrüder gemeinsam Totenwache halten sollten. Zumindest dies hatte sich doch geändert – zum ersten Mal waren die Edlen nicht auf der Seite Gerards, obschon er einer von ihnen war. Natürlich waren sie auch nicht auf Eadrics Seite, dazu hatten sie keinen Grund. Aber in ihren Herzen waren sie noch immer Gefolgsleute Sir Geoffreys und hatten seinen letzten Wunsch vernommen, und das wiederum änderte die Art und Weise, wie sie Eadric betrachteten.
Gerard öffnete die Augen und stellte zu seinem Verdruss fest, dass er noch immer nicht allein war.
»Verdammt!«, schrie er und griff nach dem Zinnbecher, der auf der Truhe stand und aus dem sein Vater vorhin noch Wein getrunken hatte, versetzt mit einem Sud aus schmerzstillenden Kräutern. Es schepperte hell, als Gerard das Gefäß zu Boden schmetterte. »Warum seid Ihr immer noch hier? Habe ich nicht das Recht, mich in Ruhe von meinem Vater zu verabschieden?«
Ein Augenblick betretenen Schweigens trat ein.
»Doch, natürlich«, versicherte Sir Warin schließlich, wenn auch widerstrebend. Mit einer tiefen Verbeugung vor dem Leichnam verabschiedete er sich von seinem Dienstherrn und Freund, dann wandte er sich ab und verließ die Kammer. Die anderen taten es ihm gleich, zuletzt verneigte sich auch Eadric, wobei Gerard ihn mit Blicken durchbohrte.
Dann ging auch Eadric hinaus, in seinem Inneren eine seltsame Leere, die Erinnerungen weckte.
Nach all den Jahren, in denen er ihn mit Missachtung gestraft hatte, war Geoffrey FitzKane doch noch sein Vater geworden.
Und nun war er tot.
4
Kingorn CastleVier Tage später
Tiefe Unrast hatte von Gerard FitzKane Besitz ergriffen.
Wie ein lauerndes Raubtier ging er in dem Quartier auf und ab, das noch bis zum gestrigen Tag seinem Vater vorbehalten gewesen war. Nun lag sein Vater begraben, und Gerard hatte nicht gezögert, die Unterkünfte der Knappen zu verlassen und sein Quartier zu beziehen. Aus Respekt vor seinem Vater hatte keiner der Männer, die in Kingorn ihren Dienst versahen, ihm dieses Privileg streitig gemacht, aber auch Gerard war klar, dass es nicht von langer Dauer sein würde. Denn schon bald würde ein anderer Edler als Kommandant der Garnison eingesetzt werden – und er, Gerard FitzKane, würde das Nachsehen haben.
So hatte es nicht kommen sollen, sagte er sich immer wieder. Durchaus nicht …
»Sorgt Euch nicht, Esquire«, warf Warin Mason ein, der fest entschlossen schien, den Treueid, den er dem Vater geleistet hatte, auch gegenüber dem Sohn zu halten.
Gerard blieb stehen und sah ihn fragend an. Eine Strähne seines dunklen Haars fiel ihm ins Gesicht und ließ es noch blasser erscheinen, als es ohnehin schon war. Seine Nase schmerzte noch immer, was seine Wut nur noch mehr anstachelte. »Ich soll mir keine Sorgen machen?«, fragte er spitz.
»Eure Zeit der Ausbildung ist beinahe beendet«, begründete der Ritter seine ermunternden Worte. »Schon bald werdet Ihr den Ritterschlag empfangen und das Lehen Eures Vaters erben.«
»Mein Vater«, entgegnete Gerard, wobei er jedes einzelne Wort betonte, »stand in des Königs Dienst. Er hinterlässt mir nicht viel mehr als eine schäbige kleine Burg in Lothian und ein paar Felder, denen stumpfsinnige Bauern karge Frucht abzutrotzen versuchen!«
»Und einen guten Namen«, fügte Sir Warin hinzu. »Auch der neue Kommandant von Kingorn wird nicht umhinkönnen, dies anzuerkennen. Möglicherweise nimmt er Euch in seine Dienste.«
Gerard konnte nicht anders, als spöttisch aufzulachen. »Und Ihr glaubt, dass es das ist, wonach ich begehre? Dann kennt Ihr mich nicht sehr gut.«
»Seit Ihr ein Säugling wart«, gab Warin zu bedenken. »Ich werde den Tag nie vergessen, da ich Euch das erste Mal erblickte. Eure Mutter lebte damals noch …«
»Was Ihr nicht sagt«, unterbrach Gerard ihn unwirsch – er verspürte kein Verlangen danach, wie ein alter Greis in Erinnerungen zu schwelgen. »Aber ich bin längst kein Kind mehr, Mason. Und meine Mutter ist nicht mehr am Leben, ebenso wenig wie mein Vater!«
»Ich weiß«, räumte der andere ein, »was Euren Zustand erklärt …«
»Ihr sprecht von meinem Zustand?« Abermals war Gerard stehen geblieben und sah den Freund seines Vaters zweifelnd an. »Ihr glaubt, dass die Trauer um meinen Vater meinen Verstand benebelt? Dass sie es ist, die mich harsche Worte wählen lässt?«
»Das muss ich wohl glauben, junger Herr«, erwiderte der Ritter ausweichend, wobei er Gerards Blick jedoch standhielt. »Alle anderen Folgerungen würden weder Euch noch mir gefallen.«
»Warum? Weil sie enthüllen würden, dass ich nicht der bin, für den Ihr mich gehalten habt? Nicht der Sohn, den mein Vater sich gewünscht und den er eigentlich verdient hätte?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Nein«, gab Gerard zu, »denn auch ich kenne Euch schon lange, und in dieser Zeit habe ich gelernt, Eure Miene zu deuten: Das Spiel der Falten um Euren Mund, wenn Euch etwas nicht gefällt, das Mahlen Eurer Kiefer unter Euren Wangen.«
Warin sah ihn an. Das Maß an Feindseligkeit, das Geoffrey FitzKanes Sohn ihm entgegenbrachte, schien ihn zu überraschen. »Junger Herr«, sagte er leise und um Ausgleich bemüht, »ich weiß nicht, was in Euch gefahren ist, aber solltet Ihr das Andenken an Euren Vater nicht …«
»Mein Vater, Mason«, fiel Gerard ihm ins Wort, »war ein treuer Untertan des Königs und ein pflichtbewusster Kommandant. Seine Männer haben ihm alles bedeutet. Sie haben ihn geliebt und respektiert, und zumindest einige von ihnen wären ohne Zögern für ihn in den Tod gegangen.«
»So ist es«, bestätigte Warin ohne Zögern.
»Als sein leiblicher Sohn hingegen habe ich eine etwas andere Sicht der Dinge«, stellte Gerard klar.
»Wie könnt Ihr so etwas sagen?« Der andere sah ihn fassungslos an. »Ihr habt keinen Anlass zur Beschwerde! Euer Vater hat es Euch gegenüber niemals an etwas fehlen lassen, im Gegensatz zu …« Er unterbrach sich und blickte zu Boden.
»Ja?«, hakte Gerard genüsslich nach. »Sprecht nur weiter, alter Freund! Auch mein Vater war nicht vollkommen. Jeder in Kingorn weiß, dass er den Reizen einer Magd verfiel – und jeder kennt den Stachel, der seither in meinem Fleisch sitzt. Wisst Ihr, warum ich diesen Stachel auch weiterhin dulde? Warum ich den Bastard nicht bestrafen ließ, obwohl er mich dort draußen im Wald angegriffen und verwundet hat?« Er deutete auf seine nicht mehr ganz gerade Nase.
»Nun«, meinte Warin und blickte verlegen zu Boden, »ich nehme an, weil es der letzte Wille Eures Vaters war. Er wollte, dass Ihr und Euer Halbbruder …«
»Nein«, widersprach Gerard, wobei er sich schüttelte – schon der Gedanke an seinen Bastardbruder erfüllte ihn mit Abscheu. »Sondern weil ich das Gefühl habe, dass mir der Kerl irgendwann einmal noch nützlich sein wird – und genauso lange werde ich ihn in meinen Diensten behalten.«
»Aber Euer Vater wollte …«
»Mein Vater, Mason, weilt nicht mehr unter uns. Je eher Ihr dies einseht, desto besser ist es – denn uns allen stehen Veränderungen bevor.«
Der Ritter horchte auf. »Was für Veränderungen?«
»Könnt Ihr Euch das nicht denken?« Gerard lachte leise. Mason mochte fast zwanzig Winter älter sein als er, ein wackerer Kämpfer und seiner Familie treu ergeben – doch er war kein Mann des Verstandes. Ebenso wenig, wie Gerards Vater es gewesen war. Vielleicht hatten sie einander deshalb so nahegestanden. »Ich habe nie begriffen, warum mein Vater mit derartiger Zuversicht in die Zukunft geblickt hat«, gestand Gerard offen. »Er war des Königs Ritter, fürwahr, und befehligte diese Festung im Dienst der Krone. Doch die Wahrheit ist, dass Schottland keinen König hat. Schon seit vier Jahren nicht mehr, seit er in jener mondlosen Nacht von der Klippe stürzte, gar nicht weit von hier entfernt – und das Weib, dessen Reize Schuld daran trugen, weilt längst schon wieder in Frankreich.«
»Seither bewahren die Wächter von Schottland das Reich«, wandte Warin ein – das immerhin schien er zu wissen. »Ehrbare Männer, die den Adel hinter sich wissen.«
»Ist das so?« Gerard lachte wieder. »Erzählt mir nicht, dass Ihr nichts wisst von den Rivalitäten, die zwischen den Häusern Comyn und Bruce bestehen. Von den Ränken, die sie schmieden, um sich gegenseitig zu übervorteilen. Und manch einer, der den stolzen Namen Balliol oder Bruce trägt, mag auch schon selbst nach dem Thron geschielt haben.«
»Ihr habt keinen Grund, so etwas zu behaupten. Weder Bruce noch Balliol wird den Thron besteigen, sondern Margaret, des Königs leibliche Enkelin und letzte Erbin des Hauses Canmore. So wurde es in Brigham festgelegt und beschlossen, mit Zustimmung aller Adelshäuser.«
»Die Häuser mögen zugestimmt haben, das ist wahr«, räumte Gerard ein, »doch wie soll eine Königin, die erst sieben Lenze zählt und dazu noch in Schottland eine Fremde ist, weil sie fernab am Hof des norwegischen Königs aufwuchs, sich gegen die Machtgelüste der Lords behaupten?«
»Die Wächter werden …«


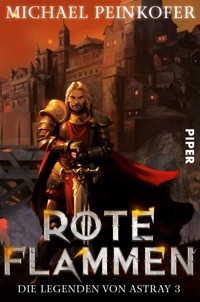
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)