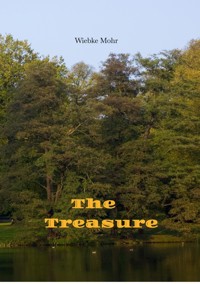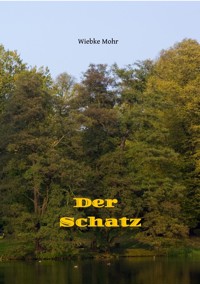
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
auch als Farbversion und preiswerte schwarz-weiß-Version erhältlich Dieses Büchlein handelt von dem, was auf den Etiketten, die an den Insekten einer historischen Sammlung hängen, zu lesen steht. Diese Etiketten sind beschriftet mit dem Namen des Tieres, Fundorten, Funddaten und Sammlernamen. Zumindest soll das seit ca. 1905 so sein. Die hier zugrunde liegende Insektensammlung deckt den Zeitraum von 1868 bis 1963 ab und enthält deshalb auch Zeitzeugen von histori-schen Ereignissen (z.B. Versaille 1919, Cherson 1942), die jungen Men-schen nicht mehr geläufig sind. Enthalten sind auch Insekten von Sammlern mit interessanter Vita, die nicht mal Insidern bekannt sind, wie auch Expeditionen und echten Abenteuerreisen (Hedin, Citroen). Auch werden gesellschaftlich relevante Aspekte beleuchtet. Das Ganze gespickt mit vielfachen Zitaten aus alten Berichten von Sammlern, von Legenden und Mythen sowie Aspekten von Kunst und Religion. Die einzelnen Kapitel sind in lockerem, leicht verständlichem "Plau-derton" geschrieben und mit 1 – 2 Seiten absichtlich kurz gehalten um nicht langweilig zu werden. Es geht um Übersichten, nicht um Vertie-fungen. Es ist deshalb kein Lexikon, kein Reiseführer, kein Lehr- oder Erklärbuch. Es ist ein Lesebuch und soll so viel Freude vermitteln, dass der Leser oder die Leserin sich auf eigene Faust in Themen der Allge-meinbildung vertiefen. Denn daran mangelt es insbesondere in Kreisen der Studierenden der Biologie: die sogenannte klassische Allgemeinbil-dung ist dort weiträumig abhandengekommen. Es gab 2 Anstöße für dieses Büchlein: das Objekt "Hister hottentota" (Kapitel "alles begann .." ) sowie die Unkenntnis der mich bei der Arbeit an der Sammlung umgebenden Studenten über vielerlei geschichtliche und geografische Begebenheiten und Zusammenhänge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
QIÉN, QIÈN, NATURALEZA,
levantando tu gran cuerpo desnudo,
como las piedras, cuando niños,
se encontrara debajo
tu secreto pequeño e infinito!
Vermöchte man doch, o Natur,
deinen großen, nackten Körper emporzuheben,
gleich Steinen in der Knabenzeit,
und fände darunter
dein kleines und unendliches Geheimnis!
Juan Ramón Jiménez 1)
1 Herz, stirb oder singe, Gedichte, Zürich 1969 mit freundlicher Genehmigung des Diogenes Verlages, Zürich
Am 12. Juni 2021 war in der Bergedorfer Zeitung zu lesen: „Seltener Insektenschatz aus Lohbrügge begeistert Forscher“, „die Wissenschaftler haben aus Lohbrügge einen Schatz erhalten, von dessen Existenz über Jahrzehnte nur sehr wenige Menschen wussten.“ 2)
Eine Sammlung alter Insekten – wer braucht das schon – so Mancher von uns hat bestimmt schon einmal solches oder ähnliches gedacht. Es gab eine Zeit mit dem Willen, diese und auch andere Sammlungen zu vernichten. Zumindest landeten Sie in dunklen Ecken oder Kellern und wurden vergessen. Angeblich wurde diese Sammlung im Keller aufgefunden, als das Thünen-Institut seinen Umzug vom Schloss Reinbek nach Lohbrügge plante. Nun ist Etwas, das im Keller steht, eigentlich abgeschrieben, wir stellen so etwas aber doch erst nochmal in den Keller, weil wir uns doch noch nicht so richtig davon trennen mögen.
Also: wer braucht das Zeugs schon?
WIR ! – rufen die Fachleute, wir möchten sie ansehen und auseinander nehmen. Vor allem die TYPEN brauchen wir. Wir wollen sehen, welche der Arten noch existieren und wo.
Die Vorstellungen, was alles in dieser Sammlung enthalten ist, Arten, Individuenzahl oder Qualitäten der Insekten dieser Sammlung waren genaugenommen nur vage und voller Vermutungen. Deutlich jedoch sind vorwiegend Käfer (Coleoptera), sowie Schmetterlinge (Lepidoptera), enthalten. Aber auch Fliegen (Diptera), Läuse, Zikaden und Wanzen und allerlei andere 6-Beiner sowie einige anders-beinige.
Die „Thünen-Sammlung“ ist Eigentum des „Thünen-Institutes für Holzforschung“ und wurde dem „Leibnizinstitut zur Analyse des Biodiversitätswandels Hamburg“ (LIB) als Dauerleihgabe zur Erforschung zur Verfügung gestellt. Hier ist sie hinter den dicken Mauern des „Museum der Natur – Zoologie – Hamburg“ oder kurz „zoologisches Museum Hamburg (ZMH)“, eingelagert und steht Forschenden auf Anfrage zur Verfügung.
Wenn ich mit Fachleuten plauderte und erzählte, ich arbeite an der „Thünen“-Sammlung, kam sofort die Gegenfrage: „Ach - was sammelte der denn?“. Das ist unsere heutige Zeit: hohes Spezialistentum. Man sammelt nicht mehr nur Käfer (oder Briefmarken) sondern man sammelt bestimmte Käfer (bestimmte Briefmarken), wie z.B. Laufkäfer oder Prachtkäfer (nur Briefmarken von Australien). Und da kommt gleich die Erklärungsnot: Johann Heinrich von Thünen war alles andere als ein Insektensammler - diese Sammlung wurde gekauft!
Die Sammlung wurde 1944 durch Dr. Franz Heske – fast 100 Jahre nach dem Tod Heinrich von Thünens - für das von ihm geleitete Forstinstitut gekauft. Verkäufer war der seinerzeit wohl größte Insektenhändler der Welt, mindestens in Europa, Eugéne le Moult.
Die Objekte in der Sammlung sind zwischen 60 und 160 Jahre alt. Eine genauere Aussage über die Herkunft jedes einzelnen Käfers, Schmetterlings oder jeder Fliege lässt sich allerdings nur anhand der Beschilderung treffen.
Genau um diese Schilderchen oder Etiketten wird es in den folgenden Kapiteln gehen. Sie enthalten Informationen, die der Wissenschaftler normalerweise nur zu Vergleichen heranzieht. Bei mir lösten Sie Assoziationen an Reisen, Könige, Teppiche, geschichtliche Ereignisse, Abenteuer, Gefühle wie Grusel, Ungläubigkeit, Heiterkeit und Fernweh aus.
Seltsamerweise, ja geradezu mystisch anmutend sind nahezu alle hier aufgeführten Etiketten unter den über 63.000 Einzelobjekten nur jeweils 1 x vorhanden. Als ob eine magische Hand sie gewissermaßen als Belohnung für die mühselige Arbeit der Inventarisierung unter all den vielen Objekten versteckt hat.
Die Ordnung der Kapitel ist ein Versuch, Themen in irgendeiner Form zusammenzuführen, was jedoch nicht immer gelungen ist. Mit der Ordnung ist das nämlich so eine Sache: nach welchen Gesichtspunkten soll sortiert werden? Die Ordnung der Natur beschäftigte und beschäftigt die Wissenschaft seit eh und je.
Dies ist kein Lexikon, kein Reiseführer, kein Lehr- oder Erklärbuch – es ist ein Mitmachbuch, ein Erkundungsbuch und deshalb ein Freu-Buch! Es erwartet Sie, liebe Leserin und lieber Leser, wissenswertes, unterhaltsames und abenteuerliches aus Geographie, Geschichte, Kunst und Kultur. Es geht nicht um kleine Insektenmumien. Es geht um Diejenigen, die diese gesammelt und bestimmt haben, es geht um die Orte, an denen sie aufgefunden wurden, um die Zeit, in der sie an diesen bestimmten Orten aufgefunden wurden und auch um Ereignisse, die an diesen Orten einst stattfanden. Es geht um Sammler, Autoren, Händler, Länder, Stätten, Gegenden, Expeditionen, Abenteuer und historische Ereignisse. Auch Poesie, Mythologie und Fantasy kommen nicht zu kurz. Vermeintlich langweilige Listen können sich als wahrer Fundus an Informationen herausstellen.
Sehen Sie „hinter“ die Etiketten und betrachten Sie ohne Vorurteil, freuen Sie sich an den Gedanken, die Sie spontan erreichen. Bewertungen drängen sich schnell auf, betrachten Sie die Dinge wie sie waren oder zu sein scheinen. Lassen Sie sich berühren von einem Kaleidoskop der Assoziationen, stellen Sie sich eine imaginäre Weltreise vor.
Überprüfen Sie die Aufzeichnungen und betreiben Sie eigene Forschungen, beginnen Sie dort, wo das jeweilige Kapitel endet, lassen Sie sich bloß nicht aufhalten, nehmen Sie Atlas, Globus oder eine Weltkarte zur Hand (oder deren elektronischen Varianten) und fahren Sie mit dem Finger durch die Weltgegenden, denen Sie im Buch begegnen, schöpfen Sie Informationen aus Lexika oder elektronischen Informationsquellen. Folgen Sie mir im typischen Zick-Zack-Flug der Insekten kreuz und quer durch Raum und Zeit, erkunden Sie die Welt, lassen Sie sich zum Forschen verführen, finden Sie Schönheit, Freude, Abenteuer, Unsägliches, Spannendes und Grusel.
Der Staufferkaiser Friedrich II, Enkel des großen Friedrich Barbarossa, wurde schon zu Lebzeiten als „stupor mundi“ - „das Staunen der Welt“ genannt –
Staunen Sie !
2 Christina Rückert, Leihgabe an die Uni, Bergedorfer Zeitung12.6.2021
Inhalt
Cover
Vom Sammeln
Händler
Eugéne Le Moult
Franz Heske
Johann Heinrich von Thünen
Vom Wert
Types, Cotypes, Paratypes
Alles begann
Perspektivwechsel
Etiketten
Fisimatenten
Rätselhafte Kürzel
Herrmann
Ochsenheimer
Kelemen
Rakos mezo
Banat
Herkulesbad
Macedonia
Trapezunt
Cherson
Musca domestica L.
Kaukasus
Elisabethpol
Sarepta
Mesopotamien
Elburs - Gebirge
Aulie Ata
Buchara
Samarkand
Croisière Jaune
Beinahe ….
der die das Älteste
Zeitleiste
Novara
Neuholland
Neue Hebriden
Nova Teutonia
Theresopolis
Colonia Hansa
Tring-Museum
Rossitten
Beresina
Napoleons Adjudant
Namen, Namen, Namen
Casablanca
Omo
Niger-Benue
Mohrenfalter
Goliath
Buschmannsland
Kapland
Natal
Transvaal
Orange Colon
Frauen
Asia minor
Versaille 1919
Azoren
Suez
Reise um die Welt
Tahiti
Coromandel
Pionierbivak
Neu Guinea
Diego-Suarez
Usambara
Sansibar
Gouverneur
Lappmark
Finlande
Hedin
Przewalski
Kamtschatka
Alaska
Long134° – Lat66N
Saguenay
New York
Pennsylvania
Dyar
Athos
Pater Marie
Schrein
Jerusalem
Grüße vom Pharao
Mythologe
Die ganze Welt
Blumenthal
Heinrich
von Harling
Escherich / Eidmann
Händler
Länder – Stätten – Gegenden
Lesestoff
Danke
Wer Schmetterlinge lachen hört,
Urheberrechte
Der Schatz - e-book
Cover
Vom Sammeln
Urheberrechte
Wer Schmetterlinge lachen hört,
Der Schatz - e-book
Cover
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
Vom Sammeln
Was sammeln Sie?
Wer die Taschen eines kleinen Kindes revidiert findet so manches Aufgesammelte darin, nicht mehr die Frösche früherer Generationen, doch allerlei von der Straße Aufgehobenes. Auch wir Erwachsenen können es nicht lassen, wer an einem beliebigen Tage am Strand spazieren geht, kann beobachten, wie Jedermann und Jedefrau sich hin und wieder bückt – wirklich Jeder! Ich kenne Niemanden, der nicht irgendetwas sammelt: Muscheln, Kronkorken, Elefanten, Briefmarken, Autos, Gemälde, usf.
Sammeln gehört in unser Leben wie lachen, lieben, Sport treiben, lernen, spielen. Wir sammeln aus Freude, aus Wissendurst, aus Gründen des Ansehens, weil wir Langeweile haben, zu viel Platz - wie auch immer. Der Mensch ist in der Lage, jedem seines Tuns einen Sinn zu geben. Ein Briefmarkensammler sagte einmal zu mir, Briefmarken sind die Gemälde des kleinen Mannes.
Ebenso auch das Horten des Aufgesammelten. Diese sortieren wir dann nach Farben, Formen, irgendein System wird sich schon finden. Über die Ordnung muss sich der Sammler Gedanken machen, sie ist existentiell um Vergleiche anstellen zu können, welches Kriterium ist als entscheidendes Merkmalgeeignet? Farben, Größen, Formen, alphabetisch, nach Sammeldatum, Anzahl der Beine oder Flügel? Diese Frage beschäftigt eigentlich alle Sammler. Die Biologen haben sich da den größten Brocken herausgesucht mit ihrer „Binären Nomenklatur“, nach der sie die Natur heute sortieren. Einst hat sie ein gewisser Carl von Linné ersonnen.
Irgendwann hat man dann also eine Sammlung zusammen, fein sortiert und optisch hübsch aufbereitet. Und dann zeigen wir sie stolz herum – unsere Sammlung. Wir gehen auch in einen Verein, um uns mit anderen Sammlern auszutauschen und zu fachsimpeln.
Schließlich sammeln wir im Namen der Wissenschaft. Je mehr Material desto besser lässt sich die wissenschaftliche Genauigkeit unterlegen, die These begründen oder widerlegen. Immer nur her mit den Steinen, Blättern, Samen, toten Vögeln und Käfern. Bei Spinnen und Schlangen kommt der Gruselfaktor dazu. Man muss nur den Menschen im Naturkundemuseum leise zuhören…
Zum Sammeln wird aber nicht nur Leidenschaft benötigt, auch das nötige Handwerkszeig muss her. Um eine Vorstellung von der Größe der hier gezeigten Objekte zu bekommen, nehmen Sie nur eine Stecknadel zur Hand, Insektennadeln sind lediglich ein wenig länger als normale Stecknadeln. Zur Erleichterung einer Größeneinschätzung wurde, ganz unwissenschaftlich, eine Cent-Münze, ein alltäglicher Gegenstand, in die Fotos integriert. Auch ein, ganz wissenschaftlicher, Maßstab ist gelegentlich zu finden. Für den Fall, dass die Schrift zu klein ist, werden Sie sicherlich eine Lupe heranziehen müssen, dazu schenken Sie sich eine Pinzette. Damit haben Sie dann die wichtigsten Werkzeuge eines Entomologen zusammen: Lupe, Pinzette und Insektennadel
Die Objekte der „Sammlung Thünen“ wurden in einer Zeit gesammelt, in der Jedermann in die Natur ging und sich ihrer erfreute, der Mensch sah sich selbst als Teil der Natur, er war gewissermaßen auf der Erde angekommen, der Wandervogel ward erfunden, die ausgehende Romantik zeigte ihre Folgen, das Interesse an der Natur an sich war entstanden. Man sah sich nicht mehr von dieser getrennt, sondern begann zu begreifen, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und ihren Mechanismen unterlegen wie jedes andere Lebewesen. Man begann nicht nur aus Freude zu sammeln, sondern vor allem wegen der Wissenschaft. Der sinnlich-mythische Zauber von Schmetterlingen, Käfern und Co wandelte sich zum romantischen Dekor, Jagdstimmung kam auf 3). Es war die Zeit der Gründungen von naturwissenschaftlichen Vereinen, in denen man seine Erkenntnisse austauschte, wissenschaftlich forschte und ganz einfach auch vergnügte. Die erste entomologische Gesellschaft wurde bereits 1832 in Frankreich gegründet. Es folgte 1834 das erste Adressbuch von Entomologen. Allein in den Jahren 1860 bis 1914 wurden 88 naturwissenschaftliche Vereine in Deutschland gegründet 4). Alle großen Namen der Naturforschergilden sind und waren in diesen Vereinen vertreten. Es war auch eine Zeit des Abenteuerlebens, der Eroberung der letzten weißen Flecken auf den Landkarten der Welt. Expedition auf Expedition startete in unbekannte Welten, neue Gefilde zu entdecken und Dimensionen des Lebens zu erkunden.
Den größten Anteil am Entstehen von Sammlungen tragen die einfachen Sammler bei. Dann sind da diejenigen begeisterten Menschen, die ihre Mußestunden neben ihrem Beruf nutzen, um wissenschaftlich über Insekten zu arbeiten. Und schließlich die Händler, die alles vermischen und zu Geld machen.
Sammlungen verbinden uns mit der Geschichte. Jeder hat den Wunsch, der Nachwelt etwas zu hinterlassen, erst wenn uns nachkommende Generationen vergessen haben, sind wir wirklich tot. Sammlungen stellen aber auch einen Schatz dar, der uns die Vergangenheit lehrt und lehren kann.
Und so ist es nur folgerichtig, diese Sammlungen auch nach dem Sammler oder Besitzer zu benennen. Als weitere Folge von Sammeln, tauschen, schenken und handeln entsteht eine Sammlung, in der dann auch Teile anderer Sammlungen enthalten sind. Auf den kleinen Schildchen sind dann Begriffe wie „col“ oder „Coll“ für Collection, oder „ex Museo“ für „aus der Sammlung“, gefolgt von dem Namen des ursprünglichen Sammlers aus dessen Bestand das kleine Objekt stammt, zu finden. Auch manchmal nur ein „ex“ mit dem Namen des Sammlers. Auch lassen sich Wanderungen einzelner Objekte feststellen. In diesen selteneren Fällen finden sich 2 oder noch mehr „ex“. Wer diesen Wanderungen folgt, kann unerwartete Verbindungen und ein ganzes Netzwerk aufdecken.
3 Wiemers, Carola, Nur ein Flügelschlag, 1.4.2014 Deutschlandfunk
4 Daum, Wissenschaftspopularisierung 2002
Händler
Gewöhnlich sammelt also ein einzelner Mensch und wenn er genug gesammelt, keine Lust mehr hat oder gar verstorben ist, wird die Sammlung verschenkt, verkauft, vererbt, manchmal weggeworfen. Erben wiederum machen dasselbe.
Üblicherweise tragen Sammlungen demnach auch den Namen des oder derjenigen, die diese zusammengesammelt haben. Wir haben es also mit e i n e m Sammler zu tun. Wenn also Jemand etwas loswerden will, kann er es fortwerfen, verschenken, oder verkaufen in der Annahme, Jemand Anderer sieht darin denselben Wert wie er selbst. Man wendet sich deshalb an einen Händler
Händler sind Menschen, die kaufen und verkaufen, damit den Warenfluss in Gang setzen und halten und dazwischen ihren Gewinn abschöpfen. Ebenfalls sind umgekehrt Insekten auch Mittel zum Gelderwerb geworden. So werden also Insekten gehandelt. Früher wie heute. Nur die Handelsplattformen haben sich geändert, heute ist das Internet die Plattform schlechthin zum Kauf oder Verkauf von Allem. Dennoch gibt es hier und da immer noch Tauschmessen, die bekannteste und größte dieser Insektentauschmessen in Europa findet 1 bis 2 x jährlich in Prag statt.
Viele dieser Händler gibt es nicht mehr, der 2. Weltkrieg hat nicht nur viele Sammlungen zerstört, sondern auch diese Handelsstrukturen. Dazu kommt die in den vergangenen Jahren sich immer rasanter entwickelnden Medien und damit Möglichkeiten.
In der Bilanz am Ende des Büchleins findet sich eine Liste der Händler, die als solche identifiziert werden konnten und durch deren Hände mindestens ein Objekt der in der Sammlung „Thünen“ enthaltenen Objekte gegangen sind. Oftmals handelt es sich selbst um Sammler, die sich ihrerseits von eigenen gesammelten Beständen trennen wollten.
Von einem der größten Händler seiner Zeit, Eugéne Le Moult aus der Welt- und Lichterstadt Paris, stammt der Großteil der hier untersuchten und dokumentierten Sammlung.
Eugéne Le Moult
Name: Drypta Crampeli, Alluoud
Fundort: Fort-Crampel, Congo-Francaise
Sammler: Alluaud det.
Vor-Eigentümer: Coll K.
Eigentümer: Coll de Le Moult
Co-Type
Die vorliegende Sammlung „Thünen“ stammt überwiegend aus dem Bestand des französischen Naturforschers, Jäger, Sammler und Händler Eugéne Le Moult (1882-1967) 4, Rue Duméril, Paris.
Aufgewachsen in Französisch Guayana, einer französischen Strafkolonie, spezialisierte er sich früh auf die leuchtend blauen Morpho-Schmetterlinge. Er sammelte die blauen Falter wahrhaft exzessiv und verkaufte sie mit großem Erfolg in das französische Mutterland in Europa.
Er galt in seiner Zeit als der größte Insektenhändler der Welt. Zugleich entwickelte sich Le Moult zum weltweit anerkannten Spezialisten für Morpho-Schmetterlinge. So verfasste er zusammen mit Pierre Réaleine eine Überarbeitung des Taxons „Les Morpho d´ Ameriquew du Sud et Centrale“, Paris 1962-1963.
Das berühmteste Portrait von ihm stilisiert ihn ganz bewusst im Stil eines Heiligenbildes mit dem Schmetterlingsnetz als Heiligenschein drapiert.
Sein Schmetterlingsexport war Anfang des 20. Jahrhunderts neben den Ausfuhren an Tropenhölzern und Gold der drittgrößte Exportschlager Französisch Guayanas. Zu seinen Kunden gehörten die großen Museen in Europa und Amerika wie auch Privatsammler, so auch der japanische Kaiser Hirohito und der Sohn des russischen Ministerpräsidenten Chruschtschow.
Seine Sammlung Morphofalter galt als die viertgrößte der Welt. Allein seine Schmetterlingssammlung soll nach seinem Tod auf eine Million Exemplare geschätzt worden sein.
Franz Heske
Franz Heske wurde 1892 in Frauenberg, Böhmen geboren und studierte Forstwissenschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien.
Er gründete 1931 das „Institut für ausländische und koloniale Forstwirtschaft“ im sächsischen Tharandt, wo er als Direktor des „Instituts für Forsteinrichtung“ und als Professor für Forstwissenschaft an der Forstlichen Hochschule tätig war.
Hier ersann er auch 1932 die Zeitschrift für Weltforstwirtschaft. Mit seinen Arbeiten zu Leitlinien für die Holznutzung, den Waldbau sowie speziell für die Walderhaltung in den Tropen, gab er der Weltforstwirtschaft entscheidende Entwicklungsimpulse
Auf Weisung von Reichsforstmeister Hermann Göring wurde das Institut dann 1937 zur Reichsanstalt erklärt und 1940 als „Reichsinstitut für ausländische und koloniale Forstwirtschaft“ in das Schloss nach Reinbek bei Hamburg verlegt.
1943 leitete Franz Heske am Deutschen Institut im besetzten Paris die Abteilung Forstwirtschaft und Bodenkunde. Hier dürfte er den Insektenhändler Le Moult und auch dessen Berufskollegen Deyrolle und Henri Beureau und andere mehr kennen gelernt haben.
Basierend auf dem im ausgehenden Mittelalter entstandenen Grundsatz der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft übertrug Franz Heske den Gedanken der Nachhaltigkeit auch auf andere Bereiche des Lebens und entwickelte 1954 daraus die philosophische Denkrichtung der „Organik“. Unter nachhaltiger Forstwirtschaft ist die Betreuung von Waldflächen auf eine Art und Weise und in einem Maße zu verstehen, als dass die Produktivität, die Bodenertragskraft, die Verjüngungsfähigkeit und Vitalität der Waldflächen nicht nur erhalten, sondern auch verbessert werden.
Ferner beleuchtet Heske in seiner Philosophie die Rolle des moralischen oder ethischen Wächters über die Ausführung wissenschaftlicher Erkenntnisse: muss man alles das machen, was aus wissenschaftlich-technischer Sicht machbar ist? Die mit der Naturwissenschaft eng verbundene Möglichkeit, durch Technik das gesellschaftliche wie auch das individuelle Leben zu beeinflussen stellt jeden Wissenschaftler in die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Arbeit.
„Die Auffassung des Weltgeschehens nur als (mechanisches) ERGEBNIS, nicht als AUFGABE oder Weg zu einem Ziel, förderteher die epikuräische als eine heroische Lebensanschauung und der vorwiegenden Ansicht der Welt als Nebeneinander, nicht als Miteinander, liegt ein egozentrischer Individualismus näher, als ein dienendes Aufgehenlassen des Ich in einem übergeordnet gedachten Gefüge. Das Jetzt und Hier steht im Vordergrund, und die Atomisierung des raumzeitlichen Kontinuums fördert die Neigung, die Interessen im ich und in der Gegenwart zu konzentrieren.[..] Eine Weltanschauung, die das Leben nicht nur als Ergebnis, sondern auch als Aufgabe sieht, und den Eispanzer sprengt, den der moderne Atheismus um das unbefriedigt gebliebene Menschenherz gelegt hat, indem sie der Religion den Weg in jene Bezirke der Erlösersehnsucht freiläßt, die eine noch so machtvolle Technokratie niemals erfüllen kann und die schließlich im Leben des gewachsenen menschlichen Gesellschaftswesens die zwei unerläßlichen Voraussetzungen menschenwürdigen Daseins, nämlich Freiheit und Einordnung in einer neuen Synthese vereinigt, im Sinne der organischen „suum cuique“ (Jedem das Seine) anstelle des mechanischen „Allen das Gleiche“.“5)
Damit schuf er die gedankliche Grundlage des erst in den 1990er Jahren vermehrt aufgekommenen Gedankens einer allgemeinen nachhaltigen Lebensweise und Nachhaltigkeitswissenschaft.
Bis zu seiner Emeritierung 1956 blieb Franz Heske Leiter der aus dem Reichsinstitut umgewandelten „Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft“ (BFH). Von 1957 bis 1961 fungierte Franz Heske als Generalforstmeister in Äthiopien, nachdem er schon zuvor längere Zeit in den USA, Indien und der Türkei tätig war.
Das Erbe Franz Heskes besteht, die Bundesforschungsanstalt für Forstwesen wurde 2008 mit den Forschungsanstalten für Landwirtschaft und Fischereiwesen zum „Johann-Heinrich von Thünen-Institut für ländliche Räume, Wald und Fischerei“ im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtshaft (BMEL) zusammengelegt.
Franz Heske kaufte diese Insektensammlung damals in dem Wunsche, Anschauungsmaterial forstwirtschaftlich relevanter Insekten als Beleg- und Studienmaterial verfügbar zu haben. Ein weiterer Grund könnte in der Vernichtung der Sammlungen des Hamburger Naturkundemuseums durch dessen Zerstörung 1943 zu suchen sein, denn es befinden sich unter der Eingangsnummer ZMH 1.1957 ca. 247.000 weitere Exemplare von Le Moult in der Sammlung des Zoologische Museums.
5 Heske, Franz, Organik, Berlin 1954
Johann Heinrich von Thünen
Namengeber der Sammlung ist also der Eigentümer, das „Johann-Heinrich von Thünen-Institut für ländliche Räume, Wald und Fischerei“.
Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) hat gewiss einige Steine aufgehoben, jedoch nicht um darunter nach Käfern zu suchen. Auch ist er nicht über Wiesen und Felder gesprungen um mit einem Netz Schmetterlinge einzufangen. In seinem Nachlass wurde keine Insektensammlung gefunden.
J.-H- von Thünen war das, was wir heute als einen Sozialreformer bezeichnen. Basierend auf den Theorien des Aufklärers Adam Smiths beschäftigte ihn die Frage der Alterssicherung bäuerlich lebender Menschen, also der heutigen Landwirte. Smith beschäftigte sich in seinem Werk „Der Wohlstand der Nationen“ (1764) mit Fragen zur Rolle und Funktion des freien Marktes, der Bestimmung vom Wert der Arbeit, des Profites, des Lohns, produktiver und unproduktiver Arbeit, der Funktion von Arbeit und Arbeitsteilung. Letztlich auch mit der Frage von der Wirkung und der Rolle des Staates.6)
Als Sohn des Gutsbesitzers Edo Christian von Thünen in Hooksiel brachte er die denkbar besten Voraussetzungen dazu mit. Nach seiner Grundschulzeit in Hooksiel und Jever absolvierte er eine landwirtschaftliche Ausbildung auf verschiedenen Gütern und unter Anleitung damaliger renommierter Fachleute wie Lukas Andreas Staudinger in Groß Flottbek bei Hamburg und Albrecht Daniel Thaer in Celle. Schließlich schloss er seine Ausbildung mit 2 Semestern Landwirtschaft an der Uni Göttingen ab. 1809 erwarb er das 465 ha große Gut Tellow bei Teterow in Mecklenburg.
Ihn beschäftigten vor allem Fragen zur Bodenfruchtbarkeit und die Entstehung des Getreidepreises. In Anlehnung an die aktuellen politischen Geschehnisse – die Staatenbildung in Europa war in vollem Gange - ging er von der Annahme des landwirtschaftlichen Betriebes als eines abgeschlossenen wirtschaftlichen Gebildes, eines Staates, aus, der sich im Geflecht von Herstellungsbedingungen, landwirtschaftlicher Produktionsbedingungen und Marktgeschehen behaupten muss. Er untersuchte die Beziehungen zwischen Kapital, Einkommen und Marktpreis der Ware. Dazu führte er auf seinem Gut akribisch Buch über alle Ausgaben und Einnahmen, Bodenbeschaffenheit, eingesetzter Arbeitskraft der Menschen und ihrer Maschinen. Aus seinen Erkenntnissen entwickelte er 1826 die Theorie des „Isolierten Staates“, in dem er den Mindestpreis eines Agrarproduktes aus der Lagerrente (Marktpreis pro ha), den Transportkosten und fixen Produktionskosten (Löhne, Maschinen) errechnet und in dem Modell der „Thünenschen Kreise“ oder „Ringe“ 1842 zusammenfasste:
Im Zentrum steht dabei der Gebäudekomplex des landwirtschaftlichen Betriebes. Direkt daran liegen die Obst- und Gemüseflächen, die regelmäßige und intensive Pflege bedürfen, „Sonderkulturen“ sagen wir heute dazu. Darauffolgend ein Gürtel für Nutzholz (damals notwendiges Bau- und Heizmaterial). In immer größeren Abständen folgen kreisförmig die Flächen für intensiven Ackerbau wie Kohl- und Kartoffelanbau, Milchweidewirtschaft, Getreideanbau als 3-Felder-Wirtschaft sowie am Rand die extensive Viehwirtschaft wie Almen und Heuflächen.
Thünen gilt damit als Begründer der landwirtschaftlichen Betriebslehre und darauf fußend der heutigen Raumwirtschaftstheorie, die inzwischen auch in der modernen Stadtökonomie Anwendung findet.
Bereits 33 Jahre nach von Thünens Tod, am 15. Juni 1883, verabschiedete der Reichstag auf Initiative Otto von Bismarcks ein Gesetz zur Krankenversicherung für Arbeiter. Ihm folgte dann 1889 die Verabschiedung des Gesetzes über Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter. Diese Gesetze wurden später auf Angestellte erweitert und haben heute noch ihre Gültigkeit.
Die im September 1990 in Tellow gegründete „Thünengesellschaft e. V.“ wurde eigens zur Bewahrung, Aufarbeitung und Bekanntmachung seines Vermächtnisses geschaffen.
6 Zitelmann, Rainer, Der Kampf gegen Klimawandel gelingt nicht mit Planwirtschaft, Adams Smith zum 300. Geburtstag, 3.7.2023 Focus Online
Vom Wert
1.725.000,- Reichsmark –
soooviel Geld wurde von Dr. Franz Heske im Jahr 1944 an den Händler Eugene le Moult via südamerikanischer Bank gezahlt, nebst Vermittlungs- und anderen Gebühren.
Das sagt erst mal nicht viel aus. Man muss sich die Kaufkraft dieses Betrages ansehen. Erst dann ist das mit unserer aktuellen Währung vergleichbar, dann wird dieser Betrag greifbar. Als Kaufkraft oder Kaufkraftäquivalent bezeichnet man denjenigen Geldbetrag, der aufgewendet werden muss für den Kauf eines alltäglichen Gegenstandes, z.B. ein Pfund Butter. Diesen Vergleich hat die Bundesbank 7) schon für uns gemacht und veröffentlichte im Januar 2024 eine aktualisierte Tabelle namens „Kaufkraftäquivalente historischer Beträge in deutschen Währungen“ dazu im Internet:
Als Umrechnungsbetrag ist für 1944 angegeben € 4,60. Das heißt: für eine Reichsmark aus dem Jahr 1944 müsste man heute € 4,60 auf die Theke legen. Daraus folgt:
1.725.000 RM entsprechen 7,935 Millionen Euro
Käme heute Jemand auf die Idee, noch einmal soooo viele Euros für rund 63.000 tote Insekten auszugeben?
Da diese Frage bisher nicht gestellt wurde und auch nicht absehbar ist, dass sie sich stellen wird, ist es müßig darüber zu spekulieren.
Dennoch. Was mag den Käufer bewegt haben, diesen Betrag zu bezahlen? 1944, nach 5 Jahren Krieg, ohne Aussicht auf ein Ende, war viel Geld in Umlauf, es gab jedoch immer weniger dafür zu kaufen 8). Also, warum nicht dem Fachinstitut eine schöne Sammlung kaufen, war doch ein Jahr zuvor das Zoologische Museum Hamburg ausgebrannt und damit ein Großteil der Sammlungen in Flammen aufgegangen?
Was macht denn überhaupt den Wert einer solchen Insektensammlung aus? Schönheit? Ist relativ und unwissenschaftlich. Lehrmaterial – kann man vor der Tür finden. Seltene Arten - möglich. Gelegenheit – auf jeden Fall. Und - vor allem: Typen. Als Typen werden diejenigen Exemplare bezeichnet, an denen eine Art erstmalig beschrieben wurde. Diese „Ur“ Exemplare werden weltweit in Tresoren verwahrt und stellen die eigentlichen Werte der Sammlungen dar. Aktuell laufen weltweite Bemühungen, diese Exemplare aus allen Tier- und Pflanzenarten zu katalogisieren und damit der internationalen Forschergemeinschaft verfügbar zu machen.