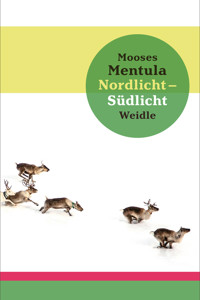Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weidle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tino geht auf die Vierzig zu, hat es aber zu nichts gebracht. Die Aufnahmeprüfungen für die Universität hat er vergeigt, und seine berufliche Laufbahn als Straßenbahnfahrer endete am ersten Arbeitstag mit einem psychotischen Schub. Seitdem treibt er, unterstützt von Psychopharmaka, ohne Ziel und Perspektive durchs Leben. Gelegentlich versucht er sich an Fortbildungsmaßnahmen des Arbeitsamtes, die er jedoch allesamt abbricht. Er ist zutiefst menschenscheu, meidet Begegnungen und Anforderungen jeder Art und begnügt sich damit, in seiner Einzimmerwohnung den Live-Stream eines schwedischen Aquariums zu verfolgen. Bewegung kommt in sein Leben, als er auf dem Weg zum Bierholen im Supermarkt auf eine Frau und ein kleines Mädchen trifft. Die Vierjährige bedrängt ihn mit ihrer Neugier so, daß Tino davonläuft und in einen Trödelladen flüchtet. In seiner Wehrlosigkeit läßt er sich vom pockennarbigen Besitzer im Trenchcoat den Panzer einer riesigen Schildkröte andrehen und dazu eine Tüte mit Büchern. Tino schleppt nach Hause, was eines der Leitmotive des Romans werden wird: den Schild, dessen Kröte er nun ist. Die Tüte mit Büchern aber verleiht seinem Leben eine neue Dynamik. Er beginnt, die Geschichten, in die er nun eintaucht, selbst weiterzuerzählen. Sie gehen in sein Leben über. Zu seiner Unterstützung erscheinen in der Messiwohnung plötzlich Figuren wie Charles Bukowski, Jack Kerouac und Jane Austen als mit allen Wassern der Plot-Entwicklung gewaschene Schutzengel. »Der Schildkrötenpanzer« (»Toiset meistä«) ist ein vielschichtig unterhaltender Roman, dessen Botschaft unüberhörbar lautet: Schreibe deine eigene Geschichte! Und vor allem lebe sie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Tino geht auf die Vierzig zu, hat es aber zu nichts gebracht. Die Aufnahmeprüfungen für die Universität hat er vergeigt, und seine berufliche Laufbahn als Straßenbahnfahrer endete am ersten Arbeitstag mit einem psychotischen Schub. Seitdem treibt er, unterstützt von Psychopharmaka, ohne Ziel und Perspektive durchs Leben.
Dies ändert sich, als er auf dem Weg zum Bierholen im Supermarkt auf eine Frau und ein kleines Mädchen trifft. Die Vierjährige bedrängt ihn mit ihrer Neugier so, dass Tino davonläuft und in einen Trödelladen flüchtet. In seiner Wehrlosigkeit lässt er sich vom pockennarbigen Besitzer im Trenchcoat den Panzer einer riesigen Schildkröte andrehen und dazu eine Tüte mit Büchern. Tino schleppt nach Hause, was eines der Leitmotive des Romans werden wird: den Schild, dessen Kröte er nun ist. Die Tüte mit Büchern aber verleiht seinem Leben eine neue Dynamik. Er beginnt, die Geschichten, in die er nun eintaucht, selbst weiterzuerzählen. Sie gehen in sein Leben über. Zu seiner Unterstützung erscheinen in der Messiwohnung plötzlich Figuren wie Charles Bukowski, Jack Kerouac und Jane Austen als mit allen Wassern der Plot-Entwicklung gewaschene Schutzengel.
»Der Schildkrötenpanzer« (»Toiset meistä«) ist ein vielschichtig unterhaltender Roman, dessen Botschaft unüberhörbar lautet: Schreibe deine eigene Geschichte! Und vor allem lebe sie!
Über den Autor
Mooses Mentula, 1976 geboren, hat lange in Nordfinnland und Lappland gelebt. Schon als Jugendlicher arbeitete er als Journalist für Printmedien und Hörfunk. Er studierte Pädagogik an der Universität von Lappland. Heute leitet er in der Nähe von Helsinki eine Schule. Sein erster Roman, »Nordlicht ― Südlicht« (»Isän kanssa kahden«), Deutsch von Antje Mortzfeldt, erschien 2014 im Weidle Verlag. Stefan Moster, geboren 1964 in Mainz, lebt als Autor und Übersetzer in Berlin und Porvoo (Finnland). Er hat an den Universitäten München und Helsinki unterrichtet und übersetzt seit 1993 finnische Literatur aller Gattungen. Dafür ist er u. a. mit dem Finnischen Staatspreis für Übersetzer ausgezeichnet worden. Als Autor schreibt er hauptsächlich Prosa. Seine Romane sind im mareverlag erschienen, zuletzt »Alleingang« (2019).
Mooses Mentula
Der Schildkrötenpanzer
Roman
Aus dem Finnischen von Stefan Moster
Weidle Verlag
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Weidle Verlag, Göttingen 2025
Wallstein Verlag GmbH
Geiststr. 11, 37073 Göttingen
www.wallstein-verlag.de
Der Weidle Verlag ist ein Imprint der Wallstein Verlag GmbH.
Die Originalausgabe, Toiset Meistä, erschien 2020.
Copyright © Mooses Mentula, 2020
Original edition published by WSOY, 2020
German edition published by agreement
with Mooses Mentula and Elina Ahlback
Literary Agency, Helsinki, Finland.
Die Übersetzung wurde gefördert von:
FILI Finnish Literature Exchange
Dank an Ritva Röminger-Czako
Lektorat: Stefan Weidle
Korrektur: Barbara Weidle
Gestaltung und Satz: Friedrich Forssman
Einband: Greta von Richthofen
ISBN (Print) 978-3-8353-7531-4
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-7723-3
Inhaltsverzeichnis
Der Inhalt von Tinos Büchertasche:
Bukowski, Charles: Schlechte Verlierer
Genet, Jean: Querelle
Kerouac, Jack: Unterwegs
London, Jack: Südsee-Geschichten
Im Roman ebenfalls erwähnt:
Austen, Jane: Stolz und Vorurteil
Orwell, George: 1984
Poe, Edgar Allan: Der Rabe
Some people are writers
Others avid readers
Some absorb like vampires
And some are bleeders
Peter Perrett
Wenn der Vorwurf erhoben wird,
es sei etwas nicht wirklichkeitsgetreu
dargestellt, dann kann man vielleicht
einwenden, es sei dargestellt,
wie es sein sollte.
Aristoteles
ERSTER TEIL
1
Staubteilchen schwebten im gestreiften Sonnenlicht vor der Jalousie. Die verkalkte Kaffeemaschine pröttelte, und der Kühlschrank seufzte verdrossen. Vor dem einst orange gestrichenen, inzwischen aber verblaßten Küchenschrank stand ein runder Tisch, an dem ein Mann, der sich in Boxershorts mit Simpsons-Figuren gehüllt hatte und dessen Haare in alle Himmelsrichtungen abstanden, in eine Scheibe Roggenbrot biß.
Tino nahm geräuschvoll einen Schluck heißen Kaffee und blätterte weiter in der Gratiszeitung, die vor ihm auf dem Tisch lag. Auf der Doppelseite in der Mitte wurde von einem Zwanzigjährigen berichtet, der vorhatte, mit dem Fahrrad nach Südamerika zu fahren. Der breit lächelnde junge Mann mit dem Ziegenbart, der seinen Schnäuzer mit Wachs zu Spießen gespitzt hatte, meinte, die Zeit für so ein Abenteuer sei gut, weil er noch keine Familie, keine feste Arbeit und auch sonst keine Verpflichtungen habe.
Tino knüllte die Zeitung zusammen und warf sie in die Ecke, wo bereits ein Satz Pizza-Schachteln von zwei Wochen und diverse Saftpackungen lagen. »Keine Verpflichtungen.« Wie konnte jemand so etwas denken? Die Erfahrung hatte Tino gezeigt, daß das Leben vor allem aus Verpflichtungen, Voraussetzungen, Erwartungen, Forderungen und Bedingungen bestand. Das erwies sich sogar bei so alltäglichen Verrichtungen wie dem Gang zum Supermarkt: Zu den Pflichten des Kunden gehörte es, einen Mehrwegbeutel anstatt einer Plastiktüte zu benutzen; wenn man in dem Laden häufiger zu tun hatte, wurde vorausgesetzt, daß man eine Kundenkarte durch den Schlitz zog; fast schon eine Forderung war es, den Riegel aufs Band zu legen, um die eigenen Einkäufe von denen des folgenden Kunden zu trennen (aber verdammt, war es jetzt die Aufgabe der vorderen oder der hinteren Person, das Trennholz zu plazieren?). Und es wurde verlangt, daß man als Kunde die Angestellten in einem Ton grüßte, der von korrekter Höflichkeit, aber nicht von übertriebener Vertraulichkeit geprägt war.
Tino erinnerte sich, einmal gelesen zu haben, der antike Philosoph Demokrit habe als erster die noch immer herrschende Auffassung formuliert, daß sich das Weltall aus Atomen zusammensetzte. Totaler Scheißdreck! Die eigentlichen Elementarteilchen waren Pflichten, Voraussetzungen, Erwartungen, Forderungen und Bedingungen. Schon hatte sich in Tinos Körper die übliche Spirale in Gang gesetzt, die ihn direkt von der Couch zum Marathon und von der Zeitung zum Kampf mit einem Bären führte. Sein Herz pochte, seine Lunge verlangte nach Sauerstoff, und gleichzeitig stockte ihm der Atem.
Er fingerte ein Röhrchen aus dem Gewürzregal, das als Medikamentenschrank diente, kippte eine Tablette auf die flache Hand und legte sie sich weit hinten auf die Zunge. Ein Schwall Kaffee beförderte die Pille auf ihre innere Reise in Richtung Magen. Tino schaltete den großen Bildschirm ein, setzte sich auf die Couch, zog die Beine an und schlang die Arme um die Knie. Auf dem Monitor erschien das vertraute Bild des Aquariums. Flinke, farbige kleine Fische schwammen im Schwarm in ihrem Becken umher, drei schnurrbärtige Welse saugten Algen von den Steinen und dem Miniaturmodell eines Schiffswracks, Goldfische schwenkten träge ihre schleierartigen Flossen. Tino versuchte sich in die Beobachtung der Fischbewegungen zu versenken, anstatt an die bedrückende, festgefahrene Gesamtsituation zu denken, in der er sich befand und sich bemühte, Unterwasserwesen zuzuschauen.
Die hypnotische Wirkung des Streams aus Schweden hatte er zufällig beim Surfen in den Tiefen des Internets entdeckt, in einer Novembernacht, der ein schwieriges Telefonat mit seinen Eltern vorausgegangen war. Damals hatte er damit gerechnet, vor Aufregung und Ärger die ganze Nacht nicht schlafen zu können, aber es hatte ihn beruhigt, den Fischen beim Schwimmen zuzusehen. Das Aquarium ließ ihn ans Meer und dessen stille, dunkle Welten denken. Erst ein Zehntel der Ozeane war bislang erforscht, es gab in ihnen also Millionen Kubikmeter an unschuldigem Raum.
Zunächst hatte Tino mit dem Gedanken gespielt, sich ein eigenes Aquarium anzuschaffen, davon aber Abstand genommen, als er an die Verantwortung dachte, die das Versorgen der lebendigen Wesen mit sich bringen würde. Ihm genügte es, den Fischbehälter jener Familie in Uppsala anzuschauen (im Link des Streams wurde der Standort der Kamera genannt, und auf dem Glas waren im Lauf der Jahre flüchtig Hände aufgetaucht, die der Größe sowie dem Gepflegtheitsgrad der Nägel nach zu schließen einem Mann, einer Frau und zwei Kindern gehörten).
Knapp eine Stunde später hatte das Aquarium seinen Zweck erfüllt. Tinos Atem ging normal, und sein Herz verrenkte sich nur noch selten. Er stellte die zerlaufene Margarine in den Kühlschrank zurück, der abgesehen von zwei Kartoffeln und drei Dosen Bier leer war. Die Gerstengetränke ordnete er in einer Reihe auf dem Tisch an und bereitete sich mit ihrer Hilfe auf den Gang in die Außenwelt vor. Das erste Getränk spülte eiskalt die Innereien durch. Laut Anweisung des Arztes durfte man zu den Medikamenten keinen Alkohol genießen. Aber hier ging es nicht um den Genuß; ein paar schnell geschluckte Biere stumpften lediglich genügend ab, um einkaufen gehen zu können. Die ausreichende Dosis bestand aus drei Büchsen vorher zur Ermutigung und drei hinterher, um den Teufelskreis der Panik zu brechen. Das zweite Bier wurde ebenso roboterhaft geleert wie das erste.
Tino zog die Jacke an, vervollständigte seine Garderobe mit Blues-Brothers-Sonnenbrille und Kapuze, deren Zweck nicht so sehr darin bestand, das Eindringen von Licht zu begrenzen oder den Kopf zu wärmen, sondern eher darin, die Außenwelt eine Linsen- und Stoffbreite weit von sich fernzuhalten. Im Flur schüttete er die dritte flüssige Arznei in sich hinein, bevor er durch den Türspion lugte und horchte, ob auch niemand im Treppenhaus war. Dann trat er aus der Wohnung, eilte mit großen Schritten vom dritten Stock die Treppe hinunter (den Fahrstuhl zu benutzen war eine unerträgliche Vorstellung; es kam nicht in Frage, mit einem anderen Menschen auf engem Raum zusammenzustehen) und machte sich auf dem Weg zu Alepa.
Es regnete nur leicht, aber die Tropfen waren so groß wie mit Wasser gefüllte Ballons. In einiger Entfernung kam ihm ein Kind auf einem Fahrrad samt hinterherhumpelnder Mutter entgegen. Dem Kind fehlte die Geduld, langsam zu fahren, und die Mutter befahl ihm darum immer wieder, zu bremsen. Meter für Meter kamen sie näher. Tino prüfte mit dem Zeigefinger, ob er die Brille aufhatte, und starrte stur einen Meter vor sich auf den Asphalt. Ein fingerdicker Regenwurm pumpte sich vorwärts. Die Herzschlagintervalle wurden dichter, ihm stockte der Atem, und Schweiß lief ihm in den Nacken.
Kinder waren unberechenbar, sie konnten durchaus jemanden ansprechen, den sie nicht kannten. Sie schauten einen mit munteren Augen an, feixten und verlangten eine Reaktion. Dann mußte man in der Lage sein, spannend, witzig und fürsorglich mit ihnen zu sprechen, so daß es für die Kinder unterhaltsam war und zugleich den Eltern in der Nähe vermittelte, daß der fremde Erwachsene ungefährlich für ihre Kinder war und Respekt vor dem Resultat ihrer Erziehung hatte.
»Guck mal, Mama, der da hat eine Sonnenbrille auf, obwohl es regnet«, sagte das Mädchen.
Tino zog die Schultern hoch und den Kopf in den Kragen. Das Mädchen hatte ihn bereits erreicht, und auch die Mutter suchte wahrscheinlich schon den Blickkontakt, um ein Kinder-sind-Kinder-Lächeln zu tauschen.
»Warum hast du eine Sonnenbrille auf?« wollte das Mädchen wissen.
Es klang neugierig und lieb. Tino hätte gern freundlich geantwortet, mit der Mutter ein paar ironische Kommentare über das Wetter gewechselt und gutgelaunt seinen Weg fortgesetzt. Statt dessen wandte er den Blick ab und beschleunigte seine Schritte.
»Bist du blind?« hakte das Mädchen nach.
»Laß den Onkel in Ruhe«, sagte die Frau.
Tino blickte in Richtung Frau und konnte gerade noch ihre freundlichen Augen und ihr Lächeln sehen, als sein Kopf auch schon anfing zu zittern. Im Laufschritt ging er weiter.
Um ein Gefühl für die Beklemmung, die Tino befiel, zu bekommen, kann man sich eine Situation vorstellen, in der man vor Publikum eine wichtige Rede halten soll, obwohl man außer Atem ist wie nach einem Cooper-Test, in der Tasche statt dem Redemanuskript eine Telefonrechnung findet und im letzten Moment merkt, daß der Hosenstall offen steht. Das Herz hämmert, man kann weder ein- noch ausatmen, die Augen quellen hervor, das Sichtfeld trübt sich ein, Schweiß rinnt über die Schläfen, der Kopf zittert, und gleich soll man sprechen. Ein ähnliches, jedoch mit Worten nicht zu fassendes Gefühl überkam Tino in ganz gewöhnlichen Situationen, in denen man sich auf etablierte Weise verhalten mußte und ein natürlicher Rückzug nicht möglich war, zum Beispiel an der Supermarktkasse, vorm Geldautomaten, im Treppenhaus, wenn man einem Nachbarn begegnete, oder beim Anruf eines Telefonverkäufers. Zu den schlimmsten Orten gehörte der Friseursalon: Man konnte nicht einfach so vom zäh knirschenden Lederstuhl aufspringen und im Umhang und halb frisiert davonrennen, wenn man nach den Urlaubsplänen oder dem Arbeits- oder Studienplatz gefragt wurde. Darum durften Tinos Haare auch seit Jahren ungehindert sprießen.
Das Mädchen hatte sich umgedreht und folgte ihm. Auf seinem mit Marienkäfern verzierten Fahrrad hielt es gut mit. Tino beschleunigte, aber die Stützräder schnurrten, und das Mädchen blieb ihm hartnäckig auf den Fersen.
»Tuuli, hierher!« rief die Mutter.
Die Göre kümmerte sich nicht darum. Sie klebte an ihm wie ein Dialoger in der Fußgängerzone und wollte alles mögliche wissen. Tinos Blickfeld verengte sich zum Kegel, sein Brustkorb zog sich zusammen. Die Mutter rief nach ihrem Kind und versuchte es einzuholen, aber weil sie humpelte, kam sie nur langsam vorwärts. Tino mußte das Mädchen selbst dazu bringen zu verschwinden.
»Hää!« krächzte er und zeigte der Kleinen die Zähne.
Das Mädchen bremste schlagartig und rief mit weinerlicher Stimme nach seiner Mutter. Tino rannte weiter bis zu Alepa, stützte die Hände auf die Knie und verschnaufte. Die Panik ließ nach, aber Scham und Enttäuschung traten an ihre Stelle. Wegen ihm hatte sich das kleine Mädchen erschreckt. Das Weinen hallte in Tinos Ohren nach. Er kniff die Augen zusammen und sagte innerlich, daß er sich keine Vorwürfe für etwas machen mußte, für das er nichts konnte.
Durch die Klebefolien am Fenster konnte man die Kasse sehen, an der an diesem Tag eine Person saß, die Tino nicht kannte. Gut so. Beim letzten Einkauf hatte nämlich ein Verkäufer, der sich ständig räusperte, ein vertrauliches Geplauder angestimmt: »Tja, nun steckt Finnland doch nicht in der Hitzeklemme, obwohl der Wetterfrosch es fest versprochen hat.« Beim nächsten Mal würde der Mann das Gespräch schon ganz selbstverständlich aufs Kommentieren von Sportereignissen ausdehnen, dann auf die Politik und schließlich auf persönliche Themen.
Vorsichtig öffnete Tino die schwere Glastür, damit die daran befestigte Kuhglocke nicht schellte, schnappte sich einen Einkaufskorb zum Ziehen und machte sich ans Einsammeln: eine Packung Feiertagsmokka, zwei Liter fettarme Milch, sieben Bananen, Fischstäbchen, Hackfleisch, eine Dose Erbsensuppe, eine Doppelpackung Mexicana-Tiefkühlpizza, eine Gurke, Roggenbrot in Scheiben, Kochschinken, ein Liter Erdbeerjoghurt, anderthalb Liter Cola, eine Tüte ABC-Weingummis und ein Sixpack Bulkbier.
Er tat so lange, als inspiziere er die Produkte in der Tiefkühlwanne, bis keine Schlange mehr an der Kasse stand. Dann versuchte er, der Verkäuferin zuzunicken, aber die Bewegung fiel zu weich aus und konnte nicht als Gruß identifiziert werden. Wäre es möglich, sie zu wiederholen? Er gab den Gedanken schnell auf und schaufelte bloß die Einkäufe aufs Gummiband.
»Hier fehlt der Preis.«
Die Verkäuferin ließ die Chiquita-Staude an den Fingern baumeln. Auf ihren hellroten Nägeln klebte Glitter.
»Was machen wir?«
Wie, was machen wir? Was waren die Alternativen?
»Gehen Sie die wiegen, oder nehmen wir sie raus?«
Das »S« der Verkäuferin klang so scharf wie Aufgußwasser auf den heißen Steinen eines Saunaofens. Tino brachte es nicht fertig, ihr in die Augen zu schauen, weil dann sein Kopf zu zittern angefangen hätte. Er sah nur das Bananenpendel, das mit jedem Ausschlag den Druck in seinem Gehirn erhöhte.
»Joo.«
Die Verkäuferin lachte. Man hätte einstimmen und gemeinsam den Kopf schütteln müssen, aber Tino brachte nur eine Handbewegung zustande.
»Weg damit?«
Tino schwenkte erneut die Hand und drückte das Kinn auf die Brust. Sein Herz bebte wie ein Tamburin. Jedes Zittern pumpte weitere Panik in den Körper, und ein Ventil gab es nicht. Schweiß lief die Wirbelsäule hinab. Außer dem Herzen wurde auch sein Geist einer schweren Prüfung unterzogen. Sein Gehirn bestand aus Eis, das zuerst einen Riß bekam, dann mehrere, worauf sich die Spalten knisternd ausbreiteten und miteinander verbanden. Tino stopfte die Einkäufe in eine Plastiktüte und stürzte aus dem Laden.
Draußen lehnte er sich an eine Wand. Sein Hemd klebte an der Haut, und es rauschte in seinem Kopf.
»Mama, da ist er wieder. Der Kranke!«
Mädchen und Mutter rückten an. Tino blickte sich um. Wenige Meter entfernt befand sich eine Tür. Er riß sie auf und trat in einen An- und Verkauf-Laden. An allen Wänden standen Regale, für deren oberste Fächer man eine Leiter gebraucht hätte. Tino schob sich weiter hinein, um sich bei Bedarf hinter den Regalen verstecken zu können. Dabei stolperte er über ein Hindernis, das auf dem Boden lag, und setzte darüber hinweg. Wie durch ein Wunder blieb die Tüte dabei in senkrechter Position. Der Grund für den Zusammenprall entpuppte sich als riesige gepanzerte Schildkröte. Bei genauerer Betrachtung handelte es sich allerdings lediglich um den Schild; die Kröte hatte irgendwann ihr Haus verlassen und sich in andere Dimensionen begeben. Das Gehäuse sah aus, als setzte es sich aus den Nägeln riesiger großer Zehen zusammen, die von tiefen Furchen eingefaßt waren. Jemand hatte Muster und Buchstaben hineingeritzt. In den Rand war ein Loch gebohrt worden, an dem ein Glöckchen hing.
»Was suchst du?«
Noch vor der optischen Wahrnehmung wurde eine Geruchsmischung aus Zigaretten und frischem Alkohol übertragen. Tino blickte rasch auf. Vor ihm stand ein pockennabiger Mann. Ihm in die Augen zu schauen war jetzt zuviel für ihn, also starrte Tino auf den am Bund ausgefransten grauen Pullover des Mannes sowie auf die zwischen gelben Fingern steckende Selbstgedrehte, von der Asche auf den Fußboden rieselte.
»Sag bloß nicht, daß du nur zum Gucken kommst. Einen Laden betritt man, um was zu kaufen. Wenn man gucken will, kann man ins Kino gehen oder von mir aus in eine Stripteasebar«, sagte der Mann.
»Also ich ...« fing Tino an.
In der Absicht, sich davonzustehlen, machte er einen ersten Schritt, aber der Mann versperrte ihm mit ausgestrecktem Bein den Weg.
»Für drei Zehner gehört er dir«, sagte er.
»Was?«
»Der Schild natürlich.«
»Ich hab keine ...«
»Wieviel hast du?«
»Einen Zehner.«
Man hörte ein Rascheln, weil der Mann seine unrasierte Wange kratzte.
»Scheiß drauf. Nimm ihn mit. Für nen Zehner kriegt man immerhin eine Flasche Rotwein, und Schrott liegt hier genug rum.«
Tino zog den Geldschein aus dem Portemonnaie.
»Nimm von denen hier auch welche mit.«
Es war mehr ein Befehl als eine Aufforderung oder ein Ersuchen.
»Kriegst du umsonst. Heutzutage zahlt dafür niemand mehr was.«
Der Mann reichte ihm einen Stoffbeutel und deutete hinter die Theke, wo ein Haufen Bücher auf dem Boden lag. Tino wühlte darin und schob eines davon, dessen Verfassernamen er kannte, in den Beutel.
»Nein, nein, nein. Laß die Scheiße liegen. Da sind Meisterromane und Sammlerschätze dabei. Gib her, ich stell dir ein Set zusammen«, sagte der Mann.
Er grub einige Werke aus, blies den Staub von den Umschlägen und den Rauch seiner Zigarette darauf, murmelte etwas vor sich hin und steckte einen Schwung Bücher in den Beutel, den er Tino anschließend hinhielt.
»Bist du mit dem Wagen unterwegs?«
Tino wußte die Frage mit nichts in Verbindung zu bringen.
»Der Panzer ist höllisch schwer. Aber scheiß drauf, ist ja nicht meine Sorge. Probieren wir mal. Bück dich!«
Tino machte den Rücken krumm. Der Mann tätschelte ihn, wie man es bei einem Pferd macht, und befahl ihm, sich tiefer zu bücken. Dann ging der Mann in die Knie, packte den Schild am Rand und lud ihn Tino auf den Rücken. Als sich die Last im Gleichgewicht befand, stellte der Mann fest:
»Du siehst aus wie Gregor Samsa.«
Er gab ein langes kinoreifes Lachen von sich, das in einen Hustenanfall mündete.
»Probier mal, dich zu bewegen!«
Mühsam bewegte sich Tino vorwärts. Unter dem Gewicht des Panzers gaben die Knie nach, aber die Bürde blieb stabil. In der einen Hand hielt er die Tüte mit den Lebensmitteln, in der anderen die Bücher.
Der Verkäufer machte ihm die Tür auf.
»Guten Heimweg!«
Die wenige Hundert Meter lange Strecke kam ihm wie eine Wanderung vor. Das Gehäuse drückte, und die Kreuzung aus Mensch und Schildkröte war dazu angetan, Aufmerksamkeit zu erregen.
»Mama, guck mal, eine Teenage-Mutanten-Ninja-Schildkröte!«
Dieses Mädchen kannte er schon. Er zog den Kopf unter das Gehäuse und duckte sich. Es war dunkel. Gedämpft drang die Stimme der Mutter durch den Panzer:
»Tuuli, sofort weg da!«
Das Mädchen sagte etwas und klopfte ans Gehäuse. Tino dachte an den Wels, der im Aquarium wohnte, und an dessen Sandmulde. Er machte sich unter dem Schild so klein wie möglich. Als er das nächste Mal vorsichtig unter dem Rand hervorspähte, war er sich nicht sicher, ob eine oder zehn Minuten vergangen waren. Es war niemand mehr zu sehen. So schnell er konnte, schwankte Tino weiter. Den Schild in der Balance zu halten schränkte den Oberkörper in seiner Bewegungsfreiheit ein und verengte das Sichtfeld nach vorn auf einen Meter. Er kam nur langsam vorwärts, erreichte die heimische Haustür aber ohne weitere Zwischenfälle.
Mit Schwung schüttete sich Tino das erste Beruhigungsbier hinein, packte die Lebensmittel in den Kühlschrank und schleppte den Schild vom Flur ins Wohnzimmer. Er hätte vielleicht als interessanter Zierat in den Salon einer Villa gepaßt; in einem Einzimmerapartment aber beanspruchte er zuviel Raum und Aufmerksamkeit. Tino blickte sich um. Man könnte den Schild auf dem Gestell plazieren, das aus der Wand ragte und einmal einen Röhrenfernseher getragen hatte. Dort saß er stabil. Tino fuhr mit dem Zeigefinger über das Dreieck, das in den Panzer eingeritzt war. Unter der Fingerkuppe wurde es heiß, als berührte er einen von der Sonne erwärmten Felsen. Der Panzer war der konkrete Überrest von etwas, das einmal gelebt hatte, er war lebendig und tot zugleich. Die ältesten Schildkröten wurden über zweihundert Jahre alt. Auch diese hier war womöglich gleichzeitig mit Napoleon Bonaparte über die Erde gestapft und bei vollem Verstand durch die Revolutionen von 1848/49 gekommen.
Tino holte sich ein weiteres Bier aus der Kühlung, ließ es aufzischen und sank auf die Couch. Er schaffte zwei Schlucke, bis ihm die Bücher einfielen, also holte er den Beutel aus dem Flur und stapelte die abgenutzten, an den Ecken verknickten Werke auf dem Wohnzimmertisch. Das Sortiment war gemischt. Er beschloß, mit dem Opus zu beginnen, das ganz oben auf dem Stapel gelandet war. Er hielt es sich vor die Nase und fing an zu blättern. Es roch nach Salz und heißem Sand. Den Umschlag zierte der gelbliche Ring, den eine Kaffeetasse hinterlassen hatte.
2
Tino wachte mit dem Buch auf dem Brustkorb auf. Er lag auf der Couch. Zunächst war ihm unklar, in welcher Phase des Tages oder der Nacht er sich befand, aber die Wanduhr zeigte zehn, und die Dunkelheit sowie die Tatsache, daß die Beleuchtung des Aquariums auf dem Bildschirm ausgegangen war, teilten mit, daß es abend war.
Tino blätterte im Buch und stellte fest, daß er vor dem Einschlafen fast bis zum Ende gekommen war. Es stimmte melancholisch, in einem stickigen Apartment aufzuwachen, nachdem man kurz zuvor das Perlentauchen vor einer tropischen Insel außerhalb der Reichweite jedes Kartenzeichners beobachtet hatte. In der Absicht, auf die Toilette zu gehen, stand Tino auf und stolperte sogleich über den Bücherbeutel. Er war mit der Aufschrift Bücher sind Fenster zur Welt bedruckt. Tino setzte sich auf die Schüssel und dachte, daß dieser Satz mit Sicherheit zutraf. Vorhin hatte er eine tropische Insel betrachtet und verfolgt, wie sich ein Missionar mit der Frage abmühte, welches Weltbild das richtige war, das eigene oder das der anderen. Das war eine starke Erfahrung gewesen. Ob es wohl möglich wäre, sie noch weiter zu verstärken? Ließ sich das Fenster öffnen?
Tino erinnerte sich, im Fernsehen ein Interview mit einem weltberühmten Schriftsteller gesehen zu haben, bei dem dieser sagte, viele Leute glaubten, das beste am Schreiben sei das Erschaffen einer Phantasiewelt und der Gedanke, daß andere daran ihre Freude haben werden. Der Schriftsteller hatte kurz aufgelacht und gemeint, das sei jedoch keineswegs der Fall. Das Großartigste sei die Möglichkeit, während des Schreibprozesses in der Welt zu leben, die man errichtet habe.
Nach dem Interview hatte sich Tino einen gebrauchten Computer, einen Drucker und Papier gekauft und angefangen zu schreiben. Leider sprudelte es in seinem Leben nicht gerade vor Themen. Die Geräusche der Nachbarn, die man durch die Rohrleitungen hörte, und die Ansichten des Aquariums waren schnell abgegrast und der Schreibversuch damit früh versiegt.
Aber wie wäre es, die eigenen Erfahrungen zu vergessen und sich Bücher zunutze zu machen? Vielleicht fänden sich darin Inhalte, die er zum Erschaffen seiner Welt benutzen könnte. Entschlossen verließ Tino das Klo, schnappte sich den Laptop, ließ sich am Küchentisch nieder und klickte das Symbol an, das eine Schreibfeder und ein Blatt Papier zeigte.
Aufgrund der hohen Temperaturen sorgte der Wind nicht für Erfrischung, sondern verstärkte im Gegenteil noch die Wirkung der Wärme. Seit Tagen hielt die Hitze die vom Stillen Ozean umgebene tropische Insel umklammert, und die Luft war feucht wie in einem türkischen Dampfbad.
Mormonenprediger Joshua Donaldsson hatte seine tägliche Andacht abgesagt und war vor der Hitze in die mit Palmblättern gedeckte Hütte geflohen, die er mit seiner Schildkröte teilte. Dort lag er in der Hängematte und döste. Die Augen fielen ihm zu, und er trieb weit ab, in eine Erinnerung jenseits des Ozeans, in der er die Karpfen im Gartenteich seines Elternhauses mit Brotkrümeln fütterte.
Tino klappte den Deckel des Laptops zu und ging an den Kühlschrank, um sich ein Brot zu machen. Allerdings hielt er vor der Kühlschranktür inne, um die Postkarten zu studieren, die ihm seine Eltern von skandinavischen Campingplätzen und seine Schwester aus fernen Ländern geschickt hatten. Die Landschaft auf der Karte, die einen tropischen Sandstrand zeigte, kam ihm bekannt vor. Am linken Rand, im goldenen Schnitt, stand eine Palme, die übrige Bildfläche nahmen feiner Sand und das türkis leuchtende Meer ein. Für einen Moment glaubte Tino zu sehen, wie ein Sturmwind die Palme bog. Er beschloß, das Brotschmieren zu verschieben, und kehrte an den Computer zurück.
Die Arbeit eines Missionars war ein einsames Geschäft. Auf dieser Seite der Erdkugel war man als Kirchenmann aus London anders als die anderen und somit Außenseiter. Die blasse Glatze unterschied sich von den mit schwarzen Korkenziehern bedeckten Köpfen, und eine gemeinsame Sprache gab es auch nicht. Aber selbst wenn es mit dem Reden geklappt hätte, wäre mit den ungebildeten Wilden wahrscheinlich kein sonderlich kultiviertes Gespräch zustandegekommen. Die genannten Gründe machten es schwer oder nahezu unmöglich, kameradschaftliche Beziehungen aufzubauen, außerdem wollte die Heimatgemeinde des Missionars, daß er alle paar Jahre den Dienstort wechselte. Um seine Gefühle zu schonen, hatte Donaldsson darum gelernt, Abstand zu den Menschen zu halten.
Die Schildkröte war etwas anderes. Die blieb bei ihm und hörte ihm zu, auch wenn sie nicht antwortete. Donaldsson war nicht abergläubisch, aber die Schildkröte schien etwas Besonderes an sich zu haben, immerhin hatte sie gerade in dem Moment an die Tür seiner Hütte geklopft, als Einsamkeit und Isolation sein Denken so verdüstert hatten, daß bereits das Sisalseilbündel, das in einer Ecke der Hütte lag, darin eine Rolle spielte. Nicht ganz ohne Bedeutung war auch die Tatsache, daß die Schildkröte, die in seiner Gesellschaft von der Größe eines Brotlaibs auf Ausmaße herangewachsen war, die eher mit einem Mehlsack zu vergleichen waren, bei der Rückkehr in die Heimat auch finanziell ein ziemlich kostbares Souvenir darstellen würde. Er könnte das exotische Tier an einen Zirkus oder einen Zoo verkaufen, sobald er keinen Bedarf mehr an einem Ersatz für menschliche Freunde hätte.
Donaldsson schreckte auf, als draußen Spiel und Gesänge der Eingeborenen ertönten, die heidnischen Ritualen entsprangen und deren Zweck darin bestand, das Glück beim Fischen zu sichern. Er murmelte Wörter vor sich hin, die nicht für die Ohren Gottes bestimmt waren, und verließ die Hängematte. Er ging in die Hocke, schob den Stoff der Hängematte zur Seite, hob eine Ecke der Schilfmatte, die auf dem Erdboden lag, an und brachte eine Luke zum Vorschein, unter der sich zwei Holzkästen befanden. Er stellte sie auf den Tisch und öffnete den ersten. Er enthielt Bündel mit Geldscheinen, zahlreiche Goldmünzen sowie ein Heft, in dem Donaldsson in sorgfältiger Schrift Daten und Summen eingetragen hatte. Der zweite Kasten war voller schimmernder Perlen.
Der Missionar öffnete ein Geldbündel, zählte es genau durch, machte einen Eintrag im Heft und ging zum nächsten Bündel über. Bei jedem Geldscheinfächer führte er die gleiche Prozedur durch, und die Münzen addierte er ebenfalls. Zum Schluß zählte er die Perlen. Es war einiges an Barem und an Perlen zusammengekommen, aber er mußte das Geschäft noch ein paar Jahre fortsetzen, bevor er die finsteren Winkel der Urwälder verlassen, nach London zurückkehren, sich dort ein Haus kaufen und ein Leben in Reichtum führen konnte. Als junger Mann hatte er am Altar gelobt, sein Leben in den Dienst des Allmächtigen zu stellen, aber alles hatte seine Grenzen. Wie sehr sehnte er sich nach Darjeeling-Tee, nach Toast mit Marmelade und einem Pint Stout. Die Grenze des Erträglichen war erreicht. Fast jede Nacht träumte er davon, wie er im Begriff war, sein Missionarsgelübde abzulegen, sich aber im entscheidenden Moment umdrehte und aus der Kirche rannte. Nach dem Aufwachen fühlte er sich schwer und betrogen. Wie konnte er noch länger durchhalten?
Inzwischen hatten sich die hereindringenden Laute der Eingeborenen verändert. Es wurde jetzt ständig ein und dasselbe Wort wiederholt, von dem Donaldsson mittlerweile wußte, daß es »Schiff« bedeutete. Er stand auf, öffnete das Moskitonetz, setzte sich den Tropenhelm auf und trat aus der Hütte. Die Eingeborenen deuteten aufs Meer und juchzten wie Kinder. In der Ferne sah man den Qualm eines Dampfschiffes. Tatsächlich kam das Schiff schneller zurück, als es der Kapitän bei seinem letzten Besuch eingeschätzt hatte. Das störte Donaldsson überhaupt nicht, denn die Taucher hatten effektiv gearbeitet, es waren also genügend Perlen da.
Die Taucher waren unglaublich geschickt: Im Boot schnauften sie kurz konzentriert durch, banden sich einen Lederbeutel um die Hüften, drückten sich dann eine aus Holz gefertigte Klammer auf die Nasenlöcher und versanken im türkis leuchtenden Meer. Sie blieben eine übernatürlich lange Zeit unter Wasser und schienen auf den Korallen, Seeigeln und anderen Formationen, die in allen möglichen Farben den Meeresgrund bedeckten, spazierenzugehen. Wäre das Wasser nicht so klar, daß man von oben ihre Bewegungen auf den Korallen beobachten konnte, würde man glauben, sie hätten durch Ertrinken ihr Ende gefunden. Schließlich kamen die Taucher wie Delphine an die Oberfläche geschossen, holten ein paar Mal tief Luft und verschwanden wieder in der Welt der Fische. Nach einigen Tauchgängen stiegen sie ins Boot und leerten den Inhalt ihrer Beutel in Donaldssons Korb, der sich im Lauf des Tages mit wunderbaren matt schimmernden Perlen unterschiedlicher Größe füllte. Die Schätze, die sich in den Muscheln verbargen, hatten eine so feine und zarte Färbung, daß man eine Perle mit bloßem Auge schwer erkennen konnte, wenn man sie in ein Wasserglas fallen ließ. Eine Perle war hart und konkret und gleichzeitig flimmernd und stofflos.
Donaldsson kehrte in seine Hütte zurück und hüllte sich trotz der Hitze in anständige Kleider: heller Sommeranzug aus Leinen, Safaristiefel und Tropenhelm. Die Kleidung sollte bei den Verhandlungen mit dem Kapitän Würde verkörpern.
»Ich haben gefunden das.«
Donaldsson, der in Gedanken versunken war, zuckte vor Schreck zusammen. Einer der Taucher hatte sich hinterrücks angeschlichen. Es war der absolut Tüchtigste von ihnen. Sein kakaobohnenfarbener Körper war wie für das Tauchen gebaut: Die flossenartigen Füße und die an Paddel erinnernden Handflächen ermöglichten kräftige Züge, mit denen er im Nu bis zum Grund kam, selbst bei vielen Metern Wassertiefe. Sein faßähnlicher Brustkorb barg eine Lunge, deren Volumen ihm zweimal so lange Tauchgänge erlaubte als den anderen Perlenfischern der Insel.
»Das groß«, ergänzte der Taucher.
Er reichte dem Missionar eine Perle, die so groß war wie eine Billardkugel und auch ebenso schwer und glatt. Donaldsson schnappte nach Luft, versuchte aber normal zu wirken. Für den Handelspreis dieser Perle würde er in London ein Herrenhaus erwerben sowie einen Butler und eine Haushälterin einstellen können. Endlich würde er jenes herrschaftliche Leben im Wohlstand führen können, zu dem er seiner Meinung nach berechtigt war, da er nun schon im dritten Jahr das Licht Gottes in die finstersten und primitivsten Winkel der Urwälder trug.
Die Taucher der Insel hatten bis dahin die Perlen, die sie eingesammelt hatten, weder gezählt noch sortiert. Sie waren nur getaucht, hatten sofort ihre Sammelbeutel in Donaldssons Korb geleert und waren wieder unter Wasser verschwunden. Den Tand, den sie als Bezahlung erhielten, teilten sie gerecht untereinander auf. Nun hatte der beste Taucher anscheinend seinen Wert erkannt und die Riesenperle, die er entdeckt hatte, vor den anderen Perlenfischern versteckt. Der Missionar hob die Perle auf die Höhe seiner Augen, kniff ein Auge zu und bewunderte die Lichtreflexe auf der glatten Oberfläche. Die Perle war milchweiß, aber ihre makellos glatte Oberfläche schimmerte in allen Farben des Regenbogens.
»Du bekommst deinen Lohn, sobald ich sie verkauft habe«, sagte Donaldsson.
Er wickelte die apfelgroße Meeresfrucht in ein Taschentuch und ließ sie in die Brusttasche gleiten.
»Nun. Du kannst gehen.«
Tino ging ins Wohnzimmer, um nachzusehen, wie die Lage im Aquarium war. Der größte Wels hatte sich in der Höhle, die er unter einem Stein in den Sand gescharrt hatte, vergraben und griff von dort aus andere Fische an, die sich in die Nähe verirrten. Tino war überrascht, wie leicht der Anfang der Geschichte entstanden war. Bisweilen hatte es den Anschein gehabt, als bewegten sich die Finger von selbst über die Tastatur. Falls das Unterbewußtsein hinter der Geschichte steckte, stellte sich die Frage, warum es ihn auf diese Reise mitnehmen wollte. Offenbar identifizierte er sich mit der Einsamkeit und dem Außenseiterdasein des Missionars Donaldsson. Auch er hatte das Gefühl, daß die übrige Welt jenseits unermeßlicher Meere lag.
Donaldsson stand mit seinem Perlenbeutel am Strand und schmunzelte gedankenverloren vor sich hin. Er wußte, daß die riesige Perle in seiner Tasche einen nahezu unermeßlichen Wert besaß. Die Eingeborenen bekämen Tand und Ramsch wie Armreifen aus Aluminium, Ringe aus Eisen, Glanzbilder und bunte Glasstücke. Donaldsson bekäme Geldscheine.