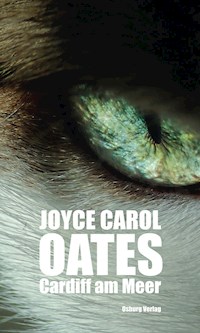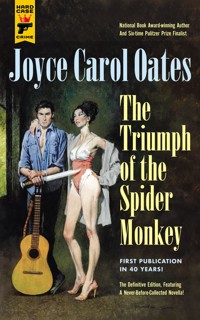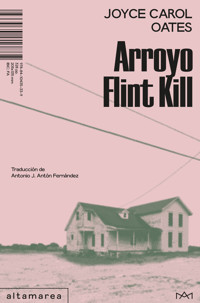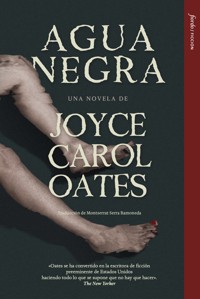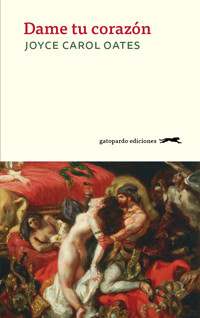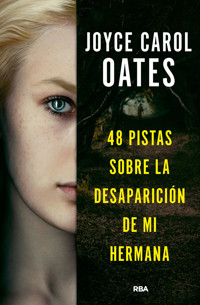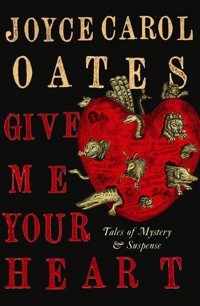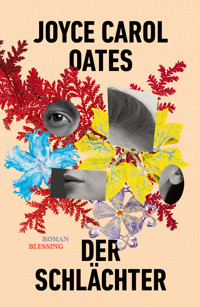
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Düster wie Bram Stoker, feministisch wie Margaret Atwood: Der neue Roman von einer der bedeutendsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart
Pennsylvania, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dr. Silas Weir ist ein junger Arzt aus gutem Hause, doch ohne Charisma und Talent. Beim Anblick von Blut wird er ohnmächtig, Frauenkörper stoßen ihn ab. Um seinen strengen Vater zu beeindrucken, versucht er, auf unorthodoxe Weise als Chirurg voranzukommen, was ihn gesellschaftlich isoliert. Dann wird er durch eine Aneinanderreihung von Zufällen Direktor der Staatlichen Heilanstalt für weibliche Geisteskranke in New Jersey. Hier beginnt Weir, vorgeblich im Dienste des medizinischen Fortschritts, Experimente an den meist schwarzen und irischen Insassinnen durchzuführen. Bald gilt er als führender, wenn auch berüchtigter Experte für Gynäkologie und Psychiatrie. Bis eine junge Dienstmagd zu seiner Obsession, seinem wichtigsten Versuchsobjekt und schließlich zu seinem Verhängnis wird.
»Oates' Anklage gegen die physische und psychische Behandlung von Frauen durch das medizinische Establishment ist eine fesselnde, anspruchsvolle Lektüre.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ZUMBUCH
Pennsylvania, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dr. Silas Weir ist ein junger Arzt aus gutem Hause, doch ohne Charisma und Talent. Beim Anblick von Blut wird er ohnmächtig, Frauenkörper stoßen ihn ab. Um seinen strengen Vater zu beeindrucken, versucht er, auf unorthodoxe Weise als Chirurg voranzukommen, was ihn gesellschaftlich isoliert. Dann wird er durch eine Aneinanderreihung von Zufällen Direktor der Staatlichen Heilanstalt für weibliche Geisteskranke in New Jersey. Hier beginnt Weir, vorgeblich im Dienste des medizinischen Fortschritts, Experimente an den meist schwarzen und irischen Insassinnen durchzuführen. Bald gilt er als führender, wenn auch berüchtigter Experte für Gynäkologie und Psychiatrie. Bis eine junge Dienstmagd zu seiner Obsession, seinem wichtigsten Versuchsobjekt und schließlich zu seinem Verhängnis wird.
ZURAUTORIN
Joyce Carol Oates wurde 1938 in Lockport, New York geboren. Sie zählt zu den bedeutendsten und vielseitigsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart. Für ihre mehr als 60 Romane und über 300 Erzählungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem National Book Award. Joyce Carol Oates lebt in Princeton, New Jersey, wo sie Kreatives Schreiben unterrichtet. Sie war mehrfach für den Pulitzer-Preis nominiert und gilt seit Jahren als Anwärterin auf den Nobelpreis für Literatur.
ZURÜBERSETZERIN
Silvia Morawetz, geboren 1954 in Gera, studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik. Sie hat bisher ca. 150 Werke aus den Gattungen Prosa, Lyrik, Essay und Hörspiel übertragen und ist, neben Joyce Carol Oates, die Übersetzerin von u. a. Henry Miller, Anne Sexton, Ali Smith und Hilary Mantel. Sie erhielt Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds, des Landes Baden-Württemberg und des Landes Niedersachsen.
JOYCE CAROL OATES
DER SCHLÄCHTER
Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz
BLESSING
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel BUTCHER bei Alfred A. Knopf, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e. V. für seine Förderung der Arbeit am vorliegenden Text.
Copyright © 2025 by Joyce Carol Oates
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Alle Rechte vorbehalten.
Coverdesign: semper smile, München
Unter Verwendung von ©plainpicture/Pupa Neumann ©shutterstock/fizkes, mimagephotography, Pressmaster, Cast of Thousands, VolodymyrSanych, paseven, Vectoressa, Refluo
Redaktion: Anna Koliska
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33063-7V001
www.blessing-verlag.de
Für alle Brigits – die Ungenannten & die Genannten,
die Stummen & die, deren Stimmen gehört wurden,
die Vergessenen & die von der Geschichte Bewahrten.
Wie Kolumbus staunend auf die Neue Welt blickte,
wie Kopernikus & Galileo in den Himmel blickten, so blickte Dr. Silas Aloysius Weir, Arzt, in das dunkle Rätsel
des Weibes – bis dato allein unter den Männern.
Silas Aloysius Weir
Ein Chirurg braucht das Gehirn eines Apolls, das Herz eines Löwen & die Hand einer Frau.
Sir John Bell
Freude gab es, im Schmerz.
Im Schmerz, Freude.
Denn Freude, die schmerzt,
dringt tiefer
als reine/reinste
Freude.
Brigit Agnes Kinealy
Verlorenes Mädchen, wiedergefunden: Die wahre Geschichte einer Waise, erzählt von ihr selbst
Anmerkung des Herausgebers
Nachfolgend eine Biografie, bestehend aus verschiedenen Stimmen, jedoch hauptsächlich der meines verstorbenen Vaters Dr. Silas Aloysius Weir, Arzt (1812 – 1888), fünfunddreißig Jahre lang Direktor der Heilanstalt für weibliche Geisteskranke des Staates New Jersey in Trenton, New Jersey: nach übereinstimmender Meinung seiner Ärzte – Chirurgen & Psychiaterkollegen – der »Begründer der Gynäkopsychiatrie«, das heißt, der auf Frauen spezialisierten Psychiatrie. Doch Silas Aloysius Weir leistete Bahnbrechendes auch auf anderen Gebieten der medizinischen Wissenschaft, wie diese Biografie aufzeigen wird.
Als Testamentsvollstrecker meines Vaters hatte ich zunächst die Absicht, anlässlich der (zehnten) Wiederkehr seines Todestags aus Zeugnissen von Berufskollegen ein Kompendium der Pionierarbeit von Silas Aloysius Weir zu erstellen, habe dieses ursprüngliche Vorhaben jedoch nun durch andere Dokumente aus unerwarteten Quellen & eigene Bemerkungen ergänzt.
Ich musste erkennen, dass es so gut wie unmöglich ist, ein gerechtes Bild von Silas Aloysius Weirs Leben & beruflichem Werdegang zu zeichnen. Als couragierter, wenn auch zuweilen eigenwilliger Pionier auf seinem Gebiet hat mein Vater zu Lebzeiten naturgemäß viel Missgunst, Konkurrenz & Kritik erfahren; nach seinem Tod haben sich die Ansichten über seinen Ruf verfestigt. Sie verteilen sich weitgehend auf zwei Lager: zustimmend & ablehnend.
Mein Standpunkt als Vollstrecker des Testaments meines Vaters, aber auch als sein ältester Sohn, ist, wie ich hoffe, dessen ungeachtet objektiv.
Festgehalten werden muss jedoch, dass Silas Aloysius Weir ein höchst ungewöhnlicher Forscher war, ein Vorreiter nicht nur auf dem Gebiet der Psychiatrie, sondern der Gynäkopsychiatrie, einer zu ihrer Zeit umstrittenen Spezialisierung, von Vater nebst seinem Verwandten Medrick Weir überhaupt erst begründet; heute folgen ihnen freilich nur noch wenige. Mancherorts wurde Vater verleumdet als ein Arzt, der seine (hilflosen) Patientinnen für sein berufliches Fortkommen, aber auch aus persönlicheren, lüsternen Beweggründen ausnutzte. Keiner der dogmatischeren Kollegen seiner Zeit hätte jedoch den Wunsch verspürt, Vaters typische Patientin zu untersuchen, geschweige denn den Versuch unternommen, sie von ihren Beschwerden zu »heilen«. Seine Patienten im Krankenhaus in Trenton waren häufig Mittellose, »das Strandgut der Erde«, wie Vater sie nannte. Eine Zeit lang führte er zwar außerdem eine florierende Privatpraxis für Wohlhabendere in Trenton, als seine wichtigste Aufgabe aber betrachtete er es, sich um die Leidenden in der Staatlichen Heilanstalt für weibliche Geisteskranke zu kümmern. Dies hielt er für eine heilige Pflicht, ihm auferlegt vom Gouverneur des Staates, von der staatlichen Kommission für öffentliche Gesundheitsfürsorge, vom Steuerzahler von New Jersey & von der Vorsehung selbst, an die er nie aufhörte zu glauben.
(Tatsächlich durchzieht es als ein wiederkehrendes Thema Silas Weirs gesamte Autobiografie, dass alles, was er tat, auf der Überzeugung fußte, die Vorsehung habe ihm die Hand geführt. Vater hielt noch die geringsten Tätigkeiten für einen Ausweis seiner Bestimmung. Was wir, die einer jüngeren Generation angehören, eher als bloßen Zufall, wenn nicht gar als Laune des Schicksals betrachtet hätten, deutete Vater als den Willen Gottes.)
Ich räume ein, dass anzügliche Gerüchte über Silas Weir in Umlauf gebracht wurden von Personen, die ihn kaum kannten, sogar unter den angeheirateten Cleffs, den Verwandten meiner Mutter, von denen ich mich, wie ich zugeben muss, aus Gründen, die in dieser Biografie deutlich werden, entfremdet habe.
Alles in allem erwiesen sich die Zeugnisse der Ärztekollegen meines Vaters als enttäuschend & wären allein eine überaus langweilige Lektüre: Hagiografien seiner engsten Mitarbeiter & Verteidiger oder erzürnte Bekundungen von Empörung, Abscheu & Missbilligung seiner Verleumder. Da ich zudem nicht die Absicht habe, Zeugnisse von Vaters Verwandten beizuziehen, von denen ich mich ebenfalls entfremdet habe, mangelt es hier nachfolgend an biografischem Material, das über das hinausginge, was Vater in Auszügen in seiner (posthum publizierten) Autobiografie Chronik eines Arztlebens selbst zur Verfügung gestellt hat, die ich für die Aufnahme in dieses Buch aufbereitet habe.
(Im Interesse vollständiger Offenlegung sollte ich anmerken, dass die Authentizität & Genauigkeit von Vaters Autobiografie seitens einiger Historiker in Zweifel gezogen worden ist. Insbesondere wurde gegen Silas Weir vorgebracht, er habe seine chirurgischen »Erfolge« stark übertrieben & geflissentlich unterlassen, seine entsetzlichen Fehler festzuhalten, wie ein Arzt es aus ethischen Gründen zu tun gehalten ist. Nach einem verheerenden Brand in Silas Weirs Labor in der Heilanstalt in Trenton im März 1861 sind Niederschriften zu seinen umstrittensten Experimenten verloren gegangen; von dem, was er hier vollbrachte, ist nur das bekannt, was Vater in der Chronik bewahren wollte.)
Was ich schließlich zusammengetragen habe, ist, wie ich hoffe, ein überzeugendes & authentisches Porträt meines Vaters Dr. Silas Aloysius Weir, Arzt, bestehend aus einem Chor von Zeugen: einige erkennbar voreingenommen, andere objektiver. In seiner Schonungslosigkeit am überraschendsten ist Teil V mit Auszügen aus dem erfolgreichen Memoir von Brigit Agnes Kinealy, Silas Weirs berühmter ehemaliger Patientin, mit dem provokanten Titel Verlorenes Mädchen, wiedergefunden: Die wahre Geschichte einer Waise, erzählt von ihr selbst (Matthew Carey Publishers, 1868), das Belege zu den Arbeitsmethoden & zu der Persönlichkeit meines Vaters liefert, die aus anderen Quellen nicht erhältlich wären & auf höchst frappierende Weise von den Schilderungen meines Vaters abweichen.
Sie sind daher ein Dokument von unschätzbarem Wert in der unruhigen Geschichte der Gynäkopsychiatrie, in der der eigentliche Gegenstand der Wissenschaft, das heißt Frauen, viel zu selten selbst zu Wort kamen.
Dass viele Leser meine eklektische Biografie vermutlich »strittig« – sogar »skandalös« – finden werden, ist eine Zwangsläufigkeit, die ich als Silas Weirs ältester Sohn, eine Enttäuschung für den Mann & dennoch sein kämpferischster Chronist & Erbe, hinnehmen muss.
Jonathan Franklin Weir
Boston, Massachusetts
Oktober 1898
Prolog
März 1861
… wir hatten noch nicht angefangen, ihn zu ermorden, da war es schon vorbei. Doktor Bluthand, der Schlächter, war sofort auf den schmutzigen Boden geplumpst wie ein von Gott persönlich gefälltes blödes Tier, wand sich jämmerlich in seinem eigenen Blut. Wie ein gescholtenes Kind weinend, aller Hoffnung beraubt & beschämt, die Kleider zerfetzt & ihm vom Leib gerissen, blutete er in seiner Nacktheit aus verstümmelten Genitalien zwischen bleichen Altmännerschenkeln, wir kreischten vor Lachen bei dem Anblick. Halleluja! – der Ruf des zornigen Jehova, Gott der Israeliten, wir drängten voran in seliger Wut, wie Hochwasser über die Ufer tritt, die Kühnsten von uns sannen auf Mord, die Wonne des Metzelns unsere Messer hungerten nach dem zarten Fleisch der Brust des Schlächters mit den roten Händen, der uns gefangen gehalten hatte, nach dem Herzen des Schlächters mit den roten Händen, der uns gefoltert hatte, nach dem Leib des Schlächters mit den roten Händen, der uns sodomisiert hatte, während die Besonneneren riefen: Nein! Nein, das dürfen wir nicht! – Es nimmt für uns ein schlimmes Ende, wenn wir den Schlächter-Doktor ermorden.
Ich verbarg die Augen, ich konnte nicht mitansehen, was wir getan hatten.
I Der junge Doktor Weir
Der Bewerber (1835)
Mrs. Elias Rollins, geb. Tabitha Tyndale
Chestnut Hill, Pennsylvania
Gott vergib uns! – Wir verkannten das junge Genie, das im Herbst 1835 aus heiterem Himmel in unserer Mitte auftauchte; wie alberne Gänse, die wir ja waren, hielten wir, blind vor Eitelkeit & dem permanenten Spreizen unserer Federn, diesen wenig verheißungsvollen Arzt in spe für einen Narren, mochte er auch scheu & unbeholfen wirken & aus einer in seiner Heimatstadt Concord, Massachusetts, »sehr angesehenen« Familie stammen.
Wir lachten sogar über ihn. Der, ein Bewerber? – ganz gleich, bei welcher von uns.
Stellte sich in einem feierlich ernsten Ton, in dem etwas Großsprecherisches mitschwang, als Dr. Silas Weir, Arzt, vor. In Chestnut Hill bestimmt der reizloseste Junggeselle der Saison!
Das Erste, was einem an Silas Weir auffiel: Seine Haut war ungesund fahl, die farbliche Entsprechung von Ernst. Das Gesicht eines jungen Arztes, der zu lange nicht an der frischen Luft gewesen war, sich in Lehrbücher versenkt hatte, in luftlose Operationssäle & die entsetzlichen Orte namens »Leichenhallen«, in denen Kadaver grausam zerschnitten werden. Ein Gesicht, jungenhaft & verhärmt zugleich, die (hohe, knochige) Stirn von Sorgenfalten durchzogen, wie man mit einer Gabel Linien in den Teig zieht, & etwas Verhuschtes um die Augen wie von Unbehagen, von Schuld.
Silas Weir war von mittlerem Wuchs, der Kopf übergroß auf herabhängenden dünnen Schultern, das dicke, büschelige Haar ohne klar erkennbare Farbe, weder dunkel noch hell, einen besseren Schnitt benötigend; die Augen, ziemlich tief in den Höhlen liegend wie bei einem Nagetier, feucht & flink hin- & herhuschend; die Ohren, seltsam weiß, standen ein wenig vom Kopf ab, & doch hatte seine Haltung etwas ungelenk Würdevolles wie bei einem, der sich für jemand ausgibt, der er nicht ist.
Seine Kleider aus leichter dunkler Wolle waren von guter Qualität (wie Mutter mit scharfem Blick bemerkte), aber etwas zerknittert, so als hätte er darin geschlafen. Seine Wäsche mochte frisch gewesen sein, als er von seiner Unterkunft in der weiter entfernten Unterstadt aufgebrochen war, wurde in unserem überhitzten Wohnzimmer aber schon nach kurzer Zeit feucht & sein gestärkter Kragen schlaff. Wir jungen Damen in unserer hellen Seide & Satin & fest in unsere Fischbeinkorsetts geschnürt, waren mit Talkum weiß gepudert, am stärksten unter den Achseln & zwischen den Beinen, in der niederen Region, die nicht benannt war & daher auch nicht genannt werden konnte; kam für irgendeine von uns die bestimmte Zeit im Monat, war sie zwischen den Beinen mit dicken Mullbinden bewehrt, schon bald schwer geworden von brackigem Blut, das trocknete & an der zarten Haut scheuerte wie gröbstes Sandpapier; ebenfalls großzügig mit Talkum gepudert, wäre es doch das Allerschlimmste, schlimmer noch als abscheuliche Sünden & Verbrechen, wenn die bestimmte Zeit im Monat für irgendwen anders & insbesondere für Männer, zumal für solche, die als geeignete Junggesellen ausersehen waren, erkennbar wurde. Vor lauter Angst, ausgespürt, von (männlichen) Nasen erschnuppert, gerochen & entdeckt zu werden, waren wir ständig auf der Hut, was uns launisch & (manchmal) grausam sein ließ & allemal wachsam, denn wir wollten nicht ertappt werden.
Daher nahmen wir Silas Weir mit gewisser Herablassung & Erleichterung zur Kenntnis, hatten wir hier doch einen geeigneten Junggesellen vor uns, dessen Ansichten uns nicht im Mindesten interessierten. Unsere Verehrer aus Chestnut Hill kannten wir seit Kindertagen, & noch der unansehnlichste unter ihnen war für uns so ansehnlich wie ein Verwandter; in Wahrheit war der junge Dr. Weir weniger hässlich als schlicht zu gewöhnlich & machte in Gesellschaft nichts her.
Die eindrucksvollen Konterfeis von Dr. Silas Aloysius Weir, Arzt, in späteren Jahren, die in Zeitungen & unlängst in Harper’s Weekly erschienen sind – so streng & souverän mit vorspringendem Kinn & finsterem Blick, ein angesehener, preisgekrönter Wissenschaftler & Forscher, der im Weißen Haus geehrt wurde –, entsprechen ganz & gar nicht meiner Erinnerung an den blässlichen jungen Doktor.
In unserem Salon in Chestnut Hill gab Silas Weir im Herbst 1835 ein merkwürdiges Bild ab. Er lächelte, wenn er ein ernstes Gesicht hätte machen müssen, & machte ein ernstes Gesicht, wenn er hätte lächeln sollen. Sein Mund wirkte wachsweich & wurmfarben; bei der Aussicht, dass ein solcher Mund es wagen würde, dich zu küssen, würdest du laut aufschreien. (Bei keiner von uns ging die Fantasie so weit, das will ich schnell versichern!) Er hatte das Benehmen eines Vierzigjährigen, war angeblich aber erst dreiundzwanzig!
Für unsere Ohren klang sein Akzent sehr – seltsam. In Boston sprechen die Leute, als ob sie erkältet wären, & Silas Weirs Akzent war besonders stark ausgeprägt. Zwar brachte er ausgefallen klingende Wörter (Aristoteles, Galen, Kontagium, Verbluten) über die Lippen, der Effekt aber war komisch. Wir hätten uns ausgeschüttet vor Lachen, wenn wir es gewagt hätten, Blicke zu wechseln wie früher manchmal in der Schule & in der Kirche, doch wir waren keine Kinder mehr, sondern junge Damen.
Von Zeit zu Zeit, einer züngelnden Schlange gleich, flogen Blicke aus Silas Weirs feuchten Augen in meine Richtung: glitten von der Spitze meines unter dem schweren Rock & den Petticoats hervorlugenden Schuhs über meine eingeschnürte Taille bis zum Spitzenbrokat meines Mieders & hoben sich zu meinem weißen Hals & dem hell gepuderten Gesicht, wagten es aber nicht, meinem Blick zu begegnen.
Natürlich konnte er nichts dafür, dass er zu einem gerade noch tolerierten allwöchentlichen Gast beim Tee in unserem Haus in Chestnut Hill geworden war – er hatte sich nicht selbst eingeladen. Mein Großonkel Clarence Tyndale war Diakon in unserer Kirche, der Ersten Episkopalkirche von Chestnut Hill, deren Gemeinde Silas Weir beigetreten war; aus reiner Nächstenliebe & mit den besten Absichten hatte Onkel Clarence den »jungen Dr. Weir« (wie er ihn nannte) ermutigt, uns »seine Aufwartung zu machen«. Er kenne in Chestnut Hill keinen Menschen, hieß es. Er hatte gerade das Medizinstudium in Philadelphia abgeschlossen & famulierte beim Arzt unseres Orts, Ambrose Strether, der sich dem Ruhestandsalter (sechzig) näherte & in vermindertem Umfang noch praktizierte – für einen jungen Arzt kein vielversprechender Beginn einer medizinischen Laufbahn.
(Erst später erfuhren wir, dass Silas Weir von seiner eigenen Familie – sozusagen – »verbannt« worden war, da er den hohen Maßstäben an Vortrefflichkeit, die von den Weirs aus Concord, Massachusetts, erwartet wurden, nicht genügte; er hatte sich beim Studium nicht ausgezeichnet & war daher an der Fakultät von Harvard, die in der Geschichte der Weirs bisher alle männlichen Mitglieder besucht hatten, nicht zugelassen worden.)
Zweifellos hoffte Onkel Clarence, dem jungen christlichen Herrn behilflich zu sein. Jesu Mahnung Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hatte sich in den Kopf des Onkels eingegraben wie der Eschenprachtkäfer in unsere stattlichen Eschen & ihn seiner Familie zum Ärgernis werden lassen.
Ein geeigneter Junggeselle, der studiert hat & Arzt werden will. Wer weiß, welche Zukunft vor ihm liegt. Ihr jungen Damen werdet freundlich zu ihm sein, das weiß ich. Ihr werdet dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt in Chestnut Hill, wo es seit eh & je, fürchte ich, einen »Standesdünkel« gibt.
So lange her, es schwindelt mich regelrecht.
Ich war gerade mal achtzehn, hatte die Lehranstalt für Mädchen in Chestnut Hill abgeschlossen. Fiona Fox, meine beste Freundin, war mit mir von der Schule abgegangen. Zu unserem Kreis gehörten außerdem meine (ältere) Schwester Katherine, eine Schönheit mit ernstem Gesicht, & unsere lebhaften Cousinen June & Jetta. & Belinda Prescott, die Tochter des Richters. Ich will nicht übertreiben, aber ich muss sagen, unser Kreis war in diesen Jahren in Chestnut Hill das Nonplusultra. Mädchen aus den besten Familien rissen sich darum, unsere Freundinnen zu sein, wie sich ihre Brüder & Cousins darum rissen, uns »den Hof zu machen«, aber wir waren jung & verwöhnt & wählerisch, & das machte uns grausam.
Ja, ich gebe es zu: Wir waren hübsch. Alle miteinander!
Und sehr hübsch angezogen mit unseren mit Rüschen & Bändern aus geblümter Spitze besetzten Kleidern mit den engen Miedern & den bodenlangen bauschigen Röcken, die unsere (schmalen, in weißen Strümpfen steckenden) Fesseln bedeckten; in unseren feinen Kleidern saßen wir zwangsläufig ja auch sehr gerade, wie gemalt, so eng in Fischbeinkorsetts geschnürt, dass wir kaum Luft holen konnten.
Meine Sechzigertaille, zwischen dem wie Satin schimmernden Mieder & dem Volant des Rocks auf unter fünfzig geschnürt, um das Auge eines jungen Herrn zu verlocken.
Der kranke, unglückliche Ausdruck in Silas Weirs Gesicht, als sein Blick das erste Mal auf uns fiel, wie eine Reihe Gladiolen in einem üppigen Garten; er tat uns – fast – ein bisschen leid …
Er hielt den Hut mit beiden Händen, als Lettie ihn an die Tür des Salons geleitete. Schaute & blinzelte, als blendete grelles Licht seine Augen. Schnell nahm Mama dem linkischen Besucher die Befangenheit oder versuchte es zumindest: Der arme Dr. Weir stolperte über die eigenen Füße, als er sich auf einem Stuhl am Kamin niederließ, & errötete tief. In so vornehmer Gesellschaft war er wohl noch nie gewesen!
Hatte offenbar noch nie junge Damen wie uns zu Gesicht bekommen.
Wie oft Silas Weir in jenem & einem Teil des folgenden Jahres in unser Haus zurückgekehrt war, weiß ich nicht mehr genau. Wir nahmen ihn nicht ernst, wenn außerdem bestimmte andere, wesentlich attraktivere junge Männer aus »guten« Familien in Philadelphia anwesend waren, die mit ihm um unsere Beachtung wetteiferten; unter all den »geeigneten Junggesellen« war er der Kümmerling. Was er aber – natürlich – nicht wusste.
Nach dem ersten unbeholfenen Besuch brachte Dr. Weir jedes Mal Blumen für Mama mit: häufig gewöhnliche Hortensien, schon voll erblüht, sogar Stockrosen & Tigerlilien! (Wahrscheinlich fand er diese Blumen auf Feldern & in Straßengräben, wo sie wild wuchsen, als ob wir uns das nicht denken könnten.) Mama brachte es nicht übers Herz, ihn zu entmutigen, stand ihm doch in Chestnut Hill kein anderes Haus offen. Es waren nicht unser gut gezogener englischer Tee oder die köstlichen Tee-Sandwiches & Crumpets unserer Köchin, die den linkischen jungen Mann anlockten, denn er hatte in unserem Beisein kaum einmal Appetit; hob er mit zitternder Hand eine zarte Teetasse zum Mund, verschüttete er den Inhalt gern auf seine schlecht sitzende Hose. Wir stellten ihm höfliche Fragen, & er antwortete stammelnd mit einem Lächeln, das schiefe Zähne & feuchte Gaumen entblößte, voller Eifer, so als wären wir wirklich interessiert & nicht bloß höflich; schlimmer noch, zuweilen – auch ich habe mich solcher Grausamkeit schuldig gemacht, ich gebe es zu – neckten wir ihn wie einen täppischen Hund.
Was hatte der junge Mann, der eines Tages so berühmt werden sollte, vor so langer Zeit in unserem Salon in Chestnut Hill uns zu sagen? Ich entsinne mich, dass Silas Weir mit einer gewissen schüchternen Ruhmredigkeit darüber schwadronierte, das menschliche Wissen erweitern & sich auf dem Gebiet der medizinischen Forschung »einen Namen machen«, die Laufbahn eines Klinikers & Chirurgen einschlagen zu wollen; er sprach von einer ihm vorschwebenden »experimentellen Chirurgie«, von seiner Hoffnung, »angeborene Fehlbildungen« bei Kindern & sogar Säuglingen korrigieren zu können. Wir fuhren zusammen, wenn wir Vulgarismen wie Gaumenspalte, Klumpfuß, Schielen hörten – derbe Ausdrücke, die man in gemischter Gesellschaft vermied. Der junge Doktor brachte sogar das Schreckenswort Tuberkulose über die Lippen oder Obszönitäten wie Kadaver, Niederkunft, sogar Uterus. (Doch vielleicht war es nicht »Uterus«, was Silas Weir sagte, denn dieses Wort hätten wir nicht gekannt, da es geradezu unaussprechlich war; möglicherweise sagte er mit seinem näselnden Neuengland-Akzent in Wirklichkeit »Usher«, ein höchst eigentümlicher, aber poetischer Ausdruck, der an das Werk Edgar Allan Poes gemahnte.)
In dem schicklichen Gemurmel gedämpfter Stimmen erhob sich jäh eine tiefe Stille, in der Silas Weirs Stimme überlaut & töricht erscholl; der junge Doktor errötete tief & blickte sich im Raum um wie jemand, der aus Versehen derangiert & unordentlich vor andere hingetreten ist & hofft, es habe niemand bemerkt.
Mitleidlos zogen meine Freundinnen mich damit auf, dass »der Einfaltspinsel« Silas in mich verliebt sei. Meine Cousinen June & Jetta waren die Schlimmsten.
Seinem Benehmen nach zu urteilen – sah ich auch nur kurz in seine Richtung oder wechselte ein paar Worte mit ihm oder lächelte ihn gar an –, war es wohl tatsächlich so; wagte er es, meinen Namen auszusprechen – »M-Miss Tabith-a« –, tat er es mit so brüchiger, krächzender Stimme, dass wir uns beinahe vergessen hätten & in schallendes Gelächter ausgebrochen wären.
Ich wiederum hütete mich, den jungen Doktor je anders als mit »Dr. Weir« anzusprechen. Ich sagte gewiss niemals »Silas«. Was andere auch denken mochten, ich ermunterte ihn nicht einmal aus bloßem Mutwillen.
So dämmerte Silas Weir schließlich, dass Tabitha Tyndale nicht von ihm angezogen war, & er wandte sich ein bisschen verzweifelt der lieben Fiona zu, deren Herzensgüte es nicht zuließ, irgendwen grob zu behandeln, mochte er noch so plump sein; allerdings ermutigte auch Fiona ihn nicht, sodass sich Silas Weir kurz darauf, als Fionas Aufmerksamkeit ganz von ihrem eleganten Verehrer Rufus Clark beansprucht war, noch verzweifelter meiner koketten Cousine Jetta zuwandte.
Von allen aus unserem Kreis ausgerechnet Jetta! Die darauf aus war, mit dem Herzen des naiven jungen Mannes zu spielen, wie eine Katze mit einer Maus spielt, einer anfangs intakten, lebendigen Maus, zuletzt aber mit ihren bloßen Überresten, den Innereien, ihrem Köpfchen & zu allerletzt mit ihrem elastischen Herzchen.
Denn Jetta legte es auf eine Vorführung an & beschwor Gelächter herauf, das auf Kosten der (unwissenden, ahnungslosen) »Maus« ging – der arme Weir so verblendet, zu glauben, die temperamentvolle rothaarige Jetta, siebzehn Jahre alt, könnte auch nur flüchtig an ihm interessiert sein.
Wie wir hinterher in meinem Schlafzimmer über den Narren lachten – unbändig! Das feste Korsett, das mich an Oberkörper, Taille, Hüften & Gesäß einschnürte, schmerzte mich so stark, dass ich beinahe in Ohnmacht gefallen wäre & aufgeschnürt werden musste.
»Ihr Mädchen! Das ist sehr grausam von euch & ganz & gar nicht christlich. Der arme junge Mann verehrt euch alle. Schickt es sich, ihm das so zu vergelten?«, schalt Mama uns seufzend.
Von den Possen beim Freitagnachmittagstee in unserem Salon wusste Papa nichts – zum Glück! Er setzte nie einen Fuß in diese Zusammenkünfte, die ihn, einen calvinistischen Geschäftsmann, für den vornehmes Geplauder wenig Reiz besaß, ganz & gar nicht interessierten.
Am Ende würden seine Töchter junge Männer heiraten, die er für gut befand, weil er ihre Väter kannte & respektierte, wie sie ihn respektierten; alles Übrige war Geplänkel & Koketterie, aber harmlos.
Als Silas Weir das nächste Mal bei uns vorsprach & Mama einen struppigen Strauß aus Sonnenhut & Maßliebchen überreichte, war Jettas vorgetäuschtes Interesse an dem jungen Mann abgeflaut, denn es waren andere, interessantere junge Männer zugegen, & auch Fiona erwies ihm nicht mehr als steife höfliche Aufmerksamkeit, sodass er völlig verloren war. Inzwischen war auch Elias Rollins nach Chestnut Hill zurückgekehrt & bot in seiner Uniform eines Kadetten von West Point einen so hinreißenden Anblick, dass ich die Augen kaum abwenden konnte, & auch wenn meine perfekte Haltung dank der unsichtbaren Schnürung nichts davon verriet, war es um meine kokette Sprödigkeit geschehen.
Denn das war ein gut aussehender junger Mann, dessen Vater mein Vater respektierte, da er in der Stadt Geschäfte mit ihm tätigte; das war ein junger Mann, der tatsächlich als Bewerber infrage kam.
Doch ohne Gespür für die Torheit & Aussichtslosigkeit seines Betragens zog Silas Weir unbeholfen einen Stuhl in meine Richtung, um sich an der Unterhaltung zwischen mir & Elias zu beteiligen, wie ein Esel, der auf der Weide mit den zwei reinrassigen Hengstfohlen herumtollen will. Ich blickte den hässlichen jungen Mann mit dem lächerlichen Bostoner Akzent kalt an, als ob ich ihn noch nie gesehen hätte, stellte ihn Elias nicht vor, denn – wozu auch? Ich überhörte scheinbar jedes Wort, das er stammelnd an uns richtete.
Schließlich wurde Mama aufmerksam & erbarmte sich Weirs, kam herüber, schob ihren Arm unter seinen, führte ihn zu einem unserer älteren Verwandten & stellte ihn ihm als einen »höchst vielversprechenden jungen Arzt, neu in Chestnut Hill« vor.
Der Ausdruck in dem missmutigen Pferdegesicht! Die tiefe Röte, die eng aneinander stehenden Mäuseaugen & der gekränkte Mund – man rechnet doch nicht damit, dass ein Narr so verletzt sein kann.
Es war an jenem Nachmittag, dass Mama, als sie sich in der Eingangshalle unseres Hauses von Silas Weir verabschiedete, im Ton tiefen Bedauerns flüsterte: »Ich glaube, wir sind nächsten Freitag nicht zu Hause, Dr. Weir. Wir fahren alle weg, wissen Sie. Es tut mir sehr leid.«
»Oh, es tut mir sehr leid.« Er hätte nicht verblüffter sein können, wenn jemand ihn mit einem Schüreisen auf den Kopf geschlagen hätte. »W-wohin denn?«
»Wohin …?«
»… fahren Sie denn?«
Er stellte diese grobe Frage so unbedarft, mit einem Blick von so jungenhafter Unschuld, dass Mama sie nicht schlicht überging, wie sie es vielleicht zu tun gewünscht hätte, sondern etwas von einem Todesfall in der Familie murmelte, einer Beerdigung, einer Trauerzeit …
»Ah, verstehe! Es tut mir sehr, sehr leid. Darf ich Ihnen mein Mitgefühl aussprechen, Mrs. Tyndale?«
»Sie dürfen, Dr. Weir. Sie dürfen.«
Sogar unser irisches Mädchen lächelte mit kaum verhohlenem Spott, als es ihn aus dem Haus & für immer aus unserem Leben geleitete.
Endlich los den Plagegeist! Wir frohlockten alle, denn wir würden Silas Weir nicht vermissen.
Und doch hatte ich bei aller Freude über meine aufregende Zukunft einen Anflug von schlechtem Gewissen.
Zu unserer Überraschung erschien Silas Weir aber mindestens noch ein weiteres Mal in unserem Haus anlässlich eines großen Weihnachtsessens. Vermutlich hatte Onkel Clarence ihn eingeladen, der das hinterher allerdings bestritt; wir trauten es dem aussichtslosen »Bewerber« jedenfalls zu, in unserem Haus zu spionieren, die Gelegenheit einer großen Zusammenkunft wahrzunehmen & einfach Gästen nach innen zu folgen, wohl wissend, dass er von so liebenswürdigen Menschen kaum an der Tür abgewiesen worden wäre.
Liebeskrank, mit feuchten Mäuseäuglein, ließ er den Blick durch den Salon schweifen & heftete ihn auf mich.
An jenem Tag war ich entschlossen, Silas Weir endgültig zu entmutigen. Ich ging umstandslos auf ihn zu, wie ich noch nie auf ihn zugegangen war, streckte ihm fröhlich die Hand entgegen – »Ich habe Neuigkeiten, Dr. Weir, ich bin verlobt!« –, zeigte ihm triumphierend den wunderschönen Ring, ein Erbstück mit einem Diamanten im Prinzessinnenschliff, besetzt mit Rubinen, der einmal Elias Rollins’ Urgroßmutter gehört hatte.
In seine Augen, die sich bei meinem Kommen aufgehellt hatten, trat der Farbton von trüber Teichbrühe, & sein Mund erschlaffte vor Bestürzung. Ich bin nicht stolz darauf, derart herzlos gewesen zu sein. Bestimmt leuchteten meine Augen vor Genugtuung. Als träte man auf eine Motte, auf die man nicht hatte treten, die man nicht hatte verletzen wollen, doch nun zuckt & flattert das arme Ding halt im Gras, & man ist, ohne recht zu wissen, warum, verärgert.
Trotz seines Schocks brachte Dr. Weir stammelnd eine Gratulation heraus. Zum Glück war mein fescher Verlobter Elias nicht zugegen, wodurch der Wortwechsel weniger strapaziös für Weir war, der sich mannhaft wieder fing & nicht auf dem Absatz kehrtmachte. Allerdings war der ganze Salon verstummt, denn bei meiner Grausamkeit gegen ihn fuhr ein leiser Schauer durch die Herzen von Fiona, Katherine & Belinda, June & Jetta, die, beim Blick auf die geeigneteren jüngeren Männer aus unserem Bekanntenkreis schon lange in Unruhe & Angst, sich ungetrübt an unserer gemeinsamen Verachtung für den Störenfried erfreuten.
Danach verschwand der junge Dr. Weir aus unserem Leben. Wir hatten so wenig Interesse an ihm, dass wir uns nie nach ihm erkundigten, nicht einmal an ihn dachten, bis Onkel Clarence uns Monate später beiläufig mitteilte, Silas Weir habe Chestnut Hill & seine Famulatur bei Ambrose Strether »ziemlich plötzlich« drangegeben & eine Stelle in New Jersey angetreten.
»Tabitha! Silas Aloysius – ist das Dr. Weir – unser Dr. Weir?«
Mama war zwar gealtert, hatte aber noch fast dasselbe scharfe Auge wie immer & in der neuesten Ausgabe von Harper’s Weekly ein ihr bekanntes Konterfei erblickt, das sie mir gebieterisch hinhielt.
»Oh, ich glaube – ja –, das ist er. Er nennt sich jetzt anscheinend Silas Aloysius Weir.«
Ich betrachtete die Zeichnung eines äußerst würdevollen Herrn mittleren Alters mit borstigem Schnurrbart, schämte mich nicht wenig. Und Mamas mokantes Lächeln war mir kein sonderlicher Trost.
Jahrzehntelang hatte niemand in Chestnut Hill einen Gedanken an »Dr. Silas Weir, Arzt« verschwendet. Er war ebenso spurlos aus unserem Gedächtnis verschwunden wie das eine oder andere unserer irischen Mädchen, die ihre Dienstschuld in unserem Haushalt abgearbeitet hatten & bei Auslaufen ihres Vertrags gegen geringen Lohn & mit Vaters Segen aus unseren Diensten entlassen, ihrer Wege geschickt & vergessen wurden. Bis Dr. Weir Jahre später Bekanntheit dafür erlangte, dass die »Nationale Gesellschaft der Medizinischen Wissenschaft« ihm für seine »tiefgreifenden Neuerungen« in der Chirurgie, insbesondere im Hinblick auf die »weibliche Anatomie«, einen bedeutenden Preis verlieh & ihn, höchst erstaunlich, als »Begründer der modernen Gynäkopsychiatrie« bezeichnete.
Gynäkopsychiatrie! Ein Wort, das man nicht einmal laut murmeln kann, so hässlich & beunruhigend ist sein Klang.
Wir hatten nur eine vage Vorstellung davon, was das sein mochte – Gynäkopsychiatrie –, eine besondere Krankheit des »Geistes« bei Frauen. Aber doch offenbar eine sehr seltene, wenn kein einziger Arzt in Chestnut Hill auf dem Gebiet ausgebildet war.
Was Dr. Weirs medizinische Neuerungen sind, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel im Harper’s Weekly nur überflogen. Ich würde die Besinnung verlieren, würde ich genauere Kenntnis über solche Details des weiblichen Körpers erlangen, da bin ich mir sicher; meine Nerven sind so angegriffen, dass bestimmte Wörter mich beunruhigen.
Und erst recht unerwünschte Erinnerungen an eine Mädchenzeit, die lange vorbei ist, als ich so schön war, dass ich über einen »Verehrer« grausam lachen konnte …
Ah, Dr. Weir! Nach zwölf Schwangerschaften, sieben Totgeburten & fünf Geburten, mit zwei noch lebenden Kindern, beide inzwischen erwachsene Männer, & sieben (noch lebenden) Enkeln gesegnet, würden Sie Ihr ausgelassenes Kätzchen Tabitha nicht wiedererkennen, fürchte ich.
Meine Nerven sind nicht mehr so stabil, wie sie es einst waren, & meine Gedanken nicht mehr so spielerisch & funkelnd. Meine geschwollenen Knöchel & mit Krampfadern überzogenen Beine können meinen umfänglichen Leib kaum tragen. Meine eutergleichen Brüste würden mir auf den Schoß sinken wie Sandsäcke, würden feste Unterkleider sie nicht in Schach halten.
Wirklich, ich finde es schwierig, mir auch nur vorzustellen, geschweige denn zu bereuen – ich weiß nicht, was …
Und Mama bringt das Thema Dr. Weir auf, um mit mir zu schimpfen, als wäre ich keine Frau in späten mittleren Jahren, deren Haut ständig gerötet ist & deren Haar dünner wird, sondern ein eigensinniges junges Mädchen mit Fünfziger-Taille.
»Ich fand, dieser junge Doktor war sehr vielversprechend, wenn du dich erinnerst – du & deine Schwestern, ihr wart sehr dumm, das nicht zu sehen. Wäre der Rollins-Clan dir nicht zu Kopfe gestiegen & hättest du stattdessen den feschen jungen Silas Weir geheiratet – wärst zu dieser Stunde du die Frau des Begründers der Gynäkopsychiatrie …«
Der Famulus (1835 – 1836)
Dr. Milton Thorpe, Arzt
Chestnut Hill, Pennsylvania
Ihn! »Silas Aloysius Weir«, wie er sich nun nannte, den würde ich sicherlich nicht vergessen.
Tatsache ist, solange wir ihn in Chestnut Hill kannten, war er »Silas Weir« – nichts Auffallendes an ihm oder seinem Abschluss vom medizinischen College in Philadelphia, wo der gesamte Einführungskurs bloße vier Monate dauerte.
Meine Erinnerungen an Silas Weir stammen aus dem turbulenten Jahr, das wir gemeinsam in Dr. Strethers Praxis als Famuli des lang gedienten Arztes verbrachten; ich, zwei Jahre älter als er & mit einem medizinischen Abschluss vom selben College in Philadelphia (wie er), & er, 1834 gerade fertig geworden & für einen Dreiundzwanzigjährigen noch sehr jung & unerfahren.
Als Arzt war Silas Weir allerdings nicht vielversprechend & als Chirurg erst recht nicht. Unter den Weirs in Massachusetts, ließ er mich wissen, gebe es »bedeutende« Ärzte & einer seiner Onkel sei ein berühmter Astronom in Harvard, weshalb mich natürlich interessiert hätte, warum Silas an eine mittelmäßige medizinische Hochschule gegangen war & nicht vielmehr nach Harvard oder an die Universität von Pennsylvania, auch wenn ich nicht so unhöflich war & danach fragte.
Er hatte erkennbar richtig Angst, in Strethers Untersuchungszimmer einem Patienten gegenüberzutreten, drängte mich jedes Mal, ihm vorauszugehen, & folgte mir dann in den Raum.
Sofern Strether ihn nicht direkt ansprach & aufforderte, ein Urteil zu riskieren, brachte Weir die ganze Untersuchung hindurch keinen Ton heraus & blickte ängstlich auf die erkrankte Person, wenn es ein Mann war; eine Frau wagte er kaum anzusehen.
Zuweilen zitterte er förmlich, stellte ich fest, wie vor Kälte.
(Und tatsächlich fror er anscheinend viel. Bei kalter Witterung waren seine Fingernägel bläulich, häufig auch seine Lippen. Seine Ohren, ein bisschen größer als normal & an den Enden leicht spitz zulaufend, waren eigentümlich wächsern weiß, wie erfroren.)
Die meiste Zeit war daher ich genötigt, Dr. Strether zu assistieren, was mir nichts ausmachte, lernte ich auf die Weise doch viel über das praktische ärztliche Handwerk alter Schule, während Weir wie der Hasenfuß, der er war, in der Ecke hockte.
Denn schon bald zeigte sich, dass Weir bei Körperkontakt unwohl war – ein ziemlicher Nachteil für einen Arzt! Zweifellos hatte er noch keine intime Erfahrung mit einer Frau gemacht & sicher noch nie einen unbekleideten weiblichen Körper betrachtet. Eine nackte oder auch nur eine halb bekleidete Frau zu sehen flößte zu der Zeit vielen christlichen jungen Menschen Angst ein, & Weir war keine Ausnahme; sogar Mädchen aus guten christlichen Familien hatten keine Vorstellung davon, wie ihr unbekleideter Körper aussah, da man ihnen beigebracht hatte, ihre Geschlechtsteile zu betrachten sei eine Sünde, wenn nicht gar dämonisch. Und natürlich hatten sie keinerlei Kenntnis von den physiologischen Vorgängen der Fortpflanzung & traten in völliger Ahnungslosigkeit in die Ehe ein.
Zusätzlich zur normalen Unsicherheit empfand Weir wie viele Männer & Jungen seiner Zeit insbesondere Abneigung gegen weibliche »Geschlechtsteile«; unbestreitbar eine Anziehung der Art, wie sie von Verbotenem & Obszönem ausgeht, alles in allem aber ein instinktives Missfallen, das in unverhohlenem Ekel gipfelte.
Mit der Zeit, so geht es aus seiner Autobiografie hervor, sollte er sich nicht mehr schwertun, Frauen der unteren Klassen zu behandeln, vor allem Dienstschuldnerinnen & irische Immigrantinnen, die er für »Tiere« hielt, in Gegenwart von Frauen aus »gutem Hause« aber war er mit Stummheit geschlagen.
Vor den vornehmeren, den begüterten schreckte er zurück, als wären es Göttinnen, ähnelten sie doch den Frauen aus der eigenen Familie & den Nachbarn in Concord. Als ein jüngerer Sohn selbst gewissermaßen deklassiert, kam er kaum als Haupterbe des väterlichen Vermögens in Betracht & war daher besessen von der Hoffnung, durch eine (wenig wahrscheinliche) Verbindung mit einer der jungen Erbinnen in Chestnut Hill eine gute Partie zu machen.
Da sich Dr. Strether dem Ruhestand näherte & junge Ärzte in Chestnut Hill, dem wohlhabenden Vorort von Philadelphia, im Überfluss vorhanden waren, hatte er seine reichsten Patienten verloren; in seine Praxis kamen meist die Frauen & Töchter hiesiger Händler, Handwerker & Arbeitsmänner, unterbezahlter Lehrer & dergleichen samt einer Prise Diener & Landarbeiter, von ihren Herren geschickt. Einige der eingewanderten Frauen ärmerer Sorte boten, ungeschnürt, einen erstaunlichen Anblick: Ihre Tiermutterleiber, von zahlreichen Schwangerschaften grotesk in die Breite gegangen, verströmten häufig einen höchst widerwärtigen Geruch; solche Frauen aus nächster Nähe zu untersuchen ist für jeden Arzt eine Prüfung, sogar für einen gestandenen Mediziner wie Strether.
»Den Atem anhalten, das werden Sie lernen müssen, Silas«, sagte Strether mitleidig lächelnd zu Weir & warf mir einen verständnisinnigen Blick zu, »wenn Sie Arzt werden wollen. Unsere Brüder in der Geistlichkeit haben es besser getroffen, sie befassen sich mit dem Odem der Seelen, der keine Gerüche ausdünstet.«
Weir versuchte lahm zu lachen. Er konnte einem fast leidtun, dieser Mann mit dem kranken, untergehenden Blick & dem verdrossenen Pferdegesicht.
»Ja. Ich sage mir: ›Jesus liebt uns alle.‹« Doch seine Miene sprach eine andere Sprache.
Fragen Sie sich, wie es sein kann, dass wir unsere Approbation als Ärzte erhielten, wenn wir so wenig Erfahrung mit Patienten hatten? In Philadelphia bestand der Hauptteil des Medizinstudiums aus Vorlesungen, meist langweiliger, trockener Art, gehalten von einem älteren Dozenten in einem monotonen Singsang, bei dessen Klang wir bald einschlummerten. Im Gegensatz zu den Studenten an angeseheneren Einrichtungen wie der medizinischen Fakultät der Universität von Pennsylvania sind wir Patienten nie begegnet; wir besuchten keine Krankenhäuser, kamen offiziell mit Krankheit nicht in Berührung. Unsere Vorlesungen beschränkten sich auf die Anatomie des Menschen, großer Wert wurde auf das Auswendiglernen der Körperteile & der unzähligen Knochen des Skeletts gelegt. Ein praktizierender Arzt hatte keinen Grund, sich diese Kenntnisse in Erinnerung zu rufen, da er, wie Dr. Strether, in seiner Praxis über Fachbücher & Tafeln verfügte, die er zurate ziehen konnte. Die zu der Zeit herrschende Lehre lautete: Im Zweifel zur Ader lassen – sprich, den Patienten; wir hatten jedoch noch nie gesehen, wie Blut aus Adern abgelassen wird, eine unschöne Prozedur, die wir als Anfänger bei älteren Ärzten lernten.
Wir mussten Sezierungen beiwohnen, durften uns zu unserer Erleichterung aber nicht daran beteiligen. An der Schule herrschte Leichenmangel, sie hatte sich mit den am stärksten verwesten & schäbigsten Leichnamen von Armen zu begnügen, nachdem sich die angesehenere medizinische Fakultät der Universität die besseren Exemplare gesichert hatte.
Die »klinische Untersuchung« übten wir an Puppen, deren Gestalt der männlichen & der weiblichen Anatomie ähnelte. Auch wenn sie wenig lebensecht waren mit ihren leeren blinden Augen & der porenlosen sandfarbenen Epidermis, wirkten sie beunruhigend realistisch auf die Empfindsameren unter uns, die wir allesamt noch sehr junge Männer waren, kaum älter als Jungen & ziemlich unerfahren; sogar eine rudimentäre Darstellung menschlicher Genitalien war schockierend für unsere Augen. Noch bestürzender aber waren die »schwangeren« weiblichen Puppen mit geschwollenen Bäuchen, in denen, wurden sie zu unserem Schrecken geöffnet, Fötusse befestigt waren, die hernach durch einen widerwärtig fleischfarbenen Kanal im Uterus aus dem Schoß der Puppe ausgetrieben wurden … Medizinstudenten, die so unbedarft waren wie Silas Weir, wurde flau bei dem grässlichen Anblick, oder sie ekelten sich.
Da die meisten Babys nicht von Ärzten, sondern von Hebammen entbunden wurden, wurde die Niederkunft innerhalb der Ärzteschaft nicht ernst genommen. Nur wenn eine Frau aus einer guten Familie ungewöhnlich komplizierte Wehen hatte, wurde vielleicht ein Arzt hinzugezogen & war als persönliche Gefälligkeit für den Hausherrn anwesend; im Übrigen nahm man hin, dass zahlreiche Kinder bei der Geburt oder kurz danach starben. Es kam vor, dass eine gesunde Mutter bei der Geburt eines Kindes verblutete oder aus einem rätselhaften, nicht feststellbaren Grund hohes Fieber bekam & starb. (Die »Entzündung« war offensichtlich – aber wodurch war sie verursacht? Und wie sollte man sie behandeln? Eine Patientin zur Ader zu lassen, die bereits viel Blut verloren hatte, war nicht zweckmäßig. Aristoteles hatte sich zu diesem medizinischen Problem nicht geäußert, doch wenn er es getan hätte, hätte man es sicher auf eine Hysterie des weiblichen Bluts zurückgeführt, die mit dem Uterus zu tun hatte. Und wie sollte man die behandeln?)
Die Schwierigkeit war, dass Puppen reglos sind, gleichgültig gegenüber »Schmerz« & nicht zu bluten beginnen, wenn die Geburtswehen einsetzen. Wir jungen Ärzte waren also auf eine tatsächlich komplizierte Geburt schlecht vorbereitet. Man nahm an, dass ein junger Arzt alles, was er wissen musste, in der Famulatur bei einem ausgewiesenen Arzt lernte, wie jeder junge Lehrling, ganz gleich in welchem Handwerk, von einem Älteren lernte, denn die Medizin galt zu dieser Zeit als Handwerk & nicht als geachteter Beruf. Von einem Studenten dieses Fachs wurde erwartet, dass er die Körperteile auswendig lernte, nicht jedoch, dass er wusste, wie der lebendige Körper tatsächlich funktionierte; Maßstab für das Körperbild war ein Weißer im besten Mannesalter; Frauen & Kinder waren von untergeordnetem Interesse.
Silas Weirs erster persönlicher Kontakt mit einer schwangeren Frau war verheerend – für ihn. Der bloße Anblick der (voll bekleideten) Frau mit dem geschwollenen Leib in Dr. Strethers Praxis, die unbequem saß & dem prüfenden Blick des finster dreinschauenden Arztes füllige weiße, grotesk von Besenreisern durchzogene entblößte Beine präsentierte, von denen sie die dicken Strümpfe heruntergerollt hatte, bewirkte, dass er auf der Stelle in Ohnmacht fiel!
Ich war es, der Weir mit Riechsalz wiederbelebte. Mit bebender Stimme erzählte er mir, er habe mal die unbedeckten Beine seiner Schwestern gesehen, als sie Kinder waren, nur flüchtig, noch nie im Leben aber die nackten Beine einer erwachsenen Frau, & habe sich nicht vorstellen können, wie »grob, hässlich & behaart« die seien – nicht wesentlich anders als seine eigenen.
Zum Glück wurden weibliche Patienten mehr oder weniger vollständig bekleidet untersucht, nur männliche teilweise entkleidet. Wenn Strether es nötig fand, legte er beim Körper eines männlichen Patienten Hand an, berührte weibliche Patienten aber nicht, wenn er es vermeiden konnte. Seine Famuli waren noch zaghafter. Wir hatten uns noch nicht einmal mit dem Stethoskop einen Herzschlag angehört, bis Strether es uns verschmitzt aufdrängte: »Hier! Hören Sie mal, ob da drin irgendetwas schlägt.«
Der Humor des älteren Doktors war mitunter etwas bemüht. Einmal, er untersuchte gerade einen betagten Patienten, reichte Strether das Stethoskop an Weir weiter, der sich den Herzschlag anhören sollte, hatte die Finger aber so um das Instrument gelegt, dass das Geräusch unterdrückt war. Weir wurde ganz blass, als er vergeblich horchte, & platzte schließlich heraus: »Mein Gott! Sein Herz ist stehen geblieben!«, während Strether mir zuzwinkerte & herzhaft zu lachen begann.
Noch erheiternder war Weirs Angst vor dem Anblick von Blut. Zuweilen bei der bloßen Aussicht auf den Anblick von Blut.
Mit der Zeit kam heraus, dass Silas Weir gegen den Willen seines Vaters darauf bestanden hatte, Medizin zu studieren. Percival Weir hatte offenbar keine hohe Meinung von seinem jüngsten Sohn; dessen Angst vor Blut wie vor anderen natürlichen Phänomenen war in der Familie bekannt & wurde bespöttelt. Es gab einen älteren Bruder namens Franklin, mit Abstand der Liebling, der an der medizinischen Fakultät von Harvard einen Abschluss mit Auszeichnung gemacht & eine vielversprechende Laufbahn als Chirurg in Boston eingeschlagen hatte. Sogar ein jüngerer Bruder, eben erst in Harvard abgegangen, hatte eine aussichtsreiche Laufbahn als Chemiker vor sich. Alles, was Silas in Angriff nahm, stand in scharfem Kontrast zu den Erfolgen seiner Brüder & ließ zu wünschen übrig.
Widerstrebend erklärte sich Weirs Vater bereit, ihm die Ausbildung an der Medizinischen Fachschule von Philadelphia zu bezahlen, aber nur, weil Silas keine anderen Fähigkeiten oder Talente – für Recht, Pädagogik, nicht einmal für ein geistliches Amt – erkennen ließ; er würde höchstwahrscheinlich auch weder eine reiche Bostoner Erbin heiraten noch eine einträgliche Position im Geschäftsleben oder Finanzwesen finden. Ärzte, deren Praxis nicht von Wohlhabenden aufgesucht wurde, insbesondere in ländlichen Gegenden, galten nicht wesentlich mehr als reisende Handlanger, die man für Reparaturen bestellte, & wurden schlecht bezahlt, wenn überhaupt. Zum Verdruss der Weirs von Concord, Massachusetts, sah es danach aus, als stünde Silas Weir so ein minderwertiges Leben bevor.
Als ich ihn fragte, wie er verhindern wollte, dass Dr. Strether seine Angst vor Blut bemerkte, bettelte er: »Kannst du mir helfen, Milton? Ich will ja.«
Als ein junger Arbeiter in die Praxis gebracht wurde, dem bei einem Unfall mit einer Axt beinahe der Fuß abgetrennt worden wäre, stand Weir hilflos zitternd daneben, als Strether & ich uns wacker (wenn auch vergeblich) bemühten, den Mann davor zu bewahren, dass er vor unseren Augen verblutete; ein andermal ging Weir mir (träge) zur Hand, als ich mich in fliegender Hast um die heftig blutende Platzwunde kümmerte, die sich eine Frau beim Sturz auf der Steintreppe vor einer Kirche in Chestnut Hill zugezogen hatte, wo sie mit dem Kopf auf jeder Stufe aufgeschlagen war & sich die Haut so stark lädiert hatte, dass sie fast vom Schädel abgerissen worden wäre; die Frau, korpulent & in mittleren Jahren, stammte aus einer sehr angesehenen hiesigen Familie.
Ein andermal kippte Weir gleich um, als ich Strether bei der Entfernung gangränöser, stark verfaulter Zehen vom Fuß eines (zuckerkranken) Patienten assistierte, der festgeschnallt werden musste, damit wir »operieren« – das heißt mit einer Säge amputieren – konnten.
Zogen sich Geburtswehen über drei Tage hin & machten es erforderlich, dass der blutbespritzte Arzt eine Zange in den weit geöffneten Muttermund der Frau einführte & den lebenden oder – eher – toten Säugling herauszog oder, noch blutiger, ohne Betäubung einen kunstlosen Kaiserschnitt durchführte, musste Weir die Augen schließen & leise vor sich hin beten, damit er nicht in Ohnmacht fiel.
Bei einer Gelegenheit erforderten schmerzhaft verdickte Hämorrhoiden, die einen (korpulenten) männlichen Patienten plagten, einen strapaziösen, mit dem als Écraseur bekannten Instrument durchgeführten Eingriff – bei dem der Blutfluss zur Hämorrhoide durch das Zuziehen einer Schlinge, ähnlich wie bei einer Garrotte, unterbunden wird. Auch diese Operation fand ohne Betäubung statt, sodass der Patient zu seiner eigenen Sicherheit an einen Tisch gefesselt werden musste; denn der Schmerz war so groß, dass er sich herumwarf, mit den Beinen ausschlug & Strether getroffen hätte, der mit einem Ausdruck äußerster Konzentration, wenn auch Widerwillen das Instrument anlegte, bevor er es an mich, der ihm assistierte, & dann an Weir weiterreichte, der zaghaft danach griff, da es glitschig war von Blut.
Strether herrschte Weir an: »Zufassen, Silas, & verwenden, wie es sich gehört – oder für Sie war es das hier in Chestnut Hill.«
Weir versuchte es also, hantierte ungeschickt mit dem Instrument herum; zu seinem Glück war der schreiende Patient inzwischen in Ohnmacht gefallen & wehrte sich nicht mehr. Trotzdem stümperte Weir noch herum & ließ den Écraseur sogar zu Boden fallen, wo er etwas Schmutz abbekam.
Geduldig hielt Strether Weir zum Weitermachen an, denn es war nur noch eine geschwollene Hämorrhoide übrig, & die hatte der junge Arzt einige unangenehme Minuten später auch verkleinert.
»Sie sehen, Silas – mit Beharrlichkeit kommen Sie voran. Wer weiß, eines Tages finden Sie vielleicht sogar Gefallen an diesen gröberen Handgriffen.«
Als wir hinterher alles säuberten, fragte Weir mich mit aschgrauem Gesicht, ob ich gewusst hätte, dass es solche grauenhaften Dinge in Gottes Schöpfung gab – er jedenfalls habe das nicht gewusst.
Kühl erwiderte ich: »Gott gilt alles, was er sieht, gleich viel, würde ich meinen.«
»Alles – gleich viel? Das kann ich nicht glauben.«
Weir starrte mich verständnislos an. Sein Gott war der Gott Johannes Calvins, der menschliche Schwäche tief verachtete & nur zu bereit war, manches, worauf sein Blick fiel, für höllisch, ja verdammt zu halten.
War ein Patient kein Notfall & ging es in der Praxis relativ ruhig zu, war Silas Weir als Famulus durchaus tüchtig, das muss ich zugeben. Nach & nach gebärdete er sich, zumindest wenn Strether nicht anwesend war, ziemlich aufgeblasen & autoritär, wenn er die häufig auftretenden Beschwerden behandelte – Ballenzehen, Ausschläge, (normalgroße) Hämorrhoiden, Zysten & Furunkel, Magenverstimmungen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Verstopfung, Pfeifatmung, Fieber & Erkältungen, Grippe, »Klingeln in den Ohren« oder die »Nerven« et cetera; bei diesen Leiden wie bei allen anderen lernten wir die jeweils übliche Behandlungsmethode & verschrieben ein begrenztes Repertoire an Arzeneien: Laudanum, Fingerhut, Quecksilber, Tollkirsche, Echinacea, Ginkgo biloba, Weißdorn, Knoblauch, Schwarzwurz, Johanniskraut & geringe Mengen von Arsen- & Kokaintropfen.
Wie bereits erwähnt, war der gängigste medizinische Eingriff die Phlebotomie, der Aderlass, der für alle Leiden verschrieben wurde, da man glaubte, die meisten Krankheiten rührten aus einem Überfluss von Blut oder »erhitztem« Blut her. An diese auf die Antike zurückgehende Tradition glaubte Strether fest: Im Zweifelsfall zur Ader lassen. Es war jedoch eine unangenehme, unappetitliche Prozedur, die der ältere Arzt am liebsten an seine Famuli delegierte.
Überraschenderweise stellte Weir fest, dass er ein besonderes Talent dafür besaß. Anscheinend linderte es seine panische Angst beim Anblick von Blut, wenn er den Patienten selbst zur Ader ließ & nicht bloß Zeuge war.
Ja, mit der Zeit entdeckte ich, dass ein seltsames Funkeln in Weirs tiefliegende feuchte Augen trat, wenn er zum Aderlassmesser griff & die Vene eines Patienten eröffnete, mochte der an Fieber oder Erkältung leiden, an kaltschweißiger Haut, an pochenden Kopfschmerzen oder an Pfeifatmung, Brustschmerzen & Palpitationen, einer Rückenverletzung, schwerer Verstopfung oder Diarrhö, Übelkeit oder tumorhaften Gewächsen – Weir wurde so geschickt in der Kunst der Phlebotomie, dass er schon bald sogar weibliche Patienten zur Ader lassen konnte, vorausgesetzt, sie stammten nicht aus »guten« Familien & waren vollständig bekleidet & nicht jung oder hübsch. Mehr als einmal hatte ich einen Blick auf Weir erhascht, der seine rot glänzenden Hände mit einem Ausdruck verdutzter Bewunderung betrachtete, bevor er sie wusch.
»Endlich etwas, was unser junger Freund zuwege bringt«, sagte Strether trocken zu mir. »Und wird nicht mal selbst ohnmächtig, sondern sorgt bloß beim Patienten dafür.«
Natürlich ist die Phlebotomie als Wissenschaft ebenso unzuverlässig wie die Phrenologie, & manchmal kam es vor, dass schwache, blasse Patienten, wenn wir sie zur Ader ließen, noch schwächer & blasser wurden & in Ohnmacht fielen, gelegentlich sogar vor unseren Augen verschieden, während ihr Blut in den Eimer auf dem Boden tropfte, ein Umstand, der Strether entsetzte & sehr fuchste, denn er wollte, auf seine alten Tage reizbar geworden, von seinen Famuli nicht in Verlegenheit gebracht werden.
»Hast du Narr es wieder geschafft? Tut noch einer seinen letzten Atemzug?«, fauchte Strether Weir an, dessen Angewohnheit, fest die Augen zu schließen & Gebete vor sich hin zu murmeln, wodurch er in einen tranceartigen Zustand geriet, unter diesen Umständen nicht hilfreich war.
In Todesfällen wie dem in der Praxis des Arztes sah man Werke Gottes. Ein Christ verstand: Seine Zeit war gekommen.
Durch seine Erfolge als Phlebotomist mutig geworden, bildete sich Weir mit der Zeit ein, er wäre Experimentalchirurg.
Mit bloßer klinischer Medizin hatte man keine Zukunft, wurde ihm klar. Wollte er mit seinen Brüdern & anderen Weirs, die sich »einen Namen gemacht« hatten, mithalten, müsste er auf ein neues Gebiet vorstoßen, Risiken eingehen & seine Ergebnisse in den angesehensten medizinischen Fachzeitschriften publizieren.
Schloss die Praxis in den frühen Abendstunden, blieb Weir noch da & las bei Kerzenlicht medizinische Zeitschriften, manchmal bis Mitternacht. Ach, einer der berühmten amerikanischen Ärzte zu sein! Der Ärzte, die medizinische Verfahren, die grundlegend neue Behandlungsmethoden entwickelt hatten! Er gab sich verführerischen Fantasien hin, in denen er neue Wege bei der Heilung gewöhnlicher Gebrechen (Klumpfuß, Gaumenspalte, Schielen) beschritt – das allein sicherte ihm den Erfolg & einen Platz in der Geschichte der Medizin. Er verfiel auf die Idee, »Geisteskrankheit« als Variante von »Fieber« zu behandeln; er geriet in den Bann der Phrenologie, einer neuen Disziplin, die Zusammenhänge zwischen Arealen des Gehirns & menschlichen Handlungen & Gefühlen herstellte, die lehrte, dass sich von der Gestalt der Schädelknochen bedingte Krankheiten wie Epilepsie, geistige Behinderung, Wahnsinn & »Stimmungsschwankungen« durch chirurgische Eingriffe behandeln ließen.
Ursache für viele dieser Krankheiten, glaubte man, sei das Handeln unwissender Hebammen bei der Geburt; so wurde es weithin an medizinischen Fakultäten gelehrt. Allein schon, dass die Hebammen Frauen waren, erklärte einen Großteil der Irrtümer, auf die erhebliche Schädigungen der Gebärenden & der Säuglinge zurückgingen; & dennoch war die Entbindung als medizinische Prozedur verpönt & galt als die buchstäblich schmutzigste & scheußlichste von allen, sodass sich angesehene Ärzte, außer unter besonderen Umständen, nicht dazu herabließen, bei Geburten zu assistieren.
Es war um diese Zeit, dass Silas Weir vom Diakon der Kirche, die er besuchte, mit guten Absichten vermittelt, zum Freitagstee ins Haus der Tyndales, einer der führenden Familien von Chestnut Hill, eingeladen wurde – & er, eitler Narr, der er war, brüstete sich mir gegenüber damit. (Als ob ich eifersüchtig auf ihn sein könnte.) Treuherzig vertraute er mir an, er hoffe, sich »einen Namen zu machen« & Tabitha, die jüngste Tyndale-Tochter, zu beeindrucken, eine »engelsgleiche Schönheit«, die eines Tages eine Tyndale-Erbin sein würde; Weir schien sogar zu glauben, Mrs. Tyndale sei von ihm eingenommen & ermutige ihn, Tabitha, die gerade mal achtzehn Jahre alt war, »den Hof zu machen«.
Weirs plumpe Prahlerei war so geschmacklos & unreif, dass ich ihm schließlich sagen musste, ich wolle nichts mehr von den Tyndales hören. Wenn er mit Tabitha verlobt war, sei zum Prahlen immer noch Zeit.
»Stimmt! Du hast recht«, sagte Weir & errötete, mehr aus Zorn als vor Verdruss. »So weit ist es noch nicht. Aber – wir werden sehen.«
Bei solchen Gelegenheiten kam das immense Geltungsbedürfnis des Mannes zum Vorschein. Persönlich nicht eben eindrucksvoll, von eher schmächtiger Statur, mit vor der Zeit herabhängenden Schultern & runzliger Stirn & mit einer Art wie ein aufgeregter Hund, der zwanghaft im Schmutz herumscharrt – & doch hatte er eine hohe Meinung von sich.
Zweifellos sind Selbsttäuschungen gang & gäbe unter denen, die Größe erstreben, ohne die dafür notwendige Integrität, Einsicht & Begabung mitzubringen.
Bald darauf fiel Weir ein besonders bedauernswertes Kleinkind in die nach chirurgischen Experimenten gierenden Hände.
Dieses Kleine, ein Mädchen & gerade einmal fünf Monate alt, war das neunte Kind einer Frau, die nicht in Chestnut Hill, sondern unweit davon in einer ländlichen Siedlung aus Landarbeitern, Tagelöhnern & Taugenichtsen lebte, viele davon aus verschiedenen Gründen – Alter, Krankheit, Verletzungen, Alkohol – stellungslos. Die Frau, deren Name Brush lautete, lebte nichtehelich mit einer kunterbunten Abfolge von Männern zusammen, alle dem Trunk ergeben, & war angeblich wie ihr Nachwuchs von sehr geringer Intelligenz; eine weitläufige Familie mit zweifelhafter Ahnenreihe, unverkennbar gemischten Bluts, der »Schwachsinn« für das scharfe Auge unverkennbar.
Das christliche Empfinden stand einem sündhaften Leben außerhalb der Ehe entgegen, & medizinische Versorgung für in Armut Lebende war kaum vorhanden, sodass eine derart heruntergekommene Mutter & ihre Kinder kaum Nachsicht & Hilfe fanden. Sogar Dr. Strether, seinem Wesen nach weder selbstgerecht noch voreingenommen, sagte oft mit mitleidigem Kopfschütteln, ein kurzes Leben sei die einzige Wohltat für solche Menschen. Es war nicht zu erwarten, dass diese kranken Kinder älter als sechs oder sieben wurden; doch es ergab sich auf verdrehte Weise, dass die schwachsinnige Familie Brush in einer baufälligen Hütte am Rande der Stadt wuchs, wenn nicht gar gedieh.
Wie genau Weir von der liederlichen Mutter des fünf Monate alten Mädchens erfuhr, wie es kam, dass die kleine Brush zu ihm gebracht wurde – als die Praxis, wie Dr. Strether annahm, doch schon seit Stunden geschlossen war –, habe ich nie erfahren, auch wenn nach dem Unglück Gerüchte grassierten.
Vielleicht hatte der ehrgeizige junge Arzt, wie manche spekulierten, Erkundigungen unter den ärmeren Bewohnern der Gegend eingezogen & Bargeld angeboten, wenn sich Freiwillige für seine chirurgischen Experimente zur Verfügung stellten; gut möglich, dass er das kleine Kind für seine Zwecke »gemietet« hatte.
Anfangs war Weir offenbar zufrieden mit dem Kind – sogar von ihm beflügelt. Denn dies war ein Geschöpf, das dringend reparaturbedürftig war, wie jeder auf den ersten Blick sehen konnte.
Das quengelige, fiebrige Kind hatte einen missgebildeten Schädel wie eine Melone, die asymmetrisch gewachsen war. Oberhalb des rechten Auges trat eine knochige Wulst hervor, die sich wie ein flacher Kamm über den gesamten Scheitel hinzog & nichts ähnelte, was der angehende Arzt je außerhalb eines Fachlehrbuchs gesehen hätte. Weir konnte mit den Fingern über die Erhöhung hinwegstreichen & den deformierten Schädel fast schon mit den Fingern in eine andere Form drücken, denn die Schädelknochen eines Kleinkindes wachsen erst im Laufe des ersten Lebensjahrs nach & nach zusammen & sind bis dahin in Maßen veränderbar. Der Kopf dieses Kindes, stellte Weir fest, fühlte sich heiß an – auch wenn er, zugegeben, nicht wusste, wie warm ein Säuglingskopf sein sollte. War das Fieber? Der Hautton war zweifellos ungesund, ein ikterisches Gelb im Gegensatz zum natürlicheren rosigen Schimmer eines normalen Kleinkindes, & die Augen sahen aus wie asymmetrisch eingestellt – das heißt, als »sähen« sie aus verschiedenen Winkeln. (Oder war das arme Ding blind? Weir schwenkte die Finger vor den Augen, wurde sich aber nicht schlüssig.)
Beim Vergleich des kindlichen Schädels mit der phrenologischen Schautafel an der Wand von Strethers Untersuchungszimmer kam er zu dem Schluss, dass die Hirnregion, die als der Sitz der »moralischen & religiösen Empfindungen« galt, unnatürlich abgeflacht war, während die Regionen, die mit »Destruktivität«, »Heimlichkeit« & »Unaufrichtigkeit« in Zusammenhang standen, unverhältnismäßig ausgeprägt waren.
Die kleine Brush würde also, konnte sie ungehemmt heranwachsen, eine ebenso unmoralische Kreatur werden wie ihre Mutter. Er würde diese Krankheit kurieren.
Weir bemühte sich, mit starkem Druck seiner Finger dem Schädel der Kleinen, die strampelte & sich brüllend, das Gesicht rot wie ein Teufel, hin & her warf, eine andere Form zu geben. Die Schreie des Kindes waren so laut & kraftvoll, dass Weir sich eines Wattebauschs bedienen musste, den er ihm in den Mund steckte, um das Geräusch zu dämpfen, was halbwegs gelang. Bald darauf resignierte er an einer manuellen Verschiebung der Schädelplatten, wofür mehr Kraft benötigt wurde, als er in den Händen besaß, & griff zu einem chirurgischen Instrument aus Strethers Praxis, ähnlich einer (spitzen) Zange, um die (weichen) Schädelplatten des Kindes neu auszurichten, & danach zu einer Schuhmacherahle, in einer Schublade gefunden, mit der sich besser hebeln ließ.
Unversehens flossen Rinnsale von Blut aus den Wunden im Kopf des Kindes.
Weir wischte das Kinderblut mit Verbandmull weg. Ah, er durfte der Angst nicht nachgeben! Er hatte vergessen, falls er es je wusste, dass Schädelarterien besonders fein sind & Schädelwunden höchst eindrucksvoll bluten, sogar (offensichtlich) bei einem kleinen Kind.
»Hör auf! Herrgott, dir tut doch niemand was …«
Der Kampf zog sich noch einige mühsame Minuten hin, in denen Weir versuchte, die Ahle anzusetzen & die (sichtbare) Fehlstellung zu korrigieren, & das Kind sich wehrte, um sein Leben strampelte & zappelte.
»Ich sagte – hör auf. Du bist ein kleiner Teufel.«
Dann hörte das Kind zu Weirs Entsetzen unvermittelt auf zu strampeln & atmete kurz darauf auch nicht mehr.
Er entfernte den Knebel aus dem Mund & bemühte sich einige Minuten lang, das Kind wiederzubeleben, indem er hektisch auf den kleinen Brustkorb pochte & inbrünstig betend Gott um Hilfe & Erbarmen anflehte. Wie zur Schur für den großen Traum des jungen Doktors hatten die kleine Lunge das Atmen & das kleine Herz das Schlagen eingestellt. Eine Puppe mit warmer Haut, aber ohne Leben – Weir schreckte angewidert vom Operationstisch zurück.
Wie konnte das sein? – der kleine Teufel, unter seinen Händen erst ungemein lebendig & kampflustig; dann leblos.
Bevor ihm genügend Zeit gegeben worden war, die Missbildung des Schädels zu korrigieren, hatte die Vorsehung sein Bestreben vereitelt – doch warum? War es eine Missachtung von Gottes Willen, wenn ein Arzt & Chirurg den Versuch unternahm, so ein Leiden zu beheben?
Mit seinem unerschütterlichen Glauben an seinen Schöpfer & an Jesus Christus, seinen Erlöser, konnte Weir nicht begreifen, wieso Gott zugelassen hatte, dass er beim ersten Experiment seiner Laufbahn scheiterte, & das bei besten Absichten.
Eine kurze Weile stand er reglos vor dem blutbeschmierten kleinen Körper, mit Stummheit geschlagen. Die Stille im Raum war ohrenbetäubend. Noch nicht einmal die Verärgerung seines Vaters über ihn war zu vernehmen.
Bis es Weir langsam dämmerte: Die kleine Brush war offensichtlich fehlerhaft & nicht zum Weiterleben bestimmt gewesen.
Sehr wahrscheinlich war das Kind bei der Geburt von einer unkundigen Hebamme beschädigt & danach von der schlampigen Mutter unachtsam gestillt worden. Deshalb war dieser Tod mit Sicherheit nicht seine Schuld.
Trotzdem wühlte der Anblick des kleinen Körpers Weir auf. Jetzt, wo er sich nicht mehr bewegte, war er so viel kleiner, als er beim Kampf um sein Leben ausgesehen hatte. Er hatte noch nie zuvor ein totes Kind gesehen, überhaupt keinen toten Körper, nur die Leichname in der medizinischen Fakultät, & diese zerstückelten Exemplare hatte er nur durch die Finger hindurch zu betrachten gewagt.
»Es ist nicht meine Schuld. Doch – irgendwie muss ich dafür verantwortlich sein.«
Weir ließ der Mutter mitteilen, sie solle sofort ihr Kind abholen. Angesichts des Kummers der Frau & trotz des widerwärtigen Gin-Geruchs, den ihr Atem verströmte, bemühte er sich, in Ruhe mit ihr zu sprechen, weder ihr Vorwürfe zu machen noch überhaupt irgendwem die Schuld zu geben, kam jedoch nicht umhin, zu wiederholen, dass das Kind fehlerhaft gewesen sei, als es ihm geliefert worden war.
Wie besprochen bezahlte er der Mutter die volle Summe, war freilich überzeugt, dass man ihm mit dem Kind beschädigte Ware untergejubelt & die Frau ihn sehr wahrscheinlich zum Narren gehalten hatte, vielleicht angestiftet von einem zynischen Gefährten.
Es war ein Bild des Jammers & ging dem jungen Doktor zu Herzen, als die Frau mit dem rotfleckigen Gesicht ihr lebloses Kind, eingewickelt in das schmuddelige Umschlagtuch, in dem man es ihm gebracht hatte, schicksalsergeben aufhob & weinte wie ein Tier, falls ein unvernünftiges Tier weinen konnte, & noch jämmerlicher, demütig einen Dank für die Geldscheine, die er ihr in die Hand gedrückt hatte, murmelte.
Silas Weir war sich so sicher, dass er eines Tages eine Berühmtheit der medizinischen Wissenschaft werden würde, dass er all diese Lehrjahre hindurch ein Ärztetagebuch führte. Ein eindeutiger Verweis auf diesen verpfuschten Eingriff findet sich im ersten der elf Diarien, allerdings ohne Datumsvermerk:
Was für ein Schlag! Ich konnte es nicht begreifen. Wem war damit gedient, dass die grausame Vorsehung es zuließ, dass ich den ersten Patienten verlor, der ganz meiner gewesen war, in einer kleinen Gemeinde wie Chestnut Hill, in der alle darüber klatschen würden? Das einzig Gute daran war, dass es sich um ein geistesschwaches kleines Kind handelte, von einer geistesschwachen & kranken Mutter, die die ihr gezahlte bescheidene Summe annehmen & mir keine Schwierigkeiten machen würde, da war ich mir sicher.
In Dr. Strethers Untersuchungszimmer war einiges Blut vergossen worden, & Weir war sich nicht sicher, ob er in seiner Aufregung alles weggewischt hatte. Der junge Doktor hielt es daher für das Klügste, am nächsten Morgen früh zu erscheinen, weiter sauber zu machen & gleich selbst vor den älteren Arzt hinzutreten & ihm den unglücklichen Vorfall zu »beichten«.