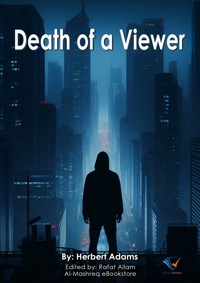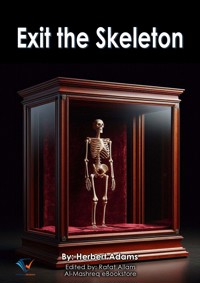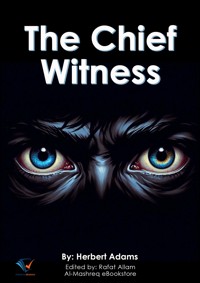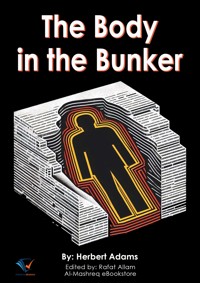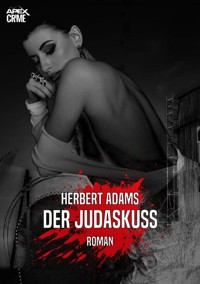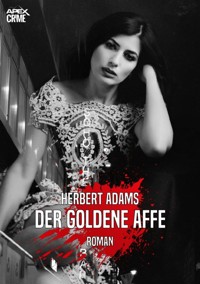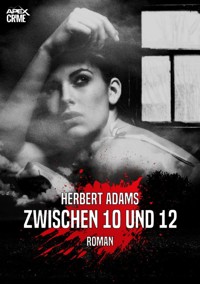6,99 €
Mehr erfahren.
Gilbert ging in sein Zimmer hinauf. Dort schritt er unruhig hin und her, obgleich sein Entschluss eigentlich schon feststand. Unter ihm, im Zimmer seines Onkels, das dem Garteneingang gegenüberlag, brannte noch Licht, als er um neun auf den Balkon hinaustrat, der den größeren Teil der Vorderfront entlanglief.
Auf Zehenspitzen schlich er ans äußerste Ende, kletterte dort über das Geländer und ließ sich in den Garten hinabfallen. Hätte er das Haus durch die Haustür verlassen, so hätte Onkel Luke ihn wahrscheinlich gehört und gefragt, wohin er ginge. Darum hatte er sich schon als kleiner Junge angewöhnt, sich auf diese Weise unbemerkt davonzumachen und wiederzukommen, um nicht über jeden Schritt Rechenschaft ablegen zu müssen. Als er Bobbie kennengelernt hatte und sich abends heimlich mit ihr traf, hatte er sich fast täglich auf diese Art aus dem Hause geschlichen...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Der Schlaftrunk erschien erstmals im Jahr 1951; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
HERBERT ADAMS
Der Schlaftrunk
Roman
Apex Crime, Band 180
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER SCHLAFTRUNK
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Gilbert ging in sein Zimmer hinauf. Dort schritt er unruhig hin und her, obgleich sein Entschluss eigentlich schon feststand. Unter ihm, im Zimmer seines Onkels, das dem Garteneingang gegenüberlag, brannte noch Licht, als er um neun auf den Balkon hinaustrat, der den größeren Teil der Vorderfront entlanglief.
Auf Zehenspitzen schlich er ans äußerste Ende, kletterte dort über das Geländer und ließ sich in den Garten hinabfallen. Hätte er das Haus durch die Haustür verlassen, so hätte Onkel Luke ihn wahrscheinlich gehört und gefragt, wohin er ginge. Darum hatte er sich schon als kleiner Junge angewöhnt, sich auf diese Weise unbemerkt davonzumachen und wiederzukommen, um nicht über jeden Schritt Rechenschaft ablegen zu müssen. Als er Bobbie kennengelernt hatte und sich abends heimlich mit ihr traf, hatte er sich fast täglich auf diese Art aus dem Hause geschlichen...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Der Schlaftrunk erschien erstmals im Jahr 1951; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DER SCHLAFTRUNK
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Die beiden Herren saßen zusammen beim Frühstück, aber sie unterhielten sich nicht miteinander. Der üppig gedeckte Tisch und die ganze Einrichtung des Zimmers zeugten von Wohlstand, ja von Reichtum. Dem bunt leuchtenden Perserteppich, dem antiken Silber und der Vitrine mit dem alten Porzellan war anzumerken, dass die Bewohner dieses Hauses solche Kostbarkeiten nicht nur besaßen, sondern sich auch die Hilfskräfte leisten konnten, die für deren Pflege erforderlich sind.
Durch die Fenster sah man einen gepflegten, von Blumenrabatten eingefriedeten Rasen und hohe Bäume, deren Laub im hellen Grün des Frühlings leuchtete.
Dass die beiden Herren nicht Vater und Sohn sein konnten, war ganz offensichtlich. Dazu waren sie einander viel zu unähnlich. Der Ältere, ein Sechziger, war ein großer, breitschultriger Mann, dessen ungewöhnlich dichtes Haar schon schneeweiß war. Es war so stark gelockt, dass es fast wie eine Perücke wirkte. Sein glatt rasiertes Gesicht war vielleicht etwas allzu rosig, um völlig gesund zu wirken. Die vorspringende Nase, der gerade etwas harte Mund und die buschigen Augenbrauen, die noch Spuren ihrer früheren dunklen Farbe aufwiesen, verrieten jedoch eine starke Persönlichkeit, einen entschlossenen und vielleicht sogar eigensinnigen Charakter. Er hieß Luke Bigwood.
Ihm gegenüber saß sein Neffe Gilbert Chapman, ein schlanker junger Mann von fünfundzwanzig Jahren, mit blondem Haar, blauen Augen und einem kurz geschnittenen Schnurrbärtchen im sommersprossigen Gesicht. Seine Züge waren nicht sehr ausgeprägt, wirkten aber gutmütig und liebenswürdig. Er las die Morgenzeitung - oder tat doch so -, aber die verstohlenen Blicke, die er von Zeit zu Zeit seinem Onkel zuwarf, zeigten, dass er etwas auf dem Herzen hatte und nur auf den geeigneten Augenblick wartete, um sein Anliegen zur Sprache zu bringen.
Der ältere Herr ließ die neben ihm liegenden Zeitungen unbeachtet. Er hatte einen Brief geöffnet und blickte bereits so lange auf die Zeilen, dass er ihren Inhalt schon mindestens dreimal gelesen haben musste. Nicht dass das Schreiben schwer zu verstehen gewesen wäre, aber es erforderte einen sofortigen Entschluss.
Schließlich reichte er es über den Tisch und fragte: »Was hältst du davon?«
Der Brief kam aus Southampton, und das Datum war undeutlich.
Gilbert las:
Lieber Onkel Luke!
Du hast einmal gesagt, dass ein falscher Fünfziger immer wieder auftaucht, und darum wirst Du Dich auch nicht wundern, wenn Dir dieses Schreiben beweist, dass Du damit recht hattest. Ich bin soeben mit der Strongmore Castle von Rio hier angekommen und wäre sehr froh, wenn ich, sei es auch nur auf ein oder zwei Tage, zu Dir kommen könnte. Hoffentlich bist Du gesund und geht es Dir so gut, wie das in diesen schlechten Zeiten überhaupt möglich ist.
Ich fürchte, meine Rückkehr wird Dich enttäuschen. Aber ich kann alles erklären, wenn wir uns sehen. Eigentlich habe ich meine Stellung in Brasilien nur verloren, weil ich sie zu gut ausfüllte.
Es gab vielleicht einmal eine Zeit, wo ein englischer Verwalter für eine Kaffeeplantage sehr gesucht war, aber diese Zeit ist vorbei. Heute wollen die Leute in jedem Land ihre Geschäfte selbst führen. Indien den Indern, Afrika den Afrikanern, so geht das überall. Kurz, nachdem ich zwei Brasilianer so weit angelernt hatte, dass sie meine Arbeit zur Not übernehmen konnten, war es offensichtlich eine nationale Forderung, mich auszubooten. Das war zwar nicht, was ich verdient hatte, aber das, worauf ich bei der Stimmung in Brasilien hätte gefasst sein müssen.
Es wäre zwecklos gewesen, zu bleiben und in einer neuen Stellung abzuwarten, bis sich dasselbe wiederholte, besonders jetzt, wo die alte Heimat sich wieder hochrappelt.
Darum komme ich nach Hause, um mein Glück wieder bei Euch zu versuchen, und ich hoffe, Du wirst mich deshalb nicht tadeln. Ich habe auch schon von einer Gelegenheit gehört, die genau das zu sein scheint, was ich suche; ich würde gern in dieser Angelegenheit Deinen Rat hören.
Sollte es Dir nicht recht sein, dass ich bei Dir wohne - ich werde wahrscheinlich gleichzeitig mit diesem Brief oder spätestens einen Tag danach eintreffen -, so kann ich natürlich auch im Dorf unterkommen.
Indem ich hoffe, dass Dich dieser Brief bei bester Gesundheit erreicht, bin ich Dein Dich liebender Neffe.
Edgar Denham.
PS: Bitte empfiehl mich Vetter Gilbert. Ich nehme an, dass die Flora mit seiner fähigen Hilfe blüht und gedeiht, sodass Du Dir auch manchmal Ruhe gönnen kannst.
»Er gab keine Adresse an«, meinte Gilbert, als er den Brief zurückgab. »Man kann ihm also nicht abschreiben.«
»Ich kann es auch kaum ablehnen, ihn aufzunehmen«, entgegnete Mr. Bigwood.
»Du hattest ihm doch ausdrücklich verboten, zurückzukommen...«
»Gewiss, aber wenn seine Geschichte wahr ist...«
»Im Geschichtenerzählen war er immer groß«, fiel Gilbert ein. »Er ist noch nicht einmal drei Jahre fort, und als du ihm das Geld für die Reise gabst, botest du ihm schon zum dritten Mal eine Chance. Damals erklärtest du, es sei das letzte Mal.«
»Du konntest ja nie mit ihm auskommen«, sagte der Onkel.
»Das war nicht meine Schuld.«
»Das habe ich auch nicht behauptet. Aber vielleicht hat er aus seinen Erfahrungen gelernt. Wenn er eine neue Stellung in Aussicht hat, können wir es ihm kaum abschlagen, von hier aus Erkundigungen einzuziehen.«
»Du willst ihn also tatsächlich herkommen lassen?« Gilberts Stimme klang enttäuscht.
»Wir haben ja genug Platz...«
»Obgleich du ihm, als er fortging, verboten hast...«
Der Onkel nickte. Dann lächelte er.
»Das sagt man so im ersten Ärger, aber nach einiger Zeit empfindet man anders. Schließlich ist er der Sohn meiner Schwester Mildred, und schon um ihretwillen kann ich ihm seinen Besuch nicht abschlagen. Du hast deswegen nichts zu befürchten, Gilbert; zwischen uns bleibt es bei dem, was ich dir versprochen habe.«
»Danke, Onkel«, sagte der Neffe. »Soll ich also Mrs. Webber ausrichten, dass sie ein Zimmer für ihn vorbereitet?«
»Bitte.«
Einige Sekunden herrschte Schweigen, dann meinte der junge Mann; »Hoffentlich werden wir in der Fabrik keine Schwierigkeiten haben.«
»Weswegen?«
»Wegen der drei Mädchen, die du gestern entlassen hast.«
»Warum sollten daraus Schwierigkeiten entstehen?«, fragte Mr. Bigwood gereizt. »Hatte ich denn nicht recht?«
»Entlassung ist nach Ansicht der Arbeiter eine zu harte Strafe. Eine Geldstrafe...«
Gilbert hielt inne. Er wusste, dass er einen heiklen Punkt berührte, aber er wollte sein Möglichstes versuchen. Sein Onkel schien jedoch froh zu sein, dass er zeigen konnte, dass er in seinen Entschlüssen nicht immer schwankend war und fiel ihm ins Wort:
»Ich bin noch immer Herr in meinem eigenen Werk und dulde nicht, dass man meine Anordnungen nicht befolgt. Es besteht die Vorschrift, dass in den Arbeitsräumen nicht geraucht werden darf. Dafür gibt es den Erfrischungsraum, wo die Mädchen rauchen können, so viel sie wollen oder vielmehr, so viel sie bezahlen können. Aber ich bin nicht gewillt, zuzusehen, dass unsere Waren durch Zigarettenasche verunreinigt werden.
Die Mädchen haben in dem Raum geraucht, wo Essenzen und Alkohole gemischt werden, die leicht verdunsten und Feuer fangen. In diesem Raum ist das Rauchverbot ganz besonders wichtig! Aber was fand ich, als ich gestern dorthin kam? Trotz des eindeutigen Warnschildes an der Wand Rauchen bei Strafe sofortiger Entlassung verboten arbeiteten zwei Mädchen mit brennenden Zigaretten im Munde, und die Vorarbeiterin stand daneben und sah zu. So tat ich das, was der Anschlag androhte, und entließ alle drei.«
»Ich weiß«, sagte Gilbert, »und natürlich hattest du im Prinzip recht. Aber deine Maßnahme hat unter den andern Arbeitern, Männern wie Mädchen, Unruhe hervorgerufen. Die Entlassenen waren beliebt, und die Leute meinen, sie hätten zunächst verwarnt werden müssen. Es war ja das erste Mal...«
»Woher willst du wissen, dass sie es vorher nicht schon hundertmal getan haben? Du meinst, ich habe es zum ersten Mal gesehen. An sich sind ja Personalfragen, soziale Betreuung und dergleichen deine Sache. Sahst du noch nie jemanden rauchen?«
»Höchst selten.«
»Das bedeutet doch, dass die Mädchen heimlich rauchen, sobald du den Rücken kehrst. Das muss aufhören, und der einzige Weg dazu ist der, den ich gewählt habe. Vorschriften sind da, um befolgt zu werden!«
»Man soll den Bogen aber nicht überspannen. Die Leute drohen mit Streik...«
»Streik!«, brauste der alte Herr auf. »Was meinst du damit? Glaubst du, meine Leute würden streiken, weil ich für ihre Sicherheit sorge?«
»Ich hoffe nicht. Aber sie sind verhetzt und sprechen von Solidarität.«
Sein Onkel warf ihm einen wütenden Blick zu. »Bist du vielleicht der Ansicht, ich hätte erst den Betriebsrat um Erlaubnis fragen sollen?«
»Nein«, sagte Gilbert unsicher. »Aber viele Arbeiter sind zu mir gekommen und haben gebeten, dass der Fall noch einmal überdacht wird. Ich habe ihnen versprechen müssen, dir die Angelegenheit nochmals vorzutragen.«
»Du glaubst wirklich, sie streiken, wenn ich das ablehne? Sie denken gar nicht daran, denn sie wissen, wie gut sie es haben. Ich bezahle sie über Tarif, und außerdem schenke ich ihnen noch Sportplätze, Klubs und dergleichen, wozu ich nicht verpflichtet bin.«
»Das erkennen die Leute auch an.«
»Ja?« Er schien etwas besänftigt. »In dem Fall der Vorarbeiterin, der Eileen Pearson, könnte ich meinen Entschluss vielleicht ändern. Sie ist Kriegerwitwe, lange bei uns und hat eine alte Mutter zu versorgen. Sie hat auch nicht selbst geraucht. In vierzehn Tagen kann sie wieder antreten.«
»Und Pamela James könnte man vielleicht in drei Wochen wieder einstellen«, schlug Gilbert hoffnungsvoll vor.
»Keineswegs. Warum sollte Pamela James mehr Rücksicht verdienen als das andere Mädchen?«
»Pamela James ist schon drei Jahre bei uns. Sie ist eine gute Arbeiterin und bei allen Kollegen sehr beliebt...«
»Mir scheint, ich habe auch schon weniger Günstiges über sie gehört«, erwiderte der alte Herr.
»Es wäre aber doch schade, sie zu verlieren...«
»Unsinn - sie hat die Vorschriften übertreten und muss dafür büßen. Darüber gibt es nichts mehr zu reden.«
Er nahm sich die Zeitung vor, um zu zeigen, dass dieses Thema für ihn abgeschlossen war. Gilbert wusste das, denn er kannte das cholerische Temperament seines Onkels. Da er aber noch etwas mit ihm besprechen wollte, wartete er eine Weile, um ihm Gelegenheit zu geben, seinen Gleichmut wiederzufinden. Er vertiefte sich also zunächst ebenfalls in seine Zeitung und begann erst nach längerer Pause:
»Hast du schon über das nachgedacht, was ich dir neulich wegen Bobbie sagte?«
»Eh - wie - was denn? Bobbie...?«
»Meine Braut...«
»Ja, natürlich - was meinst du denn?«
»Wir möchten doch heiraten...«
»Das hat keine Eile. Ihr seid beide jung.«
»Wir sind beide fünfundzwanzig und schon fast ein Jahr verlobt. Wir wollen uns gern nach deinen Wünschen richten, Onkel, aber es wird allmählich Zeit, das irgendwie zu regeln.«
»Was ist da zu regeln?«, brummte der alte Mann.
»Wann wir heiraten und wo wir wohnen sollen. Ich glaube, Bobbie wäre bereit, hier zu wohnen, wenn du das wünschst. Natürlich hätten wir lieber ein Heim für uns, aber ich weiß, was ich dir schulde, und um meinetwillen ist sie bereit, alles zu tun, um dich zufriedenzustellen.«
Gilbert hatte seine Rede sorgfältig einstudiert, aber jetzt klang sie ihm keineswegs so überzeugend, wie sie ihm vorher erschienen war.
»Wir fürchteten, du könntest dich einsam fühlen, wenn wir fortziehen...«, fügte er hinzu.
»Du meinst wohl, ich brauchte jemanden, der mir den Haushalt führt? »Wozu habe ich denn die Webbers?«
»Wenn du glaubst, dass dir das genügt...«
»Es hat mir bisher immer genügt. Aber warum musst du gerade jetzt davon anfangen? Drängen ihre Eltern etwa auf eine Heirat?«
»Oh, nein, keineswegs. Sie haben es nicht so eilig, ihre Tochter loszuwerden.«
»Vernünftige Leute. Bobbie ist ein nettes Mädchen; ich habe nichts gegen sie. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob ich sie dauernd hier um mich haben möchte. Lassen wir das vorläufig. Im Augenblick haben wir genug andere Sorgen. Edgar kommt, und in der Fabrik gibt es vielleicht Schwierigkeiten - das genügt. Ist Hann schon gekommen?«
»Ich glaube, ich habe ihn vorhin gehört.«
»Gut. Sag ihm, ich sei in ein paar Minuten bei ihm.«
Gilbert stand auf und ging langsam zur Tür. Er war nicht gerade mit sich zufrieden. Die unmittelbar bevorstehende Ankunft seines Vetters verstimmte ihn, und das eigene Heim zusammen mit Bobbie schien ihm auch noch in weiter Ferne zu liegen.
Zweites Kapitel
Ein hübsches Mädchen und ein gut aussehender junger Mann, die in einem Eisenbahnabteil einander gegenübersitzen, nehmen von der Existenz des andern nur selten keine Notiz.
Der junge Mann machte auch gar keinen Versuch, sein Interesse an dem schönen Gegenüber zu verbergen, aber ohne Erfolg. Sie war völlig von der Lektüre ihres Buches gefesselt - oder gab sich wenigstens den Anschein, es zu sein. Er versuchte es mit den üblichen Anknüpfungsmethoden: Hätte sie etwas dagegen, wenn er das Fenster öffne, oder solle es geschlossen bleiben? Aber sie antwortete nur, das sei ihr gleichgültig. Auch auf eine Bemerkung über das Wetter antwortete sie nur einsilbig.
»Ihr Buch ist wohl sehr interessant?«
Nun antwortete sie überhaupt nicht. Sie hob den Blick nur ganz wenig von den Seiten. Aber das genügte schon für ihn: Er sah ihre Augen - sie waren saphirblau. Ihr Gesicht hatte jenen Teint, von dem die Reklamen der Schönheitsmittel sprechen und ihr kastanienbraunes Haar legte sich in weichen, natürlichen Wellen um ihren Kopf.
Er war fest davon überzeugt, dass sie entzückend sein musste, wenn sie lächelte - wenn er sie nur zum Lächeln hätte bringen können! Aber alle Versuche dazu blieben erfolglos. Achselzuckend fand er sich mit seinem Schicksal ab und sah sich in Ermangelung eines Besseren die Bilder in seinem Magazin an.
Trotzdem hätte sie ihn, wenn sie gefragt worden wäre, wahrscheinlich besser beschreiben können als er sie. Denn sie hatte sein Äußeres bereits mit einem einzigen raschen Blick vollkommen erfasst: seine schlanke Gestalt, seine sonnengebräunte Haut, seine dunklen, lachenden Augen, sein kleines schwarzes Schnurrbärtchen, seine glänzenden weißen Zähne.
Sie wusste, er sah in seinem leichten, grauen Flanellanzug, dem Seidenhemd mit weichem Kragen und blauer Krawatte, gut aus. Sogar seine seidenen Socken und seine eleganten Wildlederhandschuhe hatte sie bemerkt. Er musste wohl Ausländer sein oder war kürzlich aus dem Ausland zurückgekommen - sicherlich also eine ganz amüsante Reisebekanntschaft. Aber sie hatte schon viel zu oft erlebt, dass Mitreisende ihre Bekanntschaft zu machen suchten, als dass sie auf ihn neugierig gewesen wäre. Solche jungen Männer neigten dazu, zudringlich zu werden, und es war viel besser, sie von Anfang an nicht zu beachten, um sie später nicht zurückweisen zu müssen.
So fuhren sie schweigend weiter, bis das Eis in unerwarteter Weise brach. Der Schaffner betrat das Abteil und verlangte die Karten.
»Bendon Parva«, sagte er. »Muss ich umsteigen?«
»Umsteigen in Caterford«, war die Antwort.
Auch das Mädchen gab ihm ihre Fahrkarte.
»Bendon Parva - in Caterford umsteigen«, sagte er.
»Sie fahren auch nach Bendon Parva? Wie merkwürdig...«
»Viele Leute fahren dorthin...« Aber sie lächelte, als sie das sagte, und er konnte feststellen, dass ihr Lächeln seinen Erwartungen entsprach.
»Wohnen Sie dort?«, fragte er weiter.
»Ja«
»Dann kennen Sie vielleicht meinen alten Onkel - Luke Bigwood?«
»Ja.« Diesmal klang ihre Antwort viel interessierter.
»Dann haben Sie vielleicht auch schon von mir gehört?«
»Das glaube ich nicht. Wer sind Sie denn?«
»Mein Ruhm hat sich also noch nicht herumgesprochen? Sie können der Rückkehr des verlorenen Sohnes beiwohnen! Wie stehen die Aktien in Bezug auf das gemästete Kalb?«
»Sie sehen nicht gerade aus, als ob Sie gehungert hätten...«
Er lachte.
»Der moderne verlorene Sohn ist eine verbesserte Auflage des biblischen. Wenn er sich hinreichend unbeliebt gemacht hat, drückt man ihm eine Passage nach Übersee mitsamt ein paar Pfund in die Hand und schiebt ihn ab. Wie geht es dem alten Herrn?«
»Gut, glaube ich. Ich war jetzt zwei Tage nicht zu Hause.«
»Das biblische Gleichnis passt auch sonst auf mich. Wenn auch kein älterer Bruder da ist, so doch ein bevorzugter Neffe.«
»Wissen Sie«, sagte sie, »ich hatte immer das Gefühl, dass uns die Bibel bei dieser Geschichte einiges vorenthält...«
»Was zum Beispiel?«
»Blieb der verlorene Sohn nun zu Hause und wurde ein würdiges Mitglied der Gemeinde, oder kehrte er nur zurück, weil er etwas wollte, und ging wieder fort, als er das hatte?«
»Ein sehr interessantes Problem.«
Er lächelte. »Wie würden Sie die Geschichte ergänzen?«
»Man müsste den verlorenen Sohn schon kennen, um das beantworten zu können. Was wollen Sie denn tun?«
»Jedenfalls kann ich einen Grund sehen, mich hier häuslich niederzulassen«, antwortete er.
»Das wird Ihren Onkel sicher freuen.« Sie hatte seine Anspielung wohl verstanden, zog es aber vor, sie zu überhören. »Woher kommen Sie denn?«
»Aus Brasilien, wo der Pfeffer wächst. In meinem Fall war es allerdings Kaffee.«
»Das muss recht interessant sein.«
»Teils - teils. Aber um zu unserem Gleichnis zurückzukommen: Liegen Ihre Sympathien vielleicht mehr bei dem älteren Bruder - in diesem Fall bei dem jüngeren Neffen...?«
»Schon möglich. Aber es hängt, wie ich vorhin sagte, davon ab, wie sich der verlorene Sohn benimmt.«
»Ich muss mich also in acht nehmen«, sagte er mit seinem gewinnenden Lächeln. »Sie kennen den jungen Gilbert wohl gut?«
»Sehr gut sogar«, antwortete sie. Aber bevor sie weiterreden konnte, klangen von draußen Stimmen ins Abteil: »Caterford - Caterford - nach Bendon umsteigen.«
Sie griffen nach ihren Koffern und begaben sich auf den Bahnsteig; er bestand darauf, ihr Gepäck zu tragen.
»Warum holt man Sie nicht mit dem Wagen von hier ab?«, fragte sie, während sie zu dem Bahnsteig hinübergingen, von dem der Lokalzug nach Bendon abgehen sollte.
»Ich habe nicht geschrieben, mit welchem Zuge ich komme. Sonst hätte man mir vielleicht abgewinkt. Aber wieso kenne ich Sie nicht, wenn Sie in Bendon wohnen? Vor drei Jahren war ich doch sehr häufig dort.«
»Das ist leicht zu erklären. Damals wohnten meine Eltern noch in Caterford, wo mein Vater sein Büro hat. Wir sind erst später nach Bendon gezogen.«
»Als Ihre Eltern genug verdient hatten, um sich zur Ruhe zu setzen...«
»Das ist übertrieben. Mein Vater ist Anwalt und geht jeden Tag in sein Büro.«
»Darf ich nach Ihrem Namen fragen?«
»Easton«, sagte sie.
»Sagt mir nichts«, lächelte er. »Wahrscheinlich, weil ich noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen bin. Aber darf ich mich, da wir doch Nachbarn sein werden, erkundigen, wie Miss Easton mit Vornamen heißt?«
»Roberta«, antwortete sie nach kurzem Zögern.
»Nicht gerade der Name, den ich für Sie ausgesucht hätte. Aber wenn man daraus Bobbie macht...«
»Macht man.« Sie nickte.
»Sie heißen also Bobbie. Das klingt recht nett.«
»Danke schön.«
Sie schlenderten den Bahnsteig auf und ab, da sie auf den Anschlusszug noch zu warten hatten. Durch die Gitter hindurch konnten sie das Bahnhofsgebäude mit seinem Vorplatz übersehen, die ziemlich einsam dalagen.
»Ist es nicht merkwürdig, dass ausgerechnet mein sittenstrenger Onkel Inhaber einer solchen Firma ist?«
»Ist die Fabrik nicht schon seit Generationen in der Familie?«, fragte sie.
»Ja, aber dass gerade ein puritanischer alter Hagestolz sein Geld damit verdient, dass er Schminke und Lippenstifte herstellt...«
»Irgendjemand muss das doch machen.«
»Zugegeben. Aber man stellt sich einen solchen Fabrikanten anders vor. Früher machte die Firma ja auch nur Seife und erst Onkel Luke hat die frivole Seitenlinie eingeführt. Aber dann hat diese Seitenlinie das ursprüngliche Geschäft überwuchert und neue und größere Fabrikräume nötig gemacht. Jetzt muss sogar Neffe Gilbert in die Fabrik eintreten, um die Schönheitsköniginnen zu überwachen, die dort arbeiten.«
»Und warum nicht Sie?«, fragte sie.
»Ach, das ist eine lange Geschichte. Spricht man denn niemals von mir? Sie sagten doch vorhin, Sie kennen den braven und tüchtigen Gilbert recht gut...?«
»Er hat wohl einmal etwas von einem Vetter in Brasilien erwähnt, aber das war auch alles.«
»Kennen Sie denn Gilbert wirklich gut?«
»So gut sogar, dass ich mit ihm verlobt bin«, sagte sie lachend.
»Das ist ja großartig, Bobbie!«, rief er. »Da muss ich meiner neuen Cousine gleich einen Kuss geben.«
»Dazu ist noch Zeit genug, wenn ich erst Ihre Cousine bin«, sagte sie und entzog sich ihm lächelnd.
»Ich betrachte das als festes Versprechen. Aber wie hat Gilbert das nur angestellt? Einen so erstaunlich guten Geschmack hätte ich ihm nie zugetraut. Aber er hat eben Glück...!«
»Es freut mich, dass Sie das glauben«, lächelte sie. »Aber vielleicht sollten Sie mir auch einmal sagen, wer Sie eigentlich sind.«
»Ich sagte Ihnen doch schon, ich bin der verlorene Sohn oder vielmehr der enterbte Neffe. Mein verehrter Onkel Luke hatte zwei Schwestern. Die ältere, die ihn, glaube ich, in seiner Jugend unter der Fuchtel hatte - wozu schon damals allerhand gehört haben muss -, heiratete einen Hauptmann Chapman und brachte in angemessener Frist Ihren Gilbert zur Welt. Die Jüngere, Mildred, die Lieblingsschwester meines Onkels, heiratete einen Major Denham und setzte mich in die Welt.
Beide Väter fielen im Krieg, und auch unsere Mütter starben, als wir noch sehr jung waren. Mich hat man Edgar getauft. Onkel Luke hatte seine beiden Neffen mehr oder minder adoptiert, sowohl Gilbert, den guten, wie mich, den bösen. Hier haben Sie, wenn Sie mich engagieren wollen, meinen Lebenslauf.«
»Und jetzt behaupten Sie, in Ungnade gefallen zu sein?«, fragte sie.
»Wie soll ich das sonst ausdrücken? Ich war im Krieg bei der Luftwaffe. Nach meiner Entlassung hatte ich keinen sehr glücklichen Start im Zivilleben. Das Geschäft mit Lippenstiften war nicht nach meinem Geschmack, und ein paar andere Sachen, die ich anfasste, gingen schief. Daraufhin wurde Onkel Luke böse, drückte mir eine Schiffskarte nach Brasilien in die Hand und machte mir klar, dass er keineswegs untröstlich wäre, wenn er mein Gesicht nie mehr zu sehen bekäme.
Ob ich ihn jetzt sehr enttäusche, weiß ich nicht. Ihr Gilbert ist jünger, aber dafür klüger als ich. Im Krieg verstand er es, sich in einer Munitionsfabrik herumzudrücken, weil seine Augen nicht sehr gut sind; schließlich konnte er sich sogar zu den Flora Werken versetzen lassen, und mit der Zeit wird er das ganze Geschäft in die Hand bekommen. Aber glauben Sie nicht, ich wollte damit behaupten, dass mir Unrecht geschehen sei. Ich weiß, ich bin daran selbst schuld.«
Bobbie kam seine Schilderung nicht ganz glaubwürdig vor. Er sprach zwar frei und offen, aber sie hatte das Empfinden, dass es manches gab, was er ihr verschwieg. Warum sollte er das auch nicht? Sie überlegte, ob sie ihn noch weiter ausfragen solle, als ihre Gedanken in eine ganz andere Richtung abgelenkt wurden.
Sie hatten wieder einmal das Gitter erreicht, das den Bahnsteig vom Bahnhofsplatz trennte, als Edgar mit einem plötzlichen Ausruf stehen blieb. Ein Auto war fast zu ihnen herangefahren. Es war ein schäbiger Wagen, aber das Mädchen am Steuer war auffallend hübsch. Ein Mann stieg aus dem Wagen aus.
»Sehen Sie, so könnte Gilbert heute aussehen!«
»Es ist Gilbert«, sagte Bobbie.
»Und wer ist das Mädchen?«
»Keine Ahnung.«
Edgar zog die Augenbrauen in die Höhe und sah sich die Begleiterin seines Vetters genauer an. Sie war schlank und hatte sehr dunkles, fast schwarzes Haar. Unzweifelhaft sah sie sehr anziehend aus, wenngleich ihr Gesicht im Augenblick keinen freundlichen Ausdruck zeigte. Gilbert sprach auf sie ein, aber sie schüttelte als Antwort nur den Kopf. Daraufhin ging er fort und betrat das Bahnhofsgebäude. Das Mädchen wendete den Wagen und fuhr wieder ab.
»Hallo! Das ist doch Gilbert, der Gute! Wie geht es dir? Bobbie und ich haben uns schon gewundert, wer deine Begleiterin sein mag.«
Gilbert war von dieser Begrüßung mehr als unangenehm berührt. Edgar hatte stets Minderwertigkeitsgefühle in ihm wachgerufen, und er war keineswegs erfreut zu sehen, dass der Vetter nicht nur angekommen war, sondern offensichtlich auch schon auf vertrautem Fuß mit Bobbie stand.
»Ach, du bist es«, stotterte er. »Du bist also angelangt?«
»Deine Augen täuschen dich nicht.«, erwiderte Edgar spöttisch. »Wir haben uns beide nicht sehr verändert. Ich habe dich sogar noch eher erkannt als Bobbie.«
»Wirklich?«, sagte Gilbert und sah unsicher von ihm zu Bobbie.
»Wir haben uns im Zug kennengelernt«, erklärte ihm seine Braut. »Wir fanden heraus, dass wir beide nach Bendon fahren, und so stellten wir uns einander vor.«
»Ach so«, murmelte Gilbert wieder und sein sommersprossiges Gesicht sah nicht erfreuter aus.
»Hat die Firma die reizende Chauffeuse gestellt?«, fragte Edgar. »Aber einen eleganteren Wagen hättet ihr euch schon leisten können.«
Gilbert gab keine Antwort, und Bobbie fragte ihn: »Wer ist die Dame denn?«
»Sie kam in die Fabrik zu mir und hat mich dort aufgehalten. Und da ich sonst den Zug verpasst hätte, brachte sie mich zur Bahn.«
»Damit verrätst du uns noch nicht, wer sie ist.«, bemerkte Edgar.
Gilbert fühlte sich offensichtlich nicht ganz behaglich. Er beachtete den Einwurf seines Vetters nicht und sprach zu Bobbie gewandt weiter.
»Sie heißt Pamela James. Onkel Luke hat sie entlassen, weil er sie ertappt hat, wie sie bei der Arbeit rauchte. Nun hat sie sich an mich gewandt und mich gebeten, sie wieder einzustellen. Ich gehe sonst immer zu Fuß von und zum Bahnhof. Aber um den Zug nicht zu verpassen...«
Diesmal wäre es Gilbert sicher lieber gewesen, wenn er den Zug verpasst hätte, der jetzt gerade einfuhr. Während sich alle drei Platz suchten, fragte Bobbie ihren Verlobten, ob Mr. Bigwood das Mädchen wieder einstellen werde.
»Das ist noch sehr zweifelhaft«, meinte Gilbert.
»Der alte Herr ist also immer noch ein bisschen Leuteschinder«, kommentierte Edgar.
Gilbert antwortete nicht, und um das Thema zu wechseln, lächelte Bobbie Edgar zu und sagte:
»Vielleicht werden Sie sich einbilden, dass Ihre Rückkehr doch gefeiert wird. Morgen Abend ist nämlich bei uns ein großes Feuerwerk.«
»Wie nett! Hat das Gilbert zur Feier meiner Ankunft arrangiert?«
»Nein«, lachte sie. »Sir Richard und Lady Truman feiern ihre goldene Hochzeit und haben das ganze Dorf in ihren Park eingeladen. Ich sehe, man muss Ihnen das sagen, sonst glauben Sie in Ihrer Eitelkeit etwas anderes.«
»Es ist nicht nett von Ihnen, mir meine Illusionen zu nehmen«, antwortete er. »Ich würde mir so gern einreden, dass andere sich über meine Rückkehr genauso freuen wie ich.«
Er fragte seinen Vetter noch nach ihrem gemeinsamen Onkel und nach der Fabrik, erhielt aber nur einsilbige Antworten. Auch Bobbie wurde bald schweigsam. Sie wollte sich nicht mit Edgar unterhalten, wenn Gilbert stumm dabeisaß. Es gab ja keinen Zweifel, dass Gilbert ihre Vertraulichkeit mit dem Neuankömmling nicht billigte. Und Bobbie wollte ihn nicht kränken. Glücklicherweise war es nach Bendon nur eine kurze Fahrt.
Drittes Kapitel
Webber war als Diener wie als Mensch nicht alltäglich. Er war ein weißer Rabe unter den Ehemännern, nämlich ein Mann, der mehr als seinen vollen Anteil zur Arbeit im Haushalt beitrug und er war keineswegs ein Snob, wie so viele Diener.
Klein und untersetzt sprach er stets frei von der Leber weg. Er hatte sich sogar schon erlaubt, Gäste beim Essen zu korrigieren, wenn sie eine irrtümliche Behauptung aufstellten. Er war auch durchaus im Stande, einem bevorzugten Gast, wenn er ihm Koteletts oder den Fisch servierte, hörbar zuzuflüstern: »Ich rate Ihnen zu diesem Stück hier.«
Aber er verstand sich auf jede Laune von Luke Bigwood und diente ihm ergeben. Webber war es, der Edgar als Erster willkommen hieß, als er Chilworth erreichte, wie Mr. Bigwoods Haus hieß.
Es war keineswegs ein stürmischer Empfang, und es gab weder Freudentränen noch Umarmungen. Webber war außerordentlich zurückhaltend und bemerkte nur höflich, er hoffe, Edgar habe eine gute Reise gehabt. Dann sagte er ihm, sein Onkel habe sich niedergelegt und erwarte, ihn beim Essen zu sehen.
»Gibt es Mastkalb?«, fragte Edgar.
»Nein, Sir«, antwortete Webber, der die Anspielung nicht verstand. »Gebratene Ente.«
»Das ist mir auch viel lieber. Wie geht es Mrs. Webber?«
Bei diesen Worten erschien Webbers bessere Hälfte aus einer nur angelehnten Tür. Sie bewillkommnete ihn herzlicher als ihr Ehemann. Mrs. Webber war groß, hager und unermüdlich.
»Ich bin froh, Sie wiederzusehen, Sir«, sagte sie. »Sie sehen ausgezeichnet aus. Sie müssen eine Menge von der Welt gesehen haben.«
»Danke schön«, sagte er lächelnd und schüttelte ihr die Hand. »Ja, ich bin ziemlich weit herum gekommen, aber es tut wohl, wieder im alten England zu sein.«
»Ich bringe Ihnen den Sherry ins Wohnzimmer«, unterbrach ihn Webber, »wenn das Mr. Gilbert und Ihnen recht ist. Oder soll ich Sie zuerst auf Ihr Zimmer führen?«
»Ich bin für den Sherry«, antwortete Edgar. »Was meinst du, Gilbert?«
Sein Vetter stand schweigend neben ihm; er hatte seinen Ärger noch immer nicht ganz überwunden. Er nickte nur zustimmend und ging ins Wohnzimmer voran.
»Legt sich Onkel immer um diese Zeit nieder?«, fragte Edgar, als er ihm folgte. »Oder will er nur das Wiedersehen mit mir noch etwas hinausschieben?«
»Im Allgemeinen ruht er jetzt vor dem Essen etwas«, antwortete Gilbert, »wenn er, wie heute, in der Fabrik gewesen ist. Seine Gesundheit ist eigentlich nicht schlecht, nur macht sein hoher Blutdruck eine gewisse Schonung erforderlich. Es wird ihm schwer, Treppen zu steigen; darum hat er jetzt auch im Erdgeschoss ein Schlafzimmer eingerichtet.«
»Ich hoffe, meine Rückkehr hat seinen Blutdruck nicht erhöht«, grinste Edgar.
»Darauf hast du es ja ankommen lassen«, entgegnete Gilbert.
»Du bist eigentlich nicht gerade herzlich; Gilbert. Übrigens, Bobbie ist ein reizendes Mädchen. Wie hast du sie nur herumgekriegt? Wenn sie nicht schon mit dir verlobt wäre, würde ich mit Vergnügen mein Glück bei ihr versuchen.«
»Lass das lieber«, sagte Gilbert warnend. »Ich weiß, du denkst, du wärst unwiderstehlich. Lass Bobbie in Ruhe!«
»Der böse Wolf tut Rotkäppchen nichts«, lachte Edgar. »Also auf euer Wohl!«
Er hob sein Glas. Gilbert stürzte das seine schnell herunter. Dann sagte er, er müsse nachsehen, ob Hann noch da sei und vielleicht etwas von ihm wolle.
»Bedien dich inzwischen selbst«, fügte er hinzu.
»Das werde ich auch.« erwiderte Edgar. Er füllte sein Zigarettenetui aus der silbernen Dose auf dem Tisch und goss sich einen zweiten Sherry ein. Man hatte ihn nicht gerade enthusiastisch begrüßt, aber es hätte schlimmer ausfallen können. Er ging zum Fenster hinüber und sah in den gepflegten Garten. Gilbert war doch ein Glückspilz; all das sollte einmal ihm gehören - all das und Bobbie dazu.
Cecil Hann, Mr. Bigwoods Privatsekretär, war ein farbloser Mensch Mitte dreißig. Er war ein Ja-Sager und hielt seine Stellung, indem er eifrig allem zustimmte, was sein Arbeitgeber vorschlug. Er wohnte nicht im Haus, kam aber meist schon zum Frühstück und blieb sehr oft auch zum Abendbrot. Er hatte nichts mit der Fabrik zu tun, sondern erledigte ausschließlich die Privatkorrespondenz, die Haushaltsrechnungen und Ähnliches. Er behandelte Gilbert mit großem Respekt und begrüßte auch Edgar unterwürfig.
Im Gegensatz dazu empfing Mr. Bigwood seinen heimgekehrten Neffen zurückhaltend. Offenbar wollte er sich sein endgültiges Urteil noch vorbehalten. Er beobachtete und hörte zu, sprach aber selbst wenig. Auch Gilbert war sehr schweigsam. Nur Hann stellte viele Fragen, und Edgar gab sich die größte Mühe, interessant zu antworten und zu erzählen.
»Brasilien muss ein herrliches Land sein«, bemerkte der Privatsekretär.
»Es ist auch ein wunderbares Land«, antwortete Edgar. »Richtig entwickelt könnte es so manches unserer Weltprobleme lösen. Es ist fast so groß wie Europa und hat dabei weniger Einwohner als England.«
»Ist denn das ganze Land bewohnbar?«
»Man könnte jedenfalls einen viel größeren Teil bewohnbar machen, als gegenwärtig besiedelt ist. Natürlich ist das Land tropisch, und die Menschen sind träge, aber es gibt dort große, dicht bewaldete Hochebenen, wo das Klima ausgezeichnet ist. Brasiliens Bodenschätze sind überhaupt noch kaum bekannt.«
»Wo haben Sie denn gearbeitet?«
»In der Nähe von Sao Paulo, ungefähr auf der Breite von Rio. Die Kaffeeplantagen liegen dort in Hochtälern, in denen reichlich Regen fällt. Das Land ist sehr fruchtbar, aber meist vernachlässigt. Wie ich schon sagte, die Brasilianer sind eben träge. Selbst gegen Termiten und Ameisen, die eine Pflanzung überfallen und kahl fressen, unternehmen sie nichts, sondern verlegen die lieber die Pflanzung andern Bereich.«
»Gibt es dort nicht auch viele Schlangen?«, fragte Hann.
»Massenhaft. Boas und Klapperschlangen. Am bösartigsten ist aber eine kleine Schlange, die im hohen Grase lauert und sich in einen Menschen oder ein Tier verbeißt. Sie vergräbt den Kopf in seine Haut und verharrt so, bis sie sich mit Blut vollgesogen hat. Dann erst fällt sie zu Boden.«
Edgar wollte offenbar mit seinen Erzählungen auf seinen Onkel Eindruck machen. Dann wandte er sich direkt an ihn:
»Gilbert hat uns erzählt, Onkel, dass du Schwierigkeiten mit den Arbeitern in der Fabrik hast.«
»Nicht dass ich wüsste«, antwortete der alte Herr.
Edgar sah ihn überrascht an.
»Entschuldige bitte, wenn ich etwas falsch verstanden habe.«
Gilbert war offensichtlich peinlich berührt.
»Ich habe nur davon gesprochen, dass eins unserer Mädchen mich bat, wieder eingestellt zu werden«, erklärte er.
»Wer?«, fragte sein Onkel.
»Pamela James.«
»Eine Schönheit, Onkel«, fügte Edgar hinzu. »Eine ausgezeichnete Reklame für dein Unternehmen. Und auch entgegenkommend. Sie nahm Gilbert gleich mit ihrem Wagen mit, damit er nur ja nicht den Zug verpasste.«
Mr. Bigwood beachtete diesen Einwurf nicht.
»Was hast du ihr denn geantwortet?«, fragte er.
»Dass du es abgelehnt hast.«
»Damit ist diese Angelegenheit wohl erledigt.«
Die Mahlzeit wurde schweigend beendet. Als Mr. Bigwood sich erhob, sagte er zu Edgar:
»Komm mit mir in mein Zimmer.«
Höchstwahrscheinlich konnte sich Edgar aus der Vergangenheit an ähnliche Aufforderungen seiner Schullehrer erinnern. Sie waren stets unheildrohend gewesen.
Trotzdem murmelte er jetzt: »Mit Vergnügen, Onkel«, was er damals vermutlich kaum getan hatte.
»Warum bist du zurückgekommen? Ich hatte es dir doch verboten!« Unvermittelt überfiel ihn der Onkel mit dieser Frage, aber Edgar hatte seine Antwort bereit:
»Ich weiß, Onkel, du warst stets gütig zu mir, und ich stehe für immer in deiner Schuld. Ich hätte es gern vermieden, deine Wünsche zu missachten, aber ich geriet in eine Zwangslage. Es war, wie ich dir schrieb, sinnlos geworden, in Brasilien zu bleiben. Wenn mir also nichts anderes übrig blieb, als nach England zurückzukehren, sollte ich das dann wirklich ohne dein Wissen tun, oder sollte ich dir nicht lieber alles erklären und mir dadurch deinen Rat sichern? Ich entschied mich für den zweiten Weg. Wenn ich damit dein Missfallen erregt habe, so bedauere ich das aufs tiefste.«
Der Onkel blickte ihn nicht ohne Misstrauen ein paar Augenblicke prüfend an.
»Warum hast du deine Stellung verloren?«
»Wie ich dir schrieb, Onkel, sind die Brasilianer so nationalistisch geworden, dass man Ausländer kaum noch in wichtigen Stellungen belässt.«
»Haben nicht auch Weibergeschichten dabei eine Rolle gespielt?«
Diesmal war Edgar an der Reihe, einen Moment zu zögern, bevor er antwortete.
»Vielleicht - war auch eine Frau mit im Spiel...«
»Inwiefern?«