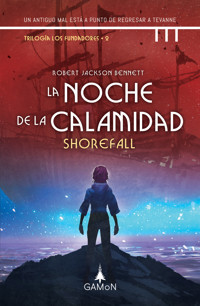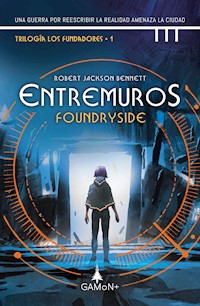9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Founders
- Sprache: Deutsch
Eine Diebin, die niemand bemerkt.
Ein sprechender Schlüssel, dem kein Schloss widerstehen kann.
Eine Macht, die die Welt verändert.
Sancia ist eine Diebin – und zwar eine verdammt gute. Daher ist sie im ersten Moment auch begeistert, als sie ihre neueste Beute betrachtet: ein Schlüssel, der jedes Schloss öffnet. Doch dann wird ihr klar, was das bedeutet. Man wird sie jagen! Jedes der mächtigen Handelshäuser wird dieses Artefakt besitzen wollen. Denn die Magie des Schlüssels ist nicht nur alt und mächtig. Die Person, die sie kontrolliert, könnte die Welt verändern. Plötzlich ist Sancia auf der Flucht. Um zu überleben, muss sie nicht nur lernen, die wahre Macht des Artefakts zu beherrschen. Sie muss vor allem alte Feinde zu neuen Verbündeten machen …
Die Trilogie Der Schlüssel der Magie:
1. Die Diebin
2. Der Meister
3. Die Götter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Sancia ist eine Diebin – und zwar eine verdammt gute. Daher ist sie im ersten Moment auch begeistert, als sie ihre neueste Beute betrachtet: ein Schlüssel, der jedes Schloss öffnet. Doch dann wird ihr klar, was das bedeutet. Man wird sie jagen! Jedes der mächtigen Handelshäuser wird dieses Artefakt besitzen wollen. Denn die Magie des Schlüssels ist nicht nur alt und mächtig. Die Person, die sie kontrolliert, könnte die Welt verändern. Plötzlich ist Sancia auf der Flucht. Um zu überleben, muss sie nicht nur lernen, die wahre Macht des Artefakts zu beherrschen. Sie muss vor allem alte Feinde zu neuen Verbündeten machen …
Autor
Robert Jackson Bennett wurde bereits mehrfach für seine Fantasy-Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Edgar Award, dem Shirley Jackson Award und dem Philip K. Dick Award. Außerdem war er Finalist beim World Fantasy Award, dem Locus Award, dem Hugo Award und bei dem British Fantasy Award. Neben den Kritikern und zahllosen Lesern gehörten auch die größten seiner Autorenkollegen zu seinen Fans, zum Beispiel Brandon Sanderson und Peter V. Brett. Robert Jackson Bennett lebt mit seiner Frau und seinen Söhnen in Austin, Texas.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
DIE DIEBIN
Deutsch von Ruggero Leò
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Foundryside (The Founders Trilogy 1)« bei Crown, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Robert Jackson Bennett
Published by arrangement with Robert Jackson Bennett
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-25719-4V001
www.blanvalet.de
I Das Gemeinviertel
Alle Dinge haben einen Wert. Manchmal bezahlt man dafür mit Münzen. Ein andermal mit Zeit und Schweiß. Und ab und zu zahlt man auch mit Blut.
Die Menschheit scheint versessen darauf, die letztgenannte Währung zu nutzen. Und uns wird erst bewusst, wie viel wir davon ausgeben, wenn wir mit dem eigenen Blut zahlen.
– König Ermiedes Eupator, »Über die Eroberung«
Kapitel 1
Sancia Grado lag mit dem Gesicht im Schlamm, eingezwängt unter der Holzempore an der alten Steinwand, und gestand sich ein, dass der Abend nicht so gut verlief wie erhofft.
Dabei hatte er ganz annehmbar begonnen. Dank ihrer gefälschten Ausweise hatte sie es aufs Michiel-Gelände geschafft, und zwar mühelos – die Wachen an den ersten Toren hatten sie kaum eines Blickes gewürdigt.
Dann hatte sie den Abwassertunnel erreicht, und von da an war alles … weniger mühelos verlaufen. Zwar war ihr Plan tatsächlich aufgegangen – der Kanal hatte ihr ermöglicht, sich unter allen inneren Toren und Mauern hindurchzuschleichen, bis dicht an die Michiel-Gießerei –, doch hatten ihre Informanten versäumt zu erwähnen, dass es im Tunnel nicht nur von Tausendfüßlern und Schlammottern wimmelte, sondern es dort auch Scheiße im Überfluss gab, die von Menschen und Pferden stammte.
Das hatte Sancia zwar nicht gefallen, doch kam sie damit zurecht. Sie war nicht zum ersten Mal durch Unrat gekrochen, den Menschen hinterließen.
Durch einen Abwasserkanal zu robben führt jedoch leider dazu, dass man dabei einen starken Geruch annimmt. Während Sancia durch die Höfe der Gießerei schlich, hielt sie sich darum auf der windabgewandten Seite der Wachtposten. Als sie ans Nordtor gelangte, hatte aus der Ferne ein Wächter gerufen: »O mein Gott, was ist das für ein Gestank?«, woraufhin er pflichtbewusst nach der Ursache für den Geruch gesucht hatte, sehr zu Sancias Entsetzen.
Es war ihr jedoch gelungen, unentdeckt zu bleiben, aber sie hatte sich auf dem Gelände in eine Sackgasse zurückziehen und unter dem verwitterten Holzpodest verstecken müssen, das früher vermutlich ein alter Wachtposten gewesen war. Rasch war ihr klar geworden, dass ihr dieses Versteck keine Fluchtmöglichkeit bot: In der Sackgasse gab es nichts außer der Empore, Sancia und dem Wächter.
Sie stierte auf die schlammigen Stiefel des Wächters, der schnüffelnd an der Empore vorbeischritt, wartete ab, bis er vorbei war, und steckte den Kopf hinaus.
Der Mann war groß, trug eine glänzende Stahlhaube, Schulterpanzer, Armschienen sowie einen Lederkürass, in den das Wahrzeichen der Michiel-Handelsgesellschaft geprägt war: die brennende Kerze im Fenster. Am alarmierendsten war, dass er ein Rapier am Gürtel trug.
Sancia beäugte die Waffe. Als sich der Mann entfernte, war ihr, als hörte sie ein Wispern im Kopf, ein fernes Säuseln. Sie hatte damit gerechnet, dass die Klinge skribiert war, und das leise Wispern bestätigte das. Ihr war klar, dass eine skribierte Klinge sie mühelos in zwei Hälften spalten konnte.
Verdammt dumm von mir, mich derart in die Enge treiben zu lassen, dachte sie und zog sich unter die Empore zurück. Dabei hat meine Mission gerade erst begonnen.
Sie musste es zur Fahrbahn schaffen, die schätzungsweise gerade mal siebzig Schritt entfernt lag, hinter der gegenüberliegenden Mauer. Je eher sie dort ankäme, desto besser.
Sie erwog ihre Möglichkeiten. Sie hätte auf den Mann schießen können, immerhin hatte sie ein kleines Bambusblasrohr und ein paar kleine, aber teure Pfeile dabei, die mit dem Gift des Dolorspinafischs beträufelt waren: eine tödliche Plage, die in den Tiefen des Ozeans lebte. Hinreichend verdünnt, schickte das Gift sein Opfer nur in einen tiefen Schlaf, aus dem es einige Stunden später mit fürchterlichen Kopfschmerzen erwachte.
Dummerweise trug der Wächter eine ziemlich gute Rüstung. Sancia würde einen perfekten Treffer landen müssen. Sie hätte ihn in die ungeschützte Achselhöhle schießen können, doch das Risiko, die Stelle zu verfehlen, war zu hoch.
Sie konnte auch versuchen, ihn zu töten. Sancia hatte ihr Stilett dabei und war gut im Anschleichen, zudem war sie für ihre geringe Körpergröße recht stark.
Allerdings taugte Sancia weit mehr zur Diebin denn zur Mörderin, und sie hatte es mit dem ausgebildeten Wachmann eines Handelshauses zu tun. Keine sonderlich guten Erfolgsaussichten.
Darüber hinaus war Sancia nicht zur Michiel-Gießerei gekommen, um Kehlen aufzuschlitzen, Gesichter einzuschlagen oder Schädel zu zertrümmern. Sie war hier, um ihren Auftrag zu erledigen.
Eine Stimme hallte durch die Gasse. »Ahoi, Niccolo! Was machst du so weit von deinem Posten entfernt?«
»Ich glaube, es ist schon wieder etwas im Abwasserkanal verendet. Hier stinkt’s nach Tod!«
»Oh, warte mal«, erwiderte die Stimme. Schritte näherten sich.
Ach verdammt, dachte Sancia. Jetzt sind es schon zwei.
Sie musste einen Ausweg finden, und zwar schnell.
Sie schaute zur Steinwand hinter sich und dachte nach. Dann seufzte sie, kroch hinüber und zögerte.
Sie wollte sich nicht jetzt schon verausgaben. Doch ihr blieb keine Wahl.
Sancia zog den linken Handschuh aus, drückte die Hand auf die dunklen Mauersteine, schloss die Augen und setzte ihr Talent ein.
Die Wand sprach zu ihr.
Sie erzählte ihr vom Rauch der Gießerei, von heißem Regen, kriechendem Moos und den leisen Schritten Tausender Ameisen, die im Laufe der Jahrzehnte über ihr fleckiges Gesicht gekrabbelt waren. Die Oberfläche der Mauer erblühte in Sancias Geist, und sie nahm jeden Riss, jeden Spalt, jeden Mörtelklecks und jeden verschmutzten Mauerstein wahr.
All diese Informationen schossen Sancia im selben Moment durch den Kopf, in dem sie die Wand berührte. Und in diesem plötzlichen Wissensschwall fand sie auch das, worauf sie gehofft hatte.
Lose Steine. Vier Stück, groß, nur wenige Schritte von ihr entfernt. Und dahinter lag ein geschlossener, dunkler Raum, ungefähr einen Meter dreißig breit und hoch. Augenblicklich wusste sie, wo er sich befand, als hätte sie die Wand selbst gemauert.
Hinter der Wand ist ein Gebäude, dachte sie. Ein altes. Gut.
Sancia nahm die Hand von der Mauer. Zu ihrem Schrecken fing die große Narbe auf ihrer rechten Kopfseite an zu schmerzen.
Ein schlechtes Zeichen. Sie würde ihr Talent in dieser Nacht noch viel öfter einsetzen müssen.
Sie streifte sich wieder den Handschuh über und kroch zu den losen Steinen. Anscheinend hatte sich hier früher eine kleine Luke befunden, die man vor Jahren zugemauert hatte. Sie hielt inne und lauschte – die beiden Wächter liefen offenbar schnüffelnd durch die Gasse, um zu ergründen, woher der Gestank kam.
»Ich schwör’s bei Gott, Pietro«, sagte einer von ihnen, »das roch wie die Scheiße des Teufels!« Gemeinsam schritten die beiden die Gasse entlang.
Sancia packte den obersten losen Stein und zog ganz vorsichtig daran. Er gab nach und ließ sich ein Stück herausziehen.
Sie blickte zu den Wächtern zurück, die sich noch immer zankten.
Rasch und leise zog Sancia die schweren Steine aus der Wand und legte sie in den Schlamm, einen nach dem anderen. Dann spähte sie in den muffigen Raum dahinter.
Darin war es dunkel, doch als nun ein wenig Licht hineinfiel, sah sie viele winzige Augen in den Schatten und jede Menge kleiner Kothäufchen auf dem Steinboden.
Ratten, dachte sie. Und zwar viele.
Dagegen konnte sie nichts tun. Ohne einen Gedanken zu verschwenden, kroch sie in den engen, dunklen Raum.
Die Ratten gerieten in Panik und kletterten die Wände hoch, flüchteten in Risse und Spalten zwischen den Steinen. Einige flitzten über Sancia hinweg, manche versuchten sie zu beißen, doch Sancia trug, was sie als ihre »Diebeskluft« bezeichnete: einen selbstgemachten Aufzug mit Kapuze, der aus dicker grauer Wolle und altem schwarzem Leder bestand. Er bedeckte ihre ganze Haut und war recht schwer zu durchdringen.
Sie zwängte die Schultern durch das Einstiegsloch, schüttelte die Ratten ab oder schlug sie beiseite – doch dann erhob sich vor ihr ein größeres Tier auf die Hinterbeine, gut und gern zwei Pfund schwer, und fauchte sie bedrohlich an.
Sancias Faust fuhr herab und zermalmte den Schädel der Ratte auf dem Steinboden. Sie lauschte, ob die Wächter sie gehört hatten, und als sie zufrieden feststellte, dass dem nicht so war, schlug sie zur Sicherheit noch einmal auf die große Ratte ein. Dann kroch sie ganz in den Raum, griff vorsichtig nach draußen und schloss die Öffnung wieder mit den Mauersteinen.
Geht doch, dachte sie, schüttelte eine weitere Ratte ab und klopfte sich die Kothaufen von der Kleidung. Das lief gar nicht mal so schlecht.
Sie schaute sich um. Ihre Augen gewöhnten sich allmählich an die Finsternis. Anscheinend befand sie sich in einem Kaminofen, in dem die Arbeiter der Gießerei vor langer Zeit ihr Essen gekocht hatten. Der Kamin war mit Brettern vernagelt. Über ihr war der offene Schornstein – gleichwohl erkannte sie, dass jemand versucht hatte, auch die Kaminöffnung mit Brettern zu verschließen.
Sie nahm ihr Umfeld in Augenschein. Der Schornstein war recht schmal. Genau wie Sancia. Und sie war gut darin, sich durch enge Schächte zu winden.
Mit einem Grunzen sprang sie hoch, verkeilte sich mit Schultern und Füßen in der Öffnung und begann, den Schornstein hochzuklettern, Zentimeter um Zentimeter. Sie war schon fast halb oben, als sie unter sich ein Klirren vernahm.
Sie erstarrte und blickte hinunter. Ein dumpfer Schlag erklang, gefolgt von einem Knall, dann fiel Licht in den Ofen unter ihr.
Die Stahlhaube eines Wächters tauchte auf. Der Mann beäugte das verlassene Rattennest und rief: »Uh! Sieht aus, als hätten es sich die Ratten hier gemütlich gemacht. Daher muss auch der Gestank kommen.«
Sancia schaute auf den Wächter hinab. Sobald er den Blick hob, würde er sie entdecken.
Der Mann besah sich die große tote Ratte. Sancia bemühte sich nach Kräften, nicht zu schwitzen, damit keine Tropfen auf seinen Helm fielen.
»Dreckige Viecher«, murrte die Wache. Dann zog er den Kopf zurück.
Sancia wartete, nach wie vor erstarrt – sie konnte die beiden unten reden hören. Dann entfernten sich ihre Stimmen langsam.
Sie stieß einen Seufzer aus. Das ist ganz schön riskant, nur um zu einem verfluchten Frachtwagen zu gelangen.
Sie erreichte die Schornsteinöffnung und hielt inne. Die Bretter gaben widerstandslos nach, als sie dagegen drückte. Sancia kletterte aufs Dach des Gebäudes, legte sich auf den Bauch und sah sich um.
Zu ihrer Überraschung befand sich die Karrenfahrbahn gleich vor dem Gebäude – Sancia war genau da, wo sie sein musste. Sie beobachtete, wie ein Karren den verschlammten Weg bis zum Ladedock hinabfuhr, das sie als hellen Lichtfleck auf dem dunklen Gießereigelände wahrnahm. Am Dock herrschte reges Treiben. Die Gießerei ragte über dem Ladedock auf, ein großer, beinahe fensterloser Ziegelbau, dessen sechs dicke Schornsteine Rauch in den Nachthimmel spien.
Sie robbte zum Dachrand, zog erneut den Handschuh aus und legte die bloße Hand auf die Fassade. Die Wand erblühte in ihrem Geist, jeder schiefe Stein, jeder Moosklumpen – und jeder Vorsprung oder Spalt, an dem sie beim Klettern Halt finden würde.
Sie ließ sich über den Rand des Daches hinab und begann mit dem Abstieg. Ihr Kopf pochte, ihre Hände schmerzten, und sie war völlig verdreckt. Ich hab noch nicht einmal die erste Etappe erreicht und bin schon fast aus eigener Schuld gestorben.
»Zwanzigtausend«, wisperte sie und setzte den Abstieg fort. »Zwanzigtausend Duvoten.« Wahrlich ein fürstlicher Lohn. Für zwanzigtausend Duvoten war Sancia bereit, eine Menge zu erdulden und viel Blut zu opfern. Sogar mehr, als sie hatte.
Die Sohlen ihrer Stiefel berührten den Boden, und sie rannte los.
Die Fahrbahn der Frachtkarren war kaum beleuchtet, das Ladedock voraus indes erstrahlte im Licht von Feuerkörben und skribierten Laternen. Selbst zu dieser Stunde wimmelte es von hin und her rennenden Arbeitern, die die aufgereihten Karren vor dem Dock entluden. Eine Handvoll Wachen sah ihnen dabei gelangweilt zu.
Sancia drückte sich an die Wand und schlich näher. Ein Rumpeln erklang, sie erstarrte, wandte den Kopf ab und presste sich noch fester an die Wand.
Ein weiterer großer Karren donnerte die Fahrbahn entlang und bespritzte sie mit grauem Schlamm. Als er vorbeigerollt war, blinzelte sie sich den Dreck aus den Augen und sah ihm nach. Der Karren schien aus eigener Kraft zu fahren: Weder zog ihn ein Pferd noch ein Esel oder irgendein anderes Tier.
Unbeeindruckt sah Sancia die Fahrbahn hinauf. Es wäre eine Schande, dachte sie, wenn ich mich durch Abwasser und einen Haufen Ratten gekämpft hätte, nur um wie ein Straßenköter von einem Karren überrollt zu werden.
Sie huschte weiter, näherte sich den Frachtkarren und besah sie sich. Einige wurden von Pferden gezogen, die meisten jedoch nicht. Sie kamen aus ganz Tevanne hierher – von den Kanälen, von anderen Gießereien oder vom Hafen. Und am meisten interessierte sich Sancia in dieser Nacht für den Hafen.
Sie duckte sich unter die Rampe des Ladedocks und schlich zu den aufgereihten Karren. Als sie sich ihnen näherte, hörte sie ihr Wispern in ihrem Geist.
Gemurmel. Geschnatter. Gedämpfte Stimmen. Nicht von den Pferdekarren – die sprachen nicht zu ihr –, nur die skribierten.
Ihr Blick fiel auf die Räder des Karrens vor ihr, und da sah sie es.
Die Innenseiten der großen Holzräder waren mit einer Art mattem, durchgehendem Text beschriftet, der aus silbrigem, glänzendem Metall zu bestehen schien – »Sigillums« oder »Sigillen«, wie Tevannes Elite diese Zeichen nannte. Aber die meisten nannten sie schlicht »Skriben«.
Zwar war Sancia nicht im Skribieren geschult, doch gehörte es in Tevanne zum Allgemeinwissen, wie skribierte Karren funktionierten: Die Befehle, die man auf die Räder schrieb, überzeugten diese davon, auf abschüssigem Gelände zu fahren, und da die Räder das wirklich glaubten, fühlten sie sich dazu verpflichtet, bergab zu rollen – selbst, wenn der Karren gar keinen Hügel hinabrumpelte, sondern über eine völlig ebene (wenn auch stark verschlammte) Fahrbahn am Kanal fuhr.
Der Fahrer saß im Inneren und bediente die Steuerung, die den Rädern Anweisungen gaben wie »Oh, wir sind jetzt auf einem steilen Hügel, dreht euch besser schneller« oder »Moment, nein, der Hügel flacht ab, lasst uns das Tempo drosseln« oder »Hier sind keine Hügel mehr, also haltet einfach an«. Und die Räder, völlig im Bann der Skriben, gehorchten freudig, wodurch man weder Pferde, Esel, Ziegen noch irgendwelche anderen stumpfsinnigen Kreaturen benötigte, die die Menschen durch die Gegend schleppten.
So funktionierten Skriben: Sie waren Anweisungen, die man auf geistlose Objekte schrieb, um sie dazu zu bringen, der Realität auf bestimmte Weise nicht länger zu gehorchen.
Sancia hatte Geschichten darüber gehört, dass man die Räder der ersten skribierten Karren nicht ordentlich kalibriert hatte. In einer dieser Geschichten hatten die Vorderräder gedacht, es würde in ihrer Richtung bergab gehen, während die Hinterräder glaubten, dies wäre in ihrer Richtung der Fall, wodurch der Karren zerborsten war. Andere Räder hatten ihre Karren in phänomenalem Tempo durch die Straßen Tevannes rollen lassen, was für jede Menge Chaos, Zerstörung und sogar Tote gesorgt hatte.
Und das bedeutete, dass es – obwohl skribierte Karrenräder eine sehr fortschrittliche Erfindung waren – nicht die klügste Idee war, seinen Abend in ihrer Nähe zu verbringen.
Sancia kroch zu einem Rad. Sie erschauderte, als die Skriben immer lauter in ihren Ohren wisperten. Das war womöglich ihr seltsamstes Talent – sie hatte noch nie jemanden getroffen, der Skriben hören konnte –, aber es war erträglich.
Sie ignorierte die Stimmen, schob ihren rechten Zeige- und Mittelfinger durch die Schlitze im Handschuh, hielt die Fingerspitzen in die feuchte Luft, dann berührte sie das Karrenrad mit den Fingern und fragte es, was es wusste.
Und ähnlich wie die Mauer in der Gasse antwortete das Rad. Es erzählte ihr von Asche, Stein, Flammen, Funken und Eisen.
Das ist der falsche, dachte Sancia. Der Karren kam vermutlich von einer Gießerei, und an Gießereien war sie heute nicht interessiert.
Sie spähte hinter dem Karren hervor, vergewisserte sich, dass die Wachen sie nicht gesehen hatten, und huschte die Reihe entlang zum nächsten Vehikel.
Sie berührte auch dort ein Karrenrad mit den Fingerspitzen und fragte es, was es wusste.
Das Rad sprach von weichem Lehmboden, vom sauren Geruch nach Mist und vom Duft gemähter Pflanzen.
Ein Bauernhof, vielleicht. Nein, dieser Karren ist es auch nicht.
Sie huschte zum nächsten Fahrzeug – diesmal zu einem guten alten Pferdekarren –, berührte ein Rad und fragte es, was es wusste.
Das Rad erzählte von Asche, Feuer, Hitze und den zischenden Funken schmelzenden Erzes.
Der hier kommt von einer anderen Gießerei, dachte sie. Hoffentlich hat sich Sarks Informant nicht geirrt. Denn wenn alle Karren hier von Gießereien oder Bauernhöfen kommen, ist der ganze Plan schon jetzt zum Scheitern verurteilt.
Das Pferd schnaubte missbilligend, als Sancia zum nächsten Karren schlich. Sie war nun am vorletzten in der Reihe angekommen, daher gingen ihr allmählich die Optionen aus.
Sie streckte die Hand aus, berührte eins der Räder und fragte es, was es wusste.
Dieses Rad erzählte von Kies, Salz, Seetang, dem Duft der Ozeangischt und nassen Holzspanten, die über den Wellen schaukelten …
Sancia nickte erleichtert. Das ist er.
Sie griff in eine Tasche und zog ein seltsam aussehendes Objekt heraus: ein kleines Bronzeblech mit vielen Skriben. Dann holte sie auch ein Töpfchen mit Teer hervor, bestrich die Rückseite des Blechs damit und klebte es an die Unterseite des Karrens.
Sie hielt inne und dachte daran, was ihr Schwarzmarktkontakt ihr gesagt hatte. »Kleb das Leitblech an das Objekt, das du verfolgen willst, und sieh zu, dass es gut hält. Du willst nicht, dass es abfällt.«
»Aber … was passiert, wenn es auf der Straße oder woanders abfällt?«, hatte Sancia gefragt.
»Tja, dann stirbst du. Wahrscheinlich ziemlich grausam.«
Sancia drückte das Blech noch fester an. Bring mich nicht um, verrogelt noch mal, dachte sie und funkelte das Blech finster an. Dieser Auftrag ist ohnehin gefährlich genug.
Dann huschte sie zwischen den anderen Karren hindurch, zurück zur Fahrbahn und den Höfen der Gießerei.
Diesmal war sie vorsichtiger und hielt sich penibel auf der windabgewandten Seite der Wachen. Rasch erreichte sie den Abwassertunnel. Jetzt müsste sie nur noch durchs stinkende Wasser zurückstapfen und zum Hafen.
Dorthin würde auch der Karren fahren, den sie manipuliert hatte. Seine Räder hatten von der Meeresgischt, von Kies und salziger Luft gesprochen – Dinge, die ein Karren nur vom Hafen kennen konnte. Hoffentlich würde er ihr auf das streng bewachte Gelände helfen.
Denn irgendwo im Hafen gab es einen Tresor. Und ein unvorstellbar reicher Kunde hatte Sancia damit beauftragt, einen bestimmten Gegenstand daraus zu stehlen, für eine undenkbar hohe Geldsumme.
Sancia verdingte sich gern als Diebin. Sie war gut darin. Doch nach dem heutigen Abend würde sie vielleicht nie wieder stehlen müssen.
»Zwanzigtausend«, murmelte sie. »Zwanzigtausend. Zwanzigtausend herrliche, herrliche Duvoten.«
Sie ließ sich in das Kanalrohr hinab.
Kapitel 2
Im Grunde begriff Sancia ihre Talente nicht. Sie wusste nicht, wie sie funktionierten, wo ihre Grenzen lagen oder ob sie sich immer auf sie verlassen konnte. Sie wusste allein, was sie bewirkten und wie sie sie nutzen konnte.
Berührte sie ein Objekt mit bloßer Hand, verstand sie es. Sie begriff seine Natur, Beschaffenheit und Form. War das Objekt in letzter Zeit irgendwo gewesen oder hatte es etwas berührt, konnte sich Sancia daran erinnern, als hätte sie es selbst erlebt. Und wenn sie ein skribiertes Objekt berührte oder sich ihm nur näherte, hörte sie dessen Wispern in ihrem Kopf.
Das bedeutete nicht, dass sie die Bedeutung der Skriben erfasste. Sie hörte nur ihr Säuseln.
Sancias Talente ließen sich vielfältig einsetzen. Bei jeder flüchtigen Berührung eines Gegenstandes strömten dessen jüngste Empfindungen in sie hinein. Eine längere Berührung vermittelte ihr ein körperliches Gespür für das jeweilige Objekt - wo man es greifen konnte, wo es schwach, weich, hohl war oder was es enthielt. Und wenn sie etwas lange genug berührte – was äußerst schmerzhaft für sie war –, erlangte sie dabei ein fast perfektes Bild von der räumlichen Dimension: Berührte sie etwa die Steinfliese eines Raums, spürte sie irgendwann alle Böden im Gebäude, alle Wände, das Dach und alles, was damit verbunden war. Vorausgesetzt, sie übergab sich nicht vor Schmerz.
Denn ihre Fähigkeiten hatten auch Schattenseiten. Sancia hielt ihre Haut größtenteils bedeckt. Denn es war beispielsweise recht knifflig, mit einer Gabel zu essen, deren Empfindungen einem den Verstand überfluteten.
Doch ihre Talente brachten natürlich auch unglaubliche Vorteile mit sich. Etwa, wenn man auf einem Gelände Wertobjekte stehlen wollte. Sancia war enorm begabt darin, Wände hochzuklettern, sich in finsteren Gassen zu orientieren und Schlösser zu knacken – denn das Schlossknacken ist leicht, wenn das Schloss selbst einem sagt, wie man es knacken muss.
Über eine Sache aber dachte sie nur äußerst ungern nach: woher ihre Talente stammten. Denn Sancia hatte ihre Talente am selben Ort erhalten wie auch die scheußliche weiße Narbe, die über ihre rechte Kopfseite verlief, die Narbe, die stets wie Feuer brannte, wenn sie ihre Talente überstrapazierte.
Sancia mochte ihre Talente nicht besonders. Sie waren ebenso einschränkend und strapaziös wie mächtig. Doch halfen sie ihr, am Leben zu bleiben. Und in dieser Nacht würden sie Sancia hoffentlich reich machen.
Die nächste Etappe war der Fernezzi-Komplex, ein neunstöckiges Gebäude auf der anderen Seite des Hafens von Tevanne. Es war ein Altbau, errichtet für Zollbeamte und Makler, die darin ihre Finanzen verwaltet hatten, ehe die Handelshäuser fast den gesamten Handel in Tevanne übernommen hatten. Das Alter des Bauwerks und seine kunstvoll verzierte Fassade kamen Sancia zupass, denn daran fand sie an vielen Stellen sicheren Halt beim Klettern.
Das heißt schon was, dachte sie, während sie ächzend die Wand erklomm, dass der leichteste Teil des Auftrags darin besteht, auf das verdammte Gebäude zu klettern.
Schließlich erreichte sie das Dach. Sie hielt sich am Granitsims fest, zog sich hinauf, lief zur Westseite und blickte hinab, vor Erschöpfung keuchend.
Vor ihr lag eine breite Bucht, über die eine Brücke führte, und auf der anderen Seite befand sich der Hafen von Tevanne. Große Frachtkarren rollten über die Brücke, ihre Karossen bebten auf den nassen Pflastersteinen. Fast alle gehörten der Handelskammer und transportierten Güter zwischen den Gießereien hin und her.
Einer davon musste derjenige sein, an dem Sancia das Leitblech befestigt hatte. Hoffe ich jedenfalls, verrogelt noch mal, dachte sie. Ansonsten habe ich meinen Hintern völlig grundlos durch einen Fluss aus Scheiße und ein Gebäude hoch geschleppt.
Seit eh und je war der Hafen so gefährlich wie jeder andere Bezirk Tevannes, den die Handelshäuser nicht direkt kontrollierten, und die Korruption war hier unfassbar schamlos. Vor einigen Monaten hatten die Häuser einen Helden der Aufklärungskriege angeheuert, und der hatte alle Gauner vertrieben, professionelle Wachen eingestellt und am ganzen Ufer Sicherheitsposten eingerichtet. Dazu gehörten auch skribierte Sicherheitsmauern wie die der Handelshäuser, die niemanden ohne die richtigen Ausweise durchließen.
Von einem Tag auf den anderen war es schwer geworden, am Hafen etwas Illegales zu tun. Was für Sancia unangenehm war. Um ihren Auftrag zu erfüllen, musste sie daher einen anderen Weg in den Hafen finden.
Sie kniete nieder, knöpfte eine Brusttasche auf und nahm ihr wahrscheinlich wichtigstes Hilfsmittel der Nacht heraus. Es sah aus wie ein Stoffbündel, doch als sie es auseinanderfaltete, nahm es in etwa die Form einer Schale an.
Sie betrachtete den kleinen schwarzen Segelgleiter, der nun vor ihr auf dem Dach lag.
»Das Ding wird mich umbringen«, murmelte sie.
Sie nahm das letzte fehlende Stück des Segelgleiters, eine ausziehbare Stahlstange. An beiden Enden war je eine kleine skribierte Scheibe befestigt – Sancia hörte ihr Säuseln und Wispern im Kopf. Wie bei allen skribierten Instrumenten verstand die Diebin nicht, was sie sagten, doch ihre Schwarzmarktkontakte hatten ihr genau erklärt, wie der Gleiter zu handhaben war.
»Das ist ein zweiteiliges System«, hatte Claudia gesagt. »Du steckst das Leitblech an das Ding, zu dem du willst. Das Blech sagt dann den Scheiben an der Stange: ›He, ich weiß, ihr glaubt, ihr seid unabhängig, aber in Wahrheit gehört ihr zu mir, und ich bin an diesem Ding hier befestigt. Also müsst ihr herkommen und euch mit mir vereinen, schnell.‹ Und die Scheiben sagen: ›Echt? Oje, was machen wir so weit von dir entfernt? Wir müssen uns sofort mit dir vereinen!‹ Und wenn du den Schalter umlegst, machen sie das auch. Und das sehr, sehr schnell.«
Sancia war halbwegs vertraut mit dieser Skribier-Technik. Sie glich dem Verfahren, mit der die Handelshäuser Ziegelsteine und andere Baumaterialien miteinander verbanden: Sie überzeugten sie davon, dass sie alle Teil eines einzigen Objekts waren. Allerdings nutzte niemand diese Methode, um größere Distanzen zu überwinden, denn das hielt man nicht für sicher; da gab es weit zuverlässigere Möglichkeiten der Fortbewegung.
Doch waren die teuer. Zu teuer für Sancia.
»Und der Segelgleiter verhindert, dass ich abstürze?«,hatte Sancia gefragt, als Claudia ihre Erklärung beendet hatte.
»O nein«, hatte die geantwortet. »Der Segelgleiter verlangsamt den Sturz. Wie ich sagte, dieses Ding wird wirklich sehr, sehr schnell. Deshalb musst du dich in großer Höhe befinden, wenn du ihn einschaltest. Sorg einfach dafür, dass das Leitblech am richtigen Zielobjekt angebracht ist und dir nichts den Weg versperrt. Probier zuerst die Testmünze aus. Wenn alles stimmt, schalte die Stange an, und los geht’s.«
Sancia griff in eine andere Tasche und nahm ein kleines Glasgefäß heraus. Darin lag eine Bronzemünze, mit Sigillen skribiert, die denen auf der Stange des Segelgleiters glichen.
Sie beäugte die Münze. Sie haftete fest an der Glasseite, die dem Hafen zugewandt war. Sancia drehte das Gefäß, und als wäre das Kupferstück magnetisiert, flitzte es durchs Glas und blieb mit vernehmlichem Tink auf der anderen Seite, die dem Hafen nähere, haften.
Wenn das Leitblech am Karren die Münze anzieht, dachte Sancia, heißt dies, dass der Karren im Hafen ist. Also alles gut.
Sie hielt inne. Wahrscheinlich. Vielleicht.
Sie zauderte eine ganze Weile. »Scheiße.«
Sancia hasste solche Situationen, doch dann steckte sie das Glas ein und führte die Stange in das spitze Ende des Segelgleiters.
Denk einfach daran, was Sark gesagt hat, dachte sie. Denk einfach an die Summe – zwanzigtausend Duvoten.
Genug Geld, um ihre Heilung zu bezahlen. Um wieder normal zu werden.
Sancia betätigte den Schalter an der Stange und sprang vom Dach.
Sofort sauste sie in einer Geschwindigkeit über die Bucht hinweg, die sie nie für möglich gehalten hätte, gezogen von der Stahlstange, die, soweit sie es begriff, sich unbedingt mit dem Karren unten am Hafen vereinen wollte. Sie hörte, wie der Stoff des Segelgleiters hinter ihr in der Luft peitschte und sich schließlich öffnete, was sie ein wenig abbremste – anfangs kaum, dann ein wenig mehr und noch ein wenig mehr.
Ihre Augen tränten, und sie biss die Zähne zusammen. Den nächtlichen Anblick Tevannes nahm sie nur verschwommen wahr. Sie sah das Wasser in der Bucht glitzern, den Wald aus Schiffsmasten im Hafen, die zitternden Dächer der Karren, die zum Hafen fuhren, und den Rauch der Gießereien, die sich um den Schiffskanal scharten.
Konzentrier dich, dachte sie. Konzentrier dich, du Idiot.
Dann … schlingerte alles.
Ihr wurde flau im Magen. Etwas stimmte nicht.
Sie blickte hinter sich und sah einen Riss im Segeltuch.
Scheiße.
Entsetzt beobachtete sie, wie sich der Riss vergrößerte.
Scheiße. Doppelscheiße!
Erneut geriet der Gleiter ins Schlingern, so sehr, dass Sancia kaum mitbekam, wie sie die Hafenmauern überquerte. Der Gleiter erhöhte das Tempo, wurde schneller und schneller.
Ich muss mich von diesem Ding lösen. Jetzt. Jetzt!
Sie segelte über aufgestapelte Frachtkisten, von denen einige ziemlich hoch emporragten. Hoch genug, dass sie sich darauf fallen lassen und abfedern könnte. Vielleicht.
Sie blinzelte die Tränen aus den Augen, konzentrierte sich auf einen hohen Kistenstapel, richtete den Segelgleiter aus und …
… legte den Hebel an der Stange um.
Sogleich verlor sie an Schwung. Sie flog nicht länger, sondern sank den Kisten entgegen, die sich knapp sieben Schritt unter ihr befanden. Der schlingernde Segelgleiter bremste sie etwas ab, war aber noch unangenehm schnell.
Die Kisten rasten ihr entgegen.
Ach, zur Hölle!
Sie prallte so heftig gegen die Kante einer Holzkiste, dass ihr der Atem wegblieb, dennoch reagierte sie geistesgegenwärtig genug, um sich daran festklammern zu können. Der Gleitschirm, den Sancia losgelassen hatte, wurde von einer Brise weggetrieben.
Sancia hing schwer atmend seitlich an der Kiste. Sie hatte ähnliche Situationen geübt, etwa von einem Dach zu springen und nach der Dachkante eines niedrigeren Gebäudes zu greifen, um ihren Sturz abzufangen und sich festzuhalten, doch hatte sie diese Fertigkeiten bislang kaum einsetzen müssen.
Irgendwo rechts von ihr fiel die Segelstange mit lautem Klirren zu Boden.
Sie erstarrte, blieb an der Kiste hängen und lauschte einen Moment darauf, ob jemand Alarm schlug.
Nichts. Stille.
Der Hafen war groß. Hier achtete man nicht unbedingt auf jedes Geräusch.
Hoffentlich.
Sancia löste die linke Hand von der Kiste, hielt sich nur noch mit der rechten fest und zog sich den Handschuh mit den Zähnen aus. Dann berührte sie mit der bloßen Hand das Holz und lauschte.
Die Kiste erzählte ihr von Wasser, Regen, Öl, Stroh und den stechenden Schmerzen, die winzige Nägel verursacht hatten …
Und wie man an ihr hinabklettern konnte.
Die zweite Etappe – zum Hafen zu gelangen – war anders verlaufen als geplant.
Jetzt zur dritten Etappe, dachte sie müde und kletterte hinab. Wollen mal sehen, ob ich wenigstens die nicht vermassle.
Als Sancia am Boden ankam, war sie zunächst zu nichts anderem imstande, als zu schnaufen und sich die geprellte Seite zu reiben.
Ich hab’s geschafft. Ich bin drin. Ich bin da.
Sie spähte zwischen den Frachtkisten hindurch zum Gebäude am Ende des Hafens. Es war das Hauptquartier der Wasserwacht, der Polizeibehörde des Hafens.
Tja, ich bin fast da.
Sie streifte sich auch den zweiten Handschuh ab, stopfte beide in die Taschen und berührte die Pflastersteine zu ihren Füßen. Sie schloss die Augen und lauschte dem Stein.
Das fiel Sancia alles andere als leicht: Der Boden ringsum erstreckte sich über das ganze Gelände, daher musste sie auf vieles gleichzeitig lauschen. Dennoch gelang es ihr. Sie ließ die Steine in ihren Geist, nahm die Vibrationen und die Erschütterungen von Leuten wahr, die …
Gingen. Standen. Rannten. Mit den Füßen scharrten. Sancia spürte sie so intensiv wie Finger, die einem über den nackten Rücken streichen.
Neun Wächter in der Nähe, dachte sie. Schwere Kerle, groß. Zwei auf ihren Posten, sieben auf Patrouille. Im Hafen waren zweifellos noch viel mehr unterwegs, doch konnte Sancia mithilfe der Steine nur begrenzt weit sehen.
Sie merkte sich die Positionen der Wächter, wohin sie gingen, ihr Tempo. Bei denjenigen, die ihr besonders nah waren, spürte sie sogar deren Absätze auf dem Stein, daher wusste sie, in welche Richtung sie unterwegs waren.
Die Narbe an ihrem Kopf erwärmte sich schmerzhaft. Sancia zuckte zusammen und nahm die Hände vom Boden, doch die Erinnerung an die Wächter blieb. Das ermöglichte ihr, sich auf dem Gelände zu orientieren, als liefe sie im Dunkeln durch einen vertrauten Raum.
Sancia atmete tief ein, löste sich aus den Schatten und lief los. Sie huschte zwischen Kisten, glitt unter Karren hindurch und hielt nur dann inne, wenn eine Patrouille vorbeikam. Die Kisten zeigten zumeist die Kennzeichnung von Plantagen weit draußen im Durazzomeer, und Sancia kannte diese Orte nur zu gut. Sie wusste, diese Güter – Hanf, Zucker, Teer, Kaffee – wurden nicht von Leuten geerntet, die ihre Arbeitskraft auch nur ansatzweise freiwillig zur Verfügung stellten.
Bastarde, dachte sie, während sie durch die Lücken zwischen den Kisten schlich. Ein Haufen elender, verrogelter Bastarde.
An einer Frachtkiste hielt sie inne. Im Dunkeln konnte sie nicht lesen, was darauf geschrieben stand, doch als sie eins der Bretter, aus denen sie gefertigt war, mit bloßem Finger berührte und aufmerksam lauschte, sah sie, was die Kiste enthielt …
Papier. Jede Menge davon. Unbeschriebenes, schlichtes Papier. Genau das Richtige für ihr Vorhaben.
Zeit für meinen Fluchtplan, dachte sie.
Sancia streifte die Handschuhe über, schnürte eine Tasche an ihrem Oberschenkel auf und holte das letzte skribierte Werkzeug heraus, das sie heute Nacht benutzen würde: ein kleines Holzkästchen. Es hatte sie mehr gekostet, als sie je für einen Auftrag ausgegeben hatte, doch ohne dieses Instrument wäre ihr Leben in dieser Nacht keinen Pfifferling wert gewesen.
Sie platzierte das Kästchen auf der Kiste. Das sollte funktionieren. Sie hoffte es. Ansonsten würde ihre Flucht vom Hafengelände um ein Vielfaches schwerer werden.
Sie griff wieder in die Tasche und zog ein schlichtes Garnknäuel hervor, auf das eine dicke Bleikugel aufgefädelt war. In der Mitte der Kugel befanden sich in perfekter Anordnung winzige Sigillen, und als Sancia sie berührte, vernahm sie ein sanftes Wispern.
Die Diebin sah von der Bleikugel zum Kästchen auf der Frachtkiste. Dieses verrogelte Kästchen sollte besser funktionieren.
Sie steckte die Bleikugel in die Tasche zurück. Ansonsten bin ich hier gefangen wie ein Fisch im Topf.
Sancia sprang über den niedrigen Zaun, der das Hauptquartier der Wasserwacht umgab, und rannte zur Gebäudewand. Sie schlich zur Ecke und riskierte einen Blick. Niemand zu sehen. Nur ein großer, dicker Türrahmen, der etwa zehn, zwölf Zentimeter aus der Wand ragte – mehr als genug, um Sancia Halt zu bieten.
Sie sprang hoch und packte den Balken des Türsturzes, zog sich hinauf, hielt inne, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden, und setzte den rechten Fuß auf den Balken. Sie zog sich ganz hoch, bis sie auf dem Türrahmen stand.
Rechts und links von ihr befanden sich zwei alte Fenster mit ölig-gelben Glasscheiben. Sancia zückte ihr Stilett, schob die Klinge in den Spalt eines Fensters, öffnete den Riegelhaken und stieß das Fenster auf. Nachdem sie das Stilett wieder weggesteckt hatte, richtete sie sich auf und blickte in den Raum.
Darin standen viele Regalreihen, mit lauter Pergamentschachteln gefüllt. Vermutlich irgendwelche Unterlagen. Wie es sich zu nachtschlafender Zeit gehörte, war niemand im Raum – mittlerweile war es eine Stunde nach der Tageswende –, doch im Erdgeschoss brannte Licht. Womöglich eine Kerzenflamme.
Die Tresore befinden sich unten, dachte Sancia. Und die dürften selbst um diese Zeit nicht unbewacht sein.
Sie kletterte durchs Fenster und schloss es dann, ging in die Hocke und lauschte.
Ein Husten, gefolgt von einem Schniefen.
Sie schlich zwischen den Regalen hindurch, bis sie an das Geländer der Galerie im ersten Stock gelangte, von wo aus sie ins Erdgeschoss spähte.
Ein einzelner Wachmann der Wasserwacht, betagt und mollig, saß bei der Vordertür an einem Tisch und füllte Formulare aus, eine brennende Kerze vor sich. Er trug einen leicht schiefen Schnauzer und eine zerknitterte blaue Uniform. Doch was Sancia wirklich interessierte, befand sich hinter ihm: eine Reihe großer Eisentresore, fast ein Dutzend, und wie sie wusste, lag in einem davon das Objekt, dessentwegen sie hier war.
Aber wasmach ich mit meinem Freund da unten?
Sie seufzte, als sie begriff, dass sie nur eine Möglichkeit hatte. Sie nahm das Bambusrohr hervor und schob einen Dolorspina-Pfeil hinein. Schon wieder neunzig Duvoten, die mich dieser Auftrag kostet, dachte sie. Sie schätzte die Entfernung zwischen sich und dem Wächter ein, der vor sich hin murmelte und das Blatt vor sich bekritzelte.
Sancia führte das Rohr an die Lippen, zielte sorgsam, atmete durch die Nase ein und …
Ehe sie schießen konnte, flog die Tür zum Hauptquartier auf, und ein großer, vernarbter Offizier der Wasserwacht trat ein. Er hielt etwas Nasses, Tropfendes in der Hand.
Sancia senkte das Blasrohr. Tja. Scheiße.
Der Wachmann war groß, breit und muskulös. Seine dunkle Haut, die dunklen Augen und der dichte schwarze Bart verrieten, dass er ein gebürtiger Tevanner war. Das Haar trug er kurz geschoren, und sein Auftreten und seine Ausstrahlung ließen in ihm ganz und gar den Soldaten erkennen, jemanden, der es gewohnt war, dass man seinen Befehlen prompt Folge leistete.
Er wandte sich dem Mann am Schreibtisch zu, der offenbar ebenso überrascht über sein Erscheinen war wie Sancia.
»Hauptmann Dandolo!«, sagte der Mann am Schreibtisch. »Ich dachte, Ihr wärt heute draußen bei den Piers.«
Sancia kannte den Namen: Das Haus Dandolo gehörte zu den vier großen Handelshäusern, und man sagte dem neuen Hauptmann der Wasserwacht Verbindungen zur Elite nach.
Ach, das ist also der Streifer, der sich vorgenommen hat, den Hafen zu reformieren. Sie zog sich gerade weit genug zwischen die Regale zurück, dass sie noch ins Erdgeschoss blicken konnte.
»Stimmt etwas nicht, Hauptmann?«, fragte der mollige Wachmann.
»Einer der Jungs hat ein Geräusch bei den Frachtkisten gehört und das hier gefunden.« Hauptmann Dandolo sprach schrecklich laut, als wollte er den ganzen Raum mit dem erfüllen, was er zu sagen hatte. Er hob etwas Nasses, Zerfetztes hoch – und Sancia erkannte darin augenblicklich die Überreste ihres Gleiters.
Sie verzog das Gesicht. Noch mal Scheiße.
»Ist das ein … Winddrachen?«, fragte der Mollige.
»Nein«, erwiderte Dandolo. »Das ist ein Segelgleiter; so etwas setzen die Handelshäuser zu Spionagezwecken ein. Ein ungewöhnlich minderwertiges Exemplar, aber offenbar ein Gleiter.«
»Alarmiert man uns denn nicht, sobald jemand die Mauer überwindet?«
»Nicht, wenn dieser Jemand sie hoch genug überfliegt, sodass er nicht bemerkt wird.«
»Ah. Und Ihr glaubt …« Der Mollige blickte über die Schulter zu der Tresorreihe.
»Ich lasse die Jungs momentan das Frachtlager durchkämmen«, sagte Dandolo. »Wenn jemand irre genug ist, mit so einem Ding in den Hafen zu fliegen, ist er vielleicht auch verrückt genug, sich an den Tresoren vergreifen zu wollen.« Er sog zischend die Luft ein. »Halt die Augen offen, Prizzo, aber bleib auf deinem Posten. Ich schaue mich um. Nur zur Sicherheit.«
»Jawohl, Hauptmann.«
Mit wachsendem Schrecken hörte Sancia, wie Dandolo die Stufen emporstieg. Das Holz knarrte unter seinem beträchtlichen Gewicht.
Scheiße! Scheiße!
Sie erwog ihre Möglichkeiten. Sie könnte zum Fenster zurück, es öffnen, sich hinausgleiten lassen und auf dem Türrahmen stehend warten, bis Dandolo den Raum verlassen hatte. Doch das barg eine Menge Risiken. Der Mann könnte sie erblicken oder hören.
Sie konnte mit einem Dolorspina-Pfeil auf Dandolo schießen. Dann würde er aber wahrscheinlich die Treppe hinunterpoltern, und der Mollige würde Alarm schlagen. Als sie überlegte, ob sie schnell genug nachladen konnte, um auch ihn rechtzeitig zu erwischen, fand sie diesen Plan nicht besser als den ersten.
Dann kam ihr eine dritte Idee.
Sie griff in die Tasche und zog das Garnknäuel mit der skribierten Bleikugel hervor.
Eigentlich hatte sie sich diesen Trick als letzte Ablenkung aufsparen wollen, während sie vom Gelände floh. Allerdings musste sie der aktuellen Lage sofort entkommen.
Sie steckte das Blasrohr ein, packte beide Enden des Garnknäuels und blickte zum Hauptmann, der nach wie vor die Stufen erklomm.
Du Arschloch verrogelst mir alles, dachte sie.
Mit einer raschen Bewegung zog sie das Garn straff.
Sancia begriff nur vage, wie der Skriben-Mechanismus funktionierte: Das Loch in der Bleikugel, durch das das Garn verlief, war innen mit Sandpapier beklebt und das Garn mit Feuerpottasche behandelt. Zog man es durch das Sandpapier, entzündete es sich. Nur ein mattes Glühen, aber das genügte.
Denn die skribierte Kugel war mit einer zweiten Bleikugel gekoppelt, die in dem kleinen Kästchen im Lager lag, auf der Frachtkiste mit Papier. Beide Kugeln waren dahingehend manipuliert, dass sie sich für ein und dieselbe Kugel hielten – wenn daher der einen etwas widerfuhr, dann auch der anderen. Tauchte man die eine in kaltes Wasser, würde sich auch die andere rasch abkühlen. Zerschlug man die eine, zersprang auch die zweite.
Wenn Sancia also das Garn straffte und das Innere der Kugel entzündete, wurde die zweite Kugel im Frachtlager im selben Moment ebenfalls heiß.
Nur, dass die zweite von wesentlich mehr Feuerpottasche umgeben war – und das Kästchen, das sie barg, war randvoll mit Blitzpulver gefüllt.
Als Sancia das Garn durch die Bleikugel zog, hörte sie ein mattes Bumm weit draußen im Frachtlager.
Verwirrt hielt der Hauptmann auf der Treppe inne. »Was zur Hölle war das?«
»Hauptmann?«, rief der Mollige von unten. »Hauptmann!«
Dandolo wandte sich um und rief: »Was war das, Feldwebel?«
»Ich weiß nicht, Hauptmann, aber, aber … da ist Rauch.«
Sancia wandte sich dem Fenster zu und sah, dass das skribierte Instrument gut funktioniert hatte. Eine dicke Säule weißen Rauchs stieg über dem Frachtlager auf, und Flammen verbreiteten ein fröhliches Flackern.
»Feuer!«, schrie der Hauptmann. »Scheiße! Komm mit, Prizzo!«
Zufrieden sah Sancia zu, wie die beiden zur Tür hinausrannten. Dann eilte sie zu den Tresoren hinab.
Hoffentlich brennt es eine Weile, dachte sie. Sonst knacke ich den Tresor, schnappe mir die Beute und hab dann keine Tricks mehr übrig, um vom Gelände zu fliehen.
Sancia musterte die aufgereihten Tresore. Sie erinnerte sich an Sarks Anweisungen: Es ist Tresor 23D. Ein kleines Holzkästchen. Die Kombination aller Tresore wird täglich geändert – Dandolo ist ein gerissener Bastard –, aber das sollte für dich kein Problem sein, oder, Mädchen?
Normalerweise nicht, aber nun arbeitete sie unter einem deutlich strafferen Zeitplan als gedacht.
Sie näherte sich 23D und zog die Handschuhe aus. In diesen Panzerschränken verstauten Passagiere ihre Wertsachen bei der Wasserwacht, vor allem jene, die keinem der Handelshäuser nahestanden. Gehörte man zu einem Handelshaus, lagerte man normalerweise dort seine Wertsachen, denn die Häuser fertigten sämtliche skribierten Gegenstände an und hatten daher weit höhere Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu bieten als lediglich ein paar Tresore mit Kombinationsschlössern.
Sancia legte die bloße Hand auf 23D. Sie drückte die Stirn gegen das Eisen, nahm das Drehrad in die andere Hand und schloss die Augen.
Der Panzerschrank erwachte in ihrem Geist zum Leben, erzählte ihr von Eisen, Dunkelheit und Öl, dem Klicken seiner vielen Zahnräder und dem Klacken seiner enorm komplexen Mechanismen.
Langsam drehte sie das Kombinationsrad und spürte gleich, auf welche Position es wollte. Sie drehte es langsam weiter, und …
Klick. Ein Funktionsriegel rastete ein.
Sancia atmete tief ein und drehte das Rad in die entgegengesetzte Richtung. Sie spürte, wie die Mechanismen in der Tür klickten und klackten.
Draußen im Frachtlager erklang das nächste Bumm.
Sancia öffnete die Augen. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie für den Knall nicht verantwortlich war.
Sie schaute zur Westseite des Büros und sah das Licht gieriger Flammen in den trüben Fensterscheiben tanzen. Etwas musste dort draußen Feuer gefangen haben, etwas weit Entzündlicheres als die Kiste voller Papier, die sie hatte abfackeln wollen.
Sie hörte Rufe und Geschrei draußen auf dem Hof. Ach, zur Hölle, dachte sie. Ich muss mich beeilen, ehe der ganze Hafen niederbrennt!
Erneut schloss sie die Augen und drehte das Kombinationsrad. Sie spürte, wie es einrastete. Die Narbe an ihrem Kopf brannte heiß, schmerzte wie ein Nadelstich ins Gehirn. Ich überanstrenge mich. Ich überschreite meine Grenzen …
Klick.
Zischend sog sie die Luft ein.
Noch mehr Geschrei auf dem Gelände. Ein weiteres, fernes Bumm.
Sie konzentrierte sich. Lauschte dem Tresor, ließ ihn in sich strömen, fühlte die freudige Erregung des Mechanismus, der mit angehaltenem Atem auf die letzte Drehung wartete.
Klick.
Sie öffnete die Augen und drehte den Griff. Der Panzerschrank öffnete sich mit leisem Klunk. Sie zog die Tür auf.
Der Tresor war mit Briefen, Schriftrollen, Umschlägen und dergleichen gefüllt. Doch weiter hinten lag Sancias Beute: ein Holzkästchen, ungefähr achtzehn Zentimeter lang und zehn Zentimeter tief. Ein schlichtes, dummes Kästchen, nahezu völlig unscheinbar – und doch war dieses Ding mehr wert als all die Kostbarkeiten, die Sancia in ihrem ganzen Leben gestohlen hatte.
Sie nahm das Kästchen mit bloßen Fingern heraus. Dann hielt sie inne.
Im Laufe des Abends hatte sie ihre Fähigkeiten sehr strapaziert; sie spürte zwar, dass das Kästchen etwas Seltsames an sich hatte, jedoch konnte sie es zunächst nicht benennen. Ein verschwommenes Bild schoss ihr durch den Kopf: Sie sah Wände aus Kiefernholz, die sich hinter weiteren Wänden befanden. Es war, als wollte sie während eines Gewitters ein Gemälde im Dunkeln betrachten.
Allerdings maß sie der Sache keine Bedeutung bei. Schließlich sollte sie das Kästchen nur stehlen, was es enthielt, konnte ihr egal sein.
Sie verstaute es in der Brusttasche. Dann schloss sie den Tresor, verriegelte ihn wieder und lief zur Tür hinaus.
Vor dem Hauptquartier der Wasserwacht sah sie, dass das Feuer inzwischen zu einer echten Feuersbrunst angewachsen war. Offenbar hatte sie das gesamte Frachtlager in Brand gesteckt. Mitglieder der Wasserwacht rannten umher und versuchten, das Inferno einzudämmen – und dies bedeutete, dass Sancia vermutlich jeden beliebigen Ausgang auf dem Gelände nutzen konnte.
Sie wandte sich um und rannte los. Wenn herauskommt, dass ich das war, komme ich ganz sicher an die Harfe.
Sie schaffte es zum Ostausgang des Hafengeländes, verlangsamte ihr Tempo, versteckte sich hinter einem Kistenstapel und vergewisserte sich, dass ihre Vermutung stimmte – alle Wachleute kümmerten sich ums Feuer, daher war der Ausgang unbewacht.
Sie rannte hindurch. Ihr Kopf tat weh, ihr Herz pochte, und ihre Narbe schmerzte entsetzlich.
Als sie durchs Tor lief, blickte sie kurz zum Feuer zurück. Ein Fünftel des Westgeländes stand lichterloh in Flammen, und eine unvorstellbar dichte Säule schwarzen Rauchs erhob sich zum Himmel und verdunkelte den Mond.
Sancia drehte sich um und rannte los.
Kapitel 3
Ein Viertel des Weges vom Hafen entfernt huschte Sancia in eine Gasse und wechselte die Kleidung. Sie wischte sich den Schlamm aus dem Gesicht, rollte ihre schmutzige Diebeskluft zusammen, schlüpfte in ein Kapuzenwams und zog Handschuhe und Strümpfe an.
Sie stand in der Gasse und schloss die Augen, fuhr zusammen, als das Gefühl von Schlamm und Rauch, Erde und dunkler Wolle aus ihren Gedanken wich und durch die Empfindung hellen, spröden Hanfstoffs ersetzt wurde. Ihr war, als hüpfe sie aus einem angenehm warmen Bad in einen eiskalten See, und es dauerte eine Weile, bis ihr Geist sich daran gewöhnt hatte.
Schließlich eilte sie die Straße entlang. Zweimal hielt sie inne, um sich zu vergewissern, dass ihr niemand folgte. Sie nahm eine Abzweigung, dann noch eine. Bald ragten die Mauern riesiger Handelshäuser zu beiden Seiten von ihr auf, weiß, hoch und gleichgültig – Haus Michiel zur Linken, Haus Dandolo zur Rechten. Hinter diesen Mauern lagen die Handelshaus-Enklaven, allgemein als »Campos« bezeichnet. Von dort aus regierten die Häuser ihre jeweiligen Gebiete wie kleine Königreiche.
Entlang der Campo-Mauern erstreckte sich ein behelfsmäßiges, klammes Gewirr aus Holzhütten und maroden Baracken mit krummen Schornsteinen, eine Siedlung, die zwischen den Campos so eingepfercht wirkte wie ein Floß zwischen zwei Schiffen.
Gründermark. Der Ort, der für Sancia einem Zuhause am nächsten kam. Am Ende einer Gasse bot sich ihr ein vertrauter Anblick. Feuerkörbe an den Straßenecken vor ihr warfen Funken in die Nacht. In einer Taverne zu ihrer Linken herrschte selbst zu dieser Stunde noch reges Treiben, in den vergilbten Fenstern schimmerte Kerzenlicht, gackerndes Lachen und Flüche drangen durch die Vorhänge vor dem Eingang ins Freie. Unkraut, Ranken und wilde Nussbäume wuchsen in den Gassen, als wollten sie das Viertel übernehmen.
Drei alte Frauen auf einem Balkon erblickten Sancia. Sie aßen von Holztellern, auf denen die Reste eines Streifers lagen – ein großer, hässlicher Wasserkäfer, der beim Kochen ein hübsches violettes Streifenmuster annahm.
Trotz des vertrauten Anblicks entspannte sich Sancia nicht. Zwar war sie in den Vierteln des einfachen Volks zu Hause, doch waren ihre Nachbarn ebenso skrupellos wie jeder Wächter eines Handelshauses.
Sie lief durch Hintergassen zu ihrem baufälligen Unterschlupf, den sie durch eine Nebentür betrat. Sie huschte durch den Flur zu ihrem Zimmer, berührte erst die Tür mit dem blanken Zeigefinger, dann die Dielenbretter. Sie spürte nichts Ungewöhnliches; niemand hatte hier herumgeschnüffelt.
Sie schloss alle sechs Türschlösser auf, trat ein und sperrte wieder ab. Dann hockte sie sich hin und lauschte, den Zeigefinger auf die Dielen gedrückt.
Sie wartete zehn Minuten. Als niemand kam, zündete sie eine Kerze an – sie war es leid, ihr Talent nutzen zu müssen, um etwas sehen zu können –, durchquerte den Raum und öffnete die Läden ihres Fensters, nur einen Spaltbreit. Dann stand sie da und beobachtete die Straße.
Zwei Stunden lang sah Sancia durch den winzigen Spalt auf die Straße hinab. Für ihren Verfolgungswahn gab es einen guten Grund, das war ihr klar. Sie hatte nicht nur einen Zwanzigtausend-Duvoten-Auftrag durchgezogen, sondern auch den verdammten Hafen von Tevanne niedergefackelt. Sie wusste nicht genau, was schlimmer war.
Falls jemand zu Sancias Fenster hinaufgeschaut und sie erblickt hätte, wäre er von ihrem Anblick beeindruckt gewesen. Sie war eine junge Frau, kaum älter als zwanzig, doch hatte sie bereits mehr erlebt als die meisten anderen, und das sah man ihr am Gesicht an. Ihre dunkle Haut war wettergegerbt und rau, und sie hatte die hageren Züge eines Menschen, der regelmäßig Hungerphasen durchlitt. Sie hatte sich das Haar geschoren, und über ihre rechte Schläfe verlief eine gezackte Narbe, dicht am Auge vorbei, dessen Augapfel ein wenig dunkler war als der linke.
Die Leute mochten es nicht, wenn Sancia sie zu eindringlich ansah. Das machte sie nervös.
Als sie zwei Stunden Ausschau gehalten hatte, war sie zufrieden. Sie verriegelte die Läden, trat zum Schrank und nahm den falschen Boden heraus. In einem Gemeinviertel gab es keine Banken oder Schatzkammern, daher hamsterte sie ihre Ersparnisse hier.
Sie nahm das Kiefernholzkästchen aus der Diebeskluft, hielt es in Händen und besah es sich.
Nun, da sie Zeit hatte, sich ein wenig zu erholen – der brüllende Schmerz in ihrem Kopf war zu einem matten Stechen geworden –, erkannte sie auf Anhieb, was an dem Kästchen seltsam war. Es erblühte deutlich in ihrem Geist, die Form und das Fassungsvermögen verfestigten sich in ihren Gedanken wie Wachs in einem Bienenstock.
Das Kästchen hatte einen doppelten Boden, ein Geheimfach. Und darin, das sagte ihr Sancias Talent, lag etwas Kleines, in ein Leinentuch eingeschlagen.
Sie hielt inne und dachte nach.
Zwanzigtausend Duvoten? Für dieses Ding?
Sie sollte sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Sie hatte das Kästchen nur beschaffen sollen, weiter nichts. In dieser Hinsicht hatte sich Sark sehr deutlich ausgedrückt. Und Sancias Kunden schätzten an ihr, dass sie ihre Anweisungen befolgte, nicht mehr, nicht weniger. In drei Tagen würde sie die Beute Sark überreichen, und dann bräuchte sie nie wieder darüber nachzudenken.
Sie stellte das Kästchen in den doppelten Boden, schloss ihn und dann auch den Schrank.
Anschließend vergewisserte sie sich, dass die Zimmertür und die Fensterläden gesichert waren, setzte sich aufs Bett, legte ihr Stilett daneben auf den Boden und atmete tief durch.
Zu Hause, dachte sie. Und in Sicherheit.
Gleichwohl sah ihr Zimmer nicht allzu sehr nach einem Zuhause aus. Falls jemand einen Blick hineingeworfen hätte, wäre er zu der Überzeugung gelangt, dass Sancia wie ein asketischer Mönch lebte: Sie hatte nur einen schlichten Stuhl, einen Eimer, einen schmucklosen Tisch und eben dieses Bett, ohne Laken und Kissen.
Zu diesem Leben war sie gezwungen. Sie schlief lieber in ihrer Kleidung statt in Bettzeug, denn es war nicht nur schwierig, in noch mehr Stoff zu schlafen, nein, Bettlaken zogen auch Läuse, Flöhe und anderes Ungeziefer an, und das Gefühl vieler winziger Beinchen auf ihrer Haut trieb sie in den Wahnsinn. Zudem ertrug sie es nicht, wenn ihre übrigen Sinne überreizt wurden. Dann brannte ihre Narbe. Zu viel Licht oder zu viele Farben fühlten sich an wie Nägel in ihrem Kopf.
Mit Essen war es sogar noch schlimmer. Fleisch kam für sie überhaupt nicht infrage. Blut und Fett bescherten ihr übermächtige Sinneseindrücke von Fäulnis, Verwesung und Zerfall. Die vielen Muskelfasern und Sehnen erinnerten sie daran, dass sie zu einem Lebewesen gehört hatten, dass sie mit etwas verbunden gewesen waren, das ganz gewesen war, voller Leben. Der Geschmack von Fleisch machte ihr zutiefst bewusst, dass sie auf dem Brocken eines Kadavers kaute. Dann musste sie immer würgen.
Sancia lebte fast ausschließlich von Reis mit Bohnen und verdünntem Rohrwein. Starke Alkoholika rührte sie nicht an – sie brauchte die volle Kontrolle über ihre Sinne, um klarzukommen. Und dem Wasser im Armenbezirk konnte man nicht trauen.
Sie saß auf dem Bett und wiegte aufgeregt den Oberkörper vor und zurück. Sie fühlte sich unbedeutend und allein, wie so oft nach einem Auftrag. Und sie vermisste sehr, was sie am meisten getröstet hätte: menschliche Gesellschaft.
Sie hatte noch nie jemand anderen in ihr Zimmer gelassen und erst recht nicht in ihr Bett, denn es war unerträglich, andere Menschen zu berühren. Zwar war es nicht so, als würde sie deren Gedanken hören, denn entgegen allgemeiner Annahmen glichen die Gedanken eines Menschen keiner nahtlosen, linearen Erzählung, sondern ähnelten vielmehr einer riesigen heißen Wolke bellender Impulse und Neurosen. Doch wenn sie die Haut eines anderen berührte, erfüllte diese heiße Wolke ihren Kopf.
Körperkontakt, die Berührung warmer Haut bescherten ihr die vermutlich unerträglichsten Sinneseindrücke von allen.
Vielleicht war es ja auch besser, allein zu sein. Das war weniger riskant.
Sie atmete mehrmals tief durch, versuchte, ihren Geist zu beruhigen.
Du bist in Sicherheit. Und allein. Frei. Für einen weiteren Tag.
Sie zog die Kapuze über, schnürte sie fest zu, legte sich hin und schloss die Augen.
Doch sie fand keinen Schlaf.
Nachdem sie eine Stunde dagelegen hatte, setzte sie sich auf, streifte die Kapuze ab, zündete eine Kerze an und musterte nachdenklich die geschlossene Schranktür.
Das … beunruhigt mich, dachte sie. Sogar sehr.
Das Problem war, dass sie eine Reihe von Risiken eingehen würde, wenn sie das Kästchen öffnete.
Sancia ließ stets Vorsicht walten – zumindest soweit es jemandem möglich war, der seinen Lebensunterhalt damit bestritt, auf Türme zu klettern und in Gebäude voller bewaffneter Leute einzubrechen. Sie versuchte immer, potenzielle Gefahren zu minimieren.
Doch je mehr sie darüber nachsann, einen kleinen Gegenstand zu besitzen, der zwar unglaubliche zwanzigtausend Duvoten wert, ihr aber völlig unbekannt war … Tja, das machte sie irgendwie verrückt. Erst recht, weil sie ihn noch drei verrogelte Tage lang behalten musste.
Denn von allen Wertsachen in Tevanne waren Skriben-Entwürfe zweifellos am meisten wert. Die Sigillen-Kombinationen, die skribierter Ausrüstung ihre Fähigkeit verliehen. Eine Skribe zu entwerfen erforderte viel Mühe und Talent, daher schützten die Handelshäuser ihre Entwürfe ganz besonders. Mit der richtigen Skribe konnte man augenblicklich alle Arten augmentierter Geräte in der Gießerei fertigen – Geräte, die mühelos ein Vermögen wert waren. Doch obwohl man Sancia schon oft gebeten hatte, Skriben-Entwürfe aus Handelshäusern zu stehlen, hatten Sark und sie das stets abgelehnt. Denn wer ein Handelshaus bestahl, schaukelte am Ende oft bleich und kalt auf den Wellen im Kanal.
Sark hatte ihr zwar versichert, dass es bei diesem Auftrag nicht um Skriben-Entwürfe ging … aber die Verlockung von zwanzigtausend Duvoten machte jeden dümmer, als womöglich gut für ihn war.
Sancia seufzte und versuchte, ihre Furcht zu bezwingen. Sie trat an den Schrank, öffnete ihn, nahm die Abdeckung zum Geheimfach heraus und griff nach dem Kästchen.
Lange Zeit sah sie es an. Es bestand aus unverziertem Kiefernholz und hatte einen Messingverschluss. Sancia streifte die Handschuhe ab und berührte das Kästchen mit blanken Fingern.
Erneut sah sie die Form und Maße der kleinen Kiste in ihrem Geist – ein Hohlraum voller Papiere. Wieder spürte sie den doppelten Boden, in dem das in Leinentuch eingewickelte Objekt lag. Sonst nichts – und niemand würde merken, dass sie das Kästchen geöffnet hatte.
Sie atmete durch und klappte es auf.
Sie rechnete damit, dass die Papiere mit Sigillen beschrieben waren, was einem Todesurteil gleichgekommen wäre, doch dem war nicht so. Vielmehr handelte es sich um filigrane Skizzen von alten, behauenen Steinen, in die etwas eingraviert war.
Jemand hatte etwas unter der Skizze notiert. Sancia war nicht allzu schriftkundig, doch sie versuchte ihr Bestes:
ARTEFAKTE DES ABENDLÄNDISCHEN REICHS
Es zählt zum Allgemeinwissen, dass die Hierophanten des alten Reichs eine Reihe erstaunlicher Instrumente für ihre Arbeiten nutzten, doch ihre Methoden sind uns nach wie vor unklar. Während unsere moderne Skribierung Objekten eine andere Realität vorgaukelt, waren die Hierophanten offenbar imstande, durch Skriben die Realität selbst zu beugen; sie befahlen der Welt, sich augenblicklich und dauerhaft zu verändern. Es gibt viele Theorien darüber, wie das möglich war, jedoch keine gesicherten und schlüssigen Erklärungen.
Weitere Fragen kommen auf, wenn wir die Geschichten von Crasedes dem Großen studieren, dem ersten abendländischen Hierophanten. Einige Sagen und Legenden erzählen davon, dass Crasedes eine Art unsichtbaren Helfer hatte: Manchmal ist es ein Kobold, manchmal ein Geist oder eine andere Wesenheit, oftmals in einem Glas oder Kästchen gefangen, das er öffnete, wenn das Geschöpf ihm zur Hand gehen sollte.
Entstammt diese Wesenheit einer weiteren Veränderung der Realität, die die Hierophanten vorgenommen hatten? Gab es diese Wesenheit überhaupt? Wir wissen es nicht, doch eine andere Geschichte über Crasedes den Großen behauptet, dass er selbst angeblich sogar einen künstlichen Gott schuf, um die Welt zu beherrschen.
Falls Crasedes über eine Art unsichtbares Wesen gebot, war es womöglich nur ein Prototyp seiner letzten und größten Schöpfung.
Sancia legte das Blatt beiseite. Sie verstand nichts von alldem. Seit sie in Tevanne lebte, hatte sie gelegentlich von den Abendländern gehört, in Märchen über alte Riesen und sogar Engel. Aber nie hatte jemand behauptet, es hätte die Hierophanten tatsächlich gegeben. Wer immer jedoch diese Notizen verfasst hatte – vielleicht der eigentliche Besitzer des Kästchens –, schien genau dies zu glauben.
Doch Sancia wusste, dass diese Unterlagen nicht der eigentliche Schatz waren. Sie kippte sie aus und schob sie von sich.
Dann griff sie ins Kästchen, berührte den Boden mit zwei Fingern und drückte ihn beiseite. Darunter befand sich der kleine Gegenstand, in Leinentuch gewickelt, ungefähr so lang wie eine Hand.
Sancia griff danach … und hielt inne.
Sie durfte keinesfalls ihre Entlohnung gefährden. Sie musste das Geld für einen Physikus zusammenbekommen, damit der ihre Kopfnarbe entfernte und somit auch das, was mit ihr nicht stimmte. Damit er sie … normal machte. Jedenfalls annähernd.
Sie rieb sich die Narbe in dem Wissen, dass sich unter der Kopfhaut eine ziemlich große Metallplatte befand, die man ihr in den Schädel geschraubt hatte, und darauf standen komplexe Sigillen. Über die eingravierten Skriben-Befehle wusste sie nichts, doch sie waren bestimmt der Grund für ihre Talente.
Ihr war klar, dass es die Handelshäuser nicht scherte, dass man ihr die Platte gegen ihren Willen implantiert hatte. Ein skribierter Mensch war irgendetwas zwischen einer Abscheulichkeit und einem seltenen, unschätzbar wertvollen Exemplar, daher würde ihre Operation sehr kostspielig werden. Denn Sancia musste dem Schwarzmarktphysikus mehr bezahlen, als die Handelshäuser ihm für ihre Auslieferung bieten würden – und die Handelshäuser konnten sehr hohe Summen aufwenden.
Sie schaute das in Leinentuch eingewickelte Objekt in ihrer Hand an. Was war das bloß? Trotz Sarks Warnungen war es ihr zu riskant, im Ungewissen zu bleiben.
Sie setzte das Kästchen ab und packte den Gegenstand aus. Etwas Goldenes blitzte auf …
Nur ein Goldstück? Goldschmuck?
Als sie das Tuch entfaltete, sah sie, dass es sich nicht um Schmuck handelte.
Sie betrachtete das Objekt in ihrer Hand.
Es war ein Schlüssel. Ein langer goldener Schlüssel mit einem komplexen, seltsamen Bart. Sein abgerundeter Kopf wies ein merkwürdiges Loch auf, das ähnlich geformt war wie ein Schmetterling.
»Was zur Hölle …?«
Sie besah sich den Schlüssel genauer. Ein seltsames Stück, doch warum sollte es so viel wert sein?
Dann entdeckte Sancia die Ätzungen, die vom Rand des Schlüssels aus rings um den Bart verliefen. Der Schlüssel war skribiert, doch die Befehle waren so klein, fein und kompliziert … Solche Skriben hatte Sancia noch nie gesehen.
Was noch seltsamer war: Falls dieser Schlüssel skribiert war, wieso konnte sie ihn dann nicht hören? Warum murmelte er nicht in ihrem Geist, wie jedes andere skribierte Ding, das sie je gesehen hatte?
Das ergibt keinen Sinn.
Mit dem blanken Zeigefinger berührte sie den Goldschlüssel.
Im selben Moment erklang eine Stimme in ihrem Kopf. Nicht die übliche Lawine an Sinneseindrücken, sondern eine echte Stimme, so klar, als stünde jemand neben ihr und sagte in gelangweiltem Ton:»Na toll. Erst das Kästchen, und jetzt das! Ach, schau sie dir an – ich wette, sie hat noch nie etwas von Seife gehört …«