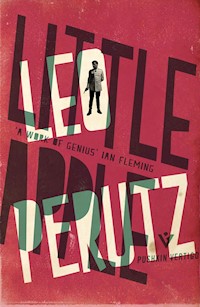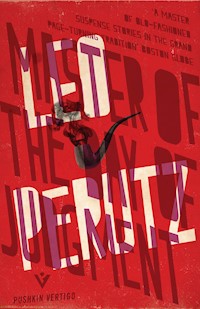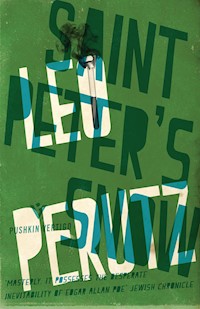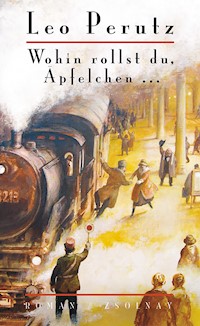Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wundersam bunt und düster zugleich schildert Perutz die Welt in "Der schwedische Reiter", der den Leser im Nu in die Zeit um 1700 versetzt. Der Roman erzählt vom verflochtenen Schicksal zweier ungleicher Männer: Krieg und Barbarei beherrschen die Szenerie, in der ein namenloser Vagabund und der desertierte schwedische Offizier Christian von Tornefeld aufeinander treffen. Der eine nimmt mit List und Tücke, aber ebenso aus Liebe zu einer jungen Frau die Identität des anderen an ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Wundersam bunt und düster zugleich schildert Perutz die Welt in »Der schwedische Reiter«, der den Leser im Nu in die Zeit um 1700 versetzt. Der Roman erzählt vom verflochtenen Schicksal zweier ungleicher Männer: Krieg und Barbarei beherrschen die Szenerie, in der ein namenloser Vagabund und der desertierte schwedische Offizier Christian von Tornefeld aufeinander treffen. Der eine nimmt mit List und Tücke, aber ebenso aus Liebe zu einer jungen Frau die Identität des anderen an ...
Leo Perutz
Der schwedische Reiter
Roman
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans-Harald Müller
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Vorbericht
ERSTER TEIL: Der Dieb
ZWEITER TEIL: Der Gottesräuber
DRITTER TEIL: Der schwedische Reiter
LETZTER TEIL: Der Namenlose
NACHWORT
Vorbericht
Maria Christine, geborene von Tornefeld, verwitwete von Rantzau, in zweiter Ehe vermählt mit dem königlich dänischen Staatsrat und außerordentlichen Gesandten Reinhold Michael von Blohme, eine in ihren jungen Jahren vielumworbene Schönheit, hat um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, als Fünfzigjährige, ihre Erinnerungen niedergeschrieben. Dieses kleine Werk, dem sie den Titel Farben- und figurenreiches Gemälde meines Lebens gegeben hat, erschien erst einige Jahrzehnte nach ihrem Tode im Druck. Einer ihrer Enkel machte es zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts einer beschränkten Öffentlichkeit zugänglich.
Seinen anspruchsvollen Titel führt das Buch nicht ganz ohne Berechtigung. Die Verfasserin hat in bewegter Zeit ein ziemliches Stück Welt gesehen, sie hat ihren Gatten, den dänischen Staatsrat, auf allen seinen Reisen begleitet und ist sogar nach Ispahan, an den Hof des berüchtigten Nadyr Schach gekommen. Man findet in ihren Erinnerungen manches, was auch dem Leser von heute Interesse abzugewinnen vermag. So in einem der ersten Kapitel einen eindrucksvollen Bericht über die Vertreibung der protestantischen Bauern aus dem Erzbistum Salzburg. In einem späteren Kapitel schildert die Verfasserin den Aufruhr der Buchabschreiber in Konstantinopel, die durch die Gründung einer Buchdruckerei um ihr Brot gebracht worden waren. Sie weiß von dem Treiben der Gesundbeter in Reval und von der gewaltsamen Unterdrückung dieser Schwarmgeistersekte sehr anschaulich zu erzählen. Sie hat — um ihre eigenen Worte zu gebrauchen — in Herculanum die ersten »unter der Erde gemachten Entdeckungen, in Marmor gearbeitete Statuen und Basreliefs«, gesehen, ohne sich freilich der Bedeutung dieser Funde bewußt zu werden, und sie ist in Paris in einer Karosse gefahren, die »ohne Pferde, nur durch ihre eigene innerliche Bewegung« elfeinhalb französische Meilen in nicht ganz zwei Stunden zurückgelegt hat.
Auch mit einigen der größten Geister ihres Jahrhunderts ist sie in Verbindung getreten. Auf einem Maskenfest in Paris lernte sie den jungen Crébillon kennen — es scheint, daß sie kurze Zeit hindurch seine Geliebte gewesen ist. Mit Voltaire führte sie ein langes Gespräch auf einem Freimaurerfest, das in Lunéville stattfand, und sie traf ihn einige Jahre später in Paris wieder, und zwar an dem Tag, an dem man ihn in die Akademie aufgenommen hatte. Auch einige Gelehrte zählte sie zu ihren Freunden, so den Herrn von Réaumur und den Professor für Experimentalphysik, Herrn von Muschenbroeck, der die Leydener Flasche erfunden hat. Und nicht ohne Reiz ist die Geschichte ihrer Begegnung mit dem »berühmten Kapellmeister, Herrn Bach aus Leipzig«, den sie im Mai des Jahres 1741 in der Potsdamer Heiligen-Geist-Kirche die Orgel spielen gehört hat.
Den stärksten Eindruck aber empfängt der Leser aus jenem Teil des Buches, in dem Maria Christine von Blohme in schwärmerischen, doch beinahe dichterisch zarten Worten ihres ihr früh entrissenen Vaters — den sie den »schwedischen Reiter« nennt — gedenkt. Sein Verschwinden aus ihrem Leben und die sonderbaren und widerspruchsvollen Umstände, unter denen dieses tragische Ereignis sich vollzog, haben einen Schatten auf ihre Jugendjahre geworfen.
Maria Christine von Blohme ist — so berichtet sie — in Schlesien auf dem Gutshof ihrer Eltern zur Welt gekommen, und der Adel der ganzen Umgebung hatte sich zu ihrer Begrüßung eingefunden. Von ihrem Vater, dem »schwedischen Reiter«, hatte sie nur ein verschwommenes Bild in ihrer Erinnerung bewahrt. »Er hatte furchterregende Augen«, sagt sie, »aber wenn er mich ansah, da war’s mir, als stünde über mir der Himmel offen.«
Als sie sechs Jahre oder etwas darüber alt war, verließ ihr Vater seinen Hof, um sich nach Rußland »unter die düsteren Fahnen Karls des Zwölften«, des Schwedenkönigs, zu begeben, dessen Ruhm zu jener Zeit die Welt erfüllte. »Mein Vater war schwedischer Herkunft«, schreibt sie, »und die Bitten und Klagen meiner Mutter konnten ihn nicht zurückhalten.«
Doch bevor er fortritt, nähte das Kind heimlich ein Säckchen mit Salz und Erde in das Futter seines Rocks. Sie tat das auf den Rat eines seiner beiden Reitknechte, der es ihr als ein erprobtes und unfehlbares Mittel, zwei Menschen für immer aneinander zu binden, empfohlen hatte. — Von diesen beiden Reitknechten des Herrn von Tornefeld ist an einer späteren Stelle des Buches nochmals die Rede: Maria Christine von Blohme erzählt, daß sie von ihnen fluchen und die Maultrommel blasen gelernt habe, doch sei ihr die letzterwähnte Kunst im Leben von keinem Nutzen gewesen.
Einige Wochen nachdem ihr Vater sich zum schwedischen Heer begeben hatte, wurde die kleine Maria Christine nachts durch ein Klopfen an die Fensterladen aus dem Schlaf geweckt. Sie meinte anfangs, es sei »der Herodes, eine Art Märchen- oder Gespensterkönig«, vor dem sie sich oftmals des Nachts gefürchtet hatte. Aber es war ihr Vater, der »schwedische Reiter«. Sie war nicht erstaunt, sie hatte es gewußt, daß er kommen mußte, Salz und Erde in seinem Rock zwangen ihn zu ihr.
Geflüsterte Fragen, leise, zärtliche Worte flogen zwischen ihnen hin und her. Dann schwiegen beide. Er hielt ihr Gesicht zwischen den Händen. Sie weinte ein wenig, aus Wiedersehensfreude, und dann auch, weil er sagte, daß er wiederum fort müßte.
Er blieb eine kleine Viertelstunde lang, und dann verschwand er.
Er kam wieder, aber immer nur des Nachts. Manchmal erwachte sie, noch bevor er an die Fensterladen klopfte. Manchmal geschah es, daß er zwei Nächte hintereinander kam, dann wieder vergingen drei, vier oder fünf Nächte, ohne daß er sich zeigte. Niemals blieb er länger als eine Viertelstunde.
So ging es Monate hindurch. Warum die kleine Maria Christine von den nächtlichen Besuchen des »schwedischen Reiters« zu keinem Menschen, auch nicht zu ihrer Mutter, sprach, war ihr später nicht mehr ganz erklärlich. Sie hält es für möglich, daß ihr der »schwedische Reiter« Schweigen auferlegte. Auch mochte sie gefürchtet haben, daß man ihr nicht glauben, ja, daß man sie vielleicht gar verlachen und ihr nächtliches Erlebnis in das Reich der Träume oder der Phantasie verweisen werde.
In derselben Zeit, in der der »schwedische Reiter« nachts vor dem Fenster der Maria Christine erschien, brachten schwedische Kuriere, die aus Rußland von der Armee kamen und auf dem Gutshof die Pferde wechselten, Nachrichten über seinen Aufstieg im schwedischen Heer.
Er hatte durch seine Bravour die Aufmerksamkeit des Königs auf sich gelenkt und war zum Rittmeister bei den Westgöta-Reitern und später zum Kommandanten des Småland-Dragonerregimentes ernannt worden. Als solcher hatte er im Gefecht von Golskwa durch sein tollkühnes Eingreifen den schwedischen Waffen den Sieg gesichert. Der König hatte ihn nach dieser Affäre angesichts der Armee umarmt und auf beide Wangen geküßt.
Maria Christines Mutter war betrübt darüber, daß »ihr Herzliebster und Vertrauter sie’s nicht par écrit wissen ließ«, wie es ihm im schwedischen Heer erging. »Aber«, sagte sie, »es ist ihm wohl im Feld nicht möglich, auch nur eine Zeile fortzubringen.«
Dann kam ein Sommertag, ein Tag im Juli, der sich der kleinen Maria Christine für immer ins Gedächtnis geprägt hat.
»Es war um die Mittagsstunde«, schreibt sie vierzig Jahre später, »wir standen, meine Mutter und ich, im Garten zwischen den Himbeerbüschen und den Heckenrosen, dort, wo der kleine Heidengott im Grase lag. Meine Mutter trug ein lavendelblaues Kleid und schalt die Katze aus, die ein Vogelnest geplündert hatte. Die Katze aber wollt’ mit ihr spielen und machte einen Buckel, daß meine Mutter lachen mußte. Da hieß es plötzlich, ein schwedischer Kurier sei auf dem Hof.
Meine Mutter lief fort, um Nachrichten zu hören, und kam nicht in den Garten zurück. Aber eine Stunde später sprachen alle Leute auf dem Hof davon, daß bei Poltawa eine große Schlacht geschlagen worden wär’, der Schwede sei besiegt, der König auf der Flucht. Und dann sagten sie, ich hätt’ nun keinen Vater mehr. Herr Christian von Tornefeld, mein Vater, sei gleich zu Beginn der Schlacht gefallen, eine Kugel hätt’ ihn vom Pferd gerissen und es sei nun schon drei Wochen her, daß man ihn begraben hätt’.
Ich wollt’s nicht glauben. Denn es waren ja noch keine zwei Tage vergangen, seit er an mein Fenster geklopft und mit mir gesprochen hatte.
Spät am Nachmittag ließ mich meine Mutter zu sich kommen.
Ich fand sie in der ›langen Stube‹. Sie trug das lavendelblaue Kleid nicht mehr, und ich habe sie von dieser Stunde an niemals anders als in einem Trauerkleid gesehen.
Sie nahm mich auf den Arm und küßte mich. Anfangs konnte sie nicht sprechen.
›Kind!‹ sagte sie dann mit Weinen in ihrer Stimme. ›Dein Vater ist im schwedischen Krieg gefallen. Er kommt nicht wieder. Falt’ die Hände und bet’ ein Vaterunser für seine abgeschiedene Seele.‹
Ich schüttelte den Kopf. Wie konnte ich für die Seele meines Vaters beten, da ich doch wußte, daß er am Leben war.
›Er kommt wieder‹, sagte ich.
Die Augen meiner Mutter füllten sich wiederum mit Tränen.
›Er kommt nicht wieder‹, schluchzte sie. ›Er ist im Himmelreich. Falt die Hände, tu deine kindliche Schuldigkeit, bet ein Vaterunser für deines Vaters Seele.‹
Da ich sie nicht durch Ungehorsam noch mehr betrüben wollte, betete ich, aber nicht für meines Vaters Seele, denn der lebte ja. Ich sah draußen auf der Landstraße einen Leichenzug, der den Hügel herabkam. Es war nur ein Karren, auf dem lag der Sarg, der Kutscher schlug auf das Pferd ein, und nur ein einziger alter Mann, ein Priester, gab dem Toten das Geleite.
Es mochte wohl ein alter Landstreicher sein, der so zu Grabe geführt wurde. Und für dieses armen Mannes Seele sprach ich das Vaterunser und bat Gott, daß er ihm sollt’ die Seligkeit geben.
Mein Vater aber, der schwedische Reiter‹«, schließt Maria Christine von Blohme ihren Bericht, »ist nicht wiedergekommen. Niemals mehr weckte mich sein leises Klopfen aus dem Schlaf. Und wie das möglich war, daß er im schwedischen Heer kämpfte und fiel und in dieser gleichen Zeit so oft des Nachts in unserem Garten stand und mit mir sprach, und wenn er nicht gefallen ist, warum er dann nie wieder kam und an mein Fenster klopfte — das ist für mich mein Leben lang ein dunkles, trauriges und unergründliches Geheimnis geblieben.«
Die Geschichte des »schwedischen Reiters« soll nun erzählt werden.
Es ist die Geschichte zweier Männer. Sie trafen einander an einem bitterkalten Wintertag zu Beginn des Jahres 1701 in eines Bauern Scheune und schlossen Freundschaft miteinander. Und dann gingen sie zu zweit die Landstraße weiter, die von Oppeln durch das verschneite schlesische Land hinüber nach Polen führte.
ERSTER TEIL
Der Dieb
Den Tag über hatten sie sich versteckt gehalten, jetzt in der Nacht wanderten sie durch den schütteren Kiefernwald. Sie hatten beide Ursache, den Menschen aus dem Weg zu gehen, mußten trachten, ungesehen zu bleiben. Der eine war ein Landstreicher und Marktdieb, der dem Galgen entlaufen war, der andere ein Deserteur.
Der Dieb, den man im Land den Hahnenschnapper nannte, ertrug die Strapazen der nächtlichen Wanderung leicht, denn er hatte sein Leben lang alle Winter gehungert und gefroren. Dem anderen aber, dem Christian von Tornefeld, war jämmerlich zumute. Er war jung, fast noch ein Knabe. Den Tag zuvor, da sie auf dem Dachboden eines Bauernhauses unter einem Haufen Binsenmatten versteckt gelegen waren, da hatte er mit seiner Courage großgetan und von seinem künftigen Glück und herrlichen Leben phantasiert. Er habe einen Vetter, von seiner Mutter Seite her, der hier in dieser Gegend auf seinem Gute säße. Der werde ihn wohl aufnehmen und ihn mit Geld, Waffen, Kleidern und einem Pferd versehen, daß er hinüber nach Polen könnt’. Und wenn er erst jenseits der Grenze wäre, dann sei alles gewonnen. Er habe es satt, in fremden Heeren zu dienen. Sein Vater habe Schweden verlassen, weil die Herren Staatsräte ihm sein Krongut genommen und ihn zu einem armen Mann gemacht hätten. Er aber, Christian von Tornefeld, sei in seinem Herzen immer schwedisch geblieben. Wo sei sein Platz, wenn nicht im schwedischen Heer! Vor dem jungen König, der von Gott auf die Erde gesandt sei, um die Untreue der Großen zu bestrafen, hoffe er mit Ehren zu bestehen. Mit siebzehn Jahren habe der schwedische Karl den weltkündigen Sieg von Narwa erfochten. Ja, es sei eine brave Sache um den Krieg, wenn einer nur die rechte Courage habe und sie zu brauchen wisse.
Der Dieb hatte zu alledem geschwiegen. Als er noch Bauernknecht in Pommern gewesen war, da hatte er acht Taler im Jahr als Lohn erhalten und sechs davon dem schwedischen König für Steuern zahlen müssen. Die Könige, die waren vom Teufel auf die Erde gesetzt, um den gemeinen Mann zu würgen und zu treten. Und er hatte erst aufgehorcht, als Christian von Tornefeld von seinem großmächtigen Arcanum zu erzählen begann, das ihm vor Seiner Majestät höchster und teurer Person zu einem Valor verhelfen werde. Der Dieb wußte, was solch ein Arcanum zu bedeuten hatte. Ein geweihtes Stück Pergament mit lateinischen und hebräischen Worten darauf, das half aus aller Not. Auch er hatte einmal eines besessen und es bei sich getragen, wenn er auf die Märkte ging, um sein Leben zu fristen. Um einen schlechten Doppelschilling hatte er es sich abschwatzen lassen, das Geld war vertan und sein Glück ging den Krebsgang.
Jetzt, da sie durch den verschneiten Kiefernwald wanderten und der Sturmwind ihnen mit Eiskörnern das Gesicht peitschte, jetzt sprach Christian von Tornefeld kein Wort mehr von seiner Courage, vom Krieg und vom schwedischen König. Keuchend ging er, mit gesenktem Kopf, und wenn er über eine Baumwurzel stolperte, stieß er ein leises Jammern aus. Er hatte Hunger, in den letzten Tagen waren gefrorene Rübschalen seine Nahrung gewesen, und Buchnüsse und Wurzeln, die sie aus der Erde gegraben hatten. Aber schlimmer noch als der Hunger war der Frost. Christian von Tornefelds Wangen sahen einer ausgeblasenen Sackpfeife gleich, seine Finger waren blau und steif gefroren, seine Ohren schmerzten ihn unter dem Tuch, das er um seinen Kopf gewunden hatte. Und während er durch den Schneesturm taumelte, träumte er — nicht von seinen künftigen Kriegstaten, sondern von dicken Handschuhen und von Stiefeln, die mit Hasenfell gefüttert waren, und von einem Nachtlager aus hochgeschichtetem Stroh und Pferdedecken ganz dicht beim Ofen.
Als sie den Wald hinter sich hatten, war es Tag geworden. Eine dünne Schicht Schnee lag auf Feldern, Wiesen und Ödland. Heidehühner strichen im fahlen Licht des Morgens darüber hin. Vereinzelt hier und dort eine Birke, in deren zerzausten Zweigen der Sturmwind sich verfing. Und im Osten dehnte sich eine weiße Wand, das war der Nebel, ein Brauen und Wogen, ein Auf und Nieder, und was dahinter lag: Dörfer, Gehöfte, Heide, Ackerland und Wald — das alles blieb dem Blick verborgen.
Der Dieb suchte nach einer Zufluchtsstätte, in der sie den Tag hätten verbringen mögen, aber da war kein Haus, keine Scheune, kein Graben, kein geschütztes Plätzchen zwischen Bäumen und Buschwerk. Aber etwas anderes gewahrte er, und er bückte sich zu Boden, um besser sehen zu können.
Der Schnee war zerwühlt, da waren Reiter abgesessen und hatten gerastet. An den Spuren, die die Musketenkolben und die Schanzgeräte im Schnee zurückgelassen hatten, erkannte das geübte Auge des Landstreichers, daß es Dragoner gewesen waren, die sich hier an einem Feuer gewärmt hatten. Vier von ihnen waren nach Norden geritten und drei nach Osten.
Eine Streife also. Wem galt sie? Noch immer kniend warf der Dieb einen Blick auf seinen Gefährten, der zusammengekrümmt, vor Kälte zitternd auf einem Meilensteine am Wegrand saß. Und wie er ihn so kläglich sitzen sah, da wurde es ihm klar, daß er diesem Knaben nichts von den Dragonern erzählen durfte, denn er hätte sonst völlig den Mut verloren.
Christian von Tornefeld fühlte den Blick, der auf ihm ruhte. Er schlug die Augen auf und rieb sich die frierenden Hände.
»Was hast du gefunden im Schnee?« fragte er mit weinerlicher Stimme. »Wenn du Rüben gefunden hast oder einen Kohlstrunk, so sollst du mit mir teilen, das war die Abred’. Haben wir nicht geschworen, daß wir einander beistehen wollen, und was der eine hat, soll auch der andere haben? Wenn ich erst bei meinem Vetter bin …«
»Daß Gott erbarm’, ich habe nichts gefunden«, beteuerte der Dieb. »Wie soll ich Rüben finden, hier auf dem Feld ist Winterkorn gesät. Ich wollt’ nur sehen, wie die Erde ist.«
Sie sprachen schwedisch miteinander, denn der Dieb war in Pommern geboren und bei einem schwedischen Gutsherrn als Knecht im Dienst gestanden. Jetzt holte er unter dem Schnee eine Handvoll Ackererde hervor und zerkrümelte sie zwischen den Fingern.
»Die Erde ist gut«, sagte er im Weitergehen, »es ist rote Erde, aus der hat Gott den Adam erschaffen. Sie müßt’ geben anderthalb Schock für einen Scheffel.«
Der Bauernknecht war in ihm erwacht. In seiner Jugend war er hinter dem Pflug geschritten, er wußte wohl, wie man mit der Erde umgehen mußte.
»Anderthalb Schock«, wiederholte er. »Aber die Herrschaft, der dieses Land gehört, die hat, mein’ ich, einen schlechten Rentmeister und nachlässige Knechte. Wie geht’s hier zu? Eine elende Wirtschaft: Viel zu spät ist mit der Wintersaat begonnen worden. Frost ist gekommen, die Egge hat warten müssen, darüber ist das Korn in der Erd’ erfroren.«
Es war niemand da, der ihm zuhörte. Tornefeld ging hinter ihm her, er hatte sich die Füße wundgelaufen und ächzte und stöhnte bei jedem Schritt.
»Gute Pflüger und Egger und Säer sind hierzulande nicht schwer zu bekommen«, fuhr der Dieb fort. »Ich mein’, die Herrschaft spart am Gesinde, mietet nur wohlfeile Leute, die nicht viel taugen. Das Beet für die Wintersaat muß immer in der Mitte hoch sein, daß sich die Nässe gegen die Furchen hin senkt. Darauf hat der Pflüger nicht geachtet, hat den Acker für viele Jahre verdorben, es wird Unkraut über Unkraut geben. Hier wiederum hat er den Boden zu tief genommen und schlechtes Land heraufgearbeitet — siehst du’s nicht?«
Tornefeld sah und hörte nichts. Er begriff nicht, warum er noch immer marschieren mußte, immer weiter ging es, immer weiter, und es war doch schon heller Tag, und Zeit, sich auszustrecken, und der Weg nahm kein Ende. »Auch von ihrem Schäfer läßt sich die Herrschaft betrügen«, räsonierte der Dieb. »Ich sah allerlei Dünger auf den Feldern: Asche, Mergel, Holzspäne und Gartenschlamm — nur Schafmist sah ich keinen. Schafmist ist gut, taugt für alle Äcker. Aber ich mein’, der Schäfer verkauft ihn für seine eigene Tasche.«
Und er begann darüber nachzudenken, wie die Herrschaft sein müßt’, die solch faule, nachlässige und betrügerische Knechte in ihrem Dienst hatte.
»Ein steinalter Mann«, sagte er. »Kann nicht mehr recht gehen, hat die Gicht in den Beinen, weiß nicht, wie’s auf seinen Feldern zugeht. Er sitzt den ganzen Tag mit der Tabakspfeife hinter dem warmen Ofen und schmiert sich die Beine mit Zwiebelsaft. Was ihm seine Knechte sagen, das glaubt er, und darum wird er betrogen, daß es eine Art hat.«
Doch von alledem hatte Tornefeld nur das eine verstanden, daß jetzt sein Kamerad endlich von einem warmen Ofen sprach. Er glaubte nicht anders, als daß er nun sogleich in eine geheizte Stube kommen werde, und Traumgedanken ergriffen Besitz von seinem Hirn.
»Heut ist Martini«, murmelte er. »Da wird in Deutschland den ganzen Tag gegessen und getrunken. Alle Herde rauchen, alle Pfannen schwitzen, und den Bauern ihre Backöfen sind voll von Pumpernickel. Wenn wir in die Stube treten, da kommt uns schon der Bauer entgegen, gibt uns von der Gans das beste Stück. Dazu einen Krug Magdeburger Bier, und nachher Rosoglio und Spanisch-Bitter, das nenn’ ich banquettiert! Trink aus Bruder! Zur Gesundheit! Sollst leben, Bruder! Gesegne es Gott!«
Er blieb stehen und schwenkte das Glas, das er in den Händen zu halten vermeinte, und machte Verbeugungen nach rechts und links. Und dabei glitt er aus und wäre vornüber hingefallen, doch der Dieb ergriff ihn an der Schulter und hielt ihn fest.
»Blick gradaus und träume nicht!« sagte er. »Martini ist längst vorüber. Und jetzt heißt es marschieren und nicht dahinstolpern wie ein altes Weiblein an seinem Stecken.«
Tornefeld fuhr auf und kam zu sich zurück — da war alles verschwunden, der Bauer und der rauchende Herd, die Gans auf der Schüssel und das Magdeburger Bier, und er stand auf weitem Feld und der eisige Wind blies ihm ins Gesicht. Da kam das Elend wieder über ihn, nirgends sah er Hilfe, nirgends ein Ende seines Jammers, und er ließ sich niedergleiten und streckte sich auf dem Boden aus.
»Bist du toll geworden?« rief der Dieb. »Willst du hier liegenbleiben? Wenn sie dich fangen, was wartet auf dich? Der Stock, der Galgen, das Halseisen oder der hölzerne Bock.«
»Um Gottes Barmherzigkeit willen, laß mich liegen, weiter kann ich nicht«, stöhnte Tornefeld.
»Steh auf«, drängte der Dieb. »Willst du durch Ruten laufen oder gehängt werden?«
Und plötzlich kam der Zorn über ihn, daß er sich mit diesem Knaben zusammengetan hatte, der nichts konnte als jammern und die Beine von sich strecken. Wäre er allein geblieben, so hätte er sich längst in Sicherheit gebracht gehabt. Nur dieser Knabe war schuld, wenn die Dragoner ihn ergriffen. Und wütend über seine eigene Torheit fuhr er ihn an.
»Was bist du von deinem Regiment echappiert, wenn du an den Galgen hinauf willst. Hätt’st dich sollen gleich henken lassen, das war besser gewesen für dich und auch für mich.«
»Wollt’ mein Leben retten, darum bin ich echappiert«, sagte Tornefeld mit leisem Wimmern. »Das Kriegsgericht hat mich zum Tod verurteilt.«
»Wer hat dich Narren geheißen, deinen Hauptmann ins Gesicht zu schlagen? Hättest dich sollen ducken und auf gut Wetter warten. Wärst ein Musketier geblieben und könntest stattlich leben. Jetzt liegst du da und läßt das Maul hängen.«
»Er hat Seiner Majestät erhabene Person geschmäht«, flüsterte Tornefeld mit einem starren Blick. »Er hat ihn einen losen jungen Buben genannt und einen stolzen Balthasar, der das Evangelium alleweil im Mund führt, um seine Büberei damit zu bedecken. War’ ich nicht ein Schelm gewesen, wenn ich ihn so hätt’ von meinem König sprechen lassen?«
»Mir sind sechs Schelme lieber als ein Narr. Was kümmert dich der König?«
»Ich hab’ mein devoir als Schwede, als Soldat und als Edelmann getan«, sagte Tornefeld.
Einen Augenblick lang hatte der Dieb daran gedacht, den Knaben liegen zu lassen und sich davonzumachen. Jetzt aber, da er diese Worte hörte, kam es ihm in den Sinn, daß er auch seine Ehre hatte, die Landstreicherehre, und daß dieser Knabe, so stolze Reden er auch führte, wie er so dalag, kein Edelmann mehr war, sondern wie er, der Dieb, zur großen Elendsbruderschaft gehörte, und daß er ihn nicht im Stich lassen durfte, wollt’ er nicht seine Ehr’ verlieren. Und er begann nochmals auf ihn einzureden:
»Steh auf, Bruder, ich bitt’ dich um alles, steh auf, die Dragoner sind hinter uns her, wollen dich fangen. Um Jesu willen, willst du uns beide an den Galgen bringen? Denk an den Profosen, denk an die Steckenknechte! Denk daran, daß sie im kaiserlichen Heer die Deserteure mit Schlägen neunmal um den Galgen treiben, eh’ sie sie henken.«
Tornefeld erhob sich und starrte verstört um sich. Da hatte der Wind im Osten den Nebelschleier zerrissen, und man sah weit hinein ins Land. Und der Dieb erkannte, daß er auf dem rechten Weg und nah seinem Ziel war.
Er sah vor sich die verlassene Mühle und dahinter Rohr und Moor und Heideland und Hügel und schwarze Wälder. Er kannte sie wohl, die Wälder und die Hügel, das war das Stiftsgut mit seinem Eisenhammer und Pochwerk, mit seinen Steinbrüchen und Schmelzöfen und Kalköfen. Hier regierten das Feuer und der herrische Bischof, der im ganzen Land »des Teufels Ambassadeur« genannt war. Und der Dieb vermeinte, weit unten am Horizont die Flammenzungen der Kalköfen zu sehen, denen er dereinst entflohen war. Feuer über Feuer, Feuer, wohin man blickte, violett und dunkelrot und schwarz vor Rauch. Dort stöhnten an den Karren geschmiedet die Lebendig-Toten, Landdiebe und Vaganten, die seine Brüder gewesen waren — vor dem Galgen hatten sie sich in die Hölle geflüchtet. Sie brachen, wie auch er es einst getan hatte, mit bloßen Händen Steine in des Bischofs Steinbrüchen, einen Stein nach dem anderen, ein Leben lang, sie zogen den glühenden Schutt aus dem Schürofen, sie standen Tag und Nacht vor dem feurigen Schlund unter dem schmalen Holzdach, das sie den »Sarg« nannten, das Feuer verbrannte ihnen die Stirn und die Wangen — sie fühlten es nicht mehr —, sie fühlten nur die Peitsche, mit der des Bischofs Vogt und seine Knechte sie zur Arbeit trieben.
Dorthin wollte der Dieb zurück, das war die letzte Zuflucht, die ihm geblieben war, denn es gab in diesem Land mehr Galgen als Kirchtürme, und er wußte, der Hanf für den Strick, an dem er gehenkt werden sollte, war schon gehechelt und gebrochen.
Er wandte sich ab, sein Blick fiel auf die Mühle. Seit vielen Jahren lag sie verlassen da, die Tür versperrt, die Fensterläden geschlossen. Der Müller war tot. Es hieß im Land, er habe sich erhängt, weil ihm des Bischofs Vogt oder Vizedom die Mühle, den Esel und die Mehlsäcke gepfändet hätt’. Doch jetzt gewahrte der Dieb, daß die Flügel sich drehten, die Achse des großen Wellbaumes knarrte, und aus dem Schornstein des Müllerhauses stieg Rauch empor.
Es gab eine Sage, die durchs Land lief, und der Dieb kannte sie. Die Bauern flüsterten einander zu, daß der tote Müller alle Jahr’ einmal aus seinem Grab käm’ und seine Mühle eine Nacht lang laufen ließ’, damit er dem Bischof von seiner Schuld einen Pfennig zahlen könnt’. Doch das alles war albernes Gerede, das wußte der Dieb. Die Toten blieben in ihren Gräbern, es war Tag jetzt und nicht Nacht. Und wenn sich die Flügel im Licht der Wintersonne drehten, so hieß das nichts anderes, als daß die Mühle einen neuen Herrn hatte.
Der Dieb rieb sich die Hände und zog die Schultern hoch.
»Es sieht aus«, sagte er, »als ob wir für diesen Tag ein Dach über den Kopf bekämen.«
»Ein Bissen Brot und ein Bündel Stroh, das ist alles, was ich will«, murmelte Tornefeld.
Der andere lachte.
»Hast vermeint, daß ein Flaumbett mit seidenen Vorhängen auf dich wartet?« spottete er. »Und vielleicht eine französische Potage und Kuchen und ungarischer Wein dazu?«
Tornefeld gab keine Antwort. Und sie gingen beide, der Dieb und der Edelmann, den Weg hinauf, der zur Mühle führte.
Die Tür war nicht versperrt, doch der Müller war nirgends zu sehen, nicht in der Stube und nicht in der Schlafkammer; sie suchten ihn vergeblich auf dem Dachboden, und auch in der Mühle war er nicht. Dennoch mußte das Haus bewohnt sein, denn im Herd brannte ein kleines Holzfeuer, und auf dem Tisch stand eine Schüssel mit Brot und Wurst und ein Krug Dünnbier.
Der Dieb blickte mißtrauisch um sich, denn er kannte die Menschen und wußte, daß dieser Tisch nicht für Leute gedeckt war, die keinen Kreuzer in der Tasche hatten. Am liebsten hätte er sich mit dem Brot und der Wurst davongeschlichen. Aber Tornefeld hatte jetzt, da er in der warmen Stube war, wieder allen seinen Mut gefunden. Mit dem Brotmesser in der Faust setzte er sich an den Tisch, als hätt’ der Müller die Wurst für ihn geräuchert und gebraten.
»Trink und iß, Bruder!« sagte er. »Bist in deinem Leben niemals ehrlicher gehalten worden. Was wir beide verzehren, dafür steh’ ich gut. Trink, Bruder! Dir zum Wohl und auf alle braven Soldaten! Vivat Carolus rex! Bist du lutherisch, Bruder?«
»Ich bin lutherisch oder papistisch, wie es die Welt will«, sagte der Dieb, indem er sich über die Wurst hermachte. »Wenn ich Bildstöcke seh’ an den Wegen und Heiligenhäuslein, dann sag’ ich allen, denen ich begegne, ein Ave Maria gratia plena auf, und wenn ich durch ein lutherisches Land zieh’, dann häng’ ich das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit an das Vaterunser.«
»Das gilt nicht«, sagte Tornefeld und streckte die Beine unter dem Tisch aus. »Man kann nicht petrisch und paulisch zugleich sein. Treib’s nur so weiter, so wirst du in der Ewigkeit verdorben sein. Ich gehör’ der protestierenden Kirche an, ich lache und verspott’ den Papst und sein Gebot. Der schwedische Karl, der ist aller Lutheraner Hort. Trink mit mir auf seine Gesundheit und Tod allen seinen Feinden!«
Er hob sein Glas und leerte es, und dann fuhr er fort:
»Jetzt hat sich der Kurfürst von Sachsen gar mit dem moskowitischen Zaren gegen ihn verbündet. Darüber lach’ ich. Das ist, als wollten ein Ziegenbock und ein Ochse zusammen den edlen Hirsch besiegen. Greif zu, Bruder, laß dir’s wohl gehn. Ich bin hier Wirt und Küchenmeister, Aufwärter und Tafeldecker, alles in einer Person. Freilich, die Küche vermag nicht viel. Ich hätt’ gern einen Eierfladen oder ein Stück Gebratenes, dieweil mein Magen etwas Warmes prätendiert.«
»Hast aber gestern auch kalte Küche nicht verschmäht und fleißig gefrorene Rübenschalen von der Erde aufgelesen«, spottete der Dieb.
»Ja, Bruder«, sagte Tornefeld. »Es waren schlimme Tage, unbeschreibliche Fatiguen, hab’ nicht geglaubt, daß ich sie übersteh’. Hab’ schon meinen Leichenzug gesehen, die Lichter, die Kränze, die Träger und den hölzernen Sarg. Enfin — ich lebe, Gott sei’s gedankt, hab’ eine Salvaguardia vor des Todes Sensen. Und in zwei Wochen werd’ ich neben meinem König im Laufgraben stehen.«
Er schlug auf die Tasche in seinem Rock, in der er das, was er sein Arcanum nannte, verwahrt hielt. Dann spitzte er den Mund und pfiff eine Sarabande vor sich hin und trommelte mit den Fingern den Takt dazu.
In dem Dieb stieg wiederum ein Zorn gegen diesen adeligen Buben auf, der vordem so jämmerlich und verzagt im Schnee gelegen war, mit aller Not hatte er ihn hieher gebracht, und jetzt saß er da und pfiff vor sich hin, als wären ihm alle Gassen zu eng und die Welt zu klein. Er, der Dieb, hatte nichts anderes mehr zu erhoffen, als ein Toter zu sein unter den Toten in des Bischofs Pochwerk und flammendem Schmelzofen. Der Knabe aber durfte mit seinem Arcanum in die Welt, um Beute zu machen und Ehre zu gewinnen. Dieses hochberühmte Arcanum hätte der Dieb für sein Leben gern gesehen, und er versuchte, den Tornefeld mit Stichelreden dahin zu bringen, daß er es ihm zeigte.
»Nimm mir’s nicht krumm, Bruder«, sagte er, »aber du läufst in den Krieg wie ein anderer zur Kirmes. Ich mein’, du solltest einem Bauern sein Korn dreschen und seine Ställe fegen. Denn der Krieg ist ein hart’ Stück Brot, glaub mir, um das zu beißen, bedarf es anderer Zähne, als du sie in deinem Mund hast.«
Tornefeld hörte auf zu trommeln und zu pfeifen.
»Wollt’ mich nicht schämen, ein Bauernknecht zu sein«, gab er zur Antwort. »Ist ein ehrlicher Stand, unter dem Dreschen ist dem Gideon der Engel erschienen. Aber wir schwedischen Edelleut’, wir sind für den Krieg geboren, wir taugen nicht dazu, einem Bauern Korn zu fahren und den Stall zu fegen.«
»Ich mein’ nur, du taugst besser hinter den Ofen, als im Felde vor dem Feind zu stehen«, sagte der Dieb.
Tornefeld blieb ruhig, nur seine Hand zitterte, und er stellte den Krug, aus dem er just hatte trinken wollen, auf den Tisch zurück.
»Werd’ mich zu allem brauchen lassen, was einem ehrlichen Soldaten zusteht«, erwiderte er. »Die Tornefelds sind allezeit Soldaten gewesen, warum sollt’ ich hinter dem Ofen liegen? Mein Großvater, der Obrist, hat bei Lützen das blaue Regiment kommandiert, ist neben seinem König gestanden, dem Gustav Adolf, und hat ihn mit seinem Leib gedeckt, als er vom Pferde fiel. Und mein Vater ist in elf Schlachten und Gefechten gestanden, und beim Sturm auf Saverne hat er den Arm verloren. Aber was weißt du, Bruder, von Saverne und wie’s dort zuging mit Blitz, Donner, Rauch und Geschrei, Vorwärts, Zurück, Lärmen, Trommeln und Trompeten, sich umformieren und von neuem attackieren! Daß man in Saverne heut Hopfen dörrt und Tapeten webt, das weißt du vielleicht, und sonst weißt du nichts.«
»Bist aber doch als ein Schelm von deiner Kompagnie gegangen«, versetzte der Dieb, »hast dein Regiment mit Schimpf quittiert. Ich hab’ dich im Schnee liegen und weinen gesehen. Du taugst nicht zum Soldaten, du wirst nicht wollen wachen, schanzen und stürmen und Frost und Elend ausstehen.«
Tornefeld schwieg. Er saß, den Kopf vornübergebeugt, und starrte in die Glut des Herdfeuers.
»Ich mein’«, fuhr der Dieb beharrlich fort, »daß du, wenn du wirst hören die Trommel Lärmen rühren, daß du wirst Angst haben, du könnt’st dein Fünfgroschen-Leben verlieren. Du wirst dich umsehen nach einem Ofenloch oder einem Schornstein und dich verkriechen.«
»Ich will’s nicht leiden«, sagte Tornefeld leise, »daß du in meiner Person die Ehre des schwedischen Adels schmähst.«
»Leid es oder leid es nicht, das gilt mir gleich«, rief der Dieb. »Ich halt’ alle Edelleut’ für Mausköpfe und Lotterbuben und geb’ keine Schuhschnallen für ihre Edelmannsehr’.«
Da war Tornefeld aufgesprungen und stand da, bleich vor Zorn und Scham, und weil er keine andere Waffe fand, so griff er nach dem Bierkrug, den schwang er gegen den Dieb.
»Jetzt kein Wort mehr«, stieß er hervor, »oder es geht dir an deinen Balg.«
Doch der Dieb hatte längst schon das Brotmesser in der Hand.
»Ei, so komm!« lachte er. »Was soll dein Drohen, ich fürcht’ mich vor dir nicht. Jetzt laß dein Arcanum sehen, ob es dich hieb- und stichfest macht. Und wenn nicht, so will ich dir so viel Löcher …«
Er verstummte, und sie ließen beide ihre Waffen sinken, der eine das Brotmesser und der andere den Bierkrug. Sie sahen plötzlich, daß sie zu dritt in der Stube waren.
Ein Mann saß auf der Ofenbank, der hatte ein Gesicht wie spanisches Leder, gelblich fahl und runzlig und voll Falten, und die Augen staken ihm im Kopf wie zwei hohle Nußschalen. Er trug ein Wams aus rotem Tuch und einen breiten Fuhrmannshut, und auf dem Hut eine Feder, und die Stulpen seiner groben Reiterstiefel reichten ihm bis über die Knie. Und wie er so schweigend dasaß mit seinen bleckenden Zähnen und seinem krummen Maul, da kam die Angst über die beiden, und der Dieb erkannte, daß das der tote Müller war, der aus dem Fegefeuer gekommen war, um zu sehen, wie’s in seiner Mühle zuging. Und er schlug hinter Tornefelds Rücken heimlich das Kreuzzeichen, und dazu rief er Jesu Weh und Jesu Wunden an und Jesu Wasser und Jesu Blut und meinte, nun müsse das Gespenst sogleich mit viel Schwefeldämpfen und Gestank verschwinden und ins Fegefeuer zurückfahren. Aber der Mann im roten Wams blieb da und rührte sich nicht, er saß und starrte die beiden an wie eine Eule, die zuschnappen will.
»Wie ist der Herr hereingekommen?« fragte Tornefeld mit klappernden Zähnen. »Ich hab’ den Herrn nicht kommen gesehen.«
»Ein altes Weiblein hat mich in einer Butten hereingebracht«, sagte der Mann mit einem lautlosen Lachen und einer Stimme, die klang so dumpf, wie wenn man Erde auf Erde schaufelt. »Und ihr? Was sucht ihr hier? Ihr eßt mein Brot und trinkt mein Bier, und ich soll dazu wohl sagen: Gesegn’ es Gott!«
»Er sieht aus, als hätt’ ihn der Teufel zehn Jahre lang in der Beiz gehabt«, sagte der Dieb halblaut zu sich selbst.
»Schweig! Sei still! Er könnt’s für einen Affront nehmen«, flüsterte Tornefeld ihm hastig zu. Und laut sagte er:
»Der Herr halte mich entschuldigt. Draußen ist alles stein- und beinhart gefroren, und die Zeiten sind in solch einem verwirrten Stand, daß ich seit drei Tagen keinen Bissen Brot im Mund gehabt hab’, Gott weiß es. Hab’ mich daher selbst an des Herrn Tisch geladen …«
»Er sieht aus, als hätt’ ihm ein Wiesel ins Gesicht geblasen«, murmelte der Dieb vor sich hin.
»… wenngleich ich nicht die Ehre habe, dem Herrn bekannt zu sein«, fuhr Tornefeld mit einer Verbeugung fort. »Werd’ es aber an der gebührenden reconnaissance nicht fehlen lassen.«
Der Dieb sah wohl, daß das nicht die rechte Weise war, mit einem Gespenst zu reden, und es fiel ihm auch ein, daß er in der Eile und in seiner Verwirrtheit einen falschen Segen gesprochen hatte. Denn Christi Blut und Wunden rief man an gegen die Wassersucht, die Pocken oder den kalten Brand, nicht aber um Gespenster zu bannen. Doch ehe er noch dazu kam, den rechten Segen herzusagen, wandte sich der Mann mit dem Fuhrmannshut an ihn:
»Du siehst mich an, Bursche, als wüßtest du, wer ich bin.«
»Ich weiß wohl, wer der Herr ist«, sagte der Dieb mit beklommener Stimme, »und ich weiß auch, aus welchem Reich der Herr gekommen ist. Der Herr ist gekommen aus dem Nobishaus, wo die Flammen aus den Fenstern schlagen und wo man auf dem Sims die Apfel brät.«
Er sah vor seinen Augen das Fegefeuer, den glühenden Schlund, die Herberge der verdammten Seelen. Das war das Nobishaus. Doch der Mann im roten Wams tat so, als hätte der Dieb vom Stiftsgut gesprochen und von den Schmelzöfen und Kalköfen, aus denen Rauch- und Flammenzungen Tag und Nacht gegen den Himmel fuhren.
»Ich seh’, du kennst mich nicht«, gab er zur Antwort. »Ich bin keiner von des Herrn Bischofs Schmelzern und Gießern und Ofenwärtern und Hüttenknechten.«
Draußen wirbelten die Schneeflocken. Der Dieb machte einen Schritt auf das Fenster zu und deutete mit der Hand auf die Flügel der Windmühle, die jetzt stillestanden.
»Ich mein’«, sagte er leise und stockend, »daß der Herr dieser selbe Müller ist, der sich mit einem Strick um den Hals aus der Welt geschlichen hat, und daß er jetzt wohnt im feurigen Schlund.«
»Ja! Ich bin dieser selbe Müller«, rief der Mann im roten Wams und erhob sich von der Ofenbank und ging in der Stube auf und nieder. »Ja. Ich bin der Müller, und es ist wahr, daß ich in einer schlimmen Stunde versucht hab’, mich mit einem Strick von der Welt abzutun. Aber da kamen vom Stiftsgut her der Vogt und seine Knechte, die schnitten mich vom Strick herunter, und der Feldscher hat mir zur Ader gelassen. Hab’ mein Leben wieder, und jetzt steh’ ich als Fuhrmann in seiner fürstlichen Gnaden, des Herrn Bischofs Dienst, fahr’ die Heerstraße hinauf und hinunter und bring’ meinem Herrn Kaufmannsgüter aus allen Ländern und Städten, aus Venedig, aus Mecheln, aus Warschau und aus Lyon. — Und ihr? Was für Gewerb’ und Wandelschaft? Woher kommt ihr, wohin geht ihr?«
Der Dieb blickte dem Mann, der sporenklirrend durch die Stube ging, mit unruhigen Augen nach. Es war ihm, als wüßte dieser längst Verstorbene, der für einen Menschen von Fleisch und Blut gelten wollt’, sehr wohl, mit wem er es zu tun hatte, und daß er, der Dieb, sein Leben lang alles gestohlen hatte, was ihm unter die Hände gekommen war: Speck, Eier, Brot und Bier, die Enten aus dem Teich und die Nüsse vom Baum. Darum schwieg er lieber von seinem Gewerbe. Er deutete mit unsicherer Hand auf die dunklen Wälder, in denen die Eisenhämmer und das Pochwerk lagen, und sagte:
»Ich will hinüber und dort nach meinem Brot trachten.«
Der Müller lachte lautlos und rieb sich die knochigen Hände.
»Wenn du hinüber willst«, meinte er, »so ist der Sache bald geholfen. Seiner fürstlichen Gnaden ist gut dienen. Du wirst haben alle Tage ein Pfund Brot in die Hand und ein halbes in die Suppe. Dazu Schmalz um zwei Kreuzer, am Abend ein Mus und sonntags Grützwurst und gedämpftes Hammelfleisch.«
Der Dieb schloß die Augen. Es waren schlimme Zeiten gewesen, in zehn Tagen hatte er nur ein einziges Mal einen warmen Bissen im Mund gehabt, das war, als er eine Dohle erlegt und gebraten hatte. Er sog die Luft durch die Nase ein, als stünde die Fleischschüssel schon vor ihm auf dem Tisch.
»Gedämpftes Hammelfleisch«, murmelte er. »Mit Kümmel darin.«
»Mit Kümmel und mit Muskatnuß«, versicherte der Müller. »Du wirst ehrlich traktiert werden.«
Er wandte sich an Tornefeld.
»Und du? Was stehst du da wie ein gemalter Heiliger, hast dein Maul und bringst nichts hervor. Du willst auch gute Tage haben? Soll der Herr Bischof alle müßigen Burschen und Pfannenschlecker ernähren?«
Tornefeld schüttelte den Kopf.