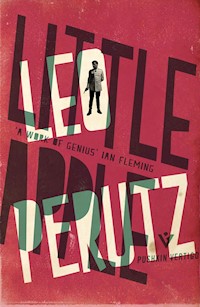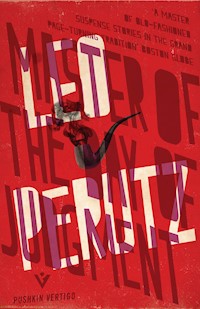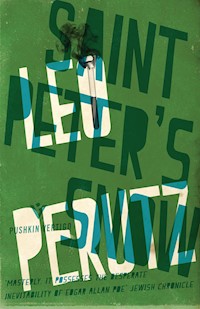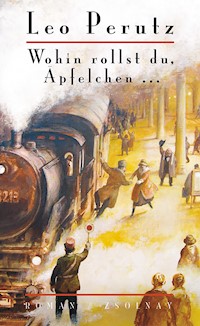Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Gemeindearzt eines abgelegenen westfälischen Dorfes, Dr. Amberg, begegnet in den 1930er Jahren dem Freiherrn von Malchin, einem Sonderling, der in jahrelangen chemischen Experimenten der Natur das Mittel zur Wiederentdeckung der Glaubensinbrunst abgerungen haben will. Es handelt sich dabei um die Getreideseuche Muttergottesbrand, bekannt auch als St. Petri-Schnee. Hin und hergerissen zwischen Faszination und kritischem Bewusstsein, erlebt der Arzt, wie Malchin die Menschen an den Rand einer Katastrophe führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der Gemeindearzt eines abgelegenen westfälischen Dorfes, Dr. Amberg, begegnet in den 1930er Jahren dem Freiherrn von Malchin, einem Sonderling, der in jahrelangen chemischen Experimenten der Natur das Mittel zur Wiederentdeckung der Glaubensinbrunst abgerungen haben will. Es handelt sich dabei um die Getreideseuche Muttergottesbrand, bekannt auch als St. Petri-Schnee. Hin und hergerissen zwischen Faszination und kritischem Bewusstsein, erlebt der Arzt, wie Malchin die Menschen an den Rand einer Katastrophe führt.
Leo Perutz
St. Petri-Schnee
ROMAN
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans-Harald Müller
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Nachwort
Der Erinnerung
an eine früh Vollendete, früh Gegangene gewidmet
Erstes Kapitel
Als die Nacht mich freigab, war ich ein namenloses Etwas, ein unpersönliches Wesen, das die Begriffe »Vergangenheit« und »Zukunft« nicht kannte. Ich lag, vielleicht viele Stunden lang, vielleicht auch nur den Bruchteil einer Sekunde hindurch, in einer Art Starrheit, und sie ging dann in einen Zustand über, den ich jetzt nicht mehr beschreiben kann. Wenn ich ihn ein schattenhaftes, mit dem Gefühl einer völligen Bestimmungslosigkeit gepaartes Bewußtsein meiner selbst nenne, so habe ich das Besondere und Eigenartige an ihm nur unzureichend wiedergegeben. Es wäre leicht, zu sagen: Ich schwebte im Leeren, — aber diese Worte besagen nichts. Ich wußte nur, daß irgend etwas existierte, aber daß dieses »Irgendetwas« ich selbst war, das wußte ich nicht.
Ich kann nicht sagen, wie lange dieser Zustand währte und wann die ersten Erinnerungen kamen. Sie tauchten in mir auf und zerflossen sogleich wieder, ich konnte sie nicht halten. Eine von ihnen bereitete mir, so gestaltlos sie auch war, dennoch Schmerz oder sie machte mir Angst, — ich hörte mich tief Atem holen, wie unter einem Alpdruck.
Die ersten Erinnerungen, die haftenblieben, waren durchaus gleichgültiger Natur. Der Name eines Hundes, den ich einstmals kurze Zeit hindurch besessen hatte, fiel mir ein. Dann, daß ich einen Band meiner Shakespeare-Ausgabe verliehen und nicht mehr zurückerhalten hatte. Ein Straßenname und eine Hausnummer flogen mir zu, mit denen ich auch jetzt noch kein Ereignis meines Lebens in Verbindung bringen kann, und dann sah ich das Bild eines Motorradfahrers, der mit zwei erlegten Feldhasen auf dem Rücken durch die menschenleere Dorfstraße —, wann war das nur gewesen? Ich entsann mich, daß ich gestrauchelt war, als ich dem Mann mit den beiden Feldhasen auswich, und im Aufstehen hatte ich bemerkt, daß ich meine Taschenuhr in der Hand hielt, acht Uhr zeigte sie, und das Glas hatte ich im Fallen zerbrochen. Ich war mit der Taschenuhr in der Hand ohne Hut und Mantel aus dem Haus —
Bis dahin war ich gekommen, da brachen plötzlich die Ereignisse der vergangenen Wochen auf mich ein mit einer Gewalt, die sich nicht schildern läßt, Anfang, Verlauf und Ende, alles im selben Augenblick, wie Balken und Steine eines zusammenstürzenden Hauses sausten sie auf mich nieder. Ich sah die Menschen und die Dinge, zwischen denen ich gelebt hatte, und sie waren über alle Maßen groß, gespenstisch; riesenhaft und furchterregend erschienen sie mir, wie Menschen und Dinge aus einer anderen Welt. Und in mir war etwas, das wollte mir die Brust sprengen: der Gedanke an ein Glück oder an die Angst um dieses Glück oder an Verzweiflung und zehrendes Verlangen, — das alles sind schwache Worte. Es war der Gedanke an etwas, das sich nicht eine Sekunde lang ertragen ließ.
Das war die erste Begegnung meines erwachten Bewußtseins mit dem ungeheuren Erlebnis, das hinter mir liegt.
Es war zuviel für mich. Ich hörte mich schreien und ich muß wohl den Versuch gemacht haben, die Decke von mir abzuwerfen, denn ich spürte einen stechenden Schmerz im Oberarm, und dann fiel ich —, nein, dann flüchtete ich mich in eine Ohnmacht, die für mich die Rettung war.
Als ich zum zweitenmal erwachte, war es heller Tag. Diesmal gewann ich das vollkommene Bewußtsein meiner selbst sogleich und ohne jeden Übergang. Ich sah, daß ich mich im Zimmer eines Krankenhauses befand, in einem freundlichen, gut eingerichteten Raum, der offenbar für zahlende oder aus irgend einem anderen Grund bevorzugte Patienten bestimmt war. Eine ältliche Pflegeschwester saß beim Fenster, sie war mit einer Häkelarbeit beschäftigt und dazwischen schlürfte sie Kaffee. In einem Bett an der Wand mir gegenüber lag ein Mann mit Bartstoppeln, eingefallenen Wangen und weißbandagiertem Kopf. Er blickte mich unverwandt an aus großen, traurigen Augen und mit einem Ausdruck von Besorgnis im Gesicht. Ich glaube, ich habe durch eine rätselhafte Spiegelung ein paar Augenblicke lang mich selbst gesehen, wie ich dalag, blaß, abgemagert, unrasiert und mit verbundenem Kopf. Doch es kann auch sein, daß ich einen fremden Menschen gesehen habe, einen Patienten, der, während ich bewußtlos war, das Zimmer mit mir geteilt hat. In diesem Fall muß er innerhalb der nächsten Minuten aus dem Zimmer entfernt worden sein, ohne daß ich es merkte. Denn als ich die Augen wieder öffnete, sah ich ihn nicht mehr und auch sein Bett war verschwunden.
Jetzt konnte ich mich an alles erinnern. Die Ereignisse, die mich hierher gebracht hatten, standen klar und festumrissen vor mir, aber sie trugen jetzt ein anderes Gesicht. Sie hatten das Ungeheuerliche, das Beklemmende verloren. Manches von dem, was ich erlebt hatte, erschien mir auch jetzt noch unheimlich, manches rätselhaft und unerklärbar. Aber alle diese Geschehnisse erschreckten mich nicht. Und auch die Menschen sah ich nicht mehr als riesenhaft schwankende, furchterregende Phantome. Sie standen in Tageshelle, sie hatten irdisches Maß, sie waren Menschen wie ich und alle anderen, Geschöpfe dieser Welt. Und sie schlossen sich, unmerklich fast und wie von selbst, meinem früheren Dasein an, die Tage, die Menschen und die Dinge, sie verschmolzen mit ihm, sie waren ein Stück meines Lebens und von ihm untrennbar geworden.
Die Pflegeschwester merkte, daß ich erwacht war, und stand auf. In ihrem Gesicht war ein Ausdruck von selbstzufriedener Einfalt, und jetzt, während ich sie ansah, fiel mir plötzlich ihre Ähnlichkeit mit jenem alten Weib auf, das wie eine Megäre aus dem Haufen der tobenden Bauern hervorgesprungen war und den greisen Pfarrer mit dem Brotmesser bedroht hatte. »Schlagt den Pfaffen nieder!« hatte sie geschrien. Und es schien mir sonderbar, daß sie jetzt hier in meinem Zimmer war, still, geräuschlos und einfältig, und daß sie mich pflegte. Doch indem sie näher kam, verlor sich diese Ähnlichkeit. Ich hatte mich getäuscht. Als sie vor meinem Bett stand, sah ich in ein völlig fremdes Gesicht. Ich hatte diese Frau nie zuvor gesehen.
Sie merkte, daß ich sprechen wollte, und hob abwehrend beide Hände, — das sollte heißen, ich möge mich schonen, das Sprechen tue mir nicht gut. In diesem Augenblick hatte ich plötzlich das Gefühl des »déjà vu«, die Empfindung, als hätte ich dies alles — das Bett, das Krankenzimmer, die Pflegerin — schon einmal erlebt. Natürlich war auch das eine Täuschung, aber die Wirklichkeit, die hinter dieser Empfindung lag, war nicht weniger sonderbar. Ich hatte, dessen entsann ich mich jetzt, in dem westfälischen Dorf, in dem ich Arzt gewesen bin, wiederholt eine Art zweiten Gesichts gehabt, ich hatte den Zustand, in dem ich mich jetzt befand, in manchen Augenblicken hellseherisch vorausempfunden. Das ist die Wahrheit, ich kann sie beschwören, — auf dem Boden Westfalens sind solche Erscheinungen seit jeher beobachtet worden.
»Wie bin ich hergekommen?« fragte ich.
Die Krankenschwester zuckte die Achseln. Vielleicht war es ihr verboten worden, sich mit mir in ein Gespräch über diesen Punkt einzulassen.
»Wie lange bin ich hier?« fragte ich weiter.
Sie schien zu überlegen.
»Es ist jetzt die fünfte Woche«, gab sie nach einer Weile zur Antwort.
— Das ist unmöglich — stellte ich fest. — Draußen schneit es, es ist noch immer Winter. Es können nur Tage vergangen sein, seit ich hierher gebracht worden bin. Vier Tage oder vielleicht fünf. An jenem Sonntag, dem letzten Tag in Morwede, hat es geschneit und es schneit noch immer. Warum lügt sie? —
Ich sah ihr ins Gesicht.
»Das kann nicht stimmen«, erklärte ich. »Sie sagen mir nicht die Wahrheit.«
Sie wurde verwirrt.
»Vielleicht sind es sechs Wochen«, sagte sie zögernd. »Ich weiß es nicht so genau. Ich bin die fünfte Woche hier auf dem Zimmer. Vor mir war eine andere Schwester da. Als ich kam, lagen Sie schon hier.«
»Welchen Tag haben wir heute?« fragte ich.
Sie tat, als hätte sie mich nicht verstanden.
»Welchen Tag im Kalender?« wiederholte ich. »Welches Datum?«
»Den zweiten März 1932«, sagte sie endlich.
»Den zweiten März.« Diesmal sprach sie die Wahrheit, das sah ich ihr an. Das Datum stimmte mit meinen Berechnungen überein. Am 25. Jänner hatte ich meine Stelle als Gemeindearzt in Morwede angetreten. Einen Monat lang, bis zu jenem verhängnisvollen Sonntag, hatte ich in dem kleinen westfälischen Dorf gearbeitet. Ich war seit fünf Tagen hier, das hatte ich nun festgestellt. Warum belog sie mich? Und in wessen Auftrag tat sie es? Wer hatte ein Interesse daran, mich glauben zu machen, ich hätte im Zustand der Bewußtlosigkeit volle fünf Wochen hier in diesem Krankenzimmer verbracht? Es hatte keinen Sinn, weiter in sie zu dringen. Als sie merkte, daß ich keine Fragen mehr zu stellen hatte, berichtete sie mir unaufgefordert, daß ich schon mehrere Male bei Bewußtsein gewesen sei. Einmal, als sie beim Verbandwechsel eine Schüssel fallen ließ, hätte ich, ohne die Augen zu öffnen, gefragt, wer denn da sei. Später hätte ich öfter über Schmerzen geklagt, behauptete sie, und auch zu trinken verlangt, sei aber immer gleich darauf wieder eingeschlafen. — An all das vermochte ich mich nicht zu erinnern.
»Das wissen die wenigsten nachher«, sagte sie und ging an ihren Fensterplatz und zu ihrer Häkelarbeit zurück.
Ich lag mit geschlossenen Augen und dachte an das, was nun zu Ende war, — für immer zu Ende. Sie lebte, das wußte ich, sie war der grauenvollen letzten Stunde und der Vergeltung entronnen, — das stand für mich fest, wie Felsen stehen. Sie war zu stark, um unterzugehen. Die Kugel, die ihr galt, hatte mich getroffen. Menschen von ihrer Art gehen nicht unter. Was immer sie begeht, wie groß die Schuld auch sein mag, mit der sie sich belädt, — sie wird immer Menschen finden, die sich zwischen sie und das rächende Schicksal werfen.
Aber ich wußte auch, daß es zu Ende war, daß sie nicht wiederkommen werde. Ein zweites Mal führte sie ihr Weg nicht zu mir zurück. Was lag daran! Eine Nacht lang hatte sie mir gehört. Und diese Nacht blieb mir, die konnte mir niemand entreißen, sie lag in meinem Leben eingeschlossen wie der dunkelrote Almandin in einem Stück Granit. Durch diese Nacht war ich für immer mit ihr verbunden. Ich hatte sie in meinen Armen gehalten, ich hatte ihre Atemzüge erfühlt und ihren Herzschlag und das Zittern, das durch ihre Glieder lief, ich hatte das Kinderlächeln ihres Erwachens gesehen. Vorüber? Nein. Was eine Frau in solch einer grenzenlosen Nacht verschenkt, das verschenkt sie für immer. Vielleicht gehörte sie jetzt einem anderen, — ohne Trauer vermochte ich daran zu denken. Lebewohl, Bibiche!
»Bibiche«, — so nannte sie sich, wenn sie mit sich selbst sprach. — »Arme Bibiche«, — wie oft habe ich diesen zärtlich-klagenden Laut aus ihrem Mund gehört. »Sie sind mir böse und ich weiß nicht, warum. Arme Bibiche!« — das stand auf einem Zettel, den mir ein kleiner Junge brachte, — wie lange ist das her? Und einmal, als wir einander kaum noch kannten, in jener Zeit, in der sie tat, als wäre ich ihr gleichgültig, da hatte ihr ein Tropfen von irgend einer Säure die Hand versengt. »Das tut ja weh! Du bist nicht gut zu Bibiche!« — hatte sie geklagt und erstaunt und traurig ihren kleinen Finger betrachtet. Und als ich über ihre Worte lachte, hatte mich ein kalter und abweisender Blick gestreift. Das ist vorüber. Diesem Blick werde ich nicht mehr begegnen. Das ist für immer vorüber seit jener Nacht —.
Ich hörte Schritte und öffnete die Augen. Der Oberarzt und seine beiden Assistenten standen an meinem Bett, und hinter ihnen schob ein herkulisch gebauter Mensch in einem blauweiß gestreiften Zwilchkittel den Verbandtisch zur Tür herein.
Ich sah ihn an und erkannte ihn sofort, seine Verkleidung konnte mich nicht beirren. Dieser mächtige Körper, das zurückfliehende, weich geformte Kinn, die tiefliegenden, wasserblauen Augen, — dieser Mann im Zwilchkittel war der Fürst Praxatin, der Letzte aus dem Hause Rurik. Die Narbe an seiner Oberlippe konnte ich nicht sehen, er hatte sich einen Schnurrbart wachsen lassen, auch trug er das weißblonde Haar nicht mehr zurückgestrichen, es fiel ihm in die Stirn und seine Hände waren braun und ungepflegt, — war er es oder war er es nicht? Er war es, da gab es keinen Zweifel. Schon die Art, wie er meinem Blick auszuweichen suchte, sagte mir alles. Er hatte hier eine Zuflucht gefunden, sich in Sicherheit gebracht, unter einem geborgten Namen spielte er den Krankenwärter, er wollte nicht erkannt werden. Nun, vor mir brauchte er sich nicht zu fürchten, mochte er sein erbärmliches Dasein weiterführen, wenn sein Gewissen es ihm erlaubte, — ich hatte nicht die Absicht, ihn zu verraten.
»Aufgewacht? Guten Morgen«, hörte ich die Stimme des Oberarztes. »Wie fühlen Sie sich? Geht es Ihnen besser? Haben Sie Schmerzen?«
Ich gab keine Antwort. Ich starrte noch immer den Fürsten Praxatin an. Er hatte sich abgewendet, mein Blick beunruhigte ihn. Und jetzt sah ich, was mir vorher entgangen war: Eine brennrote Schramme, die hinter seinem rechten Ohr begann und bis in die Gegend des Kinns lief, — ein Andenken an jene Nacht, in der er seinen Freund und Wohltäter verraten hatte.
»Wissen Sie, wo Sie sind?« fragte der Oberarzt.
Ich sah ihm ins Gesicht. Er war ein Mann von etwa fünfzig Jahren mit graumeliertem Spitzbart und lebhaft blickenden Augen. Er wollte offenbar feststellen, ob noch eine Trübung des Bewußtseins bei mir vorhanden sei.
»In einem Krankenhaus bin ich«, gab ich zur Antwort.
»Ganz richtig«, bestätigte er. »In Osnabrück, im städtischen Krankenhaus.«
Der eine der beiden Assistenten beugte sich über mich. »Erkennst du mich, Amberg?« fragte er.
»Nein«, sagte ich. »Wer sind Sie? Wer bist du?«
»Mensch, du mußt mich doch kennen«, sprach er mir zu. »Denk doch einmal nach. Wir haben in Berlin ein Semester lang zusammen im bakteriologischen Institut gearbeitet. Hab ich mich wirklich so verändert?«
»Sind Sie der Dr. Friebe?« fragte ich unsicher.
»Na also! Endlich. Hast du mich doch erkannt«, stellte er befriedigt fest, und dann begann er, mir den Verband vom Oberarm und von der Schulter abzunehmen.
Dieser Dr. Friebe war mein Kollege im bakteriologischen Institut gewesen, er hatte sie auch gekannt. Ich hätte brennend gerne ihren Namen aus seinem Mund gehört, aber irgend ein Instinkt hielt mich ab, von ihr zu sprechen oder nach ihr zu fragen.
Ich wies auf die Schußverletzung an meinem Arm.
»War es ein Steckschuß?« fragte ich.
»Was denn?« meinte er zerstreut.
»Hat man die Kugel extrahieren müssen?«
Er sah mich groß an.
»Von welcher Kugel sprichst du? Du hast Rißquetschwunden am Arm und an der Schulter.«
Ich wurde ärgerlich.
»Rißquetschwunden?« rief ich. »Das ist doch Unsinn. Die Verletzung am Arm stammt von einem Revolverschuß und die an der Schulter von einem Messerstich. Das muß sogar ein Laie sehen. Und außerdem —«
Jetzt mengte sich der Oberarzt ein.
»Hören Sie mal, — was glauben Sie denn? Unsere Verkehrspolizisten pflegen doch nicht gegen Passanten, die ihre Weisungen unbeachtet lassen, mit Messern und Revolvern loszugehen.«
»Wovon sprechen Sie eigentlich?« unterbrach ich ihn.
»So erinnern Sie sich doch!« fuhr er fort. »Sie standen vor genau fünf Wochen gegen zwei Uhr mittags hier in Osnabrück auf dem Bahnhofplatz, mitten im stärksten Verkehr, und starrten wie ein Hypnotisierter vor sich hin. Der Verkehrspolizist schrie auf Sie ein, die Chauffeure brüllten Sie an, aber Sie hörten nichts, Sie rührten sich nicht —«
»Das ist richtig«, sagte ich. »Ich sah einen grünlackierten Cadillac.«
»Du lieber Gott!« meinte der Oberarzt. »Es ist ja wahr, es gibt nur diesen einen Cadillac hier in Osnabrück. Aber für Sie, der Sie aus Berlin kommen, ist ein Cadillac doch keine so besondere Situation. Sie werden diese Marke doch schon öfter gesehen haben.«
»Ja, aber diesen Cadillac —«
»Nun, und was geschah weiter?« unterbrach er mich.
»Ich ging über den Platz zum Bahnhof, löste meine Fahrkarte und stieg in den Zug.«
»Nein«, sagte der Oberarzt. »Sie kamen nicht zum Bahnhof. Sie liefen direkt in ein Auto hinein und wurden niedergestoßen. Bruch der Schädelbasis, Bluterguß ins Gehirn, — so brachte man Sie hierher. Sie waren nicht gut daran, es hätte auch anders ausgehen können. Jetzt sind Sie außer Gefahr.«
Ich versuchte in seinem Gesicht zu lesen. Das konnte doch nicht sein Ernst sein, das war ja Wahnsinn, was er da sprach. Ich war in den Zug gestiegen, hatte zwei Zeitungen und ein Magazin gelesen und dann schlief ich ein. Als der Zug in Münster hielt, erwachte ich und kaufte mir auf dem Bahnsteig Zigaretten. Um fünf Uhr, als es zu dunkeln begann, kam ich nach Rheda und von dort fuhr ich in einem Schlitten weiter.
»Verzeihen Sie«, sagte ich ganz bescheiden.
»Aber die Kopfverletzung rührt doch von einem Schlag mit einem stumpfen Instrument her. Es war der Hieb eines Dreschflegels.«
»Was denn!« rief er. »Wo in aller Welt gibt es heute noch Dreschflegel? Überall auf dem Land arbeitet man doch mit Maschinen.«
Was hätte ich darauf erwidern sollen! Er konnte ja nicht wissen, daß es auf dem Gut des Freiherrn von Malchin keine Maschinen gab, daß dort das Korn gesät, geschnitten und gedroschen wurde wie vor hundert Jahren.
»Dort, wo ich bis vor fünf Tagen war, gibt es noch Dreschflegel«, sagte ich endlich.
Er wechselte einen Blick mit Dr. Friebe.
»Dort, wo Sie bis vor fünf Tagen waren?« fragte er in gedehntem Ton. »Wirklich? Na, dann wird es schon so sein. Also ein Hieb mit einem Dreschflegel. Alles in Ordnung, denken Sie nicht weiter daran. Solche unangenehme Erlebnisse mit Dreschflegeln vergißt man am besten. Versuchen Sie, Ihre Gedanken auszuschalten, Sie brauchen Ruhe. Später einmal werden Sie mir alles erzählen.«
Er wendete sich an die Pflegeschwester:
»Bisquit, Tee mit Milch, dünnes Gemüse«, ordnete er an und dann ging er und seine beiden Assistenten folgten ihm und als letzter verließ, den Verbandtisch vor sich hinschiebend, der Fürst Praxatin, mit einem scheuen Seitenblick auf mich, das Zimmer.
Was war denn das gewesen? Was hatte das zu bedeuten? Wollte mir der Oberarzt eine Komödie vorspielen? Oder glaubte er tatsächlich an diesen Autounfall? Aber es war doch ganz anders, das mußte er doch wissen, ganz anders ist es gewesen.
Zweites Kapitel
Ich heiße Georg Friedrich Amberg und bin Doktor der Medizin. Mit diesen Worten wird mein Bericht über die Ereignisse in Morwede beginnen, den ich eines Tages schriftlich niederlegen werde, sobald ich physisch dazu imstande bin. Bis dahin wird wohl noch einige Zeit vergehen. Ich bin außerstande, mir Feder und Papier zu verschaffen, — ich soll ja ruhen, meine Gedanken ausschalten, auch verweigert mir mein verwundeter Arm den Dienst. Ich kann nichts anderes tun als das, was geschehen ist, mit allen Einzelheiten meinem Gedächtnis einprägen, ich muß es festhalten, damit nichts, auch nicht das scheinbar Unbedeutende, verloren geht, — das ist alles, was ich jetzt tun kann.
Ich werde in meiner Erzählung weit zurückgreifen müssen. Meine Mutter verlor ich wenige Monate nach meiner Geburt. Mein Vater war ein Historiker von Ruf, die Geschichte Deutschlands bis zum Interregnum war sein Spezialgebiet. In den letzten Jahren seines Lebens hielt er an einer mitteldeutschen Universität Vorlesungen über den Investiturstreit, über die deutsche Wehrverfassung zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts, über Sinn und Bedeutung der Sonnenlehen und über die Verwaltungsreformen Friedrichs II. Als er starb, war ich vierzehn Jahre alt. Er hinterließ nichts als eine ansehnliche, aber etwas einseitig angelegte Büchersammlung, — sie enthielt außer den Klassikerausgaben nur historische Werke. Einen Teil dieser Bücher besitze ich noch heute.
Eine Schwester meiner Mutter nahm mich zu sich. Sie war eine pedantisch-strenge, wortkarge und nüchterne Frau, die selten aus sich herausging, — wir hatten einander wenig zu sagen. Dennoch werde ich ihr mein Leben lang Dankbarkeit bewahren. Ich hörte zwar kaum jemals ein freundliches Wort von ihr; aber sie wußte ihre geringen Mittel so einzuteilen, daß ich mein Studium fortsetzen konnte. Ich hatte schon als Knabe ein brennendes Interesse für das Wissensgebiet meines Vaters gezeigt, es gab kaum ein Buch in seiner Bibliothek, das ich nicht mehrmals gelesen hatte. Als ich aber kurz vor meinem Abiturium zum erstenmal die Absicht äußerte, mich dem Studium der Geschichte zu widmen und sodann die akademische Laufbahn einzuschlagen, sprach sich meine Tante mit aller Entschiedenheit dagegen aus. Geschichtsforschung erschien ihrem nüchternen Verstand als etwas Vages, Überflüssiges, der Welt und dem Leben Fremdes. Ich sollte einen praktischen Beruf ergreifen, mich, wie sie es ausdrückte, auf festen Boden stellen, also entweder Arzt oder Jurist werden.
Ich wehrte mich dagegen und es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Eines Tages rechnete mir meine Tante, pedantisch, wie sie war, mit Bleistift und Papier die Opfer vor, die sie Jahre hindurch gebracht hatte, um mir das Studium zu ermöglichen. Da gab ich nach, — was blieb mir anderes übrig! Sie hatte sich ja wirklich um meinetwillen Entbehrungen auferlegt und meinte es gut mit mir, ich durfte sie nicht enttäuschen. Ich inskribierte mich an der medizinischen Fakultät.
Sechs Jahre später war ich ein Arzt von durchschnittlichem Wissen und Können, wie es ihrer viele gibt, mit einem Jahr Spitalpraxis, ein Arzt ohne Patienten, ohne Geld, ohne Verbindungen und, was das Schlimmste ist, ohne innere Neigung für meinen Beruf.
Ich hatte im letzten Jahr meiner Studienzeit unter der Einwirkung eines Erlebnisses, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, gewisse Gewohnheiten angenommen, die ich mir eigentlich nicht hätte gestatten dürfen. Ich pflegte mich überall dort einzufinden, wo sich die vornehme Welt traf. So bescheiden ich hierbei auch auftrat, — meine veränderte Lebensweise erforderte eben doch erhöhte Ausgaben, und auch der Ertrag der Nachhilfestunden, die ich gelegentlich erteilte, reichte nicht aus, sie zu decken. So sah ich mich öfters gezwungen, wertvolle Bücher aus der Bibliothek meines Vaters zu verkaufen. In den ersten Jännertagen dieses Jahres befand ich mich wieder einmal in Geldverlegenheit, ich hatte kleine Schulden, die mich drückten. Unter den Büchern meines Vaters befanden sich die Werke Shakespeares und Molières, die letzten Klassikerausgaben, die noch vorhanden waren. Die trug ich zu einem mir befreundeten Antiquar.
Er übernahm die Bücher und bot mir einen Betrag an, den ich angemessen fand. Als ich schon in der Tür stand, rief er mich zurück, um mich darauf aufmerksam zu machen, daß die Shakespeare-Ausgabe unvollständig war. Der Band, der die Sonette und das »Wintermärchen« enthielt, fehlte. Im ersten Augenblick war ich bestürzt, zu Hause war er nicht, das wußte ich; aber dann fiel mir ein, daß ich ihn vor Monaten einem Kollegen geliehen hatte. Ich bat den Buchhändler, sich bis zum Nachmittag zu gedulden, und dann machte ich mich auf den Weg, um das Buch zurückzufordern.
Ich traf meinen Kollegen nicht in seiner Wohnung an und entschloß mich, auf ihn zu warten. Aus langer Weile griff ich nach dem Morgenblatt, das auf dem Tisch lag, und begann zu lesen.
Es ist nicht ohne einen gewissen Reiz, sich in die Minuten zurückzuversetzen, die dem unerwarteten Eintritt eines entscheidenden Ereignisses vorangingen. Sich zu fragen: Was hat dich damals beschäftigt, wo warst du, vor einer Wende deines Lebens stehend, mit deinen Gedanken? — Nun, ich saß in einem ungeheizten Zimmer und fror in meinem dünnen Überzieher; denn einen Wintermantel besaß ich nicht. Ohne besondere Aufmerksamkeit, nur um mir die Zeit zu vertreiben, las ich einen Bericht über die Verhaftung eines Eisenbahnattentäters, einen Artikel »Der Kaffee als Nahrungsmittel« und einen Aufsatz über das Geräteturnen. Ich war wütend über meinen Kollegen, ich fand es unverantwortlich von ihm, daß er mir das Buch nicht rechtzeitig zurückerstattet hatte, und außerdem irritierte mich noch ein großer Fettfleck in der Mitte des Zeitungsblattes, — wahrscheinlich hatte mein Kollege während der Lektüre gefrühstückt und sein Butterbrot war mit der Zeitung in Berührung gekommen.
Das Ereignis, das dann eintrat, hatte ein ganz gewöhnliches, ein beinahe nichtssagendes Gesicht. Mein Blick fiel auf eine Anzeige, das war alles.
Die Freiherr von Malchin’sche Gutsverwaltung in Morwede, Kreis Rheda, Westfalen, verlautbarte, daß sie die Stelle eines Gemeindearztes zu vergeben habe. Geboten wurde die Garantie eines jährlichen Mindesteinkommens, sowie freie Wohnung und Beheizung. Bewerber mit guter Allgemeinbildung sollten den Vorzug erhalten.
Daß ich für diese Stelle in Betracht kommen könnte, daran dachte ich zunächst gar nicht. Was meine Aufmerksamkeit erregte, war der Name des Gutsherrn. »Freiherr von Malchin und von der Bork« hörte ich mich sagen, und dabei fiel mir auf, daß dieses eine Wort »Malchin« den vollen Namen und Titel in meiner Erinnerung ausgelöst hatte. Er war mir geläufig. Aber wo hatte ich ihn gehört oder gelesen?
Ich dachte nach. Mein Erinnerungsvermögen schlägt manchmal sonderbare Wege ein. Eine Melodie ging mir durch den Kopf, irgend ein altes Lied, an das ich viele Jahre lang nicht gedacht hatte. Ich summte es vor mich hin, einmal und noch einmal, und dann sah ich das eichengetäfelte Zimmer und den Tisch, der mit Büchern beladen war, und ich saß am Klavier und spielte das Lied, und jetzt fiel mir auch der Text ein, er war banal genug: »Hab ich nur deine Liebe«, so begann es. Mein Vater ging im Zimmer auf und nieder, die Hände auf dem Rücken gekreuzt, so wie es seine Gewohnheit war. Draußen im Garten zwitscherte der Buchfink. »Die Treue brauch ich nicht«, spielte ich, — so ging der Text weiter. »Freiherr von Malchin und von der Bork« meldete eine Stimme, mein Vater blieb stehen und sagte: »Lassen Sie den Herrn eintreten.« Und ich stand auf und ging aus dem Zimmer, wie ich es immer tat, wenn mein Vater Besuch erhielt.
Daß jener Besucher und der Gutsbesitzer in Morwede gar nicht dieselbe Person sein müßten, daß es vielleicht mehrere Träger dieses Namens gab, fiel mir erst viel später ein. Ich las die Anzeige noch einmal. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch und verfaßte ein Bewerbungsschreiben. Ich erwähnte flüchtig meinen Vater, beschrieb meinen Lebenslauf, soweit er einen fremden Menschen interessieren konnte, und machte Angaben über meinen Studiengang.
Die Rückkunft meines Kollegen wartete ich nicht ab. Ich hinterließ ein paar Zeilen für ihn, in denen ich ihn um die sofortige Rückstellung des Buches bat, und dann ging ich zum nächsten Postamt und gab den Brief auf.
Die Antwort kam erst nach zehn Tagen; aber sie erfüllte meine Erwartung. Der Freiherr von Malchin schrieb, daß er es sich als Ehre anrechne, meinen Vater persönlich gekannt zu haben. Er sei glücklich, dem Sohn des von ihm hochgeschätzten, leider zu früh verstorbenen Gelehrten einen Dienst erweisen zu können. Er bat um Mitteilung, ob ich die Stelle noch in diesem Monat antreten könne. Ich müsse über Osnabrück und Münster fahren, in der Bahnstation Rheda werde mich ein Wagen erwarten. Einige Formalitäten seien noch zu erfüllen: Ich müsse mein Doktordiplom sowie das Zeugnis über das beendete Praktikum an das Gemeindeamt schicken.
Als ich meiner Tante mitteilte, daß ich Berlin noch in diesem Monat verlassen und eine Stelle auf dem Lande antreten würde, nahm sie dies wie etwas Selbstverständliches und Längsterwartetes zur Kenntnis. An diesem Abend sprachen wir miteinander nur über die Ausgaben, die mir nunmehr bevorstanden. Ich mußte meine Garderobe ergänzen, mußte mir die notwendigsten chirurgischen und geburtshilflichen Instrumente und einen Vorrat an Medikamenten verschaffen. Es war noch Schmuck von meiner Mutter her vorhanden: ein Smaragdring, zwei Armbänder und ein Paar altmodischer Perlenohrgehänge. Das alles machten wir zu Geld. Doch der Erlös blieb hinter unseren Erwartungen zurück und so mußte ich, so schwer es mir auch fiel, noch einen großen Teil der Bücher meines Vaters verkaufen.
Am fünfundzwanzigsten Jänner begleitete mich meine Tante zum Bahnhof. Sie ließ es sich nicht nehmen, mir meinen Reiseproviant aus eigener Tasche zu bezahlen. Als ich am Bahnsteig Abschied nahm und ihr für alles dankte, sah ich in ihrem Gesicht zum erstenmal so etwas wie Rührung. Ich glaube, sie hatte auch Tränen in den Augen. Als ich in den Zug stieg, machte sie mit einer entschlossenen Bewegung kehrt und verließ den Bahnhof, ohne sich nochmals nach mir umzusehen. Das war so ihre Art.
Um die Mittagsstunde kam ich nach Osnabrück.
Drittes Kapitel
Ich hatte einen Aufenthalt von einer und einer halben Stunde und benützte ihn zu einem Spaziergang durch die Stadt. Es gibt in Osnabrück einen alten Platz, genannt »die große Domfreiheit«, und einen aus dem sechzehnten Jahrhundert stammenden befestigten Turm, er heißt »der Bürgergehorsam«. Diese beiden Namen, die mir, so gegensätzlich sie auch klingen, dennoch zueinandergehörig erschienen, hatten meine Neugierde geweckt, und ich schlug den Weg in die Altstadt ein. Doch der Zufall wollte es, daß ich weder den Platz noch den Turm zu Gesicht bekam.
Ist es wirklich ein Zufall gewesen? Ich habe gehört, daß es möglich ist, Schiffe aus einer Entfernung von vielen Kilometern durch elektrische Wellen in Bewegung zu setzen und zu lenken. Welche unbekannte Kraft hat damals mich gelenkt, daß ich vergaß, was ich suchte; und durch die winkeligen Gassen der Altstadt ging, als hätte ich noch immer ein bestimmtes Ziel vor Augen? Daß ich in ein Haustor eintrat, — es war ein Durchhaus, und ich gelangte auf einen kleinen Platz, in dessen Mitte ein steinerner Heiliger stand, und rings um ihn hatten Wurstwaren- und Gemüsehändler ihre Verkaufsbuden, — ich überquerte den Platz, stieg eine Treppe empor, bog in eine Seitengasse ein und dann blieb ich vor einem Antiquitätenladen stehen. Ich glaubte, ein Schaufenster zu sehen, und wußte nicht, daß ich in die Zukunft blickte. Aber warum mir damals ein unbekannter Wille diesen Blick in die Zukunft gewährte, dafür kann ich auch heute noch keine Erklärung finden.