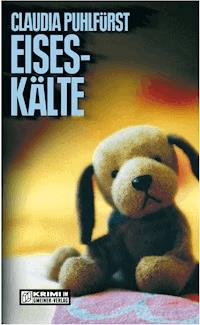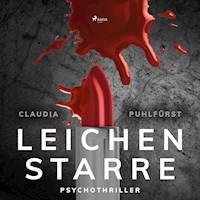Der Sensenmann: Ein Fall für Lara Birkenfeld 2 – Eine toughe Reporterin im Visier eines brutalen Serienkillers E-Book
Claudia Puhlfürst
5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lara Birkenfeld ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sie sollen am eigenen Leib erfahren, was sie ihm angetan haben … Der Psychothriller »Der Sensenmann« von Claudia Puhlfürst als eBook bei dotbooks. Mit der Erinnerung kommt der Hass, mit dem Hass die Gewalt – und für einen skrupellosen Killer ist sie der einzige Weg in die Freiheit … In einem verlassenen Plattenbau wird eine bis zur Unkenntlichkeit verweste Leiche gefunden. Während die Polizei noch im Dunkeln tappt, beginnt die brillante Journalistin Lara Birkenfeld zu ermitteln. Sie spürt eine seltsame Nähe zum Täter und ahnt, dass er auf einem Rachefeldzug ist. Schon bald findet Lara eine Spur, die bis in die 70er Jahre zurückreicht und zu einem längst geschlossenen Kinderheim führt. Doch Laras Recherchen gehen nur mühsam voran – und der Sensenmann ruht nicht … »Claudia Puhlfürst ist eine der besten deutschen Psychothriller-Autorinnen!« Westfalenblatt Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der schockierende Thriller »Der Sensenmann« von Claudia Puhlfürst ist der zweite ihrer Reihe um die fähige Journalistin Lara Birkenfeld. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mit der Erinnerung kommt der Hass, mit dem Hass die Gewalt – und für einen skrupellosen Killer ist sie der einzige Weg in die Freiheit … In einem verlassenen Plattenbau wird eine bis zur Unkenntlichkeit verweste Leiche gefunden. Während die Polizei noch im Dunkeln tappt, beginnt die brillante Journalistin Lara Birkenfeld zu ermitteln. Sie spürt eine seltsame Nähe zum Täter und ahnt, dass er auf einem Rachefeldzug ist. Schon bald findet Lara eine Spur, die bis in die 70er Jahre zurückreicht und zu einem längst geschlossenen Kinderheim führt. Doch Laras Recherchen gehen nur mühsam voran – und der Sensenmann ruht nicht …
»Claudia Puhlfürst ist eine der besten deutschen Psychothriller-Autorinnen!« Westfalenblatt
Über die Autorin:
Claudia Puhlfürst, Jahrgang 1963, wurde in Zwickau geboren. Nach dem Studium der Biologie und Chemie war sie lange Zeit als Lehrerin und Dozentin tätig. Zu ihren Spezialgebieten gehören nonverbale Kommunikation und die Humanethologie, die menschliche Verhaltensforschung. Für ihre Thriller ist sie deutschlandweit bekannt. Sie ist Organisatorin der Ostdeutschen Krimitage und Mitglied bei den »Mörderischen Schwestern«, einem Verein, der von Frauen verfasste deutschsprachige Kriminalliteratur fördert.
Claudia Puhlfürst veröffentlichte bei dotbooks die Psychothriller-Reihe um Lara Birkenfeld: »Der Totschneider«, »Der Sensenmann« und »Der Tätowierer«.
Die Website der Autorin: www.puhlfuerst.com
***
eBook-Neuausgabe April 2020
Dieses Buch erschien bereits 2011 unter dem Titel »Sensenmann« bei Blanvalet.
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Blanvalet Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: © HildenDesign, München unter Verwendung mehrerer Fotos von Shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96148-978-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Sensenmann« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Claudia Puhlfürst
Der Sensenmann
Psychothriller
dotbooks.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Prolog
Die Stille vor den Plattenbaublöcken wird von Motorengebrumm gestört. Mit toten Augen starren die leeren Fenster der Häuser auf die beiden Fahrzeuge, die direkt vor dem mittleren Kubus parken. Vier Männer steigen aus, Bauarbeiter in Blaumännern, mit staubigen Stiefeln. Ihre Helme baumeln an ihren Armen, ihre Gespräche durchbrechen polternd die Stille. Das Haus scheint sich kurz zu schütteln und wirft seine Hitzestarre ab. Vielleicht ist es auch nur das Flirren heißer Luft über dem Betonklotz, der schon morgen abgerissen werden soll.
Der Größte, ein Zwei-Meter-Hüne, beschirmt die Augen mit der flachen Hand, blickt nach oben und mustert das leerstehende Gebäude, das sie gleich betreten werden, nichts ahnend von dem, was sie dort erwartet.
Überall liegen Glassplitter herum. In den unteren zwei Stockwerken fletschten die gezackten Ränder eingeworfener Scheiben drohend die Zähne. Der Bautrupp jedoch marschiert unbeeindruckt drauflos, ihre Stiefel wirbeln lehmgelbes Pulver aus ausgetrockneten Pfützen hoch, der Staub scheint eine Weile in der Luft zu schweben und sinkt erst ab, als die vier schon im linken Eingang verschwunden sind.
Den Gestank bemerken sie erst im vierten Stock. Einer zieht ruckartig die Luft ein wie ein schnüffelnder Hund, dann fällt es auch den anderen auf. Eine Wolke aus Verwesung und ranzigem Fleisch, die umso stärker wird, je näher sie dem Ende des Flurs kommen. Die Bauarbeiter schauen sich an, bleiben schließlich stehen, versuchen durch den Mund zu atmen.
»Wahrscheinlich ein toter Vogel?« Es klingt wie eine Frage.
»Das will ich hoffen.« Der Zwei-Meter-Mann setzt sich in Bewegung. »Schauen wir nach.« Er glaubt nicht, dass diese massiven Ausdünstungen von einem toten Kleintier verursacht werden. Das, was da verrottet, muss größer sein. An der hintersten Wohnungstür wird der Gestank unerträglich. Der kleine Dicke, der sich gewünscht hat, es möge bloß ein toter Vogel sein, schluckt mehrmals. »Ich kann das nicht.«
»Dann bleibst du mit Manfred hier draußen.« Der Große hat das Ruder an sich gerissen. Er ist hart im Nehmen. »Holger und ich gehen rein.«
Holger nickt und streift sich die dicken Handschuhe über, ehe er den Knauf berührt. Die Tür ist nur angelehnt und schwingt langsam nach innen. Ein heißer Schwall faulig-stechender Luft quillt heraus, legt sich wie ein fettiger Film auf die Atemwege. Der Große hustet kurz. »Bringen wir es hinter uns.«
Aus der halboffenen Badezimmertür surren fette Fliegen. Ihre Körper schillern im Licht in allen Regenbogenfarben. Dem Lärm nach zu urteilen, müssen es Tausende sein. Holger schaut zuerst um die Ecke, prallt zurück. Dann schlägt er die Hand vor den Mund, würgt und taumelt rückwärts. Der Zwei-Meter-Mann denkt noch darüber nach, dass seine Kollegen alle miteinander Weichlinge sind, ehe auch er sieht, was da in der Badewanne liegt, bedeckt von diesem wimmelnden Teppich aus Fliegen und Maden, der den Anschein erzeugt, das verwesende Etwas, das einmal ein Mensch gewesen ist, vibriere im Takt des Summens.
Kapitel 1
Grell blendeten die aufflackernden Neonlampen. Matthias Hase kniff die Augen zusammen und öffnete sie gleich wieder. Das Kunstlicht verlieh seiner Haut jedes Mal eine kränkliche Farbe, und doch wollte er im Badezimmer keine andere Beleuchtung. Er trat an das Waschbecken heran, seifte die Hände gründlich ein und erwiderte dabei im Spiegel seinen eigenen kritischen Blick. Unter den Augen hatte die Haut einen bläulichen Schimmer. Und es zeigten sich feine Knitterfältchen, die man nur sah, wenn man so dicht vor dem Spiegel stand, dass er beschlug. Sein Mund hatte einen wehmütigen Zug, und Matthias Hase zog probehalber die Mundwinkel nach oben. Weil die Augen nicht mitlächelten, wirkte es ein wenig gezwungen. Er stellte das Wasser ab und griff nach dem Handtuch, ohne den Blick vom Spiegel zu nehmen. Der vierzigjährige Mann, der ihm entgegenschaute, war attraktiv, ohne schön zu sein. Er hielt seinen Körper in Schuss, trieb regelmäßig Sport und achtete auf seine Ernährung. Seine Haare waren in den Jahren weder schütter noch merklich grau geworden, was daran liegen mochte, dass sie blond waren. Auch von auffälligen Falten war er bisher verschont geblieben. Das Schicksal hatte es gut gemeint mit seinem Äußeren. Ihm fehlte ein bisschen Schlaf, aber das war auch schon alles.
Nachdenklich ging er zurück ins Wohnzimmer. Es war Zeit für sein abendliches Ritual: zuerst die Nachrichten und dann das Abendbrot.
»Einzelhaft, Schläge, Vergewaltigungen. In einem Heim auf der Kanalinsel Jersey wurden Waisenkinder über Jahre hinweg systematisch gequält. Nach ersten Vermutungen soll es sogar Tötungen gegeben haben.« Die Fernsehkamera schwenkte langsam von dem hellen Mittelgebäude über ein davor aufgebautes weißes Zelt zu einem der beiden spitzgiebeligen Seitenteile und glitt dann von oben nach unten über die braunroten Natursteine und die in viele Fächer geteilten Fenster.
Matthias Hase legte die Fernbedienung wieder zurück auf den kleinen Beistelltisch und beugte sich nach vorn, als habe er Witterung aufgenommen.
»Alles fing damit an, dass der Keller des heute als Jugendherberge genutzten Hauses marode war und modernisiert werden sollte.« Jetzt kam die Reporterin ins Bild. Sie hielt ein zottiges Mikrofon in der Rechten. Ihre blonden Haare wurden vom Wind zerzaust. Mit der linken Hand zeigte sie auf das altertümliche Gebäude im Hintergrund.
»Bei diesen Sanierungsarbeiten wurden erste Knochenteile entdeckt. Die hinzugezogene Polizei suchte den Keller des viktorianischen Gebäudes daraufhin mit Spürhunden ab ...«, die Reporterin machte eine dramatische Pause, »... und wurde fündig.« Das Bild zweier Männer in den typischen weißen Anzügen der Spurensicherung wurde eingeblendet. Sie hockten auf dem Boden, umgeben von gelben Tüten, und kratzten im Beton.
Matthias Hase versuchte zu schlucken, aber sein Mund war eine Wüste. Er konnte den Blick nicht vom Bildschirm abwenden.
»Die auf Leichengeruch spezialisierten Hunde schlugen über einer massiven Betonschicht an. Darunter fand man den Schädel eines Kindes, das vermutlich in den achtziger Jahren starb. Dicht daneben wurden Stoffreste, ein Knopf und eine Haarspange entdeckt. Die Fundstücke sind mittlerweile zu forensischen Untersuchungen aufs britische Festland gebracht worden. Die Polizei sucht inzwischen mit Spezialausrüstung nach weiteren Leichen; vor allem in einem zugemauerten Kellerraum; denn hier, im Keller, so berichten ehemalige Insassen, wurden die Kinder bei schlechtem Betragen eingesperrt.«
Das Foto der Spurensicherer verschwand und wurde durch eine Grafik der Räume ersetzt. Von oben konnte man sehen, dass die Gebäudeteile zu einem Rechteck mit Innenhof angeordnet waren. Das helle Frontgebäude, vor dem das weiße Zelt stand, schien nachträglich zwischen die langen Seitenflügel eingefügt worden zu sein. Der rückwärtige Trakt war breiter. An der linken oberen Ecke stand das Wort skull. Matthias musste nicht auf die erklärende Stimme der blonden Reporterin warten, um zu wissen, was das hieß. Dort war also der Schädel gefunden worden.
Vor der rechten Längsfront – er konnte nicht verhindern, dass in seinem Kopf jemand die Anzahl der Fenster zählte – waren zwei kleinere, halbrunde weiß-blaue Aufblaszelte und das Wort cellar eingezeichnet. Cellar hieß Keller. Matthias Hase hatte in Englisch immer gut aufgepasst. Sein Mund war noch immer trocken, und er sehnte sich nach etwas zu trinken, konnte aber jetzt nicht aufstehen. Zuerst musste er diesen Bericht bis zum Schluss ansehen.
»Auch außerhalb des Gebäudes werden mit den Hunden sechs hot spots untersucht, an denen Leichenteile vermutet werden.« Hinter dem linken Seitenflügel zeigten zwei Pfeile auf das Wort pits – Gruben.
»Der Leiter der Suchaktion, Jerseys stellvertretender Polizeichef Sam Lowell, bestätigte, dass die Polizei mit Listen mit den Namen vermisster Kinder arbeitet.« Die Grafik verschwand und die Reporterin erschien wieder im Bild. Der Wind wehte jetzt offenbar stärker, denn Matthias hatte das Gefühl, sie müsse sich regelrecht dagegenstemmen.
»Die mutmaßlichen Morde an den Heimkindern sollen in der Zeit von 1960 bis zum Jahr 1986, als das Kinderheim geschlossen wurde, geschehen sein. Die Ermittler gehen überdies davon aus, dass außer Tötungen hier auch zahlreiche andere Straftaten stattgefunden haben. Heimkinder wurden sexuell missbraucht, gequält, eingesperrt, geschlagen.« In Matthias' Kopf bildeten die Worte der Reporterin einen Strudel, der immer schneller kreiselte und alle klaren Gedanken zu verschlingen drohte.
»Bereits vor fünf Jahren hatte man hier bei Bauarbeiten Knochen gefunden. Diese wurden jedoch für Tierknochen gehalten – obwohl man sie in unmittelbarer Nähe zu Kinderschuhen gefunden hatte. Angesichts der sich anbahnenden Morduntersuchung versucht die Polizei jetzt, diese Knochen wiederzufinden, damit sie noch einmal untersucht werden können.« Die Reporterin hielt kurz inne und holte tief Luft. Hinter ihr kam Bewegung in das Bild. Ein blau-gelb gestreiftes Auto mit der Aufschrift Police rollte vor das Gebäude. Ein Mann mit neongelber Weste und Schirmmütze stieg aus, gefolgt von einem dunkel gekleideten Herrn. Beide verschwanden in dem weißen Zelt.
Die Journalistin erklärte unterdessen weiter. »Inzwischen haben sich mehr als achtzig ehemalige Insassen bei der Polizei gemeldet, unter ihnen auch Zeugen, die inzwischen im Ausland leben. Sie alle berichteten von systematischem Missbrauch im Haut de la Garenne.«
Matthias Hase spürte sein Herz pochen. Es hämmerte mit weit über hundert Schlägen und er überlegte, ob es womöglich schlappmachen würde. Ehemalige Insassen. Der Begriff schnürte ihm die Kehle zu. Er war selbst in so einer Einrichtung gewesen. Seine Erinnerung war verschwommen, aber er musste damals ungefähr acht Jahre gewesen sein. Seine kleine Schwester Mandy war zu dem Zeitpunkt erst vier gewesen. Jahrelanger Aufenthalt in einem Kinderheim prägte das ganze weitere Leben. Er war wie gelähmt. Seine Kaumuskeln schmerzten.
Nun wurde ein grobkörniges vergilbtes Foto, auf dem ungefähr vierzig Jungen in drei Bankreihen saßen, gezeigt. Am hinteren Rand stand ein Mann mit schwarzem Anzug und weißem Hemdkragen. Das Gesicht des Lehrers war ein verwaschener grauer Fleck, und doch vermeinte Matthias, die Bösartigkeit darin zu erkennen.
»Das Kinderheim Haut de la Garenne wurde 1867 als Schule für ›junge Menschen der unteren Klassen und vernachlässigte Kinder‹ gegründet. Zu Beginn besuchten nur Jungen die Institution. Sie waren zwischen sechs und fünfzehn Jahren alt. Erst ab dem Jahr 1959 nahm man auch Mädchen auf ...«
Jungen, Mädchen, vernachlässigte Kinder. Matthias schüttelte den Kopf und öffnete die Augen, die er, ohne es zu merken, geschlossen hatte. Das Boulevardmagazin hatte sich inzwischen anderen Themen zugewendet. Mühsam erhob er sich und tappte wie ein alter Mann in die Küche. Das Mineralwasser schmeckte nach Blut. Seine Unterlippe schmerzte. Er leckte mit der Zunge darüber und spürte an der Innenseite eine wunde Stelle. Was war in diesem Kinderheim auf Jersey geschehen? Und warum wühlte ihn das bis ins Innerste auf? Was war in seinem Kinderheim vor dreißig Jahren geschehen? Wo zum Teufel waren eigentlich alle seine Erinnerungen an diese Zeit?
Die Wasserflasche unter den Arm geklemmt, marschierte er ins Arbeitszimmer. Vielleicht würde eine Internetrecherche seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen.
Hastig tippten die Finger Kinderheim + »Ernst Thälmann« in die Suchmaschine. Fast 4000 Einträge erschienen. Es gab Einrichtungen mit dem Namen des Arbeiterführers in Dessau, Eisenhüttenstadt, Kyritz, Flöha, Pillnitz, Eilenburg und noch in vielen weiteren Städten. Zu einigen existierten sogar Foren und Weblogs. Es folgten Kinderheime in Ernst-Thälmann-Straßen und Heime, die in anderer Form mit dem Namen verknüpft waren.
Nur zu dem Kinderheim, in dem er und Mandy gewesen waren, fand sich nichts als zwei uralte Zeitungsmeldungen von der Schließung 1989. Keine »Ehemaligen-Seiten«, keine Foren.
Matthias betrachtete abwesend das Etikett der Wasserflasche. War das ungewöhnlich oder nicht? Da er nicht wusste, wie viele Heime mit dem Namen »Ernst Thälmann« es gegeben hatte, fiel es ihm schwer, das zu entscheiden. Sein Blick wanderte zu der Holzschatulle, in der er seine wenigen persönlichen Erinnerungen aufbewahrte. Er musste sie nicht öffnen, um zu wissen, was darin war: ein paar kleinformatige Fotos, Notizen, Briefe, eine Haarspange seiner Schwester Mandy.
Die Jahre im Heim waren ihm in der Erinnerung immer so nichtssagend wie die Schwarz-Weiß-Bilder in dem Kästchen erschienen, ein ewig gleicher Reigen von Schule, Hausaufgabenbetreuung, schlechtem Essen und mürrischen Erziehern. Was also hatte ihn vorhin an diesem Bericht über das Haut de la Garenne dann so aufgewühlt? Erinnerte ihn irgendein unwichtiges Detail der Berichterstattung an etwas? Er brauchte detaillierte Informationen, dann würde es ihm vielleicht wieder einfallen. Wie von selbst huschten die Finger über die Tastatur.
Schon seit Jahren hatte es im idyllischen St. Martins auf Jersey Gerüchte über Vorfälle in dem Kinderheim Haut de la Garenne gegeben. Die Gerüchte blieben jedoch immer ohne Folgen, bis im Jahre 2006 eine verdeckte Ermittlung zu dem vermuteten Kindesmissbrauch ihren Anfang nahm, in deren Folge immer mehr grausige Details ans Licht der Öffentlichkeit gelangten.
Ein ehemaliger Heimbewohner, der inzwischen verstorben ist, berichtete, Direktor Badham sei für seine Grausamkeit bekannt gewesen: »Er hat mich vor versammelter Mannschaft so lange mit dem Stock geschlagen, bis ich blutete. Einem Jungen hat er dabei einen Finger abgetrennt.«
Matthias schluckte mehrmals. In seinem Kopf lief ein Film ab, in dem ein Mann im schwarzen Anzug auf einen kleinen Jungen eindrosch. Wie lange musste man mit einem Rohrstock auf eine Hand schlagen, bis ein Finger abgehackt wurde?
Seit den Knochenfunden der vergangenen Woche haben sich bereits zehn weitere Personen gemeldet, die den sexuellen und körperlichen Missbrauch in dem Heim bestätigt und weiterführende Aussagen gemacht haben. Damit steigt die Zahl der Zeugen auf über hundert. Insgesamt wurden seit Beginn der Ermittlungen schon dreißig Verdächtige von der Polizei vernommen. Nur einer von ihnen wurde bisher angeklagt: Der ehemalige Wachmann Allan Waterford, der zehn Jahre in Haut de la Garenne tätig war, muss sich seit Januar wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht verantworten. Er wurde wegen sexueller Übergriffe in drei Fällen angeklagt, weil er zwischen 1969 und 1979 mehrere Mädchen unter 16 Jahren missbraucht haben soll.
Etwas flammte in Matthias' Kopf auf wie eine altertümliche Blitzlichtlampe und verlosch sofort wieder.
Laut den Angaben der Ermittler werde es immer deutlicher, dass sich möglicherweise noch Schlimmeres in dem ehemaligen Kinderheim abgespielt habe. Sie erhielten mehrere separate Hinweise, dass sich sterbliche Überreste von Kindern hier befinden könnten. Aus sicherer Quelle war zu hören, dass in den Kellerräumen verkohlte Knochenteile, Kinderzähne und Gegenstände, die wie Fußfesseln aussahen, gefunden worden seien. In einer Badewanne habe man eindeutige Blutspuren entdeckt.
Die Polizei vermutet, dass es sich um Folterkeller gehandelt habe, in denen mindestens fünf Kinder im Alter von vier bis elf Jahren brutal ermordet worden seien. Die Untersuchungen werden noch mehrere Wochen andauern. Erste Obduktionsergebnisse der gefundenen Leichenteile werden frühestens in vierzehn Tagen erwartet.«
Der nächste Link führte ins Nichts. Die Seite war nicht erreichbar. Matthias griff nach der Wasserflasche, um zu trinken, und stellte fest, dass sie leer war. Seine Hände zitterten. Eine Stimme in ihm flüsterte, er sollte den Computer ausschalten, sollte die schrecklichen Berichte vergessen, die Bilder verdrängen. Wenn er nicht damit aufhörte, würde es schlimme Folgen für ihn haben.
Nach dem Bericht eines ehemaligen Heimkindes, das in den 1960er Jahren dort untergebracht war, floh dessen damals 14-jähriger Freund Michael C. aus dem Heim und wurde nur kurze Zeit später erhängt an einem Baum aufgefunden. In zwei weiteren Fällen seien Jungen spurlos verschwunden. Man habe sie als vermisst gemeldet und es hieß: »Sie sind wieder nach Hause gegangen.« Der Zeuge sagte aus, dass ihm dies aus heutiger Sicht fraglich erscheint.
»Wissen Sie, das waren alles Kinder, die keiner wollte«, sagte ein ehemaliger Anwohner. »Jeder in St. Martin wusste, dass in dem Heim hart durchgegriffen wurde, aber nichts anderes wurde in der damaligen Zeit erwartet.« Er zieht das Fazit: »Es wundert mich eigentlich nicht, dass dort Kinder verschwunden sind. Sie waren ja schon fast verschwunden, als man sie dahin brachte.«
Ein Name loderte in dunkelroten Lettern vor Matthias' Augen: Peter. Dann machte irgendetwas in seinem Kopf Knack. Eine Tür ging auf. Es wurde dunkel.
Kapitel 2
Wasser ist ein gutes Mittel, um Menschen zu quälen. Es hinterlässt keine körperlichen Spuren und ist damit eine klassische Methode der »weißen Folter«. Wasser gibt es überall. Man kann es leicht beschaffen und einfach wieder loswerden, und es bedarf keiner aufwändigen Vorbereitungen.
Die Möglichkeiten, jemanden mittels Wasser zu foltern, sind so vielfältig wie ihre Anwender. Die Inquisition zwang ihre Opfer zum Trinken. Maßkrug um Maßkrug wurde dem gefesselten Delinquenten eingeflößt, sechs Liter bei der »kleinen Wasserfolter«, zwölf bei der großen, bis sein Bauch schier zu platzen drohte und er gestand, was immer die Peiniger von ihm verlangten. Eine verfeinerte Form wurde »chinesische Wasserfolter« genannt, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass sie tatsächlich in China erfunden wurde. Analog zu einem stetig fallenden Wassertropfen, der einen Stein höhlen kann, zurrte man die Opfer in Vorrichtungen fest, das Gesicht nach oben gerichtet, damit sie die Tropfen sehen konnten, die ihnen über Stunden und Tage hinweg auf das Gesicht fallen würden, ein stetiges Tröpfeln eisigen Regens.
Der »Tauchstuhl«, ein Gerät, das im Mittelalter vordergründig zur Bestrafung »zänkischer Weiber und Huren« diente, bestand aus einem Hocker, der an einem langen Balken befestigt war. Das Opfer wurde darauf festgebunden und dann langsam ins Wasser hinabgelassen, bevorzugt in schlammige, faulige Tümpel, bis der Scheitel bedeckt war. Man konnte die Gefesselten nach Belieben wieder herausziehen, zur Besinnung kommen und wieder hinabtauchen lassen. »Waterboarding« wird bis in die heutige Zeit von verschiedenen Geheimdiensten angewendet. Das Opfer wird so fixiert, dass sich sein Kopf tiefer als der Körper befindet. Ein saugfähiges Tuch über dem Gesicht wird ständig mit Wasser übergossen. Die Atmung des Gefolterten ist stark erschwert, das Gefühl zu ertrinken nimmt überhand, schon nach wenigen Minuten erlischt der Widerstand.
Noch bessere Ergebnisse erzielt man mit heißer oder gar kochender Flüssigkeit, doch nur kaltes Wasser hinterlässt keine Spuren beim Gefolterten.
Matthias Hase warf den Knebel auf den Boden und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Die Gestalt vor ihm lag wie ein nasser Sandsack auf den schmutzigen Fliesen. Die Augen hatte der Mann geschlossen. Leises Wimmern zeigte, dass er bei Bewusstsein war. Eine Fliege surrte durch die halbgeöffnete Tür.
»Steh auf. Du bist nicht verletzt, also hoch mit dir.« Matthias trat gegen die Speckwülste an der Hüfte des Mannes, doch der krümmte sich nur stärker zusammen und schniefte. Von selbst würde der Typ sich nicht erheben. Er würde nachhelfen müssen.
Jetzt bewegte sich der Gefangene leicht, drehte den Kopf zur Seite und schielte nach oben. »Lassen Sie mich frei, bitte. Ich habe Ihnen doch gar nichts getan!« Das weinerliche Gewinsel ging Matthias auf die Nerven. Wenn es um ihre eigene Gesundheit ging, wurden sie alle wehleidig. Er packte die auf dem Rücken gefesselten Arme und zerrte den Fettwanst in eine hockende Position. Der Mann öffnete die Augen, sah die Badewanne und die leeren Kanister daneben und heulte auf. Er schien zu ahnen, was ihm bevorstand. Matthias überprüfte die Fesseln und schob den Gefangenen näher an die Badewanne heran. »Schau ruhig hinein! Ich habe genug Wasser aufgefüllt!« Das Winseln wurde zu einem Schluchzen. Gelber Rotz lief aus der Nase des Mannes. Matthias wandte den Blick ab und unterdrückte den Brechreiz. Er musste anfangen, bevor sein Gefangener wieder zu Kräften kam. Mit dem ganzen Körper drückte er den Mann dicht an die Wanne, packte dann die fettigen Haare und drückte den Kopf ins kalte Wasser.
***
Dienstag, der 14.07.
Liebe Mandy,
wahrscheinlich wirst Du diesen Brief nie zu Gesicht bekommen. Wenn Du ihn aber liest, ist entweder irgendetwas verdammt schiefgegangen, oder ich habe meine Vorhaben geschafft.
Ein Anfang ist jedenfalls gemacht – einen von ihnen habe ich gefunden und bestraft. Davon will ich hier berichten, und da Du mir immer am nächsten gestanden hast, sollst Du auch als Einzige davon erfahren.
Vielleicht erinnerst Du Dich nach all den Jahren längst nicht mehr, vielleicht denkst Du aber auch täglich an mich – so wie ich an Dich –, meine kleine Schwester. Eigentlich kann man diese Vergangenheit nicht vergessen, unsere gemeinsame Vergangenheit, man kann sie nur verdrängen; und manchmal wünschte ich mir, ich könnte das auch. Andererseits muss es aber jemanden geben, der Rechenschaft ablegt, der sich an jedes Detail erinnert. Und derjenige bin anscheinend ich. Das ist einerseits gut so, andererseits eine schwere Bürde. Wie gern würde ich auch Dir ein wenig von dem Kummer nehmen, indem ich Dir schon jetzt diese Nachricht von meiner – unserer – Rache zukommen lasse, aber das wäre in diesem frühen Stadium zu gefährlich. Ich habe noch so viel zu erledigen, und ich möchte nicht, dass meine weiteren Vorhaben gefährdet werden. Nicht durch Dich, meine Kleine – nie könnte ich glauben, dass Du mich verrätst! –, aber durch unglückliche Umstände, Zufälle, Neugier anderer könnten die Pläne ans Licht kommen. Und das darf nicht geschehen, bevor ich mich dem Ziel nähere.
Jetzt, meine liebe Mandy, jetzt aber will ich Dir endlich vom ersten Schritt berichten! Sicher bist Du schon gespannt, wen ich mir als Erstes vorgenommen und wie ich ihn bestraft habe ... Ist Dir Siegfried Meller noch gegenwärtig? »Fischgesicht« nannten wir ihn im Geheimen, weil er diese hervorstehenden Augen hatte und seine aufgequollenen, viel zu roten Lippen immer ein erstauntes »O« formten. Eigentlich sah er ganz harmlos aus, fast ein bisschen dumm, was er nicht war. Er liebte Wasser in jeder Form, dieses Schwein. Daran erinnerst Du Dich aber noch? (Oder vielleicht hast Du aus gutem Grund gerade das »vergessen«?)
Es tut mir sehr leid, wenn dies alles durch meinen Brief wieder in Dir aufgewühlt wird, aber vielleicht tröstet es Dich, dass Fischgesicht seine gerechte Strafe bekommen hat.
Als ich ihn endlich aufgespürt hatte – wie, ist nicht weiter wichtig, entscheidend ist nur, dass ich ihn aufgestöbert habe – da musste ich feststellen, dass Meller sich nach fast dreißig Jahren gar nicht groß verändert hatte. Du hättest ihn bestimmt auch wiedererkannt. Noch immer glotzten diese wässrig blauen Augen aus dem aufgedunsenen Gesicht. Dazu der widerliche Mund! Am liebsten hätte ich ihm sofort die Faust in die Fresse – entschuldige bitte den Kraftausdruck – gehauen, aber ich konnte mich dann doch beherrschen. Schläge wären für ihn viel zu einfach gewesen. Nein, mein Plan sieht vor, dass jeder auf die Art und Weise bestraft wird, die er damals selbst angewandt hat. Und Mellers Strafe musste mit Wasser zu tun haben, das ist doch klar, oder? Erinnerst Du Dich noch an das, was wir »chinesische Wasserfolter« nannten? Wie er uns immer und immer wieder den Kopf unter Wasser gedrückt hat? Nein? Vielleicht ist es besser so. Es war grausam. Meller jedoch liebte es, weil es keine sichtbaren Spuren an seinen Zöglingen hinterließ. Nichts, was man hätte vorzeigen können. Keiner hätte uns geglaubt.
Ich hatte ziemlich lange mit den Vorarbeiten zu tun. Denn natürlich habe ich ihn nicht sofort besucht, nachdem ich endlich herausgefunden hatte, wo das Schwein wohnt. Ich musste zuallererst einen geeigneten Ort finden, an dem er und ich genügend Zeit miteinander hätten, ohne dass uns jemand störte. Die abbruchreifen Plattenbaublöcke am Rande Leipzigs waren für meine Pläne wie geschaffen. Wenn ich Glück hatte, würden sie die Betonklötze einfach abreißen, würden Mellers Leiche unter Bergen von Schutt begraben und seine zertrümmerten Knochen auf eine Halde fahren. Wenn nicht – auch egal. Es kommt ja nicht darauf an, dass man die Leichen niemals findet. Natürlich ist es von Nutzen, wenn die Überreste nicht gleich entdeckt werden. Schließlich brauche ich noch Zeit, um mich um die anderen zu kümmern. Wenn sie mich zu schnell erwischen, schaffe ich nicht alle.
Aber ich rede zu viel. Vielleicht, weil ich möchte, dass Du mich verstehst.
Kanister für Kanister habe ich nachts in den vierten Stock geschleppt, einen Aufzug gab es nicht, und das Wasser war ja längst abgestellt. Bestimmt kannst Du Dir vorstellen, was das für eine Arbeit war! Aber die Mühe hat sich gelohnt!
Nach den Vorbereitungen bin ich zu ihm gefahren. Er wohnte ganz allein in Wurzen. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, er hat gewohnt. Eigentlich müsste man doch annehmen, dass ein Mensch mit so einer Vergangenheit misstrauisch ist, aber weit gefehlt! Ein Paket – da öffnet man doch gern seine Tür. Danach war alles ganz einfach. Schließlich bin ich mindestens fünfunddreißig Jahre jünger als das Schwein. Und ich habe seit Jahren im Fitnessstudio auf Kraft trainiert. Ehe er es sich versah, hatte ich die Pistole auf ihn gerichtet, ihn in seine verlotterte Küche gedrängt und gefesselt. Dass es nur eine, zugegebenermaßen ziemlich echte Nachbildung einer Pistole war, hat er in seiner Angst gar nicht bemerkt.
Liebe Mandy, Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als es ihm endlich dämmerte, wer ich bin! Urkomisch war das. Er hat so sehr gezittert, dass sogar sein Gebiss angefangen hat, zu klappern. Ich musste ein wenig lachen. Ein Karpfen mit Gebiss! Natürlich hat er nichts bereut. Das hatte ich auch nicht erwartet, nicht bei Fischgesicht. Zuerst hat er so getan, als sei alles gar nicht wahr, hat versucht, meine Erinnerungen zu diffamieren, ein Kind könne sich doch nicht an alles genau entsinnen, ich würde ihn verwechseln ... Als er gemerkt hat, dass ich mich nicht in die Irre führen lasse, ist er umgeschwenkt und hat mir zu erklären versucht, dass seine Methoden dazu dienten, uns zu disziplinieren. Schließlich hätten er und die anderen Erzieher es nicht leicht mit uns gehabt. Was für ein Hohn! Uns, den Kindern, den schwarzen Peter zuzuschieben!
Das hat mich dann ziemlich wütend gemacht, wie Du Dir bestimmt vorstellen kannst. Als er sein Blut gesehen hat, war es ganz vorbei mit seiner Contenance. Er hat so sehr geheult, dass ihm der Rotz aus der Nase lief.
Danach war er bewusstlos und ich musste ihn in die Garage tragen. Ich fand es besser, ihn mit seinem Wagen zu transportieren, der Spuren wegen – Du verstehst? – auch wenn das bedeutete, dass ich in der nächsten Nacht zu seinem Haus zurückfahren und seinen dicken Wagen wieder in der Garage parken musste. Kein Problem das Ganze, es gab ja niemanden, der zu Hause auf ihn gewartet hätte.
Vor den Plattenbaublöcken ist er wieder aufgewacht und hat richtig Schiss gekriegt. Wahrscheinlich ahnte er, was in dem leerstehenden Gebäude auf ihn zukommen würde, aber das war genau das, was ich wollte. Ebendiese Furcht vor dem Unbekannten, vor drohenden Strafen, die Angst vor den Schmerzen; Meller sollte genau das fühlen, was wir damals im Vorfeld seiner Bestrafungen gefühlt haben.
Als wir endlich oben angekommen waren, lief mir der Schweiß in Strömen herunter, und ich musste erst einmal verschnaufen. Mit weit aufgerissenen Augen hat er dann die Badewanne und die Kanister betrachtet. Wahrscheinlich ist ihm erst da wirklich aufgegangen, was gleich mit ihm passieren würde. Trotzdem habe ich mir die Zeit genommen, ihm noch einmal ausführlich zu erklären, was ich mit ihm vorhatte. An seinen Augen konnte ich erkennen, dass er sich erinnerte. Er wusste ganz genau, was er damals mit Dir, mit mir und mit all den anderen im Keller gemacht hatte, auch wenn er fast bis zum Ende alles abgestritten hat. Die Badewanne war dem Waschkessel von damals nur entfernt ähnlich, aber das spielte keine Rolle. Meller sah sie, bemerkte das Wasser darin, erblickte die Tücher und Fesseln und wusste, was geschehen würde. Seine Glotzaugen quollen wie zwei trübe Glasmurmeln noch weiter aus dem verfetteten Gesicht hervor.
»Ein Fisch muss schwimmen!«, habe ich zu ihm gesagt, aber er hat mich nur angestiert, das Maul halb offen. Kann es sein, dass er den Spitznamen, den wir ihm verliehen hatten, gar nicht kannte?
Als sein Kopf das erste Mal unter Wasser tauchte, sah ich die kleine Heike vor mir. Sie war noch nicht mal sechs Jahre alt, als er sie sich das erste Mal geholt hat.
Dann begann Fischgesicht zu zappeln, und ich drückte seinen Kopf fester unter die Wasseroberfläche.
Ich habe es gesehen. Als die kleine Heike aus dem Keller zurückkam, war ihr Blick wie tot, und sie ist gelaufen wie einer dieser Blechroboter zum Aufziehen. Es hat Tage gedauert, bis sie wieder mit uns gesprochen hat. Wahrscheinlich erinnerst Du Dich nicht daran, denn Du warst damals ja auch noch ziemlich klein, und ich habe, so gut es ging versucht, Dich von solchen Erlebnissen fernzuhalten.
Mellers Zappeln wurde schnell schwächer. Ich zählte bis fünfzehn und zog seinen Kopf dann mit einem Ruck aus dem Wasser. Er röchelte und hustete. Es klang genauso wie bei uns, wenn das Gesicht aus dem Waschkessel auftauchte. Da wusste ich, dass er das Gleiche empfand wie die kleine Heike und all die anderen Kinder, die er aus purer Lust am Quälen gepeinigt hatte. Diese Panik, wenn man keine Luft bekommt, wenn die Kehle immer enger wird, wenn der Brustkorb sich zusammenzieht, wenn man weiß, man muss den Mund geschlossen halten, und es doch nicht beherrschen kann. Dann dieses schreckliche Gefühl, nach Luft zu schnappen und Wasser einzuatmen – Todesangst.
Ich gab ihm ein paar Sekunden Zeit, dann drückte ich seinen Kopf wieder unter Wasser. Nachdem wir das viermal wiederholt haben, hat Meller irgendwie aufgegeben. Dann hat er sich nassgemacht. Irgendwann war plötzlich Ruhe. Ich habe ihn noch exakt fünf Minuten untergetaucht, um sicher zu sein, dass er auch wirklich tot war.
Zum Schluss habe ich das Wasser abgelassen und ihn so da liegen lassen. In einer leeren Badewanne.
Die nächsten Schritte sind nicht mehr ganz so einfach. Zuerst muss ich die anderen Scheusale finden, eines nach dem anderen. Ich hoffe nur, sie leben noch alle. Einige waren damals ja schon älter. Aber ich schwöre Dir, dass ich alles dafür tun werde, um unsere Rache zu vollenden. ALLES.
Meine liebe Mandy, mit diesem Versprechen möchte ich meinen Brief beenden. Ich werde ihn an einem sicheren Ort verwahren, bis es an der Zeit ist, ihn abzuschicken.
In Gedanken bin ich immer bei Dir, meine Kleine. Ich bin mir sicher, Du spürst das.
Bis bald.
Ich liebe Dich.
Dein Matthias
Kapitel 3
Lara Birkenfeld wischte sich mit dem nackten Unterarm über die Stirn. Die Redaktionsräume glichen einer Sauna. Seit Tagen lag eine glühende Hitze über der Stadt, die den Aufenthalt in den Büros schon vormittags unerträglich machte. In ihrem Kopf verwoben sich das hämmernde Geräusch der Tastaturen, das unverständliche Murmeln an den Telefonen und das Rattern des Faxgerätes zu einer Kakophonie des Schmerzes.
Sie stand auf, um eines der Fenster zu öffnen, und lehnte sich einen Augenblick hinaus. Die Sonne brannte ihr entgegen. Hinter Lara kicherte Isabell ihr albernes Kleinmädchenlachen. Wie eine heiße Wand aus zähem Honig stand die Luft vor dem Gebäude. Lara schloss das Fenster wieder und seufzte. Wenn sie jetzt noch einen Kaffee trank, würde ihr Kopf wahrscheinlich wie ein überdehnter Luftballon platzen. Die Klimaanlage brachte auch nichts. Es zog höchstens an allen Ecken und Enden, und am nächsten Tag waren garantiert drei Leute heiser.
Lara setzte sich auf ihren Drehstuhl, starrte auf den Bildschirm und dachte an ihren Urlaub und dass sie es noch immer nicht geschafft hatte, sich für ein Reiseziel zu entscheiden. Am Ende würde es wieder irgend so eine Last-Minute-Reise werden, an die sie sich im Nachhinein gar nicht mehr richtig entsinnen konnte.
Ihr gegenüber zuckte Tom plötzlich unmerklich zusammen. Sein Blick huschte hin und her, danach beugte er sich nach vorn und schob seinen Kopf dichter an den Monitor. Lara kannte die Anzeichen. Eine interessante Meldung war hereingekommen, und Tom wollte der Erste sein, der sie las, um den Artikel an sich reißen zu können. Es konnte eigentlich nur eine unerwartete Agenturnachricht oder ein Computerfax von der Polizei sein. Ohne den Oberkörper zu bewegen, drückte Lara leise ein paar Tasten und hatte die Nachricht auf dem Bildschirm.
Leichenfund in Abbruchhaus. Todesursache unbekannt.
Lara konnte Tom schnaufen hören, während sie den kurzen Text überflog. Vier Bauarbeiter hatten in einem leerstehenden Plattenbaublock, der diese Woche abgerissen werden sollte, eine verweste Männerleiche gefunden. Allerdings würde man die Obduktion abwarten müssen, um festzustellen, ob es sich um ein Tötungsdelikt, einen Unfall oder Selbstmord handelte.
Vor Laras innerem Auge tauchte das Plattenbaugebiet im Südwesten der Stadt auf. Ein Viertel, in dem vor der Wende zehntausende Menschen gewohnt hatten. Jetzt waren viele Wohnungen verwaist, und es hatte ein Prozess begonnen, den man »Rückbau Ost« nannte.
Tom schnaufte jetzt leiser. Seine Nasenspitze zuckte so wie immer, wenn er Witterung aufgenommen hatte, wenn er die Möglichkeit sah, einen Vorteil für sich herauszuschinden. Wahrscheinlich wappnete er sich schon mit Argumenten, warum er und nicht seine Kollegin Lara Birkenfeld über diesen Fall berichten müsste. Dabei war das gar nicht sein Ressort. Aber das hatte Tom noch nie interessiert.
Das Pochen in Laras Kopf verstärkte sich. Wenn die Tagespresse ihre Leser über die »Plattenbauleiche« informierte, dann war das ihre Aufgabe. Jetzt hatte sie dem Fall schon einen Namen verpasst. »Plattenbauleiche« – das klang seltsam pedantisch, so als wäre der Tote nie ein lebendiger Mensch mit Wünschen und Träumen gewesen.
Tom lehnte sich zurück, bemerkte, dass seine Kollegin ihn beobachtete, setzte ein schnelles Grinsen auf und ging sofort zum Angriff über. »Du siehst geschafft aus!«
»Findest du? Mir fehlt nichts.« Lara hatte keine Lust, mit ihm über die Hitze oder ihre Kopfschmerzen zu diskutieren und das geheuchelte Mitleid zu ertragen, das sich in Schadenfreude verwandelte, sobald sie ihm den Rücken kehrte.
»Hast du heute noch Außentermine?« Tom deutete mit dem Kinn in Richtung Fenster.
»Bis jetzt noch nicht. Warten wir die Redaktionskonferenz ab. Und du?«
»Ich muss nachher zur Neueröffnung des Mehrgenerationenhauses in Grünau. Ein paar städtische Prominente habe ich im Vorfeld schon interviewt. Daraus machen wir morgen ein Meinungsbild.«
»Ach ja. Wie schön.« Lara griff nach ihrer Wasserflasche, während sie beschloss, so bald wie möglich Kriminalobermeister Schädlich anzurufen und ihn ein bisschen wegen der Plattenbauleiche auszuhorchen. Kampflos würde sie Tom das Feld nicht überlassen.
»So liebe Kollegen.« Gernot Hampenmann straffte den Rücken und legte beide Handflächen auf die Tischplatte. »Dann wollen wir mal. Zuerst der Wochenfahrplan.« Im Eiltempo ging der Redaktionsleiter die Termine durch, vermerkte die diensthabenden Journalisten und teilte ihnen Fotografen zu.
»Und nun die neu reingekommenen Sachen.«
»Hampelmann« machte seinem Spitznamen alle Ehre. Er konnte einfach nicht stillsitzen. Sein Oberkörper bewegte sich vor und zurück, und die Hände flogen wie zwei aufgescheuchte Tauben durch die Luft, während er sprach. Ohne dass sie hinsehen musste, wusste Lara, dass auch seine Dackelbeine unter dem Tisch hin- und herschwangen, wobei die Fußspitzen den Boden gerade so berührten.
»Da hätten wir als Erstes die Protestdemonstration zur geplanten Biogasanlage.« Der Redaktionsleiter lehnte sich kurz zurück, faltete die Hände vor dem Bauch, ließ dabei den Blick über seine Kollegen schweifen und wartete darauf, dass sich jemand freiwillig meldete. Lara verbarg ein Grinsen, während sie wie alle anderen auf ihre Notizen schaute. Es war immer das Gleiche. Manche Themen wollte einfach niemand haben. Hampenmann verharrte noch einen Augenblick lang in seiner gestrafften Haltung, dann flatterte seine Rechte nach oben und deutete auf Hubert. »Herr Belli – was ist mit Ihnen?«
»Ich, äh ...« Hubert hatte sich im Vorfeld keine unaufschiebbaren Aufgaben zurechtgelegt, was ihm jetzt zum Verhängnis wurde.
»Dann machen Sie das.« Die Hand des Redaktionsleiters klatschte auf die Tischplatte und besiegelte seine Worte. Hubert schob die Unterlippe nach vorn, wagte es aber nicht zu protestieren.
»Kommen wir zu dem Leichenfund im Abbruchhaus.« Lara hob den Kopf, um zu antworten, und hörte im gleichen Moment Toms Stimme. »Das übernehme ich.«
»Tom, alles klar.« Gernot Hampenmann zückte den Kugelschreiber, um den Namen in seine Liste einzutragen. Lara öffnete den Mund und wollte protestieren, brachte aber kein Wort heraus, während Tom schon weiterredete. »Ich habe deswegen schon mit KK Stiller telefoniert.« Laras Mund öffnete sich noch ein bisschen weiter. Ihr Kollege hatte den Kriminalkommissar schon angerufen? »Ich bin heute Nachmittag sowieso in Grünau, das Mehrgenerationenhaus, Sie wissen ...?« Tom zögerte gerade so lange, dass Hampenmann nicken konnte, und redete dann schnell weiter. »Da kann ich auch gleich ein paar Bilder vom Fundort der Leiche schießen, und wir brauchen nicht erst einen Fotografen hinzuschicken.«
»Sehr gut.«
In Laras Kopf rauschte das Blut. »Das ist eigentlich mein Ressort.« Sie hatte Mühe, ihre Stimme unter Kontrolle zu halten.
»Oh, entschuldige, Lara.« Tom klang zuckersüß. »Ich will dir nichts wegnehmen. Aber da du diese Woche schon mehrere Gerichtstermine hast und deshalb dauernd außer Haus bist, dachte ich, es wäre dir recht, wenn du heute nicht auch noch rausmüsstest.« Lara spürte, wie ihr linkes Augenlid zu zucken begann. Das hatte Tom ja geschickt eingefädelt. Er musste das Ganze geplant haben, seit die Nachricht heute Morgen über den Ticker gekommen war. Der Wochenplan hatte ihm dann noch die nötigen Argumente geliefert.
»Tom hat vollkommen recht. Sie können sich dann ja absprechen, wer den Fall weiterverfolgt.« Hampenmanns Tonfall gab zu verstehen, dass die Diskussion damit beendet war.
Lara versuchte, ihre Atmung unter Kontrolle zu bekommen. Ihr Lid zuckte unaufhörlich, und sie war sich ziemlich sicher, dass Tom das bemerkt hatte. Dem Rest der Besprechung hörte sie nur mit halbem Ohr zu, während sie sich fieberhaft zu erinnern versuchte, wann der Kollege die Gelegenheit gehabt hatte, den Kriminalkommissar anzurufen. Dauernd musste Tom in ihr Ressort eindringen. Wahrscheinlich machte er das, weil ihm die Polizei- und Gerichtsberichterstattung prestigeträchtiger erschien als der allgemeine Lokalteil.
»Das war's. Und nun wieder an die Arbeit, Kollegen. Ich bin heute bis halb drei hier, dann habe ich einen Termin außer Haus.« Hampenmann sprang wie ein Schachtelmännchen auf und eilte hinaus.
»Ich koche Kaffee. Wer möchte alles?« Isabell stolzierte in Richtung der Büros, schwenkte dabei ihre Hüften vor Tom her und zählte durch.
»Ich gehe eine rauchen.« Friedrich schlurfte zur Tür.
»Ich komme mit.« Lara folgte ihm. »Ich brauche frische Luft.« Nebeneinander gingen sie die Treppen hinunter.
»Hättest du lieber über die Leiche geschrieben?« Friedrich schnippte Asche in das große Silbermaul des Standaschenbechers neben der Eingangstür.
»Für Straftaten und Gerichtsberichte bin ich zuständig.« Lara versuchte, tief ein- und auszuatmen.
»Aber wenn Tom eh dort ist ... und auch schon mit Stiller gesprochen hat ...«
»Das wäre auch meine Aufgabe gewesen!«
»Er will dir doch nur helfen. Und mit KK Stiller kannst du doch eh nicht.«
»Ja, aber ...«
»Dann lass ihn das doch machen, und sieh es einfach als Arbeitserleichterung. Ich glaube nicht, dass Tom dir eins auswischen will.« Friedrich drückte den Stummel aus. »Gehen wir wieder hoch. Manchmal klappt halt nicht alles so, wie man sich das wünscht.«
Lara schluckte. So wie Friedrich das sagte, klang alles ganz stimmig. Sah denn niemand, dass Tom versuchte, sie auszubooten?
Kapitel 4
An Mama und Papa
Wo seit ihr? Ich vermisse euch so ser. Liebe Mama, hoffendlich bist du wieder gesund. Bitte kommt und hohlt mich hier ab. Bitte bald.
Ich habe euch ser lieb.
Eure Melissa
Matthias Hase betrachtete die Kinderschrift. Das Papier zitterte in seinen Händen. Es war schon ein bisschen vergilbt und die Ecken zerbröselten allmählich. Unter die Zeilen hatte das Kind noch ein großes rotes Herz gemalt.
Melissa war nicht lange bei ihnen gewesen, und doch hatte sich ihr Bild tief in sein Herz gegraben. Genau wusste er es nicht mehr, aber es konnte höchstens ein halbes Jahr gewesen sein. Eines Tages verschwand sie, wie sie gekommen war, verschwanden ihre Sachen auf geheimnisvolle Weise aus ihrem Schrank, verschwanden alle materiellen Erinnerungen; so als sei die Kleine nie dagewesen. Bis auf diesen Brief.
Matthias' Gedächtnis hatte die Szene konserviert. Jede Einzelheit war noch vorhanden: der stickige Schlafsaal mit den Doppelstockbetten, sauber übereinandergefaltete Decken, das rötliche Muster des Linoleums, die müden Sonnenstrahlen, die zu den Fenstern hereinschienen, die tote Fliege auf dem Fußboden neben dem Tischbein. In der rechten Ecke des großen Zimmers, dort, wo es auch am Nachmittag dämmrig war, hatte Melissa gehockt, die Arme um die dünnen Beinchen geschlungen, das Gesicht zwischen den Knien versteckt. Sie musste ihn gehört haben, weil er sehen konnte, wie sie bei seinen Schritten erschauerte, aber sie hatte nicht aufgeschaut, hatte sich stattdessen nur noch stärker zusammengekrümmt.
Erst als seine Hand ihre Schulter sanft berührte – die Knochen waren unter der Haut deutlich zu spüren –, erst dann hob sie den Kopf und sah ihn an. Ihre Augen waren gerötet und schimmerten feucht, und sie schniefte. Matthias wusste noch, dass er in seiner Hosentasche nach einem Taschentuch gesucht, aber keines gefunden hatte. Sie trug »Affenschaukeln«, die gleiche Zopffrisur, die auch seine Schwester Mandy liebte. Vielleicht war es das gewesen, was sein Herz am stärksten berührt hatte.
Warum waren er und Melissa an diesem Tag eigentlich nicht bei den anderen gewesen? Nachmittags hatten die Kinder in den Schlafsälen nichts zu suchen, von zwei Uhr bis zum Abendessen saßen alle in dem Raum, den sie das »Hausaufgaben-Zimmer« nannten, und befassten sich mit Schularbeiten. Auch an den Wochenenden verbrachten sie die Nachmittage dort. Es gab immer etwas zu lernen oder vorzubereiten für das Kollektiv des Kinderheims, wie man die Kinder nannte. Irgendwie jedoch musste es ihnen an diesem Tag geglückt sein, sich der Aufsicht zu entziehen, und da hatten sie nun gehockt – der große, schlaksige Vierzehnjährige und das kleine, zarte Mädchen.
Nach einer Weile hatte Melissa aufgehört, zu schluchzen und ihm gezeigt, was sie in der Tasche ihres Kleidchens verbarg wie einen kostbaren Schatz. Diese Nachricht an Mama und Papa, die sie in ihrer schönsten Kinderschrift geschrieben hatte; heimlich, am Abend vorher, unter der Bettdecke.
Es war nicht erwünscht, dass die Kinder Botschaften an Verwandte schickten, und jeder Brief wurde vor dem Absenden sorgfältig kontrolliert. Melissa hatte Matthias erzählt, dass sie nicht wusste, wie sie ihre Eltern erreichen konnte, sie hatte keine Adresse, besaß keinen Umschlag und auch kein Geld für eine Briefmarke. Dann hatte sie wieder zu schniefen begonnen, und weil das kleine Häufchen Elend ihm fast das Herz brach, beschloss er, sich der Sache anzunehmen; auch wenn er sich sonst aus den Angelegenheiten der anderen heraushielt, um sich selbst zu schützen.
Die Kleine erinnerte sich nicht an besonders viele Details, nur dass ihre Mama sehr krank geworden war und der Vater jeden Tag Bier und Schnaps getrunken hatte. Irgendwann war die Mutter in eine psychiatrische Klinik – Melissa sagte »Klapse« und Matthias hörte die verächtliche Stimme ihres besoffenen Vaters heraus – eingeliefert worden. Der Vater war anscheinend schnell mit den Kindern überfordert gewesen. Und so war sie hier gelandet. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihren beiden älteren Schwestern geschehen war. Dann hatte sie wieder zu weinen begonnen.
Matthias faltete den Brief vorsichtig, um ihn nicht weiter zu beschädigen, und legte ihn in die geschnitzte Schatulle zurück. Draußen hupte ein Auto. Ein salziger Schweißtropfen rann an seiner Stirn herunter und bog an der Augenbraue rechts ab.
Melissas Brief hatte ihre Eltern nie erreicht, obwohl er ihr das hoch und heilig versprochen hatte, nachdem die Tränen versiegt waren. Matthias hatte ihr geschworen, ihn sicher für sie aufzubewahren, weil sie glaubte, dass er dies besser könne als sie. Keiner der Schränke war abschließbar, immer wieder verschwanden Sachen, aber die Älteren hatten fast alle irgendwo ein Versteck.
Es war ihm nie gelungen, herauszufinden, wo Melissas Eltern lebten oder was mit ihren Schwestern geschehen war. Und so war dieser Brief bis heute bei ihm geblieben. Eines aber hatte sich damals verändert – seit der Begegnung im Schlafsaal hatte Matthias Hase die kleine Melissa in sein Herz geschlossen und bemühte sich, so gut er konnte, sie zu beschützen.
Es waren damals nicht nur die Erzieher. Auch die Kinder, besonders die älteren unter ihnen, konnten grausam zueinander sein. Das schien unlogisch, schließlich wäre es für sie alle sinnvoller gewesen zusammenzuhalten, sich gegen die Willkür der Erwachsenen gemeinsam zur Wehr zu setzen, aber Logik funktionierte hier nicht. »Fressen oder gefressen werden« war die Devise. Entweder man hielt das alles aus oder man zerbrach. Matthias hatte es ausgehalten.
Aber jetzt, fast dreißig Jahre später, war es an der Zeit, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Bedächtig schmeckte er den letzten Schluck Cola, ehe er den Computer einschaltete. Den Kindern im Heim vergab er ihre Bosheiten. Schließlich kannten die meisten von ihnen es nicht anders. Einige stammten aus Elternhäusern, in denen Schläge, Misshandlungen, Beleidigungen und Vernachlässigung an der Tagesordnung gewesen waren. Die Ungewollten waren schon im Babyalter fortgegeben worden. Andere waren krank oder schwer therapierbar – ab mit ihnen ins Heim. Ältere hatten die Schule geschwänzt, gestohlen oder einfach nur die falsche Musik gehört. Woher hätten diese Kinder und Jugendlichen wissen sollen, wie man sich »normal« verhielt? Und nicht zu vergessen – sie alle waren Kinder gewesen. Nein, den anderen Kindern konnte er verzeihen, nicht aber den Erziehern. Vor allem die Kleinen hatten es schwer gehabt. Sie waren eine leichte Beute für die Erzieher, konnten sich kaum zur Wehr setzen und litten meist schweigend. Melissa war es besonders schlecht ergangen, gerade weil sie so zart und klein gewesen war. Es war ein Glück für sie gewesen, dass ihr Aufenthalt nur ein halbes Jahr gedauert hatte.
Matthias hatte nie wieder etwas von ihr gehört. Die Erzieher erteilten den Kindern keine Auskunft, aber es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder war Melissa adoptiert worden – von liebevollen Pflegeeltern, die sich genau so ein kleines Mädchen immer gewünscht hatten – oder ihre Mutter war gesund geworden und hatte sie wieder zu sich genommen. Matthias' Gedächtnis hatte zwar die Szene mit dem Brief bis ins kleinste Detail behalten, aber vieles von dem, was danach passierte, war verwischt, unscharf wie ein zu lange belichtetes Foto.
Der Rechner summte. Es war an der Zeit, ein wenig zu recherchieren. Wie jedes Mal gab er zuerst Namen und Ort des Kinderheims in die Suchmaschine ein, um festzustellen, ob neue Artikel erschienen waren, und wie immer war das nicht der Fall.
Matthias Hase lehnte sich kurz zurück und schloss die Augen. Dann hämmerte er den Namen der Frau in die Tasten, die den Spitznamen »Walze« gehabt hatte – Isolde Semper.
Während sein Blick über die Einträge huschte, zischelte die eisige Stimme der Gesuchten durch seinen Kopf und befahl: »Du isst das jetzt auf, sofort!« Ein klatschendes Geräusch. Der rote Abdruck einer Handfläche in einem Kindergesicht. Tränchen kullerten über rosige Wangen. Ein Löffel zitterte in der Luft und dicke Tropfen einer undefinierbaren Suppe platschten zurück auf den halbvollen Teller.
»Ich kann das nicht essen, bitte.« Leises Flehen. »Es ist zu salzig.«
»Willst du damit sagen, ich hätte dein Essen versalzen?« Bis auf das erneute Klatschen herrschte Totenstille. Matthias Hase hatte die Augen geschlossen und versuchte, ein Bild zu dem Dialog heraufzubeschwören, aber es wollte ihm einfach nicht gelingen zu sehen, wer da von der Walze gequält wurde.
»Was meinen die anderen? Ist eure Suppe auch zu salzig?« Auch wenn er keine Bilder zu dem Fragment fand, Matthias wusste, dass niemand etwas geantwortet hätte. Ein vorsichtiges Kopfschütteln war alles, was man auf diese rhetorische Frage erwidern durfte. Die Speisen und Getränke der anderen waren ja auch stets in Ordnung. Es betraf immer nur ein Kind – dasjenige, das die Semper gerade auf dem Kieker hatte, und es war nie jemand von den Älteren. Die Walze schikanierte bevorzugt die Kleinen.
Auch Melissa, seine kleine Schutzbefohlene, bekam verdorbenes Essen vorgesetzt. Keiner wusste, wie Isolde Semper es anstellte, denn die Suppe wurde immer aus der großen Terrine geschöpft, kein Kind bekam eine Extrawurst, aber die Erzieherin schaffte es irgendwie gleichwohl.
Matthias hatte die Augen wieder geöffnet. Seine Finger glitten über die Tasten und hinterließen klappernde Echos in der Stille des Nachmittags. Die Luft im Arbeitszimmer roch nach staubigem Papier.
Er musste Isolde Semper finden, wo auch immer sie jetzt lebte. Und er hoffte inständig, dass sie noch lebte. Sie musste inzwischen auf die sechzig zugehen, genau wusste er es nicht.
Die Walze war nicht die Schlimmste gewesen. Im Vergleich zu den anderen erschienen ihre Quälereien sogar fast harmlos, alle Betroffenen hatten die Marter überlebt. Dennoch durfte auch sie nicht ungestraft davonkommen. Auf eine Reihenfolge hatte er sich nicht festgelegt. Matthias Hase überließ sich ganz seinen Eingebungen, wartete darauf, dass sein Gehirn ihm den Namen des Nächsten, den er suchen sollte, eingab. Er vertraute seinem Unterbewusstsein, das die schrecklichen Erinnerungen nur nach und nach an die Oberfläche ließ, in kleinen Portionen, die der Geist gerade noch bewältigen konnte. Das diffuse Gefühl, dass da weit schrecklichere Dinge im Verborgenen lauerten, verstärkte sich zwar mit zunehmender Konfrontation mit der Vergangenheit, aber noch war er anscheinend nicht bereit, sich all dem zu stellen.
Den Erinnerungen an die Essensfolter hielt sein Geist stand. Vielleicht auch deswegen, weil er nie selbst betroffen gewesen war. Die Walze hasste zarte, kleine Mädchen wie Melissa am meisten. Das jeweilige Kind wurde gezwungen, Löffel für Löffel hinunterzuschlucken. Wenn es sein musste, auch mit Schlägen. Irgendwann waren alle anderen fertig und verließen den Speiseraum, das würgende Geräusch von Nahrung, die die Speiseröhre wieder nach oben quoll, im Ohr.
Matthias hatte es nie mit eigenen Augen gesehen, aber wenn die Kinder ihr Essen tatsächlich erbrachen, mussten sie den sauersalzigen Brei erneut auflöffeln. Geschah dies, konnte sich die Prozedur über Stunden hinziehen, manchmal bis zum Abendessen. Übergeben – Verzehren. Erneutes Speien – nochmaliges Aufessen.
Bis auf die Schläge ins Gesicht hatte die Semper keine Gewalt angewendet, und sie beteiligte sich auch nicht an den nächtlichen »Aktivitäten« der männlichen Betreuer. Isolde Semper hatte eine sadistische Freude daran, Kinder mit verdorbener Nahrung zu drangsalieren, das war aber auch alles. Mochte manch einer meinen, solcherart Quälerei sei nicht lebensbedrohlich; der Selbstekel jedoch, der bei den Kleinen zurückblieb, die ihr eigenes Erbrochenes gegessen hatten, führte zu seelischen Verletzungen, die oft schwerer heilten als körperliche Wunden.
Vielleicht hatte die Walze den Tod nicht verdient. Das würde sich zeigen, wenn er ihr gegenüberstand.
Matthias Hase betrachtete sein leeres Colaglas. Seit dem Aufenthalt im Heim hatte er nie wieder Tee getrunken. Schon der Geruch von Fenchel oder Kamille verursachte ihm Übelkeit. Er richtete den Blick zurück auf den Bildschirm.
Von draußen drang Kindergeschrei herein. Staubfünkchen tanzten im Licht der Nachmittagssonne. Wohlwollend summte der Rechner. Lautlos erschien eine Liste von Namen und Adressen auf dem Bildschirm.
»Da haben wir dich ja.« Matthias Hase biss sich auf die Unterlippe und grinste dann. Jetzt war alles Folgende ein Kinderspiel.
Kapitel 5
»Hier ist Lara Birkenfeld. Von der Tagespresse, genau. Ich hätte ein paar Fragen zu dem Toten im Plattenbaublock.« Lara lauschte einen Moment und betrachtete dabei die Mutter mit den zwei kleinen Jungen an der Eisbude gegenüber. Der Eismann drückte jeweils zwei Kugeln in die Tüten und reichte sie über die Theke. An ihrem Ohr hörte sie Kriminalobermeister Schädlich schnaufen. Wahrscheinlich dachte er darüber nach, wie er sich unverfänglich aus der Affäre ziehen konnte. Sie setzte hinzu: »Das kam heute Vormittag über den Ticker.«
»Das stimmt.« Kriminalobermeister Schädlich war wortkarg. Kein Wunder bei dem Theater, das sein Vorgesetzter letztes Jahr veranstaltet hatte. Angeblich hatte sein Untergebener vertrauliche Informationen an die Zeitung und insbesondere an sie herausgegeben. Lara verzog das Gesicht. Und das alles, weil Kriminalkommissar Stiller sie nicht leiden konnte.
»Ich kann aus ermittlungstaktischen Gründen nichts dazu sagen, Sie verstehen?«
Die Standardantwort. Jetzt seufzte Lara, sodass er es hören konnte. Die Sonne hatte inzwischen die Eingangstür zum Zeitungsgebäude erreicht. Es musste schon mindestens sechzehn Uhr sein.
»Rufen Sie unsere Pressestelle an.« Schädlich klang bekümmert.
»Ich dachte, der direkte Weg wäre günstiger ...« Sie ließ das Satzende in der Luft hängen. Manchmal fühlten sich die Gesprächspartner dadurch zum Reden animiert. Schädlich gehörte nicht dazu. Die Stille dehnte sich aus wie ein schwarzes Loch.
»Na gut. Es war ein Versuch.« Sie ließ es fröhlich klingen, um dem Beamten kein schlechtes Gewissen zu verursachen. Er sollte sich nicht unwohl fühlen. Sie brauchte seine Hilfe bestimmt noch.
»Tut mir leid, Frau Birkenfeld, wirklich. Aber ich kann definitiv nicht. Nicht am Telefon.«
»Ich verstehe das.« Noch während sie sprach, dachte Lara darüber nach, ob der Nachsatz etwas zu bedeuten hatte. Schädlichs bulliges Gesicht tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Wollte der Beamte ihr zwischen den Zeilen mitteilen, dass er zu Aussagen bereit wäre, wenn sie sich persönlich begegneten? Sie beschloss, alles auf eine Karte zu setzen. »Haben Sie Lust, sich mit mir auf einen Kaffee zu treffen?«
Es dauerte mindestens zehn Sekunden, dann antwortete der Kriminalobermeister mit einer Frage. »Wo denn?«
Lara grinste. Ihr Arm wollte einen »Strike« vollführen, aber sie verbot es ihm. »Wie wäre es mit dem Lindencafé?«
»Aber heute wird das nichts mehr, ich habe bis achtzehn Uhr Dienst.«
»Morgen?« Lara wollte keine Zeit verschwenden. Mochte sein, dass ihr Kollege Tom sich bei der Tatortrecherche vorgedrängt hatte, aber die Berichterstattung über Kriminalfälle war immer noch ihr Ressort. Und so einfach ließ sie sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
»Das ginge.« Schädlich klang unschlüssig.
»Dann treffen wir uns morgen Nachmittag im Lindencafé. Gegen sechzehn Uhr?«
»Lieber um fünf.«
»Fein. Ich freu mich.« Lara wartete noch einen Moment, aber der Beamte hatte schon aufgelegt.
Sie schob ihr Handy in die Hosentasche. Die Sonne war in der Zwischenzeit bis zu ihren Knien gewandert. Es wurde Zeit, dass sie wieder nach oben ging. In der Redaktion würde jetzt auch Ruhe einkehren. Wenn sie noch ein wenig dablieb, erwischte sie Tom vielleicht noch, wenn er von seiner Tour zurückkam.
Die Tachonadel bewegte sich auf die siebzig zu und Tom bremste. Es fehlte noch, dass er geblitzt wurde. Sein Punkteregister in Flensburg war schon groß genug.
Dieses verlotterte Plattenbauviertel hatte ihn depressiv gemacht. Depressiv und wütend. Die überall gleich aussehenden Betonklötze widerten ihn an. Das war doch keine Architektur!
Zuerst hatte er schnell die Eröffnung des Mehrgenerationenhauses abgehakt, Alltagsarbeit. Das Konzept war eine nützliche Sache, aber es riss einen Journalisten nicht vom Hocker. Er hatte Meinungen eingeholt, Fotos gemacht und ein paar Details auf sein Diktiergerät gesprochen; in Gedanken war er jedoch schon bei seinem Treffen mit Kriminalkommissar Stiller gewesen. Stiller mochte ihn. Tom hatte sich vorgenommen, ihn so lange zu löchern, bis er mit Details zu der Leiche im Abbruchblock herausrückte.
Links vor ihm ratterte die Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Tom scherte auf die linke Spur aus und überholte einen Škoda.
Grünau war immer staubig. Schien die Sommersonne auf den Beton, wirkte das Wohngebiet noch schmutziger. Irgendwann würde er eine kunstvoll-literarische, schwermütige Reportage über die dem Tod geweihten Plattenbausiedlungen in der ehemaligen DDR schreiben. Etwas Preisträgerverdächtiges.
Tom hatte dreihundert Meter vor dem Gebäude gehalten, in dem die Leiche gefunden worden war. Alles war vollständig mit rot-weißem Polizeiband abgesperrt gewesen. Er hatte ein paar Fotos geschossen und sich vorgenommen, die Namen der Bauarbeiter herauszufinden, die die Leiche entdeckt hatten. Sie zu befragen war schließlich nicht verboten. Die Spurensicherung würde ihn nie und nimmer in das Gebäude lassen, und der Tote war auch schon längst in die Rechtsmedizin abtransportiert worden. Details über Fundort und Aussehen der Leiche würde er also, wenn überhaupt, höchstens von den Arbeitern der Abbruchfirma erfahren.
Wenn er Glück hatte, konnte eine ganze Artikelserie daraus entstehen. Er war fest angestellt und hatte es nicht nötig, Zeilen zu schinden wie die freien Journalisten, aber dies war eine gute Möglichkeit, sein Profil in der Redaktion zu schärfen. Hampenmann hatte Ambitionen, aufzusteigen. Auch wenn der Chef nicht darüber redete, wusste es doch jeder. Und wenn der Hampelmann die Leiter nach oben fiel, musste ein neuer Redaktionsleiter her. Empfehlungen von Vorgesetzten in Bezug auf ihren Nachfolger waren da Gold wert.
Tom schob seine Dauerkarte in das Lesegerät an der Einfahrt des Parkhauses. Es piepste und dann fuhr die Schranke nach oben. Die Typen von der Spurensicherung hatten ihn vorhin einfach ignoriert, und er hatte sich beherrschen müssen, seine Wut wegen ihres elitären Gehabes nicht zu zeigen. Stiller war erst kurz vor halb fünf aufgekreuzt und hatte auch nicht sofort Zeit für ihn gehabt, sich aber schließlich doch noch zu einem kurzen Gespräch mit Tom herabgelassen und ein paar Fragen beantwortet. Leider rückte er dabei nicht mit Details über den Zustand der Leiche, die mögliche Todesursache oder Vermutungen zum Tathergang heraus. Es gäbe noch keinen Bericht der Rechtsmedizin, daher wolle er sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Insgesamt war das trotz allem jedenfalls mehr, als Lara je erreicht hätte. Tom wusste nicht genau, warum Stiller sich weigerte, mit seiner Kollegin zu reden, aber es passte ihm gut in den Kram.
Die Zentralverriegelung klickte. Er machte sich auf den Weg in die Redaktion. Die kühle Luft im Treppenhaus trocknete die feinen Schweißperlen auf seiner Stirn, während er gemächlich nach oben stieg. Er würde zuerst die Fotos herunterladen und bearbeiten und danach den Artikel schreiben, damit dieser noch in die morgige Ausgabe kam. Lara durfte keine Chance haben, sich in diese Geschichte hineinzudrängen, auch wenn Gerichts- und Kriminalberichte eigentlich zu ihrem Arbeitsbereich gehörten. Tom setzte in Gedanken ein »noch« hinzu. Voriges Jahr war es ihm fast gelungen, sie bei Hampelmann in ein schlechtes Licht zu rücken, aber die kleine Schlange hatte es verstanden, sich geschickt aus der Schlinge zu winden. Das hier war eine neue Chance, einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Und heute Abend würde er Isabell so richtig rannehmen. Das kleine Dummchen war ganz heiß auf ihn.
Er war ganz in Gedanken und hatte das breite Grinsen noch im Gesicht, als er die Tür zu den Redaktionsräumen aufstieß und direkt vor Lara Birkenfeld stand. Seine unvermittelten Schuldgefühle beiseiteschiebend, registrierte er das rotgoldene Funkeln ihrer Haare und sah, dass ihre Augen sich ganz kurz verengten, bevor sie lächelte und »Hallo Tom!« sagte. Das Gefühl, ihr Blick brenne Löcher in seinen Hemdrücken, verstärkte sich auf dem Weg zu seinem Schreibtisch. Sein Computer summte bereits vor sich hin. Wahrscheinlich hatte wieder einer dieser Freien daran herumgepfuscht. Es war ein Kreuz, dass man hier seinen Rechner nie für sich hatte.
Tom steckte die Kamera an und begann, Fotos auf die Festplatte zu kopieren. Ein Blick aus den Augenwinkeln bestätigte ihm, dass Lara noch immer am Kopierer stand und auf die herausgleitenden Blätter sah. Sie schien auf ihn gewartet zu haben. Genauso wie Isabell. Tom hörte das Klacken ihrer Absätze in der Küche. Jetzt kam die Praktikantin, einen Kaffeebecher in der Linken, herausstolziert, stakste heran und stellte die Tasse auf den Rand seines Schreibtisches.
»Wie war's?« Ihr Atem kitzelte seinen Nacken. Sämtliche Härchen an Toms Körper richteten sich auf. Isabell säuselte weiter. »Hast du alles erfahren, was du wolltest?«
Und nicht nur die Härchen erhoben sich. Tom grinste kurz, ohne sich umzudrehen. Er würde dem kleinen Luder jetzt mit Sicherheit keinen Bericht erstatten. Heute Abend vielleicht. Wenn sie nett zu ihm gewesen war. »Danke für den Kaffee, Bella.« Sie liebte es, wenn er sie so nannte. »Ich habe noch mindestens zwei Stunden zu tun.« Ein schneller Blick zu Lara, dann senkte er die Stimme. »Ich rufe dich nachher auf dem Handy an.«