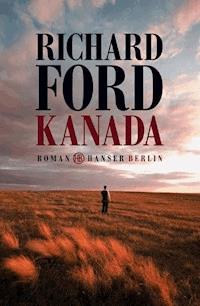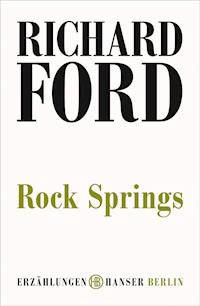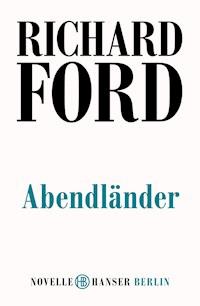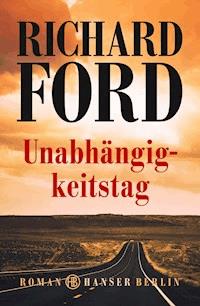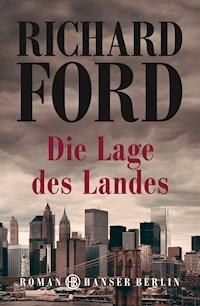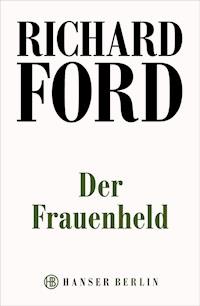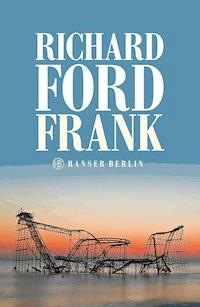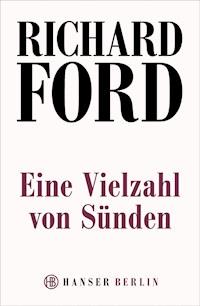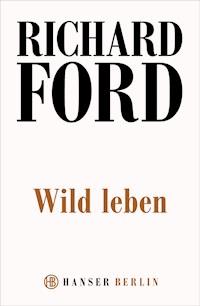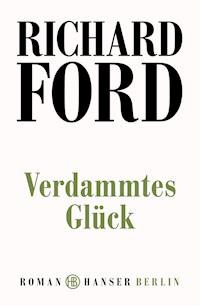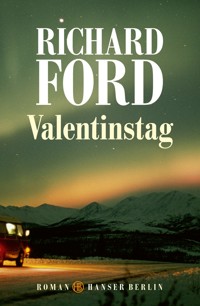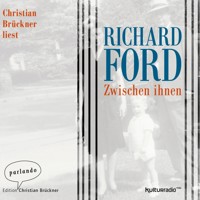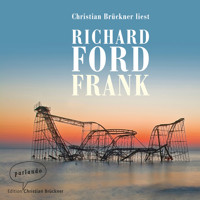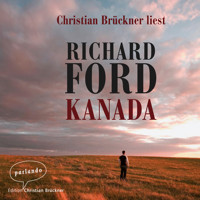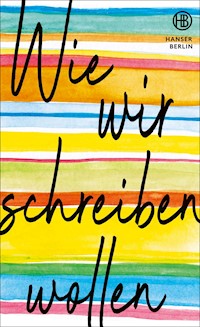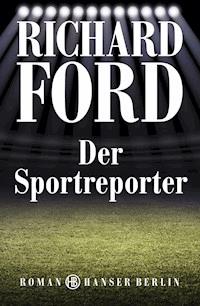
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Der Sportreporter“, ein Klassiker der modernen Literatur der USA, bildet zusammen mit „Unabhängigkeitstag“ und „Die Lage des Landes“ Richard Fords große Romantrilogie um Frank Bascombe, einen netten, vernünftigen Amerikaner. Frank hat sich vor einigen Jahren von seiner Frau getrennt, arbeitet als Sportreporter und ist das, was man für gewöhnlich einen „Durchschnittstypen“ nennt. Doch eine Kette von dramatischen Ereignissen stört ihn jäh in der Ruhe der Mittelmäßigkeit: Er reist nach Detroit, um ein Interview mit einem an den Rollstuhl gefesselten Ex-Footballstar zu führen, anschließend erfährt er vom Selbstmord seines Freundes Walter, und es kommt zum Bruch zwischen ihm und seiner Freundin Vicky ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser Berlin eBook
Richard Ford
Der Sportreporter
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Hans Hermann
Hanser Berlin
Die Originalausgabe erschien 1986
unter dem Titel The Sportswriter bei Vintage Books / Random House Inc., New York.
ISBN 978-3-446-24246-3
© Richard Ford 1986
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2012
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche
© by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eine Fotos von © efks/ iStock
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Kristina
Eins
Ich heiße Frank Bascombe. Ich bin Sportreporter.
Seit vierzehn Jahren wohne ich hier in Haddam, New Jersey, in der Hoving Road 19; das große Haus im Tudorstil habe ich gekauft, als ein Band Short Storys von mir für sehr viel Geld an einen Filmproduzenten ging und meiner Frau und mir und unseren drei Kindern – von denen zwei noch nicht einmal geboren waren – ein angenehmes Leben in Aussicht stellte.
Wie dieses angenehme Leben – das von mir erwartete – im einzelnen aussah, kann ich heute nicht genau sagen, aber ich würde andererseits auch nicht behaupten, es sei nichts daraus geworden; es ist eben nur eine Menge dazwischengekommen. Ich bin zum Beispiel nicht mehr mit X verheiratet. Das Kind, das damals kam, als alles anfing, ist gestorben, obschon, wie bereits erwähnt, noch zwei andere da sind, quicklebendige und prächtige Kinder.
Ich habe, kurz nachdem wir von New York hierher gezogen waren, einen kurzen Roman angefangen und ihn, als die Hälfte geschrieben war, in die Schublade gelegt, wo er bis heute geblieben ist und wohl auch weiterhin bleiben wird, wenn nicht irgend etwas geschieht, das ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann.
Vor zwölf Jahren, als ich sechsundzwanzig war und nicht so recht wußte, wie und was, wurde mir vom Herausgeber eines teuer aufgemachten New Yorker Sportmagazins, das Ihnen allen ein Begriff ist, der Job eines Sportreporters angeboten, weil ich als freier Mitarbeiter einen Artikel in einer ganz bestimmten Art geschrieben hatte, die ihm gefiel. Und zu meiner – und nicht nur meiner – Überraschung stellte ich die Arbeit an meinem Roman ein und nahm an.
Und von da an hat es für mich keine andere Arbeit mehr gegeben, nur noch diesen Job, wenn man einmal von den Urlaubszeiten absieht und von einer dreimonatigen Unterbrechung nach dem Tod meines Sohnes, als ich einen Neuanfang erwog und eine Stelle als Lehrer an einer kleinen Privatschule im westlichen Teil von Massachusetts annahm, wo es mir aber schon bald nicht mehr gefiel, so daß ich es kaum erwarten konnte wegzukommen und hierher nach New Jersey zurückzukehren und wieder Artikel für das Sportmagazin zu schreiben.
Mein Leben ist in diesen zwölf Jahren keineswegs übel gewesen, und das ist es auch heute noch nicht. Es ist in fast jeder Beziehung phantastisch gewesen. Und obwohl mir mit zunehmendem Alter immer mehr Dinge angst machen, und obwohl mir immer klarer wird, daß einem üble Dinge passieren können und auch tatsächlich passieren, gibt es sehr wenig, was mich wirklich beunruhigt oder nachts nicht schlafen läßt. Ich glaube immer noch an Liebe und Leidenschaft. Und ich würde nicht viel oder gar nichts ändern. Vielleicht würde ich mich nicht mehr scheiden lassen. Und mein Sohn, Ralph Bascombe, würde nicht sterben. Aber das ist, was diese Dinge betrifft, auch schon alles.
Warum, werden Sie vielleicht fragen, gibt einer eine vielversprechende Laufbahn als Schriftsteller auf – es gab ein paar gute Rezensionen –, um Sportreporter zu werden?
Das ist eine gute Frage. Im Moment will ich nur so viel dazu sagen: Wenn du bei der Arbeit des Sportreporters eines lernst – und sie bringt viel Wahres, aber auch eine Menge Lügen mit sich –, dann die Erkenntnis, daß du, wenn dein Leben etwas wert sein soll, früher oder später der Tatsache eines fürchterlichen brennenden Bedauerns ins Auge sehen mußt. Aber du mußt es auch fertigbringen, ihm zu entrinnen, sonst ist dein Leben ruiniert.
Ich glaube, ich habe beides getan. Den Schmerz durchgestanden. Den Ruin vermieden. Und ich bin immer noch hier, um davon zu berichten.
Ich bin über den Eisenzaun in den Friedhof direkt hinter meinem Haus gestiegen. Es ist fünf Uhr morgens am Karfreitag, dem 20. April. Alle anderen Häuser in der Umgebung sind noch dunkel, und ich warte auf meine Exfrau. Es ist der Geburtstag meines Sohnes Ralph. Er wäre heute dreizehn geworden, fast schon ein Mann. Wir haben uns hier die letzten beiden Jahre frühmorgens vor Tagesbeginn getroffen, um ihm unsere Aufwartung zu machen. Davor sind wir als Mann und Frau immer gemeinsam herübergekommen.
Ein gespenstischer Nebel steigt aus dem Gras des Friedhofs auf, und hoch oben in der unteren Wolkenhöhe höre ich das Flügelrauschen vorüberziehender Gänse. Ein Polizeiauto ist mit leisem Schnurren durchs Tor hereingefahren, hat angehalten, die Scheinwerfer ausgeschaltet und angefangen, mich zu überwachen. Im Auto sah ich ein Streichholz aufflackern, sah das Gesicht des Polizisten, wie er auf ein Klemmbrett blickte.
Von der entlegenen Seite des »neuen Teils« äugt ein kleines Reh in meine Richtung. Hin und wieder funkelt das gelbe Tapetum in seinen Augen bis herüber zum alten Teil, wo die Bäume größer sind und wo in Sichtweite des Grabs mit meinem Sohn drei Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung begraben liegen, vom Grab meines Sohnes aus kann man ihre Gräber sehen.
Meine Nachbarn, die Deffeyes, spielen Tennis und rufen sich den Spielstand in gedämpft-höflichen Frühmorgenstimmen zu. »Entschuldigung.« – »Danke.« – »Vierzig-null.« Pock. Pock. Pock. »Vorteil für dich, Schatz.« – »Ja, danke.« – »Dein Spiel.« Pock. Pock. Ich höre, wie sie heftig und stoßweise durch die Nase atmen, höre das Scharren ihrer Füße. Sie sind schon in den Achtzigern und brauchen keinen Schlaf mehr, und so sind sie Tag und Nacht auf den Beinen. Sie haben matte Barium-Schwefel-Lampen installiert, damit das Licht nicht in meinen Hof fällt und mich am Schlafen hindert. Und wir sind gute Nachbarn geblieben, wenn nicht enge Freunde. Heute habe ich nicht mehr viel gemein mit ihnen und werde kaum einmal zu ihren Cocktailpartys – oder zu denen anderer Leute – eingeladen. Die Leute in der Stadt sind bei aller Zurückhaltung immer noch freundlich zu mir, und in meinen Augen sind es gute Menschen, konservativ, anständig.
Es ist, wie ich inzwischen weiß, nicht leicht, einen geschiedenen Mann zum Nachbarn zu haben. In ihm schlummert das Chaos – der lebensfähige Gesellschaftsvertrag ist durch den zwielichtigen Aspekt des Sex in Frage gestellt. Die meisten meinen, sie müßten eine Entscheidung treffen, und es ist immer leichter, sich für die Ehefrau zu entscheiden, was denn auch fast alle meine Nachbarn und Freunde getan haben. Und obwohl wir über die Garageneinfahrten und Hecken oder auf den Parkplätzen von Lebensmittelmärkten über die Dächer unserer Autos hinweg plaudern und uns über den Zustand unserer Dachunterseiten und Fallrohre und die Wahrscheinlichkeit eines frühen Winters austauschen, manchmal auch zaghafte Pläne für einen gegenseitigen Besuch machen, kommen wir praktisch nie zusammen. Und ich werde spielend damit fertig.
Der Karfreitag heute ist ein besonderer Tag für mich, ungeachtet der schon angesprochenen Besonderheit. Als ich heute morgen im Dunkeln aufwachte, hämmerte mein Herz wie ein Tamtam, und es kam mir so vor, als bahne sich eine Veränderung an, als sei diese Verträumtheit, an die sich Erwartungen knüpfen und die ich nun schon einige Zeit empfinde, im Begriff, von mir zu weichen, hinaus in die kühle, dunkle Morgendämmerung.
Heute breche ich nach Detroit auf und mache mich an das Porträt eines berühmten ehemaligen Footballspielers, der in Walled Lake (Michigan) wohnt und seit einem Unfall beim Wasserskilauf an den Rollstuhl gefesselt ist, der aber für seine früheren Mannschaftskameraden dadurch zum leuchtenden Vorbild wurde, daß er tapfer und zielstrebig aufs College zurückkehrte, in Kommunikationswissenschaften seinen Abschluß machte, seine schwarze Physiotherapeutin heiratete und schließlich das Ehrenamt des Mannschaftsgeistlichen für seine alten Kameraden übernahm. Der »Beitrag zur gemeinsamen Sache« wird mein Aufhänger sein. Geschichten dieser Art machen mir Spaß, und sie bereiten mir wenig Mühe.
Die Sache wird aber dadurch spannender, daß ich meine neue Freundin Vicki Arcenault mitnehme. Sie ist erst vor kurzem von Dallas nach New Jersey heraufgezogen, aber ich bin schon jetzt ziemlich sicher, daß ich in sie verliebt bin (ich habe es noch nicht angesprochen, aus Angst, sie könnte mißtrauisch werden). Als ich mir vor zwei Monaten in meiner Garage beim Schleifen des Messers vom Rasenmäher den Daumen aufschlitzte, war es Schwester Arcenault, die mich in der Notaufnahme der Ärzteklinik zusammenflickte, und seither hat sich einiges entwickelt. Sie machte ihre Ausbildung an der Baylor University in Waco und zog hierher, als ihre Ehe kaputtging. Tatsächlich lebt ihre Familie unten in Barnegat Pines, nicht allzu weit weg, in einem neuen Wohngebiet dicht am Meer, und ich bin als Beweisstück Nummer eins beim Osteressen eingeplant – um ihnen den Beleg dafür zu liefern, daß sie den Wechsel in den Nordwesten erfolgreich vollzogen, einen zuverlässigen und gutherzigen Mann gefunden und die schlechten Zeiten einschließlich ihres hitzköpfigen Ehemannes Everett weit hinter sich gelassen hat. Ihr Vater, Wade, arbeitet an der Ausfahrt 9 der Schnellstraße, wo er die Straßenbenutzungsgebühr kassiert, und ich kann nicht erwarten, daß ihm der Altersunterschied zwischen uns gefällt. Vicki ist dreißig. Ich bin achtunddreißig. Er selbst ist erst in den Fünfzigern. Aber ich hoffe doch, daß ich ihn für mich einnehmen kann, und ich bin so erpicht darauf, wie das unter den Umständen nur möglich ist. Vicki ist eine liebenswerte, kesse kleine Person mit schwarzen Haaren, reizvoll breiten Backenknochen, einem starken texanischen Akzent und in ihren leidenschaftlichen Momenten von einer lockeren Selbstverständlichkeit, die einen Mann wie mich nachts vor Verlangen stöhnen lassen kann.
Soll keiner glauben, der Ausstieg aus einer Ehe gebe einem die Freiheit, fortan den unbeschwerten Schürzenjäger zu spielen oder irgendein exotisches Leben zu führen, das man vorher nie ganz gepackt hat. Weit gefehlt. Niemand kann das lange durchhalten. Der örtliche »Klub der Geschiedenen Männer«, dem ich angehöre, hat mir das mehr als alles andere klargemacht – wir reden nicht viel über Frauen, wenn wir zusammen sind, und fühlen uns einfach erleichtert, unter Männern zu sein. Was der Ausstieg aus einer Ehe mir – und den meisten von uns – gebracht hat, war Enthaltsamkeit und größere Treue als je zuvor in meinem Leben, nur eben mit niemandem in der Nähe, dem diese Treue und Enthaltsamkeit gilt. Nichts als ein langer leerer Augenblick. Allerdings sollte jeder irgendwann in seinem Leben eine Zeitlang allein sein. Nicht so, wie man als Kind in den Sommerferien allein ist oder im Einzelzimmer eines Wohnheims an irgendeiner idiotischen Schule, aber wenn man erwachsen ist. Dann sollte man allein sein. Es kann das Richtige sein. Am Ende ruht man vielleicht stärker in sich selber – wie die besten Sportler –, und dann hat es sich gelohnt. (Ein Basketballspieler, der zu seinem Spezialwurf von außerhalb der Zone ansetzt, ist nur noch die Verkörperung des einfachen Wunsches, der Ball möge durch den Ring fallen.) Jedenfalls ist es nicht leicht – kann es vermutlich auch nicht –, sich unerschrocken zu behaupten. Ich erledige meine Arbeit und erledige sie gut und erwarte weiterhin das Beste, ohne im entferntesten zu wissen, was es sein wird. Und die Dreingabe ist, daß dir ein hübsches kleines Ding wie Schwester Arcenault wie ein Geschenk des Himmels erscheint.
Die letzten paar Monate war ich nicht mehr unterwegs, und das Magazin hat für mich genügend Arbeit in New York gefunden. Vor Gericht wurde von X’ tranigem Anwalt Alan vorgebracht, meine Reisen seien der Anlaß für unsere Schwierigkeiten gewesen, vor allem nach Ralphs Tod. Und obwohl das strenggenommen nicht stimmt – es war eine von X und mir gemeinsam erfundene Begründung für das Gericht –, ist richtig, daß ich die mit meiner Arbeit verbundenen Reisen schon immer genossen habe. Vicki hat in ihrem ganzen Leben nur zwei Landschaften kennengelernt: zum einen die flachen, nichtssagenden, trübseligen Prärien um Dallas und zum anderen New Jersey – eine seltsame Weltfremdheit in unseren Tagen. Aber ich werde ihr demnächst den mittleren Westen zeigen, wo gute alte Normalität noch sozusagen in der feuchten Luft liegt und wo ich meine Studentenzeit verbracht habe.
Es stimmt schon, daß meine Arbeit als Sportreporter in vielen Punkten genauso aussieht, wie es sich wohl die meisten vorstellen: Ich sitze in Flugzeugen, betrete und verlasse Flughäfen, gehe in zentral gelegenen Hotels ein und aus, warte oft Stunden in Gängen und Umkleideräumen, besorge mir Mietwagen, habe Auseinandersetzungen mit unfreundlichen Portiers. Ich sitze spätnachts in fremden Bars, bin immer vor Tagesanbruch auf den Beinen, so wie heute morgen, und versuche, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen. Aber das alles enthält auch ein Versprechen, ohne das ich, glaube ich, nicht glücklich wäre. Man kommt sehr früh zu der Erkenntnis, daß einen nichts jemals von sich selbst entfremden wird. Doch in diesen prosaischen und anonymen Großstädten des Landes, den Milwaukees, den St. Louises, den Seattles, den Detroits, sogar den New Jerseys, kann sich etwas Vielversprechendes und Unerwartetes abspielen. Eine Frau, die ich an dem College kennenlernte, an dem ich kurz unterrichtete, sagte einmal zu mir, ich könne unter zu vielen Möglichkeiten wählen, ich werde zu wenig von schierer Notwendigkeit zum Handeln gezwungen. Aber das ist nur eine Illusion und ihr eigener Fehler. Möglichkeiten brauchen wir alle. Und wenn ich in die gemauerte Welt dieser amerikanischen Städte hinausgehe, empfinde ich genau das. Jede Menge Möglichkeiten. Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, die mir aber möglicherweise gefallen, sind hier und warten vielleicht auf mich. Selbst wenn sie’s nicht tun. Die Heiterkeit eines Neuankömmlings. Gutes Licht in einem Restaurant, das einen besonders befriedigt. Ein Taxifahrer, der eine interessante Lebensgeschichte zu erzählen hat. Die lässige, vibrierende Stimme einer Frau, die du nicht kennst, der du aber in einer Bar, in der du nie gewesen bist, zuhören kannst, zu einem Zeitpunkt, zu dem du sonst allein gewesen wärst. Diese Dinge warten auf dich. Und was könnte besser sein, geheimnisvoller? Was könnte eine größere Vorfreude rechtfertigen? Nichts. Gar nichts.
Die Barium-Schwefel-Lampen am Tennisplatz der Deffeyes verlöschen. Delia Deffeyes geduldige und unbeschwerte Stimme, immer noch gedämpft, redet auf ihren Mann Caspar ein, während sie in ihrer gebügelten weißen Tenniskleidung auf das dunkle Haus zugehen, und sie versichert ihm mehrmals, er habe gut gespielt.
Der Himmel ist zu einem milchigen Auge geworden, und obwohl es Frühling ist und Ostern vor der Tür steht, hat dieser Morgen etwas seltsam Winterliches, als verhülle ein hoher Nebel die Morgensterne. Vom Mond ist nichts zu sehen.
Der Polizist hat endlich genug gesehen und rollt aus dem Friedhofstor hinaus auf die stillen Straßen. Ich höre eine Zeitung auf einen Gehweg klatschen. Weit weg höre ich den Vorortzug nach New York mit lautem Bimmeln in unseren Bahnhof einfahren – immer ein tröstliches Geräusch.
X’ brauner Citation hält vor der blinkenden roten Ampel an der Constitution Street, gegenüber der neuen Bibliothek, und bewegt sich dann auf der Plum Road im Schrittempo, die Scheinwerfer aufgeblendet, den Friedhofszaun entlang. Das Reh ist verschwunden. Ich gehe ihr entgegen.
X, die ich in Ann Arbor kennengelernt habe, ist ein altmodisches, bodenständiges Michigan-Mädchen aus Birmingham. Ihr Vater Henry war ein Soapy Williams-Liberaler der alten Schule und besitzt immer noch eine Fabrik, in der Gummimanschetten für eine gewaltige Maschine ausgestanzt werden, die ihrerseits Kotflügel für Autos ausstanzt; heute ist er allerdings Republikaner und so reich wie ein Pharao. Ihre Mutter Irma lebt in Mission Viejo, und die beiden sind geschieden; dessenungeachtet schreibt mir ihre Mutter regelmäßig, denn sie glaubt, X und ich würden uns eines Tages wieder versöhnen, was so möglich erscheint wie alles andere.
X könnte, wenn sie wollte, wieder nach Michigan ziehen, eine Eigentumswohnung oder ein Landhaus kaufen oder sich auf dem Besitz ihres Vaters einrichten. Wir haben uns bei der Scheidung darüber unterhalten, und ich hatte keine Einwände. Aber ihr Stolz und ihre Unabhängigkeit lassen es nicht zu, daß sie jetzt ins elterliche Haus zurückkehrt. Außerdem hält sie viel von Familie und möchte, daß Paul und Clarissa in meiner Nähe sind, und ich bin glücklich bei der Vorstellung, daß es ihr gelungen ist, sich in ihrem neuen Leben einzurichten. Zuweilen werden wir erst dann richtig erwachsen, wenn wir einen einschneidenden Verlust erlitten haben, so daß unser Leben uns gewissermaßen einholt und wie eine Welle über uns hinwegspült und alles mit sich reißt.
Nach unserer Scheidung hat sie sich in einer weniger teuren, aber aufstrebenden Wohngegend von Haddam, die von den Einheimischen The Presidents genannt wird, ein Haus gekauft und eine Stelle als Golflehrerin im Country Club Cranbury Hills angenommen. Sie war eine der Mannschaftsführerinnen der Lady Wolverines im College und hat in letzter Zeit an einigen offenen Turnieren in der Region teilgenommen, und nachdem sie ihre kurzen Schläge stark verbessert hat, konnte sie sich im letzten Sommer einige Male auf vorderen Rängen plazieren. Ich glaube, sie hat sich schon immer danach gesehnt, so etwas zu versuchen, und durch die Scheidung hat sie die Gelegenheit dazu bekommen.
Wie hat unser Leben ausgesehen? Ich kann mich heute kaum noch daran erinnern, aber ich erinnere mich an die Zeitspanne, die dieses Leben gedauert hat. Und ich erinnere mich gern daran.
Ich nehme an, unser Leben war das allgemein übliche, wie man so sagt. X war Hausfrau und brachte Kinder zur Welt, las Bücher, spielte Golf und hatte Freundinnen, während ich über Sport schrieb und in der Gegend herumfuhr, um meine Geschichten aufzulesen, heimkam, um sie aufzuschreiben, dabei oft tagelang in alten Kleidern durchs Haus geisterte und zwischendrin immer wieder mit dem Zug nach New York fuhr. X schien die bestmögliche Einstellung zu meinem Leben als Sportreporter gefunden zu haben. Sie fand das alles ganz in Ordnung, oder zumindest sagte sie das und schien glücklich. Sie glaubte, einen jungen Sherwood Anderson mit Perspektiven beim Film geheiratet zu haben, aber es störte sie nicht, daß es anders kam, und sie ließ es auch mich nie spüren. Ich fühlte mich so frei wie ein Vogel. Mit unseren drei Kindern machten wir Ferienreisen. Nach Cape Cod (das Ralph Cape Gott nannte), nach Searsport in Maine, zum Yellowstone-Nationalpark, zu den Schlachtfeldern aus dem Bürgerkrieg, Antietam und Bull Run. Wir zahlten Rechnungen, machten Einkäufe, gingen ins Kino, kauften Autos und Kameras und Versicherungen, grillten im Garten, gingen auf Cocktailpartys, besuchten Schulen und flirteten miteinander in der netten, behutsamen Art von Erwachsenen. Ich blickte aus meinem Fenster, stand mit einem Gefühl der Genugtuung und des Stolzes auf das Erreichte bei Sonnenuntergang in meinem Garten, säuberte meine Regenrinnen, überprüfte meine Dachschindeln, befestigte die Sturmfenster, düngte regelmäßig, errechnete den Wert meines Hauses nach Abzug der Hypotheken, redete mit meinen Nachbarn in einem interessierten Ton – das normale, beifallslose Leben, das wir alle führen.
Doch gegen Ende unserer Ehe verlor ich mich in gelegentlichen Träumereien. Manchmal wachte ich morgens auf, sah X tief atmend neben mir liegen und erkannte sie nicht! Wußte nicht einmal, in welcher Stadt ich mich befand, wie alt ich war oder was für ein Leben ich führte, so sehr war ich in meine Träume verstrickt. Ich lag nur da und versuchte, das Nichtwissen zu verlängern, so gut ich konnte, versuchte, dieses angenehme, mir immer besser gefallende Gefühl des Entschwebens und Zurückblickens auf die alten Positionen auszukosten, solange es anhielt, während zwanzig Möglichkeiten des Wer, Wo und Was vorüberzogen. Bis ich plötzlich alles wieder richtig sah. Und dabei empfand ich ein Gefühl des – ja, was? – des Verlusts, muß es wohl heißen, auch wenn ich nicht weiß, was für ein Verlust das gewesen sein soll. Mein Sohn war gestorben, aber ich will nicht sagen, daß das der Grund war oder daß irgend etwas jemals der einzige Grund für irgend etwas anderes ist. Ich weiß, daß man träumend durch ein im übrigen gutes Leben gehen kann, ohne jemals aufzuwachen: Fast hätte ich das selbst getan. Ich glaube, ich habe das jetzt überwunden, und die Zeit des Träumens liegt mehr oder weniger hinter mir, obwohl zwischen X und mir eine entschiedene Traurigkeit darüber herrscht, daß unsere Ehe vorbei ist, eine Traurigkeit, die nicht traurig stimmt. Es ist ein Gefühl wie bei einem Klassentreffen, wenn du spätabends eine deiner alten Lieblingsmelodien hörst, nur daß du jetzt ganz allein bist.
X tritt aus dem achatenen Friedhofslicht, mit wackligen Schritten und verschlafen, in flachen Schuhen, ausgebeulten Kordhosen und einem alten Trenchcoat, den ich ihr vor Jahren gab. Ihre Haare sind nach der neuesten Mode geschnitten, die mir gefällt. Sie ist groß und kräftig, brünett und hübsch und sieht jünger aus, als sie ist, sie ist erst siebenunddreißig. Als wir uns vor fünfzehn Jahren bei einer langweiligen Stunde des Büchersignierens in New York kennenlernten, führte sie in einem Modegeschäft an der Fifth Avenue Kleider vor, und sie neigt selbst heute noch dazu, die Schultern hängen zu lassen und auf eine lässige Art mit nach außen gestellten Füßen zu lange Schritte zu machen; doch wenn sie sich breitbeinig über einen Golfball stellt, kann sie ihn endlos weit weg schlagen. In mancher Hinsicht ist sie zu einer echten Athletin geworden, wie ich nicht viele kenne. Selbstredend empfinde ich nur die größte Bewunderung für sie und liebe sie, vom strengen Wortsinn abgesehen, in jeder Weise. Manchmal sehe ich sie unverhofft und von ihr unbemerkt auf der Straße oder in ihrem Wagen, und ich frage mich staunend: Was kann sie jetzt vom Leben wollen? Wie habe ich sie je lieben und dann gehen lassen können?
»Es ist noch kühl«, sagt sie mit ihrer kleinen, festen Stimme, sobald sie in Hörweite ist, die Hände tief in den Taschen ihres Trenchcoats vergraben. Ich liebe diese Stimme. In mancher Hinsicht war es ihre Stimme, die ich zuerst liebte, die spitzen Vokale des mittleren Westens, die knappe, vereiste Syntax: Benton Harbor wird da zu Binton Herbor, Grand Rapids zu Gren Repids. Es ist eine Stimme, die weiß, was als Minimum genügt, und die sich darauf verläßt. Im allgemeinen habe ich Frauen schon immer lieber reden hören als Männer.
Tatsächlich frage ich mich, wie meine eigene Stimme klingt. Ist es eine überzeugende, die Wahrheit wiedergebende Stimme? Oder eine pseudo-aufrichtige, falsche Exehemann-Stimme, die Ärger heraufbeschwört? Ich habe eine Stimme, die wirklich mir gehört, eine ehrliche, irgendwie ländliche Stimme, mehr oder weniger wie ein Gebrauchtwagenverkäufer: eine ungekünstelte Stimme, die mit einer geradlinigen Anwendung der Tatsachen die schlichte Wahrheit aufzudecken hofft. Als Student habe ich diese Stimme eingeübt. »Na schön, okay, aber sieh mal die andere Seite«, sagte ich dann laut vor mich hin. »Schon gut, schon gut.« – »Klar, aber denk doch mal nach.« Es ist vor allem das, was meine Sportreporterstimme ausmacht, obwohl ich mittlerweile nicht mehr übe.
X lehnt sich an den geschwungenen Marmorgrabstein eines Mannes namens Craig – in sicherer Entfernung von mir – und kneift die Lippen zusammen. Bis zu diesem Augenblick ist mir die Kälte nicht aufgefallen. Aber jetzt, da sie’s erwähnt hat, friere ich bis auf die Knochen und wollte, ich hätte einen Pullover angezogen.
Diese Treffen vor Morgengrauen waren meine Idee, und rein theoretisch bieten sie zwei Leuten wie uns eine gute Gelegenheit, die noch verbleibende Vertrautheit miteinander zu teilen. In der Praxis sind sie so unangenehm wie eine Hinrichtung, und es ist durchaus vorstellbar, daß wir nächstes Jahr darauf verzichten, obschon es uns im letzten Jahr genauso ging. Es ist einfach, daß ich mich aufs Trauern nicht verstehe, und X auch nicht. Wir haben beide dafür weder die richtigen Worte noch das Naturell, und so neigen wir eher dazu, die Zeit zu verplaudern, was nicht immer klug ist.
»Hat Paul von unserer Begegnung gestern abend erzählt?« frage ich. Paul, mein Sohn, ist zehn. Gestern abend hatte ich ein unerwartetes Zusammentreffen mit ihm, als er auf der dunklen Straße vor seinem Haus stand, während seine Mutter drin war und nicht wußte, daß ich draußen herumschlich. Wir unterhielten uns über Ralph und wo er jetzt sei und wie man ihn möglicherweise erreichen könne – was dazu führte, daß ich mich auf der Nachhausefahrt besser fühlte. X und ich sind uns prinzipiell darin einig, daß ich meine Besuche nicht heimlich machen solle, aber das war etwas anderes.
»Er hat mir erzählt, Daddy sitze im Dunkeln im Auto und beobachte das Haus wie die Polizei.« Sie sieht mich merkwürdig an.
»Es war einfach ein seltsamer Tag. Aber am Ende war alles wieder in Ordnung.« In Wirklichkeit war es viel mehr als nur ein seltsamer Tag.
»Du hättest ins Haus kommen können. Du bist dort immer willkommen.«
Ich zeige ihr ein gewinnendes Lächeln. »Beim nächsten Mal denk ich dran.« (Manchmal tun wir seltsame Dinge und sagen, es handle sich um Zufälle, obwohl ich sie glauben machen möchte, daß es ein Zufall war.)
»Ich hab mich nur gefragt, ob irgend etwas los ist«, sagt X.
»Nein, ich liebe ihn sehr.«
»Gut«, sagt X und seufzt.
Ich habe mit einer Stimme gesprochen, die mich befriedigt, einer Stimme, die wirklich mir gehört.
X zieht eine Sandwichtüte aus ihrer Tasche, holt ein hartgekochtes Ei heraus, schält es und läßt die Schalen in die Tüte fallen. Wir haben uns eigentlich nicht viel zu sagen. Wir unterhalten uns mindestens zweimal in der Woche am Telefon, größtenteils über die Kinder, die mich nach der Schule besuchen, wenn X noch auf dem Golfplatz draußen zu tun hat. Gelegentlich begegne ich ihr zufällig beim Einkaufen oder beim Essen im August Inn; dann setze ich mich an den Nebentisch, und wir plaudern ein wenig, Stuhllehne an Stuhllehne. Wir haben immer versucht, eine moderne getrennte Familie zu bleiben. Unser Treffen hier gilt nur dem Andenken an ein altes Leben, das wir verloren haben.
Es ist trotzdem eine gute Gelegenheit für ein Gespräch. Letztes Jahr erzählte mir X zum Beispiel, sie würde, wenn sie noch einmal von vorn anfangen könnte, mit dem Heiraten wahrscheinlich warten und erst mal versuchen, die Turnierserie für Berufsgolferinnen in Angriff zu nehmen. Ihr Vater habe sich ihr schon 1966 als Sponsor angetragen, sagte sie – davon hatte sie mir noch nie erzählt. Sie erwähnte nicht, ob sie mich auch dann zu gegebener Zeit geheiratet hätte. Sie sagte jedoch, sie wünschte, ich hätte meinen Roman zu Ende geschrieben, weil dann wahrscheinlich alles besser gelaufen wäre für uns, was mich überraschte. (Sie nahm das später wieder zurück.) Sie sagte mir auch, ohne besonders kritisch zu sein, sie sehe in mir einen Einzelgänger, was mich ebenfalls überraschte. Sie meinte, es sei ein Fehler von mir gewesen, so wenige oberflächliche Freundschaften in meinem Leben geschlossen und mich auf einige wenige Dinge konzentriert zu haben – auf sie, zum Beispiel. Oder auf meine Kinder. Meine Tätigkeit als Sportreporter und mein Dasein als normaler Bürger. Dadurch war ich ihrer Meinung nach für das Unerwartete nicht ausreichend gerüstet. Sie sagte, das liege daran, daß ich meine Eltern nicht genau kenne, auf eine Militärschule gegangen und im Süden aufgewachsen sei, der voller Verräter und Geheimniskrämer und unzuverlässiger Leute sei, worin ich ihr durchaus zustimme, auch wenn ich nie einen von ihnen gekannt habe. All das, meinte sie, habe mit dem Ausgang des Bürgerkrieges zu tun. Es sei viel besser, so wie sie an einem Ort aufgewachsen zu sein, der keine besonderen Merkmale aufweise, wo es keine dunklen Geheimnisse gebe, die einen nur verwirren oder alles komplizieren, und wo man sich ernsthafte Gedanken allenfalls über das Wetter mache.
»Hast du auch hin und wieder was zu lachen?« Sie schält das Ei zu Ende und steckt die Tüte tief in ihre Manteltasche. Sie weiß von Vicki, und es hat seit der Scheidung noch ein paar andere Freundinnen gegeben, von denen die Kinder ihr mit Sicherheit erzählt haben. Aber sie glaubt wohl nicht, daß sich damit an meiner Grundsituation viel geändert hat. Und vielleicht hat sie ja recht. Jedenfalls befriedigt mich dieses offensichtlich vertrauliche und aufrichtige Gespräch sehr, etwas, was ich nicht sehr oft erlebe und was einem eine Ehe wirklich bieten kann.
»Da kannst du Gift drauf nehmen«, sage ich. »Ich glaube, ich komme sehr gut zurecht, wenn du das meinst.«
»Wahrscheinlich meine ich das«, sagt X und sieht dabei ihr gekochtes Ei an, als werfe es ein kleines, aber faszinierendes Problem auf. »Ich mache mir deinetwegen keine echten Sorgen.« Sie mustert mich mit einem taxierenden Blick. Möglicherweise denkt sie nach meiner Begegnung mit Paul am gestrigen Abend, ich hätte den Kopf verloren oder angefangen zu trinken.
»Ich seh mir Johnny an. Da gibt’s immer was zu lachen«, sage ich. »Ich glaube, er wird komischer, so wie unsereins älter wird. Aber danke der Nachfrage.« Ich komme mir ziemlich idiotisch vor. Lächelnd sehe ich sie an.
X knabbert einen winzigen Mäusebissen von ihrem weißen Ei. »Entschuldige, ich wollte nicht in deinem Leben herumschnüffeln.«
»Mein Leben ist ganz in Ordnung.«
X atmet hörbar aus und redet jetzt ganz leise: »Als ich heute morgen im Dunkeln aufwachte, stellte ich mir plötzlich vor, wie Ralph lachte. Ich mußte tatsächlich weinen. Aber ich dachte bei mir, du mußt dich bemühen, dein Leben bis zum letzten auszuleben. Ralph hat sein ganzes Leben in neun Jahren hinter sich gebracht, und ich erinnere mich, daß er gelacht hat. Ich wollte nur sicher sein, daß du’s auch tust. Du hast ein viel längeres Leben.«
»In zwei Wochen hab ich Geburtstag.«
»Glaubst du, du wirst wieder heiraten?« fragt X mit äußerster Förmlichkeit und blickt zu mir auf. Einen Augenblick rieche ich etwas Neues in der schweren Morgenluft, es ist ein Swimmingpool! Irgendwo in der Nähe. Das kühle, wäßrige, vororttypische Chlorbukett, das mich an den kommenden Sommer denken läßt und an all die anderen besseren Sommer in meiner Erinnerung. Es ist ein Kennzeichen der Vororte, die ich liebe, daß dir von Zeit zu Zeit ein Swimmingpool oder ein Holzkohlengrill oder ein Laubfeuer – Dinge, die du nie zu Gesicht bekommst – provozierend in die Nase steigen.
»Ich weiß nicht«, antworte ich. Dabei wäre es mir viel lieber, ich könnte sagen: Niemals, jede Wette, doch ich nicht. Nur daß meine tatsächliche Antwort der Wahrheit näher kommt. Und im Handumdrehen ist der seiden-sommerliche Duft weg, und der Geruch des Schmutzes und der stumpfen Grabsteine hat seinen ihm zustehenden Platz zurückgewonnen. In der zitternden grauen Dämmerung geht auf der anderen Seite des Zauns in einem Fenster im zweiten Obergeschoß meines Hauses das Licht an. Bosobolo, mein afrikanischer Mieter, ist wach. Sein Tag beginnt, und ich sehe seine dunkle Gestalt am Fenster vorbeigehen. Über dem Friedhof drüben, in der anderen Richtung, sehe ich gelbe Lichter in der Hütte des Verwalters, neben der der grüne Kleinbagger von John Deere steht, mit dem die Gräber ausgehoben werden. Aus der Kirche Sankt Leos des Großen erklingt das Glockenspiel und ruft zum Karfreitagsgebet. »Christ ist gestorben, Christ ist gestorben.« (Ich glaube allerdings, es ist »Stabat Mater Dolorosa«.)
»Ich glaube, ich werde wieder heiraten«, sagt X beiläufig. Wen?, frage ich mich.
»Wen?« Doch nicht – bitte schön – einen der Klubhauskönige mit den fetten Brieftaschen, einen dieser so gesund und munter wirkenden kräftigen Typen im grünen Sportsakko, die mit ihr fürs Wochenende zur Trapp Family Lodge fahren oder sie zu Spritztouren in die Pocono-Berge einladen, wo sie sich mittelmäßige Komiker reinziehen und sich auf Wasserbetten lieben. Ich hoffe ohne Hoffnung, daß es keiner von denen ist. Ich weiß alles über diese Typen. Die Kinder beschreiben sie mir. Sie fahren alle Oldsmobiles und tragen mit Quasten geschmückte Schuhe. Und es spricht sehr viel dafür, mit ihnen auszugehen, das gebe ich zu. Sie sollen ruhig ihr Geld ausgeben und die verfügbare Zeit genießen. Bestimmt sind es anständige Burschen. Aber sie sind nicht zum Heiraten.
»Na ja, einen Software-Verkäufer vielleicht«, sagt X. »Oder einen Immobilienmakler. Hauptsache, ich kann ihn im Golf schlagen und herumkommandieren.« Mit hängenden Mundwinkeln und einem aufgesetzten traurigen Lächeln sieht sie mich an und zieht die Schultern wie zu einem Achselzucken hoch. Doch dann fängt sie unverhofft und mit einem Kopfnicken an zu weinen, als wüßten wir beide davon und hätten damit rechnen müssen und als wäre ich irgendwie dafür verantwortlich, was ich irgendwie auch bin.
Das letzte Mal habe ich X nach dem Einbruch in unser Haus weinen sehen, als sie auf der Suche nach Dingen, die gestohlen worden sein könnten, einige Briefe fand, die mir eine Frau aus Blanding in Kansas geschrieben hatte. Ich weiß nicht, warum ich sie aufbewahrte. Sie bedeuteten mir wirklich nichts. Ich hatte mich vor Monaten mit der Frau getroffen, und auch da nur einmal. Aber ich steckte damals in den dichtesten Tiefen meiner Träume und brauchte – zumindest glaubte ich das – ein Ziel vor Augen, das vom Leben wegführte, auch wenn ich nicht plante, sie jemals wiederzusehen und wirklich vorhatte, die Briefe wegzuwerfen. Die Einbrecher hatten Polaroidbilder von unseren leeren Zimmern im Haus herumliegen lassen, die wir dann fanden, als wir von einer Vorstellung der Thirty-Nine Steps im Playhouse zurückkamen, und dazu an die Wohnzimmerwand gesprayt: »Wir sind die Angeschmierten.« Ralph war schon zwei Jahre tot. Die Kinder waren bei ihrem Großvater im Huron Mountain Club, und ich war gerade von meiner Lehrtätigkeit am Berkshire College zurück und saß mehr oder weniger untätig im Haus herum, fühlte mich so unnütz wie eine taube Nuß, war aber sonst ganz guter Dinge. X fand die Briefe in einer Schublade meines Schreibtischs, als sie nach einem Strumpf voller Silberdollars schaute, die meine Mutter mir hinterlassen hatte, setzte sich auf den Boden, um sie zu lesen, und drückte sie mir in die Hand, als ich mit einer Liste fehlender Kameras, Radios und Angelgeräte ins Zimmer kam. Sie fragte, ob ich etwas zu sagen hätte, und als nichts kam, ging sie ins Schlafzimmer und fing an, mit einem Hammer und einer Brechstange ihre Aussteuertruhe auseinanderzunehmen. Sie schlug sie kurz und klein, trug die Stücke zum offenen Kamin und verbrannte sie, während ich draußen im Garten stand, Cassiopeia und die Zwillinge anschmachtete und mich unverwundbar fühlte, denn da waren ja meine Träume und eine eigenartige Belustigung, zu der mir fast alles in meinem Leben Anlaß geben konnte. Man hätte meinen können, daß ich in diesem Augenblick »in mir ruhte«. Doch in Wirklichkeit war ich Lichtjahre von allem entfernt.
Kurz darauf kam X aus dem hellerleuchteten Haus, während der Rauch von ihrer Truhe aus dem Schornstein quoll – es war Juni –, setzte sich in einem anderen Teil des dunklen Gartens in einen Liegestuhl und weinte laut. Hinter einem großen Rhododendron im Dunkeln lauernd, redete ich mit Worten voller Hoffnung und ohne Trost auf sie ein, aber ich glaube nicht, daß sie mich hörte. Meine Stimme war inzwischen so leise geworden, daß keiner außer mir etwas hören konnte. Ich blickte hinauf zu dem Rauch, der, wie ich dann erfuhr, von ihrer Aussteuertruhe mit all den Kostbarkeiten stammte, den Speisekarten, abgerissenen Eintrittskarten, Fotos, Hotelrechnungen, Tischkarten, ihrem Hochzeitsschleier, und fragte mich, was es um alles in der Welt gewesen sein könnte, was nun in die klare geistlose New Jersey-Nacht entschwebte. Ich mußte an den Rauch denken, der einen neuen Papst ankündigt – einen neuen Papst! –, wenn mir das heute jemand glauben kann, unter diesen Umständen. Und vier Monate später war ich geschieden. Das alles kommt mir nun seltsam vor, weit weg, als sei es einem anderen zugestoßen, und ich hätte nur davon gelesen. Aber das war damals mein Leben, und es ist jetzt mein Leben, und ich bin dennoch ganz guter Dinge. Auch das lernt man als Sportreporter: Es gibt keine transzendenten Themen im Leben. Dinge sind ausnahmslos hier, und sie sind vorbei, und das muß genügen. Die andere Sicht der Dinge ist eine Lüge der Literatur und der Geisteswissenschaften, ein Grund dafür, daß ich als Lehrer keinen Erfolg hatte, und auch ein Grund, weshalb ich meinen Roman in die Schublade gelegt und nicht wieder herausgeholt habe.
»Ja, natürlich«, sagt X und schnieft. Sie hat fast aufgehört zu weinen, obwohl ich nicht versucht habe, sie zu trösten (ein Privileg, das mir nicht mehr zusteht). Sie hebt den Blick zum milchigen Himmel und schnieft noch einmal. In der Hand hält sie immer noch das angeknabberte Ei. »Als ich im Dunkeln weinte, mußte ich denken, was für ein großer, netter Junge Ralph Bascombe heute wäre und daß ich siebenunddreißig bin, was nun mal so ist. Ich fragte mich, was wir alle eigentlich tun sollten.« Sie schüttelt den Kopf und preßt die Arme fest an den Bauch, wie ich das bei ihr schon lange nicht mehr gesehen habe. »Es ist nicht deine Schuld, Frank. Ich dachte nur, es wäre in Ordnung, in deiner Gegenwart zu weinen. Es ist meine Vorstellung von Kummer. Ist das nicht typisch Frau?«
Sie wartet jetzt darauf, daß ich etwas sage, daß ich uns von jenem alten Elend der Erinnerungen und des Lebens befreie. Ganz offensichtlich spürt sie, daß heute etwas Seltsames in der Luft liegt, ein frischer Wind, der eine dauerhafte Veränderung ahnen läßt. Und das kann ich, genau das kann ich glücklicherweise mit meinem Optimismus einen Tag oder wenigstens einen Morgen oder einen Augenblick zurückgewinnen, wenn alles dem Kummer ausgeliefert scheint. Meine einzige Charakterstärke, die manches ausgleicht, ist wahrscheinlich, daß ich gut bin, wenn es hart auf hart geht. Mit dem Erfolg komme ich schlechter zurecht.
»Vielleicht sollte ich ein Gedicht vorlesen«, sage ich mit dem versöhnlichen Lächeln eines abgewiesenen Liebhabers.
»Ich glaube, ich hätte diesmal eines mitbringen sollen, nicht wahr?« sagt X und wischt sich die Augen. »Statt ein Gedicht zu bringen, hab ich geweint.« Die Tränen haben sie zu einem kleinen Mädchen gemacht.
»Laß mal, das macht nichts«, sage ich und fingere in meiner Hosentasche nach dem Gedicht, das ich im Büro fotokopiert und mitgebracht habe, für den Fall, daß X nicht daran denken würde. Letztes Jahre hatte ich Housmans Auf den Tod eines jungen Sportlers mitgenommen und den Fehler gemacht, es vorher nicht durchzulesen. Ich hatte es seit meinen Studententagen nicht mehr gelesen, aber dem Titel zufolge glaubte ich mich zu erinnern, es sei gut vorzulesen. Was es nicht war. Es redete viel zu nüchtern – und das auf eine verschwommene Art – von echten Sportlern, und das ist ein Thema, bei dem ich mich sehr erregen kann. Ralph war im Grunde genommen nicht sehr sportlich gewesen. Ich kam kaum über »Bewohner einer stilleren Stadt« hinaus, als ich schon abbrechen mußte und nur noch dasitzen und auf den bescheidenen Grabstein aus rotem Marmor und die kleine Inschrift RALPH BASCOMBE starren konnte.
»Housman haßte Frauen«, hatte X in die schreckliche Stille hinein gesagt, während ich nur dasaß. »Das geht nicht gegen dich. Mir ist das nur wieder eingefallen, aus irgendeiner Vorlesung. Ich glaube, er war ein alter Päderast, der Ralph geliebt und uns gehaßt hätte. Nächstes Jahr bring ich ein Gedicht mit, wenn’s dir recht ist.«
»Gut«, hatte ich kläglich geantwortet. Und dann sagte sie, daß ich meinen Roman hätte zu Ende schreiben sollen und daß ich ein Einzelgänger sei und daß sie damals in den sechziger Jahren den Wunsch gehabt habe, die Turnierserie für Berufsgolferinnen zu spielen. Ich glaube, ich tat ihr leid – ich bin mir sogar sicher –, aber ich tat mir auch selbst leid.
»Hast du wieder ein Housman-Gedicht mitgebracht?« fragt sie jetzt grinsend, wendet sich dann ab und wirft ihr angeknabbertes Ei, so weit sie kann, zwischen die Grabsteine und Ulmen des alten Friedhofteils, wo es geräuschlos aufschlägt. Sie wirft in der Art eines Fängers beim Baseball, in einer eleganten Ausholbewegung am Ohr vorbei und dann schnurgerade in den Schatten. Ich bewundere ihre positive Haltung. Den Verlust eines Kindes zu betrauern, wenn man zwei andere hat, ist eine harte Angelegenheit. Und wir sind darin nicht sehr geübt, auch wenn für uns persönliche Würde und Zuneigung im Mittelpunkt stehen, weil wir nicht wollen, daß Ralphs Tod und unser Verlust sich in der Zukunft verfangen und dabei heimlich unser Leben ruinieren. In gewissem Sinn können wir hier nichts falsch machen.
Draußen auf der Constitution Street hat der Kundendienstwagen eines Installateurs vor der Ampel angehalten. Easler’s Philco Repair, gefahren von Sid (früher bei Sid’s Service, ein Bankrotteur). Er hat so manches Mal in meinem Haus gearbeitet und ist nun unterwegs zum Marktplatz, um sich in The Coffee Spot eine Tasse zu genehmigen, bevor er sich auf sein Tagespensum an Küchen und Kellern und verstopften Toiletten stürzt. Der Tag hat endgültig begonnen. Ein einzelner Fußgänger – ein Mann – ist auf dem Gehweg zu sehen, einer der wenigen Neger in der Stadt; in einem hellen, pflegeleichten Anzug ist er auf dem Weg zum Bahnhof. Der Himmel ist immer noch milchig-weiß, aber vielleicht setzt sich die Sonne durch, bevor ich mit Vicki zur Motor City fahre.
»Kein Housman diesmal«, sage ich.
»Also gut«, sagt X lächelnd und setzt sich auf Craigs Grabstein, um zuzuhören. »Wenn du meinst.« Die vielen Lichter auf den Rückseiten der Häuser in meiner Straße verblassen im Tageslicht. Mir ist jetzt wärmer.
Es ist eine »Meditation« von Theodore Roethke, der auch die Universität von Michigan besucht hat, was X wissen wird, und ich beginne in meiner besten, glaubwürdigsten Stimme, als könne mein toter Sohn dort unten mithören:
»Aufgesucht hab ich die öden einsamen Weiten hinter dem Auge …«
X schüttelt schon den Kopf, noch bevor ich bei der zweiten Zeile bin, und ich breche ab und blicke sie fragend an.
Sie schiebt die Unterlippe vor und rührt sich nicht von dem Grabstein. »Ich mag das Gedicht nicht«, sagt sie ganz sachlich.
Ich wußte, sie würde es kennen und ihre eigene Meinung davon haben. Sie ist immer noch ein eigensinniges Michigan-Mädchen, das feste Vorstellungen von allem hat und enttäuscht ist, wenn der Rest der Welt nicht denkt wie sie. So ein starkes, strammes, klarblickendes Mädchen sollte im Leben jedes Mannes einen Platz haben. Sie allein sind Grund genug für die Existenz des mittleren Westens, denn dort gedeihen die meisten von ihnen. Ich spüre, wie die Spannung wie ein Fieber von mir auf sie übergreift. Möglicherweise ist es keine gute Idee, ein Gedicht über dem Grab eines kleinen Jungen zu lesen, der sich aus Gedichten nie etwas gemacht hat.
»Ich dachte mir schon, daß du’s kennst«, sage ich mit einer verbindlichen Stimme.
»Ich sollte eigentlich nicht sagen, daß ich es nicht mag«, bemerkt X kühl. »Ich glaube einfach nicht daran, das ist alles.«
Es ist ein Gedicht über die Möglichkeit, sich vom Alltäglichen glücklich machen zu lassen – von Insekten, Schatten, dem Farbenspiel im Haar einer Frau –, auch etwas, von dem ich sehr viel halte. »Wenn ich es vorlese, denke ich immer, ich bin es, der da redet«, sage ich.
»Ich glaube nicht, daß die verschiedenen Dinge in diesem Gedicht irgend jemand glücklich machen würden. Sie machen einen vielleicht nicht unglücklich, aber das ist auch schon alles«, sagt X und gleitet von dem Grabstein. Sie lächelt auf eine Art, die mir nicht gefällt, schmallippig und geringschätzig, als irrte ich mich ihrer Meinung nach in allem, und als finde sie das amüsant. »Manchmal denke ich, niemand kann mehr glücklich sein.« Sie steckt die Hände in ihre Manteltaschen. Sie hat wahrscheinlich um sieben eine Stunde zu geben oder ein Seminar über das Durchschwingen, und sie ist innerlich schon weit, weit weg.
»So wie ich das sehe, sind wir alle auf den Rest unseres Lebens losgelassen worden«, sage ich voller Hoffnung. »Hab ich nicht recht?«
Sie starrt auf das Grab unseres Sohnes, als horche er und finde es peinlich, uns zu hören. »Kann schon sein.«
»Wirst du tatsächlich heiraten?« Ich spüre, daß meine Augen ganz groß werden, als wüßte ich die Antwort im voraus. Wir sind plötzlich wie Bruder und Schwester, Hänsel und Gretel, die ihre Flucht in die Sicherheit planen.
»Ich weiß nicht.« Sie zuckt leicht mit den Schultern, wieder wie ein Mädchen, aber es sieht ganz nach Resignation aus. »Es gibt Leute, die mich heiraten wollen. Aber ich habe vielleicht schon ein Alter erreicht, wo ich keine Männer mehr brauche.«
»Vielleicht solltest du heiraten. Vielleicht würde es dich glücklich machen.« Ich glaube natürlich keine Sekunde daran. Ich bin selber bereit, sie wieder zu heiraten, das Leben zurück ins rechte Gleis zu bringen. Mir fehlt die reizvolle Ausschließlichkeit der Ehe, der feste Halt und die klare Richtung. X fehlt das offensichtlich auch. Es ist das, was uns beiden abgeht. Wir müssen uns nun alles ausdenken, da wir von Rechts wegen nichts Eigenes mehr haben.
Sie schüttelt den Kopf. »Worüber habt ihr gestern abend gesprochen, du und Pauly? Ich hatte das Gefühl, es waren alles Männergeheimnisse, die mich nichts angehen. Ich hasse so was.«
»Wir haben über Ralph gesprochen. Paul vertritt die Theorie, daß wir ihn erreichen können, wenn wir eine Brieftaube nach Cape May schicken. Es war ein gutes Gespräch.«
X lächelt beim Gedanken an Paul, der auf seine Art mindestens ebenso verträumt ist, wie ich es je war. Ich hatte immer gedacht, daß X diesen Zug an ihm nie besonders mochte, eher Ralphs Bestimmtheit, die ihr näher und daher bewundernswert war. Als er mit der fürchterlichen Reyeschen Krankheit in der Klinik war, setzte er sich eines Tages im Delirium im Bett auf und sagte: »Die Ehe ist eine verdammt ernste Angelegenheit, besonders in Boston« – etwas, das er in Bartlett’s gelesen hatte, in dem er gern blätterte, um Sätze auswendig zu lernen und dann zu zitieren. Ich brauchte sechs Wochen, um die Bemerkung zu Marquand zurückzuverfolgen. Und zu dem Zeitpunkt war er tot und lag bereits hier. Doch X freute sich darüber; für sie bewies es, daß sein Verstand auch im tiefen Koma gut weiterarbeitete. Unglücklicherweise wurde der Spruch für die restliche Zeit unserer Ehe eine Art Motto, eine unbeabsichtigte Verwünschung, die Ralph uns mitgab.
»Deine neue Frisur gefällt mir«, sage ich. Neu daran war eine Art Tolle im Nacken, die ihr sehr gut steht. Unser Treffen ist längst beendet, aber ich will noch nicht gehen.
X greift sich eine Strähne, hält sie in gerader Linie vom Kopf weg und versucht, sie aus den Augenwinkeln zu sehen. »Ein bißchen aggressiv, findest du nicht?«
»Nein.« Und das meine ich wirklich so.
»Na ja, sie hatten so eine komische Länge, ich mußte was damit tun. Zuhause gab es einen Aufschrei, als sie es sahen.« Sie lächelt, als werde ihr in diesem Moment klar, daß aus Kindern unsere Eltern werden, während wir uns einfach in Kinder zurückverwandeln. »Du kommst dir doch nicht alt vor, Frank, oder?« Sie wendet sich ab und blickt über den Friedhof hinaus. »Ich weiß nicht, wie ich auf all diese beschissenen Fragen komme. Ich fühle mich heute alt. Es ist bestimmt nur, weil du neununddreißig wirst.«
Der schwarze Mann hat auf der Constitution Street die nächste Ecke erreicht und wartet nun gegenüber der neuen Bücherei darauf, daß die Ampel von Rot auf Grün umspringt. Der Kundendienstwagen des Installateurs ist weg, und ein gelber Minibus hält und läßt an derselben Ecke schwarze Hausangestellte aussteigen. Es sind massige Frauen in weißen, zeltähnlichen Arbeitskleidern; sie plaudern und schwenken ihre großen Schläger-Handtaschen und warten darauf, daß ihre weißen Herrinnen kommen und sie abholen. Der Mann und die Frauen reden nicht miteinander. »Ist das nicht furchtbar traurig«, sagt X mit einem Blick auf die Frauen. »Irgendwie bricht mir das Herz. Ich weiß nicht, warum.«
»Ich komme mir kein bißchen alt vor«, sage ich, glücklich, eine Frage ehrlich beantworten und vielleicht noch einen guten Rat anbringen zu können. »Ich muß meine Haare ein bißchen öfter waschen. Und manchmal hämmert beim Aufwachen mein Herz wie wild drauflos – aber Fincher Barksdale sagt, ich brauche mir deswegen keine Sorgen zu machen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, eine Art von Drang, meinst du nicht?«
X blickt immer noch zu den Hausangestellten hinüber, die sich zu fünft unterhalten und dabei in die Richtung sehen, aus der sie abgeholt werden. Seit unserer Scheidung hat sie die Fähigkeit entwickelt, völlig geistesabwesend zu sein. Sie kann sich mit einem unterhalten und gleichzeitig tausend Meilen weit weg sein. »Du bist sehr anpassungsfähig«, sagt sie leichthin.
»Das bin ich. Ich weiß, du hast in deinem Haus nicht die Möglichkeit, auf der Terrasse zu schlafen, aber du solltest versuchen, in den Kleidern und mit ringsum offenen Fenstern zu schlafen. Wenn du aufwachst, bist du sofort startklar. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile.«
X zeigt mir wieder ihr schmallippiges, herablassendes Lächeln, das ich nicht mag. Wir sind nicht mehr Hänsel und Gretel. »Gehst du immer noch zu deiner Handleserin, wie heißt sie doch gleich?«
»Mrs. Miller. Nein, nicht mehr so oft.« Ich werde ihr nicht auf die Nase binden, daß ich gestern abend zu ihr wollte.
»Hast du eigentlich das Gefühl, daß du inzwischen alles verstehst, was geschehen ist – mit uns und unserem Leben?«
»Manchmal. Heute sind meine Empfindungen, was Ralph angeht, ziemlich normal. Es sieht nicht so aus, als könnte es mich wieder verrückt machen.«
»Stell dir vor«, sagt X, ohne mich anzusehen, »heute nacht lag ich im Bett und dachte, Fledermäuse flatterten durch mein Zimmer, und als ich die Augen zumachte, sah ich weit im Hintergrund nur eine Horizontlinie, und alles war leer und flach wie ein langer Eßtisch, an dem nur für einen gedeckt war. Ist das nicht schrecklich?« Sie schüttelt den Kopf. »Vielleicht würde ich besser so ein Leben führen wie du.«
Eine leichte Verstimmung steigt in mir auf, aber das ist nicht der richtige Ort für eine Verstimmung. In X’ Augen ist mein Leben eine vergnügtere, natürlichere Angelegenheit als ihr eigenes Leben – und gewiß auch als das Leben, das ich tatsächlich führe. Am liebsten würde sie mir wahrscheinlich wieder sagen, daß ich meinen Roman hätte zu Ende schreiben sollen, anstatt aufzustecken und als Sportreporter zu arbeiten, und daß auch sie einiges anders hätte machen müssen. Aber das wäre nicht richtig, zumindest was mich betrifft – oft genug hatte sie das sogar selber gesagt. Sie sieht jetzt alles so düster. Wenn sich in ihrem Wesen etwas durch unsere Scheidung verändert hat, dann ihre Spannkraft, die möglicherweise nachgelassen hat, und besorgte Gedanken wegen des Älterwerdens sind ein Beweis dafür. Wenn ich könnte, würde ich sie aufheitern, aber das ist eine der Gaben, die ich längst eingebüßt habe.
»Ich muß mich schon wieder entschuldigen«, sagt sie. »Ich bin heute einfach deprimiert. Durch dein Weggehen hab ich irgendwie das Gefühl, daß du zu einem neuen Leben aufbrichst und ich nicht.«
»Hoffentlich gelingt mir das«, sage ich, »ich habe da meine Zweifel. Ich hoffe, es gelingt dir.« Tatsächlich würde mir nichts besser gefallen, als wenn sich mir heute eine ganz neue, bunte Welt eröffnete, obwohl mir auch mein jetziges Leben durchaus gefällt. Ich denke an ein hübsches Zimmer im Pontchartrain, ein Jägersteak und ein Salatbüfett im langsam rotierenden Dachrestaurant, ein Flutlichtspiel der Tigers. Ich brauche nicht viel zu meinem Glück.
»Wünschst du dir manchmal, du wärst jünger?« fragt X trübsinnig.
»Nein, ich bin auch so ganz zufrieden.«
»Ich wünsche es mir die ganze Zeit«, sagt sie. »Es ist idiotisch, ich weiß.«
Es gibt nichts, was ich darauf sagen kann.
»Du bist ein Optimist, Frank.«
»Das hoffe ich«, sage ich mit einem treuherzigen Lächeln.
»Gewiß, gewiß.« Und damit dreht sie sich um und macht sich zwischen den Grabsteinen rasch auf den Weg nach draußen, den Kopf zum weißen Himmel erhoben, die Hände tief in den Taschen, ganz das Mädchen aus dem mittleren Westen, das im Augenblick vom Glück verlassen ist, das aber bald wieder obenauf ist, so gut wie neu. Von der Kirche Sankt Leos des Großen her höre ich die Glocken sechs Uhr schlagen, und aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, daß ich sie lange nicht wiedersehen werde, daß irgend etwas vorüber ist und daß irgend etwas angefangen hat, aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, was.
Zwei
Im Grunde genommen wollen wir nur an dem Punkt anlangen, wo die Vergangenheit nichts mehr über uns aussagt und an dem wir mit unserem Leben fortfahren können. Kann die Lebensgeschichte eines Menschen jemals sehr viel über ihn enthüllen? Meiner Ansicht nach messen Amerikaner in ihrem Bemühen, sich selbst zu definieren, ihrer Vergangenheit zuviel Gewicht bei, und das kann tödlich sein. Ich weiß, ich werde bei Romanen immer tiefbetrübt (manchmal überspringe ich diese Abschnitte ganz; manchmal mache ich das Buch zu und nehme es nie wieder in die Hand), wenn der Autor seine geschwätzige, obligatorische Reise an den Meeresgrund der Vergangenheit antritt. Bei den meisten von uns, seien wir ehrlich, ist die Vergangenheit kein sehr dramatisches Thema, und sie sollte gerade uninteressant genug sein, um uns augenblicklich freizugeben, wenn wir bereit sind (obschon es stimmt, daß wir, wenn wir diesen Moment erreichen, oft entsetzliche Angst haben, uns nackt fühlen, wie frisch gehäutet und nichts zu sagen haben).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!