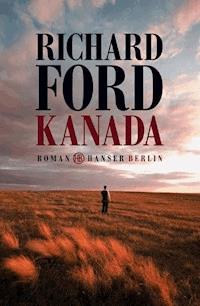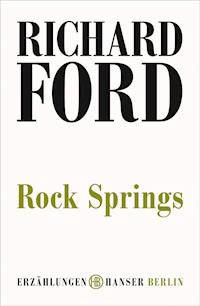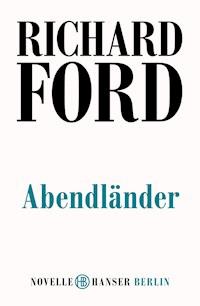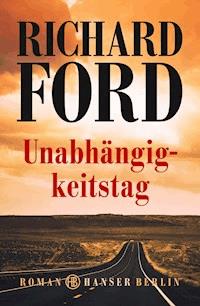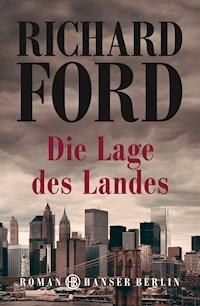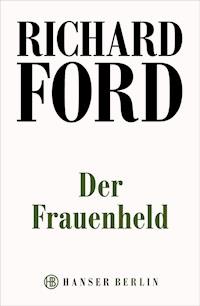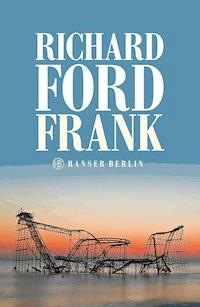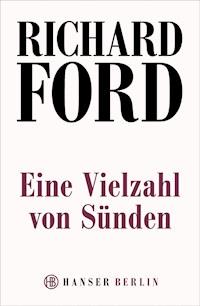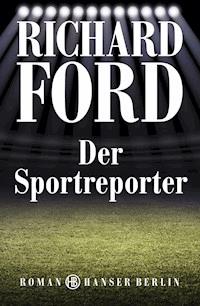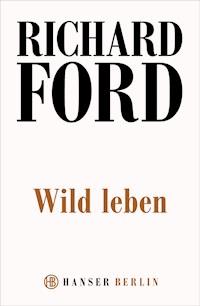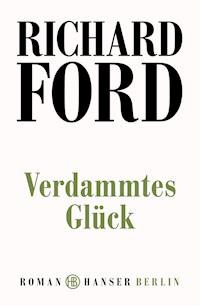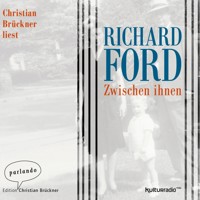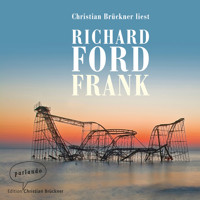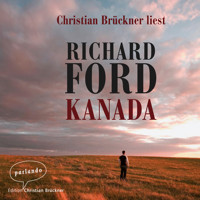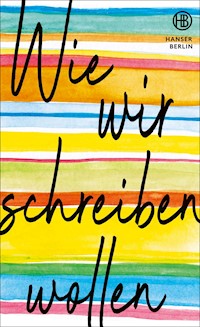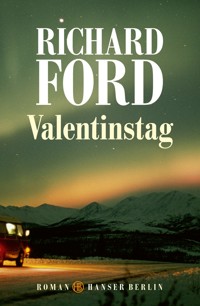
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Richard Fords Frank Bascombe ist zurück. Lässiger und berührender hat noch niemand seinen Frieden mit dem Schicksal gemacht. „Ein großes Buch. Sarkastisch, unsentimental, voller Liebe.“ (Christian Brückner) Richard Fords berühmteste Figur, Frank Bascombe, ist zurück. Und nun, mit 74, wird seine unangefochtene Meisterschaft, auf lässige Weise den Frieden mit sich und dem Leben zu machen, noch einmal extrem gefordert. Sein Sohn Paul, 47, ist krank, ihm bleibt nicht viel Zeit. Eng waren beide nie, doch jetzt verbindet sie die Bereitschaft, sich mit ungelenker Liebe auf das Kommende einzulassen, und ihr Blick für die Komik des Abseitigen. Für ein letztes Abenteuer mieten sie ein Wohnmobil, einmal von Minnesota bis zum Mount Rushmore – der Weg ist das Ziel. Ford, der große Chronist des modernen Amerika, schickt seine Helden auf eine Odyssee durch die scheinbar banalen Attraktionen im Herzen des Landes und zeigt uns mit jeder kleinen Provinzhölle eine neue Facette des amerikanischen Lebens, das wir so gut zu kennen glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Richard Fords Frank Bascombe ist zurück. Lässiger und berührender hat noch niemand seinen Frieden mit dem Schicksal gemacht. »Ein großes Buch. Sarkastisch, unsentimental, voller Liebe.« (Christian Brückner)Richard Fords berühmteste Figur, Frank Bascombe, ist zurück. Und nun, mit 74, wird seine unangefochtene Meisterschaft, auf lässige Weise den Frieden mit sich und dem Leben zu machen, noch einmal extrem gefordert. Sein Sohn Paul, 47, ist krank, ihm bleibt nicht viel Zeit. Eng waren beide nie, doch jetzt verbindet sie die Bereitschaft, sich mit ungelenker Liebe auf das Kommende einzulassen, und ihr Blick für die Komik des Abseitigen. Für ein letztes Abenteuer mieten sie ein Wohnmobil, einmal von Minnesota bis zum Mount Rushmore — der Weg ist das Ziel.Ford, der große Chronist des modernen Amerika, schickt seine Helden auf eine Odyssee durch die scheinbar banalen Attraktionen im Herzen des Landes und zeigt uns mit jeder kleinen Provinzhölle eine neue Facette des amerikanischen Lebens, das wir so gut zu kennen glauben.
Richard Ford
Valentinstag
Roman
Aus dem Englischen von Frank Heibert
Hanser Berlin
Kristina
Glück
In letzter Zeit denke ich öfter als früher über das Glück nach. Das ist, egal in welcher Lebensphase, nie eine müßige Überlegung; aber für mich, Jahrgang 1945, ist es ein Bonusthema im oberen Preissegment — während ich mich allmählich der in der Bibel festgesetzten Zuteilung nähere.
Als früherer Presbyterianer (nicht praktizierend, nicht gläubig, wie die meisten Presbyterianer) bin ich mit einer Version von Glücksvorstellung komfortabel durchs Leben gekommen, die wohl auch der alte Knox hätte gelten lassen, auf dem schmalen Grat zwischen den verschwisterten Leitsätzen: »Was uns nicht umbringt, macht uns stärker« und »Alles, was nicht niederknüppelndes Unglück ist, zählt als Glück«. Wobei der zweite eher an Augustinus gemahnt; aber all diese komplexen Systematiken bringen einen zu demselben Rätsel: »Und was jetzt?«
Dieser Mittelweg hat in den meisten Situationen, die mir das Leben so hingeschmissen hat, ziemlich gut funktioniert. Ein allmähliches, manchmal unmerkliches Voranschreiten in der Zeit, ohne dass irgendwas Großartiges passierte, nichts Unüberlebbares dabei und das meiste ganz in Ordnung. Der schmerzliche Tod meines ersten Sohnes (ich habe noch einen). Scheidung (zwei Mal!). Ich hatte Krebs, meine Eltern sind gestorben. Auch meine erste Frau ist gestorben. Mir wurde mit einem AR-15 in die Brust geschossen, und dabei bin ich fast selbst gestorben, aber dann, unwahrscheinlicherweise, doch nicht. Ich habe Hurrikane überlebt und eine, manche würden sagen: Depression (falls es überhaupt eine war, dann eine leichte). Aber nichts hat mich ganz nach unten trudeln lassen, so dass ich auf die Idee gekommen wäre, mir selbst den Stecker zu ziehen. Viel ziemlich gute zeitgenössische Literatur, die ich abends im Bett lese, handelt — wenn ich das richtig durchschaue — von diesen Themen, das Glück entzieht sich immer, bleibt aber das Ziel.
Und doch. Ich weiß nicht, ob Glücklichsein der wichtigste Zustand ist, den wir alle anstreben sollten. (Es gibt Statistiken dazu, Doktorarbeiten, Forschungsbereiche mit Stipendien, einen Glücks-Thinktank an der UCLA.) Anscheinend nimmt bei den meisten Erwachsenen das Glücksgefühl im Lauf ihres dritten und vierten Lebensjahrzehnts ab und erreicht Anfang des fünften einen Tiefpunkt, und dann nimmt es in den Siebzigern manchmal wieder zu — sicher ist das aber nicht. Zu wissen, wovor man im Leben Angst hat, ist vielleicht viel nützlicher. Als der Dichter Larkin von einem Interviewer gefragt wurde: »Meinen Sie, Sie hätten im Leben glücklicher sein können?«, antwortete er: »Nein, es sei denn, ich wäre ein anderer gewesen.« Und so würde ich über den Daumen gepeilt schon sagen, ich bin glücklich gewesen. Zumindest glücklich genug, dass ich Frank Bascombe bin und kein anderer. Bis vor kurzem hat das zum Weitermachen vollauf genügt.
In letzter Zeit allerdings, seit mein überlebender Sohn Paul Bascombe, 47 Jahre alt, krank ist, mit deutlichen Symptomen von ALS (dem Lou-Gehrig-Syndrom — obwohl es mittlerweile Spekulationen gibt, dass das Eiserne Pferd gar nicht ALS hatte), musste ich dem Thema Glück mehr Aufmerksamkeit widmen.
*
Seit achtzehn Monaten habe ich einen Teilzeitjob bei den Hausflüsterern in Haddam, New Jersey, wo ich ein einsames Seniorenleben lebe, inkl. Schlüsselkarte und Bibliotheksausweis. Die Hausflüsterer ist eine Boutique-Immobilienfirma, eingebettet in ein größeres, vertikal integriertes Immobilienunternehmen, das komplett meinem früheren Angestellten Mike Mahoney gehört. Mike, mein Mitarbeiter ab den Neunzigern, in denen ich — wir — an der Küste New Jerseys rasend erfolgreich Häuser verkaufte(n), ist nachweislich Tibeter — vor langer Zeit änderte er seinen Namen Lobsang Dhargey in »etwas Irischeres« — und schwerreich geworden, nachdem ihm ein neuer Markt aus finanzstarken tibetischen Investoren aufgefallen war, die scharf darauf waren, vom letzten Hurrikan ramponierte Strandimmobilien in New Jersey zu kaufen. (Beim Reichwerden geht es fast immer darum, schneller als die Konkurrenten einen Markt zu erkennen. Aber wer hätte gedacht, dass Tibeter über so viel flüssiges Kapital verfügen, und wo hatten die das her?)
Mike hat zügig den Verkauf von Strandliegenschaften-mit-Schäden hinter sich gelassen und seine neue Vermögenslage dazu genutzt, den Ankauf Hunderter früher ganz normaler Familienhäuser zu organisieren — in Topeka, Ashtabula, Cedar Rapids und Caruthersville, Georgia —, die aufgrund von Steuern, verzögerter Instandhaltung, Krankheit der Besitzer, Sorgen um das Festgehalt, um ausstehende Unterhaltszahlungen usw. für die Besitzer zu einem Problem geworden waren. Diese Häuser renovierte er billig (das tut er immer noch), wobei er outgesourcte Bautrupps einsetzt, Instandhaltungsfirmen, die ihm gehören, damit beauftragt, sich um die Häuser zu kümmern, dann wandelt er sie in Wertpapiere um, die er scheibchenweise als Anteile an der Börse von Tokio jedem verkauft, der bereit ist, ein Risiko einzugehen (oft andere Tibeter). Wonach er sie dann vermietet — manchmal an ihre früheren Besitzer. Der ganze Schwindel ist lückenlos legal, nach dem »verlorenen Immobilien-Jahrzehnt« schürft der Bankensektor nach reicheren Flözen. Seine Mantel-Firma heißt HLP, Himalaya Lösungen und Partner. (Die Partner gibt es nicht.)
Die Hausflüsterer, wo ich offiziell arbeite, ist Mikes Baby, ein Westentaschen-»Nischen«-Projekt, um hochklassige Immobilienkunden zu finden, die aus ihren ureigensten Gründen beim Hauskauf absolute Hochsicherheitslevel-Anonymität wünschen. In allen Stadien des Hauserwerbs, sogar über den eigentlichen Kauf hinaus, gibt es Unmengen betuchter Leute, die einfach nicht wollen, dass die Welt auch nur das Schwarze unterm Fingernagel über sie erfährt: Leute, die ein Haus kaufen, aber es nie bewohnen, besichtigen, ja betreten wollen; Leute, die ein Haus für Opa Beppo haben wollen, bis er »dahinscheidet« und das Testament durch ist. Oder Leute, die tatsächlich ein Haus kaufen, um darin zu wohnen, aber sie sind berühmte Rockstars, in Ungnade gefallene Politiker oder russische Dissidenten, die keine Öffentlichkeit wollen. Für eine saftige Provision bedienen Die Hausflüsterer diesen Markt. (Und ich meine keine Menschen im Zeugenschutzprogramm oder verurteilte Schniedelwedler, die inmitten der allgemeinen Bevölkerung keine Zuflucht finden könnten. So was wird von Regierungsbehörden gehandhabt, das ist nicht unsere Kundschaft.)
Vor Jahren ließ ich meine eigene Maklerlizenz auslaufen. Aber ich war bereit, bei Mike an Bord zu gehen, um mich in den Nachwehen meiner Scheidung wieder wachzurütteln, als meine zweite Frau, Sally Caldwell, beschloss, ihr Leben als Beraterin in den Dienst der Trauernden in fernen Landen zu stellen (wo anscheinend sehr viel getrauert wird). Sie hat ihr Gelübde als Laiennonne abgelegt, so dass eine glückliche Neuaufstellung unseres Ehelebens kaum am Horizont steht.
Unser kleines Hausflüsterer-Büro liegt im ersten Stock über dem Hulett’s-Schuhladen, gegenüber vom August Inn, am Haddam Square; mein Job dort ist nur ein Halbtagsjob, keine Gig-Economy, aber auch nicht das glatte Gegenteil. Eigentlich gehe ich nur ans Telefon und gebe private Kontaktinfos an meine Vorgesetzten in der Agentur weiter. Allerdings bescheren mir meine Minimalpflichten den Bonus, allen Anrufern, die unseren Internet-Auftritt missverstanden haben — da steht, wir sind »Vertrauliche Berater mit einzigartigen Hauskauf-Strategien für ungewöhnliche Kunden« —, detaillierte Grundlagen- und Echtzeitinfos in Immobiliendingen zu bieten. Mitbürger, die (irrtümlich) glauben, unsere Website-Beschreibung meint sie, rufen regelmäßig an und wollen sich über das banalste Immobilien-Einmaleins informieren, und mit dem größten Vergnügen löse ich ihnen auf Grundlage meiner jahrelangen Erfahrung jedes Dilemma auf: »Wie (zum Beispiel) funktioniert eigentlich eine umgekehrte Hypothek, und sollte ich mich, mit 92 und diversen Vorerkrankungen, in so was reinstürzen?« Nein. »Was sind die Nachteile, wenn ich in der Wohnung meiner Schwiegermutter aus China importierten Trockenbeton einsetze?« Da lauern Prozesse. »Wo liegt der Break-even-Punkt bei dem renovierungsbedürftigen Haus, das ich auf dem Mietmarkt anbieten will, aber die Decken müssen noch gemacht werden?« Wann war es kein Vermietermarkt? Verdienen Sie Geld, indem Sie Geld ausgeben.
Die meisten dieser Informationen findet man natürlich auch in der New York Times. Nur wollen sich die Leute diese Mühe nicht machen — und deswegen haben wir anderen einen Job. Und: Selbst im schicken Haddam lesen die meisten Leute keine Zeitungen mehr.
Mike Mahoney, mein Möchtegernboss, ist wie immer ein halbwegs liebenswerter, quasi-ehrlicher Unternehmerdynamo, der es zu seinen angeborenen Vorzügen zählt, dass all seine geldgierigen Beutezüge auch das Leiden anderer lindern, indem er sie von ihren Lasten befreit — ihren Häusern. Steht alles in Übereinstimmung mit dharmischen Sprüchen aus irgendeinem Bardo. Mir für meinen Teil ist Mike sympathisch, weil er seinen kleinen tibetischen Arsch riskiert und auf lange Sicht viel gewonnen hat. Und doch: Aus meinem dubiosen Block der Wilson Lane in Haddam hat sich das Flair des wahren Wohnens heute praktisch verflüchtigt, wie es für viele Innenstadtstraßen im ganzen Land gilt — und das lässt die Tür einen Spalt offen für stets abwesende Besitzer, private Beteiligungen als Schnäppchen, AirBnBs und Business-Apartments, genau dort, wo früher normale Bürger, also Apotheker, Lehrer, Bibliothekare und Professoren, Steuern bezahlten und zu Recht ihren Lokalstolz hatten. Inzwischen ist es selten geworden, deinen Nachbarn überhaupt zu kennen. Solltest du in einer solchen Nicht-ganz-Bleibe sterben, würden keine Kränze an der Tür hängen, kein Pastor käme vorbei, kein Nachbar mit einer warmen Mahlzeit. Zu meiner Zeit habe ich diese Häuser wie Pfannkuchen verkauft. Aber immer an richtige Menschen, die darin leben wollten, Kinder aufziehen, Geburtstage und Feiertage begehen oder sich scheiden lassen. Und sterben — meistens glücklich.
*
Letzten Oktober saß ich an meinem Hausflüsterer-Schreibtisch und schaute aus dem Fenster auf die Grünanlage, wo zwei Mädchen in Sportshorts Fähnchen fürs Oktoberfest aufhängten. Und plötzlich geschah etwas ziemlich Ungewöhnliches. Ohne anzuklopfen, trat über die Schwelle meines winzigen Büros meine Mutter, die meines Wissens seit sechsundfünfzig Jahren tot war. Natürlich nicht meine Mutter. Aber ihre Zwillingsschwester, wenn all die Jahre keine Spuren hinterlassen hätten und wenn meine Mutter eine Zwillingsschwester gehabt hätte — was nicht der Fall war.
Ich hinter meinem Schreibtisch muss gestarrt haben, als wäre ich betrunken. Womöglich stand mir sogar der Mund offen. Erschrocken schob ich mich auf meinem Stuhl nach hinten, denn vielleicht hatte ich ja gerade einen Schlaganfall.
»Sie wirken nicht besonders glücklich, mich zu sehen«, sagte meine Mutter — also die Frau, die wie sie aussah, als ich sie zum letzten Mal lebendig erblickte. 1965. Diese Person betrachtete mich mit spöttischem Ernst, dann lächelte sie rätselhaft. Sie war sechzig (ungefähr so alt wie meine Mutter, als sie starb) und hatte sowohl das komplexe, fröhliche Gesicht und den dichten silbrigen Pagenschopf meiner Mutter als auch ihre kleinen, kessen Züge, die ihr eine lebhafte Ausstrahlung gaben, bereit zu jeder Narretei, die man ihr antrug.
»Es tut mir leid«, sagte ich und brachte ein erleichtertes Lächeln zustande. »Hier kommen nicht viele Leute ohne Termin herein. Sie erinnern mich an eine Person, die ich sehr liebte und die vor langer Zeit gestorben ist.« Das kam so unmittelbar herausgeplatzt wie in einem Traum.
»Oha, die alte Geschichte«, sagte die Frau skeptisch. »Tja, ich bin weder Ihre Ex-Frau Dolores noch Ihre zweite Frau, falls ich nach denen aussehe. Mein Mann hätte seinen Spaß an Ihnen. Ich suche nach der Zahnarztpraxis. Dr. Calderon. Vielleicht habe ich den falschen Eingang erwischt. Beim Schuhladen hängen die Schilder alle durcheinander.« Sie zeigte ein schimmerndes Regiment von Beißerchen. »Das hier sind nagelneue Implantate«, sagte sie. »Ich kehre jetzt zu einem richtigen Zahnarzt zurück.«
»Okay.« Calderon war seit fünfunddreißig Jahren mein Zahnarzt, hätte schon vor zehn Jahren in Rente gehen sollen, hat aber nichts Besseres zu tun. Ich war schon eine Weile nicht mehr bei ihm gewesen und brauchte eine neue Krone. »Er ist in Nummer 12. Da müssen Sie nochmal nach unten und dann nach links. Das ist der nächste Eingang, neben dem Schuhladen.« Ich bot ihr noch einmal mein wiederhergestelltes Lächeln an, aber mein Herz klopfte.
»Und was läuft hier?«, fragte die Frau und sah sich um. »Was ist ein Hausflüsterer? Sind Sie Privatdetektiv?«
»Nein. Immobilien.«
»Ach so.« Sie glättete ihren Mund. »Hübscher Name. Also, wem sehe ich denn so ähnlich?«
»Meiner Mutter.« Ich wollte es eigentlich nicht zugeben. Wer weiß warum.
»Ohhhh. Wirklich? Das ist aber süß. Macht es Sie glücklich, sie wiederzusehen? Also, mich? Manchmal sehe ich Verstorbene im Traum. Das finde ich immer aufregend. Jedenfalls eine Zeitlang.«
»Hm. Ja«, sagte ich. »Das macht es.« Stimmte auch.
»Sehen Sie, Sie können den Tod nur durch Träumen besiegen. Meine Mom lebt noch, und sie ist der Horror. Immer noch in Manalapan. Kauft selber ein. Fährt ihren kleinen Kia. Ich besuche sie nie, aber meine Schwester kümmert sich.«
»Das ist gut.«
»Na ja«, sagte meine Mutter. »Wir können uns unsere Eltern ja nicht aussuchen, oder? Und die uns auch nicht. Also. Das passt am Ende schon.«
»Nein, tun wir nicht. Ich meine, ja, wahrscheinlich.«
»Sonst würden wir uns wohl kaum unsere aussuchen, oder?« Meine Mutter stand in meinem kleinen Büro und sagte diese Worte zu mir. Es hätte durchaus passieren können, dass ich als Nächstes ohnmächtig wurde oder anfing zu bellen.
»Ich weiß nicht.«
»Doch, doch. Aber ich verstehe«, sagte die Frau. »Ich … verstehe. Sie haben viel zu tun. Also, ich wünsche einen gesegneten Tag. Ja? Ich geh dann mal zum Zahnarzt. Wie heißen Sie?«
»Frank«, sagte ich. Erst hatte ich bloß zu »Bascombe« angesetzt.
»Okay, Frank. Try to remember the kind of September.« Mit diesen Worten — immerhin war mein Name dabei — ging meine Mutter hinaus, schloss die Tür hinter sich und war weg. Wie ein Geist.
*
Mehr brauchte es nicht, um mir »Glück« ins Gehirn zu setzen, wo es schon länger nicht gewesen war. Alte Menschen — ich bin vierundsiebzig — können es eigentlich ganz bleiben lassen, sich Gedanken übers Glücklichsein zu machen (so wie der Frosch im Topf nicht darüber nachdenkt, dass das Wasser immer heißer wird, bis das Froschsuppenstadium erreicht ist). Hätte mich jemand gefragt, ob ich glücklich bin, hätte ich gesagt: »Klar. So glücklich man nur sein kann. Eine sichere Bank.« Hätte mich aber derselbe Mensch gefragt, was mich so glücklich macht oder wie sich ›glücklich‹ anfühlt, wäre mir eine Antwort schwerer gefallen. Glück gehörte nicht zu meinem Alltagswortschatz, anders als hundert glücksneutrale Signifikanten (zum Beispiel: ich höre immer noch gut; meine Reifen sind ordentlich ausgewuchtet; bislang hat mich heute noch keiner beklaut).
Aber auf einmal sagte meine »Mutter« zu mir, ich wirkte »nicht glücklich« (sie zu sehen), und fragte mich: »Macht es Sie glücklich, Ihre Mutter zu sehen?« Das tat es, es war mir nur nicht anzumerken. Oft, wenn ich auf dem Kraftfahrzeugamt ein neues Foto machen lassen muss, sagt die Frau hinter der Kamera: »Und jetzt schön lächeln, Mr. Bascombe, damit die Cops Sie nicht verhaften.« Dann kann ich immer nur sagen: »Ich dachte, ich würde lächeln.«
Als meine echte Mutter starb, in einer frühen Version eines Hospizes in Skokie, damals war ich Erstsemesterstudent in Michigan und fuhr mit dem New York Central, um sie an den Wochenenden zu besuchen — sie so zu sehen, eingefallen und entstellt, tat unerträglich weh —, da schrak sie eines Tages jäh aus ihrem Morphiumtraum hoch, als ich ängstlich und ehrfürchtig an ihrem Bett stand. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich erkannte, und taumelte vor Angst buchstäblich zurück. Ihre dunklen Augen waren weit aufgerissen und starrten nach oben, als sähe sie ein Gespenst, ihre Nasenflügel blähten sich, als atmete sie Schwefelschwaden ein, und ihre Lippen waren in einer wilden, bewussten Anstrengung zusammengepresst. Und urplötzlich rief sie aus — an meine Adresse: »Ich habe dir nur eines zu sagen, Freundchen!« »Was denn?«, fragte ich zitternd, zutiefst verängstigt und verzweifelt. Vielleicht schrie ich das sogar vor lauter Schreck. »Bist du glücklich?«, fragte sie anklagend. »Dein Vater war ein sehr glücklicher Mensch. Er war ein fantastischer Golfer. Bist du das auch?« Sie meinte nicht, ob ich ein Golfer sei (das bin ich kein bisschen), sondern, ob ich glücklich sei. In diesem Moment ohnegleichen schien ihr das am allerwichtigsten auf der Welt zu sein — wichtig genug, um sie aus der Besinnungslosigkeit hochzureißen und mir die Frage ganz direkt zu stellen. (Am nächsten Tag nach dem Mittagessen starb sie.) »Das musst du sein«, sagte sie furchteinflößend. »Davon hängt alles ab. Du musst glücklich sein.« »Das bin ich doch«, sagte ich zitternd — obwohl ich auch hätte sagen können: »Okay, dann bin ich das«, im Sinne von »Wenn du das von mir verlangst, dann bin ich es«. Ich log. Ich war alles andere als glücklich. Meine Mutter starb vor meinen Augen — ein folgenschweres, schlimmes Ereignis. Ich war kein guter Student. Ich hatte keine Freundin und machte mir auch keine Hoffnung auf eine. Ich überlegte, zu den Marines zu gehen, in Asien zu kämpfen, um meinem Leben zu entkommen. Welchen Grund, glücklich zu sein, hatte ich denn? Ich hätte anders reagieren können, mit streitlustigen, jungmanntypischen Fragen wie »Was meinst du mit glücklich?«, »Warum fragst du mich ausgerechnet das?« oder einfach mit »Ich bin mir nicht sicher«. Aber sie lag auf dem Totenbett, also sagte ich Ja.
»Gut. Da bin ich aber froh«, sagte sie. »Das habe ich gehofft. Ich hab mir solche Sorgen deswegen gemacht. Jetzt lass mich mal ein bisschen schlafen. Ich habe einen weiten Weg vor mir.«
Was gar nicht stimmte. Fast leblos fiel sie auf ihr Kissen zurück. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie noch einmal mit mir sprach, obwohl man ja die letzten Worte, die jemand zu einem sagt, angeblich nicht vergisst. Ich wohl schon. Es ist lange her.
*
Ein anderes bedeutungsvolles Ereignis, wodurch das Glücklichsein aus dem Kühllager befreit und in meinem vorderen Hirnbereich installiert wurde, geschah letzten Sommer. Im Juni beschloss ich, zu einer Versammlung des 63er-Jahrgangs der Militärakademie von Gulf Pines (Die Einsamen Pinien) zu fahren, die an der stickigen Golfküste von Mississippi stattfinden sollte. Wir hatten uns sonst immer auf den alten Paradeplätzen getroffen, aber in den letzten fünfzehn Jahren — in denen die Akademie erst an einen religiösen Kult verkauft, dann weiterverkauft, dann abgerissen wurde, um Platz für die Parkfläche eines Kasinos zu machen — wurden die Treffen auf dem eichenbeschatteten Gelände von Jefferson Davis’ Familiensitz anberaumt. Hurrikan Katrina hat das Haus des früheren Präsidenten zwar in einen Haufen Streichhölzer verwandelt, aber immerhin wurden die meisten großen Eichen, die sich zäh an ihrem Spanischen Moos festklammerten, verschont. Über die Jahre habe ich ein paar Mal an diesen Versammlungen teilgenommen und war danach immer verblüfft und halbwegs beschwingt. Verblüfft, weil die meisten meiner Jahrgangskameraden knallharte Vollpfosten waren, und sie Jahre später in ihrem aktuellen Zustand wiederzusehen, verstummt, unaufdringlich, schwerfällig, etwas feindselig, oft angeschlagen, diente nur als Beleg dafür, dass es reine Glückssache ist, ob man über seine Anfänge hinauskommt oder nicht. Viele von uns waren nach Vietnam gegangen und benebelt, geistig vertrocknet, vorzeitig verbraucht zurückgekehrt (sofern sie nicht ganz oder teilweise in Stücke gerissen worden waren). Das Schicksal hatte die meisten quer über den Kontinent verstreut, zu John-Deere-Vertretern, Sportlehrern, Krankenpflegern, bildenden Künstlern (abstrakte Metallskulpturen in Hayden Lake) oder, wie mich, zu Immobilienexperten in New Jersey gemacht. Ein paar hatten es geschafft, sich mit angeborener Cleverness und befeuert vor allem von Scheitern und Wut eine goldene Nase zu verdienen. Aber mit denen redete ich nie, weil die einzige Lebensgeschichte, die sie kannten, immer ihre eigene war.
Ich fand es aber, um mal die positive Seite hervorzukehren, belebend, ein paar dieser Wandergefährten — von denen ich mich an keinen so richtig erinnerte — die Hand zu schütteln und sich gegenseitig auf den aktuellen Stand zu bringen, und sei es nur wegen einer Buchkritik, die ich in der New York Times gelesen hatte. Es ging um den Roman einer berühmten Autorin mit drei Namen, der die Lebensgeschichte einer Figur mit komplettem Verlust des Langzeitgedächtnisses erzählte (das könnte man auch als Segen empfinden, aber nicht in diesem Buch). Der Artikel hatte ein klangvolles Glöckchen in meinem Hirn angeschlagen. Die Kritikerin schien den Roman zu mögen, allerdings irgendwie grollend, und das tat sie wie folgt dar: »Als welche Art Mensch können wir uns bezeichnen, wenn uns die Fähigkeit fehlt, ein zusammenhängendes persönliches Narrativ zu stricken?« Das sollte ein Lob sein.
Heutzutage ist natürlich alles ein Narrativ. Und mir war mein eigenes eher scheißegal. Es ist weithin anerkannt, dass die Menschen länger leben und glücklicher sind, je mehr Zeug sie vergessen oder ignorieren können. Außerdem hätten die meisten anderen vermutlich eine deutlich andere Sicht auf mein persönliches Narrativ als ich — angefangen bei meinen beiden Ex-Frauen und den beiden überlebenden Kindern, die sich eher für Opfer »meines Narrativs« halten. Anders als die Figur im Roman war ich froh und glücklich, einen Großteil meines Narrativs fahrenzulassen, es hatte mich oft genug nachts wach gehalten und unglücklich gemacht.
Doch die Einladung zu dem Treffen kam zufällig genau in dem Moment, als ich die Book Review in die Hand nahm. (Die Gründe, zu solchen Treffen zu gehen, zeigen uns nie von unserer besten Seite.) Und aus einer perversen Laune heraus befand ich: Wenn ich im dampfenden Spätaugust da runterflöge, mich in der sengenden Hitze irgendwo auf dem schattigen Rasen von Jeff Davis postierte, unter die Leute mischte, den Ellbogengruß machte, auf Schultern klopfte, aus der Hüfte geschossen redete, nickte und schallend lachte, vielleicht sogar ein Tränchen mit den ganzen früheren Vollpfosten vergösse, dann würde ich am Ende vielleicht ein durchdachteres, klareres Gefühl davon bekommen, »was für eine Art Mensch ich war«, während sich mein Narrativ der letzten Zeile näherte. (Ich gebe auch gern zu, dass das vielleicht eine heimliche Entschuldigung dafür war, um während der Hundstage aus Haddam rauszukommen, wenn das Maklergeschäft sowieso in den Sommerschlaf geht.)
Immer weniger alte Jahrgangskameraden kommen zu diesen öden Anlässen. Diesmal, zum sechsundfünfzigsten Mal, waren noch weniger aus unserer Originalbesetzung dort — nur die paar verstreuten, die in der Nähe wohnten oder in New Orleans oder Pensacola: Leute, die an einem Sommersamstag nichts Besseres zu tun hatten und keine Lust auf Baseball im Fernsehen daheim. Lange Klapptische aus Metall waren aufgebaut, bedeckt mit blau-weißem Metzgerpapier (die Farben der Militärakademie). Dazu Klappstühle in Hülle und Fülle, denn viele von uns können nicht mehr lange stehen. Jemand hatte für einen leichten Imbiss Geld hingeblättert — eiskalte Shrimps, warmen Coleslaw, Kartoffelsalat und Wassermelone. Plus eine lange geriffelte Blechwanne mit Bierdosen auf Eis. Aus unserem Jahrgang von siebzig Leuten waren vielleicht dreißig da. Nichts Exorbitantes war geplant — einfach zwei Stunden die Fressalien konsumieren, ein, zwei Bier dazu, vielleicht mit jemandem plaudern (aber nicht unbedingt), über den Highway zum Golfküsten-Kasino schlendern, eine Stunde an den Spielautomaten, dann verschwinden.
Wir verhielten uns alle genauso, wie ich es erwartet hatte: unruhig die anderen belauern, zögernd Blickkontakt aufnehmen, dann schnell wieder weggucken; Bauch voran die Hand ausstrecken, dann zögern, nicken, halb lächeln, aufgesetzt lachen, krampfhaft überlegen, wer der andere war und wie er die Zeit seit unserem fünfzigstem Jubiläum überlebt hatte (das mir Spaß gemacht hatte, weil meine Frau Sally mitgekommen war und später verkündet hatte, das Ganze und meine Jahrgangskameraden seien »zum Brüllen«). Worte — sehr wenige — wurden gefunden und gesagt. Abgänge nahm man nickend zur Kenntnis. Nettigkeiten oder Nähe ergaben sich seltener — wie man »aussah«, was ein anderer durchgemacht und einigermaßen überstanden hatte; wo die Kinder eines Dritten jetzt zu Hause waren, wann die Ehefrau gestorben war (meine erste erst vor zwei Jahren). An Politik traute sich keiner ran, es war keine Rede davon, welche Kriege gerade geführt wurden, niemand ging das Risiko ein, etwas Sexuelles oder auch nur halbwegs Witziges zu äußern. Die Chancen verschiedener Universitäten, Ole Miss oder Louisiana State, und des Footballs in Alabama wurden flüchtig und leidenschaftslos angetippt. Das Essen war zuerst weg. Dann das Bier. Und dann wir alle — ohne dass ich irgendetwas über mein Narrativ gelernt hätte oder was für eine Art Mensch ich war, bis auf die Tatsache, dass ich mich ihnen kaum zugehörig fühlte, was ich sowieso vermutet hatte.
Alle waren weg, und dann gab es doch noch eine Begegnung — ein seltsames, unerwartetes und vielsagendes Beinahe-Gespräch mit Pug Minokur: ursprünglich aus Ferriday, Louisiana, der Heimatstadt des alten Countrymusikers und Cousinenschnackslers Jerry Lee Lewis, die auch an einem besseren Tag harter Tobak ist. Pug — leicht zu erkennen, weil er sich kein Jota verändert hatte — stand einsam und allein neben einer großen Eiche, Bier in der Hand, gekleidet in ein Paar trottelbeige Bermudashorts, ein weißes Hemd mit offenem Kragen, dazu lange peinliche schwarze Nylonsocken und weiße Lackslipper. Auf mich wirkte er gestrandet, als bräuchte er dringend jemanden, der seine Isolation durchbrach, ihn ansprach und den Augenblick rettete, denn mittlerweile neigte sich das Fest seinem Ende zu. Pugs Miene war ausdruckslos. Aber als er mich sah, leuchteten seine Augen auf, und er lächelte, als sei er freudig bereit für irgendeine harmlose Verbrüderung, bevor er sich heimwärts trollte. Und ich verfügte über den Ball, den wir, wie kurz auch immer, ins Rollen bringen konnten. In dem mehrere Leben zurückliegenden Halbdunkel von 1961 war Pug unangefochtener Star der Basketballmannschaft der Gulf Pines Fighting Seamen gewesen. Als gerissener, hartgesottener Aufbauspieler von knapp eins achtzig, der Körbe in Serie warf, hätte Pug nach Baton Rouge gehen und an der Louisiana State University bei den Tigers als Frischling einsteigen können, bloß hatte er leider die Neigung, in Vorstadthäuser einzubrechen und Dinge zu stehlen, die er nicht brauchte und sofort in den Mississippi warf — bis er erwischt wurde. Er hatte Pech, und das brachte ihn statt auf den glamourösen Erfolgskurs zu den Tigers in die Militärakademie der Einsamen Pinien. Eine Menge der Kadetten dort waren angehende Verbrecher, denen ein Jugendrichter eine letzte Chance gegeben hatte, weil er sie weder teuer einbuchten noch in den Tod in einem Kriegsgebiet schicken wollte. Und ich, ein wenig sportbegabter Außenseiter aus einem nahe gelegenen Städtchen und Interner an der Akademie, malte mir aus, wie die (wundersame) Aufnahme in die Basketballmannschaft hinfort für mein Vorankommen hier sorgen würde. Ich war gut eins achtzig groß. Das stellte meine einzige Basketball-Befähigung dar. Ich war ein trauriger, ungeschickter Lahmfüßler, neigte zu Fouls, konnte nicht höher als meine High-Tops springen und brachte nicht den simpelsten Korbleger oder Sprungwurf aus der Nähe zustande. Doch genau wie die anderen Tölpel war ich in der »Statistenmannschaft« nützlich. Bei den eigentlichen Spielen durften wir nie mitmachen, aber Shug Borthwick, der alte Seamen’s-Trainer, stellte uns in ungefähren Basketball-Posituren auf den Übungsplatz, dort, wo bei den echten Ausscheidungskämpfen die gegnerischen Spieler stehen würden, und dann wurden wir herumgeschubst, Bälle flogen über unsere Köpfe, wir wurden geblockt und gelegentlich umgerannt, falls das gerade irgendwem aus der Mannschaft Spaß machte. Pug war unser Kapitän — eine ungestüme, bedrohliche Gestalt im Blau der Militärakademie mit einer frechen Nummer 1 auf dem Trikot. Er hatte noch nie das Wort an mich gerichtet, offenbar gab es keinen Grund dafür. Einmal war er an mir in meiner hilflos erstarrten Block-Haltung nahe der Grundlinie vorbeigezischt und hatte es dabei fertiggebracht, mir wüst gegen das Brustbein zu rammen — so hart, dass ich eine Verletzung am Herzen fürchtete. Zutiefst demütigend war das. Ich tat natürlich, was ich konnte, um mir nichts anmerken zu lassen, das wollte ich keinem gönnen, ich schluckte es runter, nahm Pugs Volltreffer hin und sagte nichts. Insgeheim wollte ich davonkriechen und sterben, nie mehr einen Basketball oder auch nur ein Trikot sehen müssen.
Doch am nächsten Tag, während meine Statistentruppe »trainierte«, also abprallende Bälle einfangen und unermüdlich die Mannschaftshelden mit ihnen füttern musste, so dass sie ihre beidhändigen Würfe und Haken-Würfe perfektionieren konnten, was ihnen natürlich gar keine Zeit ließ, die Bälle selber einzusammeln, da kam Pug zu mir und sagte: »Charlie« (er dachte, ich heiße Charlie), »ich finde, du solltest durchhalten. Du bist groß genug und absolut zäh genug dafür. Wenn du über den Sommer hart an deinen Grundtechniken arbeitest, kannst du dir nächstes Jahr einen Platz in der großen Mannschaft verdienen. Ich leg beim Trainer ein Wort für dich ein, wenn du willst.« »Das fände ich toll, Pug«, sagte ich feige. »Du bist ein super Spieler.« »Ich weiß«, sagte er. »Aber das steckt in uns allen, Charlie. In dir bestimmt auch.« Und das war’s schon.
Aber nichts — das kann ich bis heute ohne jeden Zweifel sagen — hatte mir je so viel bedeutet wie diese wenigen, unaufgeforderten, höchstwahrscheinlich unaufrichtigen, halbwegs lobenden Worte. Pug ging weg — ich sah ihm nach — und direkt zu Trainer Borthwick, mit dem er ein paar Worte wechselte. Beide drehten sich zu mir um und beobachteten, wie ich versuchte, abprallende Bälle einzufangen und möglichst nicht auf den Kopf zu kriegen. Ich glaubte, dass Pug getan hatte, was er mir versprochen hatte. Im nächsten Jahr könnte ich auf einer ganz neuen Ebene des Daseins leben, gedeihen, mich auszeichnen; denn selbstredend würde ich mir den Sommer über ein bis zwei Beine ausreißen, um an den Grundtechniken zu arbeiten (was immer die genau waren). Dieses neue Leben würde ruhmreich werden — anstelle der Demütigungen in der Statistenmannschaft (die Statisten hatten nicht mal Spielernummern auf dem Trikot) ein echter neuer Maßstab von erzielten Trefferpunkten und wirklichen eingefangenen Abprallern — nicht so wie jetzt, wie ein Scheißautomat am Fließband.
Dass es nie zu alldem kam, dass ich, bis die nächste Saison angefangen hatte, schon bei der Zeitung der Akademie, Poop Deck, als anfangender Sportreporter mitmachte und nie ein weiteres Wort an Pug Minokur richtete (ich schrieb allerdings über ihn, als wäre er mindestens Bob Cousy), dass ich nie mehr auf einen Basketballkorb warf, außer mit meinen beiden Söhnen auf verschiedene Korbbretter in anderen Städten und anderen Lebensphasen — all das war wurschtpiepenwumpe. Ich hatte gehört, was ich gehört hatte. Es war zum Schwur gekommen. Meine Zukunft war ausgelegt für Basketballruhm — falls ich das so wollte. Nur wollte ich es gar nicht. Aber Pug Minokur hatte sich für mich eingesetzt, als es drauf ankam. Er war ein Riese; so zäh und geschmeidig wie nur was, mit dem Herzen eines Kriegers, und doch konnte er sich hinunterbeugen zu einem anderen Jungen, der ein gutes, aufmunterndes Kumpelwort brauchte. Auch wenn das totaler Bullshit war.
Derlei Gefühle hielt ich vor Pug in jenen kaputten Tagen damals natürlich verborgen. Es war mir peinlich, dass ich im nächsten Jahr nicht meinen »Auftritt« hatte, sondern mich für das berührungsfreie Spiel beim Poop Deck entschieden hatte. Pug schien mich niemals zu bemerken oder wiederzuerkennen (den ollen Charlie). Wir hatten unseren einen strahlenden Augenblick gehabt, und das war’s.
Bis zu dem Treffen.
Trotz all der Jahre war das eindeutig Pug, den ich da erspähte: dieselbe zerknitterte Stirn, derselbe altmodische Bürstenhaarschnitt, dasselbe unterdimensionierte Kinn, als hätte sein Schöpfer bei seinem Gesicht irgendwo ein bisschen sparen wollen. Ein Junge mit Pugs Gesichtszügen wäre früher von einem Highschoolmädchen als »süß« bezeichnet worden, das sich gesteigertes Ansehen davon versprach, eine Sportskanone ergattert zu haben. Und nun, als vierundsiebzigjähriger stellvertretender Carglass-Geschäftsleiter in Rente aus Bastrop, Louisiana, sah Pug nur noch aus wie ein trauriger kleiner Verandasprinter aus der Provinz, der früher mal viele Freunde hatte.
Aber ich würde mich von so einem wenig verheißungsvollen Gefühl nicht beirren lassen. Falls ich mit meiner Teilnahme an diesem halbherzigen Treffen hatte herausfinden wollen, welcher Aspekt meiner Person womöglich erinnernswert war, um ihn nie wieder zu vergessen (»Bascombe war nicht so übel, oder jedenfalls nicht so übel«), dann hatte ich jetzt die Chance, das Richtige zu tun. Gerechtigkeit, verzögert, aber nicht verweigert bis in alle Ewigkeit.
Ich lief quer über das glühend heiße St.-Augustine-Gras auf Pug zu, der an der überlebenden Eiche lehnte. Er schaute jetzt anders drein, starrte mit ungerührter Miene in irgendeine Ewigkeit hinein, seine runzligen, glänzenden Knie zwischen Bermudashortssaum und Sockenbund leicht gebeugt, wie auf der Suche nach Gleichgewicht. Er fixierte mich, während ich näher kam, und schien mich doch nicht zu erfassen. Die Dose Schlitz-Bier hatte er noch nicht zum Mund geführt, sie hing an seinem Arm.
»Pug?«, sagte ich und streckte ihm eine Hand entgegen. »Franky Bascombe. Ich war dein größter Fan damals, Anno 61. Ich war dabei, als du 64 mit den Birmingham Lutherans die Jungs von Huntsville Normal beim Heimspiel auf den Topf gesetzt hast, dreißig hast du eingefahren.« Irgendwann hatte er — als Star — für irgendein Popelcollege gespielt, dritte Unterliga, bevor er zur Navy ging.
Pugs kleine dunkle Augen, wie Kugelgeschosse, reagierten jetzt und nahmen mich wahr, aber so, als spräche ich aus einiger Entfernung und möglicherweise nicht zu ihm. Meine Hand nahm er nicht, also zog ich sie zurück.
Pug hatte es nie mit Worten. Als er mir geraten hatte, durchzuhalten und mein Können aufzupolieren, weil in uns allen Größe stecke usw., waren das Worte, die ich jetzt als einen kleinen, aber damals wichtigen Wendepunkt für mich feiern wollte und bis zum heutigen Tage zu schätzen wusste. Es waren aber auch die einzigen Worte, die Pug jemals an mich richtete, selbst wenn ich ihm später, in gedruckter Version, Tausende gewidmet hatte.
»Ich hab dir was zu verdanken, Pug«, sagte ich. Pug hieß eigentlich Rodney Jr., und danach sah er jetzt auch aus, in seinen hochgezogenen Shorts, den schwarzen Socken und dem Haarschnitt aus dem Einkaufszentrum. Ich kannte mich immer noch mit weißen Südstaatlern aus; Pugs unkommunikatives, Rollladen-runter-Starren war sein »Pug-Look«. So war Pug; mit diesem Gesicht begrüßte er die Welt, seit der Applaus verebbt und für die restlichen langen Jahre nur der Austausch gesprungener Windschutzscheiben und Abendessen-zu-Hause übrig geblieben waren. Falls er jetzt gesprochen hätte, wäre vielleicht das letzte kleine bisschen vom alten Pug in Gefahr geraten. Was ich gern vermeiden wollte. »Wahrscheinlich überschreite ich hier meine Grenzen, Pug«, sagte ich schnell, mit dem Grinsen eines Schuhverkäufers, bereit zum Rückzug. Es war brutal heiß. Ich schwitzte sturzbachartig mein kariertes Hemd durch, aber Pug schien die Hitze nichts auszumachen. Irgendwas kühlte ihn runter. Der Golf drüben, jenseits vom Highway 90, lag grau da, dick gebacken wie Schlamm. Weit draußen tauchten immer mal die Köpfe von Schwimmern auf. Eine Konföderiertenflagge hing schlaff an einem traurigen Mast, wo das frühere Anwesen des Verräterpräsidenten gestanden hatte.
»Du musst eines wissen«, sagte Pug ruhig, als hätten wir die ganze Zeit wie die Gänse geschnattert, über Temperaturschutztönungen von Autofenstern, damit man auf seiner Fahrt in den Urlaub nach Wicki-Wachee nicht geröstet wurde.
»Was denn, Pug?« Er sah mich direkt an mit seinem weichen, nachgiebigen Gesicht, erfüllt von einem Gefühl, für dessen versuchsweisen Ausdruck er von seinem üblichen unkommunikativen Ich abgerückt war. Und natürlich sah ich es dann. Erkannte es. Begriff es. Dumm, dumm, dumm (ich).
»Ich bin wirklich glücklich«, sagte Pug mit einem Lächeln, das seine aufgereihten viereckigen farblosen Zähnchen entblößte. Die dunklen Augen glänzten. Ich hatte nichts Bedeutsames gesagt und würde es jetzt auch nicht tun. »Mein Leben war wunderbar, einfach wunderbar, Franky« (nicht Charlie), sagte Pug. »Und das hier wäre alles gar nicht nötig gewesen. Ich habe …« Er hielt inne und musterte mich scharf, als hätte ich ihn unterbrochen. Er blinzelte, der kleine Mund verzog sich zu einer Art Lächeln. Er nickte. »Ich verstehe«, sagte Pug, genau wie die Frau, die meiner Mutter so ähnlich sah, es sechs Wochen später tun würde. »Ich verstehe.« Pug schaute erstaunt. »Diese kleine Mini-Uhr läuft nicht, wenn man sie nicht anschließt, nicht wahr?«, sagte er. »Von daher …« Mehr war Pug und mir nicht beschieden, nicht an jenem Tag oder sonst wann. Ich dankte ihm — für lebenslange Erinnerungen. Ich ergriff seine erstaunlich weiche, erstaunlich kleine und einst geschickte Hand — seine Werferhand — und schüttelte sie behutsam, um der guten alten Zeiten willen. In dem Moment kam ein Teenager — sein Enkel, ein kleiner Pugster — auf uns zu und sagte leise etwas, worauf Pug nicht antwortete. Er nickte mir zu. Dann gingen die beiden zusammen zu den Autos, die auf dem Sonnengrill geparkt standen.
Wozu nicht mehr viel zu sagen ist. Wie kommt es, dass eine lange schlafende Idee wieder zum Leben erwacht und als komplett erneuertes Ziel ihr strahlend helles Lebensbanner schwenkt? Glücklich sein — bevor der graue Vorhang fällt. Oder zumindest drüber nachdenken, warum du es nicht bist, wenn du es nicht bist. Und ob es überhaupt was bringt, sich darum zu scheren. Was ich behaupten würde. Es bringt was, sich darum zu scheren — mehr Sicherheiten habe ich allerdings auch nicht anzubieten. Aber wer zur Tür hinausgeht (das wusste meine Mutter, das »wusste« sogar Pug Minokur, falls er überhaupt etwas wusste) und sich nicht darum schert, ob er glücklich ist, der zollt dem Leben weniger als den vollen Tribut. Was doch schließlich unser Daseinsgrund ist. Dem Leben seinen vollen Tribut zu zollen, egal wer wir sind. Oder etwa nicht?
TEIL EINS
Eins
Rochester, Minnesota. In der trüben Jahreszeit des Lupercal. Heilige, blutige Märtyrer, Opfer. Im gefrorenen Herzen des Winters die Verheißung eines fruchtbaren Frühlings. Und in drei Tagen Valentinstag.
Ich fahre mit meinem Sohn Paul in die Comanche Mall für die Dienstagsmatinee des Northern Lights Octoplex-Kinos. Der Enteiser bläst, die Scheibenwischer schlappen. Es schneit, als wär’s Alaska. Paul starrt hinaus und sagt wenig. Seine rechte Hand könnte, wenn ich es recht sehe, zittern, vielleicht auch die Knie in seiner Jogginghose. Wir haben keine Kinomatinee mehr besucht, seit er ein süßer, chaotischer Zwölfjähriger war. Wie gesagt, jetzt ist er siebenundvierzig und nicht gut beieinander.
Allerdings ist der heutige Kinoausflug für mich eine Wiederaufnahme meiner eigenen, lang vergangenen Samstage in dem runtergekühlten verräucherten Dunkel des alten Bay View Biloxi, wo ich mich vier Hauptfilme, vier Kurzfilme, sechs Zeichentrickfilme plus eine Talentshow lang mit Süßigkeiten vollstopfte. Um dann watteäugig in den mulmig heißen Spätnachmittag an der Küste zu taumeln, mit dem Gefühl, so gut könne das Leben nie wieder sein. Wahrscheinlich hatte ich recht.
Die Programmplaner der Naldo-Kinos (Zentrale in Mendota) — acht kleine Kinosäle, sie zeigen selten Filme, für die jemand bezahlen würde — bieten eine opulente Auswahl von »Spezialitäten der Amor-Woche« an, um Stubenhocker und alte Nostalgiker in die erschlagende Kälte und auf die andernfalls leerstehenden Sitze zu locken. Mein Sohn ist mehr oder weniger ein Stubenhocker. Und ich der alte Nostalgiker. Wobei ich nicht glaube, dass Nostalgie mein hauptsächlicher Blick auf die Welt ist.
Kino 8 ist für mich nur von geringem Interesse, gefällt aber meinem Sohn, der behauptet, er »liebt« Roger Cormans Breitwandsplatter von 67, Das Valentins-Massaker, »ein Brüller und ein Klassiker«, findet er. Er will auch zu Picknick am Valentinstag in Kino 6 dableiben — den Titel findet er »interessant«, obwohl wir beide nicht mehr darüber wissen, als dass es ein australischer Film ist und vielleicht einen Bezug zum Valentinstag hat. Da wir jeden Tag vor der Aufgabe stehen, die Zeit rumzubringen, ist er bereit, ihn mir aufzuzwingen. In der Hinsicht ist er nicht anders als mit zwölf.
Draußen an der Kreuzung South Broadway / State Highway 14 sind es unter dem Nichthimmel minus zwanzig Grad, ein großes Alberta-Tief schleudert Eisnadeln und Schnee wie Schrot, mein Honda Civic bebt unter den Sturmböen. In Minnesota steckt man das alles cool weg. »Trockene Kälte«, »da zieht man sich für an«, »Wir fahren von Geburt an auf Eis«, »kann immer noch schlimmer werden«. Als altgedienter New-Jerseyer, der nur hergekommen ist, um seinen Sohn bei seiner experimentellen ALS-Behandlung in der Mayo-Klinik zu begleiten, fühle ich mich eher in der verbesserungswürdigen Jahreszeitenfolge der mittleren Ostküste zu Hause — wo eine kaum von der anderen zu unterscheiden ist. In New Jersey redet keiner vom Wetter — wir lassen uns darin treiben wie die Goldfische. Das muss man Minnesota zugute halten, hier passiert alles Nötige, damit den Leuten der Arsch abfriert, da wird nichts dem Zufall überlassen.
Heute beginnt eine Woche mit hohem Stress und hoher Priorität für meinen Sohn — und für mich. Wir sind seit zwei Monaten in der Klinik in Rochester, seit er kurz vor Weihnachten in die Arzneimittelstudie aufgenommen wurde — eine regenerative »Versuchsphase I« in der Neurologie-Abteilung, die ich nicht so richtig verstehe, aber die seine Ärzte blumig »Medizinpioniere an den Grenzen der Wissenschaft« nennen. Sein Medikament hat einen bombastischen Namen, der so klingt wie »Cyclotron«. Sobald er es im Körper hat, können die Ärzte essenzielle Dinge isolieren und untersuchen (Proteine) und essenzielle andere eliminieren, die ausschlaggebend dafür sind, warum die Krankheit bei ihm voranschreitet, anders als bei anderen Patienten. Man weiß nicht viel darüber, was einen bestimmten Menschen anfällig für ALS macht, nur, was passiert, wenn man es bekommt; wenn die Studie also nichts herausfindet, wäre das auch schon was. Die »Behandlung« wird ihn selbst garantiert nicht retten, nicht mal seinen Zustand verbessern, denn er bekam die Diagnose zu spät (ein guter Grund, es einfach bleiben zu lassen). Die Aufnahmeevaluation hat ihn jedenfalls als »höchst geeignet« für die Studie ausgewiesen, und wir waren noch nicht ganz aus der Praxis raus, als er schon sagte, er wäre dabei. »Das ist mein Vermächtnis«, sagte er amüsiert im Auto, obwohl er, genau wie ich, »Vermächtnisse« für ausgemachten Schwachsinn hält. Seine ALS-Variante hat mit dem Gehirn zu tun, nicht mit dem Rückenmark, deshalb erledigt sie ihr schmutziges Geschäft schneller. Der Grad der Neurodegeneration war bei ihm zum Zeitpunkt der Diagnose schon weit fortgeschritten, aber er könnte noch jahrelang leben. Die meisten Patienten haben schon länger Symptome, als ihnen bewusst ist. Paul dachte (und hoffte), bis er durchgecheckt wurde, er hätte Borreliose.
In der Klinik, umgeben von seinem »Team« — ärztliche Behandlung, Pflege, Therapie, Massage, Beratung, Vermittlung, Betreuung, für alles ist im Rahmen der Studie gesorgt —, hat Paul seine lebenslange Außenwirkung als verquer-abgründiger Introvertierter aufgegeben. In den Büchern, die ich gelesen habe, hat diese Verwandlung in einen Extrovertierten ihren eigenen klinischen Begriff — »idiopathische Selbstobjektifizierung«. Eine schlimme und tödliche Krankheit hat ihm, heißt es da, ein besonderes Ich angeboten und ihn »befreit« — wovon oder wozu, da bin ich mir nicht sicher: vielleicht so, dass er nicht darüber grübelt, wie der Rest seines Lebens aussehen wird. Mir kommt er zum Glück so vor, als würde er seine »Lage« eher beherrschen, als von ihr beherrscht zu werden, er ist zu ihrem leibhaftigen Repräsentanten und Ausrufer geworden. Er ist mit seinem Team aus Kümmerern so locker wie ein Spielshow-Host und lässt sie freigiebig an seinen einzigartigen Ansichten über alles teilhaben. (Wir müssen ja jetzt alle ein Team haben.) Sie nennen ihn »Hübscher« oder »Professor Bascombe« oder »Lover Boy«, während Paul ALS nur noch wie »Al’s« ausspricht (wie in »Al’s Bar«), den Tod umschreibt er mit »das Finale mit links schaffen«, »die Farm kaufen«, »Immobilienerwerb« oder einfach seine »magische Zahl« (z.B. »meine magische Zahl ist bestenfalls sechs Monate«). Bedauerlicherweise beschäftigt er sich seit einiger Zeit auch viel mit Leben und Musik eines Cockney-Crooners im Bonsaiformat, Anthony Newley, der seit über zwanzig Jahren tot ist. Wenn wir allein sind, kann er nervtötende Karaoke-Sessions abziehen (und tut es auch), von There’s No Such Thing As Love, The Candy Man und Who Can I Turn To: »… with you on a nyew dah-ay«, was ich ertrage, aber oft unterbinden muss. Es stabilisiert ihn, sagt er, eine Figur nachzuahmen, die nicht gerade stirbt (bzw. erst später). Die Ärzte betonen, das sei gut für ihn. Musikunterstützte Entspannung. Mich macht es halt manchmal wahnsinnig.
Er sieht sich tatsächlich nicht als Patient, als Leidenden oder als lebende Statistik, sondern als Amateur-»Wissenschaftler«, der einen schadhaften Körper objektifiziert, und zufällig ist das sein eigener — alles zugunsten namenloser anderer. Wie ein Auto, das defekt ist, aber noch gefahren werden kann. Mehr als einmal hat er mir gegenüber angemerkt, er sei »überrascht«, dass es so lange dauere, bis er tot sei. Was statistisch gar nicht stimmt.
Bislang habe ich bei ihm noch keine Angst vor dem nahenden Tod bemerkt. Er wirkt eher fasziniert als betroffen. (Ich beneide ihn sogar um die Unvergleichbarkeit seiner Erfahrung, ohne dass ich ihn um die Erfahrung selbst beneide.) Gelegentlich äußert er ungute Gefühle in Bezug auf das Leiden — das fürchte ich am meisten für ihn. Obwohl ich manchmal denke, bei dem Umstand, dass mein Sohn eine ausgefallene tödliche Krankheit hat, geht es gar nicht so sehr um den Tod (er ist halt ein ungewöhnlicher Mann), sondern darum, die Gelegenheit zu nutzen und einen schwierigen Trick besonders gut vorzuführen, einen Zaubertrick, den man nur einmal vorführen kann. Jemand, der ihn nicht kennt, könnte vielleicht sagen, er sei dabei, mit dem Leben klarzukommen, indem er einen guten Tod vorbereite, oder wie die tibetischen Buddhisten sagen: Da vereinigen sich der weiße und der rote Tropfen im Herzen wieder. Aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass es ihm gänzlich um ein gutes Leben geht und nicht die Spur um einen guten Tod (was immer das sein könnte). In meinen einsam-stummen Augenblicken kann ich mich dem Gedanken, die tödliche Krankheit meines Sohnes sei womöglich einer der Höhepunkte seines Lebens, nicht so ohne weiteres hingeben und frage mich zuweilen: Ergeben seine siebenundvierzig Jahre unter der Sonne genug Leben? Ich kenne die Standardantwort. Mein Herz antwortet trotzdem (seltsam, für einen Mann, der nie hofft): Ich hoffe es. Es ist nur schade, dass sein gutes Leben jetzt nicht mehr besonders lang sein wird.
*
Diese Valentinswoche ist so stark emotional aufgeladen, weil ich morgen um zehn Paul für den letzten seiner geplanten Aufenthalte in die Klinik fahre — das »Kennenlern- und Wertschätzungstreffen der medizinischen Pioniere an den Grenzen der Wissenschaft«, wo die Pioniere der Studie, an der er teilnimmt (ursprünglich acht, aber einer ist verloren gegangen), neurologisch begrüßt, bedankt, befeiert, belobigt, beschenkt und dann zu einem »Langzeit-Update« zu den Ärzten geschickt werden. Es ist eine stachlige »Promotion«, schließlich stirbt er. (Das soll keiner sagen, obwohl er selbst es natürlich tut, und ich genauso, damit das Leben eine Chance hat, in Echtzeit und Augenhöhe auf einem Spielfeld gegen seinen Feind anzutreten.) Er ist beharrlich in seiner Begeisterung für die Pioniere. Als Vater mache ich mir Sorgen, dass in ihm eine unausrottbare Hoffnung glimmt, irgendwas in seiner Zweimonatsstudie würde von Zauberhand ausgegraben, so dass irgendwas, irgendwas, irgendwas an irgendwas, irgendwas anderem gemacht und das schlimmste Irgendwas vermieden werden kann — wird’s aber nicht. Ich fürchte, dass das vorhersagbare Scheitern — unser aller Schicksal — einen großen psychisch-spirituellen Pauken-und-Trompeten-Zusammenbruch in ihm auslöst, an dem er zugrunde geht. Und ich auch. Ärzte sind daran gewöhnt, Unglücksbotschaften zu verkünden, und praktizieren »Ablieferstrategien«, die in Hopkins und Yale unterrichtet werden, was ihnen ermöglicht, den Blick abzuwenden, wenn die Welt für den Patienten die Grätsche macht. Aber ich als sein Pflegender muss ihn davor schützen. Obwohl ich zufällig der Ansicht bin, dass oft vieles für robuste Verdrängung spricht — und der Tod steht da weit oben auf der Liste.
Und so habe ich mir als Verarbeitungsstrategie für Paul und mich ausgedacht, dass wir morgen, wenn er »rauskommt«, eine nahezu epische Fahrt gen Westen unternehmen werden. Eine Lewis-und-Clark-Expedition der Letzten Stunde, munter hinaus durchs wintrige Minnesota und weiter in die South-Dakota-Prärie, bis hin zum Mount Rushmore (den ich 1954 mit meinen Eltern besichtigte), ein fernliegendes Ziel, fernliegenderweise im tiefsten Winter angepeilt, aber möglicherweise findet Paul es ja »urkomisch« und es kann seine Verzagtheit, seine Verzweiflung, dass nichts mehr zu machen ist, verdrängen. Mehr kann ich nicht tun — die Kunst des geretteten Augenblicks ist die einzige, in der ich halbwegs gut bin, auch wenn ich nicht weiß, was wir danach machen sollen. Hierher zurückkommen? Nach New Jersey fahren? Auf die Seychellen fliegen? Er ist bislang skeptisch, was so einen Ausflug betrifft und was mich betrifft und überhaupt alles, denn das sind vermutlich die letzten Dinge, die er sich wird aussuchen können. Aber auch wenn ich das Schlimmste nicht abwenden kann, würde ich meinen Sohn, wo es irgend geht, vor jedem Leid bewahren.
*
Der Verkehr, kurz bevor wir in die Comanche Mall abbiegen, ist Stoß-’n’-Stop, Stoß-’n’-Go. Wir stecken auf Rochesters überfüllter »Wundermeile« fest, aber keiner hupt. In Minnesota misstraut man der Hupe an sich, die für New Jerseyer ein wahres Musikinstrument ist. Gelb blinkende Streufahrzeuge verstopfen weiter vorne alles, zudem haben die Cops einen Typen rechts rangewinkt, denen ist scheißegal, dass sie die Kreuzung blockieren, die blau blinkenden Streifenwagen sorgen dafür, dass wir in einem Klumpen vor Babies R Us hängenbleiben. Paul und ich sind hinter einem Pick-up, der anscheinend lauter kaputte Hockeyschläger transportiert. Allerdings hatte ich, weil wir neu in der Stadt sind, Pufferzeit eingeplant.
Paul hat den Vormittag nicht gut überstanden — er hat mit den Hemdknöpfen und dem Zähneputzen gekämpft und im Bad zu lange gebraucht (ich musste zweimal anklopfen, bis er durch die Tür knurrte: »Ich leg grad ein Ei, das ist nicht so einfach«) und ist wie ein Varietéclown auf dem Seil zum Auto geschwankt. Wir waren früh aufgestanden, damit er pünktlich zu seinem Entlassungsgespräch bei seiner Neurologin Dr. Oakes war, einer grinsenden, sommersprossigen, rothaarigen Beinahe-Schönheit aus Menominee (in Stanford ausgebildet). Pauls letzte Infusion war gestern, und jeden Dienstag wird er — wie heute — zur Sprechstunde gebeten, um »seine Erfahrungen durchzugehen«: wie sich sein Körper anfühlt, wie er das Riluzole verträgt, das er einnimmt, um das Fortschreiten seiner Krankheit zu verlangsamen (es sorgt für verschwommenes Sehen und erhöhte Herzfrequenz, und er muss öfter — besser geht es ihm aber nicht), und wie er das Leben im Allgemeinen sieht — besser als ich. An seinen Kliniktagen bemüht er sich darum, robustes Wohlbefinden auszustrahlen, und takelt sich gern auf, als hätte er ein Date mit Dr. Oakes. Heute Morgen war seine Stimme allerdings »dünner« und höher, eine Symptomatik, die Dr. O. sicher bemerkt, notiert und kommentiert haben wird, obwohl Paul mir gegenüber nichts davon erwähnt hat. In diesem Stadium seiner Krankheit — dem mittleren — lassen die Muskeln seines Sprechapparats nach, weil in seinem Gehirn Nerven absterben. Irgendwann wird er schlicht aufhören zu sprechen. Und irgendwann werden sämtliche Muskeln aufhören, Aufträge vom Gehirn umzusetzen — obwohl dieses weiterhin tapfer welche schicken wird. Und danach wird er — für alle bis auf die Philosophen unter uns — aufhören zu »sein«. Bislang waren wir nicht sehr erfolgreich darin, dieses Thema anzusprechen, aber wir werden es bald versuchen müssen.
Nach zehn Minuten Stillstand sind wir endlich auf dem Parkplatz der Comanche Mall, der größer ist als die Oberfläche der meisten Kleinstädte, harter Schnee prasselt herunter. Schneepflüge rumpeln herum — Autos und Fußgänger schlittern den blinkenden, pingenden, scharrenden, schneespuckenden Panzern aus dem Weg, die Einkaufswagen, verlorene Einkäufe, Kleinwagen, Haustiere und Kinder zu dem Schnee-Matterhorn hinter dem Sears-Kaufhaus bulldozern, wo alles bis nächsten Sommer gefroren bleiben wird. Auf diesem Breitengrad herrschen die Schneepflüge, deren bärtig-bullige, Meth-entflammte Fahrer mit niemandem Gnade kennen.
Das Northern Lights Orthoplex, unser Ziel, befindet sich auf der Rückseite, hinter einer hoch aufragenden Jagen & Angeln-Pagode (Scheels) und einem verreckten Penny. Paul nutzt seine metallene Mehrfußgehhilfe — praktischer für den Schnee als sein Rollator, der ihn andererseits besser davor bewahrt, zu stürzen und sich das Gesicht aufzuschlagen, was heute Morgen beinahe passiert wäre. Aus irgendeinem Grund macht ihm die Kälte weniger aus als mir, aber er nähert sich der Grenze zwischen Gehenkönnen und Nichtmehrgehenkönnen. Für viele ALS-Kranke kann das den finsteren Übergang von ihrem bereits in Mitleidenschaft gezogenen Selbstwertgefühl zu etwas Schlimmerem darstellen. Ich bin mir nicht sicher, wie er das wegstecken wird, er ist so schwer einzuschätzen.
Im Auto hat er Anthony Newley auf seinem iPhone laufen, das er in einem albernen, paillettenbesetzten Gürtelholster aus Plastik »trägt« — Bluetooth eingeschaltet, Ohrstöpsel drin. Er starrt stumm auf die Mall-Tundra hinaus wie aus einem Flugzeug. Irgendetwas an dem Gespräch mit Dr. Oakes heute Morgen beschäftigt ihn noch. Ärzte von sterbenden Patienten müssen kühn die Wahrheit sagen und einen heiligen Bund der Aufrichtigkeit mit den Menschen einhalten, denen sie aus dem Leben helfen. Bloß dass sie es nicht richtig machen können. Jedes unbehauste Wort, ein »und« statt eines »aber«, ein falsch platziertes »sehr« oder »möglicherweise« oder »in meinen Augen«, und der gut eingestellte Leukämie-Leidende oder Nierentransplantatträger rauscht davon in unerreichbare Ängste. Aller Fortschritt dahin. Ich will mal versuchen, ihn danach zu fragen, wenn es einen geeigneten Augenblick gibt, wobei er normalerweise nichts eingesteht.
Auf unserer Fahrt in die Mall gab es nur zwei Momente größerer Lebendigkeit, als wir an seinen beiden Lieblingsgeschäften vorbeikamen — Little Pharma Drug und die Reinigung namens Free Will. Beide entlockten ihm einen prüfenden Blick zu mir, als wir vorbeifuhren, als würden wir beide ein unaussprechliches Geheimnis genießen. Unser ganzes Leben lang war das Gespräch zwischen Vater und Sohn kodiert und lückenhaft — kontinuierliches, themenbezogenes Sprechen liegt uns einfach nicht. Manchmal schweigen wir lieber. So ungewöhnlich kann das nicht sein.
Die Reinigung Free Will hatte rote Herzchen quer übers Schaufenster drapiert, dazu handschriftlich die Worte »Porentief frei — vom Fleck weg«, das gefiel ihm.
»Weißt du zufällig«, fragte er, ohne seine Ohrstöpsel rauszunehmen, »was die verbreitetste Hosengröße bei Männern ist?«
»Nein«, sagte ich, mit Verkehr und Schnee beschäftigt.
»Vierunddreißig, regular.« Er atmete unauffällig ein und wieder aus. Ich konnte den Tony-Newley-Song hören, der in seinen Ohren summte. Sonst sagte er nichts.
Als Paul in Connecticut auf die St. Jehosaphat’s ging (das war sein Name für die zweitklassige Prep School, auf die seine Mutter und ich ihn geschickt hatten), war er schon unterwegs in sein Leben eines Unnormalen; sie und ich schickten ihn zu zahllosen Therapeuten, probierten verschiedene Einrichtungen aus, sogar holistische Sommerlager in Maine, um herauszufinden, ob er in irgendeinem Syndrom oder Spektrum oder einer »-ose« festhing, gegen die nur half, was immer man in den fernen Achtzigern so verabreichte. Er »passte sich nicht ein«. Er war fröhlich und höflich, aber (viele) Freunde hatte er nicht. Sein Berufswunsch lautete Bauchredner. Sport war ihm egal. Er war Linkshänder. Er stotterte. Er legte abwechselnd diffuse Symptome von Tourette, Zwangsneurose, vielleicht auch ADHS an den Tag, ohne dass irgendwas davon als klinisch »nicht in Ordnung« eingeschätzt wurde. Sein IQ lag bei beachtlichen 112 (höher als meiner und der seiner Mutter, deutlich unter dem seiner Schwester). Er tat sich selbst oder anderen nichts zuleide, onanierte nicht exzessiv, zeigte sich nicht von Feuer fasziniert, versagte nicht in der Schule. Sein Verhalten — oft grinste er wie die Cheshire-Katze über etwas, das sonst niemand lustig fand — war »gar nicht mal so schräg«, laut Dr. Wolfgang Stopler, angesichts einer Scheidung, eines gestorbenen Bruders und der hereinbrechenden Pubertät. Mit dieser Diagnose waren seine Mutter und ich nicht einverstanden, aber wir trösteten uns damit, dass wir alles versucht hatten und sonst nicht viel tun konnten — da wir ihn mochten und auch gar nicht mehr tun wollten. Er sollte sein Leben leben. Wir ahnten nicht, dass er eines Tages ALS bekommen würde.
Und noch etwas sagte Paul heute Morgen, während wir in den Mall-Verkehr kamen und der Schnee wie Hagel auf die Windschutzscheibe pfefferte: »Wie geht es dir damit, Vietnam verpasst zu haben?«
Ich musste mich umdrehen und ihn anschauen. »Was bitte?«
»Wie geht es dir damit, Vietnam verpasst zu haben?« Seine Nase lief. Er wischte sie mit dem Ärmel ab und fingerte an dem silbernen Knopf herum, den er seit Mayo im linken Ohrläppchen implantiert hat.
»Warum zum Kuckuck fragst du mich das?«
»Hab ich so gedacht.« Dazu ticktackte er seinen Kopf vor und zurück, zu Anthony Newley in beiden Ohren.
Paul trug seinen »Krankenanzug«. Graue Jogginghosen, geräumig am Hintern, um seine bereits eingeschränkte Mobilität nicht noch weiter einzuschränken. Nach seinem Entlassungsgespräch hatte er sich umgezogen (zu diesem Anlass hatte er ein Brooks’ Oxford-Hemd mit Button-down-Kragen getragen, einen Pullover mit V-Ausschnitt, Chinos und Mokassins — um Dr. Oakes zu beeindrucken. Genau diese Uniform hatte ich ca. 1964 im Haus der Sigma-Chi-Studentenverbindung in Ann Arbor angehabt, und auch jetzt sah meine Zivilkluft des Pflegenden ungefähr so aus). Paul hat seit seiner Diagnose ein paar Pfund zugelegt und wirkt jetzt rundlich. Er hat immer eine Brille getragen und verliert seit zehn Jahren sein Haupthaar, manchmal ähnelt er dem alten Pornopapst Larry Flynt — kein guter Look. Er hat kurze, warzige Finger, und seit er als Kranker dokumentiert ist, hat er einen Teint wie das Innere eines Kühlschranks bekommen. Manchmal verströmt er auch einen scharf-metallischen Geruch, vermutlich von seinen Medikamenten. Die Zunge rollte er schon immer im Mund zusammen und drückt die grau-rosa Unterseite zwischen den Lippen hervor — was ich als Zeichen der Anstrengung erkenne. Neben mir im Auto, in seinem dreiviertellangen roten Super-Bowl-Stadionparka mit Kapuze (Kansas City Chiefs steht drauf), seiner Jogginghose, seinen speziellen Schweizer Schuhen, eigens für Al’s-Patienten entworfen, und den Fäustlingen, die seine Mutter für ihn strickte, als er ein Teenager war, sah er wie ein Riesenbaby aus.
»Das geht gerade in deinem Gehirn vor sich? Du denkst an Vietnam?«
»Genau.«
»Ich bin glücklich, dass ich Vietnam verpasst habe.« Die Scheibenwischer matschten lautstark Schnee. »Sonst gäbe es dich nicht. Oder vielleicht wärst du ein kleiner vietnamesischer Junge.«
Ich wusste, dass er diese Idee großartig fand, und nicht darauf einging.
»War das eine Art Hürde?« Paul denkt (zuweilen obsessiv) an Hürden; ein Widerstreben in uns, das uns daran hindert, all die dynamischen Dinge zu tun, die wir tun wollen. Harmonika spielen. Jonglieren. Einen Rückwärtssalto vom Zehner springen. Nichts, was er je hätte tun können. Jegliche Leistung fordert von ihm die unvermeidlich schmerzliche Überschreitung von Schwellen. Tatsächlich ist er zum Beispiel ein mäßig-bis-schlechter Bauchredner, besitzt eine Profi-Puppe mit orangem Haar, einer grellen, karierten Reitjacke und dummen blauen Glotzaugen. »Otto« — den er nach Minnesota mitgebracht hat. Das Bauchreden zu lernen, was er auf der Highschool gemacht hat, erforderte die Überwindung starker innerer Hürden. Er brauchte Jahre dazu, obwohl er immer noch die Lippen bewegt, wenn Otto reden soll — was er auch weiß. Seine Schwester findet Otto gruselig und erträgt seinen Anblick nicht. Das löst bei Paul einen Freudentaumel aus.
»Es war überhaupt keine Hürde für mich«, sagte ich, Vietnam betreffend. Das blaue Blinklicht der Polizei flackerte durch den Schnee, der die Scheibe beflog. Irgendein armer Somali reichte seinen Führerschein durchs Fenster, als wir vorbeikrochen. »Ich hab es mir nicht ausgesucht, nicht nach Vietnam zu gehen«, sagte ich. »Ich wurde krank und wurde für untauglich erklärt. Die Marines wollten mich nicht. Damals hab ich das bedauert, aber nicht lange. Der Krieg war schrecklich. Du bist in dem Jahr auf die Welt gekommen, als er zu Ende ging.«
»Ich hab mich nur gefragt, ob das ein Syndrom hervorgebracht hat wie meins.«
»Wie deins? Welches hast du denn? Du hast doch kein Syndrom. Du hast was anderes.«
»Stimmt.« Die schwere rosa Zunge wurde wieder sichtbar.
»Meinst du so was wie das Überlebendensyndrom?«
»Keine Ahnung. Nein. Das ist Bullshit.« Vor einer Woche fragte er mich, was das moderne Äquivalent des Unsichtbaren Mannes sei — noch ein Lieblingsfilm von ihm. Claude Rains, Gloria Stuart et al. Ich wusste es nicht. »Ein Al’s-Überlebender«, sagte er. »Jemand, den es nicht gibt.« Sein Mund kräuselte sich, dann sah er weg.
»Pass auf«, sagte ich verstimmt, als wir an dem Streifenwagen vorbeikamen, »dass ich verpasst habe, mich in Vietnam hochjagen zu lassen, hat gar nichts verhindert. Okay? Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Inklusive jetzt hier zu sein. Klar?«
»Ja.« Es gefiel ihm nicht, dass ich mich über ihn ärgerte.
»Und falls ich länger leben sollte als du — was nicht gesagt ist —, dann werde ich auch deswegen kein Schuldgefühl haben.« Das gefiel ihm, schließlich ist es praktisch sicher, dass ich ihn überlebe.
»Also. Und du, ähm, freust dich jetzt, dass ich hier bin?« Er blies in seinem Chiefs-Parka die Backen auf, denn er wusste, meine Antwort bedurfte einer gewissen Kunstfertigkeit. Das war seine Art, sich »selbst zu verorten«, was er laut seinen Ärzten tun sollte.
»Ja, aber auch nein«, sagte ich. »Ich freue mich nicht, dass du jetzt genau hier bist. In Rochester. Ich wäre lieber mit dir an einem Strand auf den Malediven. Aber ansonsten, ja. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass du am Leben bist. Das war eigentlich immer so.«
»Okay.« Er starrte vor sich hin, die Zunge war immer noch ein bisschen draußen. Ja-und-nein-Antworten mag er am liebsten.
»Und übrigens«, sagte ich, immer noch verstimmt, »ist das vollkommen idiotisch, ja? Ich liebe dich.« Es ist nie eine schlechte Idee, das mit einzubauen, falls er womöglich meinen sollte, sein Kranksein wäre eine Hürde für die Liebe. Ich war mir nicht sicher, ob er mich hörte, mit seinem Bluetooth drin.
»Das ist gut«, sagte er. »Aber den Geist darfst du nicht aus der Flasche lassen, Lawrence.« Er ist auf der Hut vor jeglichen Sentimentalitäten, vor Gönnerhaftigkeit, Melodrama oder Angelegenheiten des Herzens — das hasst er, da kann er grausam werden. Seit wir in der Mayo-Klinik waren, hat er angefangen, mich Lawrence zu nennen, kurz für Lawrence Nightingale.
»Ziemlich anspruchsvolle Nummer«, sagte ich, damit es ein Ende hatte.
»Jepp, du sagst es«, sagte er und sah hinaus auf den verschneiten, verstopften Verkehr.
*