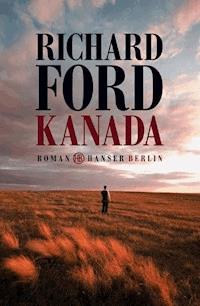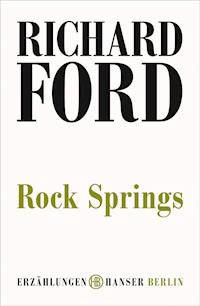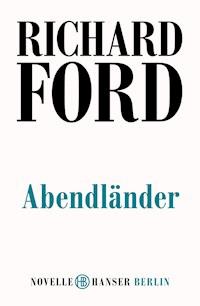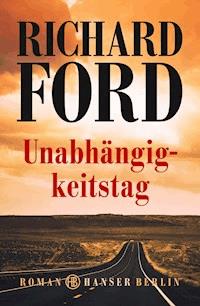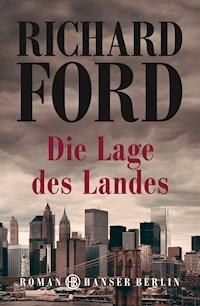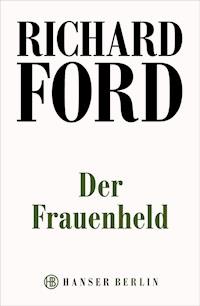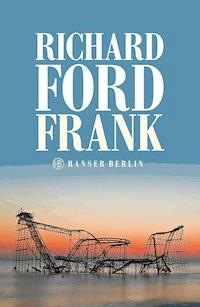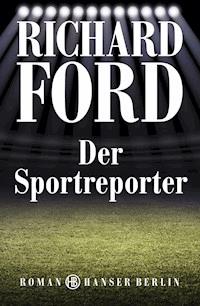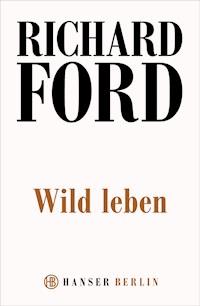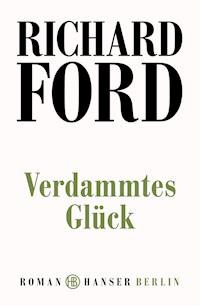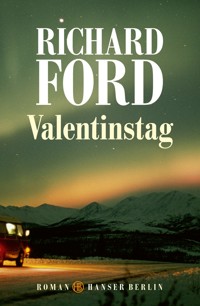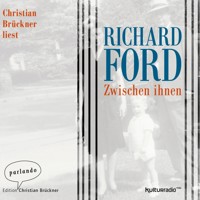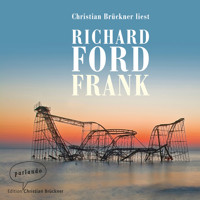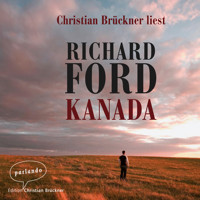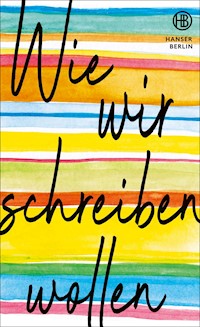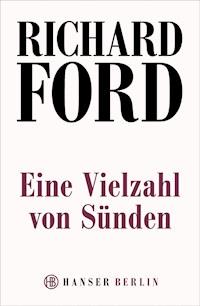
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit scharfer Beobachtungsgabe zeigt Richard Ford Momentaufnahmen von Affären verheirateter Männer und Frauen, die wenig heldenhaft, dafür aber umso menschlicher auf ihrer Suche nach Glück porträtiert werden. Da ist beispielsweise eine Steuerberaterin, die ihren Geliebten mit ihrem Ehemann (einem angeheuerten Schauspieler) konfrontiert, um eine Entscheidung über ihre Beziehung zu erzwingen. Richard Ford beweist in diesen zehn Erzählungen einmal mehr seine Fähigkeit, die Figuren psychologisch auszuleuchten und die Vielschichtigkeit menschlicher Gefühle offen zu legen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser Berlin eBook
Richard Ford
Eine Vielzahl von Sünden
Aus dem Amerikanischenvon Frank Heibert
Hanser Berlin
Die Originalausgabe erschien 2000
unter dem Titel A Multitude of Sins bei Alfred A. Knopf, New York.
ISBN 978-3-446-24244-9
© Richard Ford 2000
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2012
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Kristina
INHALT
Aussicht
Gute Zeiten
Ruf
Wiedersehen
Welpe
Krippe
Unter dem Radar
Revier
Nachsicht
Abgrund
AUSSICHT
Es geschah damals, als meine Ehe noch glücklich war.
Wir wohnten in einer großen Stadt im Nordosten. Es war Winter, Februar. Der kälteste Monat. Ich versuchte natürlich immer noch zu schreiben, meine Frau arbeitete als Übersetzerin für einen kleinen Verlag, der auf tschechische Wissenschaftstexte spezialisiert war. Wir waren zehn Jahre verheiratet und glaubten noch an die seltsame, erheiternde Illusion, wir hätten die schlimmsten Prüfungen des Lebens hinter uns.
Unsere Mietwohnung lag in der alten Industriegegend am Südende der Stadt, der Wohnbereich war ein einziger großer leerer Raum mit hohen Fenstern zu beiden Seiten, praktisch ohne elektrisches Licht. Alles natürliches Licht. Ein berühmter Theaterregisseur der Avantgarde hatte vor uns hier gewohnt und auch seine stachligen, nihilistischen Stücke aufgeführt, die Wände waren daher schwarz gestrichen, und an der einen gab es eine Reihe Klappstühle für sein kleines launisches Publikum. Unser Bett stand in einer dunklen Ecke, hinter ein paar hohen Kulissen aus schwarzer Leinwand, mit denen wir für etwas Intimsphäre sorgen wollten, dabei gab es niemanden, vor dem wir sie hätten schützen müssen.
Jeden Abend, wenn meine Frau von der Arbeit nach Hause kam, gingen wir hinaus auf die kalten, glänzenden Straßen, um in irgendeinem Restaurant zu essen. Danach saßen wir noch eine Stunde in einer Bar und tranken Kaffee oder Brandy, diskutierten die Übersetzungen, an denen meine Frau gerade arbeitete, und (zum Glück) nie meine Texte, an denen ich schon längst scheiterte.
Man muss es wohl kaum sagen: Wir wollten die Rückkehr in die Wohnung möglichst lange hinauszögern. Es gab nämlich nicht nur praktisch kein Licht dort, der Hausbesitzer drehte außerdem jeden Abend um sieben die Heizung ab, und bis zehn Uhr war es sogar in unserem, dem obersten Stockwerk zu kalt, um sich woanders aufzuhalten als im Bett, unter Bergen von Decken, so dass man sich kaum rühren konnte. Meine Frau hatte damals lange Arbeitstage und war immer übermüdet. Manchmal geschah es zwar, dass wir etwas angetrunken nach Hause kamen und uns im Dunkeln liebten, unter den Decken, aber meistens kippte sie völlig erschöpft ins Bett und schnarchte, noch bevor ich neben sie geschlüpft war.
Und so kam es, dass ich in jenem Winter an vielen Abenden in dem kalten, großen, beinahe leeren Raum saß, wach, oftmals hellwach von dem starken Kaffee, den wir getrunken hatten. Und oft schlenderte ich einfach von Fenster zu Fenster, starrte in die Nacht hinaus, nach unten auf die leer gefegte Straße oder nach oben in den gespenstischen Himmel, der vom schimmernden Widerschein der Stadt mit ihren Gebäuden leuchtete, Gebäuden, die ich gar nicht sehen konnte. Oft hatte ich eine oder gar zwei Decken um die Schultern geschlungen und trug die groben dicken Socken, die ich noch aus meiner Jungenzeit hatte.
Und in so einer kalten Nacht passierte es, dass ich durch die Fenster auf der Rückseite der Wohnung, die auf eine schmale Durchfahrt und eine dahinter liegende Fläche hinausgingen, wo eine Kabelfabrik abgerissen worden war, was den Blick auf die Häuser der Parallelstraße freigab – dass ich in einer lang gezogenen, gelb erleuchteten Wohnung die Gestalt einer Frau erblickte, die sich langsam auszog, offenbar ohne einen Gedanken an die Welt da draußen hinter ihrer Fensterscheibe.
Wegen der Entfernung konnte ich sie nicht richtig sehen, schon gar nicht deutlich erkennen, nur dass sie von kleiner Statur war und vermutlich dünn, mit kurz geschnittenem dunklem Haar – eine in jeder Weise zierliche Frau. Das gelbe Licht in ihrem Zimmer schien zu lodern und tauchte ihre Haut in glänzende Bronze, ihre Bewegungen erschienen durch das Fenster stilisiert und etwas unwirklich, wie die Bewegungen einer Silhouette oder in einem alten Kinofilm.
Und ich, der ich allein in der sinnesfeindlichen Dunkelheit saß, in Decken gewickelt, die auch meinen Kopf umhüllten wie ein großer Schal, während meine Frau nur wenige Schritte entfernt schlief – ich war von diesem Anblick wie entrückt. Zuerst ging ich näher an die Scheibe heran, nah genug, um sie kalt an meiner Wange zu spüren. Doch dann beschlich mich das Gefühl, ich könnte trotz der großen Entfernung bemerkt werden, und ich zog mich weiter ins Zimmer zurück. Irgendwann ging ich in die Schlafecke und knipste die kleine Lampe aus, die meine Frau neben unser Bett gestellt hatte, so dass mich die Dunkelheit nunmehr vollkommen verbarg. Und ein paar Minuten später holte ich aus einer Schublade das silberne Opernglas, das der Theaterregisseur zurückgelassen hatte, nahm es mit ans Fenster und beobachtete die Frau über den dunklen Raum hinweg aus meinem eigenen dunklen Raum heraus.
Ich weiß nicht, was ich alles dachte. Keine Frage, dass ich erregt war. Keine Frage, dass mir die Heimlichkeit, aus dem Dunkel herauszuspähen, einen besonderen Kitzel verschaffte. Keine Frage, dass mir gerade das Ungehörige daran gefiel, wo meine Frau direkt neben mir lag und schlief und keine Ahnung von dem hatte, was ich tat. Möglicherweise mochte ich sogar die Kälte, die mich umgab, so allgegenwärtig wie die Nacht selbst, vielleicht hatte ich gar das Gefühl, der Anblick der Frau – die ich als jung einschätzte, als entweder unvorsichtig oder wenig schamhaft – stärkte mich irgendwie, umgäbe mich mit einer Isolierschicht, und die ganze Welt stünde still, vollkommen in dem Bild zweier Pole aufgehoben, die mein Blick miteinander verband. Inzwischen weiß ich, dass all das mit meinem bevorstehenden Scheitern zusammenhing.
Sonst geschah nichts. Ich blieb jedoch in den kommenden Nächten immer wach, um die Fremde zu beobachten, und ließ meine Frau erschöpft einschlafen. Eine Woche lang erschien die andere Frau allabendlich an ihrem Fenster und entkleidete sich langsam in ihrem Zimmer (das ich mir nie vorzustellen versuchte, an der Wand hinter ihr hing allerdings eine Zeichnung, die nach einem springenden Hirsch aussah). Sobald ihre Kleider abgelegt waren, ihre knochigen Schultern, die kleinen Brüste und dünnen Beine und Rippen und der unauffällige, leicht gerundete Bauch entblößt, bewegte sich die Frau eine Zeit lang im Zimmer umher, von Fenster zu Fenster im Bronzelicht, und vollführte etwas, das mir wie ein langsamer ritueller Tanz vorkam oder vielleicht ein theatralischer Bewegungsablauf, Aufrichten und Bücken und Armausstrecken, Nackenkrümmen, während die Hände anmutige, federnde Gesten machten, die ich nicht verstand, ich versuchte es auch gar nicht, so gebannt war ich von ihrer Nacktheit und dem gelegentlichen Anblick des dunklen Haarbüschels zwischen ihren Beinen. Es war die reine Erregung und Heimlichkeit und Ungehörigkeit, sonst eigentlich nichts.
Eine Woche lang tat ich das, wie gesagt, und dann hörte ich damit auf. Einfach so, eines Abends, als ich, wieder einmal in Decken gewickelt, mit meinem Opernglas ans Fenster trat und das eingeschaltete Licht über den leeren Raum hinweg betrachtete. Eine Weile sah ich niemanden. Und dann drehte ich mich um, ohne einen bestimmten Grund, und legte mich ins Bett zu meiner Frau, die unter ihren Decken warm war und nach Brandy, Schweiß und Schlaf roch, und ich schlief selber ein und kam nie mehr auf den Gedanken, durch dieses Fenster zu starren.
Eines Nachmittags jedoch, eine Woche nachdem ich aufgehört hatte, die Frau durchs Fenster zu beobachten, stand ich frustriert und in sinnloser Verzweiflung von meinem Schreibtisch auf und stapfte hinaus in das Winterlicht, an der Reihe schicker Geschäfte entlang, wo die alten Häuser gerade zu Kleiderläden und erfolgreichen Kunstgalerien umgestylt wurden. Ich ging bis zum Fluss, auf dem sich große graue Eisschollen ineinander schoben. Und weiter in das Universitätsviertel, fast bis dorthin, wo meine Frau gerade arbeitete. Dann, es wurde bereits dunkel, machte ich mich auf den Rückweg in meine Straße, das Gesicht hart vor Kälte, die Schultern steif, die Hände ohne Handschuhe erstarrt und rot. Als ich um eine Ecke bog, eine Abkürzung zu meinem Block einschlagend, fiel mir plötzlich das Haus auf, das ich tagelang ausgespäht hatte. Es hatte irgendetwas an sich, das keinen Zweifel daran ließ, obwohl ich noch nie mit Bewusstsein daran vorbeigegangen war oder es auch nur bei Tageslicht gesehen hatte. Und genau in diesem Augenblick stand dort, die große Haustür aufschließend, die Frau, die ich in jenen wenigen Nächten beobachtet, von der ich mir Vergnügen und sicher auch heimlichen Trost geholt hatte. Natürlich erkannte ich ihr Gesicht – klein und rund und, wie ich sah, unbewegt. Zu meiner Verblüffung, nicht aber traurigen Enttäuschung war sie alt. Vielleicht siebzig oder noch älter. Eine Chinesin, gekleidet in dünne schwarze Hosen und eine dünne schwarze Jacke, in der sie bestimmt so fror wie ich. Eiskalt muss ihr gewesen sein. Plastiktüten voller Lebensmittel hingen an ihren Armen, einige hielt sie in der Hand. Als ich stehen blieb und sie ansah, wandte sie sich um und musterte mich, am Fuß der Treppe, mit einem Ausdruck, den ich im Nachhinein nur als Gleichgültigkeit bezeichnen kann, vielleicht war auch ein Hauch Bedrohtheit dabei. Schließlich war sie alt. Ich hätte plötzlich das Bedürfnis verspüren können, ihr etwas zu tun, und es wäre ein Leichtes gewesen. Aber natürlich dachte ich gar nicht daran. Sie drehte sich wieder zur Tür um und steckte, sichtlich hastig, den Schlüssel ins Schloss. Noch einmal warf sie mir einen Blick zu, als ich hörte, wie der Riegel weit zurückschnellte. Ich sagte nichts, sah sie auch nicht mehr an. Ich wollte nicht, dass sie darauf kam, was mir durch den Kopf ging, und ebenso wenig auf das, was mir nicht durch den Kopf ging. Also setzte ich meinen Weg fort, fühlte mich seltsam, aber keineswegs überraschend betrogen, ging einfach weiter die Straße entlang zu meinem eigenen Zimmer, meinen eigenen Türen, damals, als mein Leben in seinen ersten, langen Zyklus der Not eintrat.
GUTE ZEITEN
Von dort, wo er auf der befahrenen Sheridan Road an einer roten Ampel hielt, beobachtete Wales, wie eine Frau im Schnee hinfiel. Plötzlich den Tritt verloren auf dem rutschigen, unebenen Haufen, den die Schneepflüge am Fußgängerüberweg hinterlassen hatten. Wahrscheinlich alt, dachte Wales, obwohl es dunkel war und er ihr Gesicht gar nicht gesehen hatte, nur ihren Sturz – hintenüber. Sie trug einen langen grauen Herrenmantel und Stiefel und eine ins Gesicht gezogene Strickmütze. Oder sie trank, klar, überlegte er und beobachtete sie durch seine salzgesprenkelte Windschutzscheibe, während er weiter wartete. Sie konnte auch jünger sein. Jünger und Trinkerin.
Wales war unterwegs zum Drake, um die Nacht mit einer Frau namens Jena zu verbringen, einer verheirateten Frau, deren Mann ein enormes Vermögen mit Immobilien gemacht hatte. Jena hatte sich für eine Woche eine Suite im Drake genommen – um dort zu malen. Sie war vierzig. Sie hatte die Erlaubnis ihres Mannes. Sie – sie und Wales – trafen sich jetzt schon fünf Nächte in Folge. Er wünschte sich, es könnte weitergehen.
Wales hatte vierzehn Jahre lang im Ausland gearbeitet, für verschiedene Auftraggeber geschrieben – in Barcelona, Stockholm, Berlin. Immer auf Englisch. Vor einiger Zeit war ihm aufgegangen, dass er inzwischen zu lange fort war, den Kontakt zum amerikanischen Alltag verloren hatte. Doch dann rief ihn ein jahrelanger Freund an, ein Reporter, den er aus London kannte, und sagte, komm zurück, komm nach Hause, komm nach Chicago, halt ein Seminar darüber, was genau es heißt, James Wales zu sein. Nur zwei Tage die Woche, ein paar Monate lang, dann zurück nach Berlin. »Die Literatur des Eigentlichen«, hatte sein Freund, der Professor geworden war, gesagt und gelacht. Und es war wirklich lustig. So lustig wie Hegel ungefähr. Keiner der Studenten nahm es allzu ernst.
Die Frau, die hingefallen war – alt, jung, betrunken, nüchtern, er wusste es nicht genau –, hatte sich jetzt wieder aufgerappelt und legte aus irgendeinem Grund eine Hand auf ihren Kopf, als wäre es windig. Vor ihr rauschte der Verkehr die Sheridan Road hoch, beschleunigende Geschwindigkeit hinter Scheinwerfern. Hohe Wohnblocks aus den Sechzigern – eine lange Reihe, alle mit schöner Aussicht – trennten die Straße vom See. Es war Anfang März. Wintrig.
Die Ampel für Wales’ Spur blieb auf Rot, doch die entgegenkommenden Autos bogen jetzt vor ihm in zügiger Folge auf die Ardmore Street ab. Die Frau, die hingefallen war und sich eine Hand auf den Kopf gelegt hatte, wählte diesen Moment, um die Hauptverkehrsstraße zu betreten. Aus irgendeinem glücklichen Zufall heraus bremste der Fahrer auf der am nächsten gelegenen Spur, der am Bürgersteig, und kam für sie zum Stehen. Allerdings bemerkte die Frau das gar nicht, spürte nicht, dass sie sich mit zwei, vielleicht drei unklugen Schritten in Gefahr gebracht hatte. Wer weiß, was sich in dem Kopf abspielt, dachte Wales und beobachtete sie weiter. Eben gerade hatte sie noch im Schnee gelegen. Und kurz davor war alles in Ordnung gewesen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!