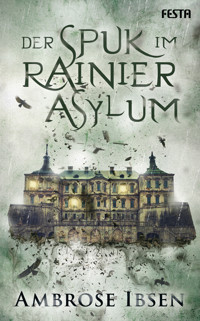4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: The Beckoning Dead Series
- Sprache: Deutsch
Sadie ist 25, arbeitet als Bibliothekarin und hat eine besondere Gabe: Sie ist empfänglich für das Übernatürliche. Ein Freund bittet Sadie, sich mit einem seltsamen Ereignis zu befassen. In einem angeblichen Spukhaus in der Stadt ist ein Mädchen verrückt geworden. Sie versucht seither sich umzubringen, weil sie, so behauptet das Mädchen, von dem Geist einer toten Frau terrorisiert wird. Diesen Geist nennt sie »die Madenmutter«. Obwohl sie ihre Gabe immer unterdrückt hat, möchte Sadie helfen und betritt das unheimliche Haus. Doch die Geschichte der Madenmutter ist keine Erfindung von einem gestörten Teenager. Der Geist der Toten ist real – und sehr bösartig ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Dirk Simons
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Haunting of Beacon Hill
erschien 2019 im Verlag Amazon.com Services LLC.
Copyright © 2019 by Ambrose Ibsen
Copyright © dieser Ausgabe 2020 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: ebooklaunch.com
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-862-9
www.Festa-Verlag.de
1
Das dunkle Haus stand auf einem Hügel. Die ersten Siedler der Gegend hatten ihn Beacon Hill getauft, und seitdem hatte er viele Häuser beherbergt. Übrig geblieben war jedoch nur das dunkle Gebäude, dessen baufälliger Zustand nun schon seit einigen Jahren den Hang verschandelte. Seine vielen Brüstungen und die Schornsteine warfen schwarze Schatten, die, wie nahezu alle Passanten dachten, wenn sie einen vorsichtigen Blick zu ihm wagten, viel zu verwinkelt wirkten, dass es die verfallenden Mauern rechtfertigten.
Das Haus bot an Architektur interessierten Passanten eine wahre Fülle an Gesprächsstoff. Das Spiel der Jahreszeiten hatte das Weiß der mit Efeu bewachsenen Fassade sichtlich getrübt, und wenngleich viele der braunen Dachschindeln zerschlissen wirkten, so bewahrte sich die alte Ruine doch eine ganz eigene, nahezu schauerromantische Atmosphäre.
Die Passanten sprachen allerdings nie über Architektur. Wann immer einer von ihnen nahe genug an das Haus herankam, wanderte sein Blick weit eher zu den Schatten in den Fenstern, die stets wirkten, als hätte sich dort jenseits der zerborstenen Scheiben just eben noch etwas bewegt. Auch berichteten sie von seltsamen Klängen – hauptsächlich von Gelächter, aber auch von Schluchzern und Schritten –, die nach Einbruch der Dunkelheit aus dem zerfallenden Inneren des Gebäudes drangen.
Seit dem großen Börsencrash hatte niemand mehr dort gewohnt, so hieß es. Manche im Ort glaubten sogar, das Haus habe von Anfang an leer gestanden und beherberge bloß Phantome aus der Sagenwelt Montpeliers. Etwa alle zehn Jahre machten Gerüchte über eine geplante Renovierung die Runde – von Initiativen, die Geld hatten und örtliche Denkmäler schützen wollten. Doch das Geld kam nie an, die Pläne blieben stets Theorie, und das steinerne Wahrzeichen auf Beacon Hill blieb allein mit seinem Verfall.
Obwohl es ein wenig außerhalb des Ortes lag, fand gelegentlich ein Einwohner Montpeliers den Weg zu ihm. Ein schmaler Bach führte am Hügel vorbei, in dem hiesige Angler im Frühjahr und Herbst nach Zandern Ausschau hielten, und weiter östlich boten breite Felder bei warmem Wetter den idealen Platz für ein ausgiebiges Picknick.
Hin und wieder verirrte sich sogar ein Forscher nach Beacon Hill: Jugendliche, die der Ruhe ihres kleinen Vororts in Indiana überdrüssig waren oder sich an Mutproben versuchten, standen gelegentlich auf der zerborstenen Türschwelle des alten Hauses.
An diesem Sommerabend wehte ein ungewöhnlich kühler Wind den Hang hinab.
Drei Schüler der örtlichen High School schritten über das mondbeschienene Feld und dem dunklen Bau entgegen.
»So nah war ich ihm noch nie«, gestand Ophelia mit leichtem Zittern in der Stimme. »Es ist viel größer, als ich dachte – echt riesig.« Sie klemmte sich eine schwarze Locke hinter das Ohr, verlangsamte ihren Schritt und sah ihre Begleiter an. »Das ist nah genug, oder?«
Leslie hielt nur inne, um ein Handyfoto zu machen. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nee, gehen wir weiter. Wir können uns ja mal drinnen umsehen, nur ganz kurz.«
»Aber die Geschichten …«, begann Ophelia.
»Meinst du die von Madenmutter?«, fiel Joey ihr Kaugummi kauend ins Wort. Er trat an den Mädchen vorbei auf den schmutzigen Pflasterpfad, der direkt zur Haustür führte. Nach ein paar Metern drehte er sich auffordernd um und die Krempe seiner Baseballmütze tauchte sein Gesicht in Schatten. »Die sind wahr. Jede einzelne!«
»Halt den Mund, Joey.« Leslie schloss zu ihm auf und verstaute das Handy wieder. »Dadrin gibt es nichts außer Spinnen und vielleicht ein paar Ratten.« Sie sah zu der noch immer zögernden Ophelia zurück. »Richtig?«
Ophelia rang sich ein Lächeln ab. »N… Na klar.«
»Oh, da gibt’s mehr als nur Ratten.« Joey kickte einen losen Stein den Hang hinab und sah ihm kurz nach. Sein Tonfall wurde dunkler, sein Grinsen wölfisch. »Vor ein paar Jahren war mein Bruder mal mit seinen Kumpels hier. Sie wollten eine Nacht im Haus verbringen, hatten sogar Schlafsäcke dabei.«
»Wie romantisch«, erwiderte Leslie. »Ich wusste gar nicht, dass dein Bruder so einer ist.«
Joey ignorierte sie.
»Kurz nach Mitternacht musste einer seiner Leute mal pinkeln, okay? Er ging also ins Freie, und als er fertig war, drehte er sich wieder um und sah an der Fassade hoch …« Nun hielt er inne und deutete auf ein dunkles Fenster im Obergeschoss. »Da von dem Fenster aus sah ihm etwas entgegen. Ein grauenhaftes Etwas. Daraufhin verloren sie alle die Nerven und packten zusammen.«
Ophelia gab sich Mühe, den Schauer zu ignorieren, der ihr bei seinem Seemannsgarn über den Rücken lief. »Na und?«, gab sie zurück, trat auf die verfärbten Pflastersteine und warf dem Haus einen Seitenblick zu. Dann räusperte sie sich, doch das Zittern in ihrem Tonfall ließ sich nicht mehr verbergen. »Da hat also jemand geglaubt, etwas zu sehen. Was soll’s? Das ist doch kein Beweis!«
»Hört sich nach einem Märchen an, wenn ihr mich fragt«, stimmte Leslie zu. Sie griff in Joeys Hosentasche und stibitzte sich einen Kaugummi, ließ das Stanniolpapier ins Gras fallen und putzte sich mit dem Saum ihres T-Shirts die Brillengläser, bevor sie den von Säulen flankierten Hauseingang einer neuen Betrachtung unterzog. »Dadrin ist es so dunkel, dass niemand seinen Augen trauen kann. Da bildet man sich alles Mögliche ein, unterm Strich ist es aber bloß ein großes leeres Haus.«
»Ach ja? Na, dann finden wir es doch einfach heraus.« Joey zog an der Krempe seiner Kappe und blieb endlich stehen. »Es ist nicht bloß mein Bruder. Dutzende von Leuten haben hier angeblich Dinge gesehen. Madenmutter schleicht noch immer durch diese Flure, darauf könnt ihr wetten.«
Ophelia, nach wie vor das Schlusslicht der Gruppe, nestelte mit zitternden Fingern an einem Hemdknopf. »Warum nennt man sie eigentlich so?«, fragte sie. »Madenmutter, meine ich.«
Bis zur Haustür waren es nur noch wenige Meter. Abermals staunte Ophelia über die Größe des Hauses, das vor ihnen aufragte wie ein zweiter Hügel. Das Licht des Mondes umspielte den Umriss seiner ramponierten Fassade. Schatten schienen aus ihm zu fließen, schwarz wie Schokoladensirup. Ein Duft von abgestandener Luft wehte aus dem offenen Türrahmen und bis zu ihren Nasenflügeln.
Joey nahm eine kleine Taschenlampe vom Schlüsselbund und schaltete sie ein, doch die helle LED-Leuchte konnte der tiefen und unerbittlichen Finsternis nichts anhaben. »Vor vielen Jahren«, begann er und senkte die Stimme unbewusst zu einem Flüstern, »lebte hier eine Frau mit ihren Kindern. Man sagt, sie habe sie missbraucht – schlimme Dinge mit ihnen angestellt. Als einer ihrer Söhne erwachsen war, beschloss er, sie dafür büßen zu lassen. Er ermordete sie auf brutale Weise, und als man die Leiche fand, hatten die Maden sich bereits daran gütlich getan. So heißt es jedenfalls …«
Leslie, eben noch ganz Skeptikerin, hing plötzlich an seinem Arm. Im Licht der Taschenlampe wirkte sie kreidebleich. »Das ist ja ekelhaft!« Mit dem freien Arm griff sie hinter sich, als suchte sie weitere Unterstützung.
Doch Ophelia blieb vor der Schwelle und sah ihren Freunden aus weit aufgerissenen Augen nach, als sie ins Schwarz eintauchten. »Ich will das nicht …«, sagte sie, die Hand an eine Säule gelehnt.
»Komm schon.« Leslie winkte entschieden. »Wir müssen zusammenbleiben!«
Bodendielen knarrten unter Joeys unsicheren Schritten, als wüssten sie noch nicht, ob sie sein und Leslies Gewicht akzeptieren wollten. Eine baufällige Stelle mochte genügen, die beiden in die Tiefe stürzen zu lassen.
»Jetzt komm, Ophelia«, sagte er. »Wir gehen ganz langsam, dann hält der Boden bestimmt.«
Doch es war nicht die Angst vor einem Sturz, die Ophelia bremste. Die Dunkelheit hatte einen lähmenden Schrecken über sie geworfen, ließ ihren Magen rumoren und ihre Glieder erstarren. Sie kannte das Gefühl gut. So war es, wenn sich ein Albtraum ankündigte oder man auf dem Sprungbrett stand und einen Eisklotz in den Eingeweiden spürte.
Leslie kam gerade weit genug zurück, um ihre Hand zu ergreifen. »Na los!«
Ophelia folgte den Freunden wie ein Hündchen an der Leine. Ihre Sohlen ließen die Dielen knarren, ihr Herz schlug wie wild in ihrer Brust. Sie wollte protestieren und sich losreißen, doch hier draußen im Schwarz kam es ihr undenkbar vor, die Kette aus Händen zu unterbrechen. Ein leises Winseln drang aus ihrer Kehle und blockierte ihren Mund, staubige Luft drang in ihre Nase. Tränen stiegen ihr in die Augen und fanden im Staub einen willigen Komplizen.
Zu dritt wagten sie sich weiter. Die genauen Ausmaße mochten im Dunkel verborgen bleiben, doch an der immensen Größe des hohen Raumes bestand kein Zweifel. Ihre schlurfenden Schritte fuhren durch vom Wind hereingewehtes Blattwerk und das Licht ihrer kleinen Lampe schlug die darin hausenden Insekten in die Flucht. Uralt wirkende Schimmelflecken prangten auf brüchigem Wandputz und durch die wenigen Löcher in den Außenmauern wucherte verdorrender Efeu hinein.
Es gab keine nennenswerte Möblierung, keine Anzeichen von Leben, sondern nur Dreck. Das Knarren der Bodendielen – gekoppelt mit dem hektischen Gezappel derer, die in ihnen wohnten – sorgte für einen gespenstischen Klangteppich. Jeder Schritt und jeder Atemzug, den die drei in die Stille entließen, hallte vielfach verstärkt in ihr wider. Staub wehte vom Boden auf, rieselte von der Decke und tanzte im dünnen Lichtkegel der Lampe wie Schnee in einem Wirbelsturm.
Sie wagten sich in noch entlegenere Winkel. Aus dem großen Zimmer gelangten sie in einen weitaus schmaleren Flur, in dem die Spinnweben dick wie Spitzendeckchen wirkten und vielbeinige Kleintiere hausten.
Ophelia schlich hinterher, wenn auch mit schlotternden Knien. Ihre Handflächen waren schweißfeucht und die dichte Finsternis raubte ihr jegliche Orientierung. Ihr Blick haftete an Joeys schmalem Lichtkegel, der konstant hin und her wippte, bis ihr schwindelig wurde. Als sie den Mund öffnete, um die anderen zum Rückzug zu überreden, brachte sie kaum einen Laut heraus, so sehr verschlug die Angst ihr den Atem. Der Geschmack des Hauses schlich sich auf ihre Zunge und ihr Magen zog sich zusammen.
An einer Biegung blieb Joey stehen. »Sieht aus, als hätten wir den Weg nach oben entdeckt«, sagte er und setzte den Fuß zaghaft auf die unterste Stufe einer breiten Treppe. Dann nickte er fest. »Die hält. Lasst uns hochgehen und einen Blick wagen.«
»Verschwinden wir lieber«, bat Leslie. Der Mut, der sie vorhin noch getragen hatte, war wie weggeblasen und sie zog so fest an Joeys Arm, dass er beinahe die Lampe fallen ließ. »Das reicht doch jetzt. Ich will nicht da rauf.«
»I… Ich auch nicht«, stieß Ophelia hervor. Ein Luftzug wehte durchs Haus und brachte die Härchen auf ihren Armen zum Stehen. Zitternd wagte sie einen Schritt zurück. »Hauen wir ab, okay?«
Joey behielt das Gleichgewicht und quittierte Ophelias Zerren mit einem eigenen. »Jetzt dreht nicht gleich durch, okay? Das ist doch nur ein Haus.« Der weiße Schein der Lampe verlieh seinem Gesicht ein unheimliches Leuchten. »Ihr habt doch wohl nicht Schiss wie kleine Babys? Ihr wolltet hierhin, schon vergessen?«
Sein Spott zeigte Wirkung, wenigstens bei Leslie. Sie atmete tief ein und hielt den Mund.
Ophelia wurde umso panischer. »Ich mein’s ernst. Wir müssen hier weg. Wir hätten nie herkommen dürfen!«
Unter den Umständen ließ sie sich nur zu gern einen Feigling schimpfen. Seit sie das Haus erblickt hatte, schrillten in ihr die Alarmglocken, und je tiefer sie in es vordrangen, desto mehr war ihr, als läge etwas in der staubigen Luft – eine Art Schrecken, der sich schon hinter der nächsten Biegung des Korridors materialisieren mochte.
Ihr Instinkt sprach eine deutliche Sprache: Sie musste fliehen, bevor alles zu spät war.
»Wir sehen uns da oben nur kurz um.« Joey richtete den Strahl der Lampe die Treppe hoch. »Dann können wir gehen.«
»Nein, ich will jetzt weg!«
Ophelia zerrte nach Kräften an Leslies Arm – und vielleicht ein bisschen zu fest. Leslie verlor das Gleichgewicht und fiel mit einem Plumpsen zu Boden. Joey folgte ihrem Beispiel und augenblicklich war die menschliche Kette unterbrochen!
»Scheiße!«, schimpfte Joey.
Die Lampe war ihm aus der Hand gefallen und erlosch. Vollkommene Finsternis umhüllte das Trio. Nur die Geräusche von Joeys suchenden Fingern und Leslies Flüche gaben einen Hinweis auf ihre jeweilige Position in der Schwärze.
»Was zur Hölle sollte das?«, fragte Leslie. Sie spuckte den Kaugummi aus und betastete ihren schmerzenden Ellenbogen.
Ophelia ging in die Hocke. Ihre Hände durchsuchten den Staub auf den Dielen nach der verlorenen Taschenlampe. Ohne das Licht würden die Schrecken, die in dem Meer aus Dunkelheit lauerten, gewiss bald näher kommen. Sie hustete und keuchte, aber das Einzige, was ihre Finger fanden, waren Splitter.
Ein neues Geräusch erklang, das sie die Suche einstellen ließ. Auch die anderen beiden verstummten sofort. Da kamen Schritte – vom oberen Ende der Treppe! Eine der Stufen knarrte, als hätte jemand den Fuß darauf gesetzt.
Die Freunde hielten den Atem an. Spielte ihre Fantasie ihnen einen Streich? Ein zweiter Schritt folgte und vertrieb alle Zweifel.
»I… Ist da jemand?«, stotterte Joey. Er war merklich entsetzt.
Statt einer Erwiderung hörten sie einen dritten Schritt, und der war Antwort genug.
Dann einen vierten.
Sie warteten nicht auf den fünften. Wenn sie abwarteten und nachdachten, erreichte die Person auf der Treppe sie bald! Chaos brach aus, und niemand verschwendete mehr einen Gedanken an die Taschenlampe. Joey erhob sich ächzend und stieß prompt gegen eine Wand. Dann übertönte der Klang seiner Turnschuhe auf dem Boden alle anderen Geräusche: Er floh so schnell er konnte, keine Spur von Tapferkeit.
Leslie schrie auf. »Joey! Warte! Ophelia, wo bist du?« Ihre Stimme hallte von den Wänden wider, jede Silbe schriller und ohrenbetäubender als die vorherige. Mit ausgestreckten Armen rannte sie los, einen neuen Schrei in der Kehle, blieb dabei aber mit dem Bein an einer unsichtbaren Ecke hängen und musste den Rest ihrer konfusen Flucht humpelnd absolvieren.
»L… Leute! Wartet auf mich!« Ophelia, die noch immer orientierungslos am Boden hockte, spürte, wie die Dielen unter ihr bebten. In welcher Richtung lag der Ausgang? Joey war in eine gerannt, Leslie dem Anschein nach in eine andere, und wo sie auch hinschaute, fand sie nur Schwärze.
Als sie aufstand, wurde ihr klar, wie egal es war. Sie musste weg hier, das allein zählte – weg von diesem Etwas auf der Treppe, das, dessen war sie sich entsetzlich gewiss, schon so gut wie neben ihr stand.
»Joey?«, schrie sie. »Leslie?«
Ihre Freunde antworteten nicht, aber auf der Treppe erklang ein weiterer Schritt, und wie die Erschütterungen in den Bodendielen verrieten, war das Etwas soeben unten angekommen. Ophelia stand keine Armeslänge von dem Unbekannten entfernt.
Ihr Puls hallte in ihren Ohren, als sie endlich loslief – ohne jede Orientierung. Sie versuchte, Leslies winselnder Stimme zu folgen, und tastete nach allem, was sie fand und was ihr helfen mochte – eine freundliche Hand, eine stützende Mauer. Doch sie tastete vergebens, allein in einem Meer aus Dunkelheit. Zitternd zog sie weiter, während Joeys Schritte und Leslies Stimme schnell in der Ferne verschwanden.
Wohin sollte sie gehen? Richtungslos stolperte sie umher, unterdrückte selbst das kleinste Schluchzen, und die Bodendielen knarrten unter ihren Füßen, als wollten sie sie verspotten.
Bleib ganz ruhig, versprach sie sich selbst. Wenn du ruhig bleibst, schaffst du es ins Freie. So groß ist das Haus gar nicht. Du findest gleich eine Tür oder ein Fenster …
Überall war Stille. Ophelia hörte ihre Freunde nicht länger und das Pochen ihres Herzens schien sogar die Dielen zu übertönen. Trotzdem zog sie weiter und tastete nach allem, was sie finden konnte. Ihre Finger strichen über knorriges Holz und weichen Staub. Mehrfach war ihr, als krabbelte etwas an ihrer Hand entlang oder über ihre Sandalen.
Dann sah sie den Mond! Ihr blindes Herumgeirre erwies sich tatsächlich als Erfolg, denn durch eine Tür oder ein Fenster weiter vorn konnte sie sein fahles Licht erkennen. Je näher sie ihm kam, desto deutlicher wurde ihre Umgebung. Sie musste in einen Seitenflügel gewandert sein, in dessen langem Korridor sie nun stand. Das Mondlicht fiel über die Schwelle eines offen stehenden Zimmers.
Sie keuchte und trat ein. Der Raum mit dem mondhellen Fenster war klein, die Scheibe zerbrochen. Sie musste vorsichtig sein, wenn sie hindurchkletterte, um sich nicht zu schneiden. Draußen im Garten wehte Buschwerk im Wind und die Nachtluft spielte mit dem Efeu an der Fensterbank.
Ophelia hatte es geschafft. Sie hatte einen Ausgang gefunden.
Nachdenklich trat sie zum Fenster und überlegte, wie sie den scharfkantigen Scherben entgehen konnte, als sie plötzlich innehielt. Irgendetwas hatte sich bewegt, dort in ihrem Augenwinkel! Ophelia erstarrte, zog die Arme an die Brust und lauschte.
Das stille Zimmer war etwa so groß wie ihr eigenes daheim und die vier schmucklosen Wände wirkten so baufällig wie alle anderen hier. Rechteckige Flecken verrieten, wo einst Bilderrahmen gehangen haben mochten. Beharrliche Nagetiere hatten ein paar Löcher in die Fußleisten gezaubert. In den Ecken lagen uraltes Laub und anderer Unrat, der von draußen hereingeweht sein musste.
Davon abgesehen gab es nur ein weiteres Ding in der Stille – ein seltsames Relikt, wie sie nirgends sonst eines entdeckt hatte: An der Wand direkt gegenüber hing ein schmutziger Spiegel, dessen Kanten im fahlen Mondlicht funkelten.
Der Spiegel war an manchen Stellen schon trübe, und auch der Rest von ihm taugte kaum noch. Das Alter hatte ihm zugesetzt und seine nunmehr schiefe Oberfläche verlieh allem, was sich in ihm zeigte, fast schon cartoonhaft verzerrte Dimensionen. Ophelia fühlte sich an eine Jahrmarktattraktion erinnert. Dieses Ding erlaubte sich einige Freiheiten mit ihren Gliedmaßen, die länger und dicker aussahen, und auch ihre braunen Augen wirkten darin riesig.
Sie beugte sich vor, um Blätter und Spinnweben aus ihrem schwarzen Haar zu klauben, straffte die Schultern und klopfte sich den Staub von der Kleidung.
Doch bevor sie sich zum Fenster wenden und ins Freie klettern konnte, sah sie es. Eine zweite Gestalt erschien in dem Spiegel! Sie lauerte direkt hinter ihr! Das Gesicht war ganz dicht an ihrer rechten Schulter und der nebulöse Körper in tintenschwarzer Dunkelheit verborgen.
Ophelia beugte sich noch weiter vor. Das musste ein Fleck im Glas sein, richtig? Irgendeine Art von Defekt.
Sie irrte sich. Das Gesicht war ein Gesicht – monströs, aufgequollen und lächelnd. Wohlgenährte Parasiten lauerten in tiefen Falten und bewegten sich energisch unter der papierdünnen Haut.
Vor lauter Entsetzen gaben Ophelias Knie nach. Sie wagte es nicht, sich nach der Gestalt umzudrehen. Sie spürte sie in ihrem Rücken, spürte ihren dunklen Blick auf sich, aber sie brachte es nicht über sich, über die Schulter zu blicken.
Dann fiel etwas auf sie herab – aus den Untiefen dieses wurmstichigen Antlitzes – und auf ihren zitternden Handrücken.
Es war eine Made.
2
Das kleine Mädchen stand vor einem der Regale, die Nase nahezu an die Buchrücken gepresst, und betrachtete die Titel. Wann immer ihr ein Buch würdig erschien, nahm sie es und unterzog den Einband einer kritischen Betrachtung. Waren sie es wirklich wert, dass sie sie las? Wer die Prüfung bestanden hatte, landete auf einem nahen Tisch, den bereits ein hoher Buchstapel zierte.
So ging es schon seit Minuten, als das Mädchen plötzlich innehielt und sich einer Bibliothekarin näherte. »Verzeihung?«, sagte sie und musste auf die Zehenspitzen gehen, um über die Theke zu blicken. »Können Sie mir helfen?«
Die junge Angestellte erhob sich umgehend. »Klar. Worum geht’s?« Sie kam um die Theke herum und ging auf ein Knie, um ihr in die Augen zu sehen. Diese waren hübsch, grün wie das Gras auf den Wiesen, und ruhten unter zwei dichten schwarzen Brauen, die an Raupen erinnerten.
»Ich suche nach Büchern«, sagte das Mädchen und deutete zur Kinderabteilung, aus der es gekommen war. Dann lächelte es und strich sich eine dunkle Locke hinter sein elfenhaftes Ohr.
»Okay, was für welche?«
Das Mädchen presste einen Finger ans Kinn. »Bücher über Kätzchen.«
Die Bibliothekarin nickte wissend und stand auf. »Kätzchen, hm? Ja, da kann ich bestimmt helfen. Komm mit.« Sie strich ihren langen blauen Rock glatt und deutete nach links, wo ein Regal mit TIERE beschriftet war. »Manche von denen sind vielleicht noch zu schwierig für dich«, warnte sie, »aber was wir an Büchern über Katzen haben, wirst du größtenteils hier finden.«
Das Mädchen trat zum Regal und inspizierte es mit vor der Brust verschränkten Armen. Ihre Zöpfe wippten im Takt ihrer Bewegungen. »Eigentlich«, erwiderte sie, »bin ich in der dritten Klasse und die Beste meiner Klasse im Lesen.« Sie hob verschwörerisch die Brauen. »Letzte Woche habe ich unseren wöchentlichen Vorlesewettbewerb gewonnen. Mein Lehrer belohnte mich mit einem Gutschein für eine Pizza.«
Die Bibliothekarin unterdrückte ein Lachen und gab sich verblüfft. »Ach du meine Güte.« Sie hob eine Hand an den Mund. »Ich hatte ja keine Ahnung. Dann bist du hier natürlich vollkommen richtig.« Während das Mädchen die ersten Bücher betrachtete, sah sie zurück zu ihrer Theke, nur um dann auf das Namensschild an ihrer Brust zu deuten. »Ich bin übrigens Sadie. Falls du noch etwas brauchst, lass es mich einfach wissen.«
»Okay, Sadie«, erwiderte das Mädchen. »Das mach ich.«
Sadie hatte die Ausleihtheke noch nicht erreicht, als die Kleine ihr schon wieder nachlief. »Hast du gefunden, wonach du suchst?«, fragte sie das Kind überrascht. »Möchtest du etwas mitnehmen?«
Das Kind, die Hände in den Hosentaschen, schüttelte den Kopf. »Ich brauche noch mehr Hilfe, Miss Sadie.«
An der Ausleihe stapelte sich die Arbeit. Berge an Rückgaben türmten sich neben der Theke und das Telefon klingelte ohne Unterlass. Delores, die Teilzeitkraft, kümmerte sich um die Anrufe, aber wenn Sadie nicht bald anfing, die Rückgaben einzusortieren, würde sie bis Mitternacht brauchen.
»Was kann ich denn jetzt für dich tun?«
»Ich suche noch immer nach Büchern über Kätzchen«, antwortete das Mädchen. Es deutete zur Tiere-Abteilung. »Die da gefallen mir nicht so.«
»Verstehe …« Sadie sah sich um und schnippte mit den Fingern. »Weißt du was? Das hier wird dir gefallen. Wir haben dahinten ganz viele Zeitschriften, direkt neben dem großen Fenster, und wir bekommen auch viele Tiermagazine. Da sind bestimmt Katzen drin. Sollen wir mal nachsehen?«
Das Mädchen nickte begeistert und folgte ihr zu den Zeitschriften. »Miss Sadie? Sind Sie gerne Bibliothekarin?«
»O ja«, antwortete Sadie. »Ich liebe Bücher. Für mich ist das hier der perfekte Job.«
Das Mädchen schürzte die Lippen und dachte kurz nach. Dann nutzte es Sadies freundliche Art für eine weitere Salve. »Wie alt sind Sie, Miss Sadie?«
»Ich?« Sadie lachte. »25, und du?«
»Neuneinhalb.« Sie hatten die Zeitschriften erreicht, doch das Mädchen interessierte sich weit mehr für die Bibliothekarin als für das Sortiment. »Sind Sie verheiratet?«, stellte es gleich die nächste neugierige Frage.
Sadie kicherte peinlich berührt, schüttelte den Kopf und sah sich fieberhaft nach etwas um, das eine Katze auf dem Titel hatte. »Ähm, nein.« Kinder waren manchmal so. Pro Schicht begegnete sie stets einem guten Dutzend, und viele stellten die unmöglichsten Fragen. Sadie ertrug es lächelnd, denn sie kam gut mit Kindern zurecht, wenngleich dieses hier zu den besonders neugierigen gehörte.
»Haben Sie viele Freunde?«
Sadie errötete, als sie durch eine Ausgabe des National Geographic blätterte und sie schnell zurückstellte. »Äh … Nein, nicht direkt.« Sie deutete zu den Computern, wo August, ein Kollege, jemandem beim Drucken half. »Sofern der Kerl da nicht zählt.«
»Oh«, sagte das Mädchen und lächelte wissend. »Ist das Ihr fester Freund?«
»N… Nein«, berichtigte Sadie mit heißen Wangen. »Er ist nur ein Freund. Von der Arbeit.«
Damit war die frühreife Kleine noch immer nicht zufrieden. »Wenn Sie keine Freunde haben, was machen Sie dann den ganzen Tag? Arbeiten Sie nur?«
Es war eine unschuldig gemeinte Frage, doch sie traf Sadie hart. Zunächst tat die Bibliothekarin, als hätte sie sie überhört, doch das Kind wiederholte sie – und lehnte zeitgleich mehrere Tierzeitschriften ab.
»Nun, ich lese gern …«, antwortete Sadie widerwillig und zermarterte sich vergebens das Hirn nach irgendeinem anderen Hobby, mit dem sie die Kleine beeindrucken konnte.
»Das klingt aber langweilig. Und einsam. Ich hoffe, wenn ich mal in Ihrem Alter bin, bin ich längst verheiratet.«
Sadie rang sich ein Lächeln ab. Besten Dank auch, dachte sie.
Das Mädchen lehnte sich seufzend gegen ein Regal. »Sie haben das Kätzchenbuch, das ich suche, gar nicht, oder?«
Frustriert ließ Sadie ein letztes Mal ihren Blick schweifen und zuckte dann mit den Schultern. »Wir waren in der Tierabteilung, bei den Zeitschriften … Ich wüsste nicht, wo wir sonst noch danach suchen sollten. In der Wissenschaftsabteilung steht vielleicht auch etwas über Katzen, aber …« Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Was willst du denn über Katzen wissen, Liebes? Das hilft uns vielleicht, die Suche einzugrenzen.«
Das Mädchen dachte eine ganze Weile nach. Erst dann antwortete es. »Ich brauche ein Buch, das mir erklärt, wie man sie repariert.«
»Wie man sie … repariert?« Sadie schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?«
»Es gibt da diesen Streuner in meiner Straße«, begann sie. »Der ist richtig süß, mit schwarz-weißem Fell und so. Ich wollte ihn schon reinlassen, aber mein Dad sagt, ich darf keine Katze haben, die nicht repariert ist.« Sie rollte mit den Augen. »Ich hab ihm gesagt, dass der Streuner kein bisschen kaputt aussieht, aber er hat nur gelacht.«
Sadie hielt sich die Stirn und verkniff sich ein Grinsen. »Oh, darum geht’s?« Sie deutete zu August, der noch immer am Drucker hantierte. »Das hättest du gleich sagen sollen. Mr. August kennt sich da nämlich hervorragend aus. Rede mal mit ihm.«
Sofort trottete das Kind los, um den zweiten Angestellten zu nerven. Sadie flüchtete zurück zur Ausleihe und versteckte sich im Pausenraum, bevor die Kundin noch mehr unschöne Fragen stellte.
»Sadie?« Delores drehte sich in ihrem Bürostuhl um. Sie hatte soeben ein Telefonat beendet, nun sah sie in den Pausenraum. »Was machst du da?«
Sadie trat zur Kaffeemaschine und füllte sie neu. »Ich? Ich kümmere mich gleich um den Rückgabestapel … und hinterfrage mein komplettes Leben.«
Sadie Young war aus einem einzigen Grund Bibliothekarin geworden: um jeden Tag acht bis zwölf Stunden lang von Büchern umgeben zu sein.
Der Geruch der Bücher, das Gefühl guten Papiers unter ihren Fingern, der matte Einband eines brandneuen Taschenbuchs oder der Glanz eines druckfrischen Schutzumschlags machte sie glücklicher als alles andere auf der Welt. Peinliche Kundenkontakte waren ein kleiner Preis, wenn man dafür Tag für Tag zwischen hohen Regalen umherstreifen durfte, sortieren, auswählen und manchmal sogar lesen konnte. Seit Kindertagen hatte sie diesen Beruf für sich gewollt, und die Büchereien ihrer kindlichen Fantasie waren grandiose Orte gewesen.
Sie hatte sich oft vorgestellt, in großen Häusern mit Wendeltreppen und gewölbten Decken zu arbeiten, etwa in der Library of Congress mit ihren Millionen an Büchern als Gesellschaft. In ruhigen Momenten, wenn ihre Fantasie mit ihr durchgehen durfte, sah sie sich in den schattigen Fluren der großen Bibliothek von Alexandria, unter dem Arm mehrere Papyrusrollen.
Im Vergleich dazu war die öffentliche Bücherei von Montpelier ein besserer Wandschrank. Dennoch war das eingeschossige Gebäude mit seinen paar Tausend Büchern irgendwie gemütlich. In der Mitte gab es eine großzügige Sitzecke, komplett mit gluckerndem Brunnen. Rechts daneben waren die Computerplätze, und sah man von der Theke und den Toiletten am Eingang ab, bestand der gesamte Rest des Geländes aus schulterhohen Regalen. Bei Tag schenkten Neonröhren ein angenehm sanftes Licht und abends ließen sorgsam positionierte Scheinwerfer die Bücher regelrecht leuchten.
Hinter dem Empfang lag der Aufenthaltsraum für Mitarbeiter, ein kleiner Verschlag, in dem sich normalerweise die vorgemerkten Titel stapelten. Hier aßen die Bibliothekare zu Mittag und sortierten die zurückgegebenen Medien vor. Hier stand auch die Kaffeemaschine – gespendet von einem reichen Wohltäter –, die Sadie ausgesprochen oft aufsuchte. Erst wenn sie eine frische Tasse Tee oder Kaffee in Händen hielt, fühlte sie sich richtig wohl.
Als ihr Earl Grey fertig war, kam sie zurück zur Theke, nippte an ihrer Tasse – zuckte zurück, weil heißer Dampf in ihre Nase stieg – und wartete darauf, dass die Zeit verging. Es war kurz vor 21 Uhr und so gut wie Feierabend.
Die letzten Besucher trotteten zur Ausleihe und scannten ihre Medien oder kamen von draußen mit ein paar Rückgaben herein. Sogar der Student mit dem glasigen Blick, der schon den halben Tag an einem der Rechner gehockt hatte, brach endlich auf. Sadie kümmerte sich um den Stapel mit den Rückgaben und scannte sie einzeln ins System. Dann sah sie wieder auf die Uhr. 21:01.
»Mist!«, stieß sie aus und sprang auf.
Das Rennen war gestartet.
Sie fischte den kleinen Schlüsselbund aus der Hosentasche und lief zur Eingangstür, wo sie den goldenen Haustürschlüssel ins Schloss steckte. Doch sosehr sie auch an ihm drehte und wackelte, er bewegte sich nicht.
Die Tür war bereits abgeschlossen.
Was hieß, dass jemand – er – Sadie zuvorgekommen war.
Ein spöttisches Schlüsselklimpern erklang hinter ihr. Sadie drehte sich um.
August saß am Rand des Brunnens und präsentierte seine Zähne. »Du lässt nach, Sadie«, sagte er grinsend und klimperte erneut mit seinem Schlüsselbund. »Ich war zuerst da. Und du weißt, was das heißt.«
Wütend steckte sie ihre Schlüssel in die Tasche. »Keine Ahnung, warum ich mich auf deine dummen Wetten einlasse.« Sie kehrte zur Theke zurück und wich seinem Blick aus.
August schlug die Beine übereinander und tauchte einen Finger ins Brunnenwasser. Er hatte einen Hemdsärmel hochgekrempelt und die Fliege abgenommen. Er trug stets Fliege auf der Arbeit, weil sie ihn, wie er felsenfest glaubte, »professionell« wirken ließ. Die heutige war rot mit weißen Punkten gewesen, und als er sich mit einem Grunzen erhob, baumelte sie aus seiner Gesäßtasche. »Hey, abgemacht ist abgemacht!«
Sadie nahm die Tasse und prüfte die Temperatur des Tees mit der Zunge. Immer noch zu heiß. Sie rollte mit den Augen und widmete sich den nächsten zurückgegebenen Büchern. »Beim nächsten Mal zahle ich das Mittagessen, alles klar. Aber nie wieder, verstanden? Wir lassen das mit der Wette von jetzt an. Sonst machst du mich noch arm.«
Er beugte sich über die Theke und roch an ihrer Tasse. »Komm schon«, tätschelte er sich den nicht vorhandenen Bauch, »ich bin im Wachstum. Lass mich nicht verhungern!« August war knapp 30, wirkte aber – sah man einmal von dem sorgsam gestutzten Bart ab – tatsächlich wie ein junger Bursche. Er war noch dünner als die schlanke Sadie und sogar ein wenig kleiner als sie, der ewige High-School-Bengel. Seine Stimme war sanft und angenehm, sein Tonfall aber stets oberflächlich. War es draußen sehr warm oder sehr kalt, was in Montpelier beides häufig vorkam, strahlten seine Wangen eine engelhafte Wärme aus.
Sein Benehmen passte zu seiner knabenhaften Gestalt. Er war fleißig und bei den Kunden beliebt, langweilte sich aber schnell und dachte sich dann elaborierte Streiche aus, um seiner Schicht die fehlende Würze zu geben. Aktuell gefiel er sich dabei, mit Sadie zu wetten – und der Sieger durfte vom Verlierer eine Einladung zum Lunch erwarten. Die Herausforderung war simpel: Wer an Abenden, an denen sie beide allein in der Bücherei waren, als Erstes die Haustür abschloss, hatte gewonnen. Doch selbst nach Wochen ununterbrochenen Wettkampfs hatte ihn Sadie erst zweimal besiegt.
Sie nahm ein paar Bücher und hielt sie ihm hin. »Hier, die hab ich schon im System. Sortiere sie ein.«
»Ja, Ma’am«, erwiderte August und ächzte spielerisch unter ihrem Gewicht. Er ließ sie in einen Rollwagen plumpsen und schob ihn zu den Regalen. Je weiter er in ihr Dickicht vordrang, desto weniger sah Sadie noch von ihm – nur sein rötliches Haar ragte über die Bücher hinaus wie der Kamm eines Hahns.
Endlich allein, lehnte Sadie sich im Sitz zurück und trank von ihrem Tee. Sie genoss es, sich am Ende der Schicht Zeit zu lassen. Waren die Bücher wegsortiert und die Vorbestellungen des Folgetages bearbeitet, drehte sie gern noch eine kleine Runde durch die Bücherei. Nicht selten setzte sie sich auch eine Stunde neben den Brunnen und las bei einer frischen Tasse Tee, bevor sie das Licht löschte und die Bibliothek durch den Seiteneingang verließ. Heute fehlte ihr aber die Zeit für Trödeleien. Ihr alter Wagen hatte kürzlich den Geist aufgegeben, und sie fuhr mit August, der gar nicht früh genug von hier verschwinden konnte.
Sadie widmete sich ihrem Tee und sortierte die restlichen Bücher auf der Theke nach Abteilung und Autorenname, bevor sie sie gruppenweise an ihren angestammten Platz brachte. Den meisten Menschen wäre diese Arbeit monoton vorgekommen, doch Sadie stieß dabei oft auf Schriftsteller und Themen, die ihr eigenes Interesse weckten. In ihrem Apartment warteten aktuell gut 50 Bücher aus den Beständen der Bibliothek auf ihre Lektüre und an den meisten Abenden brachte sie weitere in ihrer Handtasche mit.
August kehrte zurück, lud sich neue Stapel auf den Rollwagen und brauste wieder los, wobei ihm beinahe seine Ladung umkippte. Sadie drehte derweil ihre Runde, schaltete die Rechner aus und zog den Stecker des Brunnens. Als die Lichter gelöscht waren, ging sie in den Aufenthaltsraum und wischte die Kaffeemaschine kurz ab.
Erst als sie zurück zur Theke trat, um ihren eigenen Computer runterzufahren, spürte sie es. Ein Schauer lief über ihren Nacken – so plötzlich und unerwartet, dass sie die Hand dorthin hob. Als sie über die Schulter blickte, rechnete sie damit, August zu finden, doch er summte fröhlich zwischen den Regalen herum, sein rötliches Haar ein sichtbares Erkennungszeichen. Sadie sah zum Heizkörper. War sie unbemerkt dagegengestoßen und hatte ihn heruntergedreht? Doch die Temperatur war stabil und aus dem Lüftungsschacht an der Decke drang auch kein kalter Hauch.
Das seltsame Gefühl blieb. Sadie sah sich langsam um, spähte durch die Dunkelheit. Ihr Magen zog sich zusammen, wie stets, wenn sie sich beobachtet vorkam. Nur: Wer sollte sie beobachten? Und von wo? Ihr Blick glitt über den Brunnen bis zu den hohen Fenstern im hinteren Bereich des Gebäudes, ohne Verdächtiges zu finden. Dann trat sie vor die Ausleihtheke und nahm den Eingang der Bibliothek ins Visier.
Sofort stellten sich die Härchen auf ihren Unterarmen auf. Vor der Bücherei war ein geteerter Hof, hell erleuchtet und schmucklos bis auf zwei Bänke und einen Fahnenmast. Und bis auf einen Neuzugang – noch dazu einen höchst unwillkommenen.
Ein Mann stand an der Tür. Er beugte sich vor, wie um durch das Glas zu spähen, und die Schatten, die der Vorbau über ihn warf, machten es Sadie unmöglich, sein Gesicht zu erkennen. Er war groß, mehr konnte sie nicht sagen.
Nein, das stimmte nicht.
Sie sah auch seine Augen!
Wie grelle Scheinwerfer auf einem dunklen Highway wirkten sie, milchig weiß, und sie glotzten Sadie entgegen. Ohne das Gurgeln des Brunnens im Rücken konnte sie die Geräusche von draußen hören, und als sie in die zwei kalkweißen Kreise blickte, kam es ihr vor, als flehten sie sämtliche nachtaktiven Insekten der Umgebung an, es zu lassen.
Die Person vor der Tür winkte. Eine missgeformte Hand, die bisher wie taub herabgehangen hatte, lockte sie zu sich. Sadie spürte einen Schrei in ihrer Kehle nahen und hielt sich den Mund zu. Als sie sich umdrehte, um sich an der Theke abzustützen, stieß sie die Teetasse zu Boden, wo sie zerschellte. Warme Flüssigkeit suppte in den Teppich.
August kam mit leerem Wagen, beäugte die Sauerei und pfiff leise. »Och nee. Wir wollen gerade Schluss machen, und du veranstaltest so etwas?«
Er wartete auf eine Erwiderung. Doch sie reagierte nicht – noch nicht. Stattdessen stand sie da, blass wie eine Wand, und verzog das Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen.
»Hey.« Er kniete sich hin, um erste Scherben aufzulesen. »Mach dir keine Gedanken. Wir legen einfach einen Läufer drüber. Das merkt kein Mensch.«
Zitternd trat Sadie an ihm vorbei und deutete zur Tür. »D… Da draußen ist jemand. Er sieht zu uns.« Sie lehnte sich an die Theke, denn ihr wurde schwindelig. »Schick ihn weg, ja? Bitte.«
August hob die Brauen und stand auf. »Ein Kunde in letzter Minute? Ich kümmere mich darum.«