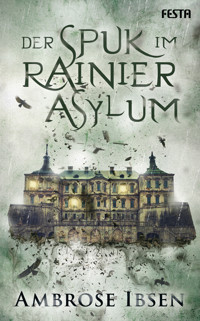5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Haus war seit Jahrzehnten verlassen. Und wäre es besser auch geblieben, denn jetzt ist in seinem Inneren etwas erwacht. Kevin Taylor ist ein im Internet bekannter Handwerker mit einer Mission: Er renoviert verfallene Häuser innerhalb von nur 30 Tagen und filmt das Ganze für seinen Onlineblog. Doch die Probleme, die das Haus in der 889 Morgan Road plagen, sind ganz anderer Art. Auf den Videos taucht immer wieder ein rätselhafter Eindringling auf, und mitten in der Nacht rufen Stimmen aus den leeren Räumen. Noch schlimmer sind die Schatten im Haus; sie scheinen ein Eigenleben zu führen und halten sich an keine Naturgesetze. Kevin muss mehr über die dunkle Vergangenheit des Hauses herausfinden – so unvorstellbar schrecklich sie auch sein mag. Ambrose Ibsen gehört zur neuen Generation der herausragenden amerikanischen Horrorautoren in der Art von Stephen King oder Dean Koontz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Alexander Nym
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The House of Long Shadows
erschien 2018.
Copyright © 2018 by Ambrose Ibsen
Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: Tanja Prokop - TLI Design
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-169-1
www.Festa-Verlag.de
1
Haben Sie jemals geschlafen wie ein Toter, wie der Volksmund sagt?
Ich schon.
Es ist das Friedlichste, was man sich vorstellen kann – so nahe an der Nichtexistenz wie nichts, was ich sonst je empfunden habe.
Definitionsgemäß ist es ein traumloser Schlaf. Ein Schlaf ohne Grenzen, bei dem die Existenz reichlich brüchig wird. Mein Leben war zu einer Kerze reduziert worden, die man im Regen stehen gelassen hatte und deren Flamme umherzuckte und nur knapp dem Tropfen auswich, der sie für immer erstickt hätte. Und wäre sie dort ausgelöscht worden, wäre ich entschlafen, ohne es überhaupt mitzubekommen. Schmerz, Leiden und Angst existieren nicht, werden nicht wahrgenommen von einem Verstand, der unter jenem Totenschlaf begraben liegt.
Mit einem Ruck wachte ich auf. Vielleicht zuckte ich auch mehrmals, aber mein Körper war zu taub, um das zu zählen.
Als Nächstes überrollte mich eine Welle der Verwirrung. Mein Bewusstsein fühlte sich fremd an. Schleichend kehrte die Beweglichkeit in meine Glieder zurück, und das Erste, was ich spürte, abgesehen von dem Pulsieren in meinen Gelenken, war kalter Stahl, der sich in meine Unterarme drückte.
Mein Geruchssinn kam zurück und ich inhalierte die abgestandene, wiederaufbereitete Luft. Sie war mit dem sterilen Aroma von chlorhaltigem Desinfektionsmittel durchsetzt. Ein raschelndes Laken war um meine Beine gewickelt. Ein lose sitzender Kittel haftete an meinem Oberkörper, angeklebt von kaltem Schweiß.
Das ist ein Krankenhaus, dachte ich.
Von diesem Schreck aufgerüttelt, öffnete ich die Augen.
Ein Pfleger und eine Frau in einem weißen Laborkittel standen seitlich neben meinem Bett und besprachen flüsternd mein wundersames Erwachen. Diese Frau im Kittel, kombinierte ich, war möglicherweise meine behandelnde Ärztin.
»Mr. Taylor?« Ihre Stimme war ruhig und bedacht. Ihre Hände bewegten sich zu dem Stethoskop, das um ihren Hals hing, aber sie tat nichts damit, spielte nur mit einem der perlenförmigen Ohrenstöpsel. »Mr. Taylor, können Sie mich hören?«
Ein starkes Aroma umgab die Ärztin – zuerst schien es mir von einer bekannten Handcreme zu stammen, mit Pfefferminz und Eukalyptus, die ich schon einmal irgendwo gerochen hatte. Vielleicht kam es vom leichten Verzögern meiner Sinne oder von einer Note, die eine olfaktorische Erinnerung weckte, aber der Geruch ließ mich würgen. Heiße Galle stieg meine Kehle hinauf, die ich kaum unter Kontrolle halten konnte, während ich ihr als Antwort zunickte.
Ich wusste, was es war.
Ihre Handcreme roch wie die giftigen Blüten der Wildbirne.
Und mit dieser Erkenntnis ergriff der Schrecken erneut von mir Besitz.
Das Haus.
Der Unfall.
All das.
Ich glaube, ich begann zu schreien. Und ich weinte auch und klammerte mich an ihren Kittel wie ein heulendes Kleinkind an die mütterliche Schürze.
Der Pfleger – der wie ein junger Lou Ferrigno aussah – hielt mich an den Schultern fest, während die Ärztin versuchte, mich zu beruhigen.
»Mr. Taylor, bitte versuchen Sie, sich zu entspannen. Es geht Ihnen gut. Hier sind Sie sicher!«
Das war eine Lüge, und ich wusste es.
Der unglaubliche Hulk drückte mich sanft auf das Bett, bis ich still war.
Als sie dachte, ich wäre ansprechbar, lehnte sich die Ärztin über mich und lächelte, während sie sich eine Locke ihres langen braunen Haars hinters Ohr strich. Es sah fettig und ungewaschen aus, so als wäre sie mitten in einer 16-Stunden-Schicht, ohne Zeit zu haben, sich um ihr Aussehen zu kümmern. Ihre Augenringe verstärkten diesen Eindruck nur noch. Ihr Atem roch nach Kaffee – nach der billigen Sorte, die man in Krankenhaus-Wartezimmern umsonst angeboten bekam. Obwohl sie müde wirkte, versuchte sie geduldig, mich aufzumuntern. Der widerwärtig süßliche Geruch der Creme war jetzt besonders stark. Speichel sammelte sich in meinem Mund, während mein Magen mit Meuterei drohte. »Mr. Taylor, Sie sind in Sicherheit. Sie sind in guten Händen. Ich bin Ihre Ärztin. Erinnern Sie sich, was passiert ist? Warum Sie hier im Krankenhaus sind?«
Ich schrie ihr ins Gesicht wie ein Wahnsinniger, aber nicht etwa, weil ich verrückt geworden wäre. Tatsächlich war ich rundum zurechnungsfähig, das war ja das Problem.
Ich schrie, weil ich mich an alles erinnerte.
Ich erinnerte mich an das Haus in der Morgan Road.
Ich erinnerte mich an den Baum davor, die Chinesische Wildbirne.
Die Stimmen.
Die langen Schatten.
Und vor allem erinnerte ich mich an …
»Mr. Taylor! Bitte versuchen Sie, sich zu beruhigen! Es ist in Ordnung. Alles wird gut. Sie hatten einen schlimmen Unfall, aber jetzt sind Sie wohlbehalten hier.«
Ich konnte nicht erkennen, ob außer uns noch jemand anders mit im Raum war. Ich versuchte, den Kopf zu drehen, aber ein scharfer Schmerz im Nacken brachte mich davon ab. Ich stellte fest, dass meine Lippen staubtrocken waren, und ich musste mit meiner Schleifpapierzunge darüberfahren, bevor ich antworten konnte: »Ist hier … Ist hier noch jemand außer uns?«
»Nein«, versicherte sie mir. »Der Pfleger ist gegangen. Hier sind nur Sie und ich.«
Ich bemühte mich, einen Blick nach rechts zu werfen – auf dem Stuhl an der gegenüberliegenden Wand erspähte ich eine verschwommene Silhouette und weißes Haar.
Das … Das ist sie … Sie ist hier drin bei mir …
Als ich zu schreien begann, gab es nichts mehr, was die Ärztin zu meiner Beruhigung hätte sagen können. Nur ein Betäubungsmittel schaffte es, mich ruhigzustellen.
2
»Hey, danke fürs Einschalten! Hier ist euer Hammer-Hauptdarsteller, Kevin Taylor. Ich bin hier, um …«
Das Stativ verschob sich um ein paar Grad, und die Kamera kippte in Richtung Boden. Ich hatte eines der Gelenke schlecht festgeschraubt, und jetzt war die Einstellung im Eimer.
»Ach, wunderbar.«
Ich zentrierte die Einstellung erneut, wobei ich sicherstellte, dass die Vorderfront des Hauses komplett im Bild war. Während ich mein Haar zurückstrich und mich einstimmte, schritt ich zu dem Punkt des Rasens, den ich mit einem großen Stein markiert hatte, setzte ein gewinnendes Lächeln auf und versuchte mich abermals an meinem Einstiegsmonolog.
»Hey VideoTube! Hier spricht FlipperKevin, euer Lieblingsheimwerker. Heute habe ich etwas Besonderes für euch. Ich stehe hier in einem Viertel von Detroit, vor dem …«
In der Höhe dröhnte ein Flugzeug vorbei. Ich wusste, wie das bei der Nachbearbeitung klingen würde. Meine Stimme wäre so übertönt, dass man mich kaum noch verstehen konnte.
»Ernsthaft jetzt?«
Es schien, als würde das Flugzeug nie verschwinden, als ob es wiederholt über mir kreisen wollte, um meine Aufnahme zu ruinieren. Ich sah zu, wie es nach Osten verschwand, und brauchte dann einen Moment, um mich zu sammeln.
Für den Frühling war es ungewöhnlich warm. Da ich meine ganze Arbeitsmontur anhatte, um wie ein seriöser Handwerker auszusehen, war mir wirklich heiß. Der schwere Werkzeuggürtel, der mit Krimskrams vollgestopft war, den ich keineswegs benutzen wollte, rutschte mir allmählich bis auf die Hüften, zusammen mit dem Bund meiner farbverschmierten Jeans. Mein Arbeitshemd aus Leinen, ebenso mit weißer Farbe befleckt, fühlte sich an wie ein Büßerhemd, trotz der hochgerollten Ärmel. Seit ein paar Monaten versuchte ich mich an einer Art James-Dean-Frisur, die Haare zu einer Tolle zurückgegelt, aber in der prallen Sonne löste mein Schweiß die Pomade auf, sodass sie meine Stirn hinunterlief und mir in den Augen brannte.
Als alles still war, räusperte ich mich und versuchte erneut, die Einleitung für mein Video aufzunehmen – zum dritten Mal.
»Hey VideoTube! Hier spricht euer allerliebster Hauptdarsteller, FlipperKevin, der eine aufregende neue Videoserie für euch hat!« Ich machte eine Pause in der Erwartung, dass irgendetwas schiefgehen würde – durch eine Motorfehlzündung oder einen zufälligen Windstoß, der die Kamera umwarf. Als nichts geschah, machte ich vorsichtig weiter. »Ich stehe hier vor diesem prächtigen alten Haus in Detroit. Wie war das? Sieht für euch gar nicht so prachtvoll aus? Also, ihr müsst wissen, dass die Lady tolle Knochen hat, und wenn ich mit ihr fertig bin, wird sie aussehen wie neu. Irgendwelche Schätzungen, wie viel ich für das Schmuckstück ausgeben musste?« Ich grinste. »Ihr werdet es nicht glauben, aber ich hab für diesen alten Kasten gerade mal einen Tausender hingeblättert!« Hier fügte ich eine dramatische Pause und ein ungläubiges Wackeln mit den Augenbrauen ein. »In meinem letzten Video hab ich angekündigt, dass meine nächste Challenge die Renovierung einer Bruchbude werden würde – von Kopf bis Fuß eine Einmannreparatur innerhalb nur eines Monats. Also, Leute, das hier ist es! Ich werde dieses Haus in nur 30 Tagen bewohnbar machen. Und ich werde täglich Videos veröffentlichen, um den gesamten Vorgang im Detail festzuhalten.«
Ich wandte mich zum Haus um, um das Publikum auf ein paar seiner Besonderheiten hinzuweisen. »Wie ihr sehen könnt, ist dieses Gebäude in einem jämmerlichen Zustand. Über Jahre hat niemand darin gewohnt – vielleicht sogar über Jahrzehnte.« Ich trat auf das Stativ zu und drehte die Kamera in einem sanften Bogen, um ein wenig von der Nachbarschaft einzufangen. »Alle Häuser in dieser Straße – zumindest die wenigen, die noch stehen – sind verlassen. Dieses Haus ist das einzige, das eine winzige Chance bietet, es aufzupolieren, und die lasse ich mir nicht entgehen. Es ist perfekt für dieses Renovierungsprojekt geeignet, und weil so ziemlich alles ersetzt werden muss, werde ich Gelegenheit haben, euch allerlei nützliche Techniken zu demonstrieren, zum Beispiel das Einziehen von Trockenbauwänden, den Einbau neuen Mobiliars und vieles mehr. Ich weiß: Wenn man sich diese bedauernswerte alte Lady ansieht, scheint es eine Riesenarbeit zu sein, sie in nur einem Monat auf Vordermann zu bringen, aber mit ein wenig Liebe und Muskelschmalz bekommen wir sie wieder auf die Füße!«
Ich warf einen Blick zurück auf das Haus und konnte nicht anders, als murmelnd hinzuzufügen: »Zumindest hoffe ich das.«
Denn tatsächlich war das Haus in einem schrecklichen Zustand.
Wenige Tage zuvor hatte ich der Stadt Detroit die Morgan Road 889 für schlappe 1000 Dollar abgekauft. Das alte Haus war irgendwann in den 70er-Jahren im amerikanischen Craftsman-Stil erbaut worden und befand sich im Eigentum der Stadt, welche geschockt reagiert hatte, als ich mein Interesse daran signalisierte. Nachdem ich die anderen Häuser in der Morgan Road inspiziert hatte, war ich von diesem genügend beeindruckt gewesen, um mir noch am selben Nachmittag die Eigentumsurkunde zu beschaffen.
Dieses verfallene zweistöckige Gebäude sollte der Star meines neuesten VideoTube-Projekts werden – ein Projekt, von dem ich mir erhoffte, dass es mir haufenweise neue Abonnenten, Werbeeinnahmen und möglicherweise einen Vertrag mit einem Fernsehsender einbringen würde.
Einige Wochen lang war ich im Mittleren Westen herumgefahren, auf der Suche nach einem Haus, das ein Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung hatte. Ohio und Indiana hatten nicht wenige Kandidaten zu bieten, aber erst in Michigan begann ich, über die echten Schnäppchen zu stolpern. Häuser in Detroit und Umgebung, insbesondere in den raueren Gegenden, wurden für weniger als 1000 Dollar angeboten. Anfangs konnte ich es fast nicht glauben. Ich meine, ein ganzes Haus zum Preis eines Laptops? Oder einer Zahnwurzelbehandlung? Es schien zu gut, um wahr zu sein.
Aber das war es nicht. Ein Rundgang durch die Stadt förderte eine Reihe Häuser in verwandelbarem Zustand zutage, die weniger kosteten als ein hochwertiger Flachbildfernseher. Natürlich wären die Materialien, die zur Sanierung eines solchen Hauses benötigt würden, nicht gerade billig, aber nachdem ich etwas recherchiert und mich mit den lokalen Händlern vertraut gemacht hatte, wurde mir klar, dass ich so ein Haus für weniger als 15.000 komplett renovieren konnte, vorausgesetzt dass ich bei den dekorativen Details wie Küchenarbeitsplatten nicht allzu wählerisch wäre.
Wirklich – dieser Stadtteil, angefüllt mit heruntergekommenen Häusern, war ein Traum für Heimwerker. Es gab sogar Förderprogramme der Regierung, durch die Häuser in leer stehenden Wohnvierteln an Polizeibeamte oder medizinisches Personal verschenkt wurden, damit diese in die Gegend ziehen und sie wieder herrichten würden. Als professioneller VideoTuber kam ich für solcherlei Regierungshilfen nicht infrage, aber die 1000 Kröten für diesen kleinen Rohdiamanten hatten mich nicht weit zurückgeworfen, und so ergriff ich die Gelegenheit in der Hoffnung, dass schon die Werbeeinnahmen meiner künftigen Videos ausreichen würden, um meine Anfangsinvestition wieder reinzuholen.
Ich widmete mich erneut der Kamera, löste sie vom Stativ und nahm die Fassade unter die Lupe. »Wird ’ne frische Außenverkleidung brauchen. Wahrscheinlich auch ein neues Dach, wie ihr sehen könnt. Innen sieht’s schlimm aus. Davon werde ich euch in Kürze mehr zeigen. Die Fenster sind in erstaunlich gutem Zustand, was großartig ist! Und seht euch die freie Fläche an! Neben dem Haus befinden sich zwei leere Grundstücke, auf denen einmal Häuser gestanden haben. Niemand, der sich über Lärm beschweren wird, wenn ich mich an die Arbeit mache. Was will man mehr?«
Ich schwenkte entlang der Grundstücksgrenze, fokussierte auf den ersten Stock, filmte den Vordereingang, die Veranda.
Und den Baum.
Den scheußlichen Baum.
Das Grundstück rühmte sich einer einzigen Zierpflanze, einer kleinen gedrungenen Chinesischen Wildbirne, die mit weißen Blüten bedeckt war, die nach etwas wie altem Urin oder totem Fisch rochen. Aus der Entfernung sah der Baum ganz hübsch aus, aber sich ihm zu nähern oder, in diesem Fall, in seiner Windrichtung zu stehen bedeutete, ihn hassen zu lernen. Am stärksten war der Gestank im Vorgarten, von wo aus er gelegentlich von der Brise ins Haus getragen wurde, wo er sich mit dem Aroma allgemeinen Verfalls vermengte und zu etwas wahrlich Übelkeit Erregendem wurde. Mit extremer Abneigung nahm ich mir – nicht zum ersten Mal – vor, das Ding zu fällen.
Soweit ich es einschätzen konnte, war das Haus in den letzten 15 bis 20 Jahren nur von Hausbesetzern oder feiernden Jugendlichen genutzt worden. Es mangelte nicht an Graffiti an den Wänden und an Spuren von vergangenen Partys: Weggeworfene Bierdosen und sonnengebleichte Kleidungsstücke waren überall zu finden. Dennoch schien das Haus trotz all der Abnutzung ein solides Grundgerüst zu besitzen.
Ich brachte die Kamera nach innen, um dort anzufangen. Nachdem ich die Haustür aufgestoßen hatte, schwenkte ich langsam vom Wohnzimmer zum benachbarten Esszimmer. »Wir haben hier original Hartholzböden, größtenteils intakt«, sagte ich, als ich auf den Fußboden fokussierte und mit den Stiefeln die quietschenden Dielen testete. »Viel Platz für Gäste.« Ich durchquerte das Esszimmer und schlenderte durch die Küche, wobei ich mir viel Zeit ließ, um deren verschiedene Makel aufzunehmen.
Die Küche war mit abblätterndem, weißem Linoleumbelag ausgestattet, dessen kleine orangefarbene Sternchen auch schon 1975 kitschig gewesen sein mussten. Die Hänge- und Einbauschränke bestanden aus gutem Holz, waren aber so stark beschädigt – manche waren zu Boden gestürzt –, dass sie kaum der Mühe wert schienen, gerettet zu werden. Das verbeulte Waschbecken befand sich noch an seinem Platz, aber wegen der maroden Befestigung wackelte es beim geringsten Anlass. Ein uralter Ofen und ein türloser Kühlschrank standen in zwei Nischen gegenüber dem Becken; links von den Schränken bot das einzige Küchenfenster einen Blick auf den Vorgarten und den Baum, den ich so verabscheute.
Ich bog um die Ecke, ging zurück ins Wohnzimmer und näherte mich der staubbedeckten Treppe mit ihrem dicken, handgeschnitzten Geländer. Mit seinen eingeschnitzten Initialen von unzähligen Partygängern entsprach es nicht ganz meinem Geschmack, sah aber aus, als wöge es mehr als 90 Kilogramm, und es war wohl einfacher zu restaurieren als auszutauschen. Nach ein wenig Abschleifen und Beizen würde es wieder prima aussehen.
Obwohl es seit Jahren unbewohnt war, wirkten die wichtigsten Bestandteile des Hauses beeindruckend solide. Die Treppen waren keine Ausnahme, und so stieg ich in den ersten Stock, wo ich ein paar Aufnahmen der drei Zimmer und des Bads machte und dabei wiederholt den Bund meiner rutschenden Jeans hochzog. Innen war es kühler, wenn auch nur, weil ich etwas Schutz vor der Sonne hatte, und als ich ging, ließ ich einige Fenster zum Lüften geöffnet.
Aus jedem der Räume überblickte man den Vorgarten, und nur das Fenster im größten Schlafzimmer wies einen sichtbaren Schaden auf: einen Haarriss quer durch die Mitte. Der Wandschrank in diesem Raum war fast groß genug, um als viertes Zimmer zu dienen; eine Handvoll verdrehter Drahtbügel waren an der heruntergesackten Kleiderstange zurückgelassen worden, die einst an den Innenseiten befestigt war. Und es gab noch etwas. Die Schlösser von zwei der Zimmer schienen unnötig kompliziert. Das Schlafzimmer hatte eine Tür, auf deren Außenseite ein Schloss angebracht war. Ein weiteres Zimmer – das, welches am nächsten zum Treppenabsatz gelegen war – besaß einen kräftigen Haken an der Innenseite der Tür, an dem vermutlich ein Vorhängeschloss befestigt war, um die Tür verschlossen zu halten. Seltsam; aber diese unattraktiven Inventarstücke konnte man ohne großen Aufwand entfernen.
Das Badezimmer war in erbärmlichem Zustand und würde mehr Arbeit machen als der ganze Rest der Bude. Zunächst einmal war die Dusche im Gegensatz zum Rest des Hauses eine armselige Konstruktion, die dabei war, in ihre Einzelteile zu zerfallen. Ein einziger gut gezielter Stoß gegen die sich wölbenden Kacheln in der Duschkabine wäre genug gewesen, um sie endgültig zerbröckeln zu lassen. Die Toilette war gesprungen und unbrauchbar; das Waschbecken war zwar benutzbar, aber fleckig und hässlich. Die Böden bestanden aus den gleichen schmutzigen Kacheln wie die Wände der Dusche und würden – man ahnt es schon – ersetzt werden müssen.
Als ich ein weiteres Mal durch die Räume lief und mir einen Überblick über all die anstehende Arbeit verschaffte, begann mir der Kopf zu schwirren. Das Haus war ein Schnäppchen gewesen, so viel stimmte, aber als Ausgleich für die unerhörte Ersparnis würde ich beträchtlich in harte Arbeit investieren müssen. Allmählich fühlte ich mich ein wenig überwältigt.
Mein VideoTube-Kanal war im letzten Jahr richtig durchgestartet und hatte mehr als zwei Millionen Abonnenten, Tendenz steigend. Dadurch lag ich unweit der Spitzenplätze in der Heimwerker-Kategorie, und die Anzeigeneinnahmen jedes meiner Videos waren mehr als genug, damit ich weitermachen konnte. Noch wichtiger: Der Erfolg meiner Videos hatte die Aufmerksamkeit gewisser hochrangiger Personen beim Heimwerkersender erregt, die vages Interesse signalisiert hatten, mir eine eigene Show im Kabelfernsehen zu ermöglichen. Sie dachten, ich wäre sympathisch genug und auch begabt genug dafür, und vorausgesetzt dass das Ansteigen meiner Abonnentenzahl und Popularität auf der digitalen Plattform anhalten würde, hatte ich eine gute Perspektive, in Zukunft zum Fernsehstar zu werden – und so in den Genuss all des Reichtums und der anderen Vorteile zu kommen, die mit solch einer Bekanntheit einhergehen.
Das war der Grund, weshalb ich das alles tat.
Daher würde ich, egal was käme, dieses Haus innerhalb eines Monats in Ordnung bringen. Ohne überflüssiges Gequassel. Dieses Haus von einem Haufen Scheiße in Gold zu verwandeln war ein Riesenaufhänger, der mir wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit einbringen würde als jedes meiner bisherigen Videoprojekte. Falls es irgendetwas gab, das Fernsehproduzenten dazu bringen konnte, an meine Tür zu klopfen, dann war es ein verwegenes Unterfangen wie dieses hier.
Mit gelegentlichen Blicken in die Kamera machte ich kleine Scherze über den Zustand des Hauses und der Räume. Witze zu machen und stets motiviert und bei der Sache zu erscheinen ist essenziell, um in dieser Branche Erfolg zu haben. Die Leute sehen sich meine Videos nicht nur an, um etwas übers Heimwerken zu erfahren – sie wollen unterhalten werden. Manchmal fühlt man sich dann, als wenn man nach jemandes Pfeife tanzt, wenn man ständig mehr Content raushaut, für mehr Klicks, mehr Abos, mehr Anzeigeneinkünfte. Wenn die größte Sorge die Vermarktungsfähigkeit des eigenen Contents wird, bringt das oft eine Qualitätsabnahme der Videos selbst mit sich, und es wird zu verführerisch, einfach eine Schwemme von seelenlosem Quatsch zu veröffentlichen. Manche meiner besonders lieblos produzierten Videos rangieren unter den höchstbewerteten hinsichtlich Klicks und Einnahmen.
Ich hatte zum Beispiel mal ein Video darüber gemacht, wie man Toilettenverstopfungen entfernt. Da würde man bei sich so denken, das ist ’ne doofe Idee für ein Video, und man läge damit halbwegs richtig, aber mein verständlicher und fröhlicher Vortrag, gepaart mit meiner cleveren Videobearbeitung, bescherte ihm über zehn Millionen Views. Glauben Sie mir etwa nicht? Suchen Sie auf VideoTube nach »FlipperKevin Top Ten Toiletten-Hacks« und sehen Sie selbst. Machen Sie schon, ich warte derweil. Die Kommentare dazu waren so überspitzt dankbar, dass man meinen konnte, ich hätte den Krebs besiegt. Die Anzeigeneinnahmen für dieses eine Video haben seitdem meinen Van abbezahlt.
Nachdem ich für den Anfang genug Material aufgenommen hatte, kam ich eilig zum Schluss. »So sieht’s aus, Leute. Da steht mir Arbeit bevor, nicht wahr? Bleibt dran! Morgen fange ich mit der Arbeit hier an, und ihr könnt euch auf tägliche Videos von mir freuen, während des gesamten kommenden Monats. Ich kann’s nicht erwarten, dieses Haus wieder einsatzbereit zu machen!«
Ich schaltete die Kamera ab und holte tief Luft.
Das Lächeln schwand, der Werkzeuggürtel fiel zu Boden.
Ich wünschte mir, der Kühlschrank würde noch funktionieren und wäre randvoll mit kaltem Bier.
Aber leider …
Es war Zeit, mein Zeug hineinzutragen. Das hintere Abteil meines Vans war randvoll gepackt mit Werkzeugen und Materialien. Auch hatte ich ein paar Sachen mitgebracht, die mir den Aufenthalt etwas angenehmer gestalten sollten. Der Gedanke war, dass ich Zeit und Geld sparen würde, indem ich einfach im Wohnzimmer auf einer Luftmatratze pennen würde, falls das Innere des Hauses kein kompletter Albtraum wäre. Also hatte ich ein paar heimelige Annehmlichkeiten eingepackt, etwa einen Klapptisch für meinen Laptop, eine tragbare Campingdusche und einen Plattenkocher. Sollte sich das Haus als zu unbequem zum Übernachten erweisen, gab es nur einen Katzensprung entfernt zahlreiche billige Motels.
Ich schleppte eine Reihe Sägen in die Küche, stapelte Boxen mit Nägeln und Schrauben auf dem bedauernswert aussehenden Linoleum und machte in Wohnzimmer und Küche einen recht gründlichen Durchgang mit meinem Industriestaubsauger. Sodann bereitete ich mich auf die Herkulesaufgabe vor, meine tragbare Werkbank aus dem Lieferwagen zu heben. Aber als ich dabei war, einen guten Standort in der Küche zu suchen, schweifte mein Blick zum Fenster und ich erschrak.
Der Wildbirnbaum, dessen widerwärtiger Gestank mir vom Luftzug in die Nase geweht wurde, lag direkt in meinem Blickfeld – doch für einen Moment hatte ich gedacht, etwas gesehen zu haben, das sich inmitten seines Bauschs aus weißen Blüten bewegte.
Einen Menschen.
Als ich mich dem Fenster näherte und aufmerksam den Baum anstarrte, sah ich, dass ich mich geirrt hatte. Aber in diesem kurzen Augenblick hätte ich schwören können, dass ich nahe seinem knotigen Stamm einen blassen Arm gesehen hatte und daneben, halb von seinen Zweigen verdeckt, einen schlanken Körper.
Ich rieb mir die Augen und schaute noch mal. Es war niemand dort.
Natürlich nicht. Meines war das einzige bewohnte Haus des gesamten Straßenzugs.
Eine Zeit lang taxierte ich den Baum aus den Augenwinkeln, hauptsächlich als Ausrede zum Atemholen und um die wenig beneidenswerte Aufgabe, meine schwersten Ausrüstungsgegenstände ins Haus zu schleppen, aufzuschieben, und rätselte, was für eine Lichtspiegelung für die Illusion verantwortlich gewesen war.
Ich lehnte mich an die Scheibe, wobei die Spitze meiner langen Nase sie fast berührte, und beobachtete den Baum. »Ich hab das Gefühl, du und ich werden uns nicht gut verstehen, oder?«
Die übel riechenden weißen Blüten schaukelten im Wind.
3
Als ich alles hineinverfrachtet hatte, war der Nachmittag vorüber.
Bevor das Wohnzimmer auch nur annähernd bewohnbar war, brauchte es einen heftigen Wischmopp-Einsatz, um den Staub, der sich tief zwischen und auf den Dielen festgebacken hatte, loszuwerden, und dann noch einmal eine gute Stunde, um die Spinnweben samt ihren achtbeinigen Bewohnern mit dem Schlauch meines Industriesaugers zu entfernen. Derweil ließ ich das Fenster offen, um zu lüften.
Ich hatte dem Stromversorger schon im Vorfeld Bescheid gegeben, sodass ich Elektrizität im Haus hatte. Oder so was in der Art. Nur eine Handvoll der Steckdosen funktionierte tatsächlich. Ich würde wohl in den Wänden herumstochern und mit den Kabeln spielen müssen, um alles zum Laufen zu bringen. Ich war besorgt, dass mir nicht genügend funktionierende Steckdosen zur Verfügung stehen würden, um meine Elektrowerkzeuge anwerfen zu können. Wenn es hart auf hart käme, würde ich einen tragbaren, benzinbetriebenen Generator kaufen müssen – so einen hatte ich mir ohnehin schon seit einer Weile zulegen wollen –, um das Problem zu lösen. Aber angesichts des Anhäufens der Renovierungskosten wollte ich die Ausgabe wenn möglich vermeiden und hoffte, dass die alte Verkabelung im Haus meinen Ansprüchen genügen würde.
Das Wasser war auch angestellt, aber das hatte ich eher aus Neugier als aus Notwendigkeit veranlasst. Die Rohre waren alt, und als schließlich Wasser stotternd aus den Hähnen lief, war es verfärbt und roch nach Fäulnis. Trinken war also nicht drin, wenn ich nicht vorhatte, eine ordentliche Dosis Blei zu schlucken. Trotzdem war es ein positives Zeichen, dass das Wasser durch alle Rohre kam. Das einzige Problem war, dass sie wie wild rumpelten, als sie wieder benutzt wurden, aber das war nicht schwer in den Griff zu kriegen. Ich ließ Wasser ins Küchenwaschbecken laufen und sah zu, wie es träge im Abfluss verschwand, während es allmählich die rostige Färbung verlor und beinahe klar wurde. Zum Glück gab es keine Lecks oder größeren Rückläufe.
Aufrecht an einer der Wohnzimmerwände stand ein weißer Klapptisch, gut eineinhalb Meter lang, auf dem vor vielen Jahren Leute ihre Namen mit wischfesten Stiften hinterlassen oder mit Zigarettenkippen eingebrannt hatten. Auf diesen stellte ich meinen Laptop, den Drucker und die Beutel mit der Kameraausrüstung, die ich mitgebracht hatte. Er würde mir als eine Art Kommandozentrum dienen, als Videoschnittplatz, als mein Büro für all die Arbeit, die es an der digitalen Front zu verrichten galt. Ein metallener Klappstuhl vervollständigte das Ensemble. Die Luftmatratze blies ich an der dem Tisch gegenüberliegenden Wand auf. Dann machte ich mich daran, die Schlösser an der vorderen und hinteren Eingangstür gegen massivere Schließtechnik auszutauschen, bevor ich mein Magenknurren beachtete und eine schnelle Mahlzeit zubereitete.
Vor dem Essen stellte ich die Kamera zwischen Wohn- und Esszimmer auf, um das Ritual meiner Nahrungsaufnahme zu filmen. Theatralisch riss ich ein Streichholz an, entzündete den Brenner meines Campingkochers und schüttete eine Dose Rindergulasch zum Aufwärmen in einen Topf, während ich einen Monolog über die Vorzüge des »einfachen Lebens« hielt.
Die Leute mögen so was – die spezifischen Kleinigkeiten; das, was zwischen den Renovierungsarbeiten passiert. Es lässt einen menschlicher wirken, sympathischer. Authentisch.
Während ich darauf wartete, dass der Eintopf Blasen bildete, machte ich einen Ausflug ins Obergeschoss, nahm die Maße der Türstöcke und Wandschränke, und dabei bemerkte ich erstmals eine komische Eigenheit. Als ich die ersten Male vorbeigekommen war, war es mir noch entgangen, aber jetzt, als das Tageslicht schwächer wurde und die Schatten sich versammelten, fiel es mir auf wie ein bunter Hund. Ich konnte mir nicht erklären, wieso, aber irgendeine Eigenschaft des Korridors im Obergeschoss sorgte für außergewöhnlich lange Schatten. Am Treppenabsatz stehend, mit nur einer Ahnung von Licht im Rücken, streckte sich mein Schatten ungewöhnlich in die Länge. Es war ein seltsamer Effekt.
Als ich zu meinem Eintopf zurückkehrte, wobei ich aufmerksam meinen Schatten im Auge behielt, bemerkte ich, dass der Effekt auch anderswo anhielt – im Esszimmer, im Wohnzimmer, in der Küche. Selbst die Schatten lebloser Dinge schienen unnatürlich lang zu sein. Die Sonne stand tiefer am Horizont, und ich versuchte, das Phänomen darauf zurückzuführen, aber trotzdem verblüffte mich dessen Ausmaß.
In meinem Kopf versuchte ich, das in eine Art Vorzug umzumünzen – eher eine coole Anomalie als ein merkwürdiger Makel. Also, sagte ich mir, wenn die Schatten in dieser Bude so weit reichen, kann niemand einbrechen und mir auflauern, ohne dass ich ihn sehen würde, lange bevor er mir nahe kommen könnte!
Doch irgendwie konnte mich das nicht beruhigen, und in der Folge war mein Denken erfüllt von Vorstellungen brutaler Hauseinbrüche.
Ich setzte mich hin, um zu essen, und fühlte mich zum ersten Mal – aber sicher nicht zum letzten – deutlich schutzlos in dem stillen alten Haus.
In Wirklichkeit gab es für mich kaum etwas zu befürchten. Es handelte sich um ein leer stehendes Wohnviertel und kaum jemand fuhr draußen die Straße entlang. Darüber hinaus war ich nicht gerade hilflos. Um es mit den Worten meiner Zuschauer zu sagen – insbesondere der weiblichen –, war ich ziemlich attraktiv und erfolgreich. Mit meinen soliden 1,83 Metern, den schwieligen Handwerkerhänden und einem ordentlichen bisschen hart erarbeiteter Muskeln sah ich älter aus als 25. Mir stand ein Haus voller Werkzeuge zur Verfügung, die meisten davon scharf, und im Fall einer Auseinandersetzung hätte ich keine Hemmungen, mich mit einem Zimmermannshammer zu verteidigen wie ein Psycho in einem Horrorstreifen. Die Fenster waren sicher, mit altmodischen, aber stabilen Verriegelungen, und die Schlösser, die ich am selben Nachmittag an Vorder- und Hintertür angebracht hatte, waren stark genug, um einer Menge Übergriffen standzuhalten.
Ich war in Sicherheit und wusste es auch.
Dennoch, als ich auf meinen Schatten hinunterstarrte, der sich fast bis ins nächste Zimmer erstreckte, rührten sich Zweifel.
Dabei hätte daran nichts Unheimliches sein sollen. Ich meine, es war mein eigener Schatten, Himmelherrgott noch mal! Ich bewegte mich, er bewegte sich. Ich schüttelte den Kopf, er schüttelte den Kopf. Beinahe hätte ich meinen Eintopf fallen lassen wie ein Trottel, weil ich zu beschäftigt damit war, auf den Boden zu glotzen, und mein Schatten tat dasselbe.
Ich verbrannte mir den Mund an einem Löffel voll Gulasch, und alle Gedanken an Schatten huschten davon.
Als ich das Mahl beendet hatte, wischte ich den Topf kurz sauber. Mein Hunger war gestillt, aber während ich ziellos durch das Erdgeschoss tingelte, mit dem Verdauen beschäftigt, klammerte sich mein Gehirn an eine vage Beklommenheit, und ich beschloss, dass es das Beste wäre, das Haus zu verlassen. Nur für kurze Zeit. Die frische Luft – ohne den Gestank dieses Baums im Vorgarten – würde mich wieder auf Vordermann bringen. Klar, es gab tonnenweise Arbeit zu erledigen und ich musste immer noch ein Video fertigstellen, aber vielleicht konnte ich noch Besorgungen in der Stadt machen, bevor es dunkel wurde …
Ich suchte nach einer unwiderstehlichen Ausrede, um die Arbeit zu verschieben und dem Haus zu entkommen.
Mir kam der Gedanke, dass ich draußen Beleuchtung mit Bewegungsmeldern anbringen könnte, da ich nun schon mal paranoid war hinsichtlich der Möglichkeit von Einbrüchen. So würde ich bei Anwesenheit von Eindringlingen alarmiert werden, lange bevor sich jemand der Tür genähert hätte. Also machte ich mich bereit, in Richtung Stadt aufzubrechen, um diese sinnvolle – nein, unerlässliche – Anschaffung zu tätigen. Nachdem ich mir selbst die Erlaubnis zum Abhauen gegeben hatte, ließ ich mein Unbehagen an der Haustür zurück, sprang in den Van und steuerte den nächstgelegenen Baumarkt an. Bevor ich in die anbrechende Dämmerung loseilte, schnappte ich mir sicherheitshalber noch meine Kamera.
4
Durch das Beifahrerfenster zoomte ich das Schild heran.
Darauf stand in großen schwarzen Buchstaben GEBR. ROOKER WERKZEUGE, und eine schlecht gezeichnete Figur – ein rosafarbenes Strichmännchen, das tatsächlich einen Schutzhelm aufhatte – lehnte sich tollpatschig an das hintere E von WERKZEUGE.
»Ist das nicht drollig?«, fragte ich und linste grinsend in die Kamera. Der Laden war offensichtlich ein lokales Unternehmen, und verglichen mit den Baumärkten, die ich gewöhnlich in anderen Städten aufsuchte, sah sein Inneres deprimierend aus. Die großen Glasfenster in der Nähe des Eingangs verliehen ihm das Aussehen eines Gewächshauses. Die besagten Fenster waren mit Kondenswasser beschlagen, während eine zweifelsfrei heruntergekommene Klimaanlage im Inneren des Ladens gegen die Hitzewelle des Frühlings ankämpfte. Auf dem Parkplatz standen zwei weitere Fahrzeuge, eines davon über zwei Stellplätze, und ich vermutete, dass sie Angestellten gehören mussten, denn von dort, wo ich mich befand, sah es nicht so aus, als wäre auch nur ein einziger Kunde zwischen den Regalreihen unterwegs. Die Innenbeleuchtung war ein abstoßendes, senfartiges Gelb, und von Hand beschriftete Schilder aus sonnengebleichtem Pappkarton in Neonfarben klammerten sich verzweifelt an das Fenster neben der Tür. Die Tinte auf manchen von ihnen begann davonzulaufen, als das Kondenswasser seine verheerende Arbeit tat.
Ich schaltete die Kamera aus, hängte sie mir aber um den Hals, als ich den Wagen verließ. Vielleicht war einer der Angestellten bereit zu einem kleinen Interview oder ließ mich zumindest im Inneren des Ladens filmen. Aufnahmen davon, wie ich Material auswählte oder mit kenntnisreichen Angestellten fachsimpelte, waren großartiges Füllmaterial für meine Videos, und mein bestes Argument war, dass es auch für die beteiligten Läden eine gute Werbung abgab.
Als ich mich der Tür näherte, wurde ich von einem kleinen handgeschriebenen Aufkleber unter dem RAUCHEN VERBOTEN-Schild überrumpelt, auf dem KEINE FOTOS stand.
Mist.
Mehr als etwas verlegen wegen der um meinen Hals baumelnden Kamera schlüpfte ich in das Geschäft und näherte mich direkt der Kasse, wo ein Typ mittleren Alters mit einer grünen Schürze dabei war, die Ladentheke mit einem Reinigungstuch zu bearbeiten. Ein anderer Typ, allenfalls im College-Alter, stapelte geschäftig Dosen mit Sprühfarbe für die Auslage. Beide sahen zu mir auf, als ich eintrat, und beide spendeten mir dasselbe gelassene Nicken. Aber es war der Ältere, der Kassierer, der seinen Blick auf mich gerichtet hielt, als ich näher kam, und etwas wegen der Kamera sagte.
»Keine Fotos«, sagte der Mann, warf das Tuch in einen Mülleimer und wischte sich die Hände an seiner Schürze ab. Er war schlaksig, mit dünner werdenden rotblonden Haaren und einem dichten, gepflegten Schnauzbart, der den Mangel an Haupthaar ausgleichen sollte. Er sah mir geradewegs in die Augen und blickte dann mit solchem Verdruss auf die Kamera um meinen Hals, als hätte ich eine Sprengstoffweste an.
Ich antwortete nicht sofort, und als ich es tat, begann ich tatsächlich herumzustottern wie ein Volltrottel. Irgendwie hatte der Typ etwas an sich, das mich aus dem Konzept brachte. »J-ja, Entschuldigung. Ich, äh … Ich werd sie nicht benutzen. Hab nur vergessen, sie abzunehmen.«
Der Typ, auf dessen Namensschild »Chip« zu lesen stand, sah fast wie mein Vater aus. Chip kratzte sich am Ohr und verzog seine Lippen zu etwas, das einem Lächeln ähnelte. »Wenn Sie sie benutzen, schmeiß ich Sie raus. Steht da an der Tür«, sagte er und deutete in Richtung des Aufklebers, den ich gerade erst entdeckt hatte.
Für einen Moment war ich wie in Trance angesichts der wundersamen Ähnlichkeit zwischen diesem Kerl und meinem Vater.
Meinem toten Vater.
Chips Haarfarbe war anders. Die meines Vaters war ein Dunkelbraun gewesen, wie meine. Und sein Schnurrbart hatte mehr die Form einer Lenkstange gehabt. Aber ansonsten hätte der Kassierer ein Zwillingsbruder meines Vaters sein können. Selbst sein Benehmen und sein Tonfall waren auf gespenstische Weise ähnlich.
Er glotzte mich an, als wäre ich blöde, und ich weiß, dass ich sicher diesen Anschein erweckte. Nach meiner peinlichen Pause entlockte ich mir ein gezwungenes Lachen und blickte mich verwirrt im Laden um. »Ich suche nur nach, ähm … Beleuchtung.«
Er legte die Stirn in Furchen und wartete mit geschürzten Lippen, dass ich weiterredete. Genau wie es mein Vater mit jemandem getan hätte, von dem er das Gefühl hatte, er würde seine Zeit vergeuden.
»Bewegungsaktivierte Strahler. Also, für draußen«, erklärte ich.
Er nickte, trat hinter der Theke hervor und führte mich aus dem Kassenbereich zwischen den Regalwänden mit Farben und Werkzeugen entlang, bevor er schließlich in einer Abteilung stehen blieb, die mit Lampenfassungen und Leuchtkörpern vollgestopft war. »Hab ein paar davon hier«, sagte er und deutete auf ein paar Kisten im unteren Regal.
»Danke.« Meine Stimme war jedoch zurückhaltend; meine Aufmerksamkeit galt eher ihm als den Waren. Ich konnte nicht aufhören, ihn anzustarren. Wahrscheinlich dachte er, ich wollte ihn anmachen oder so was, so intensiv, wie ich ihn betrachtete. Die Ähnlichkeit hatte mir ein wenig Angst eingejagt.
Er schaute noch mal auf die Kamera, mit einem Lächeln, das kleine schiefe Zähne enthüllte.
Von jetzt auf gleich war die Illusion zerstört. Seine Zähne sahen überhaupt nicht aus wie die meines Vaters, und beinahe wäre mir ein Seufzer der Erleichterung entwichen. Mir war, als könnte ich mich wieder auf meine Umgebung konzentrieren, als er fragte: »Wofür ist die Kamera eigentlich?«
»Oh.« Ich zog am Haltegurt. »Tatsächlich drehe ich Videos für meinen VideoTube-Kanal. Sehen Sie, ich renoviere Häuser und mache Videos über die Details davon. Ich hab ein Haus in der Stadt gekauft und versucht, Filmmaterial zusammenzubekommen. Ich hatte gehofft, jemanden hier im Laden interviewen zu können oder meinen Einkauf zu dokumentieren.«
»Keine Aufnahmen«, sagte Chip wie eine Aufziehpuppe. Dann, nachdem er mich erneut von oben bis unten gemustert hatte, grinste er ungläubig. »Also … Auf welchem Kanal sind Sie denn? Hab Sie noch nie im Fernsehen gesehen.«
Ich lachte. »Nein, ich bin nicht im Fernsehen. Zumindest noch nicht. Diese Videos sind online. Auf VideoTube. Aber ich hab ’ne Menge Abonnenten. Ich bin nicht superberühmt oder so, aber ich bin schon ein paarmal von Zuschauern auf der Straße erkannt worden …«
Chip blieb unbeeindruckt. Ein einzelnes »Hm«, und er machte sich auf den Rückweg zur Kasse.
Mir selbst überlassen seufzte ich und begutachtete die Waren in den Regalen bei dem Versuch, mich zu erinnern, weshalb ich hergekommen war.
Bewegungsgesteuerte Beleuchtung, Doofi.
Unter einem Stapel Kartons mit Stehlampen fand ich den Vorrat der Gebrüder Rooker an bewegungsgesteuerten Außenlampen, und zu sagen, dass ich davon nicht beeindruckt war, wäre eine Untertreibung. Es gab eine Box mit ausgefransten Kanten, die ein Paar solarbetriebener Gartenstrahler enthielt. Auf der Seite stand der Verkaufsslogan zu lesen: Verschönern Sie Ihren Garten mit unserer Premium-LED-Landschaftsbeleuchtung!
Ich schüttelte den Karton und hörte lose Glasteile klirren.
Diesem würde ich eine gnadenlose Abfuhr erteilen müssen.
Besser für meine Bedürfnisse geeignet war ein zweites Produkt. Dieses befand sich daneben, in einem staubbedeckten, würfelförmigen Karton. Ich musste mich auf einem Knie abstützen, um ihn aus dem Regal zu befreien. Darin befand sich ein bewegungsgesteuertes LED-Flutlicht. Eine Stichpunktliste der Vorzüge, allesamt mit Bezug zur Haussicherheit, war auf dem Deckel abgedruckt. Das Ding entsprach den Anforderungen, aber als ich es vorsichtig schüttelte, bemerkte ich das handgeschriebene Preisschild darauf und hätte es aus Protest beinahe wieder zurückgestellt. Es war locker 30 oder 40 Mäuse teurer als ein vergleichbares Gerät von einem größeren Baumarkt, und es sah noch dazu so aus, als hätte es seit der Zeit der großen Wirtschaftskrise im Regal gestanden.
Ich stellte ein paar Kopfrechnungen an, überlegte, wo der nächstgelegene Großhandel war, und zog sogar in Betracht, mit dem guten alten Chip über den Preis zu feilschen. Letztendlich riss ich mich zusammen und beschloss, das Ding zu kaufen, weil ich es hasste, mehr als einen Laden abzuklappern.
Und um die Wahrheit zu sagen, wollte ich auch noch etwas mehr mit dem Doppelgänger meines Vaters reden.
Den staubigen Karton auf Armeslänge von mir weghaltend kehrte ich in den vorderen Bereich des Geschäfts zurück und war ein zweites Mal baff wegen der Ähnlichkeit mit meinem verstorbenen Vater. Dort vor diesem Typen zu stehen war surreal. Es fühlte sich an, als wäre ich rund zwei Jahre in die Vergangenheit gereist. Sogar die Umgebung – ein schmuddeliger Heimwerkerladen – passte perfekt. Das war genau die Art Geschäft, wo mein Vater eingekauft hätte, und wir beide hatten in den Jahren vor seinem Tod eine Menge Zeit damit verbracht, solche Läden ausfindig zu machen.
»Das macht dann 59,22«, sagte Chip und blickte erwartungsvoll in meine glasigen Augen.
Ich reichte ihm ein paar Zwanziger – einen zu wenig, wie sich herausstellte. Ich opferte einen weiteren und wartete auf mein Wechselgeld. Er ließ das Geld in die Schublade fallen und riss die Quittung aus dem Ausgabeschlitz. Dann stupste er den Karton mit einem kleinen Grunzen in meine Richtung, als wollte er sagen »Raus mit dir«. Ich machte Anstalten zu gehen, aber als ich es tat, setzte er plötzlich wieder dieses Grinsen von zuvor auf und fragte: »Sie sagen, Sie haben ein Haus hier in der Gegend gekauft – wo genau?«
»Es ist ein Haus in der Morgan Road. Kennen Sie die?«
Das Grinsen verblasste, als würde er denken, dass ich ihn veräppeln wollte. »Klar kenn ich die. Warum sollte man da draußen ein Haus kaufen?«
Obwohl ich wusste, dass dies ein völlig Fremder war, fühlte es sich dennoch an, als würde ich Schelte von meinem Dad einkassieren, und dementsprechend erklärte ich mich Chip, um Rechtfertigung für mein Handeln heischend. »A-also wissen Sie, es war spottbillig. Und es hat eine gute Bausubstanz – sehr solide. Ich mag Herausforderungen, und dieses Haus hat, was ich brauche. Hoffentlich hab ich’s innerhalb eines Monats fertig.«
Chip warf einen Blick zu dem anderen Angestellten – der Bursche war gerade beim Sortieren verschiedener Luftreiniger, die er auf der Theke ausgebreitet hatte – und zuckte mit den Schultern. »Na ja, wünsch Ihnen’s Beste.«
Ich nahm den Karton unter den Arm, ging aber noch nicht gleich. »Die meisten Häuser die Straße runter sind verlassen«, sagte ich. »Auf der Morgan Road, meine ich. Warum ist das so? Seit wann sind das alles Leerstände? Kennen Sie die Gegend gut?« Ich war ehrlich an seiner Antwort interessiert, aber gleichzeitig wollte ich das Gespräch mit diesem väterlichen Double noch nicht beenden. Er kratzte sich am Schnurrbart. »O ja. Gab ’nen Haufen Crack-Buden und Meth-Labore da unten. Zumindest vor langer Zeit. War lange nich’ mehr in dem Teil der Stadt; dachte, alle Häuser in dem Streifen wären inzwischen zerfallen. Kann mich erinnern, dass die Häuser dort bewohnt war’n, als ich ’n kleiner Junge war. War ’ne gute Gegend damals, aber ich werd alt.« Er kicherte. »Bin überrascht, dass Sie eins gefunden haben, das es wert ist, wieder aufgemöbelt zu werden. Aber selbst dann, Fremder, sag ich Ihnen ganz ehrlich: Ich kapier nich’, wozu Sie sich die Mühe machen. Ich mein’, ein Haus in so ’ner miesen Gegend … Irgendwer wird’s einfach wieder runterramschen. Warum überhaupt Zeit verschwenden für so ’n Schrottteil?«
Ich hätte mir die Zeit nehmen können, ihm die Dynamik meines Berufs zu erklären – dass ich Häuser renovierte, um Aufmerksamkeit, Werbeeinnahmen und womöglich das Engagement durch das Fernsehen zu bekommen –, aber ich erwiderte nur mit einem schwachen Schulterzucken: »Vielleicht haben Sie recht.« Die Wahrheit war ja, dass mir das Haus kein Jota bedeutete. Wenn die Renovierung glattging und mir die Art von Erfolg und Popularität einbringen würde, nach der ich auf der Suche war, war’s mir ziemlich egal, was mit dem Haus geschehen würde, wenn ich damit fertig war. Vielleicht würde ich es zum Verkauf anbieten oder vermieten. Was immer ich mit dem Endergebnis anfangen würde, ich würde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass es dann nicht mehr mein Problem war.
Chip nickte. »Danke, dass Sie regional einkaufen«, brachte er hervor.
Ich erwiderte sein Nicken, musste mich aber zurückhalten, beim Verlassen des Geschäfts »Bis bald, Dad« zu murmeln.
5
Die Zufallsbegegnung mit dem Doppelgänger meines Vaters im Heimwerkerladen hatte mich durcheinandergebracht. Ich war so abgelenkt von dieser kleinen Begegnung, dass ich beim Heimkommen …
Nein, wenn ich darüber nachdenke, ist »heimkommen« nicht das richtige Wort. Wenn ich jetzt so zurückdenke, glaube ich nicht, dass ich das Haus in der Morgan Road jemals wirklich als mein »Heim« betrachtet habe. Der Name im Grundbuch war meiner, und ich würde im Haus übernachten und es in Ordnung bringen, aber selbst während der ersten Nacht wünschte ich, unsere Bekanntschaft wäre damit zu Ende. Von Anfang an hatte ich eine Art unbewussten Eid geschworen, auf Abstand zu bleiben und mich nicht allzu bequem darin einzuleben.
Jedenfalls war ich noch so in Gedanken an meinen Vater, dass mir die Abgelegenheit des Hauses und seine Neigung, extralange Schatten zu werfen, nicht annähernd in den Sinn kamen, als ich in die ramponierte Auffahrt einbog. Ich trottete hinein, mit meiner Neuerwerbung in der Hand, und machte mich umgehend daran, die Werkzeuge zusammenzusuchen, die ich brauchen würde, um sie zu installieren.
Das Bewegungslicht sollte dorthin, wo sich jetzt noch die alte Verandalampe befand. Die vorhandene Fassung war gesprungen und verschmutzt, und ich musste erst drei rostige Schrauben lösen, bevor ich an die dahinterliegenden Kabel gelangte.
Ich hielt eine kleine Taschenlampe zwischen den Zähnen, sodass ich sehen konnte, was ich tat. Die Kabel meines neuen LED-Strahlers mit denen im Lichtkasten zu verbinden war ein Leichtes, und nachdem ich ihn so befestigt hatte, dass er zur Außenfassade gerichtet war, trat ich zurück und wedelte mit den Armen.
Das Licht sprang flackernd an und ließ mich für ein paar Sekunden vollständig erblinden.
Was, wie ich annehme, genau das war, was ich erreichen wollte.
Auf der Rückseite gab es ein paar Schalter für verschiedene Funktionen – und zwar für die Helligkeit und die Dauer der Beleuchtung, wenn sie eingeschaltet wurde. Ich stellte maximale Helligkeit ein und entschied mich für eine Minute. So hätte ich, falls irgendetwas den Bewegungsmelder aktivieren würde, eine Minute Zeit, um die Umgebung abzusuchen, bevor sich die Lampe wieder abschaltete. Der Karton behauptete, dass die Lampe Bewegungen aus einer Entfernung von bis zu zehn Metern erfassen könne, was bis zum Straßenrand reichen würde. Ich hatte das Gefühl, einen guten Kauf getätigt zu haben, während ich die letzten Sternchen in meinem Sichtfeld wegblinzelte.
Ich ging ins Haus, schloss die Tür ab und bereitete mich auf ein wenig Videoschnitt vor. So müde, wie ich war, gefiel mir die Vorstellung, ins Bett zu gehen, zwar besser, aber wenn ich diese Herausforderung richtig angehen wollte, dann musste ich etwas Content hochladen und den Hype ins Rollen bringen.
Ich ließ mich auf meinen Stuhl fallen, beugte mich über den Laptop und legte sofort los. Nachdem ich die Aufnahmen des Tages von der SD-Karte in iMovie übertragen hatte, ging ich sie durch, beschämt von der Schmalzigkeit meiner Monologe. Ich kürzte die Fehlstarts und die Stotterer weg, und mit der Zeit ergab sich ein einigermaßen passables Video. Es begann mit meiner peppigen Vorstellung im Vorgarten und verschiedenen Einstellungen der Fassade, unterlegt mit eingängiger lizenzfreier Musik. Danach kam meine Tour durch die Innenräume mit der Vorstellung dessen, was an Arbeit vor mir lag. Ganz an den Anfang setzte ich das Intro, das ich bei all meinen Videos verwendete, und wartete anschließend darauf, dass iMovie das Endresultat exportierte.
Alles in allem benötigte ich fast eine Stunde, um das Material des Tages durchzusehen und die brauchbaren Teile auszuwählen und diese zu einem fünfminütigen Video zusammenzustellen. Als ich damals angefangen hatte und keine Erfahrung mit der Software besaß, hatte ich manchmal zwei oder sogar drei Stunden benötigt, um etwas halbwegs Brauchbares herzustellen. Inzwischen war es ein relativ schneller und zwangloser Vorgang, solange die Klang- und Bildqualität meiner Aufnahmen solide war. Das Einzige, woran ich mich nie gewöhnen konnte, war aber, mich selbst auf dem Bildschirm zu sehen.
Mir gefiel der Klang meiner Stimme nicht, und ich konnte nicht anders, als meine eigenen Witze und Späße vor der Kamera schrecklich zu finden. Mein Publikum genoss das alles ausnahmslos, aber mir meine aufgesetzte Fröhlichkeit anzusehen war mir unangenehm, und ich war jedes Mal froh, wenn die Aufgabe erledigt war. Ich sah mir meine Videos nie an, nachdem sie auf VideoTube gelandet waren – ich ertrug es nicht.
Während ich darauf wartete, dass iMovie mir das Endvideo ausspuckte, checkte ich meine E-Mails. Wie erwartet, quoll mein Postfach über. Da war der übliche Müll – Spam, Nachrichten von verschiedenen Onlinehändlern, die mich über »unglaubliche« neue Angebote informierten – zusammen mit ein paar Dutzend Nachrichten von Zuschauern. Hin und wieder schrieben mir welche, um mir mitzuteilen, dass ihnen meine Videos gefielen oder dass es ihnen dank meiner Anleitungen gelungen war, irgendein Langzeitproblem in ihren Häusern in den Griff zu kriegen. Solche Kommentare schätzte ich sehr, obwohl ich selten auf sie antwortete. Daneben gab es eine zweite Sorte Fanpost – häufiger, als mir lieb war, und die ich aus Prinzip nie beantwortete – mit Bitten um Hilfe. Lieber FlipperKevin, wie ersetze ich meine Schiebetür? Oder: Lieber FlipperKevin, ich bin ein großer Fan. Ich frage mich, ob du mir sagen kannst, welche Marke du bei Nagelpistolen am besten findest. Ich stehe gerade im Baumarkt und wär dir sehr dankbar, wenn du schnell antworten könntest! Oder manchmal: FlipperKevin, ich wäre gern ein erfolgreicher VideoTuber wie du. Ich habe gerade Kameraausrüstung für ein paar Tausend Dollar gekauft und hab mich gefragt, ob du vielleicht bei ein paar Videos mit mir zusammenarbeiten könntest. Melde dich, wenn du mal in der Nähe bist …
Es hätte schmeichelhaft sein sollen, so viele Nachrichten von völlig Fremden zu bekommen, und zu Anfang meines Erfolgs war es das auch noch gewesen. In letzter Zeit aber hatte sich das abgenutzt. Es ging mir gegen den Strich, dass mich Leute einfach so anschrieben und sich verhielten, als wäre ich ihre persönliche Informationsquelle. Es erinnerte mich daran, wie mein Vater, Zimmermann mit jahrzehntelanger Erfahrung, ständig von allen möglichen Leuten aus dem Ort mit Fragen überhäuft worden war …
Zum zweiten Mal an diesem Abend rauschten Gedanken an meinen Vater wie eine Welle durch mich hindurch. Bitterkeit schlich sich ein. Auch Zorn und Melancholie.
»Löschen. Löschen. Löschen«, murmelte ich vor mich hin, als ich den ganzen Müll aus meinem Postfach entfernte. So viele E-Mails zu löschen und das Postfach sich allmählich leeren zu sehen hatte etwas Kathartisches an sich. Darauf konzentrierte ich mich lieber als auf Erinnerungen an meinen Dad und sein Double in dem Geschäft.
Es wurde spät. Morgen würde die echte Arbeit beginnen. Ich brauchte Erholung, wenn ich morgen einen Haken auf meine kilometerlange Liste von Aufgaben setzen wollte. Es gab so viel zu tun, und der Versuch, eine Entscheidung zu treffen, wo und wann die Arbeit zu beginnen hatte, war ein wenig überwältigend. Während ich versuchte, mir einen Aktionsplan für den kommenden Tag einfallen zu lassen, erwischte ich mich bei dem Gedanken, dass Dad immer vorgeschlagen hatte, kurz vor Morgengrauen aufzustehen. Er wollte gern früh am Tag loslegen. Und riss mich immer morgens um fünf aus dem Bett …
Ich hielt inne und massierte mir verärgert die Schläfen. Der alte Mann war aufdringlich heute Nacht; sosehr ich mich auch anstrengte, ich bekam ihn nicht aus dem Kopf.
Ich versuchte, mich auf angenehmere Gedanken zu bringen, trug den Laptop rüber zum Bett und machte es mir bequem. Endlich bekam ich die Meldung von iMovie, dass mein Video fertig konvertiert war, und ich öffnete sofort meinen VideoTube-Account, um es hochzuladen – für den Konsum durch die Massen. Mit dem mittelmäßigen Signal meines Handyzugangs benötigte das Video seine Zeit, um auf die Seite geladen zu werden. Nach dem Upload bekam ich die Info, dass es etwa zehn Minuten dauern werde, bis es verarbeitet und abrufbar sei.
Ich weiß nicht mehr, was ich tat, während ich auf die Premiere des Videos wartete. Ich weiß, dass ich mein Postfach fertig geleert habe, und ich erinnere mich, mir das Kissen unters Kinn geschoben zu haben. Doch bevor ich es bemerkte, war ich vor dem Computer weggedöst.
Und als ich etwa eine Stunde später wieder erwachte, bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte.
6
Das Esszimmerfenster stand offen.
Es war die durch dieses Fenster hereinkriechende Kälte gewesen, die mich geweckt hatte – eine Kälte, die nicht zu dem warmen Frühlingsabend passen wollte, der sich mir nur eine Stunde früher noch gezeigt hatte. Zwar war die Kälte für meinen Körper ein grober Schock gewesen, doch mein Hirn hatte gänzlich andere Sorgen, als ich verschlafen das offene Fenster beäugte.
Und dann nicht mehr so verschlafen.
Ich war sicher – einigermaßen sicher –, dass ich es nicht offen gelassen hatte. Früher am Tag, bevor ich zu dem Geschäft gefahren war, hatte ich alle Fenster zugemacht und verschlossen. Es war möglich, dass ich dieses hier vergessen hatte, das Esszimmerfenster unweit der Eingangstür, aber das erschien mir unwahrscheinlich. Ich stellte den Rechner beiseite, stemmte mich auf der Luftmatratze hoch und reckte den Hals in Richtung Nebenzimmer. Das Bewegungslicht auf der Veranda war nicht an, und für einen Moment tröstete mich diese Tatsache.
Das Licht bleibt nur eine Minute an, weißt du noch? Das ist mehr als genug Zeit, damit jemand hereinschleichen kann …
Mein Gehirn hatte einen echten Lauf in dieser Nacht; es klammerte sich vornehmlich an schlechte Erinnerungen und Worst-Case-Szenarien.
Ich nahm meine unmittelbare Umgebung in den Blick und schielte in die Küche. Leer.
Dann durchquerte ich den Raum auf Zehenspitzen, auf das offene Fenster zu. Durch das Haus schleichen zu wollen erwies sich als zwecklos; die knarzenden Bodendielen kündigten mich an, ehe ich an der Eingangstür vorbei war.
Ich sah mich zwischen den gestapelten Kisten im Esszimmer um und fand nichts Ungewöhnliches. Nur dieses Fenster und ein frischer Windzug, der Staub aufwirbelte. Ich stieß das Fenster zu und verschloss es so fest, dass der Mechanismus knarzte, aber die Kälte blieb bestehen. So sehr, dass ich in Betracht zog, eins meiner Sweatshirts aus den Kisten zu kramen.
Als ich hinausschaute, war ich gebannt von der Dunkelheit. Außer einer trüben Andeutung von Mondlicht, das irgendwo in den Wolken verloren ging, gab es keinerlei Licht, um etwas sehen zu können. Die Szenerie verschmolz zu einem einzigen Trauerflor.
Ich war so weit, es gut sein zu lassen und wieder ins Bett zu tapsen, um mich dem Winterschlaf hinzugeben, aber mein Blick war aus irgendeinem Grund am Fenster festgenietet. Gespannt starrte ich durch das Glas, aber die Nacht war dunkel und still wie das Innere eines Tintenfasses. Die Scheibe. Auf der Außenseite, kaum sichtbar im schwachen Licht, das vom Esszimmer kam, konnte ich etwas erkennen.
Einen Handabdruck.
Mein erster Gedanke war ein hoffnungsvoller – dass ich ihn selbst dort hinterlassen hatte; dass ich das Fenster zuvor angefasst hatte, ohne es zu bemerken.
Ein schneller Vergleich des Abdrucks mit meiner eigenen Hand überzeugte mich vom Gegenteil. Er war kleiner als sie.
Vielleicht war er schon seit geraumer Zeit da, sagte ich mir. Das Haus stand schließlich schon seit Jahren leer. Aber war er denn auch früher am Tag schon dort gewesen? War er mir aufgefallen, als ich die Fenster geöffnet und geschlossen hatte? Ich glaube, nein. Ein derart winziges Detail wäre meiner Aufmerksamkeit wahrscheinlich entgangen. Außerdem war ich beschäftigt gewesen, ein wenig erschöpft. Der einzige Grund, warum ich mich darauf jetzt so fixierte, war, dass das Fenster offen gelassen worden war und ich mich nicht erinnern konnte, es geöffnet zu haben.