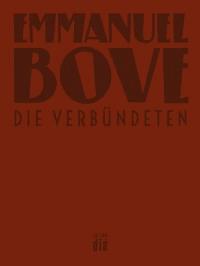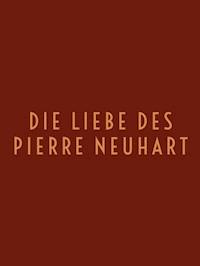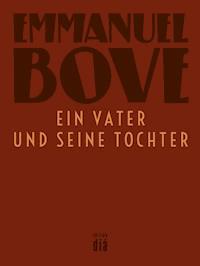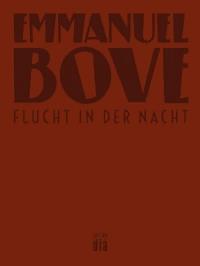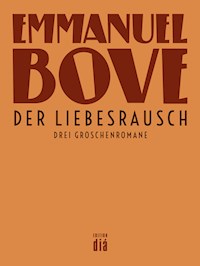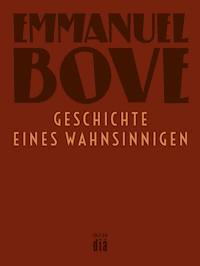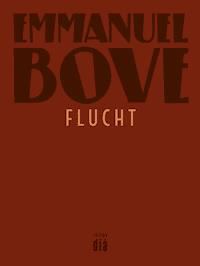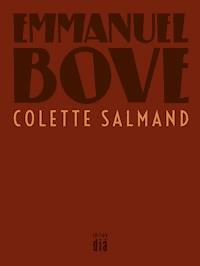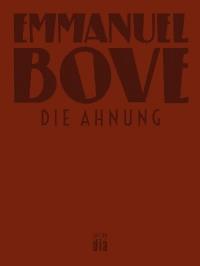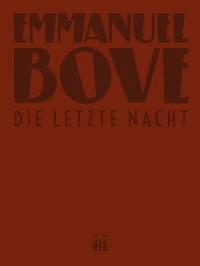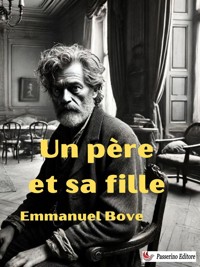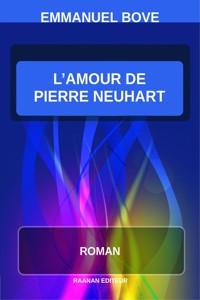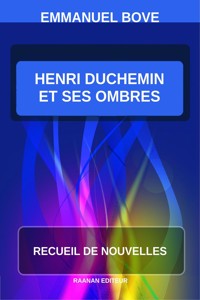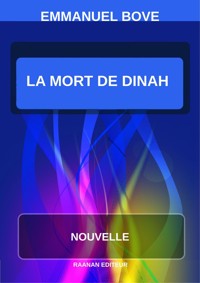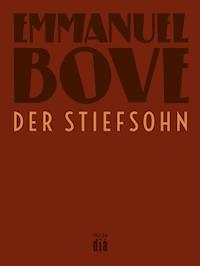
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werkausgabe Emmanuel Bove
- Sprache: Deutsch
In dem Roman "Der Stiefsohn" wird Schritt um Schritt das Innere eines Einzelgängers nach außen gekehrt, es ist der wohl autobiographischste des Autors, eine Art Selbstentblößung. Jean-Noël, schon der Klang dieses Vornamens erinnert an Emmanuel, Jean-Noël Œtlinger ist der Stiefsohn, von dem man nach und nach – wie von einem verborgenen Beobachter beschrieben – immer mehr erfährt. Im Zwiespalt zwischen pathologischer Idealisierung der Stiefmutter und befremdlicher Distanz zur leiblichen Mutter, bis hin zur Verleugnung, zeigt sich der Held des Romans, der dem Leser über eine entscheidende Lebensspanne von fast dreißig Jahren begegnet, als bindungssüchtig und zugleich bindungsunfähig. Ständig bemüht, mehr zu scheinen als zu sein, ständig bemüht, einer Welt zugeordnet zu sein, zu der er eigentlich nicht gehört, ständig begierig, den moralischen und geistigen Anforderungen der Stiefmutter Annie zu genügen, entfaltet sich der entscheidende Lebensabschnitt eines Mannes. der um seiner Eigenliebe, seiner Gefallsucht willen fast alles an menschlicher Bindung opfert, der eine hohe Kunst der Selbstverleugnung zelebriert. Immer tiefer wird man in den ganz eigenen Kosmos Bove'scher Unentrinnbarkeit gezogen, immer gebannter folgt man dem unsteten Leben zwischen großbürgerlichem Wohnambiente am Boulevard du Montparnasse und spießiger Vorstadtwelt, zwischen Pariser Hotelzimmern und Hinterhofambiente. Eindringlich entfalten sich Charaktere, offenbaren sich Seelenlandschaften. Der Schlüsselroman eines großen europäischen Schriftstellers. Zum Weiterlesen: "Emmanuel Bove. Eine Biographie" von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton ISBN 9783860347096
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
In dem Roman »Der Stiefsohn« wird Schritt um Schritt das Innere eines Einzelgängers nach außen gekehrt, es ist der wohl autobiographischste des Autors, eine Art Selbstentblößung. Jean-Noël, schon der Klang dieses Vornamens erinnert an Emmanuel, Jean-Noël Œtlinger ist der Stiefsohn, von dem man nach und nach – wie von einem verborgenen Beobachter beschrieben – immer mehr erfährt. Im Zwiespalt zwischen pathologischer Idealisierung der Stiefmutter und befremdlicher Distanz zur leiblichen Mutter, bis hin zur Verleugnung, zeigt sich der Held des Romans, der dem Leser über eine entscheidende Lebensspanne von fast dreißig Jahren begegnet, als bindungssüchtig und zugleich bindungsunfähig. Ständig bemüht, mehr zu scheinen als zu sein, ständig bemüht, einer Welt zugeordnet zu sein, zu der er eigentlich nicht gehört, ständig begierig, den moralischen und geistigen Anforderungen der Stiefmutter Annie zu genügen, entfaltet sich der entscheidende Lebensabschnitt eines Mannes, der um seiner Eigenliebe, seiner Gefallsucht willen fast alles an menschlicher Bindung opfert, der eine hohe Kunst der Selbstverleugnung zelebriert. Immer tiefer wird man in den ganz eigenen Kosmos Bove’scher Unentrinnbarkeit gezogen, immer gebannter folgt man dem unsteten Leben zwischen großbürgerlichem Wohnambiente am Boulevard du Montparnasse und spießiger Vorstadtwelt, zwischen Pariser Hotelzimmern und Hinterhofambiente. Eindringlich entfalten sich Charaktere, offenbaren sich Seelenlandschaften. Der Schlüsselroman eines großen europäischen Schriftstellers.
»Bove spinnt ein kompliziertes Netz aus Abhängigkeiten und beobachtet aus großer Distanz, wie seine Figuren sich immer tiefer ins Lächerliche verstricken.« (Eva Simon in Spiegel Special 4/2002)
Mehr zum Autor und seinem Werk unter www.emmanuelbove.de
Der Autor
1898 als Sohn eines russischen Lebemanns und eines Luxemburger Dienstmädchens in Paris geboren, schlug sich Emmanuel Bove mit verschiedenen Arbeiten durch, bevor er als Journalist und Schriftsteller sein Auskommen fand. Mit seinem Erstling »Meine Freunde« hatte er einen überwältigenden Erfolg, dem innerhalb von zwei Jahrzehnten 23 Romane und über 30 Erzählungen folgten.
Nach seinem Tod 1945 gerieten der Autor und sein gewaltiges Œuvre in Vergessenheit, bis er in den siebziger Jahren in Frankreich und in den achtziger Jahren durch Peter Handke für den deutschsprachigen Raum wiederentdeckt wurde. Heute gilt Emmanuel Bove als Klassiker der Moderne.
Die Übersetzerin
Gabriela Zehnder, geboren 1955, ist freiberufliche literarische Übersetzerin aus dem Französischen und Italienischen und lebt in der italienischen Schweiz. Sie übersetzte Autoren wie Ignacio Ramonet, Jean-Luc Benoziglio, Muriel Barbery, René Laporte, Adrien Pasquali, Etienne Barilier, Giuliana Pelli Grandini, Corinna Bille u. a.
Der Stiefsohn
Roman
Aus dem Französischenvon Gabriela Zehnder
Edition diá
1
Es war lange vor dem Krieg, 1904, um genau zu sein, als Mademoiselle Annie Villemur de Falais die Bekanntschaft von Jean-Melchior Œtlinger machte. Sie war einundzwanzig Jahre alt. Seit mehreren Monaten besuchte sie einen gemischten Malkurs, nicht etwa bei Julian oder an der École des Beaux-Arts, sondern an einer Kunstakademie in der Rue de la Grande-Chaumière, worauf sie stolz war, da diese Wahl nur auf eine echte Berufung hinweisen konnte. Sie teilte die Bewunderung der anderen Schüler für die präraffaelitischen Maler. Ihre Brüder, ihre Freunde, sogar ihr Vater kamen manchmal, um von der Tür aus einer Sitzung beizuwohnen, ein wenig verlegen, wenn das Modell ein nackter Mann war, was sie aber nicht zu sagen wagten aus Angst, für prüde gehalten zu werden. Annie war ein großes, blondes junges Mädchen, das mit seiner Schönheit nichts anzufangen wusste, so wie man in bestimmten Berufen mit seiner Jugend nichts anzufangen weiß. Nach langem Drängen hatte sie die Erlaubnis erhalten, ein Atelier im oberen Teil der Rue d’Assas zu mieten. Jede Woche gab sie dort kleine Gesellschaften. Zu den Arbeitskameraden, meist arme Ausländer, gesellte sich immer auch ein Mitglied der Familie Villemur, das darüber wachte, dass alles korrekt vor sich ging. Zu einer dieser Teegesellschaften brachte der Kassenwart der Akademie, für den Mademoiselle Villemur Sympathie empfand, weil er wie alle Kassenwarte unter den verdienstvollsten Schülern ausgesucht worden war und weil sie von ihrer Erziehung her die Gewohnheit bewahrte, Mitgefühl zu zeigen, einen seiner Freunde mit, einen düsteren Mann um die dreißig, der einen Spitzbart trug und ziemlich förmlich mit einem Cutaway bekleidet war. Es war der Sohn eines für seine frankophilen Gefühle bekannten Professors aus Mülhausen. Beim Tod dieses Professors im September 1895 hatten Jean-Melchior Œtlinger, der im Februar des gleichen Jahres volljährig geworden war, sein älterer Bruder Martin und seine jüngere Schwester Catherine das väterliche Haus verkauft und waren nach Paris gezogen, die jungen Männer mit dem Wunsch, ihr Studium fortzusetzen, das Mädchen mit dem, die Aufgabe ihrer Brüder zu erleichtern, indem es ihnen alle häuslichen Sorgen ersparte. Sie hatten in der Rue Pierre Nicole eine Zweizimmerwohnung mit Küche gemietet. Am Anfang lebten sie in schönster Eintracht zusammen. Das Mädchen ging nicht aus dem Haus. Die beiden Brüder trennten sich nur, um an ihren Vorlesungen teilzunehmen. Verspürte einer der beiden einmal Lust, ein Museum zu besuchen, teilte er es seinem Bruder mit, der sich mit Catherine besprach. Wenn alle einverstanden waren, aber nicht vorher, gönnten sie sich schließlich diese Abwechslung. Da ihr ganzes Vermögen in einer bescheidenen Erbschaft bestand, mit der sie bis zum Abschluss ihres Studiums auskommen mussten, rückten sie unwillkürlich zusammen, aus Sparsamkeit und auch, um die Versuchungen fernzuhalten, von denen sie im Laufe ihrer Jugend gehört hatten. Doch bald ließ sich Jean-Melchior zu kleinen Heimlichkeiten hinreißen. Allmählich wurde er kühner. Die Gefahren, vor denen man ihn gewarnt hatte, erschienen ihm nicht so groß. Von zarter Gesundheit und trägem Wesen, war er für keine beständige Arbeit geschaffen. Müßiggang und Bummeln sagten ihm mehr zu als das geregelte Leben in der Rue Pierre Nicole. Als er sich vier Monate später in Ernestine Mercier verliebte, die von ihrem siebzehnten bis einunddreißigsten Lebensjahr bald bei diesem, bald bei jenem Liebhaber gelebt hatte, immer in der Hoffnung, der gegenwärtige sei der letzte, zögerte er lange, es zu gestehen. Erst als er nicht mehr anders konnte, öffnete er sein Herz. Martin geriet in helle Wut. Jean-Melchior wusste noch nicht, dass man es uns übelnimmt, wenn wir uns aus einem Bund zurückziehen, und mögen wir dadurch auch die begünstigen, die ihm treu bleiben. Er wurde aufgefordert zu wählen. Einen ganzen Monat lang konnte er sich nicht entscheiden. Ab fünf Uhr nachmittags hatte er Fieber. Er liebte seinen Bruder und seine Schwester mehr als alles auf der Welt, mehr, viel mehr als Ernestine Mercier, aber Ernestine, das bedeutete das Vergnügen, tausend Dinge, die er bei den Seinen nicht hatte. Als er begriff, dass er einen Entschluss fassen musste, dass er ihn nicht länger hinauszögern konnte, packte er endlich seinen Koffer, umarmte Catherine lange, bat Martin, ihm zu verzeihen. Der ließ die Gefühle beiseite und kam auf die Geldfrage zu sprechen. Man vereinbarte, dass Martin ihm aushändigen würde, was ihm nach Abzug seines Mietanteils zustand. Danach ging Jean-Melchior zu Ernestine Mercier. Sie war nicht auf einen solchen Liebesbeweis gefasst gewesen. Daher wagte sie in den ersten Tagen nicht, Jean-Melchior zu fragen, in welche Lage ihn diese Geste brachte. Sie war bemüht, sich des Gefühls, das sie erweckte, würdig zu erweisen. Als sie jedoch erfuhr, dass Jean-Melchior ein wenig Geld hatte, dass er beabsichtigte, bescheiden zu leben, damit er in der Lage sei, sein Studium zu beenden, verspottete sie ihn. Sie überzeugte ihn, dass man nur einmal jung sei, dass man nicht wisse, wie der nächste Morgen aussah, dass man das Leben genießen müsse, solange man kann. Sie wohnten in einem komfortablen Hotel, nahmen ihre Mahlzeiten nicht mehr in kleinen, billigen Lokalen ein, sondern in Großgaststatten, wo sie, von lärmenden Freunden umgeben, bis drei Uhr morgens blieben. Ernestine strebte zwar danach, eine geachtete Bürgersfrau zu werden, jedoch später, wenn sie einem Mann begegnen würde, den sie wirklich liebte. Seiner Mätresse und vor allem des Fiebers wegen, das er bei der geringsten Anstrengung bekam, hatte Jean-Melchior sein Studium fast ganz aufgegeben. Er stand spät auf, verkehrte mit Ernestines Freunden, mit denen er keine Gemeinsamkeiten hatte. Was seine Zukunft betraf, so war er außerstande, sich ein Bild davon zu machen. Er lebte in den Tag hinein, wobei er Ernestine dauernd mit seiner Eifersucht und seiner Zärtlichkeit verfolgte, sich bei der geringsten Unstimmigkeit in ein Schweigen hüllte, das mehrere Tage dauerte und das er unvermittelt brach, verbittert, aber noch immer verliebt. Nach Jahresfrist blieb ihm fast nichts mehr vom Erbteil, das Martin ihm ausgehändigt hatte. Er musste daran denken, sparsamer zu leben, umso mehr, als seine Ausschweifungen sich auf seine Gesundheit auszuwirken begannen. Sie mieteten eine kleine Wohnung, richteten sie bescheiden ein. »Wir sind beglückt worden«, sagte Ernestine an einem drückenden Augustabend des Jahres 1897 zu ihm. Er verstand nicht, was sie meinte. Sie wollte es nicht näher erklären, aber in der Nacht, in dem Bett, das sie ihre »Domäne« nannte und das sie zu ihrem geheimen Verbündeten gemacht hatte, der in ihren Augen genauso fassbar war wie ein Lebewesen, teilte sie Jean-Melchior mit unerträglicher Geziertheit mit, er werde Vater.
In der Folge gab es keinen Tag, an dem sie ihn nicht auf die Pflichten hingewiesen hätte, die ihm zufallen würden. Ihre Zahl wuchs ins Unendliche, ohne dass deswegen die wichtigste verdrängt worden wäre, die Verpflichtung nämlich, sie zu heiraten. Aber wenn Jean-Melchior nichts mehr an einer Heirat lag, war es ihre eigene Schuld. Er hatte ihr einen Antrag gemacht, nicht etwa, weil ihm der Sinn danach stand, denn als er von seinem Bruder und seiner Schwester fortgegangen war, hatte er an alles andere gedacht als daran, eine Familie zu gründen, sondern weil er aufgrund seiner Erziehung Skrupel hatte und sich die Liebe außerhalb der Ehe nur schwerlich vorstellen konnte. Als sie ihn von diesen Skrupeln befreit hatte, was ihm nur recht gewesen war, hatte Ernestine nicht vorausgesehen, dass die Argumente, die sie vorgebracht hatte, einmal gegen sie verwendet würden. Jean-Melchior konnte nicht glauben, dass dieselbe Frau, die seine flehentlichen Bitten mit Spott aufgenommen hatte, und das zu einer Zeit, als er im Besitz seiner Erbschaft war und es ganz in ihrem Interesse gelegen hätte, ihn zu heiraten, jetzt, da er nichts mehr hatte und sich auf der Suche nach Deutschstunden die Füße wund lief, ernsthaft eine Heirat wünschte. Er antwortete ihr daher auch jedes Mal zerstreut, denn es war Ernestine selbst gewesen, die ihn überzeugt hatte, die Heiratsfrage sei belanglos.
Ende April 1898 kam ein Kind zur Welt, dem man den Vornamen Jean-Noël gab. Da sich die Lage des Haushalts noch verschlechtert hatte, bat Jean-Melchior Martin um Hilfe. Als der erfuhr, dass sein Bruder alles, was er besessen, aufgebraucht hatte, dass er überdies mit einer Frau zusammenlebte, die ihm eben einen Sohn geboren hatte, ersuchte er ihn, nicht mehr in die Rue Pierre Nicole zu kommen. Von dem Tag an häuften sich die Sorgen. Außer seiner Familie, für die er noch immer die gleichen Gefühle hegte und deren Härte ihn mehr betrübte als empörte, kannte er nur Studenten, die voll jener der Jugend eigenen Hochherzigkeit waren, jedoch unfähig, ihm zu helfen oder ihn zu lenken. Trotz Ernestines Drängen, trotz der Hindernisse, die mit jedem Tag schwieriger zu überwinden waren, wollte er nichts von einer festen Anstellung wissen, denn er hatte erkannt, dass er nur eine Chance hatte, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, wenn er sein Studium beendete. Ab und zu gab er eine Unterrichtsstunde oder nahm irgendeine Stelle an, die er zwei Monate später wieder aufgab. Unter diesen Lebensbedingungen war Ernestine die Lust vergangen, Jean-Melchiors Frau zu werden. Die mit der Ehe verbundene Vorstellung von Glück hätte unter derartigen Umständen ein betrübliches Ereignis aus einer Heirat gemacht. So vergingen mehrere Jahre in Armut und Bitterkeit. Das Verhältnis zwischen Jean-Melchior und seiner Gefährtin wurde immer gespannter. Sie warf ihm vor, er habe ihr ein Kind gemacht, obwohl er genau wusste, dass er nicht die Mittel habe, es aufzuziehen. Wenn sie so unglücklich sei, dann deshalb, weil sie die Naivität selbst sei und an all seine Versprechungen geglaubt habe. Ständig drohte sie ihm, ihn zu verlassen, und wenn er sie in seiner Niedergeschlagenheit nicht anflehte, es nicht zu tun, fing sie zu schluchzen an und sagte, er liebe sie nicht, er setze alles daran, sie loszuwerden.
Jean-Noël war schon sieben Jahre alt, als Jean-Melchior Mademoiselle de Villemur de Falais vorgestellt wurde. Die Welt, die er um das junge Mädchen herum erahnte, die unbekümmerte Atmosphäre, die im Atelier herrschte, hatten eine außerordentliche Wirkung auf ihn. Er sah Annie wieder. Eines Tages, als er mit ihr allein war, erzählte er ihr sein Leben. Der Bericht erschütterte sie. Sie hatte für den kränklichen Mann, dessen Offenheit sie überraschte, von Anfang an Sympathie empfunden. Obwohl sie ihn kaum kannte, flößte er ihr keinerlei Misstrauen, keinerlei Angst ein. Er verkörperte in ihren Augen alles, was für sie fremd war, und dass sie sich in seiner Gegenwart trotzdem so geborgen fühlte, erfüllte sie mit Stolz.
Als Annie ihrer Familie sechs Monate später mitteilte, sie wolle einen jungen Mann heiraten, den sie an der Kunstakademie kennengelernt habe, was nicht ganz der Wahrheit entsprach, stieß sie auf unerbittlichen Widerstand. Ihr Vater zwang sie, ihren Kurs, ihr Atelier aufzugeben. Er verbot ihr, ausnahmslos alle Freunde, die sie außerhalb ihrer Familie gewonnen hatte, wiederzusehen. Unzählige Schwierigkeiten tauchten auf. Sie liebte Jean-Melchior. Er war in ihren Augen ein außergewöhnlicher Mann, sogar den Künstlern überlegen, die sie bewunderte. Hatte er ihr nicht gesagt, als sie ihm vom Zorn ihres Vaters berichtet hatte, ein junges Mädchen müsse in erster Linie den Willen seiner Familie respektieren, und nur, weil er dies nicht getan habe, sei er selbst so unglücklich gewesen? Sie traf sich trotzdem weiterhin mit ihm, ohne dass ihre Eltern es wussten. Als sie davon erfuhren, konnten sie es nicht glauben. War Annie nicht die Aufrichtigkeit in Person? Sie hatte ihnen nie irgendetwas verheimlicht. Es kam zu einer heftigen Szene bei den Villemurs in der Avenue de Malakoff. Man wollte wissen, ob Annie wirklich die Absicht habe, einen unbedeutenden, kranken Elsässer ohne Vermögen zu heiraten, der schon Vater eines Kindes war. Sie antwortete, sie liebe Jean-Melchior genau aus diesen Gründen. Monsieur Villemur begriff, dass seine Tochter nicht nachgeben würde. Einen Moment lang erschien auf seinem Gesicht der Ausdruck eines Mannes, der gegen sich selbst kämpft. Er bat Annie, ihm zu folgen. Er ging in sein Arbeitszimmer. Er war sehr ruhig. Dennoch strich er sich öfter als gewöhnlich mit den Fingerspitzen, die eine perfekte Linie bildeten, über die Augenbrauen.
»Du willst heiraten«, sagte er bedächtig, »das ist dein Recht. Aber ich bitte dich, mir den Mann vorzustellen, den du dir ausgesucht hast.«
»Das wollte ich mehrere Male tun. Aber du hast immer abgelehnt.«
»Heute habe ich meine Meinung geändert.«
Die Begegnung fand statt. Als Monsieur Villemur Jean-Melchior erblickte, wurde ihm sofort klar, dass die Hoffnung, an die er sich geklammert hatte, trügerisch war. Wie hatte er glauben können, dieser Monsieur Œtlinger sei anders, als er ihn sich vorgestellt hatte? Er entsprach ganz dem Bild der farblosen Gestalt mit dem kränklichen Aussehen und den Künstlerallüren, das er sich aufgrund von Annies Erzählungen von ihm gemacht hatte. Als er mit seiner Tochter allein war, hielt er es nicht einmal für nötig, ihr mitzuteilen, welchen Eindruck er von Jean-Melchior hatte. Er begnügte sich damit, ihr zu sagen, sie sei frei, Monsieur Œtlinger zu heiraten, er werde ihr, wenn sie es tue, ihre Mitgift aushändigen, sie müsse jedoch nicht mehr daran denken, ihre Familie wiederzusehen. Wenn sie dazu bereit sei, könne sie das Haus noch am gleichen Abend verlassen.
Während Annie mit ihren Eltern heftige Auseinandersetzungen führte, denn weitere Szenen dieser Art folgten, bereitete Jean-Melchior Ernestine behutsam auf eine Trennung vor. Er wünschte sie sich übrigens seit langem. Schon nach der Geburt von Jean-Noël, das heißt von dem Augenblick an, da Ernestine begann, wirklich an ihm zu hängen, hatte er daran gedacht, seine Freiheit wiederzuerlangen. Doch zuerst musste er die materielle Lage der Frau sicherstellen, die ihm, wenn man sie so hörte, die besten Jahre ihres Lebens geschenkt hatte. Es war ihm nicht möglich gewesen. Die Zeit war vergangen und hatte sie jeden Tag mehr voneinander entfernt, so dass er, als man ihn in die Rue d’Assas geführt hatte, sich zwar, ohne zu lügen, als freien Mann hatte vorstellen können, er aber trotzdem ein Gefangener seiner Liaison war, genau wie in deren Anfängen. Frei, das war er. Unter dem Vorwand, sich auf die Suche nach Geld zu begeben, das er nur selten fand, verließ er seine Mätresse schon am Morgen, um erst nach Hause zurückzukehren, wenn sie schlief. Doch diese moralische Trennung in eine faktische Trennung umzuwandeln war genauso schwierig, als hätten sie in bestem Einvernehmen gelebt, denn Ernestine gab vor, sich ihm zutiefst verbunden zu fühlen und das Kind, das sie nur malträtierte, abgöttisch zu lieben.
Am Tag nachdem Jean-Melchior Monsieur Villemur getroffen hatte, beschloss er, die Sache offen anzugehen. Er sagte Ernestine, Jean-Noël wachse heran, er sei in einem Alter, da man sich an das, was man sehe, zu erinnern beginne, man müsse sich ernsthaft um seine Erziehung kümmern, und deshalb und weil er nicht anders könne, habe er vor, eine Zweckehe einzugehen. Er besaß die Schwäche hinzuzufügen, das Leben sei nun einmal so, es zwinge uns oft, die Gefühle den Interessen zu opfern. Ernestine geriet in eine solche Wut, dass man sie pflegen musste wie ein Kind, das von Krämpfen geschüttelt wird, und als sie endlich ihre Ruhe wiedergewann, wirkte sie im Unterschied zu den vorangegangenen Schreien und Drohungen wie eine Kapitulation. Doch Ernestine hatte keineswegs resigniert. Einen Monat später teilte sie Jean-Melchior mit der gleichen Geziertheit wie beim ersten Mal mit, sie sei schwanger. Er wollte ihr nicht glauben. Er brachte sie zu einem Arzt. Sie war es tatsächlich. Mademoiselle Villemur hatte eben ihre Familie verlassen und war in ein Hotel gezogen, dessen Name sie jedes Mal belustigte, wenn sie die Place du Panthéon überquerte, das Hôtel des Grands Hommes. Aus Angst, sie erfahre es von jemand anderem, ging Jean-Melchior dorthin und berichtete ihr, was vorgefallen war, wobei er ihr zu verstehen gab, es handle sich um eine infame Lüge. Er war sich dessen nicht sicher, aber da er auch vom Gegenteil nicht überzeugt war, empörte er sich mit einer solchen Vehemenz über das verzweifelte Manöver, wie er es nannte, dass Annie ihm glaubte, obwohl sie zutiefst gedemütigt war. »Diese Frau ist zu allem fähig«, sagte sie.
Im Frühjahr 1906 heirateten Jean-Melchior und Annie. Auch wenn die Villemurs diese Heirat nicht gerne sahen, sahen die Œtlingers sie gar zu gern. Um Annies Eltern zu entfliehen, die sich trotz ihrer vorgetäuschten Gleichgültigkeit nicht geschlagen gaben, und Jean-Melchiors Bruder, der plötzlich wie verwandelt war, und Ernestine Mercier, die sich weiterhin Madame Œtlinger nannte und die jedem, der es hören wollte, von ihrer Schwangerschaft erzählte, beschlossen die Jungvermählten, sich in Nizza niederzulassen, einer Stadt, deren Klima ausgezeichnet für Jean-Melchiors Gesundheit sei und wo es leicht sein dürfte, Jean-Noël eine solide Ausbildung zu geben. Aber als der Moment kam, das Kind zu holen, tauchten neue Schwierigkeiten auf. Trotz der Zusage, die man ihr gegen eine gewisse Geldsumme abgerungen hatte, wollte sich Ernestine Mercier nicht von ihm trennen. Jean-Melchior war genötigt, zu einer richtigen Entführung zu schreiten. Es war dramatisch. Ernestine Mercier rief die Nachbarn zu Hilfe, erzählte ihnen von ihrem Zustand, von der Unmenschlichkeit des Mannes, dem sie ihr Leben geopfert hatte. Schließlich einigte man sich, und Jean-Melchior konnte seinen Sohn mitnehmen, der weinte und vor Angst zitterte.
2
Monsieur und Madame Œtlinger wohnten seit neun Jahren in Nizza, als in den ersten Februartagen des Jahres 1915 ein Telegramm bei ihnen eintraf. Ohne ein Wort des Trostes oder der Zuneigung teilte Monsieur Villemur seiner Tochter mit, sein jüngster Sohn, ebenjener, der sich nicht gegen Annies Heirat gestellt hatte, sei schwer verwundet worden. Noch am gleichen Abend reiste sie nach Paris. Monsieur Œtlinger begleitete sie an den Bahnhof. Auf dem Bahnsteig, der voll war von Soldaten auf Urlaub, von Verletzten, von Krankenschwestern, unter dem riesigen Glasdach, wo jedes Geräusch ein Echo zurückwarf, weinte Annie. Es war das erste Mal seit ihrer Heirat, dass sie sich von Jean-Melchior trennte. Dass es unter so dramatischen Umständen geschah, ließ sie an die vergangenen Jahre denken. Sie ahnte, dass diese Minute den Abschluss eines glücklichen Zeitabschnitts darstellte. Gleich wäre sie mitten in einer Welt, deren Sorgen sie entflohen war, wie sie sich einbildete, und die schon Vergeltung zu üben schien.
Eine Woche später stieg eine ganz andere Frau aus dem Zug. Sie winkte einen Träger herbei, reichte ihm selbst ihr Gepäck. Niemand hätte geglaubt, dass man ihrem Bruder vor ein paar Tagen ein Bein amputiert hatte und er noch immer zwischen Leben und Tod schwebte. »Welchen Kummer ich dir doch bereite, mein armer Jean-Melchior«, sagte sie zu ihrem Mann, der ihr entgegengekommen war. Sie spielte auf die Briefe an, die sie ihm aus Paris geschrieben hatte und in denen sie nur die Ereignisse festgehalten hatte, die sich während ihrer Reise zugetragen hatten. Sie nahmen einen offenen Wagen. Der Abend war frühlingshaft. Das Pferd ging im Schritt. In der Luft hing ein Geruch von verbranntem Holz, und es war eine Erleichterung, fernab vom Krieg und nicht mehr in Eile zu sein. Annie schien teilnahmslos. Auf die Beherrschung, die sie bei ihrer Ankunft gezeigt hatte, um ihren Mann zu beruhigen, war eine große Müdigkeit gefolgt. Sie fragte sich, ob sie sich nicht geirrt hatte, als sie Jean-Melchior heiratete, ob ihre Familie nicht trotz allem recht gehabt hatte, sich ihrer Heirat zu widersetzen. Nicht etwa, dass ihre Liebe mit den Jahren kleiner geworden wäre. Sie hatte sich nur gewandelt. Was ihr als junges Mädchen so schön erschienen war, kämpfen, fortgehen, sich absondern mit einem Mann, den man liebt – all das hatten jene Realitäten des Alltags getötet, denen sie übertriebene Wichtigkeit beimaß. Als sie wieder im Kreise ihrer Familie war, wo es, wie ihr schien, keine dieser Realitäten gab und wo sie den Eindruck gewann, eine Abtrünnige zu sein, sich dem allgemeinen Kummer entzogen zu haben, während sie doch bisher glaubte, das Gegenteil sei der Fall, sie habe mit den Ihren auch die bürgerliche Sicherheit verlassen, war ihr klargeworden, dass die Liebe sie vielleicht blind machte. Man hatte sie mit großer Herzlichkeit empfangen. Die Tatsache, dass sie allein gekommen war, dass man ihren Mann durch ihre Schuld nicht zu den Familienmitgliedern zählen konnte, hatte einen Misston in die ersten Gespräche gebracht. Dann schien sich niemand mehr zu erinnern, was vorgefallen war. An einem Nachmittag besuchte sie sogar in einem Altersheim in Neuilly ihr ehemaliges Zimmermädchen, ihre liebe Elisabeth. Weinend schilderte ihr diese, welche Traurigkeit in ihrer Familie geherrscht hatte, nachdem sie weggegangen war. Auf so viel Wohlwollen zu stoßen weckte Gewissensbisse in ihr. Sie hatte sie sogleich wieder verscheucht, da sie ihrem Mann gegenüber ungerecht waren. Eines Abends war sie beinahe eine Viertelstunde lang mit ihrem Vater zusammen gewesen, ohne dass einer von beiden ein Wort sprach. Freunde waren gekommen, um sich zu erkundigen, wie es stand. Als sie diese Pflicht erfüllt hatten, unterhielten sie sich lange mit ihr. Man wollte nicht, dass sie sofort wieder wegfuhr. Man versuchte sie zu überreden, in Paris zu bleiben. Und am meisten berührte sie, dass ihre Mutter, die doch sonst so kalt war, besorgt fragte, ob sie glücklich sei.
Auf der Rückfahrt im Zug hatte Annie an all das gedacht. Hatte sie sich verhalten, wie sie es hätte tun sollen? War sie nicht zu schnell abgereist? Hätte sie angesichts von so viel Zuneigung ihren Aufenthalt nicht verlängern sollen, nur um zu zeigen, dass sie empfänglich gewesen war für die Aufmerksamkeit, mit der man sie umgab? Bewies sie nicht Gefühllosigkeit, indem sie nach Nizza zurückkehrte, bevor sie die Resultate von Bertrands Operation kannte? Hatte sie auf so viel Güte nicht mit Kälte geantwortet, wenn sie ihre Familie an dem Tag verließ, den sie bei der Ankunft genannt hatte, um deutlich zu machen, dass sie sich nicht aufdrängte? Was trug sie ihrer Familie denn nach? Hatte diese nicht einfach nur ihre Pflicht getan? Bei genauerer Überlegung erkannte sie dann, dass sie nicht anders hätte handeln können, nicht dass es ihre Art gewesen wäre, die Vorteile abzuschätzen, die einem entstehen, wenn man eine Versöhnung hinauszögert, sondern weil sie im Laufe ihrer Existenz als verheiratete Frau trotz ihrer Klagen stolz gewesen war, den gleichen Sorgen ausgesetzt zu sein, die, wie sie als junges Mädchen glaubte, den Künstlern vorbehalten waren, und weil sie vor allem Wert darauf legte, dass man in Paris erkannte, dass ihre Heirat sie nicht etwa herabgewürdigt, sondern geläutert hatte. Die Ausnahmesituation, in der sie sich befand, Ernestine Mercier, die ihr und Jean-Melchior nachstellte, die Vorsichtsmaßnahmen, die sie ergriffen, um ihren Zufluchtsort zu verbergen, kurz, alles, was scheinbar nur ihr zustieß, hielt ihre Illusion aufrecht, ihre Lebenserfahrung sei größer als die ihres eigenen Vaters. Sie hatte also richtig gehandelt, wenn sie an dem festgesetzten Tag abgereist war. Sie hatte den Ihren damit besser als mit Worten gezeigt, dass sie weder Groll hegte noch Reue empfand, dass sie nur einfach eine Frau geworden war.
Monsieur und Madame Œtlinger sprachen nicht. Alles erschien ihnen leicht und fern. Es kam ihnen vor, als hielten die Sterne in ihrer Bahn inne. Sie funkelten auf der Höhe, wo die Wolken vorbeiziehen, jeder entsprechend seiner Größe. Annie atmete tief ein. Es blieb nichts übrig von den Leuten, die sie gesehen, nichts von den Gesprächen, die sie geführt hatte. Die Hufe des Pferdes, sein Glöckchen, so groß wie ein Apfel, klangen wie Musik für sie. Hinter jedem Fenster der Hotels brannte ein Licht. Sie waren alle gleich, jedes beleuchtete das Zimmer eines Verwundeten. Manchmal begegnete Annie dem Blick ihres Mannes, und dann lächelten sie einander zu. Die Tatsache allein, nach einer Woche der Trennung wieder vereint zu sein, hätte nicht diese Zufriedenheit ausgelöst, wenn die Trennung nicht durch ein Unglück bedingt gewesen wäre. Dieses Unglück brachte Aussicht auf Veränderung mit sich, brachte etwas, was das Paar seit Jahren undeutlich wünschte, vor allem, seit es befürchtete, eines Tages mittellos dazustehen: die Hoffnung auf eine Versöhnung mit den Villemurs. Annie hatte noch nicht von ihrem Vater und von dem Empfang gesprochen, den man ihr bereitet hatte. Jean-Melchior wagte keine Fragen zu stellen. Bald kamen sie in die Avenue Félix Faure. Die Straße war breit, von Palmen gesäumt und glänzte. Der Wagen hielt an. Annie nahm die Hand ihres Mannes. Er blickte auf. »Wir sind angekommen«, sagte sie lebhaft. Sie warf sich jetzt vor, dass sie an die glücklichen Folgen gedacht hatte, die das Unglück, das ihre Familie traf, auf ihr Leben haben könnte.
Im Mai des gleichen Jahres starb Bertrand an den Folgen seiner Verwundungen. Seit ihrer Rückkehr hatte sich zwischen Annie und ihren Eltern ein regelmäßiger Briefwechsel ergeben. Man hatte ihr nicht verheimlicht, dass Bertrands Zustand sehr ernst war, aber da alle Briefe im sichtbaren Bemühen geschrieben waren, zu gefallen, war der Zustand des Bruders zu einem Vorwand geworden, den Kontakt aufrechtzuerhalten, und es hatte allein die Art und Weise gezählt, wie sie begannen und endeten. Obwohl sie darauf hätte gefasst sein müssen, traf sie deshalb die Nachricht von Bertrands Tod so, als hätte ihr Bruder sie erst eine Stunde zuvor bei guter Gesundheit verlassen. Während sie mit den Vorbereitungen für ihre Abreise beschäftigt war, erhielt sie ein zweites Telegramm ihres Vaters, in dem er sie bat, so bald wie möglich nach Paris zu kommen. Diese Bitte ließ sie alles vergessen, was sie von den Ihren trennte. Da kam ihr die Idee, sie könnte in Begleitung ihres Mannes fahren. Als sie ihm ihren Wunsch mitteilte, stellte sie zu ihrer Überraschung fest, dass dieser Plan ihn keineswegs freute. Sie fragte ihn nach dem Grund. Nach einigem Zögern antwortete er, sie täusche sich, er freue sich im Gegenteil sehr, sie zu begleiten.
Wenn Monsieur Œtlinger einen Moment lang versucht hatte, sich dieser Reise zu entziehen, dann deshalb, weil sich zehn Tage vorher etwas ereignete, was er seiner Frau nicht hatte erzählen wollen. Bei der Kriegserklärung hatte er auf Annies Drängen hin, deren Angst vor der Zukunft noch größer geworden war, die Pension, die er Ernestine Mercier überwies, um die Hälfte gekürzt. Der November 1914 war noch nicht vorbei, als diese in Nizza auftauchte. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass sie die Reise unternahm. In den acht Jahren nach Annies und Jean-Melchiors Weggang hatte sie sie schon dreimal gemacht. Doch die Reise, die uns hier beschäftigt, war insofern besonders, als es im Gegensatz zu den vorhergehenden diesmal keine Rückfahrt gab. Da sie es für klüger hielt, wenn man in Kriegszeiten in der Nähe dessen blieb, von dem man finanziell abhängig war, ließ sie sich mit ihrem zweiten Sohn in Menton nieder. Neben der Nähe zu Nizza und zur Grenze war es eine charmante kleine Stadt, für ihr Klima bekannt, eine Tatsache, der Ernestine Mercier große Bedeutung beimaß, war doch ihre und Émiles Gesundheit genauso wertvoll wie die von Jean-Melchior. Von dem Tag an war Monsieur Œtlinger allen möglichen Schikanen ausgesetzt. Alles diente Ernestine als Vorwand, um ihm zu schreiben, ihm Vorwürfe zu machen. Darunter gab es einen, den sie nie ausließ: Monsieur Œtlinger schien Émile nicht als seinen Sohn zu betrachten. »Ich kann dir versichern«, schrieb sie in jedem ihrer Briefe, »dass er sehr wohl von dir ist.« Jean-Melchior leugnete es nicht. Es war ihm trotzdem sehr unangenehm, da Annie die Tatsache nie hatte anerkennen wollen. Doch Madame Mercier begnügte sich nicht damit zu schreiben. Mit allen Mitteln versuchte sie, dem Mann zu schaden, der sie, wie sie überall lauthals verkündete, im Stich gelassen hatte. Sie wohnte noch keine drei Monate in Menton, als sie schon zahlreiche Freunde gewonnen hatte. Sie gab sich als die echte Madame Œtlinger aus. Diejenige, die ihren Platz eingenommen hatte, war eine Abenteurerin, und wenn sie, Ernestine Mercier, sich hatte verdrängen lassen, war es aus Liebe geschehen, weil sie Mitleid hatte mit Jean-Melchior, weil sie ihm materielle Sorgen ersparen wollte. Diese Geschichten beeindruckten die kleinen Leute, mit denen sie sich umgab. Sie hielt sich nur mit größter Mühe davor zurück, nach Nizza zu gehen und sich für ihre Sache einzusetzen.
Es war wohl eine von jenen allzu ergebenen Personen gewesen, die zwei Wochen zuvor einen Brief an Monsieur Œtlinger verfasst hatte, ohne ihn jedoch zu unterschreiben, einen Brief, in dem man ihn davon in Kenntnis setzte, dass Jean-Noël, den er, ohne zu zögern, begünstigt habe, und zwar auf Kosten Émiles, seines anderen Sohnes, ein ausschweifendes Leben führe, dass man ihn nachts in berüchtigten Häusern antreffe, dass er ein Straßenmädchen zur Mätresse habe. Der Brief endete mit Vorwürfen, neben denen die, die gewöhnlich aus Ernestines Mund kamen, nichtssagend erschienen. War es nicht eine Schande, ein Kind seiner Mutter zu entführen, um ihm dann zu erlauben, jede Nacht außer Haus zu schlafen? Fragte man sich da nicht zu Recht, ob ein solcher Vater nicht eher Deutscher als Franzose sei?
Monsieur Œtlinger hatte seinen Sohn herbeigerufen. Der Knabe, den wir in den Armen seines Vaters gesehen haben, während Madame Mercier versuchte, ihn diesem zu entreißen, war jetzt ein großer, hagerer junger Mann von siebzehn Jahren. Sein Gesicht war aufgedunsen, von einer glanzlosen Haut, deren Poren sichtbar waren. Seine Zähne standen leicht vor, so dass man sie sah, selbst wenn er nicht sprach. Von seiner ganzen Person ging etwas Schlaffes, Schüchternes, Hochmütiges aus. Die Stirn war faltig wie bei einem alten Mann; die Züge, vor allem die Nase, waren grob. Dennoch lag in dem unansehnlichen Gesicht etwas wie ein Licht, das vom Blick herrührte und vermuten ließ, dass der junge Mann in manchen Momenten schön sein konnte.
Behutsam, um das Schamgefühl nicht zu verletzen, das er kannte, weil er es damals selbst empfand, als er noch in Mülhausen wohnte, hatte Monsieur Œtlinger seinen Sohn befragt. Ihm war bald klargeworden, dass der anonyme Brief die Tatsachen zwar übertrieben hatte, aber trotzdem etwas Wahres enthielt. Jean-Noël hatte schließlich gestanden, dass er manchmal, wenn die Eltern im Bett waren, die Wohnung verließ, um zu einer Frau zu gehen, deren Namen und Adresse er weinend preisgab. Jean-Melchior beruhigte seinen Sohn, gab ihm zu verstehen, nichts getan zu haben, was nicht alle jungen Männer tun, und während Jean-Noël in seiner Verwirrung weit davon entfernt war, an seine Stiefmutter zu denken, fügte er hinzu, er werde nie darüber sprechen, als rühre die Scham seines Sohnes von seiner Angst her, Annie könnte von seinem Benehmen erfahren. In Wirklichkeit war es Monsieur Œtlinger, dessen größte Angst darin bestand, Annie erführe, was vorgefallen war. Wenn sie es natürlich fand, dass sie heute noch unter Jean-Melchiors vergangenen Fehlern oder Schwächen litt, weil sie ihrer Meinung nach untrennbar mit den Umständen verbunden waren, unter denen sie geheiratet hatte, geriet sie wegen jeder neuen Sorge außer sich, ob ihr Mann nun direkt oder indirekt der Grund dafür war. Deshalb war es Monsieur Œtlinger unangenehm, dass man seinem Sohn etwas vorwerfen konnte. Aber noch unangenehmer wäre es ihm gewesen, wenn Jean-Noël seine Angst gekannt hätte. Er empfand für ihn eine abgöttische Liebe. Dass sein Sohn auch nur ahnen könnte, in welch unterlegener Position er sich Annie gegenüber befand, ließ ihn erzittern, so sehr war er bestrebt, sein Ansehen zu bewahren, das trotz seiner Anstrengungen jeden Tag geringer wurde. Seit zwei Jahren schon ging ihm Jean-Noël aus dem Weg, und wenn er es nicht konnte, wagte er ihm nicht ins Gesicht zu schauen. Er war eifersüchtig auf seinen Vater. Er hatte das Gefühl, dieser sei Annies nicht würdig, er habe ihre Liebe nur errungen, weil er ihr verborgen hatte, wer er wirklich war. Die Jahre ließen ihn nicht die Intimität vergessen, die zwischen seinem Vater und Ernestine Mercier bestanden hatte. Er erinnerte sich deutlich an die heftigen Szenen in der bescheidenen Wohnung, wo sich seine frühe Kindheit abgespielt hatte, an die Streitereien wegen Geldsummen, die sogar dem Gymnasiasten, der er heute war, unbedeutend erschienen, an die Freude, die er empfand, wenn man ihn in die Rue d’Assas und später in jenes Hotel mitgenommen hatte, das durch seine Nähe zum Pantheon noch beeindruckender wirkte, und vor allem an die Sicherheit, in der er sich fühlte, sobald er bei Annie war. Obwohl er nur ein Kind gewesen war, erriet er, wie anders als seine Mutter diese Fremde war, die nie die Stimme erhob, die inmitten von Büchern, von Farben, von Gegenständen lebte, die ihm wertvoll erschienen, wie der kleine Bär aus Bern. Als Monsieur Œtlinger nach Empfang des erwähnten Briefes seinen Sohn aufforderte, ihn zu der zweifelhaften Dame zu führen, auf die man angespielt hatte, sah Jean-Noël darin nicht etwa den Wunsch, die Leute kennenzulernen, mit denen er verkehrte, sondern die Anziehung, die die Erinnerung an die eigene Vergangenheit für einen Mann hat, der genötigt ist, in einem Milieu zu leben, das nicht das seine ist.
Eine Art Kupplerin hatte Monsieur Œtlinger und seinen Sohn empfangen, und ohne sich zu wundern, dass zwei so ungleiche Besucher die gleiche Mieterin zu sprechen wünschten, hatte sie sie gebeten, in einem kleinen Salon zu warten, durch dessen Wände hindurch man Schreie und Lachen vernahm. Dann waren sie in das Zimmer der jungen Frau geführt worden. Sie empfing sie im Morgenrock. Beim Anblick des Begleiters ihres Geliebten, wenn man diese Bezeichnung für einen verliebten Gymnasiasten verwenden kann, hatte sie eine Gefahr gewittert. Da sie vor allem keinen Ärger wünschte, hatte sie vorgetäuscht, sie habe ein rein kameradschaftliches Verhältnis zu Jean-Noël. Monsieur Œtlinger hatte sich für die Störung entschuldigt. Als handle es sich um einen Höflichkeitsbesuch, sprach er dann über Banalitäten, so dass Jean-Noël sich trotz seiner Verwirrung fragte, warum sein Vater, von dem er erwartet hatte, er würde wütend sein, auf dieser Unterredung bestand, denn er war zu jung, um zu verstehen, dass Monsieur Œtlinger sich absichtlich in eine demütigende Lage gebracht hatte, mit dem einzigen Ziel, das Mitleid seines Sohnes zu erlangen, das er anders nicht zu erlangen glaubte.
Eine Woche später, am Tag vor dem Datum, für das Monsieur Œtlinger sich vorgenommen hatte, allein zu jener Frau zurückzukehren, um sich zu vergewissern, dass zwischen ihr und seinem Sohn auch wirklich alles beendet war, traf die Nachricht von Bertrands Tod ein. »Und was machen wir mit Jean-Noël?«, fragte Monsieur Œtlinger im Laufe des Abends. Er fürchtete sich davor, seinen Sohn ohne Aufsicht zurückzulassen. »Es ist nicht das erste Mal, dass er allein bleibt«, antwortete Annie schroff. Eine so natürliche Frage, wie sie ihr Mann eben gestellt hatte, genügte, um ihre Angst vor der Zukunft wieder wachzurufen, sie befürchten zu lassen, man verlange von ihr irgendwelche Opfer. Doch sie fing sich sogleich wieder, da sie an einem Tag wie diesem nicht den Anschein erwecken wollte, als gehe es ihr um ihr Vermögen. Am nächsten Morgen brachte Jean-Melchior seinen Sohn im selben Auto, das ihn eine Stunde später zur Bahn bringen sollte, zu einem Lehrer, einem Engländer namens Stevenson. Dieser Lehrer, der seit etwa zehn Jahren in Frankreich ansässig war, nahm ausschließlich junge Landsleute in Pension. Aus Verehrung für Annie hatte er sich einverstanden erklärt, eine Ausnahme zu machen. Schon lange hatte er bemerkt, dass Monsieur und Madame Œtlinger nicht demselben Milieu angehörten. Im Glauben, Annie zu schmeicheln, gab er ihr, kaum stand er ihr gegenüber, stets zu verstehen, er wisse, wer sie sei. Deshalb hatte Monsieur Œtlinger ihm seinen Sohn anvertraut, denn diese Wahl war in seinen Augen dazu angetan, die Gereiztheit zu mildern, die seine Frau zeigte, sobald sie sich auf neue Ausgaben einließ. Er hatte sich jedoch getäuscht, denn Madame Œtlinger hatte für ihre Bewunderer stets nur vollkommene Gleichgültigkeit übrig.
3
Als Monsieur und Madame Œtlinger in Paris ankamen, ließen sie sich zum Hôtel des Grands Hommes fahren. Annie dachte nie an ihren Aufenthalt dort, ohne ein romantisches Bild der Liebe vor Augen zu haben. Beim Verlassen des Bahnhofs hatte sie eigentlich die Absicht, sich mit ihrem Mann direkt in die Avenue de Malakoff zu begeben. Das war sogar die Adresse, die sie einem Taxichauffeur genannt hatte. Erst auf dem Weg dorthin war ihr das Vorhaben, Jean-Melchior gerade in dem Moment in ihre Familie einzuführen, da man Bertrand bestatten würde, als unausführbar erschienen, und ihr war klargeworden, dass man besser ein paar Tage wartete, um Monsieur Villemur auf die Begegnung vorzubereiten.
Sie ging daher erst zu ihrer Familie, nachdem sie ihren Mann zum Hotel begleitet hatte. Wenn jemand sich über diese Meinungsänderung freute, dann Monsieur Œtlinger. Er war nicht böse, dass die Begegnung mit Monsieur Villemur aufgeschoben war, obwohl er im Grunde genommen lieber direkt in die Avenue de Malakoff gegangen wäre – was natürlich gewirkt hätte –, als den Moment abzuwarten, den Annie wählte, da dies etwas Planmäßiges hatte. War es möglich, dass seine Frau nicht merkte, wie ungeschickt es war, ein so schmerzliches Ereignis wie Bertrands Tod zum Vorwand nehmen zu wollen, um Jean-Melchior bei den Ihren einzuführen? Wie konnte sie sich einbilden, ihre Eltern würden ihrem Mann die Gründe glauben, die er angeben sollte, um seine Anwesenheit in Paris zu erklären, und von denen der unwahrscheinlichste der war, Bertrands Tod habe ihn so sehr getroffen, dass er den Villemurs unbedingt mündlich habe sagen wollen, wie groß sein Beileid war? Um Annie nicht zu verstimmen und obwohl es ihn Mühe kostete, zu einem Zeitpunkt aufzutreten, da man wirklich anderes zu tun hatte, als sich mit ihm zu versöhnen, hatte er eingewilligt. Aber was würden die Villemurs von einem Mann denken, der plötzlich wie aus einem Versteck hervorkäme, während niemand an ihn dachte?
Am nächsten Tag, als Annie zu ihm kam, teilte er ihr seine Befürchtungen mit. Sie schenkte ihnen keinerlei Beachtung. Am Tag zuvor hatte sie mehrere Anspielungen auf ihren Mann gemacht. Er war in Paris. Bertrands Tod hatte ihn erschüttert. Aus Taktgefühl wollte er sich nicht zeigen. In den folgenden Tagen fuhr sie fort, ihren Vater auf Jean-Melchiors Besuch vorzubereiten. Nach einer Woche begriff Monsieur Villemur schließlich, worauf seine Tochter hinauswollte. Ihm schien, sie besitze nicht mehr das Zartgefühl, das er bei ihr so bewundert hatte, als sie ein junges Mädchen war. War diese Veränderung nicht dem Mann zuzuschreiben, in den sie sich verliebt hatte und um dessentwillen sie sich noch heute nicht scheute, ihre Familie zu verletzen? Als Annie den Augenblick für gekommen hielt, ihren Mann aus dem Schatten treten zu lassen, musste sie überrascht feststellen, dass der Empfang, den man ihm bereitete, nicht besser war als der, den man ihm vor zehn Jahren bereitet hatte. Im Anschluss an den Versöhnungsversuch kam zwischen Annie und ihrem Mann zum ersten Mal seit ihrer Heirat ein gewisses Unbehagen auf. Jean-Melchior, der bis zu diesem Tag keinen seiner einstigen Freunde und nicht einmal seinen Bruder hatte wiedersehen wollen, weil er gespürt hatte, dass es seiner Frau missfallen würde, machte sich daran, ein paar frühere Freundschaften zu erneuern, statt in Paris umherzuirren. Er sah seinen Bruder Martin wieder, der im Leben anscheinend reüssiert hatte. Er fand ihn im ersten Stock eines bescheidenen Hauses in der Rue Claude-Bernard, in einer Wohnung, die auf einen Hof hinausging. Wie Monsieur Œtlinger, das heißt aus Gesundheitsgründen, war er nicht einberufen worden. Catherine, deren Mann an der Front war und die bei Kriegsbeginn wieder zu ihrem Bruder gezogen war, wo sie als Sekretärin fungierte, zeigte sich beim Anblick von Jean-Melchior hocherfreut. »Sie stirbt vor Sorge. Du solltest sie einladen. Die Veränderung und die Sonne würden sie wieder aufrichten«, sagte Martin, als seine Schwester sich kurz entfernt hatte. »Ich würde ihr nur zu gerne eine Freude machen«, antwortete Monsieur Œtlinger.
In der gleichen Zeit unterstand Jean-Noël der besonders strengen Überwachung von Monsieur Stevenson. Man hatte sie dem Lehrer nicht eigens nahegelegt. Er glaubte, seine anderen Pensionäre vor einem möglichen schlechten Einfluss bewahren zu müssen. Was Ernestine Mercier betraf, so war sie durch einen ihrer zahlreichen Freunde von Bertrands Tod und von Monsieur und Madame Œtlingers Abreise unterrichtet worden. Diese beiden Ereignisse, die sie nichts angingen, versetzten sie in helle Aufregung, da in ihren Augen alles, was in Nizza passierte, von größter Bedeutung war. Sie war ungeduldig zu handeln, auf sich aufmerksam zu machen, als bestehe die Gefahr, dass man sie in einer solchen Situation vergaß. Da kam ihr die Idee, sie könnte ihrem Sohn einen Besuch abstatten. Sie fragte einen gewissen Monsieur Grimal, der sich neben den Stunden, die er an einer Privatschule erteilte, ein wenig um Émiles Erziehung kümmerte, was er von ihrem Vorhaben halte. Monsieur Grimal antwortete ausweichend. Der Hauptgrund für seine Freundschaft mit Madame Mercier war deren besondere Lage. Wenn er sie auch wie eine Person behandelte, der von einflussreichen Leuten Unrecht widerfahren ist, hoffte er trotzdem, dass er eines Tages die Gelegenheit haben werde, an jene Leute heranzukommen. Er achtete daher darauf, sich nicht zu kompromittieren, damit man ihm später, wenn er zum Beispiel einmal als Zeuge auftreten oder irgendeinen Konflikt würde schlichten müssen, diese Freundschaft nicht vorwerfen konnte.
Eines Morgens hielt es Ernestine Mercier nicht mehr aus, und sie ging zu Monsieur Stevensons Pension, nicht als Mutter, die man im Stich gelassen hatte, sondern als Frau, die zwar ein neues Leben begonnen, aber gleichwohl eine große Zärtlichkeit für den Sohn bewahrt hat, von dem sie sich hatte trennen müssen. Sie sprach mit viel Zuneigung, gab zu verstehen, sie komme aus genauso gutem Haus wie die andere, die ihr den Mann und das Kind entführt habe. Sie tat sogar den rätselhaften Ausspruch: »Der Tag ist nah, an dem Sie eine große Überraschung erleben werden«, deren Sinn Monsieur Stevenson aus Höflichkeit zu erfassen vorgab. Danach bat sie, ihren lieben Jungen sehen zu dürfen, und als man ihn hereinführte, schaute sie ihn mit zusammengepressten Lippen lange an. Als sei einer Frau in ihrer Lage alles erlaubt, vergoss sie dann ein paar Tränen, verbarg das Gesicht in den Händen, bat um ein Glas Wasser. Jean-Noël, hochrot vor Verlegenheit, hatte der Szene mehr beigewohnt, als dass er an ihr teilgenommen hätte. Am nächsten Tag wagte er nicht, seinen Lehrer anzublicken. Noch nie hatte er eine solche Scham empfunden. Sein einziger Wunsch war, die Pension zu verlassen, wo man ihn nur noch mit Verachtung ansah, wie ihm schien. Als sein Vater wieder in Nizza war, bat er ihn denn auch als Erstes, in die Avenue Félix Faure zurückkehren zu dürfen. Überrascht wollte Monsieur Œtlinger wissen, was vorgefallen sei. Da Jean-Noël nichts sagen wollte, befragte er Monsieur Stevenson.
»Es ist nichts Besonderes vorgefallen«, antwortete der Lehrer, der Madame Merciers Existenz als ein Geheimnis betrachtete, das er nicht hätte kennen dürfen.
Ein paar Tage später erfuhr Jean-Melchior jedoch von seinem Sohn, was geschehen war. Monsieur Stevensons Haltung fiel ihm wieder ein. Annie hatte den Lehrer gerade angerufen, um ihn zum Tee zu bitten.
»Ich will ihn nicht mehr empfangen«, sagte Monsieur Œtlinger zu seiner Frau.
Da sie Erstaunen zeigte und er vor allem den Grund für diesen Entschluss nicht nennen wollte, sagte er ihr, es seien unerfreuliche Gerüchte über Monsieur Stevenson im Umlauf, auf die er wohlweislich nicht näher einging. Annie hatte blindes Vertrauen in das Urteil ihres Mannes. Trotz der freundschaftlichen Gefühle, die sie für Monsieur Stevenson empfand, lächelte sie.
»Die Welt ist seltsam, nicht wahr?«, sagte sie. »Jeden Tag erfährt man von einer Schändlichkeit.«
Als Monsieur Stevenson merkte, wie kühl ihn Madame Œtlinger behandelte, glaubte er, es rühre daher, dass er, wenn auch unfreiwillig, Ernestine Mercier empfangen hatte. Er erinnerte sich an einen Satz, den sie gesagt hatte. »Monsieur Grimal, den Sie, glaube ich, gut kennen, hat mir gesagt, Sie seien ein reizender Mensch. Ich stelle fest, dass er nicht gelogen hat.« Die schlechte Laune des Lehrers richtete sich gegen Monsieur Grimal, der durch einen Dritten davon erfuhr. Wenn er auch keine große Sympathie hegte für seinen Kollegen, der, obwohl Ausländer, mehr Geld verdiente als er selbst, legte er doch keinen Wert darauf, es mit ihm zu verderben. Er schrieb ihm einen langen Brief, in dem er in dem überheblichen Ton, den man annimmt, um von unangenehmen Dingen zu sprechen, in die man ungewollt verwickelt worden ist, von Madame Mercier sprach, von seinen gelegentlichen Kontakten zu ihr. Nie und nimmer hatte er ihr zu ihrer Unternehmung geraten. Er versicherte Monsieur Stevenson schließlich seiner Hochachtung und seiner aufrichtigen Ergebenheit. Die Geschichte landete am Schluss wieder bei ihrer Urheberin. Als Ernestine Mercier merkte, dass Monsieur Grimal ihr aus dem Weg ging, zweifelte sie nicht mehr daran, dass Jean-Melchior gegen sie intrigiert hatte. Sie beschuldigte ihn, Monsieur Stevenson zum Vorwurf gemacht zu haben, dass er sie als Mann von Welt, der er war, empfangen hatte. Monsieur Œtlinger antwortete ihr postwendend, sie täusche sich, er habe in seiner Anwesenheit nie auch nur ihren Namen erwähnt. Sie lief zu Monsieur Grimal, um ihm den Brief zu zeigen, worauf er, verärgert, wie er war, sich ihrer so schnell wie möglich entledigte.
Genau in der Zeit kam Catherine nach Nizza. Jean-Melchior hatte sie am Bahnhof erwartet, obwohl die Züge sich bisweilen mehrere Stunden verspäteten, damit sie sich nicht in der Avenue Félix Faure zeigte. Seit ihrer Rückkehr war Annie ziemlich niedergeschlagen. Wenn sie es sich auch nicht eingestand, hatte sie doch sehr auf ihren letzten Aufenthalt in Paris gezählt, um ihren Mann in ihre Familie einzuführen. Sie hatte sogar daran gedacht, bei Kriegsende, vielleicht sogar früher, mit Jean-Melchior nach Paris zurückzukehren, um endgültig dort zu bleiben. Doch nicht nur hatten sich ihre Hoffnungen zerschlagen, sondern es war auch zwischen ihr und ihrer Familie ein neues Verhältnis entstanden, kalt und korrekt. Annie war verblüfft gewesen, wie seltsam und unvorhersehbar das Schicksal sein konnte. Sie hatte immer behauptet, zwischen ihren Eltern und ihr sei nur Platz für eine vollkommene Liebe, und ohne dass sie wusste, wie es dazu gekommen war, stand sie jetzt mit den Ihren in einem Briefwechsel wie mit entfernten Verwandten. So hatte Monsieur Œtlinger seine Schwester abgeholt, ohne Annie etwas zu sagen, und unter dem Vorwand, sie hätten keine Dienstboten, hatte er sie mit einem Brief für Ernestine nach Menton geschickt.
Als er nach Hause kam, war er froh, dass er dem Einfall, seine Schwester bei sich aufzunehmen, nicht gefolgt war, den er gehabt hatte, als sie aus dem Zug gestiegen war. Er traf Annie in äußerst schlechter Laune an.
»Wir müssen unbedingt eine Entscheidung treffen«, sagte sie.
Dann sprach sie davon, Porträts zu malen und damit genug zu verdienen, um die Kosten für die Wohnung zu bestreiten. Die paar Einkünfte, die sie noch bezog, könnten ihnen dann als Taschengeld dienen, wie sie es nannte, doch es ging über das hinaus, was man normalerweise unter diesem Begriff verstand, umfasste es doch alles, was nicht den »Haushalt« betraf.
Eines Nachmittags, als sie zu ihrem Atelier ging, das in der Altstadt lag, wurde ihre Aufmerksamkeit auf ein Schild an der Tür eines baufälligen Hauses gelenkt. Eine Wohnung war zu vermieten. Spontan, ohne zu überlegen, betrat sie das Haus, suchte den Besitzer. Ein sechzigjähriger Mann, gebeugt an einem Stock gehend, kam ihr entgegen. Er trug einen Anzug aus Cordsamt und einen breitrandigen schwarzen Hut. Ein weißer Bart verlieh ihm das Aussehen eines Modells. Obwohl sie diesen Mann noch nie gesehen hatte und keine Gemeinsamkeiten mit ihm haben konnte, machte er großen Eindruck auf sie. »Ich habe eben das Schild gelesen«, sagte sie respektvoll, »das Sie an der Tür Ihres Hauses haben anbringen lassen.« Er führte Annie in eine Art Tischlerwerkstatt, wo fünf oder sechs Katzen Seite an Seite schliefen. Sie teilte ihm ihren Wunsch mit, eine Wohnung zu mieten, die kleiner war als ihre jetzige. Der Krieg zog sich hin. Sie fürchtete, sich zu ruinieren. Sie war der Ansicht, dass sie sich mit einem bescheideneren Lebensstil begnügen musste. Erstaunt über das vertrauliche Bekenntnis, das ihm schmeichelte, bestärkte sie der Besitzer in ihrem Vorhaben. Und auf sein Versprechen hin, er werde einen Mietvertrag abfassen, verließ sie ihn beinahe fröhlich.
Als sie ihrem Mann erzählte, sie gedenke, eine Wohnung in der Altstadt zu mieten, teilte er ihre Begeisterung nicht. Er sagte, sie übertreibe es mit ihren Ängsten, der Krieg sei demnächst vorbei, alles werde wieder in Ordnung kommen, so dass Annie sich beruhigte und nicht zur Verabredung ging, zu der sie der Besitzer bestellt hatte. Er kam zu ihr. Das genügte, um Annies Besorgnis wieder zu wecken. Sie unterschrieb den Vertrag. Von diesem Tag an fühlte sie sich besser. Der Friede war jedoch von kurzer Dauer. Eine Woche später klingelte Catherine an der Wohnung in der Avenue Félix Faure. Als sie mit dem Brief ihres Bruders bei Madame Mercier erschienen war, rief diese aus: »Das ist der Gipfel!« Wie konnte Jean-Melchior nach dem, was passiert war, nur die Stirn haben, sie um einen Gefallen zu bitten! Sie hatte Catherine trotzdem nicht zurückzuschicken gewagt. Sie hatte sich damit begnügt, sie zu empfangen wie jemand, den allein die Umstände daran hindern, sich gegen den andern zu stellen. Catherine, wie gelähmt durch diesen Empfang, hatte die Ungeschicklichkeit besessen, Ernestines Gejammer nicht zuzuhören. Schon vom nächsten Tag an war diese unter dem kleinsten Vorwand aufgebraust. Das Leben war unerträglich geworden, und so war Catherine wieder nach Nizza gekommen.
Anders als man hätte vermuten können, empfing Annie die Schwester ihres Mannes liebenswürdig. Als sie aber erfuhr, dass diese nicht von selbst nach Nizza gekommen war, dass Jean-Melchior sie eingeladen hatte, ohne ihr ein Wort zu sagen, schloss sie sich in ihr Zimmer ein. Monsieur Œtlinger wollte zu ihr gehen. Die Tür war von innen verschlossen. Er klopfte mehrmals. Schließlich öffnete ihm Annie. Sie hatte Ringe unter den Augen, und ihre Lider waren geschwollen, aber trocken. Nur auf den Wangen waren feuchte Spuren zu sehen, die verrieten, dass sie geweint hatte.
»Sie muss bleiben«, sagte sie, bevor ihr Mann Zeit hatte, etwas zu sagen.
Sie hatte Gewissensbisse. Es tat ihr leid, dass sie sich zu einer Laune hatte hinreißen lassen. Hatte diese junge Frau nicht ihre Sorgen? War ihr Mann nicht an der Front? »Vergiss«, fügte sie hinzu, »was ich gesagt habe.«
Zärtlich, wie verwandelt, schlug sie Jean-Melchior nach dem Abendessen vor, einen Spaziergang zu machen. Der Abend war warm. Ein lauer Wind kam vom Meer her und bewegte leise die Palmen, die im Licht der Straßenlaternen und Autoscheinwerfer Teil einer Kulisse schienen. Jean-Melchior hatte Annies Arm genommen und drückte ihn beim Gehen an sich. Obwohl ihre Hüften sich berührten, ging sie wie immer ein bisschen voran, den Blick vor sich hin gerichtet. Sie folgten der Promenade des Anglais, überquerten die Place Masséna, bogen in die Avenue de la Gare ein. Es war nicht spät. Vor dem Aushang der Zeitung Le Petit Niçois las eine Menschenansammlung den Frontbericht. Sie setzten sich auf die Terrasse eines großen Cafés, wie sie es gerne taten. Plötzlich sagte Annie: »Ich sollte ihn anrufen.« – »Wen?«, fragte Jean-Melchior. Sie antwortete nicht. Da begriff er, dass es sich um den oft erwähnten Monsieur Duncan handelte, von dem sie seit einem Monat redete und der bereit war, wie sie behauptete, ihr ein Vermögen anzubieten, wenn sie einwilligte, sein Porträt zu malen. »Hast du nicht gemerkt, dass dieser Monsieur Duncan nur deshalb allen phantastische Versprechungen macht, weil er so widerwärtig geizig ist.« Annie fiel die Blässe ihres Mannes auf. Statt ihm zu antworten, er täusche sich, wie sie es gerne getan hätte, schaute sie ihn lange besorgt an. In dem Augenblick kam ein Oberkellner auf Monsieur und Madame Œtlinger zu. Es war ein Schwede, ein großer junger Mann mit blauen Augen und ungleich vorspringenden Kiefergelenken. Annie, die gerne Vornehmheit entdeckte, wo niemand sie suchte, drückte Jean-Melchiors Hand. Er blickte auf, war seinerseits verwirrt von der Schönheit des Oberkellners. »Wie alt sind Sie?«, fragte er ihn. Mehrere Minuten lang stellte er ihm alle möglichen Fragen, während Annie belustigt zuhörte. Dann wollte er wissen, ob er Kinder habe. Der Oberkellner antwortete ihm, er habe eine kleine Tochter. Daraufhin pries Monsieur Œtlinger die Freuden, die einem Kinder bereiten, so dass der schöne junge Mann nach Ablauf einer Minute, in der er sich versicherte, dass sein Gesprächspartner sich nicht über ihn lustig machte, in dieses Loblied auf die Vaterschaft einfiel. Beim Verlassen des Cafés begann Annie zu lachen. »Warum lachst du?«, fragte ihr Mann, der genau wusste, dass sie über seine Marotte lachte, Vatergefühle bei Männern zu suchen, die am wenigsten zu solchen fähig schienen.
4
Am nächsten Tag stand Jean-Melchior nicht auf. Während der ganzen Nacht hatte er Fieber gehabt. Seit langem schon trank er bis zu zehn Gläser Wasser, bevor er ins Bett ging. Annie war zu früh von ihrer Familie weggegangen, als dass sie sich mit den Krankheiten hätte vertraut machen können. Der ungewöhnliche Durst hatte sie nie beunruhigt. An diesem Morgen jedoch rief sie einen Arzt. Am Nachmittag wurde Monsieur Œtlinger geröntgt. Er hatte mehrere Läsionen an der Lunge. Überdies war er zuckerkrank. Man musste so schnell wie möglich nach Davos reisen.
Jean-Noël wurde nach dem Wunsch seines Vaters einer Pariser Familie anvertraut, der Monsieur und Madame Œtlingers Leben lange ein Rätsel gewesen war. Die Wohnung wurde verschlossen, außer einem Zimmer und der Küche, damit Catherine, um die sich zu kümmern man keine Zeit gehabt hatte, einen Unterschlupf hatte.
Annie hatte sich immer mit gewöhnlichen Leuten umgeben, deren Verehrung ihr jedoch die kleinen Unannehmlichkeiten des täglichen Lebens ersparten. Bei dieser Schicksalsprüfung zeigte Monsieur Saglioni, dass die respektvolle Ergebenheit, die er Madame Œtlinger bisher entgegengebracht hatte, echt war. Monsieur Saglioni war ein alteingesessener Einwohner von Nizza, Sohn eines Kaufmanns und selbst Kaufmann. Er machte ein bisschen Politik, war Mitglied des Stadtrats gewesen und immer noch Präsident eines Tourismusverbandes. Am selben Abend lief sie zu dem braven Mann. In ihrer Aufregung erzählte sie ihm nicht nur das Drama, sondern alle Sorgen, die sie bedrückten. Ein solcher Vertrauensbeweis steigerte Monsieur Saglionis Hilfsbereitschaft noch. Er tröstete sie. »Lassen Sie mich nur machen«, sagte er mehrmals zu ihr. Er schlug ihr sogar vor, sich beim Notar von Freunden nach dem wirksamsten Mittel zu erkundigen, um Madame Mercier zum Schweigen zu bringen. Doch Madame Œtlinger dämpfte seinen Eifer, da sie sich in einem so schmerzlichen Moment nicht auf den Kampf mit einer Frau wie Ernestine Mercier einlassen wollte. Sie beauftragte Monsieur Saglioni, Madame Mercier jeden Monat eine kleine Summe zu überweisen und sie von Jean-Melchiors Zustand zu unterrichten. Sie legte ihm ans Herz, auf keinen Fall ihre neue Adresse zu verraten. Sie bat ihn, ab und zu, wenn er gerade Zeit habe, in die Avenue Félix Faure zu gehen, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung sei, dass es Catherine an nichts fehle, und zu diesem Zweck übergab sie ihm einen Wohnungsschlüssel. Sie nannte ihm auch den Namen der Familie, der man Jean-Noël anvertraut hatte, damit er den jungen Mann benachrichtigen konnte, falls ein Unglück geschah. Sie erzählte ihm vom Vertrag, den sie ein paar Tage zuvor leichtfertig unterschrieben hatte, und bat ihn, alles zu tun, was in seiner Macht stand, um dessen Auflösung zu erwirken. Kurz, sie verließ sich in allem ganz auf ihn, sogar was die unmittelbaren Schritte bei der Präfektur und beim Schweizer Konsulat betraf. Am übernächsten Tag fuhr sie, begleitet von einer Krankenschwester, mit Jean-Melchior nach Davos.
Monsieur und Madame Montigny wohnten mit ihrer Tochter, deren Mann, Adrien Bérard, eingezogen worden war, und mit dessen Sohn von einer ersten Frau, die im Kindbett gestorben war, einem Freund Jean-Noëls aus dem Gymnasium, durch den die Œtlingers diese Familie erst kennengelernt hatten, seit drei Monaten in einem hübschen Anwesen unweit der Avenue Félix Faure. Sie hatten Paris wegen der Luftangriffe verlassen. Seit ihrer Ankunft in Nizza auf der Suche nach Kontakten, waren ihnen Annie und Jean-Melchior, die etwas »Pariserisches« an sich hatten, wie sie sagten, schnell sympathisch gewesen. War es nicht angenehm, in der Provinz Leute anzutreffen, die liberale Anschauungen hatten, mit denen man sich unterhalten konnte, mit denen man so manche Vorliebe teilte. Alles diente ihnen als Vorwand, um die Œtlingers einzuladen, vornehmlich Annie. Sie hatten denn auch bereitwillig zugestimmt, als sie sie auf Jean-Melchiors Bitte hin aufgesucht hatte, um zu fragen, ob sie Jean-Noël bei sich aufnehmen könnten.